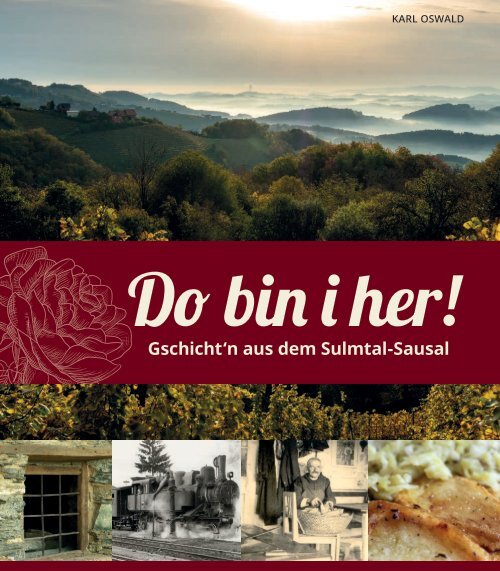Dobiniher_KarlOswald
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1
Inhalt<br />
Einleitung 5<br />
IMPRESSUM<br />
Copyright: Karl Oswald, Juni 2018<br />
Do bin i her!<br />
Gschichtʼn aus dem Sulmtal-Sausal<br />
Verlag Altenberg/<br />
Werbeagentur Karl Oswald<br />
A-8451 Heimschuh, Leitenweg 12/2<br />
Telefon: +43 (0)664 145 09 35<br />
E-Mail: info@dersteirerland.at<br />
www.dersteirerland.at<br />
UID: ATU55582408<br />
Autor: Karl Oswald<br />
Fotos: Karl Oswald bzw. von den Gesprächspartnern<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Titelfoto: fotolila.at / Urheber: Johannes<br />
Chroniken: Die geschichtlichen Inhalte<br />
stammen von den Gemeinde- und Pfarrwebseiten<br />
bzw. aus deren Chroniken.<br />
Grafik: Tanja Adam<br />
Lektorat: Martin Moll<br />
Herstellung: hm•perfectprintconsult•eu<br />
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck,<br />
auch auszugsweise, und Vervielfältigung<br />
in jeglicher Form oder Verarbeitung<br />
durch elektronische Systeme ohne<br />
schriftliche Einwilligung des Autors bzw.<br />
des Verlages verboten. Vorbehaltlich<br />
Satz- und Druckfehler.<br />
ISBN: 978-3-9504638-1-1<br />
Gleinstätten 6<br />
Schloss und Herrschaft Gleinstätten 8<br />
Wennʼs schmeckt – gehst gern! 9<br />
Liebe Kinder! 12<br />
Die Herrschaft 14<br />
Zwischen Josefi & Christi Himmelfahrt 15<br />
Pfarre Gleinstätten 18<br />
Der Eiskeller von Pistorf 20<br />
Fauland-Simmer-Erinnerungen 21<br />
Gemüsesuppe mit Fleischknödel 24<br />
Panierte Kürbisschnitzel 24<br />
Apfeltiramisu 25<br />
Danken statt Jammern! 26<br />
Gefreut und gelitten 27<br />
Das Sausal 30<br />
Großklein 32<br />
Großkleiner Wallfahrt 34<br />
Vom Aufisingen und Obilossn 35<br />
Der Räuber Finsterl 38<br />
Verkehrt herum 40<br />
Karo is Trumpf 41<br />
Pfarre Großklein 44<br />
Die Zöhrerkapelle 46<br />
Zam mudln 47<br />
Käferbohnensuppe 50<br />
Sulmtaler Hendel-Eintopf 51<br />
Gebackener Grießkoch 51<br />
2
Zoaglmocha 52<br />
Das Lachen vergangen 53<br />
Die Sulmtalbahn 56<br />
Heimschuh 58<br />
Der letzte Kalkbrenner 60<br />
Gott sei Dank 61<br />
Attila und der Königsberg 64<br />
Der Grindlbruch 66<br />
Klein aber mein 67<br />
Pfarre Heimschuh 70<br />
Farberde in Heimschuh 72<br />
Die Muata loabs 73<br />
Kürbisgemüse 76<br />
Kräuterbrot 77<br />
Jägerwecken 77<br />
Vom Ölhobln 78<br />
Feuerschauen und Rosstreiben 79<br />
Sulmtaler Hendl 108<br />
St. Andrä 110<br />
Stolz aufs Gʼwand 112<br />
Brüderlein und Schwesterlein 113<br />
Barockschloss Harrachegg 116<br />
Die Hosʼn voll 118<br />
Bauer und Schmied 119<br />
Pfarre St. Andrä 122<br />
Wirtshaus am Demmerkogel 124<br />
Erst rösten, dann mohln 125<br />
Schwammerlsterz 128<br />
Sausaler Weinsuppe 129<br />
Steirischer Rettichsalat 129<br />
Des woa teia 130<br />
Da nächste Organist 131<br />
Von Festen und dem Wissen der Leut! 134<br />
Steirische Weinbaugeschichte 83<br />
Kitzeck 84<br />
Kitzecker Michl 86<br />
Schnealiacht 87<br />
Was sind schon ein paar Jahre 90<br />
A zwickte Gʼschicht 92<br />
Ins Viech vernarrt 93<br />
Pfarre Kitzeck 97<br />
Do bleib i net 98<br />
Mami tua du 99<br />
Steirische Krensuppe 102<br />
Knoblauch-Karpfen 103<br />
Posterzipfel 103<br />
Hagelabwehr 104<br />
Alles im Wandel 105<br />
St. Nikolai 136<br />
Mit Weichfleisch und Osterbrot 138<br />
In Gottʼs Nam 139<br />
Beschreibung von 1845 142<br />
Segen für Haus und Hof 144<br />
Zufrieden muaßt sein 145<br />
Pfarre St. Nikolai im Sausal 148<br />
Aber mein Hans – der kannʼs 150<br />
Menschen sind gʼsund 151<br />
Breinsuppe mit Hendlstücken 154<br />
Kürbiskern-Reindling 154<br />
Hirschgulasch 155<br />
Von Licht und Feuer 156<br />
Vom Bauern zum Bauern 157<br />
Do bin i her! 160<br />
3
Gleinstätten<br />
Gleinstätten hieß ursprünglich Micheldorf. 1245<br />
wurde erstmals ein Konrad Micheldorfer mit einem<br />
Wehrbau urkundlich erwähnt. Von 1285 bis<br />
1607 waren die Gleinzer im Besitz der Wehranlage<br />
und des von den Salzburger Erzbischöfen zu<br />
Lehen genommenen umliegenden Landes.<br />
Die Gleinzer kamen um 1100 als Salzburger Dienstmannen<br />
aus dem bayerischen Chiemgau in die Weststeiermark,<br />
hießen ursprünglich Kelzen und nahmen<br />
den Namen des von ihnen gerodeten Gleinztales,<br />
südlich von Frauental, an. Ein Zweig baute die Feste<br />
Landsberg, ein Konrad Kelz war um 1168 Pfarrer von<br />
Groß St. Florian und gab der Kelzenwert (Katzelwehr)<br />
den Namen. Die Kelzenwert war als Sicherung und<br />
Spähposten des Salzburger Gebietes an der Südgrenze<br />
des Sausals gelegen. Weiters war die Familie<br />
mit zahlreichen Adelsgeschlechtern wie den Holleneggern,<br />
Khevenhüllern, Pettauern, Wietingen u. a.<br />
6
verwandt oder verschwägert. Sie gaben auch Lehen<br />
aus. Ihr Streubesitz reichte von Judenburg bis Pettau.<br />
Der Name Gleinstätten bezeichnet einen Ort in einer<br />
lehmigen Gegend, was sich<br />
durch die im Ort bestehende<br />
Ziegelherstellung bestätigt (ähnlich<br />
Gleinz). Haslach wird von Haselnusspflanzen<br />
abgeleitet, die<br />
an einem größeren Bach, einer<br />
Ache, stehen. Prarath ist 1136<br />
als Preurat, 1310 als Prewrewt<br />
belegt; dies wird allerdings nicht<br />
als Hinweis auf eine Rodung<br />
gesehen, sondern vom slowenischen Wort prevrat<br />
(Umkehrung, Kehre) abgeleitet, was durch den Verlauf<br />
der Flüsse in dieser Gegend erklärbar sein kann<br />
(Einmündung der Weißen und Schwarzen Sulm sowie<br />
des Leibenbaches in die Sulm). Im Rahmen der steirischen<br />
Gemeindestrukturreform ist Gleinstätten seit<br />
2015 mit der Nachbargemeinde Pistorf zusammengeschlossen.<br />
Eine 1168 in Leibnitz ausgestellte Urkunde<br />
erwähnt erstmals den Namen „Piscouistorf“. 1882<br />
lösten sich die Katastralgemeinden<br />
Distelhof, Dornach, Pistorf,<br />
Maierhof und Sausal von der<br />
Ortsgemeinde Gleinstätten und<br />
schlossen sich zur Gemeinde<br />
Pistorf zusammen.<br />
Durch die Wiedervereinigung<br />
der beiden Orte ist auch ein<br />
neues Gemeindewappen entstanden:<br />
„Im schräglinks von Silber zu Rot geteilten<br />
Schild oben ein blauer, rücksehender Pfauenrumpf<br />
mit ausgebreiteten Schwingen, unten eine silberne,<br />
rot gezierte Bischofsmütze mit zwei abfliegenden Bändern.“<br />
7
LIEBE KINDER!<br />
Schauet auf und lernt von eurem Vater,<br />
wie schwer man das tägliche Brot verdienen muss.<br />
Der Familie Temmel aus Pistorf verdanken wir diesen Brief ihres Urgroßvaters, des<br />
Herrn Franz Heinrich (1817-1902), an seine Kinder. Herr Heinrich war ein sehr<br />
gläubiger Mann, wurde erst im Alter von 56 Jahren zum ersten Mal Vater, hatte<br />
aber in Summe vier Kinder. Im hohen Alter dokumentierte er in diesem Brief<br />
an seine Kinder einen Teil seiner Lebensgeschichte.<br />
In meinem 12. Lebensjahr, das war im Jahre 1829,<br />
musste ich in den Dienst zum Simihansl in Haiholz<br />
als Ochsenknecht. Ich wurde sehr geplagt, musste im<br />
Herbst früh und spät in der Nacht Äpfel und Birnen<br />
pressen (bis 11 Uhr), außerdem musste ich oft bei drei<br />
Uhr in der Früh Korn dreschen. Habe durch zwei Jahre<br />
hindurch gedient. Von 1833 bis 1835 war ich beim Pauli<br />
in St. Josef als Kuhbub, wurde zur Arbeit stark herangezogen<br />
und hatte einen jährlichen Lohn von 20 Gulden<br />
in Scheinen oder 8 Gulden Konventionsmünzen<br />
(Konventionsgulden ist der süddeutsche Name des<br />
halben Konventionstalers). Daraufhin kam ich für ein<br />
Jahr zum Schwinzerl nach Wuschan als Hausknecht.<br />
Jährlicher Lohn: 12 Gulden. Die Kleidung musste man<br />
von Leinwand tragen, werktags schwarze Hosen aus<br />
Leinwand und sonntags blaue Leinwandhosen. In der<br />
Kirche mussten sonntags im Sommer alle in bloßen<br />
Füßen gehen, im Winter und werktags auf Holzbodenschuhen.<br />
Im Winter 1836 kam ich als Geischütz (Bezeichnung<br />
für einen Bäcker, der seine Ware mit einer<br />
Kippe auf dem Rücken selbst austrägt) zum Neupöck<br />
nach Preding mit dem jährlichen Lohn von 10 Gulden<br />
Konventionsmünzen. 1837 wurde ich Hausknecht und<br />
musste zugleich 40 Ochsen füttern. Wegen der Befreiung<br />
von den Soldaten musste man sich alles auch<br />
noch im Jahre 1838 gefallen lassen. Durch drei Jahre<br />
gedient. Im Jahre 1839 bekam ich den Pass (gemeint<br />
ist ein Dienstpass, der mit dem Erreichen der Volljährigkeit<br />
ausgegeben wurde) und begab mich nach Kalsdorf<br />
ins Gasthaus „Zum Ertl“ als Nachtwächter bei den<br />
12
Fuhrwägen. Bei Tag am Feld gearbeitet,<br />
abends und in der Früh im<br />
Gaststall geholfen, dem Hausknecht<br />
Wasser tragen. Es waren in mancher<br />
Nacht 40-60 Pferde, die mit 10-12 Wägen<br />
bespannt waren. Ich habe für einen<br />
Wagen 6 Kreuzer Nachtgeld erhalten,<br />
musste aber den ganzen Winter neben<br />
den Wägen auf einem Karren liegen.<br />
Im Jahre 1840 wurde ich zum Vorreiter<br />
rekommandiert nach Frohnleiten<br />
zum Adlerwirt und habe mir bei dieser<br />
Marterei durch zwei Jahre 60 Gulden<br />
erspart. Es hieß alle Tage um 3 oder<br />
4 Uhr in der Früh mit den Pferden hinaus,<br />
mittags nach Hause und nachmittags wieder<br />
nach Pernegg vorreiten und abends bis 11 oder 12 Uhr<br />
zu Hause abfüttern. Wieder hinauf nach Pernegg mit<br />
der Vorreiterkette 12 und 14 Pferde auf einen Wagen<br />
gespannt bei schlechtem Weg, manchmal waren es<br />
17 Pferde samt Wildbahner (Reiter, der an der Spitze<br />
des Gespannes auf einem sogenannten Handpferd<br />
reitet). Im Jahre 1842 begab ich mich mit den Fuhrleuten<br />
nach Wien und wurde dort aufgenommen als<br />
Fuhrmann mit 4 Hengsten über eine Zeit von einem<br />
halben Jahr. Zugleich wurde ich Schaffer (Stallmeister)<br />
über 48 Pferde und es ist einem dabei gut und<br />
auch schlecht gegangen. Es hieß alle Tage um 2 Uhr<br />
in der Früh füttern, um 4 Uhr durfte das ganze Jahr<br />
hindurch kein Pferd mehr im Stall sein mit Ausnahme<br />
des Sonntags. Monatlicher Lohn von 8 Gulden, das<br />
Trinkgeld hat monatlich noch mehr gezählt. Ich habe<br />
mir in jedem Jahr 200 Gulden erspart und 4 Jahre gedient,<br />
dann ist der Herr gestorben und die Frau hat<br />
alles verkauft. Ich begab mich zurück in die Steiermark<br />
zu Fuß nach Graz. Musste im Jahr 1845 in den Dienst<br />
einstehen, alltäglich, und konnte nicht nach Hause zu<br />
meinem Vater und zu meiner Mutter, sondern musste<br />
täglich (gemeint ist ständig) von Graz nach Salzburg<br />
durch drei Jahre hindurch für Herrn Kögler in Feldkirchen.<br />
Musste auch öfters nach Klagenfurt fahren und<br />
von Graz nach Wien oder von Wien nach Laibach und<br />
Triest. Im Jahre 1847 musste ich Donnerstag vor Faschingstag<br />
von Graz über Laibach, Obschina, Kasatza,<br />
Treviso, Mestro, Vincenze nach Verona durch Italien<br />
und wieder retour über Villach heraus nach Klagenfurt<br />
fahren. Von Graz nach Verona braucht man 18 Tage<br />
und von Verona nach Klagenfurt sind wir in 12 Tagen<br />
gefahren. Von Klagenfurt ging es über Judenburg und<br />
Hohentauern nach Rottenmann und über Liezen nach<br />
Salzburg, beladen mit schweren Kaufmannswaren.<br />
Von Verona bis Klagenfurt auf jedem Wagen 160 Zentner<br />
Reis, dann von Salzburg nach Graz auf zwei Wagen<br />
180 Zentner Salz. Wir brauchten gerade acht Wochen,<br />
am Osterdienstag kamen wir wieder zu Hause in Feldkirchen<br />
an.<br />
Im Jahre 1848 trat ich in den Dienst zum Herrn Josef<br />
Prattes vulgo Leber in Eibiswald und wurde abkommandiert<br />
zum Salzführer von Aussee und bin gefahren<br />
bis 28. Juni 1852. Am 8. April 1852 kaufte ich diese<br />
„Lebitsch-Realität“, war aber ganz klein, es sind nicht<br />
ganz drei Joch gewesen. Dann habe ich mich Tag und<br />
Nacht beschäftigt, nach Graz mit Schweinen, Kälbern<br />
und Wein Handel betrieben, dass ich hab können<br />
einen Wald kaufen und dann Wiesen und Äcker und<br />
später im Jahre 1866 den Weingarten. Etliche 100 Fass<br />
Wein musste ich ab- und aufladen, nach Hause führen,<br />
wieder nach Graz und Obersteiermark verkaufen<br />
und einkaufen in jenem Windischgebirg (Windische<br />
Büheln, Gegend im nördlichen Slowenien) und Luttenberg-Sauritsch<br />
(Grenzgebiet Steiermark/Ungarn),<br />
auch in Ungarn. Im Jahre 1870 war ich Wein kaufen bei<br />
Kösterl am Plattensee. Außerdem habe ich viele hundert<br />
Eimer Wein von Trient in Südtirol bezogen und<br />
wieder verkauft.<br />
Tag und Nacht immer gearbeitet, aber dabei auch gebetet,<br />
wo immer es möglich war, einer heiligen Messe<br />
beigewohnt, dann ist der Segen Gottes geblieben. Jetzt<br />
nimmt das Alter die Kraft, die Augen werden dunkler<br />
und auch die Zeiten sind durch die Eisenbahn ganz<br />
verändert und man muss ausharren bis ans Ende.<br />
Ich ersuche und befehle euch, liebe Kinder, arbeitet<br />
und betet gerne auch fleißig, das Übrige wird<br />
dann von Gott gewiss kommen.<br />
13
Familie Haring vulgo Tonijogl<br />
Der Eiskeller<br />
von Pistorf<br />
Verderbliche Lebensmittel haltbar zu machen,<br />
war für die Menschheit seit Beginn der Vorratshaltung<br />
eine große Herausforderung. Wie kreativ<br />
man in dieser Hinsicht war, zeigen heute noch einige<br />
heimische Spezialitäten wie z.B. das Kübelfleisch<br />
oder das Grubenkraut. Und schon lange,<br />
bevor die Elektrizität unser Leben erleichterte,<br />
entwickelten findige Menschen Möglichkeiten,<br />
auch in den warmen Monaten Fleisch kühl zu lagern.<br />
Ein solches Kleinod steht bis heute in Pistorf.<br />
Dort befindet sich noch ein originaler Eiskeller,<br />
von denen es anno dazumal etliche in unserer<br />
Region gegeben hat. Wann genau dieser erbaut<br />
wurde, lässt sich heute leider nicht mehr feststellen.<br />
Wir wissen aber, dass er bereits im 19. Jahrhundert<br />
in Verwendung stand und bis zum Ende<br />
der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts seinen<br />
Zweck erfüllte. Der Eiskeller befand sich im Besitz<br />
eines Stechviehhändlers und diente sowohl<br />
ihm als auch den Bauern der Umgebung zur Kühlung<br />
des Schlachtfleischs. Betritt man das unscheinbare<br />
Gebäude, so gelangt man zunächst in einen früher als<br />
Schlachtraum genutzten Raum. Von dort geht es dann<br />
weiter in den Vorkeller, in dem die verderblichen Produkte<br />
gelagert wurden und der daher – wie die massiven<br />
Türen und die Stärke der Mauern zeigen – gut<br />
isoliert war. Dieser Vorkeller ist über zwei Lüftungsschächte<br />
mit dem eigentlichen Eiskeller, dem Lagerraum<br />
für das Eis, verbunden. Öffnet man die schwere<br />
Holztür zu diesem, so ist man im ersten Moment von<br />
dessen Fassungsvermögen – das Volumen beträgt circa<br />
120 m 3 – überrascht. Wenn man sich nämlich vorstellt,<br />
dass dieser Raum bis zur Decke mit Eisplatten<br />
gefüllt war, kann man den enormen Arbeitsaufwand<br />
dafür ermessen.<br />
Die Mauern des Eiskellers sind annähernd einen Meter<br />
dick, jedoch nicht vollwandig, sondern in einem Kammersystem<br />
aufgebaut, um die Kälte besser im Raum zu<br />
halten. Das Wasser des auftauenden Eises floss über<br />
ein einfaches Rinnensystem ab und die Be- und Entlüftung<br />
sorgte dafür, dass warme Luft nach draußen<br />
strömte und die kalte Luft in den Vorkeller gelangte.<br />
Sobald die Eisschicht dick genug war, wurde das Eis<br />
Block für Block mit Sägen aus den nahegelegenen Seen<br />
geschnitten. Die Sägen hatten an einem Ende einen<br />
breiten Griff, sodass zwei Männer sie heben konnten,<br />
und auf der anderen Seite ein Gewicht, damit die Säge<br />
im Wasser nach unten gezogen wurde. Mühsam wurde<br />
Eisplatte für Eisplatte herausgeschnitten und dann mit<br />
Haken auf Schlitten und Wagen verladen. Der Eiskeller<br />
wurde über eine Öffnung im Mauerwerk bis unter<br />
die Decke (Raumhöhe etwa sechs Meter) befüllt und<br />
anschließend wieder zugemauert, um selbst den geringsten<br />
Kälteverlust zu vermeiden. Viele Tage dauerte<br />
diese Schwerstarbeit, aber sie wurde mit Kälte, die sich<br />
bis zum Spätherbst hielt, belohnt. Nach demselben<br />
Prinzip funktionierten auch die ersten Kühlkästen, bei<br />
denen ein kleiner Eisblock das benachbarte Fach kalt<br />
hielt.<br />
20
Es Rumpeln mocht den Sauerstoff<br />
Fauland-Simmer-<br />
Erinnerungen<br />
Die Arbeit der Menschen ist Kreisläufen unterworfen, sodass trotz vieler Errungenschaften<br />
und Veränderungen alles immer wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt.<br />
Was früher aus Erfahrung, Beobachtung und Intuition heraus passierte, wird heute<br />
durch die Wissenschaft bestätigt. So geht die Landwirtschaft mit neuen technischen<br />
Voraussetzungen oftmals den Weg zurück zu ihren Ursprüngen.<br />
21
Gemüsesuppe mit Fleischknödel<br />
ZUTATEN<br />
1 L Gemüsesuppe<br />
(hausgemacht oder Würfelsuppe)<br />
1 feingehackte Zwiebel<br />
kleinwürfelig geschnittenes Gemüse<br />
nach Saison (Karotten, Sellerie,<br />
Kohlrabi, Kohl, Karfiol…)<br />
FLEISCHKNÖDEL<br />
250 g Faschiertes vom Rind,<br />
Schwein oder gemischt<br />
50 g Reis (evtl. vom Vortag übriggeblieben)<br />
Petersilie<br />
Muskatnuss<br />
Salz, Pfeffer<br />
ZUBEREITUNG<br />
Den Reis kochen und abkühlen lassen oder übriggebliebenen<br />
Reis vom Vortag verwenden. Das<br />
Faschierte in eine Schüssel geben, den Reis, die<br />
feingehackte Petersilie und die Gewürze dazugeben.<br />
Die Zutaten für die Fleischknödel schön kalt<br />
kneten, damit die Masse bindet und kleine Bällchen<br />
formen.<br />
Die Suppe heißmachen, die Bällchen darin ca. 15<br />
Minuten leicht köcheln lassen. Das würfelig geschnittene<br />
Gemüse nach rund fünf Minuten zu<br />
den Fleischknödeln in die Suppe geben und mitkochen.<br />
Die Gemüsesuppe heiß servieren.<br />
Panierte Kürbisschnitzel<br />
ZUTATEN<br />
mittlerer Kürbis<br />
glattes Mehl<br />
Salz<br />
2 Eier<br />
Semmelbrösel<br />
evtl. geriebene Kürbiskerne<br />
Rapsöl<br />
ZUBEREITUNG<br />
Für die panierten Kürbisschnitzel den Kürbis aufschneiden,<br />
die Kerne entfernen und in 1 cm dicke<br />
Scheiben schneiden. Falls Kürbiskerne verwendet<br />
werden, die geriebenen Kürbiskerne mit den Bröseln<br />
vermischen (2/3 Brösel, 1/3 Kerne). Die Eier<br />
mit dem Salz in einer Schüssel verquirlen.<br />
Das Mehl und die Brösel jeweils in einer weiteren<br />
Schüssel vorbereiten. Die Kürbisschnitzel zuerst<br />
im Mehl drehen, dann durchs Ei ziehen und in den<br />
Bröseln wenden. Die panierten Kürbisschnitzel in<br />
Öl auf beiden Seiten goldbraun herausbacken.<br />
Herausnehmen und abtropfen lassen.<br />
24
Apfeltiramisu<br />
ZUTATEN<br />
250 g Mascarpone<br />
250 g Schlagobers<br />
250 g Apfelmus<br />
80 g Zucker<br />
½ TL Zimt<br />
Zitronensaft<br />
evtl. Vanillepulver<br />
200 ml Apfelsaft<br />
½ TL Zimt<br />
1 Packung Vollkornbiskotten<br />
ZUBEREITUNG<br />
Für dieses Tiramisu Mascarpone glattrühren. Mit Apfelmus,<br />
Zucker, Zimt, Zitronensaft und etwas Vanillepulver<br />
gut verrühren. Zum Schluss den steif geschlagenen<br />
Schlag unterrühren. Den Apfelsaft mit Zimt verquirlen.<br />
Für das Apfel-Tiramisu die Vollkornbiskotten darin drehen<br />
und eine Form damit auslegen. Mit der Apfelcreme<br />
bedecken. Dann wieder Biskotten abwechselnd mit der<br />
Creme schichten, bis die Masse aufgebraucht ist. Mit<br />
der Creme abschließen. Das Tiramisu mit Apfelmus für<br />
mehrere Stunden kaltstellen. Vor dem Anrichten mit<br />
Zimt bestreuen.<br />
25
REGIONALE GESCHICHTE<br />
Das Sausal<br />
Das Sausal bezeichnet das Hügelland zwischen<br />
den Flüssen Sulm und Laßnitz. Es ist aus paläozoischen<br />
Schiefern aufgebaut und Teil der mittelsteirischen<br />
Schwelle, die das oststeirische vom<br />
weststeirischen Becken trennt.<br />
30
Vor 16 Millionen Jahren entstanden durch Meeresablagerungen<br />
jene Böden, aus denen die Landwirtschaft<br />
und die Bauwirtschaft heute ihren Nutzen<br />
ziehen. Hätte Graz damals schon existiert, wäre es<br />
sicher eine wunderschöne Küstenstadt gewesen. Die<br />
Oststeiermark war ein tiefes und die Weststeiermark<br />
ein flaches Meer, aus dem Inseln herausragten und<br />
das am Fuß der Koralm seine Ufer hatte. Aufgrund der<br />
geografischen Lage (da sich die Kontinente circa 2 cm<br />
pro Jahr nach Norden verschieben, befanden wir uns<br />
damals auf der Höhe des Nildeltas) war das Meer, das<br />
unsere Heimat bedeckte, warm und lichtdurchflutet.<br />
Eine dieser Inseln, von der aus man einen wunderbaren<br />
Ausblick auf den Gleichenberger Vulkan gehabt<br />
hätte, war der Sausaler Stock, der eine viel ältere geologische<br />
Geschichte hat. Diese Gesteinsformationen<br />
werden dem Paläozän-Zeitalter zugeordnet und sind<br />
rund 60 Millionen Jahre alt.<br />
Der Name „Sausal“ wird in<br />
Urkunden des Mittelalters<br />
als „Susil“ erwähnt. Er wird<br />
aus lat. „Solva silva“ (Sulmwald)<br />
abgeleitet. Die höchste<br />
Erhebung ist der Demmerkogel<br />
mit 671 Metern.<br />
Nach dem Zusammenbruch des Römischen Weltreichs<br />
machte sich anstelle des einstigen Kulturlandes<br />
wieder Wald breit. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts<br />
siedelten sich vom Sulmtal aufwärts slawisch sprechende<br />
Karantaner an. Karantanien war ein im 7. Jahrhundert<br />
nach Christus entstandenes slawisches<br />
Fürstentum mit seinem Zentrum im heutigen Kärnten.<br />
Über Kärnten hinausreichend und als ein erstes<br />
eigenständiges und stabiles Staatsgebilde nach der<br />
Völkerwanderungszeit, war es entscheidend für die<br />
Geschichte Kärntens, der Steiermark und Sloweniens.<br />
Diese einfachen Bauern gaben den Tälern, Hügeln und<br />
Gewässern jene Namen, die noch heute, wenngleich<br />
in abgeänderter Form, an diese Zeit erinnern. Durch<br />
die Eingliederung ganz Karantaniens in das deutsche<br />
Königreich Mitte des 10. Jahrhunderts beginnt die<br />
dokumentierte Weinbaugeschichte im Sausal. König<br />
Otto I. schenkte im Jahr 970 den Landstrich zwischen<br />
Sulm und Laßnitz dem Erzbistum Salzburg. Darunter<br />
befand sich auch der Wald „Susil“. Als Verwaltungsund<br />
Schutzmaßnahme wurde von den Erzbischöfen<br />
im 12. Jahrhundert das Schloss Seggau erbaut. Die<br />
Besiedelung der Region erfolgte in dieser Zeit vor allem<br />
mit bayerischen Bauern, die hier als Kolonisten<br />
lebten. Aus jener Zeit stammt auch die Ähnlichkeit<br />
des steirischen mit dem bayerischen Dialekt. Diese<br />
Bauerngeschlechter, die meist dem Erzbischof unterstanden,<br />
leisteten im Sausal Pionierarbeit: Sie legten<br />
Täler trocken, rodeten Wälder zur Gewinnung von<br />
Ackerland und pflanzten auf sonnigen Berghängen<br />
Weinreben. Aufgrund der sehr steilen Taleinschnitte<br />
siedelten sich die Bauern entlang der Hügelketten an<br />
und wegen der zerklüfteten Landschaft bildeten sich<br />
keine größeren Siedlungen. Trotz der schwierigen Voraussetzungen<br />
hat sich der Weinbau auf Initiative der<br />
Erzbischöfe sehr bald zur wichtigsten Einnahmequelle<br />
dieser Region entwickelt.<br />
Mit dem Wissen um die große Tradition des Sausals<br />
und seine Besonderheiten, wie dem Urgesteinsboden,<br />
machten und machen Generationen die Landwirtschaft<br />
und den Weinbau zu ihrem Lebensmittelpunkt.<br />
31
Legende<br />
Der Räuber Finsterl<br />
Woher er kam oder ob er hier geboren wurde, ist nicht mehr überliefert. Ein finsterer<br />
Geselle soll er gewesen sein und wenn man ihm auf der Straße begegnete, musste man<br />
sich fürchten. Trotzdem hatte er, nach den Überlieferungen, zwar das Herz am rechten<br />
Fleck, aber leider nicht seine Finger.<br />
Es war in den 1920er Jahren, als Lois Finsterl im Kleingraben<br />
seine Keusche bewohnte und ein paar Joch<br />
Grund bewirtschaftete. Die Zeiten waren hart und die<br />
Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs spürbar. Die<br />
Menschen am Land führten ein kärgliches Dasein und<br />
rangen in mühevoller Arbeit dem Boden das Nötigste<br />
zum Leben ab. Die Kluft zwischen Reich und Arm und<br />
zwischen Herren und Dienern war groß. Die „Einleger“<br />
(arme Leute, die sich von Hof zu Hof bettelten) zogen<br />
umher, Knechte und Mägde arbeiteten auf den Höfen<br />
und die Weinzerln kümmerten sich um die Weingärten<br />
der wohlhabenden Grundbesitzer.<br />
Zu jener Zeit wurde gemunkelt, dass bei Großbauern<br />
und Gutsherren immer wieder Lebensmittel verschwanden,<br />
auch Schnapsbestände, Dinge des täglichen<br />
Gebrauchs und alte Lederhosen kamen auf seltsame<br />
Weise abhanden. Es begann mit Kleinigkeiten,<br />
kaum spürbar, aber im Laufe der Zeit wurde es immer<br />
mehr. Anfangs beschuldigte man auf einzelnen Höfen<br />
noch Knechte und Mägde des Diebstahls, bald jedoch<br />
stellte man fest, dass es anderen auch so erging. Aber<br />
es gab noch weitere Gerüchte. So trug es sich zu, dass<br />
die Ärmsten der Armen – oft Familien mit vielen Kindern,<br />
deren Eltern kaum alle Mäuler stopfen konnten<br />
– am Morgen vor ihrer Tür eine Henne, Feldfrüchte<br />
oder Getreide vorfanden. Andere wiederum erhielten<br />
wie von Zauberhand ein paar Eier, Werkzeug oder ein<br />
Stück Leder und so manch alter Knecht kam in den<br />
Genuss eines Doppeltgebrannten. Schnell sprach es<br />
sich im Kleingraben herum, welche Wunder da geschahen<br />
und dass ein Heiliger, wie einst St. Nikolaus,<br />
sich der Armen annimmt. Beim sonntätigen Kirchgang<br />
dankten die Beschenkten für Gottes Wirken durch<br />
jene gute Seele.<br />
Die Exekutive postierte jedoch Wachposten und die<br />
Weinzerln, Keuschler und Dienstleute wurden befragt.<br />
Viel half es nicht, denn die einen hüteten sich davor<br />
irgendwelche Gerüchte preiszugeben, würden sie sich<br />
doch so um die Gaben ihres Wohltäters bringen, und<br />
die anderen sagten erst recht nichts, standen sie der<br />
38
Gendarmerie und den Grundherren doch nicht sehr<br />
wohlgesonnen gegenüber. Langsam, aber sicher verdichteten<br />
sich jedoch die Gerüchte. Da des Nachts ein<br />
Schatten, der um den Hof schlich, dort Schritte, die<br />
man vor dem Haus vernahm, und hin und wieder erhaschte<br />
einer einen Blick auf den Dieb oder den Wohltäter<br />
– je nachdem, ob man ein Geschädigter oder ein<br />
Beschenkter war.<br />
Lange Zeit ging alles gut, aber schließlich wurde doch<br />
der „Finsterl Lois“ als Täter entlarvt. Einfach war es<br />
nicht, ihn zu erwischen, kannte der Bursche die Wälder<br />
im Kleingraben und auf dem Eichberg doch wie seine<br />
eigene Westentasche. Natürlich waren auch jene, die<br />
er mit Diebsgut bedacht hatte, auf seiner Seite und so<br />
war es ein Leichtes sich zu verstecken und immer etwas<br />
schneller als der Amtsschimmel zu sein. Geendet<br />
hat die Flucht dann schließlich in Fahrenbach zu Beginn<br />
der 30er Jahre. Den Erzählungen zufolge floh der<br />
„Finsterl Lois“ wieder einmal vor den Gendarmen, als<br />
diese ihn beim „Rack“ am „Sauberg“ in einem Kellerstöckel<br />
stellten. Der Bauer Schatz, der den entscheidenden<br />
Hinweis auf das Versteck gab und die Gendarmen<br />
begleitete, entdeckte den Davonlaufenden. Mit<br />
der Schrotflinte schoss er auf den Flüchtenden und<br />
bedankte sich für die Räubereien mit 52 Schrotkugeln<br />
in das Hinterteil vom Finsterl.<br />
Verletzt brachte man ihn mit einem Weidenkorb ins<br />
Tal, von wo aus er zuerst ins Spital und später ins Gefängnis<br />
kam. Natürlich wurde ihm der Prozess wegen<br />
vielfachem Diebstahl gemacht und es kam zu einer<br />
Verurteilung. Aus dem Gefängnis, so erzählt man sich,<br />
wurde er vom Militär zwangsrekrutiert, weil der Zweite<br />
Weltkrieg begonnen hatte; aus diesem Krieg kehrte er<br />
nie wieder zurück.<br />
Eingegangen ist „Lois Finsterl“ in die Aufzeichnungen<br />
der Justiz als der „Räuber Finsterl“, in die Geschichten<br />
der Menschen schrieb er sich aber als der „Robin<br />
Hood“ der Südsteirer ein, der die Reichen bestahl, um<br />
die Armen zu beschenken.<br />
39
Wir waren insgesamt acht Kinder und ich war das<br />
jüngste. Die Eltern waren Weinzerln. Als ich zur Welt<br />
kam, waren sie gerade in Pößnitz bei einem Weinbauern,<br />
der damals sieben Winzereien besaß. Wir lebten<br />
in einer kleinen Keusche mit einer Stube und einem<br />
Stüberl. Die Älteren von uns schliefen in der Saukuchl,<br />
mein Bruder und ich teilten uns das Tafelbett in der<br />
Küche. Oft war es gar nicht einfach, dort zu schlafen,<br />
denn hin und wieder kamen die Nachbarn zum Kartenspielen<br />
zu uns. Das Bett wurde aufgeklappt, mein<br />
Bruder und ich schlüpften hinein, die Tischplatte kam<br />
wieder darauf und die Kartenspielerei ging los. Mehr<br />
als einmal hat es uns aus dem Schlaf gerissen, wenn<br />
jemand schrie: „Karo is Trumpf“, und das letzte Ass mit<br />
einem lauten „Pumperer“ auf die Tischplatte knallte.<br />
Mein ältester Bruder war zehn Jahre älter als ich und<br />
das hatte seine Vorteile. Er durfte Zimmermann lernen<br />
und darüber freuten wir uns besonders im Winter.<br />
Es war zwar nicht allzu viel Zeit zum Spielen, wenn wir<br />
aber Möglichkeiten dafür fanden, nutzten wir sie aus.<br />
Besonders das Schifahren hatte es uns angetan. Die<br />
Tauben von alten Fässern mussten zu allererst herhalten.<br />
Jeweils ein Loch wurde in unsere zukünftigen<br />
Schier gebohrt, eine Schnur angeknotet und schon<br />
hatten wir unser Lenkwerkzeug beisammen. Die<br />
Schnur war auch praktisch, weil wir die Fasstauben so<br />
einfach den Berg hinauf ziehen konnten und sie nicht<br />
tragen mussten. Als Schlaufen für unsere Schuhe haben<br />
wir einfach zwei schöne, breite Schweineschwarten<br />
angenagelt und schon ging es los. Mein Bruder<br />
Ottl war sehr geschickt im Umgang mit Holz und so<br />
versuchte er sich daran, für uns richtige Schi zu bauen.<br />
Aus Eschenholz hackte er zwei Brettl heraus, hobelte<br />
diese so lange, bis sie glatt waren, und spitzte sie ein<br />
wenig zu. Dann kamen sie in den Saukessel, wurden<br />
dort gekocht, dann gebogen und mit Schraubzwingen<br />
auf Schragen eingespannt. Darunter machten wir ein<br />
Feuer und haben unsere Schier so lange gebrannt, bis<br />
sie ihre Form behielten. Das war ein Erlebnis, es ging<br />
viel schneller und einfacher zu lenken waren sie auch.<br />
Nur der Vater mochte es gar nicht, denn durch den gefrorenen<br />
Schnee gingen unsere Schuhe auf und Schuhe<br />
waren etwas Wertvolles, das man nicht so einfach<br />
kaufen konnte. Die Lösung war einfach: Wir zogen die<br />
Schuhe aus und fuhren barfuß. Ein paar Mal hielten<br />
wir das schon aus, dann liefen wir wieder heim und<br />
hielten unsere Füße in den Broter, das Bratfach unseres<br />
Tischherdes. Mehrmals haben wir in meiner Kindheit<br />
die Winzereien gewechselt. Unter anderem waren<br />
wir auch in einer Hube von Schloss Trautenburg. Ich<br />
42
musste immer zu einem Nachbarn Milch holen gehen.<br />
Dort gab es ein kleines Mädchen, kaum größer als ein<br />
„Stamperl“, sie war vier Jahre jünger als ich und sollte<br />
in meinem späteren Leben noch eine große Rolle spielen.<br />
Bis 1954 habe ich mit den Eltern im Weingarten<br />
gearbeitet, dann durfte ich das erste Mal den Winter<br />
hindurch arbeiten gehen. Im Frühjahr musste ich wieder<br />
heim und den Eltern helfen. Des Öfteren haben<br />
wir unsere wenigen Habseligkeiten gepackt und sind<br />
weitergezogen in der Hoffnung, beim nächsten Weinbauern<br />
etwas mehr Eigengrund zu bekommen, damit<br />
wir alle Mäuler unserer Familie satt machen konnten.<br />
Immer mit dabei waren auch Vaters Bienenstöcke. Vor<br />
vielen Jahren hatte er damit begonnen und sein Honig<br />
erwies sich gerade in den Kriegsjahren als überaus<br />
nützlich. Ich selbst half dem Vater von klein auf bei der<br />
Bienenarbeit, bekam später zwei Stöcke für mich und<br />
wurde als Erwachsener ebenfalls zum Imker.<br />
und ein Jahr später sind auch wir eingezogen. Meine<br />
Frau und ich taten es meinen Eltern gleich, wir haben<br />
ebenfalls acht Kinder. Nach vielen glücklichen und arbeitsreichen<br />
Jahren ist sie leider im Jänner 2018 entschlafen.<br />
Was bleibt sind viele schöne Erinnerungen.<br />
Auch die Liebe zu den Bienen ist mir vom Vater geblieben.<br />
Noch heute betreue ich zehn Völker und mache<br />
meinen Honig, um ein wenig damit zu handeln.<br />
Die Menschen kamen aus den Städten aufs Land und<br />
versuchten hier, ihr Hab und Gut gegen Nahrungsmittel<br />
einzutauschen. So handelte der Vater für etwas Honig<br />
so manches Kleidungsstück oder ein paar Schuhe<br />
ein. Viele Male, ich erinnere mich noch gut daran, wurde<br />
ein Paar Schuhe repariert anstatt es wegzuwerfen.<br />
Der Vater machte das selbst; entweder konnte er Lederabfälle<br />
beim örtlichen Schuster erwerben oder er<br />
verwendete alte Antriebsriemen, um unsere Schuhe<br />
aufzudoppeln.<br />
Jahre später traf ich jenes kleine „Stamperl“ vom Milchholen<br />
wieder, sie war zu einer jungen, feschen Frau<br />
herangewachsen. Wir haben uns verliebt und 1958<br />
geheiratet. Ihre Eltern besaßen im Kleingraben ein<br />
kleines Grundstück und dort begannen wir 1961, uns<br />
ein Haus zu bauen. Ich habe damals schon gearbeitet<br />
und verbrachte jede freie Minute auf unserer Baustelle.<br />
Das ganze Fundament und der Keller wurden händisch<br />
ausgegraben, genau so wie auch jede Scheibtruhe<br />
voll Beton von Hand abgemischt wurde. Erst beim<br />
Innenputz bekam ich leihweise eine Mischmaschine<br />
mit einem Benzinmotor, der Strom kam erst 1972 in<br />
unseren Graben. Vier Jahre nach Baubeginn konnten<br />
meine Schwiegereltern ein kleines Zimmer beziehen<br />
43
Pfarre Großklein<br />
Waren es für die prähistorische Zeit archäologische<br />
Funde, die etwas Licht ins Dunkel der Geschichte<br />
von Klein bringen, so sind es seit dem Hochmittelalter<br />
schriftliche Quellen. Am 7. September 1170 beurkundete<br />
und bestätigte der Salzburger Erzbischof<br />
Adalbert III. der Pfarre Leibnitz deren Besitzungen.<br />
Als eine zur Pfarre gehörige Tochter- bzw. Filialkirche<br />
wird in der Urkunde jene „in klvne sancti Georgii“ genannt.<br />
Die Ortschaft<br />
Klein und die dem Heiligen<br />
Georg geweihte<br />
Kirche sind demnach<br />
erstmals 1170 urkundlich<br />
nachweisbar. Über<br />
Größe, Aussehen und<br />
über den genauen<br />
Standort der in der<br />
Urkunde von 1170 genannten<br />
„capella“ ist nichts bekannt. Vergleichsbeispiele<br />
aus anderen Gegenden lassen den Schluss zu,<br />
dass die Georgskirche noch im Hochmittelalter ein<br />
Holzbau gewesen ist, der dem damaligen Typus vieler<br />
Landkirchen entsprach.<br />
Die ersten konkreten Nachrichten über Bauzustand<br />
und Bauausstattung stammen aus dem frühen<br />
17. Jahrhundert. 1607 wird in einem Visitationsbericht<br />
vermerkt, dass es in der Kirche drei Altäre gab. Einer<br />
davon sollte entfernt und stattdessen eine Kanzel errichtet<br />
werden. Der Friedhof umgab bereits damals<br />
die Kirche. Mit zunehmender Bevölkerung und wirtschaftlichem<br />
Ausbau des Landes wurden die in der<br />
Kolonisationszeit entstandenen Pfarren im Interesse<br />
einer besseren seelsorglichen Betreuung in kleinere<br />
Sprengel unterteilt. So entstand im Spätmittelalter<br />
aus der Mutterpfarre Leibnitz eine Reihe neuer Pfarren:<br />
Gamlitz, Leutschach, St. Johann im Saggautal,<br />
44
Eibiswald und St. Nikolai im Sausal. Das Gebiet von<br />
Großklein gehörte zum überwiegenden Teil zur Pfarre<br />
St. Johann i.S., die Georgskirche war nun etwa 500 Jahre<br />
lang eine von der Pfarrkirche St. Johann abhängige<br />
Filialkirche. Die Pfarrgeistlichkeit von St. Johann war<br />
lediglich verpflichtet, jeden zweiten Sonntag und zu<br />
den Hochfesten des Kirchenjahres in Großklein mit<br />
der Bevölkerung Gottesdienste zu feiern, auch Ehen<br />
durften hier geschlossen und die Toten im Kirchhof<br />
begraben werden. Das Sakrament der Taufe hingegen<br />
war alleiniges Vorrecht der Pfarrkirche.<br />
Dieses und andere, ausschließlich Pfarrkirchen vorbehaltene<br />
Rechte erlangte die Georgskirche erst im<br />
Jahr 1787. Im Zuge der sogenannten Josephinischen<br />
Pfarrregulierung wurde durch ein kaiserliches Dekret<br />
vom 2. Dezember 1787 die selbstständige Pfarre Klein<br />
geschaffen und die bisherige Filialkirche in den Rang<br />
einer Pfarrkirche erhoben.<br />
1790 richtete der erste Pfarrer von Klein, Vinzenz<br />
Martin Wittmeier, ein Ansuchen an das Gubernium in<br />
Graz, worin er um die Überlassung eines Altars aus<br />
der unter Kaiser Joseph II. aufgelassenen Dominikanerkirche<br />
in Pettau/Ptuj ersuchte, da der Hochaltar in<br />
Klein vermorscht und wurmstichig war.<br />
Gubernium und Bischof stimmten zu, sodass man<br />
trotz fehlender weiterer Quellen annehmen kann,<br />
dass der Altaraufbau aus Pettau nach Klein transportiert<br />
und hier als der heutige – wenngleich sicher modifiziert<br />
– aufgestellt wurde. Das um 1770/80 entstandene<br />
Altarbild zeigt die Aufnahme des Heiligen Georg<br />
in den Himmel. Er kniet mit Lanze und Drachen auf<br />
einer Wolke, den Blick auf die ebenfalls kniende Maria<br />
gerichtet. Ein Engel reicht ihm den Palmzweig für das<br />
erlittene Martyrium.<br />
45
Vom Berg zum Hügel<br />
„Zam mudln“<br />
Ich bin im Mölltal, auf gut 900 Meter Seehöhe, als eines<br />
von zehn Geschwistern zur Welt gekommen. Oft<br />
erzählte mir meine Mutter, dass ich bei meiner Geburt<br />
kleiner war als unsere größten Erdäpfel. Als kleines<br />
Kind war ich „a zniachti Krott“ und das war vermutlich<br />
auch der Grund, warum ich jeden Tag ein Häferl kuhwarme<br />
Milch bekam. Wir hatten sieben Kühe und einige<br />
Schafe auf unserem Hof. Es gab sehr schneereiche<br />
und strenge Winter, es war bitterkalt und deshalb sind<br />
wir so gut wie möglich unter unseren Decken zusammengekrochen.<br />
In unserer Küche stand ein Tafelbett.<br />
Am Tag war es Arbeitsfläche und in der Nacht sind<br />
wir zu dritt darin gelegen, die kleineren zwei von uns<br />
quer und das größere Geschwisterl der Länge nach.<br />
Die Schafe bei uns daheim wurden zweimal pro Jahr<br />
geschoren. Im Sommer stellten wir einen großen Holzbottich<br />
im Hof auf, kochten im Dämpfer das Wasser,<br />
gaben Soda dazu und badeten jedes einzelne Schaf<br />
darin. Mit einem „Striegler“ wurden die Tiere ordentlich<br />
gesäubert und danach mussten wir Kinder sie auf<br />
der Hausweide hüten, damit keines davonspaziert<br />
und alle ordentlich trocken wurden. Im Winter streute<br />
der Vater den Stall ordentlich ein und die Schafe<br />
wurden dort gewaschen. Waren sie trocken, ging es<br />
ans Scheren; das passierte bei uns in der Stube. Weil<br />
unsere Wirtschaft ja nicht so groß war, kamen meine<br />
Geschwister, sobald sie mit der Schule fertig waren, zu<br />
anderen Betrieben. Bei mir war es auch nicht anders.<br />
Mit 15 Jahren begann ich bei einer Jausenstation an<br />
der Glocknerstraße zu arbeiten. Ich war Mädchen für<br />
alles und musste ebenso putzen und waschen wie kochen<br />
und servieren. Sechs Jahre war ich dort, bis der<br />
Vater mich 1944 wieder nach Hause holte. Alle meine<br />
Brüder waren im Krieg und er brauchte Hilfe auf dem<br />
Hof. In jener Zeit war ich nicht mehr ganz so ein „Zniachterl“.<br />
Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir gemeinsam<br />
mit dem Vieh arbeiteten und ich Vater dabei<br />
half, mit der Zugsäge im Wald Bäume zu fällen. Das einzig<br />
Gute an jenen Kriegsjahren war, dass mein Bruder<br />
und ein steirischer Bauernbub, sein Name war Ludwig,<br />
Kameraden waren. Als der Krieg endlich vorüber<br />
war, besuchte mein Bruder seinen Freund in Großklein<br />
und auch er kam zu uns in die Berge. Mir gefiel dieser<br />
schneidige Bursche und anscheinend hatte auch er<br />
ein Auge auf mich geworfen, denn irgendwann sagte<br />
mein Bruder zu mir: „Den Ludwig muaßt nehman, der<br />
is a guata Mensch.“ Weil ich dem überhaupt nicht abgeneigt<br />
war, sagte ich nicht viel mehr als: „Schauma<br />
amol“.<br />
So kam es, dass ich meinen Bruder für ein paar Tage<br />
begleitete, mir Ludwigs Wirtschaft anschaute und natürlich<br />
auch die Schwiegereltern kennenlernte. Was<br />
ich sah, gefiel mir; die Wirtschaft war zwar nicht im<br />
allerbesten Zustand, aber das war damals keine. Die<br />
Arbeit war nicht viel anders als bei uns daheim und<br />
ich war sie ja gewohnt. Wochen später kam Ludwig<br />
wieder zu uns und alles wurde besprochen. Es war<br />
Besatzungszeit und die Vorschriften damals lauteten,<br />
dass ich sechs Wochen vor der Hochzeit zu meinem<br />
Bräutigam ziehen musste, bevor wir heiraten durften.<br />
So nahm er mich damals, 1948, mit Sack und Pack mit<br />
zu sich nach Hause. Die Schwiegermutter und seine<br />
Schwester erwarteten mich schon sehnsüchtig und<br />
nahmen mich herzlich auf. Sechs Wochen haben wir<br />
zwei dann schon „zam mudln“ und uns aneinander<br />
gewöhnen dürfen, aber sonst hat es nichts gegeben,<br />
bis uns der staatliche und der kirchliche Segen zuteilwurden.<br />
Am 1. April 1948 war es so weit, wir heirateten<br />
und es war wirklich lustig. Doch davor mussten wir<br />
noch einen kleinen Hürdenlauf absolvieren.<br />
Damals gab es einen Nachbarn, der als Streithansl bekannt<br />
war. Jeder versuchte eine Konfrontation mit ihm<br />
48
zu vermeiden und genau der wollte unbedingt unseren<br />
Hochzeitszug aufhalten und durch Absperren ein<br />
wenig Trinkgeld verdienen. Dazu hatte er einen Birkenbesen<br />
mit; als wir uns talwärts durch den Hohlweg<br />
in Richtung Höllgraben auf den Weg machten, sahen<br />
wir ihn schon von Weitem. Wir wären ihm auch nicht<br />
entkommen, da der Hohlweg sehr tief war und ausweichen<br />
nicht ging. Die ganze Hochzeitsgesellschaft<br />
machte kehrt und es ging zurück auf den Berg. Zuerst<br />
versuchten wir es über eine andere Leitn, doch schon<br />
sahen wir am Waldrand den Nachbarn, der uns den<br />
Weg abschneiden wollte. Wieder hieß es kehrt. Der<br />
dritte Versuch sorgte dafür, dass er uns übersah und<br />
so kamen wir zumindest schon bis in den Kleingraben<br />
hinunter. Jetzt war er hinter uns, wir lachten und hatten<br />
unseren Spaß damit, ihm aus dem Weg zu gehen.<br />
Gut gelaunt marschierten wir in Richtung Dorf. An der<br />
Brücke über den Kleinbach startete er einen neuen<br />
Versuch, aber dort war schon jemand anders postiert.<br />
Von dem ließen wir uns gerne aufhalten und gaben<br />
ein gutes Trinkgeld. Der Streithansl zog weiter und<br />
wir machten noch einen Umweg, um ihm ein letztes<br />
Mal auszuweichen. Erst kurz vor der Kirche hat er uns<br />
eingeholt, aber da war es schon zu spät. Laut hörten<br />
wir ihn hinter uns schimpfen und seinen Birkenbesen<br />
hat er ebenfalls nach uns geworfen, bevor er wutentbrannt<br />
nach Hause stapfte.<br />
Es gab eine wunderschöne Hochzeitsfeier. Der geworfene<br />
Birkenbesen hat uns Glück gebracht. Ich habe es<br />
mit meinem Ludwig wirklich gut getroffen. Wenn man<br />
bedenkt, dass er mit meinem Bruder Jahre im Krieg<br />
verbracht hat, aber wir uns nur wenige Wochen kannten,<br />
bevor wir heirateten, so muss man sagen, dass es<br />
das Schicksal schon gut mit uns gemeint hat. So bin<br />
ich seinerzeit vom Tiroler Berg zum steirischen Hügel<br />
gekommen.<br />
49
Käferbohnensuppe<br />
ZUTATEN<br />
150 g Käferbohnen (getrocknet)<br />
1 EL Schmalz<br />
1 Zwiebel (groß)<br />
250 g Speck<br />
1 EL Mehl (glatt)<br />
1 EL Paprikapulver (edelsüß)<br />
2 EL Essig (z.B. von Essiggurken)<br />
3-4 Essiggurken (groß)<br />
½ Dose Mais<br />
Salz<br />
Pfeffer<br />
Bohnenkraut<br />
Thymian<br />
ZUBEREITUNG<br />
Zunächst die Käferbohnen über Nacht in reichlich<br />
Wasser einweichen. Mit frischem Wasser<br />
bissfest kochen und dabei unbedingt darauf<br />
achten, dass die Bohnen mit reichlich Wasser<br />
bedeckt sind. Kochwasser NICHT wegschütten!<br />
Zwiebel kleinschneiden, Speck würfelig schneiden,<br />
Schmalz erhitzen und Zwiebeln darin goldgelb<br />
braten. Speck zugeben und glasig werden<br />
lassen. Mit Paprikapulver und Mehl stauben.<br />
Mit Essig und dem Kochwasser der Bohnen ablöschen.<br />
Essiggurken feinschneiden. Bohnen,<br />
Essiggurken und Mais zufügen. Mit Salz, Pfeffer,<br />
Bohnenkraut und Thymian würzen. Eventuell<br />
kann man auch einen Suppenwürfel dazugeben.<br />
Die Bohnensuppe ca. 15 Minuten köcheln<br />
lassen – nicht zu lange, damit die Bohnen und<br />
der Mais nicht zerkochen.<br />
50
Sulmtaler<br />
Hendel-Eintopf<br />
ZUBEREITUNG<br />
ZUTATEN<br />
1 Sulmtaler Hendl, etwa 1,5 kg<br />
4 EL Öl<br />
250 g Edelkastanien (abgeschält)<br />
150 g kleine Schalotten<br />
200 g Sellerie (würfelig geschnitten 1 cm)<br />
150 g Karotten (würfelig geschnitten 1 cm)<br />
2 Lorbeerblätter<br />
100 ml Rotwein<br />
150 ml Geflügel-Jus<br />
50 g Butter<br />
Oregano, Thymian, Rosmarin<br />
Salz, Pfeffer, Honig<br />
Gebackener Grießkoch<br />
ZUTATEN<br />
Das Hendl herauslösen und in 8 Teile zerteilen,<br />
wobei der Brust und den Flügeln die Haut nicht<br />
abgezogen wird. Mit Salz würzen. Den Backofen<br />
auf 200 °C vorwärmen. In einem Schmortopf das<br />
Öl erhitzen. Das Hendl auf der Hautseite anbraten.<br />
Nach 2-3 Minuten die Stückchen auf die andere<br />
Seite drehen und die Schalotten und Lorbeerblätter<br />
beifügen. Mit dem Deckel verschließen und<br />
in das vorgeheizte Backrohr stellen. Gelegentlich<br />
mit dem Bratensaft begießen. Nach etwa 20 Minuten<br />
den Kochtopf aus dem Rohr nehmen, das<br />
Hendl herausheben und warmstellen.<br />
Butter, Gemüse und Edelkastanien beifügen. Den<br />
Schmortopf auf die Herdplatte stellen. Bei geringer<br />
Temperatur das Gemüse gemächlich dünsten.<br />
Mit Salz, Pfeffer und Honig würzen und ein kleines<br />
bisschen Wasser untergießen. Wenn das Gemüse<br />
weich ist, mit Rotwein löschen und mit dem Geflügel-Jus<br />
aufgießen. Kurz kochen und mit Salz und<br />
frisch gemahlenem Pfeffer kräftig abschmecken.<br />
Die Hendlstücke zurück in die Schmortopf-Form,<br />
ZUBEREITUNG<br />
1,2 l Milch<br />
180 g Grieß<br />
3 Eier<br />
1-2 EL Honig<br />
Zeste von ½ Zitrone<br />
1 cl Rum<br />
Mehl<br />
Ei<br />
geriebene Nüsse<br />
Die Milch mit dem Grieß, Honig und den Zitronenzesten<br />
aufkochen und auskühlen lassen. Den Rum<br />
und drei Eidotter in die abgekühlte Masse rühren.<br />
Den Eischnee schlagen und unterheben. Die Masse<br />
in eine befettete, schmale Kastenform geben.<br />
Im vorgeheizten Backrohr bei 120 °C ca. 30 Minuten<br />
aufbacken. Aus der Form geben und in 1,5 cm<br />
dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben zuerst in<br />
Mehl, dann in verquirltem Ei und zum Abschluss in<br />
geriebenen Nüssen wenden. Die panierten Scheiben<br />
in heißem Fett goldbraun backen.<br />
51
ZEITREISE<br />
Die Sulmtalbahn<br />
Die Sulmtalbahn ist noch<br />
heute in den Erinnerungen<br />
der Menschen tief verankert.<br />
Immer wieder wird<br />
uns davon berichtet, wie<br />
die Bahn ihre rauchende<br />
Spur entlang der Sulm von<br />
Leibnitz bis nach Pölfing-Brunn<br />
zog.<br />
Von den ersten Planungen bis zur Eröffnung war es<br />
ein weiter Weg: Bereits 1850 plante Wenzel Radimsky<br />
den Bau einer Bahnverbindung von Wies-Eibiswald ins<br />
Sulmtal und weiter durch den Radlberg ins Drautal. Das<br />
Interesse galt damals der Beförderung der abgebauten<br />
Kohle aus dem Raum Wies-Eibiswald, Steyeregg und<br />
Pölfing-Brunn.<br />
Doch diese und weitere Pläne wurden nicht realisiert.<br />
Erst mit einem Landesgesetz von 1890 zur Förderung<br />
des Lokalbahnwesens wurden dem Bau der Sulmtalbahn<br />
neue Chancen eröffnet. Nach einer eingehenden<br />
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und nach Überwindung<br />
finanzieller und bürokratischer Schwierigkeiten<br />
war es dann soweit: Im Oktober 1903 beantragte<br />
das Exekutivkomitee beim Landesausschuss (so<br />
hieß damals die heutige Landesregierung) den Bau<br />
einer normalspurigen Lokalbahn von Leibnitz über Pölfing-Brunn<br />
nach Eibiswald. Der Bau der Sulmtalbahn<br />
sowie die Verlängerung von Pölfing-Brunn bis Eibiswald<br />
wurden im Dezember 1904 genehmigt. Am 11. März<br />
1906 erfolgte in Leibnitz der erste Spatenstich und nur<br />
eineinhalb Jahre später, nämlich am 13. Oktober 1907,<br />
wurde die Sulmtalbahn eröffnet. Die Sulmtalbahn führte<br />
von Leibnitz in Richtung Norden auf einem eigenen<br />
Gleis entlang der Südbahntrasse und zweigte nördlich<br />
von Leibnitz nach Kaindorf/Sulm ab, wo sie über eine<br />
prächtige Stahlbogenbrücke die Laßnitz überquerte.<br />
Danach ging es entlang der schmalen Talsohle zwischen<br />
Kogelberg und Schloss Seggau über Heimschuh<br />
und Fresing nach Gleinstätten. Einige Kilometer nach<br />
Gleinstätten überquerte die Sulmtalbahn den Leibenbach<br />
und die Schwarze Sulm und fuhr teilweise entlang<br />
der GKB-Strecke nach Wies über Pölfing-Brunn. Die insgesamt<br />
24,7 km lange Strecke führte über 13 Brücken<br />
und über 70 Wegübergänge. Die Verlängerung von Pöl-<br />
56
fing-Brunn nach Eibiswald wurde nie realisiert, stattdessen<br />
wurde eine 3,6 km lange Materialseilbahn von<br />
Eibiswald zum Bahnhof Pölfing-Brunn gebaut, um die<br />
im Eibiswalder Charlotte-Marie-Schacht gewonnene<br />
Kohle zu transportieren. So blieb Eibiswald bis heute<br />
ohne Bahnanschluss.<br />
Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs stiegen die Beförderungszahlen<br />
durch die starken Verkehrszuwächse auf<br />
der Sulmtalbahn enorm an, da die Bahn während des<br />
Balkanfeldzugs (April/Mai 1941) im Aufmarschraum der<br />
Deutschen Wehrmacht lag. Der Krieg hinterließ auch<br />
auf der Sulmtalbahn seine Spuren. So konnte die Bahn<br />
von November 1944 bis Juni 1945 nur von Wies-Eibiswald<br />
bis Heimschuh geführt werden, da immer wieder<br />
Luftangriffe die Sicherheit der Fahrgäste gefährdeten.<br />
Die permanent stärker werdende Konkurrenz durch<br />
die steigende Mobilität und die verheerende wirtschaftliche<br />
Lage führten letztendlich dazu, dass die<br />
Sulmtalbahn am 27. Mai 1967 eingestellt wurde. Auf<br />
Verlangen des Landes Steiermark blieb der Oberbau<br />
vorerst erhalten, da man beabsichtigte, das Sulmtal<br />
beim Bau einer künftigen Koralmbahn zu berücksichtigen.<br />
Schließlich wurden im Oktober 1976 die Schienen<br />
zwischen Leibnitz und Gleinstätten abgetragen und<br />
an die VOEST-Alpine AG Linz verkauft. Auf dem 6,1 km<br />
langen Reststück von Pölfing-Brunn nach Gleinstätten<br />
werden heute noch Güterzüge geführt.<br />
Die Bevölkerung lässt die Erinnerung an diese Bahnlinie<br />
weiterleben. So findet man in einigen Gasthäusern<br />
noch Wandbilder dieser Lokalbahn; vor allem erzählen<br />
die Menschen noch immer gern ihre Geschichten über<br />
den Sulmtaler und wie er schnaufend und fauchend<br />
seine rauchige Spur durchs Sulmtal zog.<br />
57
Ernst Treiber<br />
Der letzte Kalkbrenner<br />
Etliche Bodenschätze, die heute für den industriellen<br />
Abbau überhaupt nicht von Interesse sind, versorgten<br />
früher die Menschen der Gegend mit wichtigen<br />
Rohstoffen. Viele Jahrhunderte reicht die Geschichte<br />
der Bodenschätze in Heimschuh zurück.<br />
Bereits lange vor Christi Geburt wurde Raseneisenerz<br />
bei uns in der Region gefunden und auch verarbeitet.<br />
Im Siegmundswald zeugen noch heute Bodenvertiefungen<br />
von der einstmaligen Verarbeitungsstätte und<br />
der Vielzahl der vorhandenen Brennöfen. Steinbrüche<br />
gab es ebenfalls mehrere im Gemeindegebiet. Eine<br />
ganz besondere Geschichte erzählt vom letzten Heimschuher<br />
Kalkbrenner. Es handelt sich dabei um Herrn<br />
Franz Posch vulgo Woaka Franzl, der von 1881 bis 1965<br />
lebte und seine Kalkbrennerei von den Zwanziger bis<br />
in die Fünfziger Jahre betrieb. Wahrscheinlich bekam<br />
er als Erbteil jenen Grund in Pernitsch, auf dem sich<br />
der „Woaka-Steinbruch“ befand. Geschickt wie er war,<br />
begann er mit dem Brennen von Kalkstein. Es war eine<br />
mühevolle und kräfteraubende Arbeit. Jeder einzelne<br />
Stein musste der Natur in harter Arbeit abgerungen<br />
werden. Zu zweit wurden die Sprenglöcher in den Steinbruch<br />
geschlagen. Einer schlug mit dem „Schlögel“ auf<br />
den Meißel ein, der von seinem Kollegen gehalten und<br />
nach jedem Schlag gedreht wurde. So arbeitete man<br />
sich Millimeter für Millimeter in den Stein. Zwischenzeitlich,<br />
wenn das Loch durch Staub verlegt wurde, schüttete<br />
man Wasser hinein. So entstand im Bohrloch ein<br />
Brei, der dann mit einem Kratzer herausgeholt wurde.<br />
Die Bohrlöcher waren bis zu 1,5 Meter tief und viele davon<br />
waren erforderlich, bevor man eine Reihe absprengen<br />
konnte. Nach der Sprengung wurden die Blöcke<br />
noch zerkleinert und mit Fuhrwerken vom Steinbruch<br />
zum Brennplatz transportiert. Nun begann die eigentliche<br />
Arbeit des Brenners. Stein für Stein schichtete er<br />
seinen Ofen auf. Am Anfang verwendete er die größten<br />
Steine und formte damit die spätere Brennkammer.<br />
Schicht für Schicht wurden die Steine dann immer<br />
kleiner und am Schluss hatte die Aufschichtung circa<br />
4 Meter im Durchmesser und in der Höhe. Abgedeckt<br />
wurde das Ganze mit Lehmziegeln – der Brennvorgang<br />
konnte beginnen. Dieser dauerte rund drei Tage und<br />
es wurde Tag und Nacht durchgefeuert. Dafür benötigte<br />
man rund 15 Raummeter Brennholz oder später<br />
circa 10 Tonnen Braunkohle. Nach 70 durchgearbeiteten<br />
Stunden brauchte Herr Posch einen ordentlichen<br />
Erholungsschlaf, bevor es zum „Ansagen“ ging. Es dauerte<br />
mehrere Tage, bis der Ofen abgekühlt war und der<br />
Kalkstein verkauft werden konnte. Diese Zeit nutzte<br />
Posch, um in den umliegenden Gemeinden den neuen<br />
Brand anzukündigen. Wurde der Ofen dann ausgeräumt,<br />
standen Bauern und Handwerker in Schlangen<br />
vor dem Ofen und holten sich den Kalk ab. Bevor der<br />
Ofen abgedeckt wurde, musste man ihn überdachen.<br />
Da der Kalk nun fertig gebrannt war, war es viel zu gefährlich,<br />
ihn im Freien zu lassen, hätten doch bereits<br />
wenige Regentropfen ausgereicht, um ihn zum Sieden<br />
zu bringen.<br />
Kalk war viele Jahrhunderte hindurch einer der wichtigsten<br />
Baustoffe. Man mischte ihn dem Mörtel bei,<br />
brauchte ihn als weiße Wandfarbe und natürlich war er<br />
auch ein wichtiges Desinfektionsmittel in den Stallungen<br />
der Bauern.<br />
60
Brot, Wein und Schokolade<br />
Gott sei Dank<br />
Vieles ist heute so selbstverständlich, dass die Wertschätzung dafür nicht mehr<br />
vorhanden ist. Die 1929 geborene Frau Martha Wagner vulgo Hofer erinnert<br />
sich an jene Kleinigkeiten, die heute selbstverständlich, aber vor wenigen<br />
Jahren noch ganz besonders waren.<br />
61
Der Weinbau in der<br />
Steiermark geht zurück<br />
auf die Zeit der Kelten. Bereits<br />
um ca. 400 v. Chr.<br />
nutzten sie die wild wachsenden<br />
Reben zur Herstellung<br />
von Wein.<br />
82
Lebenssaft – Rebensaft<br />
Steirische Weinbaugeschichte<br />
Eine dieser Wildreben ist wahrscheinlich die Vorläuferin<br />
der Blauen Wildbacher Traube. Kultiviert wurde der<br />
Wein aber erst, als die Römer in die heutige Steiermark<br />
kamen. Dank Kaiser Marcus Aurelius Probus gelangten<br />
sowohl neue Sorten als auch bessere Anbaumethoden<br />
in unsere Region. Der Hintergrund war, dass jedem<br />
Legionär täglich eine Ration Wein zustand und da<br />
diese nicht immer verfügbar war, beschloss der Kaiser<br />
den Weinbau in den Provinzen zu forcieren.<br />
Zur Zeit der Völkerwanderung ging der Weinbau stark<br />
zurück. Erst mit der Christianisierung und der Urbarmachung<br />
des Landes gelang der Weinwirtschaft<br />
wieder ein enormer Aufschwung. Maßgeblich dafür<br />
verantwortlich zeichneten Kirchen und Klöster. Sie<br />
vergaben den Grund an die Bauern zur Bewirtschaftung<br />
und verlangten dafür als „Zehent“ einen Anteil<br />
der Erträge. Um ca. 1500 hatte zum Beispiel allein das<br />
Bistum Seckau über 6.000 Weingärten. Dass die Weinwirtschaft<br />
zu dieser Zeit großgeschrieben war, zeigen<br />
auch Einfuhrverbote von ausländischem Wein zwischen<br />
dem 13. und dem 15. Jahrhundert. Im 16. und<br />
17. Jahrhundert litt der Weinbau schwer unter Seuchen,<br />
Kriegen und Heuschrecken.<br />
Im 18. Jahrhundert unter Kaiserin Maria Theresia und<br />
Joseph II. erfuhr der Wein wieder einen Aufschwung.<br />
Zwischen 1751 und 1753 erließ Maria Theresia, weil<br />
genügend Wein im eigenen Land vorhanden war,<br />
eine Verordnung, die für jeden Eimer an eingeführtem<br />
Wein Zoll einhob. Im Jahr 1784 legte Joseph II. mit<br />
einer Zirkularverordnung fest, dass jeder Weinbauer<br />
seinen eigenen Wein und seine selbstgemachten,<br />
kalten Speisen verkaufen darf und schuf so die erste<br />
gesetzliche Grundlage für unsere Buschenschänken.<br />
Wohl die bedeutendsten Schritte für die weitere Entwicklung<br />
des steirischen Weinbaues setzte Erzherzog<br />
Johann. 1819 gründete er die „Landwirtschaftsgesellschaft<br />
für Steiermark“, eine Vorläuferin der heutigen<br />
Landwirtschaftskammer, deren Schwerpunkt in der<br />
Förderung des Obst- und Weinbaus lag. 1822 ließ er in<br />
Pickern bei Marburg ein Musterweingut anlegen. Dank<br />
ihm kamen auch viele neue Rebsorten in die Steiermark.<br />
So fanden etwa der Chardonnay, der Sauvignon<br />
und andere heutige steirische Leitsorten ihren Weg<br />
auf die Hänge des südsteirischen Hügellandes. Durch<br />
die Einschleppung der Reblaus 1880 wurde der Weinbau,<br />
nicht nur in der Steiermark, sondern nahezu in<br />
ganz Mitteleuropa massiv geschädigt. Viele Anbauflächen<br />
mussten gerodet werden. Ein Wiederaufbau der<br />
Weinwirtschaft gelang erst durch die Auspflanzung auf<br />
Unterlagsreben.<br />
Im Jahr 1889 wurde der Landes-Obst- und Weinbauverein<br />
Steiermark gegründet und sechs Jahre später,<br />
1895, die Fachschule Silberberg. Ende des 19. Jahrhunderts<br />
war die Steiermark mit etwa 35.000 Hektar ein<br />
bedeutendes Weinland in der Österreichisch-Ungarischen<br />
Monarchie. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor<br />
Österreich die Untersteiermark und das hatte auch<br />
eine Verringerung der steirischen Weinanbaufläche<br />
von etwa 35.000 auf 5.000 Hektar zur Folge. Nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg versuchte man durch den Einsatz<br />
von Wander-Weinbaulehrern, die durch ihr Wissen die<br />
Bauern beim Wiederaufbau unterstützten, dem Weinland<br />
Steiermark wieder zu neuem Leben zu verhelfen.<br />
1985 wurde das Österreichische Weingesetz zur Verhinderung<br />
von Missbräuchen bei der Weinerzeugung<br />
verabschiedet. Seit Ende des 20. Jahrhunderts nimmt<br />
der steirische Wein stetig an Qualität zu. Die Weinbauern<br />
bemühen sich um ausdrucksstarke, körperreiche<br />
Weine, harmonisch und frisch-fruchtig ausgebaut und<br />
das gelingt ihnen hervorragend. Internationale Erfolge<br />
und der große Zuspruch sind dafür der beste Beweis.<br />
83
Kitzeck<br />
Ein Einzelfund, ein Flachbeil aus Serpentin, wurde<br />
im Gemeindegebiet gemacht. Dieser Fund ist<br />
bisher das einzige Zeugnis der Frühgeschichte in<br />
Kitzeck.<br />
Bis ins Hochmittelalter hinein bedeckte ein geschlossener<br />
Forst die Höhenrücken des Sausals. Das Fehlen<br />
archäologischer Funde lässt annehmen, dass<br />
auch zur Römerzeit das Gebiet unbesiedelt war. Nur<br />
der Name „Sausal“ leitet sich vom<br />
lateinischen „Solva silva“ (Sulmwald)<br />
ab.<br />
Erstmals findet sich der Name<br />
Sausal in einer Urkunde von 970,<br />
mit der Kaiser Otto I. das Gebiet<br />
zwischen Sulm und Laßnitz dem Erzbistum Salzburg<br />
übertrug. Die Ortsnamen Kitzeck und Steinriegel finden<br />
sich in keiner mittelalterlichen Urkunde; jedoch<br />
sind im Urbar des Vizedomamts Leibnitz 1322 bereits<br />
einige der Katastralgemeinden des heutigen Kitzecks<br />
genannt. Als älteste Ortschaften sind im Ortsnamenbuch<br />
von Steiermark (1893) die Namen Fresing (Frisin<br />
1136/Vrenzen 1265), Hollerbach (Holrpach) und<br />
Teuttenpach (beide 1295) verzeichnet.<br />
In den ersten Jahrhunderten der salzburgischen<br />
Herrschaft leisteten die vorwiegend baierischen<br />
Siedler ungeheure Rodungsarbeit und schufen die<br />
Grundlage für die heutige Kulturlandschaft. Aus dieser<br />
Zeit stammen auch die Anfänge<br />
des hiesigen Weinbaus,<br />
der sich aufgrund des günstigen<br />
Klimas und der besonderen Eignung<br />
der Hanglagen zum ertragreichsten<br />
Wirtschaftszweig im<br />
Sausal entwickelte. Er hat in früheren<br />
Jahrhunderten eine weitaus größere Bedeutung<br />
für das gesamte Sausal gehabt als in unserer<br />
Zeit und im 17. Jahrhundert seine größte Ausdehnung<br />
erreicht. Heute sind lediglich Kitzeck und Höch<br />
noch als reine Weinbaugemeinden anzusehen; sie<br />
84
sind somit nahezu ein Jahrtausend lang Weinbauorte<br />
geblieben. Die heutige Rebfläche der Gemeinde<br />
umfasst circa 130 Hektar. Unter Kaiser Franz Joseph<br />
I. wurden 1862 die noch heute eingemeindeten<br />
Ortschaften zur Gemeinde Steinriegel zusammengefasst<br />
und der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz<br />
zugeordnet. Über Antrag des Gemeinderates unter<br />
Bürgermeister Paul Stiegler erfolgte 1952 die Umbenennung<br />
der Gemeinde in „Kitzeck im Sausal“.<br />
Der besondere landwirtschaftliche Reiz und der<br />
beeindruckende Fernblick werden bereits 1885 im<br />
„Topographisch-historischen Lexikon von Steiermark“<br />
von Josef Andreas Janisch betont, besonders<br />
eindrucksvoll aber im Buch Paul Anton Kellers „Das<br />
Sausaler Jahr“ geschildert. Doch erst durch die verkehrsmäßige<br />
Erschließung des Gebietes, durch<br />
die Verbesserung der Infrastruktur des Ortes und<br />
schließlich durch zielstrebige Bewerbung konnte mit<br />
dem Fremdenverkehr ein weiteres, wirtschaftlich bedeutendes<br />
Standbein geschaffen werden.<br />
85
Damit’s leichter geht!<br />
Mami tua du<br />
Damals ging es uns schon einigermaßen gut, wenn wir<br />
keinen Hunger und etwas zum Anziehen hatten. Meine<br />
Großeltern mütter- und väterlicherseits waren immer<br />
nur Weinzerln, mussten also sehr viel arbeiten, bekamen<br />
aber kaum Geld dafür. Auch wir waren damals Einwanderer<br />
bei einem Bauern und Mutter musste alles,<br />
was wir brauchten, abdienen. Nicht einmal ein Apfel<br />
war uns vergönnt. Nahm eines meiner Geschwister<br />
einen und der Bauer sah es, hielt er der Mutter vor,<br />
ihre Kinder würden stehlen. Sofort kam wieder eine<br />
Arbeit dazu, damit sein Verlust, der Apfel, abgedeckt<br />
war. Der Vater war im Krieg und ich war das vierte von<br />
insgesamt sieben Kindern. Vater geriet schon früh in<br />
russische Kriegsgefangenschaft und kam 1946 wieder<br />
heim. Ich war damals vier Jahre alt, hatte ihn noch nie<br />
gesehen und versteckte mich, als plötzlich ein fremder<br />
Mann bei uns in der Stube erschien. Die Mutter erzählte<br />
mir später, dass er als Erstes fragte, wo denn die<br />
Milli ist. Dann hob er mich hinter einem Stuhl hervor,<br />
drückte und busselte mich ab und erst dann begrüßte<br />
er meine Geschwister, die ihn ja schon kannten. Diese<br />
Erinnerung ist wohl die schönste, die ich an den Vater<br />
habe, denn die Zeiten sollten für uns nicht besser<br />
– sondern schlimmer werden. Ein kleines Grundstück<br />
wurde gekauft und darauf errichteten die Eltern ein<br />
Häuschen. Der Vater wurde Ziegelwerksarbeiter und<br />
vom Werk brachten die Mutter und mein Bruder jeden<br />
einzelnen Ziegel unseres Hauses mit dem „Ziachgoarn“<br />
nach Hause. Natürlich keine neuen, sondern jene verbrannten,<br />
die als Ausschuss weggegeben wurden.<br />
Meine Mutter war eine Seele von einem Menschen,<br />
leider wurde sie immer verbitterter, da der Vater dem<br />
Alkohol sehr zugetan war und seinen Lohn lieber beim<br />
Wirt verprasste als ihn für die Familie nach Hause zu<br />
bringen. Mehrmals ging die Mutter am Zahltag in das<br />
Gasthaus, um vom Vater wenigstens das Nötigste an<br />
Geld zu bekommen, damit sie uns ernähren konnte. Es<br />
war schlimm zum Ansehen und noch heute bewunde-<br />
100
Dachstuhl war mit Schleuderketten zusammengezogen,<br />
damit er nicht einstürzt. Aber es war unseres und<br />
sofort begannen wir damit es herzurichten und auszubauen.<br />
Mein Mann arbeitete zuerst im Ziegelwerk,<br />
wo auch mein Vater war, und ging später auf den Bau.<br />
Haus und Grund musste mein Mann damals mit geliehenem<br />
Geld kaufen, denn woher sollte er als Weinzerlbub<br />
eines nehmen? Das alles haben wir gemeistert<br />
und ich war der „Finanzminister“ bei uns daheim. Der<br />
Grund dafür war ein einfacher: In der Kindheit meines<br />
Mannes war es weit wichtiger, dass er zur Arbeit gestellt<br />
war als in die Schule zu gehen. So teilte auch er<br />
das Schicksal vieler und lernte nie ordentlich Lesen<br />
und Schreiben. Wann immer etwas mit Geldgeschäften<br />
oder bei Behörden zu erledigen war, sagte er: „Mami<br />
tua du!“<br />
re ich sie dafür, wie sie trotz all dieser Probleme uns<br />
sieben Kinder durchgefüttert hat. Als meine Schulzeit<br />
zu Ende war, ging ich sofort arbeiten. Ein Jahr war ich<br />
in der Spinnfabrik Kaindorf und danach fing ich beim<br />
Forstgarten in Geidorf zu arbeiten an. Ich bin nie ausgegangen,<br />
Tanzunterhaltungen konnte ich mir nicht<br />
leisten, denn selbst mein erstes Fahrrad – ich brauchte<br />
es um in die Arbeit zu kommen – musste ich auf Raten<br />
anschaffen und dafür monatlich 60 Schilling abzahlen.<br />
Meinen späteren Mann lernte ich daheim kennen. Er<br />
war 12 Jahre älter als ich, arbeitete lange mit seinen<br />
Eltern in Kitzeck als Weinzerl und ging dann für einige<br />
Zeit nach Vorarlberg, um Geld zu verdienen. Dabei<br />
lernte er meinen Bruder kennen und mit ihm kam er zu<br />
uns nach Hause. Im März haben wir uns das erste Mal<br />
gesehen und bereits im Oktober habe ich ihn, noch keine<br />
18 Jahre alt, geheiratet. Anfangs gab es deswegen<br />
wieder Streit mit dem Vater, aber letztendlich musste<br />
er froh sein, dass wieder eine weniger daheim am Tisch<br />
war.<br />
Damals hatte mein Mann hier in Neurath bereits ein<br />
kleines Grundstück mit einer alten Keuschen darauf<br />
gekauft. Als ich diese das erste Mal sah, bin ich richtig<br />
erschrocken. Es war ein altes, baufälliges Winzerhaus:<br />
halb gemauert und halb Holz, das Dach sah aus, als<br />
würde es jeden Moment zusammenbrechen und der<br />
Alles haben wir geschafft, mein Mann war fleißig und<br />
ich konnte sparen. Damit es leichter über die Runden<br />
ging, bin ich noch viele Jahre lang Tagwerken gegangen.<br />
Es gibt wohl kaum einen Weingarten in ganz Kitzeck, in<br />
dem ich nicht gearbeitet habe. Einfach war es nicht. So<br />
habe ich für meine Kinder beispielsweise noch sehr viel<br />
selber genäht und natürlich mussten die kleineren das<br />
Gewand der größeren nachtragen. Ich erinnere mich<br />
noch, dass der Vater aus seiner Gefangenschaft etliche<br />
gestreifte Überzüge für Strohsäcke heimbrachte. Diese<br />
lagen lange bei den Eltern herum, bis ich die Mutter<br />
darum bat, um aus diesem Stoff Kleidungsstücke für<br />
meine Kinder zu nähen. Und trotz all der Lasten, die<br />
wir zu tragen hatten, war das Leben heiter und schön.<br />
Fragte mich jemand, wie viele Kinder ich denn habe, so<br />
gab ich stets zur Antwort: „Fünf Buam und jeder hot oa<br />
Schwester“. Viele erklärten mich für verrückt und fragten,<br />
wie ich zehn Kinder in die Welt setzen kann, bis ich<br />
die Sache aufklärte und erzählte, dass ich sechs Kinder<br />
habe und jeder der Buben die gleiche Schwester hat.<br />
Was anfangs nur aus einer Lab’n (Vorhaus), einer Kuchl<br />
und einem Stüberl mit gerade genug Platz für ein Bett<br />
begann, bot später Platz für unsere ganze Familie und<br />
ist noch heute mein Zuhause. Mein Mann ist 2016 verstorben;<br />
langweilig wird es mir jedoch nie, denn Enkel<br />
und Urenkel halten mich auf Trab. Einzig der Satz<br />
„Mami tua du“ fehlt mir hin und wieder.<br />
101
Steirische<br />
Krensuppe<br />
ZUTATEN<br />
50 g Butter<br />
2 EL Mehl<br />
½ L Suppenbrühe<br />
¼ L Milch<br />
1/8 L Sauerrahm<br />
2 EL Weißwein<br />
etwas Zitronensaft<br />
Salz<br />
30 g geriebener Kren<br />
1 Schlagobers<br />
1 Jungzwiebel<br />
2 Scheiben Schwarzbrot<br />
ZUBEREITUNG<br />
Das Schwarzbrot in Würfel schneiden, in etwas Butter<br />
goldbraun rösten und zur Seite stellen. Die restliche<br />
Butter mit Mehl anschwitzen, mit Suppenbrühe und<br />
Milch aufgießen, umrühren und aufkochen lassen.<br />
Sauerrahm mit dem Stabmixer einrühren. Die Suppe<br />
mit Weißwein, Zitronensaft und Salz abschmecken.<br />
Den geriebenen Kren löffelweise dazugeben, bis der<br />
gewünschte Geschmack erreicht ist.<br />
Schlagobers aufschlagen, die Hälfte davon in die<br />
Krensuppe einrühren. Den Rest für die Garnierung<br />
aufheben. Die Jungzwiebel in feine Scheiben schneiden.<br />
Die Krensuppe anrichten, mit den gerösteten<br />
Brotwürfeln, einem Schlagobershäubchen, Jungzwiebelscheiben<br />
und geriebenem Kren garnieren.<br />
102
Knoblauch-Karpfen<br />
ZUTATEN<br />
ZUBEREITUNG<br />
1 Karpfen (ca. 2 kg, ausgenommen, geschuppt,<br />
halbiert)<br />
Öl (oder Butter zum Braten)<br />
Mehl (griffig)<br />
Zitronensaft<br />
Salz<br />
FÜR DIE KNOBLAUCHBUTTER:<br />
100 g Butter (zimmerwarm)<br />
2 Knoblauchzehen (feingehackt)<br />
1 TL Petersilie (feingehackt)<br />
Zitronensaft<br />
Die Karpfenhälften mehrmals schräg bis zum<br />
Rückgrat einschneiden (schröpfen) oder bereits<br />
beim Fischhändler schröpfen lassen. Salzen, mit<br />
Zitronensaft beträufeln und etwas ziehen lassen.<br />
In Mehl wälzen und in ausreichendem, nicht zu<br />
heißem Fett langsam braten, bis die Haut schön<br />
knusprig ist. Für die Knoblauchbutter die Butter<br />
mit allen Zutaten vermengen und den Karpfen<br />
erst kurz vor dem Anrichten damit bestreichen.<br />
Als Beilage eignen sich Petersilerdäpfel, Gurken-,<br />
Paradeiser- oder Blattsalate.<br />
Polsterzipfel<br />
ZUTATEN<br />
¼ kg Butter<br />
¼ kg Mehl<br />
¼ kg Topfen<br />
Mehl zum Verarbeiten<br />
Marmelade der Saison<br />
Staubzucker<br />
ZUBEREITUNG<br />
Butter, Mehl und Topfen zu einer Masse verarbeiten.<br />
Danach muss so viel Mehl zugegeben werden,<br />
dass sich die Masse dünn austreiben lässt.<br />
Die Menge der Mehlzugabe ist abhängig von<br />
der Art des Topfens, den man verwendet. Mehl<br />
auf die Arbeitsfläche streuen und einen Teil des<br />
Teiges dünn ausweigeln, danach mit dem Messer<br />
oder einem Teigrad Quadrate ausschneiden,<br />
diese mit Marmelade der Saison füllen und zu<br />
einem Dreieck zusammenschlagen (Polsterzipfel),<br />
die Ecken fest zudrücken und die Zipfel auf<br />
ein Backblech legen. Die Marmeladezipfel dann<br />
bei 180 °C ca. 15 Minuten backen und noch im<br />
warmen Zustand sofort im Staubzucker drehen.<br />
103
Breinsuppe<br />
mit Hendlstücken<br />
ZUTATEN<br />
700 g Suppenhuhn (etwa ein halbes)<br />
120 g Heidenbrein<br />
(Buchweizen, gewaschen)<br />
1,5 L Wasser<br />
80 g Wurzelwerk<br />
(Karotten, Sellerie etc., blättrig geschnitten)<br />
2 Blätter Liebstöckel<br />
Petersilienstengel<br />
10 g Petersilie (feingehackt)<br />
Salz, Pfeffer<br />
ZUBEREITUNG<br />
Das Suppenhuhn mit Wasser aufstellen, einmal aufkochen<br />
lassen, den ersten Kochsud weggießen und neu<br />
zustellen. Nach einiger Zeit das Wurzelwerk, die Petersilstengel<br />
und den Liebstöckel beifügen und ganz langsam<br />
weiterkochen. Sobald das Huhn weich ist, herausheben,<br />
kalt abschrecken, auslösen und das Fleisch in<br />
nicht zu kleine Stücke schneiden.<br />
Den Kochsud abseihen und den Heidenbrein darin<br />
weichkochen. Die Hühnerstücke beifügen, mit Salz und<br />
Pfeffer abschmecken und mit Petersilie bestreut die<br />
Breinsuppe servieren.<br />
Kürbiskern-<br />
Reindling<br />
FÜR DEN REINDLING-TEIG:<br />
200 ml Milch<br />
30 g Hefe<br />
500 g Mehl (glatt)<br />
60 g Staubzucker<br />
4 Stück Eidotter<br />
80 g Butter (oder Margarine)<br />
1 Päckchen Vanillezucker<br />
1 Prise Salz<br />
154
Hirschgulasch<br />
ZUTATEN<br />
1 kg Hirschfleisch (Wade oder Hals)<br />
3 mittlere Zwiebel<br />
Öl oder Schmalz zum Braten<br />
1 EL Tomatenmark<br />
¼ L Rotwein<br />
¾ L Wildfond (alternativ Rindsuppe oder Wasser)<br />
Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Piment<br />
(Nelkenpfeffer), Thymian, Majoran<br />
Salz, Pfeffer<br />
evtl. Mehl zum Binden<br />
ZUBEREITUNG<br />
Für das Gulaschrezept das Hirschfleisch in grobe<br />
Würfel zerteilen, die Zwiebel feinhacken. Das würfelig<br />
geschnittene Hirschfleisch mit Salz und Pfeffer<br />
würzen. Schmalz in einer Pfanne erhitzen und<br />
das Hirschfleisch von allen Seiten scharf anbraten.<br />
Dabei in mehreren Etappen vorgehen, denn das<br />
ganze Fleisch auf einmal würde die Pfanne zu sehr<br />
abkühlen.<br />
Das Hirschfleisch mit den Bratenresten herausnehmen<br />
und rasten lassen. In der Zwischenzeit<br />
die Zwiebel in derselben Pfanne goldgelb rösten.<br />
Tomatenmark unterrühren und etwas mitrösten.<br />
Mit Rotwein ablöschen und etwas einkochen lassen.<br />
Das Hirschfleisch mit den Bratrückständen<br />
und den Wildgewürzen hinzugeben und mit dem<br />
Wildfond aufgießen. Das Hirschgulasch zugedeckt<br />
ca. 1,5-2 Stunden köcheln lassen. Die Flüssigkeit<br />
ist ein Richtwert; falls es zu wenig Sauce gibt, einfach<br />
noch mehr Wildfond oder Wasser zugießen.<br />
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Falls nötig, mit<br />
etwas Mehl eindicken und mit Semmelknödel und<br />
Preiselbeeren servieren.<br />
ZUBEREITUNG<br />
Für die Reindling-Fülle:<br />
100 g Steirerkraft Kürbiskerne (gehackt), Vanille, Zimt<br />
und Kaffee, 100 g Rosinen (für einige Stunden in Rum<br />
eingelegt), einige EL Rum, 75 g Zucker (mit etwas Zimt<br />
vermischt)<br />
Für den Kürbiskern-Reindling zuerst ein Dampfl ansetzen<br />
(einen Teil der lauwarmen Milch mit der Hefe<br />
und etwas Mehl verrühren und gehen lassen). Die restliche<br />
Milch, Mehl, Staubzucker, Vanillezucker, Eidotter,<br />
Salz, geschmolzene Butter und das Dampfl zu einem<br />
Teig verkneten. Danach 15 Minuten gehen lassen. Den<br />
Teig ausrollen und mit etwas flüssiger Butter bepinseln.<br />
Zimtzucker, gehackte Kürbiskerne und Rumrosinen<br />
daraufstreuen, einrollen, halbieren und in gefettete<br />
Reindlingformen (Gugelhupf) einlegen. Obenauf mit<br />
Butter bestreichen und wieder gehen lassen. Den Kürbiskern-Reindling<br />
bei 180 °C ca. 45 Minuten backen.<br />
155
Er koa Göld – i koa Göld!<br />
Vom Bauern<br />
zum Bauern<br />
Unser Leben war schwer, die Wirtschaft war im wahrsten<br />
Sinne des Wortes zum Sterben zu groß und zum<br />
Leben zu klein. Keiner kann sich heute mehr vorstellen,<br />
wie viele Bogen Gras wir heimgetragen haben.<br />
Die Ochsen durften dafür nicht eingespannt werden,<br />
denn die könnten ja ins Schwitzen geraten und dann<br />
kränkeln. Sie mussten aber verkauft werden, um uns<br />
einigermaßen über die Runden zu bringen; bei uns<br />
Menschen war das egal. Der Vater besaß 700 Weinstöcke,<br />
doch auch diese machten mehr Arbeit als sie<br />
Nutzen brachten. Meine ersten Kindheitserinnerungen<br />
stammen aus den Weltkriegsjahren. Es herrschte<br />
eine ängstliche, beklemmende Spannung, fremde<br />
Menschen waren auf unserem Hof und erst Jahre<br />
später verstand ich, was da vorging. Es war eine Unternehmerfamilie<br />
aus Tillmitsch (der Vater stammte aus<br />
Italien), die bei uns Zuflucht suchte und Aufnahme<br />
fand. Die Schwester des Geschäftsmanns, seine Frau<br />
und die Kinder waren in zerlumptes Gewand gepackt<br />
und gingen herum wie Zigeuner. Was ich nicht wusste<br />
war, dass mein Vater den Mann in unserem Rübenkeller<br />
versteckte. Dieser war klein, finster und hatte einen<br />
Lehmboden. Hier wurde der Flüchtling eingemauert,<br />
einige leere Fässer wurden vor der aus Steinen gemauerten<br />
Wand aufgestellt – das Versteck war fertig. Wie<br />
er seine Notdurft verrichtete und wie der Vater ihn mit<br />
Essen versorgte, weiß ich nicht mehr, aber dass meine<br />
Eltern damals ihr Leben riskierten, war oft Gesprächsthema<br />
bei uns daheim. Einige Wochen verbrachten sie<br />
bei uns, dann sind sie weitergezogen. Nach dem Krieg<br />
war ein Fleischhauer – sein Name war Hauswirt – bei<br />
uns untergebracht. Der kaufte Vieh und Schweine ein,<br />
schlachtete sie in unserer Presse, lud die Hälften auf<br />
einen Wagen und fuhr mit diesem Pferdefuhrwerk<br />
nach Wien. Eine Woche später war er wieder da und<br />
das Ganze begann von vorn. Unsere Situation wurde<br />
nach Kriegsende nicht wirklich besser. Der Satz „viel<br />
Arbeit und wenig Brot“ beschreibt es wohl am besten.<br />
Alles war kaputt, rundherum hat es hereingeregnet…<br />
als mir der Vater 1957 die Wirtschaft übergab, bekam<br />
ich eine Ruine und eine Wirtschaft, von der man<br />
nicht mehr leben konnte. Er hatte kein Geld und ich<br />
auch nicht. Im Jahr 1959 habe ich geheiratet und eine<br />
Zeit lang versuchten wir noch unser Glück als Bauern,<br />
158
aber schließlich und endlich blieb mir nichts Anderes<br />
übrig, als mein Glück im Tunnelbau zu versuchen. Ich<br />
ging nach Tirol, ins Kaunertal, dort verdiente ich das<br />
erste Mal in meinem Leben richtiges Geld. Meinen ersten<br />
Lohn verwendete ich dafür, das Dach provisorisch<br />
herzurichten, damit es zumindest nicht mehr hereinregnete.<br />
Die Arbeit machte mir nichts aus, da war ich<br />
von Zuhause Schlimmeres gewohnt, mir ging es nur<br />
darum, endlich etwas richten zu können. So arbeitete<br />
ich damals drei Monate durch und machte 101 Schichten.<br />
Das zahlte sich aus, denn unser Rhythmus war<br />
zehn Tage Schicht und fünf Tage Abgang, also Freitage.<br />
Arbeitete man den Abgang durch, hatte man kaum<br />
Abzüge. In jenen 12 Wochen verdiente ich genug, um<br />
mir meinen ersten Traktor, einen grünen Steyrer 15,<br />
kaufen zu können. Aber ein Traktor allein ist wie ein<br />
Ross ohne Zaumzeug, denn ohne Anhänger, Pflug und<br />
Egge konnte man mit dem Traktor nicht viel anfangen.<br />
Langsam aber sicher brachte ich auch das Geld für<br />
diese Hilfsmittel auf und versuchte sogar nebenbei<br />
als Wein- und Traubeneinkäufer für eine Leutschacher<br />
Firma mein Einkommen aufzubessern. Diese Aufgabe<br />
übernahm ich vom ehemaligen Kitzecker Bürgermeister<br />
Stiegler. Dafür wurden zur Lesezeit drei Wochen<br />
geopfert, in denen ich zwar daheim, aber nie zu Hause<br />
war. Auch der Ertrag unseres kleinen Weingartens<br />
wurde verkauft. Gut erinnere ich mich noch daran, wie<br />
meine Frau mit der Butte auf dem Rücken jede einzelne<br />
Traube herausgetragen hat. In den kommenden<br />
Jahren habe ich beim Tunnelbau noch viele Baustellen<br />
erlebt und war zwischenzeitlich noch als Holzknecht in<br />
der Obersteiermark tätig. Meine Nebenbeschäftigung,<br />
den Handel mit Trauben, gab ich 1969 auf. Damals war<br />
mit Trauben einfach kein Geld mehr zu verdienen und<br />
meine Frau und ich überlegten, was wir mit dem Ertrag<br />
unserer 700 Stöcke machen sollten. Sie meinte: „Tua<br />
wos du wüllst!“ – und ich tat es. Die Trauben wurden<br />
verpresst und ich machte den Wein so, wie ich es für<br />
richtig hielt, denn eine Ausbildung dazu hatten nur die<br />
wenigsten. In unserer Küche stellten wir einen Tisch<br />
auf und fünf Sessel dazu und der Buschenschank war<br />
fertig. Lange und gerne sind die Nachbarn bei uns gesessen.<br />
Oft war es so, dass meine Eltern sie bewirteten;<br />
irgendwann in der Nacht sind sie schlafen gegangen<br />
und meine Frau und ich sind aufgestanden, um<br />
weiterzumachen. Neben dem Tisch befand sich unser<br />
Kuchlherd, darauf wurde ein Stück Geselchtes gekocht<br />
und wenn jemand Hunger hatte, hob es meine Frau<br />
heraus, schnitt ein Stück ab, rieb einen Kren dazu und<br />
mit einem Stück Brot war die Jause komplett. Was mich<br />
am meisten überraschte war, dass es nur drei Monate<br />
dauerte, bis wir keinen Wein mehr hatten.<br />
Bald darauf habe ich unseren Obstgarten ausgegraben<br />
und neue Weinstöcke angepflanzt. Unser Schlafzimmer<br />
wurde der neue Buschenschankraum, wobei<br />
es seine ursprüngliche Aufgabe nicht verlor. Hinter<br />
einem Vorhang befanden sich unsere Betten, davor<br />
hatten wir jetzt schon drei Tische mit Sesseln. Langsam<br />
wurde es immer mehr, aber zum Daheimbleiben<br />
war es noch zu wenig. Einige Jahre hindurch verdiente<br />
ich als Viehhändler etwas Geld dazu und drei Jahre<br />
lang bin ich für einen Bäcker gefahren. Stück für Stück<br />
haben wir erweitert und unseren Weingarten vergrößert.<br />
Erst 1977 bin ich endgültig als Weinbauer daheimgeblieben,<br />
denn jetzt war es so, wie es sich der<br />
Vater immer gewünscht hatte: Unsere Familie konnte<br />
von der Landwirtschaft, die jetzt ein Weinbaubetrieb<br />
war, leben.<br />
159
Do bin i her!<br />
Wenn in da Friah die Sunn aufgeht,<br />
da Himml fost in Flamman steht,<br />
des Tol noch schloft, da Berg schon brennt,<br />
a jeda Vogl sein Namen nennt,<br />
dann gspia i mi so richtig rein:<br />
do bin i her, do mecht i sein.<br />
Wo des noch gschätzt wird wos ma hom,<br />
wo´s Brot noch is da Oabat Lohn,<br />
wo Mensch´n sich noch heit vatraun,<br />
die Jungan auf die Olt´n schaun,<br />
do geht des Herz auf, kloa und fein:<br />
do bin i her, do mecht i sein.<br />
Duat wogst die Reb´n am stalstn gwiss,<br />
da Soft daraus vull Herzbluat is,<br />
wo Sterzbam wochst umd a des Troa,<br />
fia umsa Wohl des gamzi Joah,<br />
duat schenk i ein a Glasal Wein:<br />
do bin i her, do mecht i sein.<br />
Wo stali Berg die Wolk´n streichln<br />
und sanfti Hügl dem Auge schmeichl´n,<br />
wo Wossa sich durch Täler senkt<br />
umd da Boden ums Reichtum schenkt,<br />
des Land der Steirea dein und mein:<br />
do bin i her, do mecht i sein.<br />
160