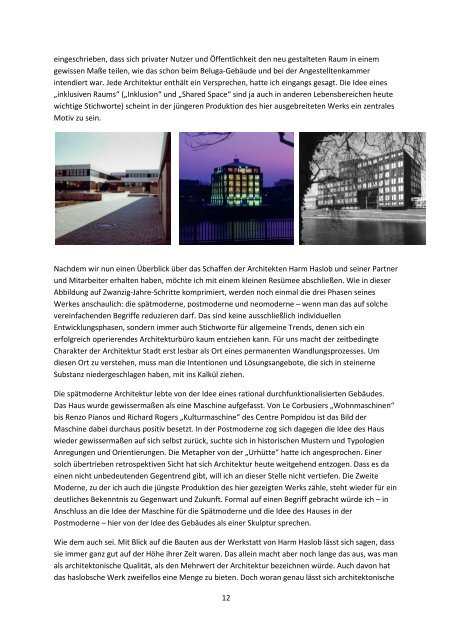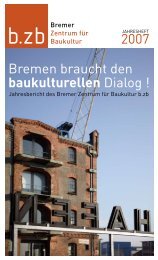Über den architektonischen Mehrwert - Bremer Zentrum für Baukultur
Über den architektonischen Mehrwert - Bremer Zentrum für Baukultur
Über den architektonischen Mehrwert - Bremer Zentrum für Baukultur
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
eingeschrieben, dass sich privater Nutzer und Öffentlichkeit <strong>den</strong> neu gestalteten Raum in einem<br />
gewissen Maße teilen, wie das schon beim Beluga-Gebäude und bei der Angestelltenkammer<br />
intendiert war. Jede Architektur enthält ein Versprechen, hatte ich eingangs gesagt. Die Idee eines<br />
„inklusiven Raums“ („Inklusion“ und „Shared Space“ sind ja auch in anderen Lebensbereichen heute<br />
wichtige Stichworte) scheint in der jüngeren Produktion des hier ausgebreiteten Werks ein zentrales<br />
Motiv zu sein.<br />
Nachdem wir nun einen <strong>Über</strong>blick über das Schaffen der Architekten Harm Haslob und seiner Partner<br />
und Mitarbeiter erhalten haben, möchte ich mit einem kleinen Resümee abschließen. Wie in dieser<br />
Abbildung auf Zwanzig-Jahre-Schritte komprimiert, wer<strong>den</strong> noch einmal die drei Phasen seines<br />
Werkes anschaulich: die spätmoderne, postmoderne und neomoderne – wenn man das auf solche<br />
vereinfachen<strong>den</strong> Begriffe reduzieren darf. Das sind keine ausschließlich individuellen<br />
Entwicklungsphasen, sondern immer auch Stichworte <strong>für</strong> allgemeine Trends, <strong>den</strong>en sich ein<br />
erfolgreich operierendes Architekturbüro kaum entziehen kann. Für uns macht der zeitbedingte<br />
Charakter der Architektur Stadt erst lesbar als Ort eines permanenten Wandlungsprozesses. Um<br />
diesen Ort zu verstehen, muss man die Intentionen und Lösungsangebote, die sich in steinerne<br />
Substanz niedergeschlagen haben, mit ins Kalkül ziehen.<br />
Die spätmoderne Architektur lebte von der Idee eines rational durchfunktionalisierten Gebäudes.<br />
Das Haus wurde gewissermaßen als eine Maschine aufgefasst. Von Le Corbusiers „Wohnmaschinen“<br />
bis Renzo Pianos und Richard Rogers „Kulturmaschine“ des Centre Pompidou ist das Bild der<br />
Maschine dabei durchaus positiv besetzt. In der Postmoderne zog sich dagegen die Idee des Haus<br />
wieder gewissermaßen auf sich selbst zurück, suchte sich in historischen Mustern und Typologien<br />
Anregungen und Orientierungen. Die Metapher von der „Urhütte“ hatte ich angesprochen. Einer<br />
solch übertrieben retrospektiven Sicht hat sich Architektur heute weitgehend entzogen. Dass es da<br />
einen nicht unbedeuten<strong>den</strong> Gegentrend gibt, will ich an dieser Stelle nicht vertiefen. Die Zweite<br />
Moderne, zu der ich auch die jüngste Produktion des hier gezeigten Werks zähle, steht wieder <strong>für</strong> ein<br />
deutliches Bekenntnis zu Gegenwart und Zukunft. Formal auf einen Begriff gebracht würde ich – in<br />
Anschluss an die Idee der Maschine <strong>für</strong> die Spätmoderne und die Idee des Hauses in der<br />
Postmoderne – hier von der Idee des Gebäudes als einer Skulptur sprechen.<br />
Wie dem auch sei. Mit Blick auf die Bauten aus der Werkstatt von Harm Haslob lässt sich sagen, dass<br />
sie immer ganz gut auf der Höhe ihrer Zeit waren. Das allein macht aber noch lange das aus, was man<br />
als architektonische Qualität, als <strong>den</strong> <strong>Mehrwert</strong> der Architektur bezeichnen würde. Auch davon hat<br />
das haslobsche Werk zweifellos eine Menge zu bieten. Doch woran genau lässt sich architektonische<br />
12