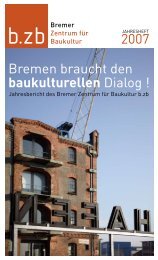Über den architektonischen Mehrwert - Bremer Zentrum für Baukultur
Über den architektonischen Mehrwert - Bremer Zentrum für Baukultur
Über den architektonischen Mehrwert - Bremer Zentrum für Baukultur
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sind einem Bauwerk nur bedingt anzusehen. Es bedarf der Vermittlung, der Erklärung, der<br />
Diskussion. Eine architektonische Werkschau ist in meinen Augen ein hervorragendes Mittel, diesen<br />
Diskurs herauszufordern, weil das präsentierte Werk sich in der Regel alles andere als homogen<br />
ausnimmt, sondern uns, wenn man es zu lesen versteht, etwas über die Entstehungszeit der<br />
einzelnen Bauwerke vermittelt und über die in sie eingeschrieben Wünsche und Lösungsvorschläge.<br />
Dadurch lässt sich nicht zuletzt das aktuelle Architekturgeschehen ein Stück weit relativieren und in<br />
eine hilfreiche kritische Distanz rücken.<br />
Da ich vermute, dass nicht alle der Anwesen<strong>den</strong> mit dem hier behandelten Werk ganz vertraut sind,<br />
möchte ich im Folgen<strong>den</strong> eine kleine Einführung in die Architekturproduktion geben, die unter dem<br />
Namen Harm Haslob in verschie<strong>den</strong>en Bürokonstellationen entstan<strong>den</strong> ist. Dabei werde ich<br />
versuchen, einzelne Werkphasen im Kontext der allgemeinen <strong>architektonischen</strong> wie<br />
gesellschaftlichen Entwicklungen zu verorten, die es nicht nur begleitet, sondern in vielen Aspekten<br />
auch bedingt haben. Grob gesagt lassen sich die Arbeiten in drei Abschnitte gliedern, die, wie könnte<br />
es anders sein, allgemeine Architekturentwicklungen widerspiegeln.<br />
Doch zunächst sollte die Sprache auf die individuellen Voraussetzungen kommen, die dem Werk<br />
zugrunde liegen. Die architektonische Gestalt besitzt ja immer auch eine biografische Dimension.<br />
Frühe Prägungen spielen dabei ein Rolle, bei Architekten aber in besonderem Maß auch das Studium.<br />
Da sich die Entscheidungen über die Gestalt eines Gebäudes kaum in einem klassisch<br />
wissenschaftlichen Sinn objektivieren lassen, sind in diesem Berufsfeld formale und inhaltliche<br />
Ideale, Wert- und Weltanschauungssysteme und so genannte „Schulen“ notwendig. Ein wichtiger Ort<br />
der Vermittlung solcher Orientierungsmuster sind die Hochschulen, beziehungsweise namhafte<br />
Architekten, die an Hochschulen lehren und bestimmte Ideen und Ideale verkörpern. Das Ergebnis<br />
der latenten Wertediskurse, <strong>den</strong>en sich ein Architekturstu<strong>den</strong>t aussetzen muss, um seine Entwürfe<br />
legitimieren zu können, ist im besten Sinn etwas, was man mit „Haltung“ und „Einstellung“ und<br />
formal mit einer bestimmten „Handschrift“ umschreiben könnte.<br />
Ein in diesem Sinn Einfluss gebender Bezugspunkt war bei Harm Haslob zunächst der Vater. Hermann<br />
Haslob war Architekt und Baudirektor in Bremen-Nord. Er hatte vor dem Krieg in Stuttgart studiert.<br />
Die so genannte Stuttgarter Schule, geprägt durch die Architekten Paul Bonatz und Paul<br />
Schmitthenner, vertrat eine antimodernistische Richtung im Bauen. In Bremen gab es zahlreiche<br />
Adepten dieser traditionalistischen Architekturhaltung. Friedrich Schumacher, Kurt Haering,<br />
Hermann Gildemeister, Hans Storm, Erik Schott, Friedrich Heuer und unter <strong>den</strong> jüngeren Gerhard<br />
Müller-Menckens – alles Architekten, die in Stuttgart ihre Ausbildung gemacht hatten und die in<br />
Bremen am Nachkriegsbaugeschehen maßgeblich beteiligt waren. Der Architekturstreit zwischen<br />
Traditionalisten und Modernisten erreichte in Bremen schließlich um 1960 mit dem Wettbewerb um<br />
das Haus der Bürgerschaft seinen Höhepunkt. Keine Frage, dass<br />
auch Hermann Haslob in diesem Streit auf der Seite der Tradition<br />
stand. Es war wohl weniger dieser architekturideologische<br />
Disput als die kreative Atmosphäre in einem<br />
Architektenhaushalt und das direkte sinnlich ansprechende<br />
Vorbild des schlichten und handwerklich soli<strong>den</strong> Einfamilienhauses,<br />
das der Vater in <strong>den</strong> späten vierziger Jahren <strong>für</strong> die<br />
Familie in St. Magnus gebaute hatte, was bei Harm Haslob schon früh <strong>den</strong> Wunsch geweckt hatte,<br />
auch Architekt zu wer<strong>den</strong>. Da ich kein Foto von diesem Haus habe, zeige ich eines aus der gleichen<br />
Zeit, das aus einer ähnlichen <strong>architektonischen</strong> Haltung heraus entstan<strong>den</strong> sein dürfte.<br />
2