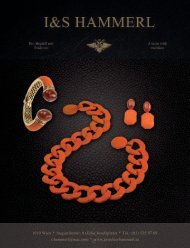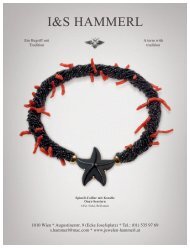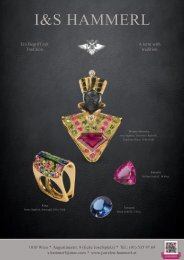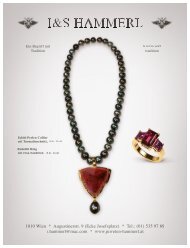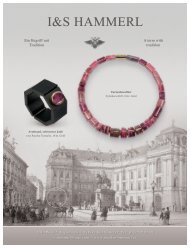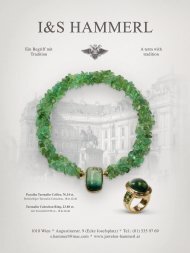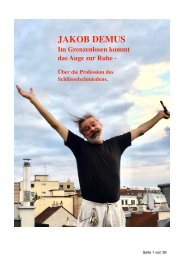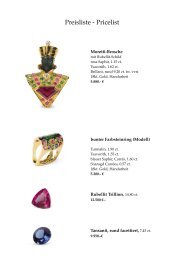Atellierbesuch bei Gerhard Häupler - Ein feature
Das floridsdorfer Gruselkabinett eines Post-Expressionisten oder die Kontinuität des Unfröhlichen
Das floridsdorfer Gruselkabinett eines Post-Expressionisten
oder die Kontinuität des Unfröhlichen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
schaffender, welcher dem Kunstwerk immer schon eigen ist, als Ar<strong>bei</strong>t in dem<br />
Sinne, etwas in die Welt zu setzen, was vorher nicht vorhanden war, und das<br />
grundsätzlich einmal ohne jegliche Wertung. Erst durch die Rezeption also entsteht<br />
überhaupt Schönheit, und damit kann man auch die These vertreten, Schönheit<br />
existiere lediglich im Auge des Betrachters. Das impliziert aber wiederum die<br />
Schwierigkeit, daß das Betrachtete durch den bloßen Schein von der Realität<br />
getrennt werden, will heißen, daß das, was uns so oder anders erscheint, nicht einmal<br />
als das Schöne an sich in den Blick kommt, sondern gefiltert durch die Art und<br />
Weise, wie es uns erscheint. Die Theorie der Ästhetik ist also letztlich eine<br />
Rezeptionsauffassung. Wenn dem aber so ist, kann das Schöne auch ein Produkt<br />
einer Täuschung sein oder zumindest höchst individuell und differenziert<br />
interpretiert werden. Oder anders gesagt: auch das Hässliche, das Un-Schöne hätte<br />
dann eine gewisse Legitimation, und diese These ist gar nicht einmal so neu, vertrat<br />
sie doch schonGotthold Ephraim Lessing im 18. Jahrhundert, dem schon die<br />
Faszinationskraft des Hässlichen nicht fremd war.<br />
Trotz allem: eine Theorie des Hässlichen ist an sich in der Kunstgeschichte noch nicht<br />
geliefert worden, obzwar auch schon lange bekannt, z.B. <strong>bei</strong> Friedrich Schlegel, daß<br />
das Schöne und das Hässliche zwei unzertrennliche Korrelate sind. Umberto Eco<br />
lieferte zwar ein vielbeachtetes Buch über die „Geschichte der Hässlichkeit“ und Karl<br />
Rosenkranz, ein Schüler Hegels, sprach sogar von einer „Ästhetik des Hässlichen“,<br />
doch ein Manko blieb da<strong>bei</strong> stets bestehen: daß das Hässliche immer nur in<br />
Abhängigkeit vom Begriff des Schönen stand, und deshalb auch der Versuch, ihn als<br />
„Negativ-Schönes“ zu definieren, das Hässliche immer noch nicht in seiner<br />
Eigenständigkeit erfasst war, es vielleicht auch nie sein könnte, und im 18. Jh.<br />
immer noch alleine als Kontrastmittel zum Begriff des Schönen herangezogen wurde.<br />
Wie es einen Willen zum Schein gibt, den ein Jahrhundert später Nietzsche und<br />
auch Schopenhauer als bewegende Kraft zur Re-Interpretation des Natürlichen als<br />
einzigem Zugang zur Realität für den Menschen generell als These in den Raum<br />
stellten, bezeichnete hingegen schon Rosenkranz ein „Wohlgefallen am Hässlichen“<br />
als krankhaft und damit Ausdruck eines durch und durch verderbten Zeitalters.<br />
Aber spätestens Friedrich Nietzsche, der an den Karthartesis-Begriff der antiken<br />
Tragödie im Geiste der Musik anknüpfte, fällt eine stärkere Gewichtung des<br />
Hässlichen auf, da er es sogar in seiner Strahlkraft (wohl des unerwarteten<br />
Überraschungseffektes wegen) über die des Schönen stellt. Und ist <strong>bei</strong> ihm auch<br />
erstmal von etwas Neuem zu lesen: dem Begriff der Lust, der da<strong>bei</strong> eine Rolle<br />
spielt, so wie schon im tragischen Schauspiel der Antike das Hässliche und<br />
Disharmonische mitunter dadurch eingesetzt werden, um die Seele einerseits<br />
aufzurütteln, andererseits aber auch, um durch diese Spannung eine Art Lust <strong>bei</strong>m<br />
Seite 6 von 67