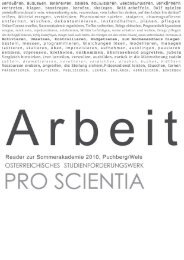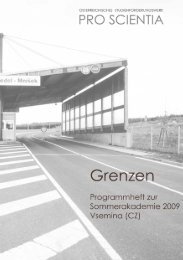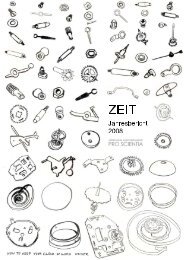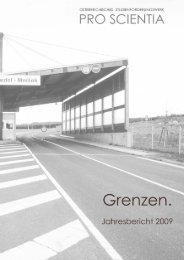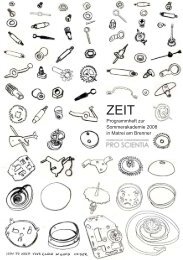ZEIT - Pro Scientia
ZEIT - Pro Scientia
ZEIT - Pro Scientia
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
von niederen zu höheren (=komplexeren)<br />
Lebewesen in zeitlicher Abfolge der<br />
geologischen Schichten.<br />
b) Evolution im Sinne der (neo-) darwinistischen<br />
Theorie. ist ein wissenschaftliches Modell, wovon<br />
es bisweilen - wie bei jeder anderen Theorie -<br />
Varianten gibt. Eine wissenschaftliche Theorie<br />
kann für sich niemals einen absoluten<br />
Wahrheitsanspruch erheben. Sie muss sich einer<br />
ständigen Prüfung stellen (Verifikation –<br />
Falsifikation). Aufgrund geänderter Hypothesen<br />
und neuer Grundsätze nähert sich eine Theorie<br />
– durch ständige „Evolution“ – asymptotisch<br />
einem Modell, das die Wirklichkeit getreu<br />
reproduzieren soll. (Anmerkung: Lehrsätze, die<br />
nicht in Frage gestellt werden dürfen, auch<br />
wenn sie offensichtlich nicht durch<br />
Beobachtungen gestützt bzw. anhand von<br />
Gegenbeispielen widerlegt werden, nennt man<br />
Dogmen.)<br />
Der Evolutionsbegriff muss je nach Zusammenhang<br />
unterschieden werden, um Missverständnisse zu<br />
vermeiden. Zur Bedeutung dieser Unterscheidung siehe<br />
später.<br />
Aus Sicht der Thermodynamik verläuft die Evolution des<br />
Lebens scheinbar gegen den Strom der Irreversibilität<br />
(=Entropieverlauf). D. h. die Natur scheint höhere<br />
Ordnungen anstatt die absolute Unordnung, nämlich das<br />
thermische Gleichgewicht, anzustreben. Das widerspricht<br />
dem Zeitpfeil der Physik.<br />
Eine Aussage, die häufig zu finden ist, lautet: Die<br />
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten neuer, aber<br />
überlebensfähiger Arten ist zwar gering, doch muss<br />
Evolution über viele Jahrtausende hinweg und in kleinen<br />
kontinuierlichen Schritten betrachtet werden. Bei dieser<br />
Betrachtung treten zunächst mindestens zwei<br />
Schwierigkeiten auf:<br />
1) Statistisch gesehen wird die Wahrscheinlichkeit eines<br />
Ereignisses nicht durch die Häufigkeit des „Würfelns“ (der<br />
Messung) beeinflusst. Wenn ein Ereignis heute sehr<br />
unwahrscheinlich ist (z.B. 20x hintereinander eine „5“ zu<br />
würfeln), wird es auch nach einem Millennium sehr<br />
unwahrscheinlich sein. Ein beliebtes Beispiel - in Analogie<br />
zum Informationsgehalt des DNA-Codes - beschreibt<br />
einen 24 Stunden täglich Schreibmaschine tippenden<br />
Schimpansen (als Zufallsgenerator). Auch nach<br />
Jahrmillionen wird weder ein Vers von Shakespeare noch<br />
von Goethe zu erwarten sein.<br />
2) In der Betrachtung der tatsächlichen<br />
Fossildokumentation, fasst der Biologe Stephan Jay Gould<br />
[19] folgende zwei Merkmale der Paläoontologie<br />
zusammen:<br />
� Stillstand (Stasis): Nach Auftreten einer neuen Art sind<br />
morphologische Veränderungen für gewöhnlich<br />
beschränkt und richtungslos.<br />
� Plötzliches Auftreten: Neue Arten treten sprunghaft<br />
und „voll gestaltet“ auf. Das prominenteste Beispiel ist<br />
wohl die so genannte „Kambrische Explosion“ (vor rund<br />
540 Mil. Jahren), gerne auch als biologischer „Big Bang“<br />
bezeichnet. [20] Siehe Abbildung A3.<br />
Erdgeschichte, Evolution und Lebenszeit<br />
Zeit und Evolution<br />
25<br />
Fossildokumentation schematisch [aus A3]<br />
Diese empirischen Merkmale stimmen nur ungenügend<br />
mit der theoretischen Voraussage einer „glatten“<br />
kontinuierlichen Evolution mit fließendem Übergang<br />
zwischen den Arten überein.<br />
Es stellt sich die Frage, ob die Biologie ohne eine<br />
grundlegende Bezugnahme auf mikroskopische Physik<br />
das Phänomen des Lebens und damit der Evolution in<br />
vollem Umfang erklären kann. Laut Dürr [15] könnte die<br />
Quantenphysik durch ihr prinzipielles Merkmal der<br />
holistischen Beziehungen neue Möglichkeiten im<br />
Verständnis der Evolution eröffnen.<br />
Interdisziplinäre Herausforderungen im 21. Jahrhundert<br />
Weitere offene Fragen im Zusammenhang zwischen<br />
Naturgesetz und Evolution stellen Herausforderungen an<br />
die heutige interdisziplinäre Forschung:<br />
�Lässt sich die Verletzung der Entropie in der Entstehung<br />
des Lebens und dessen Evolution durch Theorien der<br />
„Selbstorganisation“ [21] ausreichend erklären?<br />
�Verliert das Pasteur’sche Prinzip „Omne vivum ex vivo“<br />
(Leben kommt von Leben) zum Zeitpunkt der Entstehung<br />
des ersten Lebens seine Gültigkeit? [22] Oder: Wie lässt<br />
sich der Sprung vom Anorganischen zum Organischen,<br />
vom Toten zum Lebendigen erklären?<br />
�Lassen sich Eigenschaften des Lebens wie „der Wille<br />
zum Leben“, Instinkt oder gar Bewusstsein auf materieller/<br />
molekularer Grundlage erklären? Oder: Wo liegen die<br />
Grenzen des „physikalischen Reduktionismus“?<br />
�Bilden die Arten „quantisierte Zustände“, gleich wie die<br />
diskreten Energienieveaus der Elektronen? Wäre das ein<br />
Grund, warum Evolution in diskreten Schritten statt einem<br />
kontinuierlichen Fluss auftritt?<br />
� Muss der Energieerhaltungssatz mit einen<br />
Informationserhaltungssatz ergänzt werden um damit<br />
den sogenannten gefürchteten „Maxwellschen Dämon“<br />
[23] zu vermeiden?<br />
�Ist die Theorie der Selbstorganisation ausreichend um<br />
irreduzierbar komplexe [24] Systeme wie den DNA-RNA<br />
Zyklus [25] zu „kreieren“ und ist der Mensch daher<br />
befähigt aus toter Materie Leben zu schaffen?