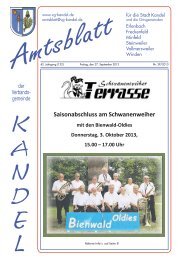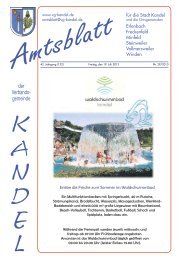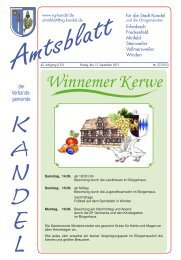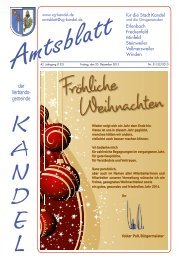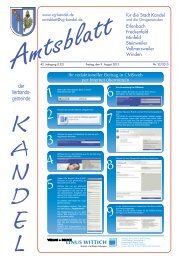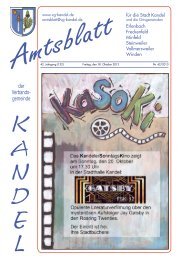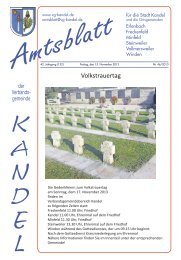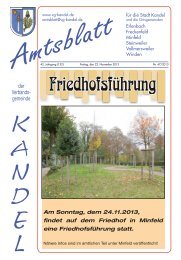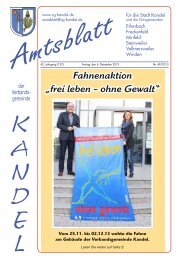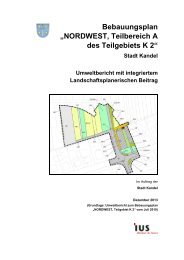NORDWEST, Teilbereich K 2 - Verbandsgemeinde Kandel
NORDWEST, Teilbereich K 2 - Verbandsgemeinde Kandel
NORDWEST, Teilbereich K 2 - Verbandsgemeinde Kandel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bebauungsplan<br />
„<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“<br />
Stadt <strong>Kandel</strong><br />
Umweltbericht mit integriertem<br />
Landschaftsplanerischen Beitrag<br />
Im Auftrag der<br />
Stadt <strong>Kandel</strong><br />
Mai 2011<br />
(Aktualisierung des Umweltberichts vom Juli 2010)
Projektleitung:<br />
Dipl. Biol. Uwe Weibel<br />
Projektbearbeitung:<br />
Dipl. Ing. Monika Langer<br />
(Landschaftsarchitektin BDLA)<br />
unter Mitarbeit von:<br />
Dipl. Biol. Christian Wettstein<br />
Projekt-Nr. 2767<br />
Humboldtstr. 15 A • 76870 <strong>Kandel</strong><br />
Tel.: 07275-95710 • Fax: 07275-957199<br />
e-mail: kandel@weibel-ness.de
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Inhalt<br />
1 Einleitung 1<br />
1.1 Anlass und rechtliche Grundlagen 1<br />
1.2 Methodik und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 2<br />
1.3 Lage und Größe des Plangebiets 3<br />
1.4 Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 5<br />
1.5 Wesentliche fachgesetzliche und fachplanerische Umweltschutzziele und deren<br />
Berücksichtigung im Bebauungsplan 7<br />
1.5.1 Fachgesetzliche Umweltschutzziele 7<br />
1.5.2 Fachplanerische Umweltschutzziele 9<br />
2 Bestandsaufnahme des Umweltzustands (Schutzgüter) 11<br />
2.1 Tiere und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt) 11<br />
2.1.1 Vegetation 11<br />
2.1.2 Tierwelt 18<br />
2.1.3 Bioökologische Bedeutung 21<br />
2.2 Boden 31<br />
2.3 Wasser 33<br />
2.3.1 Oberflächengewässer 33<br />
2.3.2 Grundwasser 33<br />
2.4 Klima/ Luft 35<br />
2.5 Landschaft (Landschafts- und Stadtbild) 37<br />
2.6 Mensch/ Bevölkerung (Gesundheit und Erholung/ Freizeit) 39<br />
2.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 40<br />
2.8 Wirkungsgefüge bzw. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 41<br />
3 Wirkungsprognose (Umweltprüfung) 43<br />
3.1 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung (Status quo-<br />
Prognose) 43<br />
3.2 Voraussichtliche, erhebliche Umweltauswirkungen der Planung 43<br />
3.2.1 Auswirkungen der Planung auf Tiere und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt) 45<br />
3.2.2 Auswirkungen der Planung auf den Boden 50<br />
3.2.3 Auswirkungen der Planung auf das Wasser 51<br />
3.2.4 Auswirkungen der Planung auf das Klima/ die Luft sowie auf Mensch/ Bevölkerung<br />
(Gesundheit) 53<br />
3.2.5 Auswirkungen der Planung auf die Landschaft sowie auf Mensch/ Bevölkerung<br />
(Erholung/ Freizeit) 55<br />
3.2.6 Auswirkungen der Planung auf Kultur- und sonstige Sachgüter 56<br />
Seite<br />
I
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
4 Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie Vorschläge zum<br />
Monitoring 58<br />
4.1 Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen 58<br />
4.2 Landschaftspflegerische und grünordnerische Festsetzungen zur Integration in den<br />
Bebauungsplan 61<br />
4.3 Begründung der landschaftspflegerischen und grünordnerischen Festsetzungen 75<br />
4.3.1 Flächen mit Pflanzbindungen und Pflanzgeboten gemäß § 9 (1) Nr. 25 BauGB 75<br />
4.3.2 Maßnahmen/ Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung<br />
von Boden, Natur und Landschaft 78<br />
4.3.3 Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 81<br />
4.3.4 Empfehlungen zu bauordnungsrechtlichen und baugestalterischen Festsetzungen 82<br />
4.4 Maßnahmenvorschläge für das Monitoring 82<br />
5 Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich (Bilanz) 83<br />
5.1 Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich (Bilanz) 83<br />
5.2 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativenprüfung) 93<br />
6 Zusammenfassung 94<br />
7 Literatur 99<br />
Anhang 102<br />
Anhang 1: Bioökologisches Potential: Wertstufen und Bewertungskriterien 102<br />
II<br />
Seite
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Verzeichnis der Abbildungen<br />
Abbildung 1: Lage des Geltungsbereiches des Bebauungsplans „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong><br />
K 2“, Stadt <strong>Kandel</strong> 4<br />
Abbildung 2: Breite Baum-Strauch-Hecke und Feldgehölze erfüllen eine Vielzahl von<br />
Lebensraumfunktionen für die heimische Tierwelt 19<br />
Verzeichnis der Tabellen<br />
Tabelle 1: Nach BauGB zu berücksichtigende Umweltbelange und ihre Zuordnung<br />
zu den jeweiligen Schutzgütern bzw. Kapiteln des Umweltberichts 2<br />
Tabelle 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet 22<br />
Tabelle 3: Schutzgutbezogene Zusammenstellung von Wechselwirkungen 41<br />
Tabelle 4: Bewertung von Eingriff und Ausgleich 84 - 89<br />
Tabelle 5: Flächenbilanzierung des Eingriffs in das Schutzgut Tiere und Pflanzen<br />
(inkl. biologische Vielfalt) im Plangebiet „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“ 91<br />
Tabelle 6: Flächenbilanzierung der Aufwertung im Hinblick auf das Schutzgut Tiere<br />
und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt) im Bereich der Ökokonto-Fläche<br />
in der Erlenbach-/ Flutgrabenniederung - Flurstück Nr. 6068, Gemarkung<br />
Steinweiler 92<br />
Verzeichnis der Pläne (als Beilage)<br />
Plan Nr. 1.1: Bestand: Realnutzung und Biotoptypen M. 1:1.500<br />
Plan Nr. 2.1: Landespflegerische und grünordnerische Festsetzungen zur Integration<br />
in den Bebauungsplan M. 1:1.000<br />
Seite<br />
III
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
IV
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
1 Einleitung<br />
1.1 Anlass und rechtliche Grundlagen<br />
Die Stadt <strong>Kandel</strong> beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Nord-<br />
West“ die Ausweisung von Wohnbauflächen am nordwestlichen, derzeit landwirtschaftlich<br />
genutzten Ortsrand. Das Baugebiet ist durch die Bahnstrecke „Karlsruhe<br />
- Landau“ in zwei <strong>Teilbereich</strong>e („Nord-West B“ und „K 2“) gegliedert, die sich auch<br />
strukturell (u. a. hinsichtlich Topographie) voneinander unterscheiden. Aufgrund<br />
der Größe des Gebiets (insg. ca. 37,4 ha) ist eine abschnittsweise Realisierung<br />
des Baugebiets vorgesehen. Im ersten Abschnitt soll das westlich der Bahntrasse<br />
gelegene Teilgebiet „K 2“ realisiert werden. Bestandteil des Bebauungsplan-Verfahrens<br />
ist zudem die Weiterführung der vom südwestlich angrenzenden Neubaugebiet<br />
„Am Höhenweg“ kommenden Ortsrandstraße in Richtung Landauer Straße<br />
(L 542) - vorliegend bis auf Höhe der am Ostrand des Plangebiets liegenden Bahntrasse.<br />
Nach § 2a BauGB (Baugesetzbuch vom 23.09.2004, BGBl. I Seite 2414/2415 zzgl.<br />
Änderungen) hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans<br />
eine Begründung beizulegen, die neben den Zielen, Zwecken und wesentlichen<br />
Auswirkungen des Plans auch - als gesonderten Teil - einen Umweltbericht<br />
enthält. In ihm werden die aufgrund der Umweltprüfung ermittelten und bewerteten<br />
Belange des Umweltschutzes dargelegt 1 . Die Belange des Umweltschutzes,<br />
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in § 1 Abs. 6<br />
Nr. 7 sowie in § 1a BauGB benannt 2 . Die Inhalte des Umweltberichts sind in einer<br />
Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB geregelt und entsprechend anzuwenden.<br />
Mit dem vorliegenden, integrierten Landschaftsplanerischen Beitrag erfolgt zudem<br />
die in § 1a Abs. 3 BauGB geforderte Einbringung der landespflegerischen Belange<br />
in die Bauleitplanung (insb. Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz<br />
- BNatSchG), die in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen sind.<br />
Im Umweltbericht/ Landschaftsplanerischen Beitrag werden darüber hinaus die artenschutzrechtlichen<br />
Vorgaben gemäß §§ 44ff. BNatSchG (Zugriffsverbote im Hinblick<br />
auf europäische Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie<br />
92/43/EWG) berücksichtigt. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt ein Verstoß gegen<br />
− das unvermeidbare Nachstellen, Fangen, Verletzen oder Töten von wild lebenden europäischen<br />
Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie oder die Entnahme,<br />
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen,<br />
− die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der<br />
wild lebenden, europäischen Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie<br />
bzw.<br />
1 § 2 Abs. 4 BauGB: Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a wird<br />
eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen<br />
ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.<br />
2 Die genannten Belange sind in die Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB einzustellen.<br />
Seite 1
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 2<br />
− die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Individuen oder Standorten wild lebender<br />
Pflanzen des Anhang IV der FFH-Richtlinie<br />
nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen<br />
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin<br />
erfüllt wird. Soweit erforderlich können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen<br />
festgesetzt werden. Darüber hinaus dürfen wild lebende europäische Vogelarten<br />
und Arten des Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG während ihrer Fortpflanzungs-,<br />
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten nicht erheblich<br />
gestört werden; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung<br />
der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Ausnahmen<br />
von den Verboten des § 44 BNatSchG sind nur in Einzelfällen möglich und darüber<br />
hinaus nur, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand<br />
der Populationen einer Art nicht verschlechtert.<br />
Grundlage des vorliegenden Gutachtens ist der bereits im Juli 2010 durch das Ius<br />
auf der Basis des Entwurfs des Bebauungsplans von Wsw & Partner GmbH (Stand<br />
Juni 2010) erstellte Umweltbericht mit integriertem Landschaftsplanerischen Beitrag.<br />
Dieser wird vorliegend aufgrund der Änderungen, die sich zwischenzeitlich im<br />
Nachgang der 1. Offenlage in der Bebauungsplanung ergeben haben, vor allem<br />
hinsichtlich der Wirkungsprognose (siehe Kap. 3), der Vermeidungs-, Verringerungs-<br />
und Ausgleichsmaßnahmen inkl. Vorschlägen zum Monitoring (siehe Kap.<br />
4) sowie der Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich (siehe Kap. 5) aktualisiert.<br />
1.2 Methodik und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der<br />
Unterlagen<br />
Die inhaltliche Gliederung des vorliegenden Umweltberichts orientiert sich an den<br />
oben genannten gesetzlichen Vorgaben. Aufgrund der weitreichenden inhaltlichen<br />
Überschneidungen mit den im Rahmen des Landschaftsplanerischen Beitrags zu<br />
erarbeitenden Aspekten erfolgt vorliegend eine integrierte Bearbeitung der beiden<br />
Gutachten.<br />
Die Umweltbelange, die als Gegenstand der Umweltprüfung bei der Aufstellung<br />
des Bebauungsplans zu berücksichtigen sind (siehe oben), werden im vorliegenden<br />
Umweltbericht folgenden Schutzgütern zugeordnet bzw. in folgenden Kapiteln<br />
thematisch näher betrachtet:
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Tab. 1: Nach BauGB zu berücksichtigende Umweltbelange und ihre Zuordnung zu den<br />
jeweiligen Schutzgütern bzw. Kapiteln des Umweltberichts<br />
Umweltbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) – i), und § 1a BauGB Abs. 2 und 3 Zugeordnete Schutzgüter/ Kapitel<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB:<br />
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge<br />
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b) BauGB:<br />
Erhaltungsziele und Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der<br />
Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 c) BauGB:<br />
Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 d) BauGB:<br />
Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 e) BauGB:<br />
Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f) BauGB:<br />
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 g) BauGB:<br />
Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-<br />
, Abfall- und Immissionsschutzrechts<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 h) BauGB:<br />
Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung<br />
zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten<br />
Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i) BauGB:<br />
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben<br />
a, c und d<br />
§ 1a Abs. 2 BauGB:<br />
sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden<br />
§ 1a Abs. 2 BauGB:<br />
Verringerung der zusätzlichen Flächeninanspruchnahme durch bauliche Nutzungen durch<br />
Nutzung der Möglichkeiten zur Wiedernutzbarmachung von Flächen, zur Nachverdichtung<br />
und anderer Maßnahmen zur Innenentwicklung<br />
§ 1a Abs. 2 BauGB:<br />
Begrenzung der Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß<br />
§ 1a Abs. 3 BauGB:<br />
Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds<br />
sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (Eingriffsregelung)<br />
• Schutzgut Tiere, Pflanzen (inkl. biologische<br />
Vielfalt)<br />
• Schutzgut Boden<br />
• Schutzgut Wasser<br />
• Schutzgut Luft/ Klima<br />
• Schutzgut Landschaft<br />
• Schutzgut Tiere, Pflanzen (inkl. biologische<br />
Vielfalt)<br />
• Schutzgut Mensch/ Bevölkerung<br />
• Schutzgut Kulturgüter/ sonstige Sachgüter<br />
• Schutzgut Boden<br />
• Schutzgut Luft/ Klima<br />
• Schutzgut Mensch/ Bevölkerung<br />
• Schutzgut Luft/ Klima<br />
• Schutzgut Mensch/ Bevölkerung<br />
• Kap. 1.6, 2<br />
• Schutzgut Luft/ Klima<br />
• Kap. 1.6<br />
• Schutzgut Tiere, Pflanzen (inkl. biologische<br />
Vielfalt)<br />
• Schutzgut Boden<br />
• Schutzgut Wasser<br />
• Schutzgut Luft/ Klima<br />
• Schutzgut Landschaft<br />
• Schutzgut Mensch/ Bevölkerung<br />
• Schutzgut Kulturgüter/ sonstige Sachgüter<br />
• Schutzgut Boden<br />
• Kap. 4, 5<br />
• Kap. 4, 5<br />
• Schutzgut Boden<br />
• Kap. 4, 5<br />
• Kap. 4, 5<br />
Hinsichtlich der Beurteilung von Auswirkungen geplanter Vorhaben stellt sich die<br />
Frage nach den Grenzen der Belastbarkeit von Natur und Landschaft. Wissenschaftlich<br />
bis ins letzte Detail begründete Bedarfswerte des Natur- und Umweltschutzes<br />
und Belastbarkeitsgrenzen liegen aufgrund der Komplexität des ökosystemaren<br />
Beziehungsgefüges i. d. R. nicht vor. Vorhandene Erkenntnisse reichen<br />
jedoch aus, um für die Planungspraxis hinreichend fundierte Umweltleitziele<br />
zu benennen, was in vielfältiger Weise und auf verschiedenen Ebenen bereits geschehen<br />
ist. Auf lokaler Ebene wurden bisher keine Umwelthandlungszielen bzw.<br />
ein Indikatorensystem zur Zielkonkretisierung und Erfolgskontrolle entwickelt.<br />
Seite 3
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 4<br />
Bezüglich der Beschreibung der Nullvariante bestehen generell Prognoseunsicherheiten,<br />
die auf derzeit nicht absehbaren Entwicklungen basieren.<br />
Der Untersuchungsumfang, die Untersuchungsmethoden und der Detaillierungsgrad<br />
des vorliegenden Umweltberichts wurden insbesondere mit der Unteren Naturschutzbehörde<br />
der Kreisverwaltung Germersheim abgestimmt.<br />
1.3 Lage und Größe des Plangebiets<br />
Das Plangebiet liegt nordwestlich Ortslage von <strong>Kandel</strong> im Bereich des Hubhofweges<br />
(siehe Abbildung 1). Es wird im Osten durch die ± in Nord-Südrichtung verlaufende,<br />
nach Winden führende Bahntrasse begrenzt. Im Norden und Westen grenzen<br />
Landwirtschaftsflächen an. Im Süden schließt sich Wohnbebauung an (Neubaugebiet<br />
„Am Höhenweg“ bzw. Bebauung an der Hubstraße/ Stresemannstraße).<br />
Die Größe des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong><br />
K 2“ beträgt rund 12,5 ha.<br />
Das Plangebiet ist Teil der Niederterrasse der nördlichen Oberrheinebene bzw. der<br />
naturräumlichen Haupteinheit „Vorderpfälzer Tiefland" (INSTITUT FÜR LANDES-<br />
KUNDE 1969). Es liegt im Süden der geomorphologischen Untereinheit „<strong>Kandel</strong>er<br />
Lößriegel“ (Einheit Nr. 221.20). Beim „<strong>Kandel</strong>er Lößriegel“ handelt es sich um einen<br />
nach Osten spitz zulaufenden, an der Oberfläche welligen, lößbedeckten Riedel.<br />
Er ist von den Rändern zum Zentrum hin 20 - 30 m hoch aufgewölbt, wobei die<br />
Oberfläche ± stark eingedellt ist. Dazwischen verlaufen zumeist flache Buckel.<br />
Vorwiegend bestimmt Ackerbau die Nutzung des Riedels (a.a.O.).<br />
Das Plangebiet liegt auf einer Höhe von etwa 138 - 126 m ü.NN. Die höchst gelegenen<br />
Flächen (Höhenlinie 138 m ü.NN) befinden sich im Südwesten des Plangebiets<br />
und zwar nördlich des Höhenwegs bzw. der Straße „Am Höhenweg“; von dort<br />
aus fällt das Gelände sowohl nach Osten (in Richtung Bahntrasse), nach Süden/<br />
Südosten (in Richtung Stresemann-/ Hubstraße) als auch nach Norden/ Nordosten<br />
ab. In Richtung Süden/ Südosten liegt das Gefälle liegt das Durchschnittsgefälle<br />
bei 7,0 %, das Höchstgefälle bei 15,0 %. Nach Norden/ Nordosten beträgt das Gefälle<br />
ca. 1,4 %, am nordöstlichen Rand wird eine Höhe von etwa 133 m ü.NN erreicht.<br />
Das Gelände ist hier schwach wellig (bspw. flache Senken südlich des<br />
Sodgrundwegs). Die nördliche Verlängerung der Hubstraße verläuft in einem kurzen<br />
Abschnitt als Hohlweg, der gegenüber der Umgebung bis ca. 4 m eingetieft ist.<br />
Die östlich an das Plangebiet angrenzende Bahntrasse liegt ebenfalls im Einschnitt;<br />
die Tiefe des Einschnitts ist im südlichen und mittleren Abschnitt am größten<br />
und verringert sich in Richtung Norden zunehmend. Auf Höhe der Querung der<br />
Guttenbergstraße ist der Einschnitt etwa 8 m tief; am Nordrand des Plangebiets<br />
beträgt die Tiefe nur noch ca. 3 - 4 m.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Abb. 1: Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“,<br />
Stadt <strong>Kandel</strong> (Ausschnitt aus TK 25 Blatt Nr. 6915, verkleinert)<br />
1.4 Inhalte und Ziele des Bebauungsplans<br />
Gemäß Entwurf des Bebauungsplans (WSW & PARTNER GMBH, Stand Mai 2011)<br />
wird das Plangebiet als „Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt, in dem frei stehende<br />
Einfamilienhäuser und Doppelhäuser entstehen sollen. Für das „Allgemeine<br />
Wohngebiet“ werden eine GRZ von 0,4, eine GFZ von 0,8 sowie maximale Firsthöhen<br />
von 9,50 m bzw. 11,00 m (im Süden/ Südosten) mit offener Bauweise festgelegt.<br />
Die baurechtlich mögliche Überschreitung der Grundflächenzahl um 0,1<br />
bzw. bei der Errichtung von Doppelhäusern (mit Grundstücksgröße < 320 m 2 ) oder<br />
einer innerhalb der Wohngebiete zulässigen gewerblichen Nutzung, die mit einem<br />
zusätzlichen Stellplatzbedarf verbunden ist, um bis zu 0,2 ist zulässig. Die Firstrichtung<br />
der Gebäude orientiert sich am Verlauf der zugehörigen Erschließungsstraße<br />
(vorwiegend senkrecht, teils auch parallel dazu, geringfügige Abweichungen<br />
sind zulässig). Für die Hauptgebäude zulässige Dachformen sind Satteldach,<br />
Krüppelwalmdach und versetztes Pultdach; die Dachneigungen liegen zwischen<br />
30° und 45°. Für Garagen, Carports und untergeordnete Nebengebäude sind auch<br />
geringere Dachneigungen zulässig. Die Dächer sind mit roten bis rotbraunen Ton-<br />
und Betondachsteinen zu versehen. Für untergeordnete Dachteile sind auch andere<br />
Materialen zugelassen.<br />
Im Süden des Plangebiets wird zudem eine Gemeinbedarfsfläche zur Errichtung<br />
eines Kindergartens festgesetzt.<br />
Die Haupterschließung des neuen Baugebiets erfolgt zum einen über die geplante<br />
Ortsrandstraße, die im Westen bzw. Norden an die neue Bebauung angrenzt und<br />
vorerst bis zur kreuzenden Bahntrasse geführt wird; zum anderen wird die Hubstraße<br />
in Richtung Norden/ Nordwesten verlängert und dann ebenfalls an die Orts-<br />
Seite 5
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 6<br />
randstraße angebunden. Die neue Verbindungsstraße Hubstraße - Ortsrandstraße<br />
dient auch der Anbindung der alten Ortslage an die Ortsrandstraße. Die Gesamtquerschnittsbreite<br />
der Ortsrandstraße beträgt 16,50 m, im Bereich von Aufweitungen<br />
(Linksabbiegespur) 19,50 m. Zur Bebauung hin ist straßenbegleitend eine 2,5<br />
m hohe Lärmschutzwand vorgesehen. Die Verlängerung der Hubstraße wird eine<br />
Querschnittsbreite von 14,5 m aufweisen. Im Norden des Plangebiets wird zudem<br />
eine Verbindungsstraße zwischen der Guttenbergstraße und der Ortsrandstraße<br />
hergestellt. Die Anbindung über das bestehende Brückenbauwerk über die Bahntrasse<br />
wird als Anliegerstraße ausgewiesen.<br />
Die innere Erschließung des Neubaugebiets erfolgt durch eine ringförmige Sammel-<br />
und davon abzweigende Stichstraßen (Wohnstraßen). Die Querschnittsbreite<br />
der Sammelstraße liegt bei 9,00 m, in verengten Bereichen bei 7,00 m. Die Stichstraßen<br />
weisen je nach Länge und Funktion eine Breite von 6,50 m bzw. 4,50 m<br />
auf. Abgesehen von den Anliegerwohnstraßen sind bei allen inneren Erschließungsstraßen<br />
Gehwege vorgesehen; Grünstreifen sind hier nicht geplant. Abschnittsweise<br />
werden jedoch Parkplätze im Straßenraum angeordnet. Von den<br />
Stichstraßen führen Fußwege (Querschnittsbreite 2,50 m) in die im Zentrum des<br />
Plangebiets gelegene Grünfläche. Zum Teil sind diese auch als 3,5 m breite notbefahrbare<br />
Wohnwege ausgewiesen. Darüber hinaus wird das bestehende landwirtschaftliche<br />
Wegesystem an die neuen Verkehrstrassen angebunden.<br />
Das Baugebiet wird im Trennsystem entwässert werden. Aufgrund des anstehenden,<br />
nur wenig durchlässigen Untergrunds (kf-Werte 1 x 10 -7 bis 6 x 10 -9 ) sollen<br />
gemäß der entwässerungstechnischen Vorplanung (WSW & PARTNER GMBH, April<br />
2008) die Regenwasserabflüsse in Grabensysteme eingeleitet bzw. in im Gebiet<br />
liegende Retentionsmulden abgeleitet und dort zurückgehalten werden (flächige<br />
Retention). Die Anbindung eines Notüberlaufs/ Drosselabflusses an den bestehenden<br />
Regenwasserkanal in der Hubstraße ist möglich. Des weiteren wird empfohlen,<br />
das auf den Privatgrundstücken anfallende Oberflächenwasser vorzugsweise<br />
in Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser zu nutzen.<br />
Die im Zentrum bzw. am Rande der neuen Bebauung angeordneten Grünbereiche<br />
(öffentliche Grünflächen) sollen je nach Funktion als Park-/ Spielbereiche und/ oder<br />
Retentionsflächen gestaltet werden. Die Freiflächen dienen auch der Umsetzung<br />
von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen. Im Südwesten verbleibt ein bestehender<br />
Garten als private Grünfläche.<br />
Am Rande der Bahntrasse wird auf Höhe des zukünftigen Haltepunkts/ Brückenbauwerks<br />
eine überbaubare Fläche (bspw. zur Anlage einer Treppe, eines Aufzugsturms<br />
o. ä.) vorgehalten.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
1.5 Wesentliche fachgesetzliche und fachplanerische Umweltschutzziele<br />
und deren Berücksichtigung im Bebauungsplan<br />
1.5.1 Fachgesetzliche Umweltschutzziele<br />
• Schutzgebiete, pauschal geschützte Biotope bzw. besonders/ streng geschützte<br />
Arten nach dem Landesnaturschutzgesetz bzw. dem Bundesnaturschutzgesetz<br />
Für das Plangebiet und umgebende Flächen bestehen keine naturschutzrechtlichen<br />
Schutzgebietsausweisungen. Gebiete des europäischen Netzes „NATURA<br />
2000“ liegen ≥ 1 km nördlich (Erlenbachniederung nördlich von Minderslachen)<br />
bzw. ≥ 0,5 km südlich (Bruchbach-Otterbachniederung südlich der Saarstraße) des<br />
Plangebiets (Vogelschutzgebiet „Bienwald und Viehstrichwiesen“/ FFH-Gebiet „Erlenbach<br />
und Klingbach“ bzw. FFH-Gebiet „Bienwaldschwemmfächer“). Auswirkungen<br />
der Planung auf die „NATURA 2000“-Gebiete sind aufgrund der räumlichen<br />
Entfernung und der dazwischen liegenden Siedlungs- bzw. Verkehrsflächen nicht<br />
zu erwarten.<br />
Darüber hinaus sind keine nach § 30 BNatSchG bzw. nach § 28 LNatSchG gesetzlich<br />
geschützten Biotope im Plangebiet vorhanden.<br />
Zum möglichen Vorkommen von besonders/ streng geschützten Arten (gemäß §<br />
44 BNatSchG) im Plangebiet siehe Näheres in Kap. 2.1.<br />
• Altablagerungen/ Altlastenverdachtsfläche/ Bodenbelastungs- und Bodenschutzgebiete<br />
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Gebiet keine Altablagerungen oder Altlastenverdachtsstandorte<br />
vorhanden. Am Westrand der Bebauung in der Guttenbergstraße<br />
ist eine Altablagerung registriert (Guttenbergstraße, Reg.-Nr. 33404013-<br />
0202). Sie ist von vorliegender Planung jedoch nicht betroffen.<br />
Darüber hinaus ist das Plangebiet nicht als Bodenbelastungsgebiet bzw. als Bodenschutzgebiet<br />
nach § 8 Landesbodenschutzgesetz festgesetzt.<br />
• Bodendenkmäler/ Grabungsschutzgebiete<br />
Auf der Fläche befinden sind keine Bodendenkmäler oder Grabungsschutzgebiete.<br />
• Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete und sonstige wasserrechtliche<br />
Vorgaben<br />
Das Plangebiet ist weder als Wasserschutzgebiet noch als Überschwemmungsgebiet<br />
ausgewiesen. Klassifizierte Oberflächengewässer sind nicht vorhanden.<br />
Seite 7
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 8<br />
• Ziele der Raumordnung 3 (insb. Regionale Grünzüge, Grünzäsuren und<br />
Vorranggebiete)<br />
Regionalplanerische Zielausweisungen im Hinblick auf die regionale Freiraumstruktur<br />
und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, bestehen für das Gebiet<br />
nicht (PLANUNGSGEMEINSCHAFT RHEINPFALZ 2004).<br />
Die nördlich an die bestehende Bebauung an der Hub-/ Stresemannstraße angrenzenden<br />
Flächen sind bis auf Höhe der nördlich querenden Landwirtschaftswegs (in<br />
westlicher Verlängerung der Guttenbergstraße) als geplante „Siedlungsfläche<br />
Wohnen“ ausgewiesen. Die nördlich des Landwirtschaftswegs gelegenen Flächen<br />
sind als „Vorranggebiet Landwirtschaft“ deklariert. Der Raumordnungsplan wird zur<br />
Zeit fortgeschrieben.<br />
• Luftqualität/ Lärm<br />
Aus fachgesetzlicher Sicht ergibt sich die Verpflichtung zur Einhaltung von Immissionsgrenzwerten<br />
bestimmter Substanzen in der Luft (siehe insb. 22. BImSchV).<br />
Bei Überschreitung bzw. der Gefahr der Überschreitung von Immissionsgrenzwerten<br />
(bzw. Summenwerte aus Immissionsgrenzwert + Toleranzmarge) oder Alarmschwellen<br />
(siehe hierzu auch Kap. 2.3) sollen Luftreinehaltepläne bzw. Aktionspläne<br />
aufgestellt werden, die die erforderlichen Maßnahmen zur Verminderung der<br />
Luftverunreinigungen festlegen (siehe § 47 BImSchG). Für die in den Ballungsräumen<br />
und Gebieten betroffenen Kommunen - nicht für die gesamte Gebietsfläche -<br />
erstellt die zuständige Landesbehörde Luftreinhaltepläne, über die der Kommission<br />
der Europäischen Union berichtet werden muss. Das Plangebiet liegt jedoch<br />
nicht in einem festgelegten Ballungsraum. Festsetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 23<br />
BauGB werden im Bebauungsplan deshalb nicht getroffen.<br />
Aus fachgesetzlicher Sicht ergibt sich darüber hinaus (insbesondere für Neuplanungen)<br />
die Verpflichtung zur Einhaltung von Immissionsrichtwerten für Geräusche,<br />
deren Höhe je nach Schutzwürdigkeit des Gebiets unterschiedlich definiert<br />
ist. Zur Bewältigung möglicher Konflikte im Hinblick auf Lärmemissionen durch den<br />
Kfz-Verkehr auf der neuen Ortsrandstraße und den umgebenden schutzwürdigen<br />
Nutzungen (insb. bestehende bzw. geplante Wohnbebauung) wurde ein Fachbüro<br />
mit der Erstellung eines schalltechnischen Gutachtens beauftragt (GSB - SCHALL-<br />
TECHNISCHES BERATUNGSBÜRO PROF. DR. KERSTIN GIERING 2011). Die Ergebnisse<br />
der schalltechnischen Untersuchung und Beurteilung hinsichtlich der Immissionsgrenzwerte<br />
der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) wurden im Bebauungsplan-Entwurf<br />
berücksichtigt (Errichtung einer 2,5 m hohen Lärmschutzwand<br />
auf der Ostseite der Ortsrandstraße).<br />
Mit Umsetzung der EG-Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung<br />
von Umgebungslärm in die nationale Gesetzgebung wird zudem eine Strate-<br />
3 Ziele der Raumordnung stellen endgültig abgewogene Aussagen dar und sind für nachfolgende<br />
Planungsebenen verbindlich. Die Überwindung rechtsverbindlicher Ziele ist nur im Rahmen eines<br />
formellen „Zielabweichungsverfahrens“ möglich. Nach den Bestimmungen des Landesplanungsgesetzes<br />
(§ 10 Abs. 6) ist dieses Verfahren an besondere Voraussetzungen gebunden<br />
und damit auf besonders begründete Einzelfälle begrenzt.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
gische Lärmkartierung und Lärmminderungsplanung verpflichtend. Diese soll gewährleisten,<br />
dass zukünftig für alle Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken<br />
und Hauptverkehrsflughäfen sowie in Ballungsräumen auch für sonstige<br />
Hauptlärmquellen Lärmkarten erstellt werden und die Bevölkerung über die Lärmbelastung<br />
informiert wird. Für die ≥ 1,5 km östlich/ nordöstlich des Plangebiets verlaufende<br />
A 65 liegen erste Ergebnisse der Lärmkartierung vor (siehe http:// informatik1.umwelt-campus.de/rlp/download/).<br />
Das Plangebiet liegt außerhalb des diesbezüglich<br />
relevanten Lärmkorridors entlang der A 65.<br />
• Historische Kulturlandschaften/ -landschaftsteile sowie Kultur- und Baudenkmäler<br />
Entsprechend denkmalgeschützte Flächen oder Objekte kommen im Plangebiet<br />
nicht vor (zum Vorkommen eines Hohlweg-Restes als kulturhistorisch bedeutsamer<br />
Landschaftsbestandteil, der noch heute wahrnehmbarer Ausdruck früherer<br />
Landnutzungsformen bzw. deren Infrastrukturen ist; siehe unten bzw. Kap. 2.7).<br />
1.5.2 Fachplanerische Umweltschutzziele<br />
• Biotopkartierung Rheinland-Pfalz<br />
Im Zuge der landesweiten Biotopkartierung (siehe http://map1.naturschutz.rlp.de/<br />
mapserver_lanis, Stand 2009) wurden zwei Biotope des Plangebiets als schutzwürdig<br />
erfasst:<br />
- Lange Heckenstrukturen und kurze ehemalige Hohlwege zwischen Höfen<br />
und <strong>Kandel</strong> (BK-6914-0015-2009), hier: ehemaliger Hohlweg in der nördlichen<br />
Verlängerung der Hubstraße (Hubhofweg); Bedeutung: lokal als lokales,<br />
kleines Refugium für Vögel und Säugetiere, Bruthabitat für verschiedene<br />
Vogelarten, Trittsteinbiotop zu den anderen Gehölzstrukturen im Umfeld<br />
und Vernetzungsstruktur in Nord-Südrichtung; Schutzziel: Erhalt des<br />
derzeitigen Zustands, sachgerechte Pflege der Gehölze, Offenhaltung der<br />
Säume.<br />
- Gehölze und Böschungen entlang der „Maximiliansbahn“ zwischen <strong>Kandel</strong><br />
und Winden (BK-6914-0013-2009), hier randlich ein Teilabschnitt des Biotops;<br />
Bedeutung: lokal als Bruthabitate für Vögel, Unterschlupf für Kleintiere,<br />
großräumige Vernetzungsstruktur in Ost-West-Richtung in Kombination<br />
mit den nach Süden verlaufenden Ast der Maximiliansbahn und den Heckenstreifen<br />
nördlich von <strong>Kandel</strong>; Schutzziel: Erhalt des derzeitigen Zustands,<br />
sachgerechte Pflege der Gehölze.<br />
• Planung vernetzter Biotopsysteme Landkreis Germersheim<br />
Die „Planung vernetzter Biotopsysteme“ des Landkreises Germersheim weist die<br />
landwirtschaftlich genutzten Flächen des Plangebietes sowie nördlich und westlich<br />
angrenzende Bereiche als „Schwerpunkträume zur Sicherung der Biotopstrukturen<br />
im Agrarraum“ aus (MFUF & LFUG 1997). Diese Zielkategorie kennzeichnet Berei-<br />
Seite 9
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 10<br />
che mit guten Entwicklungsansätzen für die Strukturierung und Aufwertung ausgeräumter<br />
Agrarfluren als Lebensraum für hier ehemals heimische Pflanzen und Tiere<br />
und für die Biotopvernetzung. Neben dem Erhalt vorhandener Strukturen (z. B.<br />
Gehölzbestände entlang der Bahnlinie und des Hohlwegs) sollen Maßnahmen zur<br />
dauerhaften Sicherung von Populationen typischer Arten gut strukturierter Ackerlandschaften<br />
(z. B. Neuntöter, Rebhuhn), der Aufbau eines Netzes von u. a. Saumbereichen,<br />
Ackerrainen, Hecken, Obstbaumreihen und -beständen sowie die<br />
Schaffung von Kernbereichen mit reduzierter Bewirtschaftungsintensität (bevorzugt<br />
auch in Bereichen mit geringerer Bodenmesszahl) umgesetzt werden.<br />
• Regionaler Raumordnungsplan Rheinpfalz (Grundsätze/ Beikarte Landespflege)<br />
In der Beikarte Landespflege ist das Plangebiet mit keinen besonderen Funktionen<br />
im Hinblick auf Arten und Biotope, Wasser, Klima oder Erholung belegt.<br />
• Flächennutzungsplan/ Landschaftsplan <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Kandel</strong><br />
Der Flächennutzungsplan der <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Kandel</strong> (SCHARA + FISCHER<br />
2002) wurde im Zuge der 8. Änderung/ Fortschreibung (genehmigt am 17.12.2009)<br />
an die vorliegende Planung angepasst.<br />
Die im Rahmen der Landschaftsplanung zur Flächennutzungsplanung erstellte landespflegerische<br />
Zielkonzeption beurteilt die Siedlungserweiterungen als „landespflegerisch<br />
vertretbar“ (MIESS & MIESS 1993, siehe dort Karte Nr. 2). Nach Möglichkeit<br />
sind die ökologisch wertvollen Elemente (insb. gehölzbestandener Hohlweg,<br />
gehölzbestandene Bahnböschungen, Streuobstbestand im Südwesten) zu<br />
erhalten. Zu den Gehölzbeständen entlang der Bahntrasse soll ein Schutzabstand<br />
von 10 m Breite belassen werden (Beruhigung des Lebensraums); die neue Siedlungsfläche<br />
soll mit großkronigen Laubbäumen ein- und durchgrünt werden. Als<br />
Ausgleich sollen auf den angrenzenden Flächen Gehölzstrukturen gepflanzt werden.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
2 Bestandsaufnahme des Umweltzustands (Schutzgüter)<br />
2.1 Tiere und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt)<br />
2.1.1 Vegetation<br />
Heutige potentielle natürliche Vegetation<br />
Mit der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation (hpnV) wird die Summe der<br />
Standorteigenschaften gekennzeichnet 4 . Das Plangebiet ist natürliches Wuchsgebiet<br />
eines basenreichen, mäßig frischen bis frischen Perlgras-Buchenwalds (Melico-Fagetum)<br />
und Waldmeister-Buchenwaldes (Asperulo-Fagetum, LFUG 1979).<br />
Nutzungen und reale Vegetation<br />
Im Frühjahr/ Frühsommer 2008 wurde im Plangebiet sowie auf angrenzenden Flächen<br />
eine flächendeckende Kartierung der Biotoptypen und Vegetationseinheiten<br />
durchgeführt. Die Kartierung erfolgte in Anlehnung an die aktuelle Biotopkartieranleitung<br />
von Rheinland-Pfalz (LÖKPLAN 2007, Stand: 13.04.2007), wobei die Kartiereinheiten<br />
vorhabensbezogen stellenweise ergänzt bzw. modifiziert wurden.<br />
Der Bestand des Plangebiets ist in Plan 1.1 und wird im Folgenden näher beschrieben.<br />
Die Bewertung der Biotoptypen/ Vegetationseinheiten erfolgt in Tabelle<br />
2.<br />
Äcker, Sonderkulturen und Feldgärten (HA), Ackerbrachen (HB)<br />
Die fruchtbaren Böden des <strong>Kandel</strong>er Lößriegels werden intensiv ackerbaulich genutzt.<br />
Intensiväcker (HA1) umfassen ca. 76 % des Plangebiets. Bei der Bestandserhebung<br />
2008 wurde auf den meisten Äckern Getreide und Gemüse (v. a. östlich<br />
der Bahntrasse), stellenweise auch Raps angebaut. Auf den Ackerflächen unterbinden<br />
die intensive Nutzung und/ oder der Einsatz von Herbiziden i. d. R. die Ausbildung<br />
einer typischen Ackerwildkrautbegleitflora.<br />
Westlich der Bahntrasse befindet sich auf einer Ackerfläche in der Nähe der Trasse<br />
ein Folientunnel (HA4), der zum Aufnahmezeitpunkt ungenutzt war; ein Bewuchs<br />
mit wildlebenden Pflanzen war aber aufgrund des stark verdichteten Bodens<br />
ebenfalls nicht vorhanden.<br />
Am nördlichen Ortsrand von <strong>Kandel</strong> (östlich des Neubaugebiets „Am Höhenweg“)<br />
befinden sich zwei kleinere Anbauflächen von Rhabarber, die den mehrjährigen<br />
Sonderkulturen (HA2) zugeordnet wurden. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden<br />
sich dort auch ein kleiner Feldgarten (Grabeland) [HA3], der ausschließlich als<br />
4 Als hpnV wird jene dauerhaft stabile Vegetationseinheit angegeben, für die die derzeitigen<br />
Standortbedingungen am besten geeignet sind. Anthropogene Veränderungen der ursprünglichen,<br />
natürlichen Standortbedingungen wie Entwässerungen und Versiegelungen werden mit<br />
berücksichtigt (TÜXEN 1956).<br />
Seite 11
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 12<br />
Nutzgarten für den Anbau von Gemüse bewirtschaftet wird, sowie eine junge Ackerbrache<br />
(HB). Der Bewuchs der Ackerbrache wird von einer für basen- und<br />
nährstoffreiche Standorte typischen ruderalen Annuellenflur (LA1) mit Arten wie<br />
Kriech-Quecke (Elymus repens), Stumpfblättrigem Ampfer (Rumex obtusifolius),<br />
Roter Taubnessel (Lamium purpureum), Hirtentäschelkraut (Capsella bursa-pastoris),<br />
Vogelmiere (Stellaria media) und Beständen der vorjährigen Kulturpflanzen<br />
(hier Raps) bestimmt.<br />
Foto 1: Blick vom Nordwestrand des Plangebiets in Richtung Süden; im Hintergrund sind<br />
die gehölzgesäumte Bahntrasse und der nicht genutzte Folientunnel erkennbar.<br />
Grünland (E)<br />
Grünland ist im Plangebiet nur kleinflächig bzw. lokal vorhanden. Westlich der<br />
Bahntrasse befindet sich in Trassennähe eine ca. 0,4 ha große, mäßig artenreiche<br />
Glatthaferwiese (Fettwiese), wie sie in der Region für nährstoffreiche mittlere<br />
Standorte charakteristisch ist. Pflanzensoziologisch ist der Bestand als „Typische<br />
Glatthaferwiese“ (Arrhenatheretum typicum) [EA1] gekennzeichnet. Typisch sind<br />
ein ausgeglichener Wasserhaushalt sowie das weitgehende Fehlen von Trockenheits-<br />
und Magerkeitszeigern, wie auch von ausgewiesenen Feuchtezeigern. Bestandsbildend<br />
sind neben Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Wiesen-Rispengras<br />
(Poa pratensis), Weicher Trespe (Bromus mollis) und Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus<br />
pratensis) häufige Kräuter der nährstoffreichen Frischwiesen wie Wiesen-Labkraut<br />
(Galium mollugo), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Gänseblümchen<br />
(Bellis perennis), Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium), Wiesen-<br />
Sauerampfer (Rumex acetosa), Rot-Klee (Trifolium pratense) und Gamander-<br />
Ehrenpreis (Veronica chamaedrys).<br />
Als typische Glatthaferwiese ist auch eine kleine Mähwiese im besiedelten Bereich<br />
im Süden des Plangebiets (bebautes Grundstück an der Hubstraße) ausgebildet.<br />
In der kleinteiligen Gemengelage am nördlichen Ortsrand von <strong>Kandel</strong> (östlich des<br />
Neubaugebiets „Am Höhenweg“) sind die vorhandenen Grünlandflächen wegen
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
häufiger Mahd oder intensiver (Vor-)Nutzung als fragmentarische oder stark ruderalisierte<br />
Glatthaferwiese (EA2/ EA3) ausgebildet. Der an den Feldweg in Verlängerung<br />
der Hubstraße angrenzende Bestand ist durch die zeitweilige Nutzung als<br />
Stellplatz für Fahrzeuge gestört und weist Übergänge zu Trittrasen auf.<br />
Westlich des Hohlweges (s. u.) befindet sich auf dem Lößriedel eine jung eingesäte<br />
Pferdweide (EB1), auf der die Saatreihen teilweise noch zu erkennen sind. Wegen<br />
des geringen Bestandesalters handelt es sich um blumen- und blütenarmes,<br />
grasreiches Grünland mit einzelnen weidefesten Kräutern wie Spitz-Wegerich<br />
(Plantago lanceolata), Gemeiner Schafgarbe (Achillea millefolium) und Wiesen-<br />
Kümmel (Carum carvi) sowie einzelnen Ackerunkräutern wie dem Stumpfblättrigen<br />
Ampfer (Rumex obtusifolius). Das Auftreten des Kleinen Wiesenknopfs (Sanguisorba<br />
minor) als typischem Magerkeitszeiger für mäßig trockene, basenreiche<br />
Lehm- und Lößböden, lässt das Potenzial für die Entwicklung artenreicherer Bestände<br />
erkennen.<br />
Foto 2: Frisch eingesäte Pferdeweide westlich des Hubhofwegs.<br />
Naturraumtypische Hecken und Gebüsche (BD, BB)<br />
Naturnahe Baum- und Strauchhecken (BD1, BD2) mit naturraumtypischer Gehölzartenzusammensetzung<br />
sind entlang der Bahntrasse und auf den Böschungen des<br />
Lößhohlweges (Hubhofweg) ausgebildet.<br />
Die überwiegend strauchigen, artenreichen Feldhecken auf den Flanken des Hohlweges<br />
(s. u.) werden von Arten der Schlehen-Weißdorn-Gebüsche mittlerer Standorte<br />
(Prunetalia) - besonders von Schlehe (Prunus spinosa), Eingriffeligem Weißdorn<br />
(Crataegus monogyna) und Europäischem Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)<br />
sowie Blutrotem Hartriegel (Cornus sanguinea), Liguster (Ligustrum vulgare)<br />
und Hunds-Rose (Rosa canina) - unter Beimischung von Schwarzem Holunder<br />
(Sambucus nigra), Feld-Ulme (Ulmus minor) und jungen Eschen (Fraxinus excelsior)<br />
aufgebaut.<br />
Seite 13
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 14<br />
Die Bahntrasse verläuft auf Höhe des Plangebiets in einem Geländeeinschnitt. Die<br />
angrenzenden Böschungen sind mit Ausnahme des unteren Böschungsbereichs<br />
(gehölzfreier Unterhaltungsstreifen) durchgängig mit strukturreichen Baum-<br />
Strauch-Hecken bewachsen. Bestandsbildend sind - mit abschnittsweise unterschiedlicher<br />
Dominanz - v. a. Esche, Feldahorn (Acer campestre), Feld-Ulme,<br />
Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quercus robur), Hasel (Corylus avellana)<br />
und die kennzeichnenden Arten der Schlehen-Weißdorn-Gebüsche (s. o.).<br />
Hervorzuheben ist ein ca. 260 m langer Gehölzstreifen mit sechs ökologisch besonders<br />
wertvollen alten Stieleichen auf der Westseite der Bahntrasse.<br />
Ein kleines naturraumtypisches Gebüsch mittlerer Standorte (BB1) findet man am<br />
nördlichen Rand des bebauten Grundstücks an der Hubstraße (Holundergebüsch).<br />
Naturraum- und standortfremde Hecken und Gebüsche (BZ)<br />
In dem kleinteiligen Gemenge östlich des Neubaugebiets „Am Höhenweg“ wurde<br />
an einer Stelle zur Abgrenzung von Grundstücken ein „Heckenzaun“ (BZ1) angelegt.<br />
Es handelt sich dabei um eine wenig strukturierte, heckenförmige Anpflanzung<br />
von Sträuchern (v. a. Berberitze und Weißdorn), die wegen häufigem Rückschnitt<br />
der Gehölze eine regelmäßige Form hat. An der Einfahrt zum Feuerwehrgelände<br />
und auf den Gehwegen an der Hubstraße findet man Pflanzbeete mit naturfernen<br />
Zierstrauchpflanzungen (BZ2). Auf dem bebauten Grundstück an der<br />
Hubstraße befindet sich an der Hofeinfahrt ein Gebüsch des ursprünglich aus<br />
Südosteuropa stammenden Flieders (Syringa vulgaris) [BZ3].<br />
Gestrüpp (BK)<br />
Unter dieser Kartiereinheit wurde ein kleines ruderales Gestrüpp der Kratzbeere<br />
(Rubus caesius) auf der westlichen Hohlwegsböschung erfasst.<br />
Einzelbäume, Baumgruppen und Baumreihen 5<br />
Einzelbäume, Baumgruppen und Baumreihen aus heimischen Laubbäumen, hochstämmigen<br />
Obstbäumen und Nussbäumen sind auf den überwiegend intensiv<br />
landwirtschaftlich genutzten Flächen des Plangebietes selten.<br />
In dem kleinteiligen Gemenge aus Gärten/ Feldgärten, kleineren Acker- und Grünlandflächen<br />
östlich des Neubaugebiets „Am Höhenweg“ findet man eine Baumgruppe<br />
aus unterschiedlich alten Walnussbäumen sowie einen alten freistehenden<br />
Kirschbaum.<br />
5 Einzelbäume, Baumgruppen und Baumreihen sind in der Bestandskarte mit Baumsymbolen<br />
kenntlich gemacht.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Foto 3: Kleinteilige Gemenge aus Gärten/ Feldgärten, kleineren Acker- und Grünlandflächen<br />
östlich des Neubaugebiets „Am Höhenweg.<br />
Am Feldweg im Norden des Plangebiets steht ein alter solitärer Nussbaum. Auf<br />
dem bebauten Grundstück an der Hubstraße befinden sich drei naturraumtypische<br />
Laubbäume mittleren Alters (Birke, Eberesche, Linde). Im angrenzenden Straßenraum<br />
wurde im Straßenbegleitgrün ein gebietsfremder Amerikanischer Amberbaum<br />
(Liquidambar styraciflua) gepflanzt.<br />
Landschaftsprägende und ökologisch besonders wertvolle Bäume der Hecken am<br />
Hohlweg und an der Eisenbahntrasse sind in der Bestandskarte ebenfalls durch<br />
spezielle Baumsymbole kenntlich gemacht. Besonders hervorzuheben sind hierbei<br />
neun Alteichen (Quercus robur) in den Baumhecken der Eisenbahntrasse (s. a.<br />
BD).<br />
Ruderale, frische bis trockene Säume und Hochstaudenfluren (KB1), Dominanzbestände<br />
(LD)<br />
Schmale linienförmige Säume aus häufigen und weit verbreiteten Ruderalarten findet<br />
man im Plangebiet auf frischen bis mäßig trockenen, nährstoffreichen Standorten<br />
entlang der Wege und Ackerränder sowie im Randbereich der Bahntrasse.<br />
Die meisten Säume erreichen allerdings nicht die naturschutzfachlich erforderliche<br />
Mindestbreite von ca. 3 - 5 m.<br />
Am Hohlweg und an einigen Ackerrändern westlich der Bahntrasse handelt es sich<br />
meist um ruderale Glatthaferbestände (KB11), die von Glatthafer, einigen anspruchslosen<br />
Arten des Wirtschaftsgrünlands wie Knäuelgras (Dactylis glomerata),<br />
Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) und Zaunwicke (Vicia sepium) sowie typischen<br />
Ruderalarten wie Weiße Taubnessel (Lamium album), Acker-Kratzdistel<br />
(Cirsium arvense), Gemeiner Beifuß (Artemisia vulgaris) und Taube Trespe (Bromus<br />
sterilis) aufgebaut werden.<br />
Weitere grasreiche Ruderalsäume (KB12) sind im Plangebiet auf einem ehemaligen<br />
bzw. wenig genutzten Grasweg am Rand der Wohnbebauung und auf dem<br />
bebauten Grundstück an der Hubstraße anzutreffen. An bestandsbildenden Grä-<br />
Seite 15
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 16<br />
sern wachsen dort v. a. Taube Trespe, Mäuse-Gerste (Hordeum murinum) und<br />
Weidelgras (Lolium perenne).<br />
An der Bahntrasse werden auf beiden Seiten des Gleiskörpers ca. 3 m breite „Sicherheitsstreifen“<br />
durch regelmäßige Unterhaltung gehölzfrei gehalten. Dort haben<br />
sich auf gut mit Nährstoffen versorgten, mittleren Standorten ausdauernde Ruderalbestände<br />
entwickelt, die von stickstoffliebenden Stauden und Gräsern bestimmt<br />
werden, nicht selten mit Dominanz der Brennessel (LD1). Kleinere Dominanzbestände<br />
der Brennessel findet man auch an nährstoffreichen Stellen am Wegrand<br />
oder am Rand der Wohnbebauung.<br />
Ein Dominanzbestand der Tauben Trespe (Bromus sterilis) [LD2] hat sich in den<br />
Randbereichen des Folientunnels auf dem Rapsacker westlich der Bahntrasse eingestellt.<br />
Morphologische Sonderformen anthropogenen Ursprungs - Lößhohlweg<br />
(hk 6 )<br />
Westlich der Eisenbahntrasse befindet sich in Verlängerung der Hubstraße ein ca.<br />
140 m langer Lößhohlweg, dessen Flanken mit naturnahen Feldhecken bewachsen<br />
sind (s. BD), die eigentliche Wegfläche ist dagegen versiegelt (Plattenweg, s.<br />
VB4).<br />
Foto 5: Hohlwegsabschnitt in Verlängerung der Hubstraße.<br />
Hohlwege sind typisch für die Lößlandschaften der Rheinebene. Sie sind jedoch im<br />
Zuge der Flurbereinigung selten geworden. Sie sind als Folge der Verdichtung<br />
durch die Nutzung festgelegter Wege durch Mensch und Tier entstanden. Diese<br />
Verdichtung des Bodens führte zur Wasserundurchlässigkeit des Bodens und in<br />
der Folge zu Erosion durch abfließende Niederschläge.<br />
6 Hohlwege sind Komplexbiotope. In der Bestandskarte sind die einzelnen Biotopelemente (z. B.<br />
Plattenweg, Feldhecke, Kratzbeergestrüpp) dargestellt und anhand eines Zusatzcodes (hk) als<br />
Teil des Lößhohlwegs kenntlich gemacht.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Weitere anthropogen bedingte Biotope (H)<br />
Östlich des Plangebiets liegt die in einem Geländeeinschnitt verlaufende Bahnstrecke<br />
„Karlsruhe - Landau“. Der Gleis-/ Schotterkörper der Bahntrasse (HD1) ist<br />
vegetationsfrei. Die angrenzenden Flächen und Böschungen sind mit ruderalen<br />
Krautsäumen und naturraumtypischen Hecken bewachsen (s. o.)<br />
Foto 6: Im Einschnitt verlaufende Bahntrasse mit gehölzbestandenen Böschungen.<br />
Westlich der Bahntrasse grenzen an die vorhandene Wohnbebauung stellenweise<br />
Gärten (HJ) an, die dem Anbau von Zier- oder Nutzpflanzen und zugleich auch der<br />
Erholung dienen. In Abhängigkeit von der jeweiligen Nutzung und den vorhandenen<br />
Biotopstrukturen wurde unterschieden zwischen strukturreichen Gärten mit<br />
teilweise altem Obstbaumbestand (HJ1), reinen Nutzgärten (HJ2) und dem Mischtyp<br />
von Nutz- und Ziergarten (HJ3).<br />
Am Rand des Folientunnels westlich der Bahntrasse (s. o.) befindet sich eine kleine<br />
Obstbaumgruppe aus nieder- bzw. mittelstämmigen Obstbäumen (z. B. Apfel,<br />
Zwetschge) und ruderaler Feldschicht (Dominanzbestand der Tauben Trespe)<br />
[HK1].<br />
Im Süden des Plangebiets haben sich auf dem Hof und auf der stellenweise mit<br />
Asphaltresten versehenen Hofeinfahrt des bebauten Grundstücks an der Hubstraße<br />
unterschiedlich lückige Trittrasen und Trittpflanzenbestände (HM11) entwickelt.<br />
Östlich des Neubaugebiets „Am Höhenweg“ wird ein Teil einer ruderalen Fettwiese<br />
zum Lagern von Brennholz verwendet. Die Brennholzstapel (HT1) wurden am<br />
Rand der Grünlandfläche angelegt.<br />
Gebäude und Verkehrsflächen (V)<br />
Es wurde unterschieden zwischen Straßen (VA), unterschiedlich befestigten Wegen<br />
(VB), Wohngebäuden (VG) und Schuppen (VS).<br />
Seite 17
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 18<br />
Asphaltierte Straßen (VA) befinden sich im Süden des Plangebiets (Stresemannstraße/<br />
Hubstraße). Für die Bewirtschaftung des Lößriedels wurde in der Vergangenheit<br />
ein gut ausgebautes Netz an Wirtschaftswegen angelegt. Im Plangebiet<br />
überwiegen wegen der intensiven Nutzung Betonplattenwege (VB4). Einzelne Wege<br />
oder Wegabschnitte sind mit wasserdurchlässigem Material (Kies/ Schotter) befestigt<br />
(VB3). Andere, weniger intensiv genutzte Wege sind unbefestigt (Gras- und<br />
Erdwege). Während Graswege (VB1) vollständig oder weitgehend mit trittunempfindlichen<br />
Gräsern und Kräutern wie Weidelgras (Lolium perenne), Einjähriges<br />
Rispengras (Poa annua), Breitblättriger Wegerich (Plantago major), Vogel-Knöterich<br />
(Polygonum aviculare agg.) oder Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.) bewachsen<br />
sind, weisen Erdwege (VB2) größere, durch Tritteinfluss oder Befahren<br />
entstandene, offene und verdichtete Bodenstellen auf.<br />
Bei den überbauten Flächen auf dem Grundstück an der Hubstraße handelt es<br />
sich um einen kleineren Wohnblock (VG) und mehrere Schuppen (VS).<br />
Floristische Besonderheiten/ Arten des Anhang IVb der FFH-Richtlinie<br />
Die Flora des Plangebiets wird von häufigen, weit verbreiteten Pflanzenarten bestimmt,<br />
die weder gefährdet noch geschützt sind; es kommen keine nach Anhang<br />
IVb der FFH-Richtlinie 92/43/EWG geschützten Arten vor. Floristische Besonderheiten<br />
wurden im Plangebiet ebenfalls nicht festgestellt.<br />
2.1.2 Tierwelt<br />
Nähere Angaben über Artvorkommen im Plangebiet liegen nicht vor. Die Biotopkartierung<br />
von 1998 hat im Hohlweg in Verlängerung der Hubstraße (Hubhofweg)<br />
Roesels Beißschrecke (Metrioptera roeselii) und die Gewöhnliche Strauchschrecke<br />
(Pholidoptera griseoaptera) bzw. den Braunen Waldvogel (Aphantopus hyperantus)<br />
erfasst. Hierbei handelt sich um häufige, weit verbreitete Arten, die unter<br />
keinem besonderen Schutz stehen.<br />
Die nachfolgende Betrachtung zu möglichen Tiervorkommen leitet sich aus den<br />
prinzipiellen Lebensraumfunktionen der Vegetationsbestände ab, die im Plangebiet<br />
kartiert wurden.<br />
Es ist davon auszugehen, dass die intensiv ackerbaulich genutzten Flächen des<br />
Plangebiets lediglich wenigen Allerweltsarten (Teil-)Lebensraumfunktionen bieten.<br />
Inmitten der vorwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzten Lößriedelflächen stellen<br />
jedoch die Gehölzstrukturen an den Böschungen und Wegen wichtige Rückzugs-,<br />
Nahrungs- und Bruträume für die Tierwelt (insb. Vögel, Insekten) dar. Sie<br />
dienen dem Biotopverbund für verschiedene Arten überwiegend offener, strukturreicher<br />
Agrarlandschaften und für hoch mobile Arten halboffener Landschaften bis<br />
hin zu lichten Wäldern. Hecken und Feldgehölze erfüllen verschiedene zentrale<br />
Lebensraumfunktionen für Tierarten der Feldflur, die dort Nahrung, Niststätten,<br />
Überwinterungsquartiere oder Schutz z. B. vor Feinden und ungünstiger Witterung
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
suchen (siehe Abb. 2).<br />
Abb. 2: Breite Baum-Strauch-Hecken und Feldgehölze erfüllen eine Vielzahl von Lebensraumfunktionen<br />
für die heimische Tierwelt (aus BLAB 1993).<br />
Beispielsweise dienen strukturreiche Hecken verschiedenen Vögeln der Feldflur<br />
als Ansitz (z. B. Eulen, Greifvögel), Singwarte zur Reviermarkierung sowie Nist-<br />
oder Wohnplatz (z. B. Neuntöter, Dorngrasmücke, Goldammer, Nachtigall, Zaunkönig).<br />
Für andere Tiere sind Feldhecken Rückzugsräume, wohin sie vor Feinden<br />
oder bei Störungen während der Nahrungsaufnahme fliehen können (z. B. Feldhase,<br />
Rebhuhn) oder sich vor ungünstigen Witterungsverhältnissen (Regen, Wind,<br />
Trockenheit, Hitze) zurückziehen können (z. B. Insekten, Erdkröte, Rebhuhn). Für<br />
Wildbienen und Hummeln, die zur Nestanlage beruhigte Bodenbereiche oder altes<br />
Holz, Holunder- oder Brombeerzweige benötigen, stellen sie einen geeigneten Lebensraum<br />
dar. Dabei beherbergt keine andere heimische Baumart eine so große<br />
Zahl von Tierarten wie die Eiche (Stiel-/ Traubeneiche). In Mitteleuropa sind - je<br />
nach Quelle - 300 bis 500 Arten bekannt, welche auf Eichen spezialisiert, d. h.<br />
ausschließlich oder sehr stark von dieser Baumart abhängig sind. In der gleichen<br />
Größenordnung bewegt sich die Anzahl Tierarten, welche die Eiche fakultativ nutzen.<br />
Besonders artenreich besiedelt sind alte, randständige Eichen, wie sie im<br />
Plangebiet stellenweise am Rand der Bahntrasse vorhanden sind.<br />
Darüber hinaus dienen Feldhecken für eine große Zahl von Tieren als Leitlinien bei<br />
täglichen Wanderbewegungen (v. a. zur Nahrungssuche) und bei der Ausbreitung.<br />
So nutzen fast alle heimischen Fledermäuse lineare Gehölzstrukturen als Flugweg<br />
und als Jagdrevier. Oft werden über Jahre hinweg die gleichen "Flugpfade" beibehalten.<br />
Die Leitlinienfunktion besteht für viele flugfähige Tiergruppen, die sich entlang<br />
der Heckenränder immer wieder niederlassen können, z. B. Schlupfwespen<br />
und Schwebfliegen. Aber auch die Ausbreitung von Offenland-Arten wird durch<br />
Hecken gefördert. Beispielsweise landen verschiedene Feld-Laufkäfer während<br />
Seite 19
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 20<br />
ihren Ausbreitungsphasen bevorzugt in der Nähe von Hecken. Amphibien orientieren<br />
sich bei ihren Jahreswanderungen und Ausbreitungsbewegungen oft an Heckenrändern.<br />
Besonders hervorzuheben ist die Funktion der Lößhohlwege als ökologisch wertvolle<br />
Lebensräume für viele Pflanzen und Tiere, da sie spezielle Bedingungen bieten.<br />
Vor allem die Gegensätze zwischen schattigen und sonnigen, trockenen und<br />
feuchten sowie windigen und windstillen Plätzen sind verantwortlich für das Vorhandensein<br />
typischer Lebensgemeinschaften. Der im Plangebiet liegende Hohlweg<br />
ist durch eine weitgehende Verbuschung gekennzeichnet; offene, besonnte<br />
Steilwandreste mit wärme- und lichtbedürftigen Pflanzen sind nicht mehr vorhanden.<br />
Bei ausbleibender Pflege setzt sich diese Entwicklung bis Erreichen des<br />
Waldstadiums fort; hierbei besteht die Gefahr, dass Robinien eindringen und ein<br />
arten-/ und strukturarmes Endstadium entsteht. Dessen ungeachtet dienen die an<br />
den Flanken des Hohlweges siedelnden Gehölze und Stauden Kleintieren als Unterschlupf<br />
und Nahrung. Darum locken Hohlwege abends und nachts Fledermäuse<br />
an, die hier Jagd auf Nachtfalter und andere Insekten machen. Gerade in intensiv<br />
landwirtschaftlich genutzten Gebieten sind Hohlwege eine ökologische Bereicherung.<br />
Alte freistehende Obstbäume und großkronige Laubbäume mit einem gewissen<br />
Anteil an Tot-, Faul- und Stammholz, Mulm, rissiger Borke und Kleinhöhlen (z. B.<br />
Rindenspalten, Bruchstellen, natürliche Verwachsungen) erfüllen einige Lebensraumfunktionen.<br />
Beispielsweise sind sie als Lebensraum für holzbewohnende Insekten<br />
(z. B. bestimmte Käfer-, Schwärmer- und Spinnerarten) geeignet sowie als<br />
Ansitz, Singwarte oder Nisthabitat für Baumhöhlenbrüter, Wartenjäger und Vogelarten,<br />
die auf ältere insektenreiche Laub- und Obstbäume als Nahrungshabitat angewiesen<br />
sind.<br />
Auf Krautsäumen und Grünland bewirken Baumreihen eine Verbundwirkung für<br />
Arten halboffener Landschaften (Korridore). Bereits isolierte Einzelbäume in der<br />
Feldflur können in gewissem Umfang als Trittstein wirken (KORNPROBST 1994),<br />
z. B. als Deckungsort für das Rebhuhn und als Singwarte für Grauammer und<br />
Schafstelze (BLAB 1993). Bei mehreren Bäumen in einigem Abstand kommen<br />
Goldammer und Dorngrasmücke als potenzielle Brutvögel hinzu.<br />
Darüber hinaus gehören Eisenbahnanlagen zu den zentralen Lebensräumen verschiedener<br />
Reptilienarten; auch am vorliegend betrachteten Bahnabschnitt ist ein<br />
Vorkommen der nach Anhang IV der FFH-Richtlinie besonders zu schützenden<br />
Arten Zauneidechse und Mauereidechse möglich. Für die Zauneidechse ist beispielsweise<br />
der kleinräumige Wechsel von vegetationsfreien Stellen, einer gut ausgebildeten<br />
Krautschicht und einzelnen Sträuchern oder Bäumen entscheidend. Die<br />
Übergangsbereiche erlauben den Tieren eine optimale Thermoregulation und bieten<br />
ausreichende Deckung. Der Schotterkörper wird als Fluchtversteck und Schlaf-<br />
und Sonnenplatz genutzt.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
2.1.3 Bioökologische Bedeutung<br />
Die Bewertung der Biotoptypen des Plangebiets für den Arten- und Biotopschutz<br />
resultiert aus der bundesweiten und regionalen Gefährdung der Biotoptypen/<br />
Pflanzengesellschaften nach den Roten Listen Deutschlands (RENNWALD 2000,<br />
RIECKEN et al. 2006) und von Rheinland-Pfalz (MFU 1991), ferner aus ihrer Funktion<br />
als Lebensraum für einheimische Pflanzen- und Tierarten und den Möglichkeiten<br />
zu ihrer Wiederherstellung. Anhang 1 zeigt eine Übersicht der den einzelnen<br />
Wertstufen zugrunde liegenden Kriterien. Die dort dargestellten 16 Wertstufen werden<br />
zu sieben Werteinheiten (sehr hoch, hoch, mittel-hoch, mittel, mittel-gering,<br />
gering, ohne Wert), die in der Regel drei Wertstufen umfassen, zusammengefasst.<br />
Prinzipiell gilt, dass gefährdete oder geschützte Biotoptypen hochwertig sind, sonstige<br />
artenreiche oder allenfalls mittelfristig wiederherstellbare Biotoptypen mittelwertig<br />
und artenarme, leicht wiederherstellbare, doch aus Arten- und Biotopschutzsicht<br />
nicht förderungswürdige Biotoptypen geringwertig sind.<br />
Die naturschutzfachliche Bewertung der Biotoptypen ist in Tabelle 2 dargestellt.<br />
Von besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung und Schutzwürdigkeit (hoher<br />
Wert) sind im Plangebiet:<br />
− die naturnahen, überwiegend strauchigen Feldhecken an den Flanken des<br />
Lößhohlwegs,<br />
− die naturnahen Baum-Strauch-Hecken beiderseits der Bahntrasse, bes. solche<br />
mit Altholzanteil (v. a. Alteichen),<br />
− ältere landschaftstypische Einzelbäume und Baumgruppen (großkronige Laubbäume,<br />
hochstämmige Obstbäume und Nussbäume) in der weitgehend intensiv<br />
genutzten Feldflur.<br />
Feldhecken aus heimischen, naturraum- und standorttypischen Baum- und<br />
Straucharten sind typische Bestandteile der historischen Kulturlandschaft. Die besondere<br />
Bedeutung ergibt sich durch die regionale und überregionale Gefährdung<br />
dieser Biotoptypen (s. Tabelle 2) sowie deren Lebensraumfunktionen für die heimische<br />
Tierwelt.<br />
Ebenfalls von besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung, im Plangebiet aufgrund<br />
der intensiven Nutzung aber selten zu finden, sind ältere landschaftstypische<br />
Einzelbäume und Baumgruppen aus heimischen Laubbäumen, hochstämmigen<br />
Obstbäumen und Nussbäumen. Einzelne Vorkommen befinden sich in dem<br />
kleinteiligen Gemenge östlich des Neubaugebiets „Am Höhenweg“ (Nussbaumguppe,<br />
alter freistehender Kirschbaum), punktuell an Wegen (alte solitäre Nussbäume)<br />
sowie eingestreut in die Hecken/ Gehölzstreifen am Hohlweg (Nussbaum,<br />
Hainbuche) und an der Bahntrasse (mehrere Alteichen, Hainbuche).<br />
Seite 21
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Kürzel Biotoptyp<br />
Seite 22<br />
Tab. 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet<br />
Gefährdung Biotoptyp:<br />
(Biotoptypen mit Vorkommen im Plangebiet sind durch Fettdruck gekennzeichnet)<br />
Bundesweite Gefährdung (RL D) und regionale Gefährdung für das „Südwestdeutsche Mittelgebirgs-/<br />
Stufenland“ (RL SW) nach der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands (RIECKEN et al.<br />
2006):<br />
1 von vollständiger Vernichtung bedroht<br />
2 stark gefährdet<br />
3 gefährdet<br />
Tendenz Bestandsentwicklung:<br />
↓ negativ<br />
→ weitgehend stabil<br />
↑ positiv<br />
Biotope mit besonderer Bedeutung<br />
BD15a,<br />
BD27a<br />
Landesweite Gefährdung (RL RP): Sicherungsränge nach der Roten Liste der bestandsgefährdeten<br />
Biotoptypen von Rheinland-Pfalz (MFU 1991):<br />
1 Biotoptypen mit tatsächlichem/ erwartetem extrem starken Verbreitungsrückgang<br />
2 Biotoptypen mit tatsächlichem/ erwartetem starken Verbreitungsrückgang<br />
3 Biotoptypen mit mittlerer Rückgangstendenz in weiten Landesteilen<br />
4 Derzeit nur gering und nicht allgemein zurückgehender Biotoptyp<br />
Gefährdung Gesellschaft: nach der Roten Liste der gefährdeten Pflanzengesellschaften Deutschlands<br />
(RENNWALD 2000)<br />
1 vom Aussterben bedroht<br />
2 stark gefährdet<br />
3 gefährdet<br />
V zurückgehend (Vorwarnliste)<br />
Naturraumtypische<br />
Baum- u. Strauch-<br />
Hecken an der Eisenbahntrasse<br />
(hoher Altholzanteil)<br />
Gefährdung nach Roter Liste<br />
RL D/ Tendenz<br />
Biotoptyp Gesellschaft<br />
RL<br />
SW<br />
RL<br />
RP<br />
RL D<br />
Wertstufe<br />
2-3 ↑ 2-3 - - 13 Wert: hoch<br />
Werteinheit/ wertgebende Kriterien<br />
Naturnahe, strukturreiche u. landschaftsprägende<br />
Gehölzstreifen<br />
inmitten einer intensiv genutzten<br />
Agrarlandschaft; naturraumtypisches<br />
Gehölzartenspektrum (Esche,<br />
Feldahorn, Feldulme, Hasel<br />
u. Arten der Schlehen-Weißdorn-<br />
Gebüsche), hoher Altholzanteil<br />
(wertgebend sind alte Stieleichen).<br />
Bundesweit und regional stark gefährdeter<br />
bis gefährdeter Biotoptyp.<br />
Lebensraumfunktionen für bedrohte<br />
Tierarten (z. B. Vögel, Insekten,<br />
Fledermäuse), auch Altholzbewohner,<br />
sind wahrscheinlich.<br />
Vernetzungslinien mit Bedeutung<br />
für den lokalen Biotopverbund.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Fortsetzung Tab. 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet<br />
Kürzel Biotoptyp<br />
BD12,<br />
BD13,<br />
BD14,<br />
BD24,<br />
BD25,<br />
BD26<br />
BD11/hk,<br />
BD21/hk,<br />
BD22/hk,<br />
BD23/hk<br />
Stieleiche,<br />
Hainbuche,<br />
Walnuss,<br />
hochstämmige<br />
Obstbäume<br />
Sonstige naturraumtypische<br />
Baum- u.<br />
Strauch-Hecken an der<br />
Eisenbahntrasse (mittleres<br />
Alter)<br />
Lößhohlweg mit naturnahem,<br />
vorwiegend<br />
strauchartigem Gehölzbewuchs<br />
an den<br />
Flanken<br />
Alte, naturraum- u. kulturraumtypischeEinzelbäume<br />
u. Baumgruppen<br />
(Biotoptypen mit Vorkommen im Plangebiet sind durch Fettdruck gekennzeichnet)<br />
Gefährdung nach Roter Liste<br />
RL D/ Tendenz<br />
Biotoptyp Gesellschaft<br />
RL<br />
SW<br />
RL<br />
RP<br />
RL D<br />
Wertstufe<br />
2-3 ↑ 2-3 - - 12 Wert: hoch<br />
2 ↓ 2 2 - 13 Wert: hoch<br />
2-3 ↓ 2-3 - - 13 Wert: hoch<br />
Werteinheit/ wertgebende Kriterien<br />
Naturnahe, strukturreiche u. landschaftsprägende<br />
Gehölzstreifen inmitten<br />
einer intensiv genutzten Agrarlandschaft;<br />
naturraumtypisches Gehölzartenspektrum<br />
(v. a. Esche, Feldahorn,<br />
Feldulme, Hasel u. Arten der Schlehen-<br />
Weißdorn-Gebüsche).<br />
Bundesweit und regional stark gefährdete<br />
bis gefährdete Biotoptypen<br />
Lebensraumfunktionen für bedrohte<br />
Tierarten (z. B. Vögel, Insekten, Fledermäuse)<br />
sind wahrscheinlich.<br />
Vernetzungslinien mit Bedeutung für<br />
den lokalen Biotopverbund.<br />
Hohlweg als typische morphologische<br />
Sonderform mit anthropogenem Ursprung<br />
im Bereich des Lößriedels;<br />
Hohlwegsböschungen mit naturnahem<br />
Gehölzbewuchs (Hecken aus Arten des<br />
Schlehen-Weißdorn-Gebüschs, Feldulme<br />
u. Esche); teilweise Beeinträchtigung<br />
durch Versiegelung der Wegeflächen<br />
(Plattenweg) u. intensive Ackernutzung<br />
(Stoffeinträge/ Eutrophierung).<br />
Bundesweit, regional u. landesweit<br />
stark gefährdeter Biotoptyp mit bundesweit<br />
negativer Bestandsentwicklung.<br />
Lebensraumfunktionen für bedrohte<br />
Tierarten (z. B. Vögel, Insekten, Fledermäuse)<br />
sind wahrscheinlich.<br />
Vernetzungskorridor mit Bedeutung für<br />
den lokalen Biotopverbund.<br />
Alte Einzelbäume u. Baumgruppen,<br />
teilweise als Bestandteil der naturnahen<br />
Hecken am Lößhohlweg.<br />
Bundesweit und regional stark gefährdeter<br />
bis gefährdeter Biotoptyp mit negativer<br />
Bestandsentwicklung in ganz<br />
Deutschland.<br />
(Teil-)Lebensraumfunktionen auch für<br />
seltene/ geschützte Tierarten sind<br />
wahrscheinlich (z. B. für Vögel u. Insekten).<br />
Seite 23
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Kürzel Biotoptyp<br />
BD16 Naturraumtypische<br />
Baumhecke im Straßenbegleitgrün<br />
(mittleres<br />
Alter)<br />
Walnuss Einzelbaum (mittleres<br />
Alter)<br />
BD17 Baumhecke aus überwiegendnaturraumtypischen<br />
Arten am Rand<br />
des Feuerwehrgeländes<br />
(mittleres Alter)<br />
Biotope mit allgemeiner Bedeutung<br />
Birke, Eberesche,<br />
Linde<br />
Seite 24<br />
Fortsetzung Tab. 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet<br />
Naturraumtypische<br />
Baumgruppen u. Einzelbäume<br />
im besiedelten<br />
Bereich bzw. am Ortsrand<br />
(mittleres Alter)<br />
(Biotoptypen mit Vorkommen im Plangebiet sind durch Fettdruck gekennzeichnet)<br />
Gefährdung nach Roter Liste<br />
RL D/ Tendenz<br />
Biotoptyp Gesellschaft<br />
RL<br />
SW<br />
RL<br />
RP<br />
RL D<br />
Wertstufe<br />
2-3 ↑ 2-3 - - 11 Wert: hoch<br />
2-3 ↓ 2-3 - - 11 Wert: hoch<br />
2-3 ↑ 2-3 - - 11 Wert: hoch<br />
- ↓ - - - 8 Wert: mittel - hoch<br />
Werteinheit/ wertgebende Kriterien<br />
Dichter, naturraumtypischer Gehölzstreifen<br />
aus Spitzahorn, Stieleiche, Birke<br />
und Feldahorn an der L 542.<br />
Bundesweit und regional stark gefährdeter<br />
bis gefährdeter Biotoptyp in beeinträchtigter<br />
Ausbildung (negative<br />
Randeffekte durch Landstraße sind<br />
anzunehmen).<br />
Kulturraumtypischer, bundesweit und<br />
regional stark gefährdeter bis gefährdeter<br />
Biotoptyp mit negativer Bestandsentwicklung<br />
in ganz Deutschland.<br />
(Teil-)Lebensraumfunktionen auch für<br />
seltene/ geschützte Tierarten sind möglich<br />
(z. B. als Nahrungshabitat).<br />
Dichter (bedingt) naturnaher Gehölzstreifen<br />
(v. a. aus Vogelkirsche, Feldahorn,<br />
Mehlbeere, Hartriegel u.<br />
Schneeball) im Randbereich des Feuerwehrgeländes.<br />
Bundesweit und regional stark gefährdeter<br />
bis gefährdeter Biotoptyp; naturraumtypischeGehölzartenzusammensetzung<br />
ist teilweise untypisch verändert;<br />
negative Randeffekte durch<br />
anthropogene Nutzung (Landstraße,<br />
Feuerwehrgelände) sind anzunehmen.<br />
Einzelbaum (Linde) u. kleine Baumgruppe<br />
(Birke, Eberesche) im Bereich<br />
des Grundstücks im Süden des Plangebiets.<br />
(Teil-)Lebensraumfunktionen für heimische,<br />
überwiegend häufige und weit<br />
verbreitete Arten; potenzielle Trittsteine<br />
im Biotopverbund.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Fortsetzung Tab. 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet<br />
Kürzel Biotoptyp<br />
EA1 Typische Glatthaferwiese<br />
(höhere Trophie,<br />
flächige Ausbildung)<br />
HJ1 Strukturreicher Garten<br />
mit teilweise altem<br />
Obstbaumbestand<br />
BB11 Holundergebüsch mittlerer<br />
Standorte<br />
Walnuss Sonstige junge bis mittelalte<br />
Baumgruppen u.<br />
Einzelbäume<br />
Biotope mit nachrangiger Bedeutung<br />
EA1 Typische Glatthaferwiese<br />
(höhere Trophie,<br />
linienförmige Ausbildung<br />
an Straßen u.<br />
Wegen)<br />
EA2 Ruderale Glatthaferwiese<br />
(höhere Trophie,<br />
flächige Ausbildung)<br />
(Biotoptypen mit Vorkommen im Plangebiet sind durch Fettdruck gekennzeichnet)<br />
Gefährdung nach Roter Liste<br />
RL D/ Tendenz<br />
Biotoptyp Gesellschaft<br />
RL<br />
SW<br />
RL<br />
RP<br />
RL D<br />
Wertstufe<br />
- ↓ - - - 7 Wert: mittel<br />
- k. A. - - - 7 Wert: mittel<br />
- ↑ - - - 6 Wert: mittel<br />
- ↓ - - - 6 Wert: mittel<br />
- ↓ - - - 5 Wert: mittel<br />
Werteinheit/ wertgebende Kriterien<br />
Kulturraumtypische Fettwiese mit einer<br />
für frische, nährstoffreiche Böden typischen<br />
Artenzusammensetzung.<br />
Bundesweit rückläufiger Biotoptyp.<br />
Im Zusammenwirken mit dem angrenzenden<br />
Gehölzstreifen an der Bahntrasse<br />
Funktion als Trittsteinbiotop für<br />
Offenlandarten u. Arten der halboffenen<br />
Kulturlandschaft inmitten der intensiv<br />
genutzten Agrarlandschaft des<br />
Lößriedels; Beeinträchtigung durch isolierte<br />
Lage.<br />
Mischtyp von Nutz- und Ziergarten;<br />
wertgebend sind ältere Obstbäume.<br />
Lebensraumfunktionen für bedrohte<br />
Tierarten (z. B. Vögel) sind möglich.<br />
Kleines, naturraumtypisches Gebüsch<br />
stickstoffreicher, ruderaler Standorte<br />
am Siedlungsrand, anthropogen veränderte<br />
Standortbedingungen (v. a.<br />
Eutrophierung).<br />
Wegen negativer Randeffekte (Verkehr/<br />
Störungen) oder geringem Alter<br />
eingeschränkte Lebensraumfunktion<br />
i.d.R. für häufige u. weit verbreitete Arten.<br />
Kulturraumtypische Fettwiesengesellschaft;<br />
schmale, linienförmige Ausbildung<br />
an Landstrasse/ Radweg und Ackerrändern,<br />
durch häufige bzw. zu<br />
frühe Mahd floristisch etwas verarmt<br />
(grasreiche, blütenpflanzenarme Ausbildung).<br />
Im Bereich intensiv genutzter Flächen<br />
(Intensivacker, gewisse Bedeutung für<br />
den Biotopverbund, lineare Vernetzungsstruktur).<br />
- → - - - 4 Wert: mittel - gering<br />
Artenarmer Biotoptyp aus wenigen Allerweltsarten<br />
auf anthropogen veränderten<br />
Standorten (erhöhter Nährstoffgehalt<br />
des Bodens).<br />
Seite 25
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Kürzel Biotoptyp<br />
EA1 Typische Glatthaferwiese<br />
(höhere Trophie,<br />
kleinflächige Ausbildung<br />
im Siedlungsbereich)<br />
EB1 Fettweide, Neueinsaat<br />
(Pferdekoppel)<br />
HJ3 Mischtyp von Nutz-<br />
und Ziergarten<br />
KB11 Ruderaler Glatthaferbestand<br />
(linienförmiger<br />
Saum in der Feldflur)<br />
Seite 26<br />
Fortsetzung Tab. 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet<br />
(Biotoptypen mit Vorkommen im Plangebiet sind durch Fettdruck gekennzeichnet)<br />
Gefährdung nach Roter Liste<br />
RL D/ Tendenz<br />
Biotoptyp Gesellschaft<br />
RL<br />
SW<br />
RL<br />
RP<br />
RL D<br />
Wertstufe<br />
Werteinheit/ wertgebende Kriterien<br />
- ↓ - - - 4 Wert: mittel - gering<br />
Kulturraumtypische Fettwiesengesellschaft;<br />
kleinflächige Ausbildung im besiedelten<br />
Bereich (Hausgarten).<br />
Eingeschränkte Lebensraumfunktion<br />
durch untypisch geringe Größe, isolierte<br />
Lage und negative Randeffekte/ Störungen<br />
im Siedlungsbereich.<br />
- ↑ - - - 4 Wert: mittel - gering<br />
Mit Pferden beweidetes, derzeit noch<br />
artenarmes Saatgrasland mit Kräutern<br />
auf ehemaligen Ackerflächen, wechseltrocken<br />
mit einzelnen Magerkeitszeigern<br />
(Kleiner Wiesenknopf).<br />
Potenzial für die kurz- bis mittelfristige<br />
Entwicklung blütenpflanzenreicher Bestände<br />
ist vorhanden; Funktion als<br />
Trittsteinbiotop für Offenlandarten u.<br />
Arten der halboffenen Kulturlandschaft<br />
inmitten der intensiv genutzten Agrarlandschaft<br />
des Lößriedels; Beeinträchtigung<br />
durch isolierte Lage.<br />
- k. A. - - - 4 Wert: mittel - gering<br />
Garten, der sowohl der Nutzpflanzenproduktion<br />
als auch dem Anbau von<br />
Zierpflanzen dient; teilweise mit heimischen<br />
Gehölzen aber ohne älteren<br />
Baumbestand.<br />
Lebensraumfunktionen i.d.R. für häufige<br />
u. weit verbreitete Arten.<br />
- → - - - 4 Wert: mittel - gering<br />
Artenarmer bis höchsten mäßig artenreicher<br />
Grassaum aus häufigen und<br />
weit verbreiteten Arten an Äckern und<br />
Wegen.<br />
Säume erreichen nicht die naturschutzfachlich<br />
wünschenswerte Mindestbreite<br />
von ca. 3-5 m.<br />
Im Bereich intensiv genutzter Flächen<br />
Bedeutung für den Biotopverbund (lineare<br />
Vernetzungsstruktur).
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Fortsetzung Tab. 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet<br />
Kürzel Biotoptyp<br />
KB12 Sonstige grasreiche,<br />
ausdauernde<br />
Ruderalvegetation<br />
(linienförmiger<br />
Saum in der Feldflur)<br />
KB13,<br />
KB13/LD1<br />
LD1/KB12/<br />
BK11<br />
Ruderale Krautbeständestickstoffreicher<br />
Standorte,<br />
teilweise mit Übergängen<br />
zu Brennessel-Dominanzbestand(linienförmige<br />
Säume an<br />
der Bahntrasse)<br />
Komplex aus<br />
Brennessel-<br />
Dominanzbestand<br />
u. grasreicher,<br />
ausdauernder<br />
Rueralvegetation,<br />
Kratzbeeren-<br />
Gestrüpp<br />
(Saum am Beginn<br />
des Hohlwegs/<br />
Hohlwegesböschung)<br />
EA2/HM11 Ruderale Glatthaferwiese/<br />
Trittrasen<br />
(Biotopkomplex)<br />
EA3 Fragmentarische<br />
Glatthaferwiese<br />
(Biotoptypen mit Vorkommen im Plangebiet sind durch Fettdruck gekennzeichnet)<br />
Gefährdung nach Roter Liste<br />
RL D/ Tendenz<br />
Biotoptyp Gesellschaft<br />
RL<br />
SW<br />
RL<br />
RP<br />
RL D<br />
Wertstufe<br />
Werteinheit/ wertgebende Kriterien<br />
- → - - - 4 Wert: mittel - gering<br />
- → - - - 4 Wert: mittel - gering<br />
- → - - - 4 Wert: mittel - gering<br />
- → - - - 3 Wert: mittel - gering<br />
- → - - - 3 Wert: mittel - gering<br />
Artenarmer Gras- u. Krautsaum aus häufigen<br />
und weit verbreiteten Arten (hoher Anteil der<br />
Tauben Trespe [Bromus sterilis] und nitrophiler<br />
Kräuter [z. B. Brennessel] auf stickstoffreichen<br />
Standorten zwischen Ortsrand und<br />
Intensivacker.<br />
Saum erreicht die naturschutzfachlich wünschenswerte<br />
Mindestbreite von ca. 3 m.<br />
Im Bereich intensiv genutzter Flächen Bedeutung<br />
für den Biotopverbund (lineare Vernetzungsstruktur).<br />
Artenarme Kraut- u. Grassäume aus häufigen<br />
und weit verbreiteten, nährstoff- u. stickstoffliebenden<br />
Arten entlang der Bahntrasse; teilweise<br />
Dominanzbestände der Brennessel<br />
(Urtica dioica); durch regelmäßige Unterhaltung<br />
gehölzfrei/-arm.<br />
Säume erreichen die naturschutzfachlich<br />
wünschenswerte Mindestbreite von ca. 3-5<br />
m.<br />
Im Zusammenwirken mit den angrenzenden,<br />
mit Gehölzen bewachsenen Böschungen<br />
Bedeutung für den Biotopverbund (lineare<br />
Vernetzungsstruktur).<br />
Artenarmer Kraut- u. Grassaum sowie Gestrüpp<br />
aus häufigen und weit verbreiteten,<br />
nährstoff- u. stickstoffliebenden Arten am Beginn<br />
des Hohlwegs (Randbereich Fettweide)<br />
bzw. auf der Böschung, teilweise Dominanz<br />
der Brennessel (Urtica dioica).<br />
Saum erreicht die naturschutzfachlich wünschenswerte<br />
Mindestbreite von ca. 3-5 m.<br />
Im Zusammenwirken mit den angrenzenden<br />
Hecken der Hohlwegsböschung Bedeutung<br />
für den Biotopverbund (lineare Vernetzungsstruktur).<br />
Artenarmer Biotopkomplex aus wenigen Allerweltsarten<br />
auf anthropogen veränderten<br />
Standorten (Tritt-/ Fahrbelastung, erhöhter<br />
Nährstoffgehalt des Bodens).<br />
Kulturraumtypische Fettwiesengesellschaft<br />
höherer Trophie, häufige Mahd, floristisch<br />
verarmt.<br />
Seite 27
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Kürzel Biotoptyp<br />
BZ1, BZ2,<br />
BZ3<br />
Seite 28<br />
Fortsetzung Tab. 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet<br />
Naturraum- und standortfremde<br />
Hecken und<br />
Gebüsche (Zierhecke,<br />
Pflanzenbeet mit Zierstrauchpflanzung,Fliedergebüsch)<br />
HB/LA1 Junge Ackerbrache mit<br />
ruderaler, frischer bis<br />
mäßig trockener Annuellenflur<br />
(Biotoptypen mit Vorkommen im Plangebiet sind durch Fettdruck gekennzeichnet)<br />
Gefährdung nach Roter Liste<br />
RL D/ Tendenz<br />
Biotoptyp Gesellschaft<br />
RL<br />
SW<br />
RL<br />
RP<br />
RL D<br />
Wertstufe<br />
Werteinheit/ wertgebende Kriterien<br />
- → - - - 3 Wert: mittel - gering<br />
- → - - - 3 Wert: mittel - gering<br />
i.d.R. naturferne, arten-/ strukturarme<br />
Zierstrauchpflanzungen im besiedelten<br />
Bereich: gepflegte Zierhecke (aus Berberitze,<br />
Weißdorn, Buchs u. Koniferen)<br />
im Bereich der Gärten östlich Höhenweg,<br />
Pflanzenbeet mit niedriger Zierstrauchpflanzung<br />
auf dem Feuerwehrgelände,<br />
verwildertes Fliedergebüsch<br />
auf dem Grundstück im Süden des<br />
Plangebiets.<br />
Anthropogen stark veränderte Standorte,<br />
untergeordnete Lebensraumfunktion<br />
für einzelne Allerweltsarten.<br />
Artenarmer Biotoptyp der Kulturlandschaft<br />
aus häufigen, nährstoff-/ stickstoffliebenden<br />
Ackerunkräutern und<br />
Ruderalarten sowie Restbeständen der<br />
angebauten Kulturpflanzen (Raps).<br />
HM11 Trittrasen - → - - - 3 Wert: mittel - gering<br />
Trittrasen im besiedelten Bereich, mäßig<br />
artenreich, untergeordnete Lebensraumfunktion<br />
für heimische Arten.<br />
HJ2 Nutzgarten - k. A. - - - 3 Wert: mittel - gering<br />
LD1 Brennessel-<br />
Dominanzbestand<br />
Arten-/ strukturarmer Garten, der v. a.<br />
der Nutzpflanzenproduktion dient; untergeordnete<br />
Lebensraumfunktion für<br />
heimische Arten.<br />
- → - - - 3 Wert: mittel - gering<br />
Kleinflächige, sehr artenarme Ruderalbestände<br />
mit vorherrschender Brennessel<br />
(Urtica dioca) auf frischen stickstoffreichen<br />
(eutrophierten) Standorten<br />
an Ackerrändern.<br />
Lebensraumfunktionen für häufige u.<br />
weit verbreitete Arten; im Zusammenwirken<br />
mit angrenzenden Saumstrukturen<br />
Bedeutung im Biotopverbund.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Fortsetzung Tab. 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet<br />
Kürzel Biotoptyp<br />
VB1 Grasweg/ unbefestigter<br />
Feldweg<br />
HA1, HA2,<br />
HA3<br />
(Biotoptypen mit Vorkommen im Plangebiet sind durch Fettdruck gekennzeichnet)<br />
Intensivacker (einschl.<br />
mehrjährige Sonderkulturen),<br />
Feldgarten<br />
HK1 Obstanlage über Ruderalvegetation<br />
HI0 Vegetationsfreie Fläche,<br />
unversiegelt<br />
Gefährdung nach Roter Liste<br />
RL D/ Tendenz<br />
Biotoptyp Gesellschaft<br />
RL<br />
SW<br />
RL<br />
RP<br />
RL D<br />
Wertstufe<br />
3 ↓ 3 - - 3 Wert: gering-mittel<br />
Werteinheit/ wertgebende Kriterien<br />
Bundesweit gefährdeter, aber regional<br />
zumindest stellenweise noch häufiger<br />
Biotoptyp der Kulturlandschaft.<br />
Kann in Abhängigkeit von der NutzungsintensitätTeillebensraumfunktionen<br />
für heimische Arten (i.d.R. Allerweltsarten)<br />
erfüllen; in intensiv genutzten<br />
Gebieten u. U. Bedeutung für den<br />
Biotopverbund (lineare Vernetzungsstruktur);<br />
im Vergleich zu befestigten<br />
bzw. stark versiegelten Wegen ist die<br />
Trennwirkung für nicht flugfähige, bodenlebende<br />
Insektenarten gering bzw.<br />
nicht signifikant (MADER et al. 1988).<br />
- → - - - 2 Wert: mittel - gering<br />
Intensiv bewirtschaftete Ackerflächen<br />
(inkl. mehrjährige Sonderkulturen<br />
[Rhabarberfelder] u. Feldgärten, wildkrautarm;<br />
i.d.R. nur untergeordnete Lebensraumfunktion<br />
für wenige, weit verbreitete<br />
Offenlandarten.<br />
Für viele Arten Barriere im Biotopverbund;<br />
vielfach angrenzende Flächen<br />
belastend (Eutrophierung, Herbizideinsatz).<br />
- ↑ - - - 2 Wert: mittel - gering<br />
Kleiner strukturarmer, nieder- bis mittelstämmiger<br />
Obstbestand über artenarmer,<br />
ruderaler Grasflur (Bestand der<br />
Tauben Trespe) in intensiv ackerbaulich<br />
genutzter Umgebung; untergeordnete<br />
Funktion für wenige, weit verbreitete<br />
Arten.<br />
- k. A. - - - 2 Wert: mittel - gering<br />
Zum Zeitpunkt der Aufnahme vegetationsfreie<br />
Fläche (ehem. Gartenanlage),<br />
Potenzial für die Entwicklung ruderaler<br />
Pionierfluren, zukünftige Entwicklung<br />
unklar.<br />
HT1 Brennholzstapel - k. A. - - - 2 Wert: mittel - gering<br />
Brennholzstapel auf ruderaler Fettwiese,<br />
einige (Teil-)Lebensraumfunktionen<br />
für weit verbreitete oder spezialisierte<br />
Arten, kein dauerhafter Lebensraum für<br />
heimische Arten, Beeinträchtigung höherwertiger<br />
Grünlandflächen durch Flächeninanspruchnahme.<br />
Seite 29
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Kürzel Biotoptyp<br />
KB12 Sonstige grasreiche,<br />
ausdauernde Ruderalvegetation(kleinflächige<br />
Säume im besiedelten<br />
Bereich)<br />
LD2 Dominanzbestand der<br />
Tauben Trespe<br />
Seite 30<br />
Fortsetzung Tab. 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet<br />
(Biotoptypen mit Vorkommen im Plangebiet sind durch Fettdruck gekennzeichnet)<br />
Gefährdung nach Roter Liste<br />
RL D/ Tendenz<br />
Biotoptyp Gesellschaft<br />
RL<br />
SW<br />
RL<br />
RP<br />
RL D<br />
Wertstufe<br />
Werteinheit/ wertgebende Kriterien<br />
- → - - - 2 Wert: mittel - gering<br />
Kleinflächige, artenarme Grasbestände<br />
aus wenigen, weit verbreiteten Ruderalarten<br />
(v. a. Mäuse-Geste [Hordeum<br />
murinum], Taube Trespe [Bromus sterilis],<br />
Weidelgras [Lolium perenne] im<br />
besiedelten Bereich (Wegböschung/<br />
Vorgarten).<br />
Nur einige wenige Lebensraumfunktionen,<br />
kein dauerhafter Lebensraum für<br />
heimische Arten.<br />
- → - - - 2 Wert: mittel - gering<br />
HA4 Acker mit Folienhaus - k. A. - - - 1 Wert: gering<br />
BZ2 Pflanzenbeet mit artenarmerZierstrauchpflanzung<br />
und gebietsfremdem<br />
Einzelbaum<br />
(Straßenbegleitgrün)<br />
HD1 Bahnlinie (Gleis-/<br />
Schotterkörper)<br />
VB3 Kies- oder Schotterweg<br />
- → - - - 1 Wert: gering<br />
- ↑ - - - 1 Wert: gering<br />
- ↑ - - - 1 Wert: gering<br />
Kleinflächiger Dominanzbestand der<br />
Tauben Trespe (Bromus sterilis) inmitten<br />
einer intensiv genutzten Ackerfläche;<br />
i.d.R. nur untergeordnete Lebensraumfunktion<br />
für wenige, weit verbreitete<br />
Offenlandarten; Beeinträchtigung<br />
durch intensive Ackernutzung (Stoffeinträge,<br />
Störungen.<br />
Folienhaus zum Anbau von Salat, Gemüse<br />
etc., derzeit ungenutzt, verdichteter<br />
Boden, vegetationsfrei.<br />
Kein dauerhafter Lebensraum für heimische<br />
Arten; Folientunnel trennen die<br />
Flächen von der natürlichen Umgebung<br />
u. stellen ein anthropogen beeinflusstes<br />
Innenklima her, das ganz auf die Bedürfnisse<br />
der jeweiligen Kultur abgestimmt<br />
ist.<br />
Arten- u. strukturarmes Pflanzenbeet<br />
mit Fünffingerstrauch u. einem jungen,<br />
solitären Amerikanischen Amberbaum<br />
(Liquidambar styraciflua) am Straßenrand<br />
im Süden des Plangebietes.<br />
Nur einige wenige Lebensraumfunktionen,<br />
kein dauerhafter Lebensraum für<br />
heimische Arten.<br />
Vegetationsfreier Schienenweg, Schotterkörper<br />
mit Teil-<br />
Lebensraumfunktionen für einzelne,<br />
i.d.R. weit verbreitete Arten.<br />
Kein dauerhafter Lebensraum für heimische<br />
Arten. Barriere im Biotopverbund.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Fortsetzung Tab. 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet<br />
Kürzel Biotoptyp<br />
VA, VB4,<br />
VB5, VB6<br />
Verkehrsstrassen (asphaltiert),Betonplattenweg,<br />
Asphaltweg,<br />
gepflasterte Fläche<br />
VG, VS Wohngebäude,<br />
Schuppen<br />
(Biotoptypen mit Vorkommen im Plangebiet sind durch Fettdruck gekennzeichnet)<br />
Gefährdung nach Roter Liste<br />
RL D/ Tendenz<br />
Biotoptyp Gesellschaft<br />
RL<br />
SW<br />
RL<br />
RP<br />
RL D<br />
Wertstufe<br />
- ↑ - - - 0 Ohne Wert<br />
- ↑ - - - 0 Ohne Wert<br />
Aus artenschutzrechtlicher Sicht relevant sind insbesondere die Lebensraumfunktionen<br />
der Biotopbestände für die (bzw. die möglichen Vorkommen der) Fledermäuse,<br />
Vögel und Reptilien.<br />
2.2 Boden<br />
Den geologischen Untergrund und das Ausgangsmaterial der Bodenentwicklung<br />
bilden im Bereich der Niederterrasse die eiszeitlichen Schotter und Sande des<br />
Rheins, die auf den Riedelflächen von äolischen, in der Regel mehrere Meter<br />
mächtigen Sedimentdecken aus Löß und Lößlehm überlagert werden. Die vorherrschenden<br />
Bodentypen sind hier basenreiche Parabraunerden (MIESS & MIESS<br />
1993) bzw. Tschernosem-Parabraunerden (GEOLOGISCHES LANDESAMT o. J.).<br />
Als Ergebnis der Jahrzehnte bis Jahrhunderte andauernden landwirtschaftlichen<br />
Bodennutzung sind aus diesen ursprünglichen Bodentypen in unterschiedlichem<br />
Maße anthropogen überformte Kulturböden entstanden. In zwei Bereichen im Südwesten<br />
des Plangebiets wurden Böden kartiert, in denen der ursprüngliche Bodentyp<br />
völlig verändert wurde (sog. anthropogene Böden oder Kultosole). Diese Bereiche<br />
werden zu den rigolten Böden (Rigosole) gerechnet, die durch tiefgründige<br />
Bodenumschichtung entstanden sind. Im Bereich aufgeschütteter, bebauter oder<br />
versiegelter Flächen finden sich darüber hinaus anthropogene Auftragsböden.<br />
Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Böden erfolgt in Anlehnung an das Gutachten<br />
der PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT GMBH (2003) sowie den<br />
Veröffentlichungen zu schutzwürdigen und schutzbedürftigen Böden in Rheinland-<br />
Pfalz (MFUF 2005 sowie www.lgb-rlp.de). Die Leistungsfähigkeit des Schutzguts<br />
Boden wird anhand von folgenden (Teil-)Funktionen ermittelt:<br />
• Boden als Lebensraum für Pflanzen (Standortpotential für natürliche Pflanzen<br />
sowie natürliche Bodenfruchtbarkeit),<br />
• Funktion des Bodens im Wasserhaushalt,<br />
Werteinheit/ wertgebende Kriterien<br />
Versiegelte Fläche ohne Lebensraumfunktion<br />
für heimische Arten bzw. mit<br />
hoher Trennwirkung im Biotopverbund.<br />
Überbaute Flächen im Plangebiet ohne<br />
Lebensraumfunktion für heimische Arten<br />
bzw. mit hoher Trennwirkung im<br />
Biotopverbund.<br />
Seite 31
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 32<br />
• Boden als Filter und Puffer für Schadstoffe,<br />
• Boden als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.<br />
U. a. im Hinblick auf die Bedeutung des Bodens als „Archiv für die Natur- und Kulturgeschichte“<br />
sowie als „Lebensraum für Pflanzen (natürliche Bodenfruchtbarkeit)“<br />
bestehen Überschneidungen mit dem Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter<br />
(siehe Kap. 2.7). In die Beurteilung der Schutzwürdigkeit bzw. des Grads der<br />
Funktionserfüllung des Bodens fließen Empfindlichkeiten und Vorbelastungen<br />
(insb. im Hinblick auf Erosion, Verdichtung, stoffliche Einwirkungen, Veränderung<br />
der natürlichen Bodenschichtung, Versiegelung) mit ein.<br />
• Boden als Lebensraum für Pflanzen (Standortpotential für natürliche<br />
Pflanzen sowie natürliche Bodenfruchtbarkeit)<br />
Naturnahe Extrem- bzw. Sonderstandorte (bspw. hinsichtlich Wasser-, Luft- oder<br />
Nährstoffhaushalt), auf deren Vorhandensein spezialisierte und häufig gefährdete<br />
Tiere und Pflanzen angewiesen sind, existieren im Plangebiet nicht. Für die Standorte<br />
wird kein besonderes Biotopentwicklungspotential ausgewiesen (siehe<br />
www.lgb-rlp.de).<br />
Die landwirtschaftlich genutzten Freiflächen des Plangebiets mit weitgehend unveränderter<br />
Bodenhorizontierung verfügen über einen mittleren anthropogenen<br />
Einfluss (euhemerobe Böden 7 ). Bei den Böden mit tiefgründigen Bodenumlagerungen<br />
(insb. Rigosole), Bodenabgrabungen und -aufschüttungen (insb. Bahntrasse)<br />
bzw. bei den befestigten oder versiegelten Böden handelt es sich um anthropogen<br />
hochgradig veränderte Standorte (polyhemerobe bis metahemerobe Böden).<br />
Weitgehend naturbelassene Böden sind somit im Plangebiet nicht vorhanden.<br />
Das natürliche Ertragspotential der Böden für die ackerbauliche Nutzung wird im<br />
Süden/ Südwesten als hoch, auf den übrigen Flächen als sehr hoch eingestuft<br />
(siehe www.lgb-rlp.de). Die Ackerzahl liegt um die 80. Der Bodenerodierbarkeitsfaktor<br />
(K-Faktor) als Bestandteil der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung bzw. als<br />
ein Maß für die Erosionsanfälligkeit des Oberbodens wird als sehr hoch bis extrem<br />
hoch eingeschätzt. Bei größeren Hangneigungen und fehlender Vegetationsbedeckung<br />
ist von einer sehr hohen Erosionsgefährdung (Bodenabtrag durch Wasser)<br />
auszugehen.<br />
• Funktion des Bodens im Wasserhaushalt<br />
Die Bodenoberfläche und der Bodenkörper beeinflussen alle Prozesse des Wasserkreislaufs.<br />
Dem Boden kommt hierbei insbesondere die Fähigkeit zu, durch<br />
Aufnahme von Niederschlagswasser den Abfluss zu verzögern bzw. zu verhindern.<br />
Das im Boden gespeicherte Wasser steht den Pflanzen zur Transpiration zur<br />
Verfügung oder es trägt zur Grundwasserspende bei. Das Wasserrückhaltevermögen<br />
der schluffig-lehmigen/ schluffig-tonigen Böden des Plangebiets ist als hoch<br />
(bei Böden mit höheren Sandanteilen) bis sehr hoch einzustufen.<br />
7 Der Grad des Kultureinflusses am Standort kann mit Hilfe des Hemerobiesystems beschrieben<br />
werden. Unter "Hemerobie" wird die Gesamtheit aller Wirkungen verstanden, die bei beabsichtigten<br />
und nicht beabsichtigten Eingriffen des Menschen in Ökosysteme stattfinden (NEIDHARDT<br />
& BISCHOPINCK 1994).
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
• Boden als Filter und Puffer für Schadstoffe<br />
Die im Plangebiet natürlicherweise vorherrschenden schluffig-tonigen/ schluffig<br />
lehmigen Oberböden, die stellenweise von Fein- bzw. Mittelsanden durchmischt<br />
bzw. unterlagert werden (LVA 1980, INGENIEURBÜRO HOHLWEGLER 1996) weisen<br />
je nach Sandanteil ein hohes bis sehr hohes Retentionsvermögen für anorganische<br />
sorbiere Schadstoffe (insb. Schwermetalle) bzw. ein hohes bis sehr hohes<br />
Säurepuffervermögen auf. Die Filterfunktion für nicht sorbierbare Stoffe wird ebenfalls<br />
als hoch eingestuft (geringe bis sehr geringe Nitratauswaschungsgefährdung,<br />
siehe www.lgb-rlp.de).<br />
Über die aktuelle Nähr- und Schadstoffbelastung des Bodens im Plangebiet liegen<br />
keine detaillierten Angaben vor. Die Hintergrundgehalte von Blei, Cadmium,<br />
Chrom u. ä. entsprechen dem Niveau umgebender Flächen und liegen unterhalb<br />
der Vorsorgewerte der Bundesbodenschutzverordnung (siehe www.lgb-rlp.de).<br />
Neben diffusen Einträgen aus der Luft trägt die intensive ackerbauliche Nutzung<br />
zur Nähr- und Schadstoffbelastung des Bodens bei. Altablagerungen wurden im<br />
Plangebiet selbst nicht nachgewiesen, wohl aber angrenzend (siehe Kap. 1.6.1).<br />
• Boden als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte<br />
Naturhistorisch bedeutsame Böden (seltene, naturbelassene Böden mit geringer<br />
Reproduzierbarkeit wie beispielsweise Niedermoore oder Dünen) kommen im<br />
Plangebiet nicht vor. Ebenso wurden im Gebiet selbst keine kulturhistorisch bedeutsamen<br />
Böden (Grabungsschutzgebiete/ archäologische Kulturdenkmale, Ackerterrassen,<br />
historische Weinbergslagen o. ä.) erfasst (siehe auch Kap. 1.6.1).<br />
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die mäßig vorbelasteten Böden des<br />
Plangebiets im Hinblick auf ihr natürliches Ertragspotential für die ackerbauliche<br />
Nutzung (bei gleichzeitig hoher Erosionsempfindlichkeit), ihres Wasserrückhaltevermögens<br />
sowie ihres Retentionsvermögens für Schadstoffe von hoher bis sehr<br />
hoher Bedeutung sind.<br />
2.3 Wasser<br />
2.3.1 Oberflächengewässer<br />
Im Plangebiet sind keine klassifizierten, dauerhaften Oberflächengewässer vorhanden.<br />
Entlang der Landwirtschaftswege finden sich flache Rinnen, die der Entwässerung<br />
dienen und episodisch Wasser führen.<br />
2.3.2 Grundwasser<br />
Die Leistungsfähigkeit des Landschaftsfaktors Grundwasser wird anhand von folgenden<br />
Funktionen und Leistungen ermittelt:<br />
Seite 33
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 34<br />
• Wasserdargebot im Hinblick auf die Trinkwassergewinnung,<br />
• Wasserreservoir für die natürliche Vegetation und Lebensraum von Tieren (oberflächennahes<br />
Grundwasser).<br />
• Wasserdargebot im Hinblick auf die Trinkwassergewinnung<br />
Die Talkiesfüllung der Rheinebene, die den geologischen Untergrund im Planungsraum<br />
bildet, stellt im Hinblick auf das Grundwasserdargebot einen überregional<br />
bedeutsamen Grundwasserleiter dar und wird intensiv für die Wassergewinnung<br />
genutzt. Im Plangebiet selbst liegt jedoch eine geringe Grundwasserhöffigkeit vor<br />
(Kapazität potentieller Grundwasserfassungsanlagen von 0 - 1,5 Mio cbm/a; siehe<br />
ARUM 1990). Die Grundwasserneubildungsrate vor Ort ist mit Sickerwassermengen<br />
von > 75 - 100 mm/a als gering bis mittel einzustufen (siehe www.geoportalwasser.rlp.de).<br />
Die klimatische Wasserbilanz aus Niederschlag und Verdunstung<br />
für die Monate April bis September (Mittelwert aus 1961-1990) fällt sogar negativ<br />
aus (Mittelwert April bis September: -62,03 mm, Monatsmittel: -10,34 mm).<br />
Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Schadstoffen,<br />
die potentiell zurückgehalten werden können, ist aufgrund des hohen Retentionsvermögens<br />
der Deckschichten, der überwiegend hohen Grundwasserflurabstände<br />
(siehe unten) und der geringen bis mittleren Grundwasserneubildungsrate als gering<br />
zu bewerten. Die Nitratauswaschungsgefährdung wird ebenfalls als gering bis<br />
sehr gering eingestuft (siehe Kap. 2.2).<br />
Wasserrechtliche Schutzgebietsausweisungen bestehen nicht (siehe Kap. 1.6.1).<br />
• Wasserreservoir für die natürliche Vegetation und Lebensraum von Tieren<br />
(oberflächennahes Grundwasser)<br />
Die mittleren Grundwasserflurabstände liegen im Norden des Plangebiets bei > 5 -<br />
8 m unter Flur bzw. im Süden des Gebiets bei > 3 - 5 m unter Flur (MFU & MFUG<br />
1988). Diese Werte spiegeln im vieljährigen Mittel etwa mittlere Grundwasserstände<br />
wider. Nach ausgesprochenen Trockenperioden (Flurabstand am 29.09. -<br />
01.10.2003, siehe UM BA-WÜ & MUFV RLP 2007) können die Grundwasserstände<br />
auf 10 - 15 m unter Flur, stellenweise auf > 15 m unter Flur absinken (Grundwasserhöhengleiche<br />
bei etwa 119 - 120 m ü.NN). Die Grundwasserfließrichtung ist<br />
nach Südosten ausgerichtet.<br />
Die Funktion des Grundwassers als standortprägendes Element für die natürliche<br />
Vegetation sowie als Lebensraum von Tieren, die insbesondere in Bereichen mit<br />
oberflächennahem Grundwasser (< 2 m) zum Tragen kommt, ist vorliegend somit<br />
nicht von Bedeutung.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
2.4 Klima/ Luft<br />
Das Plangebiet liegt inmitten einer ausgeprägten Wärmeinsel, die sich auf das gesamte<br />
Oberrhein-Tiefland erstreckt. Die mittlere jährliche Lufttemperatur beträgt 9 -<br />
10°C. Die Zahl von über 40 Sommertagen (Lufttemperatur > 25°C) unterstreicht<br />
die thermische Begünstigung des Planungsraums und der angrenzenden Bereiche<br />
(DEUTSCHER WETTERDIENST 1957). Das Plangebiet liegt im Bereich mittlerer<br />
jährlicher Niederschlagssummen von etwa 700 mm. Diese fallen zu einem großen<br />
Teil im Sommerhalbjahr als heftige Gewitterschauer.<br />
Die Hauptwindrichtungen sind SSW und SW bzw. NNO und NO (MALSCH 1953).<br />
An etwa 85 Tagen im Jahr werden im Planungsraum lang andauernde Inversionen<br />
beobachtet (nach MAYER 1972). Gehäuft treten Inversionswetterlagen dabei in<br />
den strahlungsarmen Jahreszeiten Winter und Herbst auf.<br />
Die klimatische Leistungsfähigkeit des Plangebiets wird anhand folgender ausgleichender<br />
bzw. entlastender lokalklimatischer Funktionen bzw. folgender belastender<br />
Faktoren ermittelt:<br />
• Lokalklimatisch entlastende bzw. belastende Klimatope,<br />
• Lokal wirksame Windsysteme und Wirkungsräume,<br />
• Emissionen und Luftbelastung.<br />
• Lokalklimatisch entlastende bzw. belastende Klimatope<br />
Die Ackerflächen des Plangebiets und in der Umgebung weisen einen extremen<br />
Tages- und Jahresgang der Temperatur und Feuchte sowie sehr geringe Windströmungsveränderungen<br />
auf (Freiland-Klimatop 8 ). Damit ist eine intensive nächtliche<br />
Frisch- und Kaltluftproduktion verbunden. Hinzu kommen die Entlastungsfunktionen<br />
der im Gebiet vorkommenden Gehölzbestände (insb. stark gedämpfte<br />
Tages- und Jahresgänge der Temperatur und Feuchte, Filter gegenüber Luftschadstoffen);<br />
sie sind aufgrund der Kleinflächigkeit und linearen Struktur der Gehölzbestände<br />
(insb. entlang der Bahntrasse, im Bereich des Hohlwegs) allerdings<br />
nur eingeschränkt/ begrenzt wirksam.<br />
Größere Gleisanlagen können freiland-ähnliche Eigenschaften aufweisen, wobei<br />
sie insbesondere örtlich bedeutsame Belüftungsfunktionen übernehmen können<br />
(siehe unten). Der Schotterbelag führt zu thermisch und hygrisch extremen Verhältnissen<br />
(große Tag-/ Nachtunterschiede bei der Strahlungs- und Lufttemperatur);<br />
er heizt sich beispielsweise tagsüber an der Oberfläche stark auf (an Sommertagen<br />
bis zu einer Temperatur von 70°C). Hierdurch wirken Bahnanlagen klimatisch<br />
auch auf ihr Umfeld ein; durch die Wärmeabstrahlung ist auch die Umgebungstemperatur<br />
leicht erhöht (um ca. 1 - 3°C) und die Luftfeuchtigkeit ist niedriger<br />
(um ca. 1 - 3 %, siehe EBA 2004). Zur Reichweite dieser Auswirkungen liegen keine<br />
näheren Untersuchungen vor. Nachts kühlt der Schotterkörper wiederum rasch<br />
ab.<br />
8 Als Klimatope werden Gebiete mit ähnlichen lokalklimatischen Ausprägungen des Temperaturverhaltens,<br />
der Durchlüftung und der Luftfeuchtigkeit bezeichnet.<br />
Seite 35
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 36<br />
Die Funktion der Freiflächen nördlich von <strong>Kandel</strong> als Kaltluftentstehungsgebiet ist<br />
aufgrund ihres unmittelbaren Bezugs, des Reliefs bzw. ihrer Lage in Hauptwindrichtung<br />
zum Siedlungsraum lokalklimatisch bedeutsam (sowohl für <strong>Kandel</strong><br />
als auch für den Ortsteil Minderslachen).<br />
Die befestigten, versiegelten und überbauten Flächen des Plangebiets (nur kleinflächig)<br />
und in seinem Umfeld (insb. Ortslage <strong>Kandel</strong>) weisen im Vergleich zur unbebauten<br />
Landschaft ein erhöhtes Temperaturniveau auf, das durch Wärmespeicherung<br />
und -abstrahlung versiegelter Flächen und von Baukörpern erzeugt wird.<br />
Die Luftfeuchtigkeit ist geringer. Des Weiteren wird durch die Bebauung die Luftzirkulation<br />
unterbrochen. Lokale Winde und Kaltluftströme werden behindert; Regionalwinde<br />
werden gebremst (Zunahme der Vertikalkomponente des Windes auf<br />
Kosten der horizontalen Windgeschwindigkeit). Die Erhöhung des Temperaturniveaus<br />
und die Unterbrechung der Luftzirkulation tragen dazu bei, dass der Schwüleeindruck<br />
im Siedlungsbereich verstärkt wird. Die im Siedlungsraum vermehrt auftretenden<br />
Emissionen (Industrie, Verkehr, Hausbrand etc.) bedingen erhöhte<br />
Schadstoff- und Staubkonzentrationen in der Luft. Diese belastenden Wirkungen<br />
werden durch angrenzende Freilandflächen mit ihren entlastenden Funktionen<br />
gemindert (siehe oben).<br />
• Lokal wirksame Windsysteme und Wirkungsräume<br />
Die auf den landwirtschaftlich genutzten Offenlandflächen des Lößriedels produzierte<br />
Frisch- und Kaltluft fließt - insbesondere bei windschwachen wolkenarmen<br />
Wetterlagen - von dort flächig entsprechend dem Geländegefälle in Richtung tiefer<br />
gelegener Bereiche ab (Hangabwinde). Im betrachteten Gebiet treten Hangabwinde<br />
vor allem in nördlicher und östlicher, im Süden des Plangebiets auch in südlicher<br />
Richtung auf. In Niederungen (wie bspw. in der nördlich gelegenen Erlenbachniederung)<br />
sammelt sich die Kaltluft und fließt von dort weiter in Richtung Osten<br />
ab (Kaltluftabflussbahn). Siedlungsflächen im Wirkungsbereich von Hangabwinden<br />
oder Kaltluftabflussbahnen erfahren durch diese eine klimatische Entlastung.<br />
Es ist davon auszugehen, dass die Siedlungsflächen am Nordwestrand von<br />
<strong>Kandel</strong> von den Hangabwinden aus dem Bereich der nördlich angrenzenden Freiflächen<br />
profitieren. Aufgrund der relativ geringen Größe des angeschlossenen<br />
Kaltluftentstehungsgebiets (nur bis zum nächstgelegenen Geländerücken reichend,<br />
ab dort Gelände nach Norden und Osten hin abfallend) und der mäßigen<br />
bis geringen Hangneigung sind die Hangabwinde allerdings relativ schwach ausgeprägt.<br />
Im Siedlungsbereich übernehmen häufig Bahnstrecken die Funktion von Luftleitbahnen,<br />
da sie breite Schneisen ohne Querbauwerke bilden. Durch ihre geringe<br />
Bodenrauigkeit, eine ausreichende Länge und Breite sowie durch einen möglichst<br />
geradlinigen Verlauf begünstigen sie den Luftaustausch innerhalb der Ortslage<br />
(Strömungsbahn). Die Kanalisierung der Luftströmungen ist in hohem Maße von<br />
den jeweiligen Strömungsrichtungen der Wetterlagen abhängig. Während windschwacher<br />
Hochdruckwetterlagen dienen die Luftleitbahnen als potenzielle Einströmschneisen<br />
für Frisch-/ Kaltluftabflüsse bzw. Flurwinde.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
• Emissionen und Luftbelastung<br />
Die oben genannten regionalen Klimadaten verdeutlichen, dass im Plangebiet in<br />
ausgeprägter Weise lufthygienisch kritische Wetterlagen gegeben sind. Es liegt<br />
deshalb in einem bioklimatischen Belastungsbereich. Im Sommer sorgen hohe<br />
Lufttemperaturen, geringe Luftbewegung, vermehrte Ein- und Gegenstrahlung und<br />
hohe relative Luftfeuchte häufig für Witterungsabschnitte, die als drückend-schwül<br />
und belastend empfunden werden. Hochdruckwetterlagen mit geringer lokaler<br />
Windzirkulation im Winterhalbjahr begünstigen die Entstehung und Persistenz von<br />
Kaltluft und Nebel, der von in dieser Jahreszeit in flachem Winkel einfallenden<br />
Strahlung nur schwer zu durchdringen und aufzulösen ist (langandauernde Inversionswetterlagen).<br />
Nach langjährigen Messungen des Zentralen Immissionsmessnetzes von Rheinland-Pfalz<br />
(u. a. LFUG 2003, LUWG 2004 - 2010) liegt im Planungsraum eine<br />
schwache bis mäßige Gesamtluftbelastung sowohl im Hinblick auf die mittlere Jahresbelastung<br />
als auch auf die Kurzzeitbelastung 9 vor. Bei Anwendung neuerer<br />
Verfahren zur Einstufung des Langzeit-Luftqualitätsindexes (siehe insb. LFU 2004)<br />
ist die Luftqualität im Untersuchungsgebiet als ausreichend bis schlecht zu bewerten.<br />
In den vergangenen Jahren wurden an der, dem Plangebiet am nächsten gelegenen<br />
Messstelle in Wörth a.Rh. keine Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinien<br />
(hier insbesondere Schutz der menschlichen Gesundheit) 10 im Hinblick<br />
auf SO2, NO2 und CO bzw. vereinzelte Überschreitungen im Hinblick auf Feinstaub<br />
(PM10) und Ozon erfasst. Die Anzahl der Überschreitungen für Partikel PM10 lag<br />
an der Messstation Wörth a.Rh. unterhalb der maximal zulässigen Überschreitungszahl<br />
je Kalenderjahr (nicht öfter als 35 mal pro Kalenderjahr). Bezüglich Ozon<br />
darf der Zielwert von 120 μg/m 3 (8h-MW) ab 2010 an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr<br />
überschritten werden. Dieser Wert wurde in den vergangenen Jahren<br />
an einer höheren Anzahl von Tagen überschritten. Vor allem bei austauscharmen<br />
Schönwetterperioden im Sommer kommt es infolge der geringen Bewölkung, der<br />
Sauerstoffproduktion des Waldes sowie hoher Stickoxidwerte in der Luft häufig zu<br />
einer hohen Ozonbelastung.<br />
Als lokaler Schadstoffemittent ist insbesondere der Kfz-Verkehr auf den umliegenden<br />
Straßen bedeutsam.<br />
2.5 Landschaft (Landschafts- und Stadtbild)<br />
Das Plangebiet ist naturräumlich gesehen Teil des Landschaftstyps einer durch<br />
den Klingbach bzw. den Erlenbach in West-Ost-Richtung gegliederten Lößplatte.<br />
9 Methodik der Ermittlung siehe INNENMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG 2004.<br />
10 Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid<br />
und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft; Richtlinie 2000/69/ EG des Europäischen<br />
Parlaments und des Rates vom 16. November 2000 über Grenzwerte für Benzol und<br />
Kohlenmonoxid in der Luft; Richtlinie 2002/3/EG des Europäischen Parlaments und des Rates<br />
vom 12. Februar 2002 über den Ozongehalt der Luft.<br />
Seite 37
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 38<br />
Die zwischen den Schotterkegeln des Klingbachs und des Erlenbachs höher gelegenen,<br />
lößbedeckten Riedelflächen laufen zum Rhein hin spitz zu. Morphologisch<br />
sowie im großräumigen Erscheinungsbild werden die Riedelflächen durch eine<br />
gewölbte Oberfläche mit flachen Buckeln und Dellen sowie die Weiträumigkeit der<br />
landwirtschaftlichen Nutzung geprägt. Am Südrand des Lößriegels liegen als siedlungsgeographische<br />
Leitlinie die charakteristischen Straßenortschaften („lange<br />
Dörfer“ entlang des Viehstrichs).<br />
Das Landschaftsbild des Plangebiets und seiner Umgebung ist durch weiträumige<br />
Sichtbeziehungen in westlicher, nördlicher und östlicher Richtung charakterisiert.<br />
Im Westen und Norden wird das Blickfeld durch die waldbestandenen Berge des<br />
Pfälzerwalds begrenzt (bedeutsame Raumkante). Die Kulissenwirkung der Berge<br />
wird zudem durch die nördlich des Plangebiets gelegenen Wald- und Gehölzbestände<br />
in der Erlenbachniederung verstärkt, deren Wipfel vom Norden des Plangebiets<br />
aus sichtbar sind. Im Westen sind die bei Minfeld stehenden Windräder erkennbar.<br />
Im Osten begrenzen Waldbestände westlich von Hatzenbühl/ Rheinzabern<br />
(Waldgebiet „Lichtenhart“) bzw. die Bebauung entlang der L 542 das Blickfeld.<br />
Die südliche Begrenzung des Sichtfelds bildet der Ortsrand von <strong>Kandel</strong> mit<br />
Wohnbebauung sowie dahinter liegende, höhere Einzelgebäude/ -objekte (insb.<br />
mit positiver Wirkung: Kirchturm bzw. mit negativer Wirkung: Hochhaus), Das<br />
Plangebiet wird zudem durch die im Einschnitt verlaufende gehölzbestandene<br />
Bahntrasse visuell vom östlich angrenzenden Freiraum getrennt.<br />
Der Ortsrand von <strong>Kandel</strong> weist je nach Art und Geschlossenheit/ Durchgängigkeit<br />
der Eingrünung unterschiedliche Gestaltungsqualitäten auf. Reste gebietstypischer<br />
Eingrünung mit Feldgärten/ Grabeland in direkter Verlängerung der Wohnbebauung<br />
finden sich noch nördlich der Stresemann-/ Hubstraße. Ansonsten besteht die<br />
Eingrünung aus ± lückigen, z. T. nicht gebietstypischen Gehölzbeständen in den<br />
Hausgärten, die unmittelbar an die intensiv landwirtschaftlich genutzten Freiräume<br />
angrenzen. Die Gebäudekubaturen der Bebauung am Ortsrand wirken weitgehend<br />
maßstäblich.<br />
Trotz der exponierten Lage des Plangebiets ist es im Wesentlichen von Norden<br />
(von den nördlich verlaufenden Landwirtschaftswegen bis auf Höhe des Ortsrands<br />
von Minderslachen, im weiteren Umfeld vermutlich auch von den nördlich gelegenen<br />
Lößriedelflächen aus) aus einsehbar. Von den übrigen Richtungen aus verhindern,<br />
das Relief, die bestehende Bebauung oder lineare Gehölzbestände die<br />
Einsichtnahme auf das Gebiet.<br />
Das Plangebiet selbst und seine nähere Umgebung sind vor allem durch offene,<br />
flächenhaft wirksame Ackerflächen geprägt. Naturnahe, raumgliedernde und raumdifferenzierende<br />
Strukturen fehlen weitgehend. Lediglich die gebietstypischen,<br />
dichten Gehölzbestände entlang der tiefer liegenden Bahnlinie sowie wenige Einzelbäume<br />
am Rande der Landwirtschaftswege untergliedern die ansonsten strukturarme<br />
Ackerlandschaft. Mit dem kurzen Hohlweg in der Verlängerung der Hubstraße<br />
(Hubhofweg) befindet sich darüber hinaus ein Relikt eines charakteristischen<br />
Landschaftselements der Lößriedel-Landschaft im Plangebiet.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Die nördlich und westlich des Plangebiets gelegenen landwirtschaftlichen Aussiedlungen<br />
mit Lagerhallen und Folien-Gewächshäusern sind größtenteils nur ungenügend<br />
in die Landschaft eingebunden. Die Gebäude sind lediglich durch einzelne,<br />
lückige Gehölzbestände eingegrünt; dichtere Gehölzbestände finden sich nur im<br />
Bereich der südwestlich gelegenen Lagerhallen.<br />
Aufgrund seiner Eigenart, Vielfalt, Möglichkeit zur Naturbeobachtung und Raumwirkung<br />
sowie bestehender Vorbelastungen ist die Landschaftsbildqualität des<br />
Plangebiets als mittel-gering einzuschätzen (vgl. MIESS & MIESS 1993). Obwohl<br />
lediglich einzelne landschaftlich bedeutsame Strukturen vorhanden sind, wirken<br />
sich die Reliefsituation sowie die weiträumigen Sichtbeziehungen positiv auf die<br />
Attraktivität des Raums aus.<br />
2.6 Mensch/ Bevölkerung (Gesundheit und Erholung/ Freizeit)<br />
• Gesundheit<br />
Auf die im Hinblick auf Gesundheit relevante lufthygienische und bioklimatische<br />
Situation im Plangebiet wurde bereits in Kapitel 2.3 (Schutzgut Klima/ Luft) hingewiesen.<br />
Im Untersuchungsraum ist der Verkehr auf der südlich gelegenen Saarstraße/ B<br />
427, der östlich liegenden Landauer Straße/ L 542 bzw. der weiter östlich gelegenen<br />
A 65 der hauptsächliche Verursacher von Lärm 11 . Die verkehrsbedingten<br />
Lärmemissionen auf der Saarstraße bzw. der Landauer Straße verursachen straßennah<br />
zumindest tagsüber einen dauerhaft wahrnehmbaren Geräuschpegel mit<br />
jeweils kurzzeitig aufeinander folgenden Geräuschspitzen (verlärmt); in den verkehrsärmeren<br />
Abend-/ Nachtstunden sind dann auch die Lärmemissionen der<br />
Kraftfahrzeuge auf der A 65 als dauerhaft wahrnehmbarer Geräuschpegel (Hintergrundgeräusch)<br />
hörbar (vgl. auch Kap. 1.6.1). Zeitweise kommen darüber hinaus<br />
Lärmemissionen durch den Zugverkehr auf der in Einschnittlage verlaufenden<br />
Bahntrasse hinzu.<br />
• Erholung/ Freizeit<br />
Dem Plangebiet und seiner näheren Umgebung kommt - aufgrund seiner guten<br />
fußläufigen Erreichbarkeit - eine wichtige Funktion als Naherholungsraum für die<br />
landschaftsbezogene Tages- und Feierabenderholung für die Bevölkerung von<br />
<strong>Kandel</strong> zu. Dieser Funktion als örtlich bedeutsamer Freiraum für die extensive,<br />
landschaftsbezogene Naherholung wird das Gebiet derzeit aufgrund seine mittelgeringen<br />
Landschaftsbildqualität, der Zerschneidung und Verlärmung durch Verkehrstrassen<br />
nur ungenügend gerecht. Landschaftlich attraktiver und als Naherholungsraum<br />
deutlich frequentierter sind die Niederungs- und Waldflächen (Bien-<br />
11 Das Büro MODUS CONSULT ULM GMBH hat auf der Grundlage bestehender Verkehrsuntersuchungen<br />
und aktueller Knotenpunktzählungen die Straßenbelastung in 2007 ermittelt (siehe<br />
MODUS CONSULT ULM GMBH, August 2007). Im Bereich der B 427 lag das Verkehrsaufkommen<br />
bei 7.300 bis 9.100 Kfz/ 24 h, im Bereich der L 542 bei ca. 8.200 Kfz/ 24 h bzw. im Bereich<br />
der A 65 (zw. AS <strong>Kandel</strong>-Mitte und AS <strong>Kandel</strong>-Nord) lag es bei 43.300 Kfz/ 24 h.<br />
Seite 39
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 40<br />
wald) südlich der Ortslage von <strong>Kandel</strong>. Die Lößriedelflächen nördlich von <strong>Kandel</strong><br />
werden von den Anwohnern hauptsächlich zum Ausführen von Hunden genutzt.<br />
Im Plangebiet selbst sind keine (über-)regionalen Radwanderwege vorhanden; der<br />
nächst gelegene ausgeschilderte Radwanderweg befindet sich auf der Westseite<br />
der östlich des Plangebiets verlaufenden L 542.<br />
2.7 Kultur- und sonstige Sachgüter<br />
Zu den Kulturgütern werden nicht nur denkmalgeschützte bzw. -schutzwürdige<br />
Gebäude, Ortsbilder oder Bodenformationen gerechnet, sondern auch Elemente<br />
der traditionellen Kulturlandschaft, die ehemalige, heute nicht mehr übliche bzw.<br />
verbreitete Landnutzungsformen inkl. deren Infrastrukturen dokumentieren. Ein<br />
solches für die Lößriegel des Vorderpfälzer Tieflands charakteristisches, kulturhistorisch<br />
bedeutsames Landschaftselement stellt der kurze Hohlweg in der Verlängerung<br />
der Hubstraße (Hubhofweg) dar. Der nutzungstypische, ursprüngliche<br />
Hohlwegscharakter ist jedoch nur noch rudimentär vorhanden: Durch die Versiegelung<br />
der Wegsohle wird das für die Entstehung und Entwicklung des Hohlwegs<br />
charakteristische fortwährende Eintiefen des Weges verhindert; zudem fehlen<br />
ausgeprägte steile und offene Böschungen, die insbesondere frühe Entwicklungsphasen<br />
von Hohlwegen kennzeichnen. Aufgrund ausbleibender Nutzung/ Pflege<br />
befindet sich der Hohlweg im Stadium zunehmender Verbuschung/ Verwaldung.<br />
Sonstige Kulturgüter sind im Plangebiet nicht vorhanden (siehe auch Kap. 1.6 und<br />
2.1/ 2.2/ 2.5).<br />
Im Süden des Plangebiets (östlich der Hubstraße) wurde ein leer stehender Wohngebäudekomplex<br />
(„weißes Haus“) in den Geltungsbereich mit aufgenommen. Ansonsten<br />
befinden sich vereinzelte bauliche Anlagen der landwirtschaftlichen Nutzung<br />
(insb. Foliengewächshaus südwestlich der Bahntrasse) im Plangebiet. Nördlich,<br />
nordwestlich und südwestlich des Plangebiets liegen insgesamt drei landwirtschaftliche<br />
Aussiedlungen. Bei dem im Südwesten gelegenen Landwirtschaftsbetrieb<br />
handelt es sich um einen Rindermastbetrieb. Die beiden übrigen landwirtschaftlichen<br />
Gebäudekomplexe bestehen vorwiegend aus Lagerhallen und Foliengewächshäusern.<br />
Auf die Bedeutung der Offenlandflächen für die landwirtschaftliche Nutzung wurde<br />
bereits beim Schutzgut Boden eingegangen (siehe Kap. 2.2); sie ist im Hinblick auf<br />
ihre natürliche Ertragsfähigkeit als hoch bis sehr hoch einzustufen.<br />
Am Ostrand des Plangebiets liegt zudem ein Abschnitt der im Einschnitt verlaufenden<br />
Regional-Bahnlinie Karlsruhe/ Wörth a.Rh. - Neustadt a.d.Wstr. In Verlängerung<br />
der Guttenbergstraße befindet sich eine Brücke über die Bahntrasse.<br />
Mit Ausnahme der Stresemann-/ Hubstraße dienen die im Plangebiet liegenden<br />
Verkehrsflächen der Erschließung der angrenzenden Landwirtschaftsflächen (teilweise<br />
mit Haupterschließungsfunktionen). Die Landwirtschaftswege werden zu-
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
dem von Spaziergängern sowie von Radfahrern als zwischenörtliche Verbindungen<br />
zwischen den nördlich gelegenen Ortschaften und der Stadt genutzt.<br />
2.8 Wirkungsgefüge bzw. Wechselwirkungen zwischen den<br />
Schutzgütern<br />
Die Wechselwirkungen 12 zwischen den oben genannten Schutzgütern bzw. den<br />
einzelnen Belangen des Umweltschutzes, die gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB ebenfalls<br />
zu berücksichtigen sind, veranschaulicht folgende Tabelle:<br />
Tab. 3: Schutzgutbezogene Zusammenstellung von Wechselwirkungen (nach SPORBECK<br />
et al. 1997, verändert)<br />
Schutzgut/ Schutzgutfunktion<br />
Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern<br />
Tiere<br />
Abhängigkeit der Tierwelt von der biotischen/ abiotischen Lebensraumausstattung (Vegetation/ Bio-<br />
Lebensraumfunktion topstruktur, -vernetzung, Lebensraumgröße, Boden, Gelände-/ Bestandsklima, Wasserhaushalt)<br />
Pflanzen<br />
Biotopschutzfunktion<br />
Boden<br />
Lebensraumfunktion<br />
Funktion als Bestandteil des<br />
Naturhaushalts<br />
Abbau-, Ausgleichs- und<br />
Aufbaumedium<br />
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte<br />
Grundwasser<br />
Grundwasserdargebotsfunktion<br />
Grundwasserschutzfunktion<br />
Funktion im Landschaftswasserhaushalt<br />
Spezifische Tierarten/ Tierartengruppen als Indikatoren für die Lebensraumfunktion von Biotoptypen/<br />
-komplexen<br />
Abhängigkeit der Vegetation von den abiotischen Standorteigenschaften (Bodenform, Geländeklima,<br />
Grundwasser-Flurabstand, Oberflächengewässer) sowie von der Besiedlung durch Tierlebensgemeinschaften<br />
(Pflanzen als Schadstoffakzeptor im Hinblick auf die Wirkpfade Pflanzen - Mensch, Pflanzen - Tier)<br />
Anthropogene Vorbelastungen von Biotopen<br />
Abhängigkeit der ökologischen Bodeneigenschaften von den geologischen, geomorphologischen,<br />
wasserhaushaltlichen, vegetationskundlichen und klimatischen Verhältnissen<br />
Boden als Standort für Biotope / Pflanzengesellschaften<br />
Boden als Lebensraum für Bodentiere<br />
Boden in seiner Bedeutung für den Landschaftswasserhaushalt (Grundwasserneubildung, Retentionsfunktion,<br />
Grundwasserschutz, Grundwasserdynamik)<br />
Boden als Schadstoffsenke und Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die Wirkpfade Boden -<br />
Pflanzen, Boden - Wasser, Boden - Mensch, (Boden - Tiere)<br />
Abhängigkeit der Erosionsgefährdung des Bodens von den geomorphologischen Verhältnissen und<br />
dem Bewuchs<br />
Anthropogene Vorbelastungen des Bodens<br />
Abhängigkeit der Grundwasserergiebigkeit von den hydrogeologischen Verhältnissen und der Grundwasserneubildung<br />
Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von klimatischen, bodenkundlichen und vegetationskundlichen<br />
/ nutzungsbezogenen Faktoren<br />
Abhängigkeit der Grundwasserschutzfunktion von der Grundwasserneubildung und der Speicher- und<br />
Reglerfunktion des Bodens<br />
Oberflächennahes Grundwasser als Standortfaktor für Biotope und Tierlebensgemeinschaften<br />
Grundwasserdynamik und seine Bedeutung für den Wasserhaushalt von Oberflächengewässern<br />
Oberflächennahes Grundwasser (und Hangwasser) in seiner Bedeutung als Faktor für die Bodenentwicklung<br />
Grundwasser als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die Wirkpfade Grundwasser - Mensch,<br />
(Grundwasser - Oberflächengewässer, Grundwasser - Pflanzen)<br />
Anthropogene Vorbelastungen des Grundwassers<br />
12 Definition nach RASSMUS et al. (2001): Wechselwirkungen in Sinne des UVPG sind die in der<br />
Umwelt ablaufenden Prozesse. Die Gesamtheit der Prozesse - das Prozessgefüge - ist Ursache<br />
des Zustands der Umwelt wie auch ihrer weiteren Entwicklung. Die Prozesse unterliegen einer<br />
Regulation durch innere Steuerungsmechanismen (Rückkopplungen) und durch äußere Einflussfaktoren.<br />
Seite 41
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 42<br />
Fortsetzung Tab. 3: Schutzgutbezogene Zusammenstellung von Wechselwirkungen (nach<br />
SPORBECK et al. 1997, verändert)<br />
Schutzgut/ Schutzgutfunktion<br />
Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern<br />
Luft<br />
Lufthygienische Situation für den Menschen<br />
Lufthygienische Belastungsräume<br />
Bedeutung von Vegetationsflächen für die lufthygienische Ausgleichsfunktion (u. a. Immissionsschutzwälder)<br />
Klima<br />
Regionalklima<br />
Geländeklima<br />
Klimatische Ausgleichsfunktion<br />
Luftaustausch<br />
Landschaft<br />
Landschaftsbildfunktion<br />
Mensch/ Bevölkerung<br />
Gesundheit (Wohn- und<br />
Wohnumfeldfunktion)<br />
Erholungsfunktion<br />
Kultur- und sonstige<br />
Sachgüter<br />
Natur- und kulturhistorisches<br />
Erbe<br />
Raumnutzungen<br />
Abhängigkeit der lufthygienischen Belastungssituation von geländeklimatischen Besonderheiten<br />
(u. a. lokale Windsysteme, Frischluftschneisen, Tallagen)<br />
Luft als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die Wirkpfade Luft - Pflanzen, Luft - Mensch<br />
Anthropogene lufthygienische Vorbelastungen<br />
Geländeklima in seiner klimaökologischen Bedeutung für den Menschen<br />
Geländeklima (Bestandsklima) als Standortfaktor für die Vegetation und die Tierwelt<br />
Abhängigkeit des Geländeklimas und der klimatischen Ausgleichsfunktion (z. B. Kaltluftabfluss)<br />
von Relief, Vegetation/ Nutzung und größeren Wasserflächen<br />
Bedeutung von Waldflächen für den regionalen Klimaausgleich<br />
Anthropogene Vorbelastungen des Klimas<br />
Abhängigkeit des Landschaftsbilds von den Landschaftsfaktoren Relief, Geologie, Boden, Vegetation/<br />
Nutzung, Oberflächengewässer und kulturellem Erbe<br />
Leit-, Orientierungsfunktion für Tiere<br />
Landschaftsbild in seiner Bedeutung für die natürliche Erholungsfunktion<br />
Anthropogene Vorbelastungen des Landschaftsbilds<br />
Abhängigkeit der Gesundheit von den klimatischen und lufthygienischen Verhältnissen<br />
Tiere, Pflanzen, Wasser, Luft als Lebensgrundlage<br />
Abhängigkeit der Erholungseignung vom Landschaftsbild<br />
Anthropogene Vorbelastungen im Hinblick auf oben genannte Schutzgüter sowie konkurrierende<br />
Raumansprüche (bspw. Belastungen durch Lärm)<br />
Abhängigkeit von Relief, Geologie, Boden (u. a. natürliches landwirtschaftliches Ertragspotential),<br />
Wasserhaushalt und Klima<br />
Anthropogene Vorbelastungen im Hinblick auf oben genannte Schutzgüter sowie konkurrierende<br />
Raumnutzungen
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
3 Wirkungsprognose (Umweltprüfung)<br />
3.1 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der<br />
Planung (Status quo-Prognose)<br />
Die vorliegende Planung entspricht den Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplans<br />
der <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Kandel</strong> (SCHARA + FISCHER 2002<br />
zzgl. 8. Änderung/ Fortschreibung), der die Ausweisung weiterer Bauflächen unter<br />
Berücksichtigung der Eigenentwicklung als erforderlich ansieht, da die verfügbaren<br />
Baulandpotentiale den Bedarf an Bauland mittelfristig nicht mehr abdecken.<br />
Sollte die vorliegende Planung nicht umgesetzt werden, ist davon auszugehen,<br />
dass die Freiflächen des Plangebiets auch zukünftig entsprechend ihrer derzeitigen<br />
Nutzungsform hauptsächlich als Ackerland bewirtschaftet werden. Da das<br />
Gebiet hinsichtlich der ackerbaulichen Nutzung über eine hohe bis sehr hohe natürliche<br />
Ertragsfähigkeit verfügt, ist nicht anzunehmen, dass eine Flächenumnutzung,<br />
beispielsweise hin zu extensiveren Bewirtschaftungsformen (wie Streuobstwiesen,<br />
Grünland), erfolgen wird. Negative Auswirkungen ergeben sich bei einer<br />
Fortführung der intensiven ackerbaulichen Bewirtschaftung durch zunehmende<br />
Nähr-/ Schadstoffbelastung sowie fortschreitende Erosion/ Verschlämmung des<br />
Bodens. Die positiven Wirkungen des Gebiets im Hinblick auf die lokalklimatischen<br />
Entlastungsfunktionen bleiben weiterhin bestehen. Die bioökologischen und landschaftsästhetischen<br />
Defizite werden wie bisher vorhanden sein.<br />
Denkbar wäre zudem, dass nur Teile der Darstellungen des Flächennutzungsplans,<br />
wie insbesondere die Errichtung eines Bahnhaltepunktes inkl. einer Park+-<br />
Ride-Anlage an der Bahntrasse oder auch der Bau einer Nordwest-Umgehung in<br />
Fortführung der Straße „Am Höhenweg“ mit Anbindung an die Landauer Straße,<br />
realisiert werden. Insbesondere mit Realisierung der Umgehungsstraße erhöhen<br />
sich die Belastungen für die Schutzgüter Boden (insb. durch Versiegelung, Schadstoffeinträge),<br />
Tiere und Pflanzen (insb. durch Lebensraumverlust, Zerschneidung/<br />
Verinselung), Mensch (insb. durch Verlärmung) und Landschaft (insb. durch Zerschneidung<br />
von Freiraum).<br />
3.2 Voraussichtliche, erhebliche Umweltauswirkungen der Planung<br />
Bei Realisierung der vorliegenden Planung ist prinzipiell von folgenden bau-, anlage-<br />
und nutzungs-/ betriebsbedingten Wirkungen auszugehen:<br />
• Veränderung der Standortfaktoren durch Bodenumlagerung, Abgrabung, Auffüllung,<br />
Verdichtung bzw. Trittbelastung,<br />
• Flächenversiegelung, -befestigung und -überbauung (unmittelbarer Boden-/<br />
Lebensraumverlust),<br />
• Flächenumwidmung (Lebensraumveränderung),<br />
• Lärm-, Licht- und Schadstoffemissionen, Bewegungsunruhe,<br />
Seite 43
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 44<br />
• Entstehen von Abfällen, Trinkwasserverbrauch/ Regenwasserbewirtschaftung/<br />
Abwasser, Energieverbrauch/ -nutzung/ Abwärme.<br />
Die Wirkungsprognose erfolgt verbal-argumentativ, wobei die Schutzgüter jeweils<br />
separat bzw. bei inhaltlichen Überschneidungen zusammen betrachtet werden. Als<br />
Merkmale von Auswirkungen werden Umfang und räumliche Ausdehnung, Wahrscheinlichkeit,<br />
Dauer, Häufigkeit, Umkehrbarkeit, kumulativer Charakter sowie<br />
grenzüberschreitender Charakter der Wirkungen berücksichtigt. Baubedingte Wirkungen<br />
sind zeitlich auf die Bauphase begrenzt (und werden nur werktags und<br />
tagsüber auftreten) und in der Regel reversibel. Dagegen sind die anlage- und nutzungsbedingten<br />
Wirkungen dauerhaft und größtenteils irreversibel (zumindest für<br />
absehbare Zeit). Aufgrund der Dimension und Lage der Maßnahme ist nicht von<br />
einem grenzüberschreitenden Charakter der Wirkungen auszugehen.<br />
Nachfolgend werden darüber hinaus Folgewirkungen und/ oder Wirkungsverlagerungen<br />
beschrieben. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern werden bei<br />
den jeweiligen Schutzgütern dargestellt. Der Sinn der Betrachtung der Wechselwirkungen<br />
zwischen den Schutzgütern ist, solche Wirkungen zu erkennen und herauszustellen,<br />
die für die Bewertung der Umweltauswirkungen zusätzliche Aspekte<br />
darstellen (BUNZEL 2005). Dabei geht es im Wesentlichen um Wirkungen, die sich<br />
auf das eine Schutzgut positiv, auf ein anderes Schutzgut jedoch negativ auswirken<br />
können (ambivalente Auswirkungen).<br />
Die Naturschutzgesetze knüpfen den Eingriffstatbestand (i. R. d. integrierten Bearbeitung<br />
des Landschaftsplanerischen Beitrags) an die Voraussetzung, dass eine<br />
Beeinträchtigung erheblich ist. Neben Art, Dauer und Ausmaß der Wirkung bzw.<br />
der Beeinträchtigung spielt für die Einstufung der Erheblichkeit die Bedeutung bzw.<br />
Empfindlichkeit der jeweils betroffenen Wert- und Funktionselemente der Schutzgüter<br />
sowie der Grad der Vorbelastung im Gebiet eine wesentliche Rolle (vgl. Kap.<br />
2). Die Frage nach der Erheblichkeit von Eingriffen ist im Zusammenhang mit Totalverlusten<br />
von Naturhaushaltsfunktionen immer leicht zu beurteilen, da auch die<br />
Verluste "nur" allgemein bedeutsamer Naturhaushaltsfunktionen immer erheblich<br />
zu werten sind. Problematischer wird es, wenn Naturhaushaltsfunktionen von allgemeiner<br />
Bedeutung vorhabensbedingt nicht verloren gehen, sondern "nur" beeinträchtigt<br />
werden. Verbindliche Maßstäbe für die Festlegung der Erheblichkeit von<br />
Beeinträchtigungen existieren nicht (LANA 1996). Zur Bestimmung der Erheblichkeitsschwelle<br />
sind daher auch die Ziele und Grundsätze der Naturschutzgesetze<br />
sowie regionale und kommunale Leitbilder des Naturschutzes heranzuziehen.<br />
Als erheblich werden generell Beeinträchtigungen von Funktionen mit besonderer<br />
Bedeutung für die nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts<br />
bzw. des Landschaftsbilds eingestuft. Mögliche Beeinträchtigungen, die auf<br />
Funktionselemente mit allgemeiner Bedeutung einwirken, sind im Einzelfall zu prüfen.<br />
Als erheblich sind zumindest alle dauerhaften Flächenverluste von Funktionselementen<br />
allgemeiner Bedeutung (z. B. Flächenversiegelung) einzustufen sowie<br />
die Beeinträchtigungen von Biotopen allgemeiner Bedeutung, die aufgrund längerer<br />
Regenerationsdauer nicht oder nur schwer ausgleichbar sind.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
3.2.1 Auswirkungen der Planung auf Tiere und Pflanzen (inkl. biologische<br />
Vielfalt)<br />
• Baubedingte Wirkungen<br />
Die zur Durchführung des geplanten Vorhabens eingesetzten Fahrzeuge und Baumaschinen<br />
werden das Gelände befahren und dabei Lärm und Abgase erzeugen.<br />
Die An- und Abfahrten der Baufahrzeuge verursachen auf den umliegenden öffentlichen<br />
Straßen ein höheres Verkehrsaufkommen. Auf Freiflächen werden Baumaterialien<br />
gelagert. Abgesehen von den An- und Abfahrten bleiben die Wirkungen<br />
der genannten Maßnahmen weitgehend auf das Plangebiet und die nähere Umgebung<br />
begrenzt. Die Maßnahmen sind zeitlich befristet.<br />
Werden Vegetationsflächen mit Baufahrzeugen befahren bzw. als Lagerflächen<br />
genutzt, führt dies zur Beschädigung und zur Beeinträchtigung der eine Veränderung<br />
der Standortbedingungen für die Vegetation und damit eine Veränderung der<br />
natürlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Teile des Plangebiets und seiner Randbereiche<br />
werden von bioökologisch hoch- bzw. mittel-hochwertigen Gehölzbeständen<br />
(insb. Baum-/ Strauchhecken am Hohlweg oder randlich entlang der Bahntrasse<br />
sowie alte Walnüsse/ Obstbäume) eingenommen. Werden höherwertige Vegetationsbestände,<br />
die außerhalb der eigentlichen Maßnahmenflächen liegen, baubedingt<br />
genutzt, können erhebliche negative Auswirkungen entstehen (u. a. Verlust<br />
von Lebensraumstrukturen für Vögel, Heuschrecken, Tagfalter, Nahrungsraum/<br />
Leitstruktur für Fledermäuse).<br />
Eine erhöhte Lärm- und Lichtbelastung, Bewegungsunruhe und Erschütterungen<br />
durch die baubedingten Maßnahmen können potentiell zu einer Beeinträchtigung<br />
der Tierwelt in den angrenzenden Freiflächen führen. Empfindliche Arten können<br />
hierauf mit einer Meidung des Gebiets zur Nahrungssuche oder mit der Aufgabe<br />
ihres Brut-/ Nistplatzes bzw. Reviers reagieren (insb. Vögel, Fledermäuse). Emissionsbedingte<br />
Auswirkungen auf Vögel wurden im Rahmen eines Monitorings an<br />
der Bahn-Ausbaustrecke Hamburg - Berlin untersucht (ARSU 1998). Für Vögel liegen<br />
auch quantitative Untersuchungen zu den Auswirkungen des Straßen- und<br />
Schienenverkehrslärms vor (v. a. GARNIEL et al. 2007).<br />
Danach stellen akustische und optische Störreize die wichtigsten Wirkfaktoren dar.<br />
Durch Schallimmissionen können Vögel in ihrer Kommunikation (z. B. Reviergesang)<br />
und in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit (z. B. Hören von Beute oder Feinden)<br />
beeinträchtigt werden, weil relevante Umweltsignale überdeckt (maskiert) werden.<br />
Optische Bewegungsreize können bei störungsempfindlichen Vögeln zu den bekannten<br />
Scheucheffekten führen. Eine besondere Bedeutung kann die Geräuschwahrnehmung<br />
auch für nachtaktive Arten haben, die bei der Beutesuche oft stark<br />
auf den Gehörsinn angewiesen sind. Starkes Scheinwerferlicht kann nachtaktive<br />
Arten wie Eulen beeinträchtigen. Die Empfindlichkeit gegenüber akustischen und<br />
optischen Störungen ist im Wesentlichen abhängig von artspezifischen Verhaltensweisen<br />
und Hauptaktivitätsphasen, von der Vorbelastung (Gewöhnungseffekte)<br />
und Gebietsstrukturierung (Abschirmung, Rückzugs- und Versteckmöglichkeiten)<br />
sowie von Art, Intensität, Zeitpunkt und Dauer der Störung. Eine höhere<br />
Seite 45
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 46<br />
Empfindlichkeit besteht insbesondere während der artspezifischen Paarungs-,<br />
Brut- und Aufzuchtzeiten vieler Vogelarten.<br />
Neuere Untersuchungen (u. a. GARNIEL et al. 2007) zeigen, dass der seit mehreren<br />
Jahren als Fachkonvention geltende Beurteilungspegel von 47 dB(A), ab dem<br />
von einer erheblichen Beeinträchtigung der Vogelwelt durch Lärm (insb. Verkehrslärm)<br />
auszugehen war (47 dB(A)-Grenzisophone als Indikator für erhebliche Beeinträchtigungen,<br />
siehe BFN 2001), so pauschal nicht mehr aufrecht zu erhalten<br />
ist. Die nachfolgende Beurteilung stützt sich auf die Aussagen der neueren Untersuchungen,<br />
und dabei insbesondere auf das Gutachten von GARNIEL et al. (2007),<br />
in dem für 132 Brutvogelarten art- bzw. artengruppenspezifische Empfindlichkeiten<br />
und Schwellenwerte (kritische Schallpegel bzw. Effektdistanzen) benannt werden,<br />
die zur Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Verkehrslärm herangezogen<br />
werden können. Im Hinblick auf den für den Populationserhalt besonders<br />
relevanten Aspekt der Partnerfindung wurden von den untersuchten Brutvogelarten<br />
lediglich 12 Arten als hochempfindlich gegenüber Lärm eingeschätzt<br />
(Wachtelkönig, Raufußkauz, Ziegenmelker, Große Rohrdommel, Zwergdommel,<br />
Rohrschwirl, Drosselrohrsänger, Tüpfelralle, Wachtel, Birkhuhn, Auerhuhn und<br />
Hohltaube). Deren kritische Schallpegel wurden je nach Art bei 47 dB(A) nachts<br />
bzw. bei 52 bis 58 dB(A) tags eingestuft. Ein Brutvorkommen dieser Arten im Plangebiet<br />
und seiner näheren Umgebung ist auszuschließen.<br />
Für die übrigen Vogelarten des Planungsraums wird von GARNIEL et al. (2007) nur<br />
eine mittlere bis geringe Lärmempfindlichkeit prognostiziert. Bei ihnen ist Lärm in<br />
der Regel nicht der Wirkfaktor mit der größten Reichweite. Seine Auswirkungen<br />
lassen sich von den Folgen weiterer Störfaktoren im Raum (insb. optischen Störreizen)<br />
nicht trennen. Für die Prognose der baubedingten Auswirkungen durch den<br />
Faktorenkomplex aus akustischen und optischen Störreizen liefern die biologischen<br />
Begleituntersuchungen (Monitoring) an der Bahn-Ausbaustrecke Hamburg-<br />
Berlin (ARSU 1998) Hinweise. Als Hauptstörungsquelle erwiesen sich dort bewegende,<br />
optisch wahrnehmbare Menschen und Fahrzeuge in Verbindung mit plötzlichen<br />
lauten Geräuschen. Die wenigsten Störungen verursachten nach den Untersuchungen<br />
von ARSU (1998) die auf dem Gleiskörper durchgeführten Arbeiten<br />
wie Rammen, Oberleitungsbau sowie Schienenauf- und -abbau. Es zeigten sich<br />
deutliche Unterschiede in der Betroffenheit der einzelnen Arten: Während einige<br />
Arten durch die Störeinflüsse den trassennahen Bereich mieden, brüteten andere<br />
erfolgreich direkt an einer befahrenen Baustraße. Bei Waldvögeln reicht die Störwirkung<br />
im dichten Wald nicht so weit wie in offenen Landschaften (optische und<br />
akustische Abschirmung gegen Störreize). Im Ergebnis wurden für die verschiedenen<br />
Vogelgemeinschaften jeweils unterschiedliche störungsbedingte Meidekorridore<br />
ermittelt. Es wurden aber teilweise auch bei derselben Art unterschiedliche<br />
Empfindlichkeiten festgestellt, d. h. es gab Brutpaare, die den Störungen auswichen<br />
und solche, die sich kaum stören ließen.<br />
Bei den für den vorliegenden Planungsraum relevanten Arten der halboffenen Kulturlandschaft<br />
und Heckenbrütern wurde von ARSU (1998) überwiegend eine geringe<br />
Empfindlichkeit gegenüber baubedingten Störungen festgestellt. Störungsbedingte<br />
Meidekorridore um die Bautrasse waren bei diesen Untersuchungen nicht
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
nachweisbar. Da vorliegend voraussichtlich keine besonderen/ anspruchsvolleren<br />
bzw. störungsempfindlicheren Arten betroffen sind, sind keine negativen Auswirkungen<br />
auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen der jeweiligen Art zu<br />
erwarten.<br />
Für Fledermäuse, die das Gebiet und hier insbesondere Gehölzbestände zur Nahrungssuche<br />
resp. als Leitlinie auf ihrer Flugroute nutzen können, ist Lärm grundsätzlich<br />
hörbar und potentiell störend. Von einigen Fledermausarten ist eine hohe<br />
Lärmempfindlichkeit bekannt (z. B. Braunes Langohr). Andererseits sind Fledermäuse<br />
auch sehr anpassungsfähig, wie die Quartierwahl der meisten heimischen<br />
Arten in unmittelbarer Nähe des Menschen zeigt. Eine höhere Empfindlichkeit besteht<br />
insbesondere während der Hauptaktivitätszeiten in den Dämmerungs- und<br />
Nachtstunden. Nach einer Studie von KIEFER (2004) dürfte zudem nur hoher Dauerschall<br />
das Potential besitzen, die Orientierungslaute der im Raum relevanten Arten<br />
zu überlagern und die spezielle Jagdtechnik von Fledermäusen zu behindern.<br />
Da die Baumaßnahmen voraussichtlich nur tagsüber erfolgen werden, können erhebliche<br />
baubedingte Störungen somit ausgeschlossen werden.<br />
Im Rahmen der Untersuchungen von ARSU (1998) konnten bei Amphibien und<br />
Reptilien (insb. Zauneidechse) keine Störungen durch Erschütterungen, Lärm oder<br />
Bewegungen durch den Baubetrieb festgestellt werden. Es gab keine Hinweise,<br />
dass Tiere solche Störungszonen meiden oder sich daraus zurückziehen; so wurden<br />
bspw. Gräben, die nur 5 - 10 m vom Baufeld entfernt waren, von Amphibien<br />
während der Bauphase „normal“ besiedelt.<br />
• Anlagebedingte Wirkungen<br />
Durch die geplante Flächenumwidmung/ Versiegelung gehen vor allem mittel- bis<br />
geringwertige Vegetationsstrukturen bzw. Lebensräume verloren (insb. Intensiväcker,<br />
Glatthaferwiesen, Fettweide, Nutzgärten). In geringem Umfang sind aber<br />
auch hoch- bzw. mittel- bis hochwertige Vegetationsstrukturen bzw. Lebensräume<br />
betroffen (naturraumtypische Baum- und Strauchhecken, Teile des Lößhohlwegs<br />
und alte Einzelbäume, siehe Tab. 4 und 5). Dieser Verlust stellt eine erhebliche<br />
Beeinträchtigung für Arten und Biotope dar (siehe Beurteilungsmaßstäbe in Kap.<br />
3.2). Die Bestände übernehmen für weniger anspruchsvolle Arten bzw. für Arten<br />
mit kleineren Aktionsradien wichtige Lebensraumfunktionen; mögliche Teil-<br />
Lebensraumfunktionen (Nahrungsraum/ Jagdgebiet) werden weiter eingeschränkt.<br />
Durch Bodenauffüllungen/ -umlagerungen wird das bioökologische Entwicklungspotential<br />
langfristig verändert. Bei einer Versiegelung des Bodens geht das bioökologische<br />
Entwicklungspotential vollständig verloren. Durch das Vorhaben (inkl. Bau<br />
eines Teilabschnitts der Ortsrandstraße) werden keine wesentlichen Wanderwege<br />
(z. B. für Reptilien, Amphibien) zerschnitten. Die Vernetzungsfunktion der in Einschnittlage<br />
verlaufenden Bahntrasse, die als Vernetzungslinie mit Bedeutung für<br />
den lokalen Biotopverbund besonders relevant ist, wird durch das geplante Brückenbauwerk<br />
nicht gravierend beeinträchtigt.<br />
Seite 47
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 48<br />
Die im Plangebiet zu erwartenden Vogelarten sind weit verbreitet, anpassungsfähig<br />
und größtenteils ungefährdet. Auch wenn einzelne (potentielle) Brutplätze vorübergehend<br />
oder - lokal - dauerhaft infolge des Vorhabens nicht nutzbar sein sollten,<br />
bleiben wegen der Möglichkeiten der Arten zum Ausweichen die ökologischen<br />
Funktionen der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang<br />
erhalten. Unmittelbare Verluste besetzter Nester, ggf. mit der Tötung<br />
von Jungvögeln und der Zerstörung von Entwicklungsformen, sind wegen der Bestimmungen<br />
von § 39 BNatSchG ausgeschlossen. Relevante Lebensraumstrukturen<br />
für Fledermäuse (nur kleiner Teil des großräumigen Jagdreviers betroffen,<br />
Nahrungssuche bzw. Orientierung im Hinblick auf die Flugroute auch nach Realisierung<br />
des Vorhabens weiterhin möglich) oder der Zauneidechse bzw. Mauereidechse<br />
(relevant insb. östlich angrenzende Bahntrasse) sind vom Vorhaben nicht<br />
betroffen; Vorkommen von weiteren Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind<br />
unwahrscheinlich. Aus artenschutzrechtlicher Sicht (gemäß § 44 BNatSchG) entstehen<br />
somit keine Verbotstatbestände.<br />
• Nutzungs-/ betriebsbedingte Wirkungen<br />
Im Hinblick auf betriebsbedingte Lärmemissionen und deren Wirkungen auf die<br />
Tierwelt ist insbesondere der neue Abschnitt der Ortsrandstraße näher zu betrachten;<br />
dieser liegt zum einen am Rand des Baugebiets zur freien Landschaft hin und<br />
wird aufgrund der Funktion für den Durchgangsverkehr eine höhere Verkehrsmenge<br />
aufweisen, als die lediglich der Erschließung des Baugebiets dienenden übrigen<br />
Straßen des Plangebiets. Das Verkehrsplanungsbüro MODUS CONSULT ULM<br />
GMBH (2007) prognostiziert für vorliegenden Abschnitt der Ortsrandstraße (bei<br />
vollständiger Trassierung bis zur Landauer Straße) bis zum Jahr 2025 eine Verkehrsbelastung<br />
von < 3.000 Kfz/ 24 h. Nutzungsbedingt ist somit von einer zusätzlichen<br />
Verlärmung und Beunruhigung der nordwestlich der Ortslage gelegenen<br />
Freiflächen auszugehen.<br />
Der Emissionspegel ist in der Nähe der neuen Verkehrstrasse am größten und<br />
baut sich im weiteren Umfeld immer mehr ab (vgl. auch GSB - SCHALLTECHNI-<br />
SCHES BERATUNGSBÜRO PROF. DR. KERSTIN GIERING 2011, insb. Differenzkarten<br />
tags bzw. nachts). Im Süden und Osten wird die Ortsrandstraße (zukünftig) von<br />
Wohnbebauung begrenzt. Hier sind keine Vorkommen störungsempfindlicher Arten<br />
zu erwarten. Westlich und nordwestlich der Ortsrandstraße grenzen - bezogen<br />
auf die Bereiche, in denen mit einer relevanten Lärmpegelerhöhung zu rechnen ist<br />
- lediglich strukturarme Ackerflächen an; die in dieser Richtung nächst gelegenen<br />
flächigen Gehölzbestände liegen Luftlinie > 600 m von der neuen Verkehrstrasse<br />
entfernt. Vom Erreichen von für Vögel kritischen Lärmpegeln - auch in Kombination<br />
mit optischen Störreizen durch den Kfz-Verkehr (siehe oben, baubedingte Wirkungen)<br />
- ist in dieser Entfernung zur Ortsrandstraße nicht auszugehen. Näher liegende<br />
Bereiche mit relevanten Lebensraumstrukturen befinden sich lediglich nördlich/<br />
nordöstlich der geplanten Straße; diese entlang der Bahntrasse gelegenen Baum-/<br />
Strauchhecken sind bereits durch eine zumindest zeitweise hohe Lärmbelastung<br />
gekennzeichnet (Bahnverkehr), so dass für die vorkommenden (weniger störungsempfindlichen)<br />
Arten nicht von einer wesentlichen Minderung der Habitatqualität<br />
durch zusätzliche Lärmemissionen des Kfz-Verkehrs auf der neuen Ortsrandstra-
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
ße auszugehen ist. Bei Tieren, die sich länger in den jeweiligen Gebieten aufhalten,<br />
tritt zudem eine Habituation (Verringerung der Abstände zur Störreizquelle -<br />
Gewöhnungseffekt) ein.<br />
Viele Fledermausarten gelten ebenfalls als lärmempfindlich; das Plangebiet wird<br />
jedoch allenfalls als (kleiner) Teil ihres Jagdreviers sowie als Leitlinie auf ihrer<br />
Flugroute genutzt. Die Hauptaktivitätszeiten von Fledermäusen sind nachts und in<br />
den frühen Morgenstunden, d. h. in Zeiten mit einer geringen Verkehrsbelastung<br />
auf der neuen Verkehrstrasse.<br />
Durch den zusätzlichen Kfz-Verkehr steigt zudem das Kollisionsrisiko für Tiere.<br />
Nach STEIOF (1996) weisen unübersichtliche Straßenabschnitte, randliche Strukturen<br />
mit Leitlinienwirkung, die quer zur Straße verlaufen (wie Hecken, Gräben o.<br />
ä.), eine Straßenführung auf Dämmen oder reich strukturierte Lebensräume im<br />
Randbereich der Straße einerseits und eine hohe Fahrgeschwindigkeit (deutliche<br />
Erhöhung der Opferrate bei Geschwindigkeiten > 40/ 50 km/h) sowie eine hohe<br />
Verkehrsdichte andererseits bei Vögeln besonders viele Opfer auf. Diese Bedingungen<br />
sind bei vorliegender Verkehrstrasse nicht gegeben, so dass ein besonderes<br />
Kollisionsrisiko, das deutlich über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht,<br />
nicht zu erwarten ist. Darüber hinaus ist nicht mit dem Vorkommen seltener/ gefährdeter<br />
Arten, die die Verkehrstrasse auch Höhe des Plangebiets regelmäßig<br />
queren, zu rechnen.<br />
Durch die Vorbeifahrt entstehen Sogwirkungen und Verwirbelungen (Luftturbulenzen),<br />
die allerdings nur im unmittelbaren Randbereich der Trasse wirksam sind<br />
(zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/ h) und im Vergleich zu den anderen<br />
betriebsbedingten Wirkungen eher eine untergeordnete Rolle spielen.<br />
Über die Luft und vor allem über das Spritzwasser können verkehrsbedingte<br />
Schadstoffe und Nährstoffe in angrenzende Vegetationsbestände gelangen und zu<br />
einer Verschiebung des Artenspektrums führen. In dieser Hinsicht empfindliche<br />
Biotopbestände sind im Randbereich der Verkehrstrasse jedoch nicht vorhanden,<br />
so dass diesbezüglich keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind.<br />
Die verbleibenden, an das Baugebiet angrenzenden Freiflächen werden zudem in<br />
höherem Maße Störungen durch die Wohn- und Freizeitnutzung ausgesetzt werden<br />
(Lärmemissionen, Bewegungsunruhe, Trittbelastung und zunehmende Eutrophierung/<br />
Ruderalisierung von Vegetationsbeständen). Dadurch wird die Lebens-<br />
und Nahrungsraumfunktion der Flächen für Tierarten im Gebiet selbst sowie im<br />
Gesamtkomplex weiter eingeschränkt. Mit dem Vorkommen von störungsempfindlicheren<br />
Arten ist jedoch nicht zu rechnen (s. o.). Die großzügige Durchgrünung<br />
des zukünftigen Wohngebiets mit öffentlichen Grünflächen wird zudem die Störungen<br />
auf das Gebiet selbst konzentrieren, so dass randliche Freiflächen weitgehend<br />
unbeeinflusst bleiben können.<br />
Seite 49
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 50<br />
Das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG ist gemäß den obigen<br />
Ausführungen nicht wahrscheinlich.<br />
3.2.2 Auswirkungen der Planung auf den Boden<br />
• Baubedingte Wirkungen<br />
Baubedingt werden die Böden im Gebiet mit Maschinen/ Arbeitsgeräten befahren<br />
und zur Lagerung von Materialien genutzt werden. Außerhalb von befestigten oder<br />
versiegelten Flächen führt dies in der Regel zu Bodenverdichtungen bzw. zu qualitativen<br />
Veränderungen der Bodeneigenschaften (z. B. Verringerung des Porenvolumens<br />
durch mechanische Belastung mit nur begrenzter Regenerationsfähigkeit;<br />
nachhaltige Schädigung des Bodenlebens durch Luftmangel, erschwerte Wiederbesiedlung<br />
des Bodens durch die Bodenflora und -fauna bzw. die höhere Vegetation).<br />
Im Bereich von Böden mit einem mäßigen anthropogenen Einfluss (Landwirtschafts-,<br />
Brach-, Gehölzflächen) sind diese baubedingten Wirkungen deshalb<br />
als erhebliche Beeinträchtigung anzusehen, insbesondere in Bereichen, die auch<br />
zukünftig mit Vegetation bestanden sein werden. Im Bereich zukünftig versiegelter/<br />
überbauter Flächen wird die Wirkung von den anlagebedingten Maßnahmen überlagert.<br />
Emissionen von Baufahrzeugen (Abgase, Öl, Diesel, Schmierstoffe der Baumaschinen)<br />
oder die Lagerung von Betriebsstoffen können bei grob fahrlässigem Verhalten<br />
zu potentiellen Verunreinigungen des Bodens (und in der Folge des Grundwassers)<br />
führen. Bei einem ordnungsgemäßen und sachgerechten Umgang mit<br />
den Baumaschinen (der vorausgesetzt werden kann) ist die Wahrscheinlichkeit<br />
des Eintretens einer solchen Situation jedoch eher gering.<br />
• Anlagebedingte Wirkungen<br />
Bodenabgrabungen, -umlagerungen, -auffüllungen und -verdichtungen führen zu<br />
einer Veränderung der vorhandenen Bodenverhältnisse (z. B. Entfernen des organischen<br />
Auflagehorizonts bzw. von schützenden und filternden Deckschichten im<br />
Zuge von Abgrabungen). Durch die geplante Neubebauung werden überschlägig<br />
ca. 10 ha Boden nachhaltig, z. T. auch erheblich beeinträchtigt (siehe Tab. 4). Je<br />
nach Art des für Auffüllungen verwendeten Bodenmaterials (z. B. für den Straßenbau)<br />
kann es zu zusätzlichen Nähr- und Schadstoffbelastungen des anstehenden<br />
Bodens (bzw. des Grundwassers, siehe unten) kommen. Durch Bodenumlagerungen<br />
und Bodenaufschüttungen verändert sich der jeweils vorhandene Bodentyp.<br />
Der organische Auflagehorizont und Teile des darunter liegenden Mineralhorizonts<br />
des anstehenden Bodens werden entfernt, umgelagert oder überdeckt. Es entstehen<br />
Rohböden, bei denen der Prozess der Bodenentwicklung von vorne beginnen<br />
muss. Ein neues biologisches Gleichgewicht im Boden wird sich erst nach einer<br />
gewissen, von Nutzung und standörtlichen Bedingungen abhängigen Konsolidierungszeit<br />
einstellen. Die Versiegelung und Befestigung von Flächen bewirkt zudem<br />
den Verlust aller Bodenfunktionen (insb. Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, Fil-
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
ter und Puffer für Schadstoffe, Lebensraum für Bodenorganismen, Standort für die<br />
natürliche Vegetation). Durch vorhabensbedingte Versiegelungen und Befestigungen<br />
wird die Leistungsfähigkeit des Bodens auf einer Fläche von etwa 6,5 ha erheblich<br />
beeinträchtigt (Nettoneuversiegelung).<br />
• Nutzungs-/ betriebsbedingte Wirkungen<br />
Der Kfz-Verkehr, insbesondere auf der neuen Ortsrandstraße verursacht Schad-/<br />
Schwebstoff-Emissionen, die durch Wind, Fahrbahnabrieb, Straßenabwässer oder<br />
Spritzwasser auf die Straßenrandböden gelangen können. Die Böden im unmittelbaren<br />
Randbereich der Verkehrstrasse werden voraussichtlich entsprechend höhere<br />
Konzentrationen der emittierten Stoffe aufweisen (vorwiegend schluffig-lehmige/<br />
schluffig-tonige Böden mit einem hohen bis sehr hohen physiko-chemischen<br />
Filtervermögen). Bei Unfällen sind zudem Kontaminationen mit gefährlichen Stoffen<br />
möglich; der Ausbauquerschnitt sowie der kurvige Straßenverlauf bieten kein<br />
besonderes Potential für überhöhte Geschwindigkeiten und lassen kein besonderes<br />
Risiko entstehen.<br />
Durch die Umwidmung des Gebiets werden die Böden der verbleibenden Freiflächen<br />
(evtl. auch unmittelbar angrenzender Freiflächen) vermehrt betreten bzw. genutzt<br />
werden. Damit sind in der Regel Bodenverdichtungen verbunden. Auf weniger<br />
vorbelasteten Flächen können erhebliche Beeinträchtigungen entstehen. Auf<br />
außerhalb des Plangebiets gelegenen Freiflächen wird die Erholungsnutzung allerdings<br />
vorwiegend auf Wegen stattfinden.<br />
Im Plangebiet fällt hauptsächlich Hausmüll an, der über das kommunale System<br />
der Abfallentsorgung ordnungsgemäß verwertet wird. Als Gefahrenstoffe (als gefährlich<br />
eingestufte Abfälle) im Sinne der Verordnung zur Umsetzung des Europäischen<br />
Abfallverzeichnisses vom 10. Dezember 2001 (Abfallverzeichnis-Verordnung<br />
- AVV; BGBl. 2001 Teil I Nr. 65, ausgegeben am 12. Dezember 2001, 3379)<br />
fallen lediglich solche an, die den typischen Siedlungsabfällen zugerechnet werden<br />
können (z. B. Leuchtstoffröhren, bestimmte gebrauchte elektrische und elektronische<br />
Geräte). Es besteht die Verpflichtung entsprechende Abfälle oder Geräte getrennt<br />
zu sammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen.<br />
3.2.3 Auswirkungen der Planung auf das Wasser<br />
• Baubedingte Wirkungen<br />
Mögliche baubedingte Bodenverdichtungen (siehe oben, Schutzgut Boden) wirken<br />
sich auch auf den Wasserhaushalt aus (insb. Reduzierung der Sickerwassermenge).<br />
Potentielle Verunreinigungen des Grundwassers können durch Emissionen<br />
von Baufahrzeugen oder die Lagerung von Betriebsstoffen entstehen. Bei einem<br />
ordnungsgemäßen und sachgerechten Umgang mit den Baumaschinen (der vorausgesetzt<br />
werden kann) ist die Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer solchen<br />
Situation jedoch gering. Eine Gefährdung von Oberflächengewässern erfolgt nicht.<br />
Seite 51
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 52<br />
• Anlagebedingte Wirkungen<br />
Die Versiegelung und Befestigung von Flächen (voraussichtliche Nettoneuversiegelung<br />
von ca. 6,5 ha) bewirkt eine Verringerung der Grundwasserneubildung vor<br />
Ort und des Wasserrückhaltevermögens der Landschaft sowie eine Erhöhung des<br />
Oberflächenabflusses von Niederschlägen. Falls das anfallende Niederschlagswasser<br />
vor Ort in den angrenzenden Freiflächen zurückgehalten und versickert<br />
wird, kann der Reduzierung der Grundwasserneubildung im Gebiet bzw. des Wasserrückhaltevermögens<br />
der Landschaft entgegengewirkt werden.<br />
Falls für Auffüllungen Fremdmaterial verwendet wird, kann es je nach Art des verwendeten<br />
Bodenmaterials zu zusätzlichen Nähr- und Schadstoffbelastungen des<br />
Grundwassers kommen. Bei tieferen Abgrabungen besteht zudem die Gefahr,<br />
dass Grundwasser offen gelegt wird (evtl. im Süden des Gebiets).<br />
Anlagebedingt erfolgt keine Inanspruchnahme von Gewässern bzw. keine Gewässerquerung.<br />
• Nutzungs-/ betriebsbedingte Wirkungen<br />
Der Kfz-Verkehr (insb. auf der neuen Ortsrandstraße) verursacht Schad-/ Schwebstoff-Emissionen,<br />
die durch Wind, Fahrbahnabrieb, Straßenabwässer oder Spritzwasser<br />
über die Böden am Straßenrand auch ins Grundwasser gelangen können.<br />
Erhebliche Beeinträchtigungen sind jedoch nicht anzunehmen (hohes bis sehr hohes<br />
physiko-chemisches Filtervermögen der Böden, vergleichsweise geringes<br />
Konzentrationsniveau der eingetragenen Stoffe). Bei Unfällen sind zudem Kontaminationen<br />
mit gefährlichen Stoffen möglich; es ist jedoch kein besonderes Risiko<br />
zu erwarten (s. o.).<br />
Mögliche nutzungsbedingte Bodenverdichtungen (durch Betreten von Freiflächen<br />
o. ä., siehe Schutzgut Boden) wirken sich auch auf den Wasserhaushalt aus (insb.<br />
Reduzierung der Sickerwassermenge). Gegenüber den anlagebedingten Wirkungen<br />
auf den Wasserhaushalt treten sie jedoch deutlich in den Hintergrund.<br />
Das Plangebiet wird an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Die Versorgung<br />
des Gebiets mit Trinkwasser in ausreichender Quantität und Qualität wird<br />
seitens des zuständigen Wasserversorgers (<strong>Verbandsgemeinde</strong>werke <strong>Kandel</strong>) sichergestellt.<br />
Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird über anzulegende Abwasserkanäle<br />
der Ortskanalisation mit zentraler Abwasserreinigungsanlage (Verbandskläranlage<br />
<strong>Kandel</strong>) zugeleitet. Eine Aufdimensionierung des bestehenden Kanalsystems<br />
ist nicht erforderlich.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
3.2.4 Auswirkungen der Planung auf das Klima/ die Luft sowie auf Mensch/<br />
Bevölkerung (Gesundheit)<br />
• Baubedingte Wirkungen<br />
Prinzipiell besteht die Gefahr, dass im Zuge von Bauarbeiten außerhalb der zukünftigen<br />
Verkehrsflächen/ Bauwerke gelegene lokalklimatisch ausgleichende<br />
bzw. entlastende Vegetationsflächen als Arbeitsstreifen oder Lagerflächen in Anspruch<br />
genommen werden. Gras-/ krautgeprägte Vegetationsbestände und ihre<br />
lokalklimatischen Funktionen lassen sich nach Abschluss der Baumaßnahmen relativ<br />
kurzfristig wieder neu entwickeln. Die Entwicklung von Gehölzbeständen mit<br />
lokalklimatisch spezifischen Funktionen nimmt dagegen einen längeren Zeitraum<br />
in Anspruch; am Rande bzw. innerhalb des Plangebiets sowie unmittelbar angrenzend<br />
finden sich entsprechende Gehölzbestände. Ihr baubedingter Verlust kann<br />
als erheblich eingestuft werden. Von einer möglichen erheblichen Behinderung<br />
des (schwachen/ stark reduzierten) Kaltluftabflusses durch baubedingte Lagerflächen<br />
ist dagegen aufgrund der geringen Dimension (sie können umflossen werden)<br />
und der zeitlich begrenzten Wirkung nicht auszugehen.<br />
Gasförmige Emissionen von Baufahrzeugen tragen temporär zur Erhöhung der<br />
Luftbelastung bei. Im Vergleich zu den sonstigen Verkehrsbewegungen im Untersuchungsgebiet<br />
sind die zu erwartenden Verkehrsströme zu gering, um bezüglich<br />
der Qualität der Luft signifikant belastende Emissionen zu verursachen. Darüber<br />
hinaus wird durch die Baufahrzeuge Lärm erzeugt. Da die baubedingten Lärmemissionen<br />
zeitlich begrenzt sind, kann von einer unerheblichen und nicht nachhaltigen<br />
Auswirkung ausgegangen werden.<br />
• Anlagebedingte Wirkungen<br />
Durch Versiegelung, Befestigung bzw. Umwidmung von Vegetationsflächen wird<br />
der Wärme- und Wasserhaushalt im Gebiet erheblich verändert. Versiegelung und<br />
Befestigung führen zu einer Verminderung der Verdunstung und zur Erhöhung der<br />
Wärmerückstrahlung und damit zu erhöhten Lufttemperaturen; die Luftfeuchte wird<br />
herabgesetzt. Die klimatischen Entlastungs- und Ausgleichsfunktionen der Freiflächen<br />
des Plangebiets für die angrenzenden bebauten Bereiche werden gemindert.<br />
Gebäude und sonstige Bauwerke (z. B. Lärmschutzwand) behindern zudem lokal<br />
wirksame Windsysteme. Aufgrund der relativ geringen Größe des angeschlossenen<br />
Kaltluftentstehungsgebiets (nur bis zum nächstgelegenen Geländerücken reichend,<br />
ab dort Gelände nach Norden und Osten hin abfallend) und der mäßigen<br />
bis geringen Hangneigung sind die Hangabwinde allerdings bereits heute relativ<br />
schwach ausgeprägt. Im Die Funktion der Bahntrasse als Luftleitbahn mit entlastenden<br />
Wirkungen für den Siedlungsbereich wird vorhabensbedingt nicht verändert.<br />
Die vorgesehene Dachausrichtung ermöglicht größtenteils eine effiziente Nutzung<br />
erneuerbarer Energien in Form von Sonnenkollektoren oder Solarzellen zur Gewinnung<br />
von Strom bzw. Warmwasser aus Sonnenenergie. Bei der Errichtung von<br />
Seite 53
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 54<br />
Gebäuden ist zudem die aktuelle Energieeinsparverordnung zu berücksichtigen.<br />
Dem Umweltbelang der sparsamen und effizienten Nutzung von Energie wird damit<br />
genüge getan.<br />
Die zukünftigen Anwohner des neuen Wohngebiets sind darüber hinaus den im<br />
Gebiet bereits vorhandenen Emissionen ausgesetzt. Als potentieller Emittent ist<br />
einerseits die angrenzende DB-Strecke zu beachten. Unter Berücksichtigung der<br />
in den Bebauungsplan integrierten Abstandsflächen konnte im Rahmen einer gutachterlichen<br />
Untersuchung die Unbedenklichkeit der Anordnung der angrenzenden<br />
Wohnnutzung zur Emissionsquelle Schienenverkehrslärm nachgewiesen werden<br />
(Wsw & Partner GmbH Mai 2011, Begründung zum Bebauungsplan-Entwurf).<br />
Ein weiterer möglicher Konfliktpunkt stellt - insb. im Hinblick auf eine potentielle<br />
Staubentwicklung - die intensive Ackernutzung auf den angrenzenden Freiflächen<br />
dar. Grundsätzlich kann hier auf das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme<br />
verwiesen werden. Darüber hinaus wird durch die vorgesehene Ortsrandeingrünung<br />
und die am Westrand der Wohnbebauung zu errichtende Lärmschutzwand<br />
eine eventuell in regenarmen Sommermonaten zu erwartende Belästigung auf ein<br />
mit der angrenzenden Wohnnutzung verträgliches Maß reduziert. Zu berücksichtigen<br />
ist zudem die Ortsüblichkeit solcher Staubbelästigungen am Ortsrand im Übergang<br />
zur freien Landschaft. Der westlich des Plangebiets ehemals vorhandene<br />
Rindermastbetrieb wurde mittlerweile aufgegeben. Bei den übrigen landwirtschaftlich<br />
genutzten Gebäuden in der Umgebung des Plangebiets handelt es sich hauptsächlich<br />
um Tabakschuppen und Foliengewächshäuser. Die Nutzung ist aufgrund<br />
der Abstände und der Trennwirkung von Ortsentlastungsstraße und angrenzender<br />
Lärmschutzwand ebenfalls als mit der angrenzenden Wohnnutzung verträglich<br />
einzuschätzen (zum Vergleich: zwischen Obstbauflächen und einer Wohnbebauung<br />
wird ein Abstand von 20 m als ausreichend erachtet, um insbesondere nicht<br />
zumutbare Belästigungen durch die mögliche Abdrift von Pflanzenbehandlungsmitteln<br />
zu vermeiden).<br />
• Nutzungs-/ betriebsbedingte Wirkungen<br />
Die neue Ortsrandstraße führt - bei ihrer kompletten Fertigstellung - zu einer Umverteilung<br />
bestehender/ prognostizierter Verkehrsflüsse, die bestehenden Luftqualitätsparameter<br />
im Untersuchungsgebiet werden sich hierdurch jedoch nicht wesentlich<br />
ändern.<br />
Zur Bewältigung möglicher Konflikte im Hinblick auf Lärmemissionen durch den<br />
Kfz-Verkehr auf der Ortsrandstraße und den umgebenden schutzwürdigen Nutzungen<br />
wurde ein Fachbüro mit der Erstellung eines schalltechnischen Gutachtens<br />
beauftragt (GSB - SCHALLTECHNISCHES BERATUNGSBÜRO PROF. DR. KERSTIN<br />
GIERING 2011). Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung und Beurteilung<br />
hinsichtlich der Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung<br />
(16. BImSchV) im Plangebiet wurden im Bebauungsplan-Entwurf berücksichtigt<br />
(Errichtung einer 2,5 m hohen Lärmschutzwand auf der Westseite der zukünftigen<br />
Wohnbebauung). Durch den Anschluss des Plangebiets wird es zudem zu Verlagerungen<br />
der Verkehrsmengen im Straßennetz von <strong>Kandel</strong> kommen. Mögliche<br />
Veränderungen an den Anschlusspunkten wurden deshalb ebenfalls aus schall-
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
technischer Sicht bewertet. Das schalltechnische Gutachten kommt diesbezüglich<br />
zu folgender Einschätzung (siehe S. 9f.): „Durch die verkehrliche Anbindung des<br />
Plangebiets kommt es an den vorhandenen schutzwürdigen Nutzungen im Bereich<br />
der Saarstraße (bis Hubstraße) zu einer marginalen Pegelabnahme um 0,1 dB. In<br />
der Umgebung der anderen Straßenabschnitte sind, bis auf den IO 17 (Anmerkung:<br />
im Bereich der Hubstraße), nur geringfügige Zunahmen des Beurteilungspegels<br />
bis maximal 0,5 dB zu verzeichnen. Am Immissionsort 17 kommt es zu einer<br />
Pegelerhöhung von maximal 2,1 dB (tags) und 2,0 dB (nachts). Diese ist als wahrnehmbar<br />
einzustufen; der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für Mischgebiet<br />
wird nicht überschritten. Lärmschutzmaßnahmen werden nicht erforderlich. An<br />
zwei Immissionsorten (IO 18 und IO 19, Anmerkung: Rheinstraße und Landauer<br />
Straße) kommt es zu einer Erhöhung der bereits überschrittenen Immissionsgrenzwerte<br />
für Lärmsanierung um 0,1 dB. Diese Erhöhung ist als marginal einzustufen,<br />
da sie nicht wahrnehmbar ist; allerdings sollte im Rahmen eines Lärmminderungsplanes<br />
versucht werden, die Überschreitung der IGW zu vermeiden.“ Dies<br />
führt zu folgendem gutachterlichen Fazit (s. S. 10): „An den vorhandenen schutzwürdigen<br />
Nutzungen kommt es, bis auf IO 17, nur zu nicht wahrnehmbaren Erhöhungen<br />
des Beurteilungspegels. Allerdings sind an mehreren Immissionsorten die<br />
Lärmsanierungsgrenzwerte bereits ohne das Planvorhaben überschritten.“<br />
3.2.5 Auswirkungen der Planung auf die Landschaft sowie auf Mensch/<br />
Bevölkerung (Erholung/ Freizeit)<br />
• Baubedingte Wirkungen<br />
An das neue Baugebiet resp. die neuen Baugrundstücke und Verkehrstrassen<br />
grenzen landschaftsbildprägende und kulturraumtypische Vegetationsstrukturen<br />
mit einer längeren Entwicklungsdauer (insb. Gehölzbestände, Hohlweg) an. Während<br />
der Baumaßnahmen besteht die Gefahr einer Inanspruchnahme dieser bedeutsamen<br />
Strukturen. Der Baubetrieb und die Anlage von Zwischenlagerflächen<br />
führen temporär zu einer Störung des Landschaftsbilds. Störungen durch Baulärm<br />
und geruchliche Emissionen können zudem vorübergehend zur Beeinträchtigung<br />
von Erholungssuchenden beitragen. Vorausgesetzt werden kann, dass die gesetzlichen<br />
Vorschriften, technischen Normen und Richtlinien zur Vermeidung von Baulärm<br />
und Rauchbelästigung eingehalten werden. Während der Bautätigkeiten kann<br />
es zudem zu einer eingeschränkten Nutzbarkeit von erholungswirksamen Wegeverbindungen<br />
kommen. Geeignete Ausweichmöglichkeiten/ alternative Wegeführungen<br />
sind prinzipiell vorhanden. Das Plangebiet ist zudem für die Naherholung<br />
von untergeordneter Bedeutung (wird vorwiegend zum Hunde Ausführen genutzt).<br />
Zur Naherholung werden vorwiegend die weiter südlich gelegenen Niederungsbereiche<br />
und Bienwaldteile genutzt.<br />
• Anlagebedingte Wirkungen<br />
Das Plangebiet und seine Umgebung sind vorwiegend durch offene, flächenhaft<br />
wirksame Äcker, z. T. auch Weideflächen gekennzeichnet. Prägend sind darüber<br />
Seite 55
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 56<br />
hinaus die gebietstypischen Gehölzbestände entlang der Bahntrasse und des<br />
Hohlwegs (inkl. des Hohlwegs selbst) sowie randlich mit Gehölzen bestandene<br />
Feldgärten. Anlagebedingt wird durch die vorgesehenen Versiegelungen und Flächenumwidmungen<br />
ein Teil dieser landschaftsbildprägenden Vegetationsstrukturen<br />
in Anspruch genommen. Im Zuge der Bebauung wird es zudem zu einer nachhaltigen<br />
Veränderung der Oberflächengestalt kommen (v. a. im Süden des Plangebiets).<br />
Dies betrifft auch Teile des Hohlwegs (v. a. südlicher Abschnitt, darüber<br />
hinaus Nutzung im Rahmen der Bewirtschaftung des Niederschlagswassers) - als<br />
kulturhistorisch bedeutsames Zeugnis ehemaliger Nutzungsformen. Die anthropogene<br />
Überprägung des nordwestlichen Ortsrands von <strong>Kandel</strong> nimmt weiter zu.<br />
Durch unzureichende Berücksichtigung der örtlichen Bautraditionen und monotone,<br />
örtlich beliebig austauschbare Gestaltung der Grün- und Gartenflächen (Zierrasen<br />
mit Nadelgehölzen) kann das Stadt- und Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt<br />
werden. Dies ist als erhebliche/ nachhaltige Beeinträchtigung des Landschaftsbilds<br />
zu werten. Die vorgesehenen Veränderungen werden, insbesondere<br />
von Norden/ Nordwesten aus, auch weiträumiger sichtbar sein.<br />
Durch das Vorhaben wird ein Teil des landschaftlichen Freiraums für die Naherholung<br />
für die Bevölkerung von <strong>Kandel</strong> in Anspruch genommen. Aufgrund der untergeordneten<br />
Bedeutung des Plangebiets und seiner Umgebung für die Naherholung<br />
(siehe Kap. 2.6), werden die Auswirkungen auf die Erholungssituation als<br />
nicht gravierend verschlechternd eingestuft. Vorhandene Wegebeziehungen werden<br />
anlagebedingt nicht unterbrochen resp. in die Planung aufgenommen und neu<br />
gestaltet.<br />
• Nutzungs-/ betriebsbedingte Wirkungen<br />
Der Kfz-Verkehr, insbesondere auf der neuen Ortsrandstraße, verursacht Lärmemissionen,<br />
die sich nachteilig auf die Erholungsnutzung auf den angrenzenden<br />
Freiflächen auswirken können. Aufgrund der bestehenden untergeordneten Bedeutung<br />
des Plangebiets und seiner Umgebung für die ruhige, landschaftsbezogene<br />
Naherholung (siehe Kap. 2.6), werden die Auswirkungen auf die Erholungssituation<br />
als nicht gravierend verschlechternd eingestuft. Entsprechendes gilt auch für<br />
die Erhöhung des Erholungs-/ Freizeitdrucks bzw. der Nutzungsintensität auf den<br />
angrenzenden Freiflächen durch die neuen Anwohner; durch die großzügige Anlage<br />
öffentlicher Grünflächen innerhalb des Plangebiets wird ein Großteil der wohnungsnahen<br />
Freiraumnutzung im Gebiet selbst stattfinden; gravierende zusätzliche<br />
Belastungen auf den angrenzenden Freiflächen sind nicht zu erwarten.<br />
3.2.6 Auswirkungen der Planung auf Kultur- und sonstige Sachgüter<br />
Auf die möglichen vorhabensbedingten Auswirkungen im Hinblick auf den kulturhistorisch<br />
bedeutsamen Hohlweg wurde bereits oben hingewiesen.<br />
Auf die Bedeutung der Offenlandflächen für die landwirtschaftliche Nutzung (Produktionsfunktion)<br />
wurde beim Schutzgut Boden eingegangen (siehe Kap. 2.1); sie
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
ist im Hinblick auf ihre natürliche Ertragsfähigkeit als hoch bis sehr hoch einzustufen.<br />
Durch die geplante Neubebauung geht landwirtschaftliche Nutzfläche im Umfang<br />
von ca. 11,4 ha verloren (Acker/ Grünland). Die Abwägungsentscheidung hinsichtlich<br />
der Belange der Landwirtschaft ist bereits auf Ebene der Standortfindung<br />
bzw. der Flächennutzungsplanung erfolgt.<br />
Landwirtschaftliche Zuwegungen bzw. Wegeverbindungen werden durch die Planung<br />
neu geordnet und bleiben weiterhin in ihrer Funktionsfähigkeit bestehen.<br />
Im Gebiet eventuell vorhandene Ver-/ Entsorgungsleitungen werden bei Bautätigkeiten<br />
in diesen Bereichen gesichert.<br />
Der Abschnitt der im Einschnitt verlaufenden Bahntrasse (Regional-Bahnlinie<br />
Karlsruhe/ Wörth a.Rh. - Neustadt a.d.Wstr.) wird vorhabensbedingt nicht verändert.<br />
Die neue Ortsrandstraße wird vorerst bis zur Bahntrasse geführt, bei Weiterführung<br />
wird der Kreuzungsbereich mit einem Brückenbauwerk überführt werden.<br />
Seite 57
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 58<br />
4 Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnah-<br />
men sowie Vorschläge zum Monitoring<br />
4.1 Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen<br />
Mit den folgenden Vermeidungs-, Verringerungs- 13 und Ausgleichsmaßnahmen<br />
sollen die negativen Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter verringert<br />
bzw. kompensiert werden (siehe Kap. 3.2). Die Maßnahmen bilden die Grundlage<br />
für die landschaftspflegerischen/ grünordnerischen Festsetzungen, die in Kapitel<br />
4.2 formuliert werden und die in den Bebauungsplan integriert werden sollen.<br />
Schutzgut Tiere und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt):<br />
- Ordnungsgemäßer und sachgerechter Umgang mit Baufahrzeugen, Baumaschinen<br />
und Betriebsstoffen,<br />
- Verzicht auf das Befahren bzw. die Lagerung von Baumaterialien während der<br />
Bauarbeiten im Bereich von Gehölzflächen sowie der bestehenden/ zukünftigen<br />
Grünflächen im Plangebiet, Nutzung von befestigten und versiegelten Flächen,<br />
falls erforderlich Schutz von Vegetationsbeständen (gemäß DIN 18920),<br />
- Weitgehender Erhalt bzw. Entwicklung von bioökologisch hochwertigen Gehölzbeständen<br />
(inkl. Erhalt älterer Laubbäume) im Plangebiet,<br />
- Weitgehender Erhalt bzw. Aufwertung des Hohlwegs,<br />
- Gestaltung der öffentlichen Grünflächen unter der Prämisse der Entwicklung<br />
gebietstypischer, artenreicher Landschaftsstrukturen,<br />
- Verwendung gebietstypischer Gehölze für Begrünungsmaßnahmen sowohl im<br />
Straßenraum, im Bereich der öffentlichen Grünflächen als auch im Bereich der<br />
privaten gärtnerisch anzulegenden Freiflächen,<br />
- Extensive Pflege des Straßenbegleitgrüns und der öffentlichen Grünflächen,<br />
- Anlage bzw. Entwicklung von naturnahen, wechselfeuchten bis wechselnassen<br />
Bereichen zur Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers (flache<br />
Mulden, Senken, Rinnen),<br />
- Verwendung von Beleuchtungsanlagen innerhalb der Baugebiete, im Straßenraum<br />
sowie im Bereich öffentlicher Grünflächen, durch die das Anlocken<br />
nachtaktiver Insekten minimiert wird,<br />
- Sicherstellung der Kompensation von Flächen- und Wertverlusten in (räumlich-<br />
) funktionalem Zusammenhang zur Eingriffsfläche: Entwicklung von extensiv<br />
genutztem Grünland und/ oder von Grünlandbrachen, insbesondere (wechsel-<br />
)feucht-nasser Standorte im Bereich der Erlenbach-/ Flutgrabenniederung.<br />
Schutzgüter Boden und Wasser:<br />
- Ordnungsgemäßer und sachgerechter Umgang mit Baufahrzeugen, Baumaschinen<br />
und Betriebsstoffen,<br />
- Verzicht auf das Befahren bzw. die Lagerung von Baumaterialien auf den angrenzenden<br />
oder verbleibenden Freiflächen während der Bauarbeiten (Ver-<br />
13 Die Begriffe Verringerungsmaßnahmen und Minimierungs- bzw. Minderungsmaßnahmen werden<br />
im Folgenden synonym verwendet.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
meidung von Bodenverdichtungen), Nutzung von befestigten und versiegelten<br />
Flächen,<br />
- Verwendung von inertem, unbelastetem Material für Aufschüttungen und Auffüllungen<br />
bzw. schonender Umgang mit zu beseitigendem Oberboden (Zwischenlagerung,<br />
Wiederverwendung), Abtransport überschüssigen Bodenmaterials<br />
und ordnungsgemäße Wiederverwertung andernorts,<br />
- Begrenzung der überbaubaren Fläche und des Versiegelungsgrads auf das<br />
unbedingt erforderliche Maß, weitgehende Verwendung wasserdurchlässiger<br />
Beläge für Wege, Plätze, Zufahrten sowie Stell- und Lagerplätze,<br />
- Rückhaltung und flächenhafte Versickerung des im Bereich der versiegelten/<br />
überbauten Flächen anfallenden, unbelasteten Niederschlagswassers in naturnah<br />
gestalteten Retentionsflächen innerhalb des Plangebiets bzw. im Bereich<br />
des Straßenbegleitgrüns bzw. Speicherung und Verwendung als Brauchwasser,<br />
- Extensive Pflege/ Unterhaltung der Freiflächen (keine Düngung, kein Pflanzenschutz),<br />
- Bereitstellung von Kompensationsflächen mit Verbesserung der Funktionsfähigkeit<br />
bzw. Minderung von Belastungen des Bodens und Grundwassers (insb.<br />
Entwicklung von extensiv genutztem Grünland und/ oder von Grünlandbrachen<br />
im Bereich der Erlenbach-/ Flutgrabenniederung).<br />
Schutzgüter Klima/ Luft sowie Mensch/ Bevölkerung (Gesundheit):<br />
- Erhalt und falls erforderlich Schutz (gemäß DIN 18920) randlicher bzw. angrenzender<br />
Gehölzbestände während der Baumaßnahmen,<br />
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, technischen Normen und Richtlinien<br />
zur Vermeidung von Baulärm und Rauchbelästigung während der Baumaßnahmen,<br />
- Begrenzung der überbaubaren Fläche bzw. des Versiegelungsgrads auf das<br />
absolut notwendige Maß,<br />
- Weitgehender Erhalt bzw. Entwicklung von Gehölzbeständen (inkl. Erhalt älterer<br />
Laubbäume) im Plangebiet,<br />
- Durch-/ Eingrünung des Gebiets mit - nach Möglichkeit - großkronigen Laubbäumen<br />
und Gehölzstreifen (Beschattung und Verdunstung),<br />
- Begrünung der Lärmschutzwand,<br />
- Schaffung naturnaher Versickerungsflächen für das anfallende Oberflächenwasser<br />
(Verdunstung),<br />
- Bereitstellung von Kompensationsflächen mit lokalklimatischen Ausgleichs-/<br />
Entlastungsfunktionen (insb. Entwicklung von extensiv genutztem Grünland<br />
und/ oder von Grünlandbrachen im Bereich der Erlenbach-/ Flutgrabenniederung).<br />
Schutzgüter Landschaft sowie Mensch/ Bevölkerung (Erholung/ Freizeit):<br />
- Erhalt und falls erforderlich Schutz (gemäß DIN 18920) randlicher bzw. angrenzender<br />
gebietstypischer Grünland- und Gehölzbestände während der<br />
Baumaßnahmen,<br />
Seite 59
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 60<br />
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, technischen Normen und Richtlinien<br />
zur Vermeidung von Baulärm und Rauchbelästigung während der Baumaßnahmen,<br />
- Weitgehender Erhalt der erholungswirksamen Wegeverbindungen während<br />
der Bauphase,<br />
- Begrenzung der überbaubaren Fläche, des Versiegelungsgrads sowie der Reliefveränderungen<br />
auf das absolut notwendige Maß,<br />
- Weitgehender Erhalt bzw. Entwicklung von Gehölzbeständen (inkl. Erhalt älterer<br />
Laubbäume) im Plangebiet,<br />
- Weitgehender Erhalt bzw. Aufwertung des Hohlwegs,<br />
- Gestaltung der öffentlichen Grünflächen unter der Prämisse der Entwicklung<br />
gebietstypischer, artenreicher Landschaftsstrukturen,<br />
- Durchgrünung bzw. Eingrünung des Gebiets mit gebietstypischen Gehölzen,<br />
- Naturnahe, gebietstypische Gestaltung der Retentionsflächen,<br />
- Bereitstellung von Kompensationsflächen mit hoher Bedeutung für das Landschaftserleben<br />
(insb. Entwicklung von extensiv genutztem Grünland und/ oder<br />
von Grünlandbrachen im Bereich der Erlenbach-/ Flutgrabenniederung).<br />
Schutzgut Kultur- und Sachgüter:<br />
- Weitgehender Erhalt bzw. Aufwertung des Hohlwegs,<br />
- Erhalt landwirtschaftlicher Zuwegungen und Wegeverbindungen,<br />
- Beachtung und Sicherung von Leitungstrassen/ -führungen während der Bauphase.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
4.2 Landschaftspflegerische und grünordnerische Festsetzungen<br />
zur Integration in den Bebauungsplan<br />
Mit den folgenden textlichen Festsetzungen und Empfehlungen für landschaftspflegerische<br />
und grünordnerische Maßnahmen sollen die oben genannten Vermeidungs-,<br />
Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen - soweit planungsrechtlich<br />
möglich - im Bebauungsplan verankert werden. Planungsgrundlage ist der Entwurf<br />
des Bebauungsplans von Wsw & Partner GmbH, Kaiserslautern vom Mai 2011.<br />
Die grünordnerischen Festsetzungen bzw. Maßnahmen sind in Plan 2.1 graphisch<br />
dargestellt.<br />
(1) Festsetzungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen<br />
Bepflanzungen (gemäß § 9 (1) Nr. 25b BauGB):<br />
(1.1) Der in Plan 2.1 im Bereich der Maßnahmenfläche „Ö1“, der öffentlichen<br />
Grünfläche - Parkanlage sowie im Bereich des Landwirtschaftsweges entsprechend<br />
dargestellte Baum- und Gehölzbestand ist zu erhalten und bei<br />
Bauarbeiten gemäß DIN 18 920 bzw. RAS-LG-4 zu schützen. Die Traufbereiche<br />
der Bäume sind von Versiegelung sowie von Aufschüttungen und<br />
Abgrabungen freizuhalten. Die mit Erhaltungsbindung dargestellten Gehölze<br />
dürfen nur in dem Umfang beseitigt werden, wie dies zur Verwirklichung der<br />
zugelassenen Nutzung unvermeidlich ist. Ausnahmen von der Erhaltungsbindung<br />
sind möglich, wenn auf dem betroffenen Grundstück Ersatzpflanzungen<br />
vorgenommen werden (Neupflanzung hochstämmiger Bäume mit<br />
einem Stammumfang von mind. 20 - 25 cm in 1 m Höhe, 4 x verpflanzt; bei<br />
Sträuchern Mindestgröße 150 - 175 cm, 2 x verpflanzt).<br />
(2) Festsetzungen für Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern<br />
und sonstigen Bepflanzungen (gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB):<br />
Übergeordnet:<br />
(2.1) Die Artenauswahl für Gehölzpflanzungen soll die standörtlichen, natur- und<br />
kulturraumtypischen Gegebenheiten berücksichtigen (siehe Anhang A.1 -<br />
A.5). Die in den Pflanzenlisten Anhang A.1 - A5. genannten Mindestpflanzqualitäten<br />
sind zu beachten. Alle Bepflanzungen sind fachgerecht durchzuführen,<br />
zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Im Falle des „Eingehens“ bzw.<br />
des Abgangs von Bäumen, Sträuchern oder von sonstigen Bepflanzungen<br />
sind Ersatzpflanzungen gemäß den festgesetzten Pflanzqualitäten vorzunehmen.<br />
Für Einsaaten resp. Gehölzpflanzungen ist vorzugsweise autochthones<br />
Saat-/ Pflanzgut zu verwenden (gebietseigene Herkunft).<br />
Seite 61
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 62<br />
(2.2) Für die Anlage der Vegetationsflächen werden die folgenden zeitlichen Vorgaben<br />
getroffen:<br />
Private gärtnerisch anzulegende Freiflächen: Jeweils spätestens eine<br />
Pflanzperiode nach Abschluss der Baumaßnahme (Baufertigstellungsanzeige).<br />
Öffentliche Grünflächen/ Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege<br />
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie Verkehrsbegleitgrün:<br />
Jeweils spätestens eine Pflanzperiode nach Beginn der Erschließung<br />
entsprechend dem Erschließungsfortschritt.<br />
Bereich der nicht überbaubaren Grundstücksfläche / gärtnerisch anzulegenden<br />
Freiflächen (gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauGB bzw. §§ 10 (4) bzw. 88 (1)<br />
LBauO):<br />
(2.3) Im Allgemeinen Wohngebiet dürfen die gärtnerisch anzulegenden Freiflächen<br />
40 % der Baulandfläche nicht unterschreiten. Sie dürfen nicht bebaut<br />
oder befestigt werden.<br />
(2.4) Die gärtnerisch anzulegenden Freiflächen der Baugrundstücke im Allgemeinen<br />
Wohngebiet sowie der Fläche für den Gemeinbedarf (Zweckbestimmung<br />
„Kindergarten“) sind zu mind. 20 % mit freiwachsenden, standortheimischen<br />
Gehölzen (siehe Pflanzenliste Anhang A.1) zu bepflanzen. Je Baugrundstück/<br />
Grundstück ist dabei mindestens ein hochstämmiger Laubbaum<br />
(Hochstamm oder Stammbusch) oder ein Obstbaum (Hoch- oder Halbstamm)<br />
zu pflanzen.<br />
Bereich von baulichen Anlagen sowie von Nebenanlagen und Flächen für<br />
Stellplätze und Garagen (gemäß § 9 (1) Nr. 4 BauGB):<br />
(2.5) Offene Stellplatzanlagen auf den privaten Grundstücksflächen sind durch<br />
Reihen bzw. Pflanzinseln (Mindestgröße 4 qm) groß- oder mittelgroßkroniger<br />
Laubbäume (Arten und Mindestpflanzqualitäten siehe Pflanzenliste Anhang<br />
A.2) zu gliedern. Für je 5 Stellplätze ist mindestens ein hochstämmiger<br />
Laubbaum zu pflanzen. Die Pflanzflächen müssen gegen Überfahren geschützt<br />
sein.<br />
(2.6) Wandflächen von fensterlosen, ungegliederten Fassaden und Fassadenteilen<br />
von mehr als 30 qm sowie die öffentlichen Flächen zugewandte Seite<br />
der Lärmschutzwand sind dauerhaft zu begrünen.<br />
Je laufende 5 m Wandfläche ist mindestens eine Pflanze in einem Pflanzbeet<br />
von mindestens 1 qm zu setzen. Infrage kommen schlingende oder<br />
rankende Pflanzen sowie Weinreben und Spalier-Obstbäume (siehe Pflanzenliste<br />
Anhang A.3).<br />
Die Lärmschutzwand kann alternativ durch Baumpflanzungen auf angrenzenden<br />
öffentlichen Flächen eingegrünt werden (siehe insb. Nr. 2.7).
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen (gemäß § 9 (1) Nr. 11 BauGB):<br />
(2.7) Entlang der geplanten Ortsrandstraße sind mindestens 35 hochstämmige<br />
Laubbäume, entlang der Verlängerung der Hubstraße zur Ortsrandstraße<br />
sind mindestens 28 hochstämmige Laubbäume sowie entlang der das<br />
Wohngebiet erschließenden Ringstraße (inkl. Querverbindung) sind mindestens<br />
35 hochstämmige Laubbäume zu pflanzen. Die in Plan 2.1 im Straßenraum<br />
dargestellten Bäume können angerechnet werden. Entlang der Ortsrandstraße<br />
sowie der Verlängerung der Hubstraße ist ein alleeartiger Charakter<br />
der Bepflanzung anzustreben (siehe auch Nr. 3.2).<br />
Zur Auswahl stehen insbesondere die in der Pflanzenliste Anhang A.2 genannten<br />
Baumarten. Ein Wechsel der Artenwahl ist nur an Einmündungen<br />
von Querstraßen zulässig.<br />
Die Pflanzflächen müssen eine Mindestgröße von 4 qm aufweisen und gegen<br />
Überfahren geschützt sein. Belüftungs- und Bewässerungseinrichtungen<br />
sind vorzusehen. Mit Park- oder Stellplätzen und Einfahrten ist ein Mindestabstand<br />
von 1 m zu den Baumstandorten einzuhalten.<br />
Sind Längs- oder Senkrechtparkstreifen vorgesehen, sind diese durch<br />
Pflanzinseln mit Laubbäumen zu gliedern. Die maximale Anzahl zusammenhängender<br />
Längsparkplätze wird auf drei, die maximale Anzahl zusammenhängender<br />
Senkrechtparkplätze wird auf fünf begrenzt; der Abstand der<br />
Pflanzinseln darf 15 - 18 m nicht überschreiten.<br />
(2.8) Die verbleibenden Flächen des Straßenbegleitgrüns sind mit einer artenreichen,<br />
standortgerechten Wiesensaatgutmischung anzusäen oder mit standortgerechten<br />
Stauden/ Bodendeckern/ Kleingehölzen zu bepflanzen und extensiv<br />
zu pflegen.<br />
Bereich der öffentlichen Grünflächen (gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB):<br />
(2.9) Die Bepflanzung der öffentlichen Grünflächen (Zweckbestimmung „Spielplatz“<br />
/ „Parkanlage“) ist mit standortheimischen Bäumen und Sträuchern<br />
(siehe Pflanzenliste Anhang A.4) vorzunehmen. Im Bereich des „Spielplatzes“<br />
sind ungiftige, vorzugsweise duftende / aromatische Gehölze (wie<br />
bspw. Rosen, Johannisbeere) zu pflanzen.<br />
Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ sind<br />
als Freiflächen mit Offenlandcharakter und Einzelbäumen oder Baumgruppen<br />
sowie randlicher Gehölzpflanzung anzulegen. Der anzupflanzende Gehölzanteil<br />
soll 40 % der Fläche nicht überschreiten. Die in Plan 2.1 auf der<br />
öffentlichen Grünfläche dargestellten Bäume/ Sträucher können angerechnet<br />
werden.<br />
In Abhängigkeit von der späteren Nutzung als Rückhaltefläche für Niederschlagswasser<br />
sind die Freiflächen als Wiesen unterschiedlicher Standortbedingungen<br />
(frisch bis trocken sowie wechselnass/ wechselfeucht bis<br />
wechseltrocken) anzulegen und extensiv zu unterhalten (nach Möglichkeit<br />
ein- bis max. dreimalige Mahd/ Jahr). Anzustreben sind insbesondere folgende<br />
Wiesentypen: Halbruderale Halbtrockenrasen, Typische Glatthafer-<br />
Seite 63
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 64<br />
wiese, Wechselfeuchte Glatthaferwiese bzw. Kriechstraußgras-Flutrasen<br />
oder Röhrichte. Die Entwicklung der Wiesen soll durch eine Ersteinsaat gefördert<br />
werden.<br />
Wege und Platzaufweitungen dürfen maximal 15 % der erschlossenen<br />
Grünzone belegen. Die Wegebreiten sollen eine Breite von 2,5 m nicht überschreiten;<br />
sie sind mit wassergebundener Decke auszuführen.<br />
(3) Festsetzungen für Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege<br />
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (gemäß § 9<br />
(1) Nr. 20 BauGB) in Verbindung mit Festsetzungen für Maßnahmen<br />
für die Erhaltung sowie zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern<br />
und sonstigen Bepflanzungen (gemäß § 9 (1) Nr. 25 BauGB):<br />
(3.1) Hohlweg mit Lößsteilwand („Ö1“):<br />
Auf der Westseite des Hohlwegs ist auf einer Länge von ca. 120 m eine<br />
offene Lößsteilwand anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Der Abschnitt mit<br />
Standort der Hainbuche (in Plan 2.1 mit Erhaltungsbindung gekennzeichnet)<br />
ist zu belassen. Die Gehölze auf der Böschungsoberkante sind zu erhalten.<br />
Auf der Ostseite des Hohlwegs sind die Gehölze auf der Böschungsoberkante<br />
aufzulichten (ca. 60 - 70 % des Gehölzbestands), wobei ältere Bäume<br />
(insb. Esche, Walnuss) größtenteils zu erhalten sind. Der lückige, stark lichtdurchlässige<br />
Charakter der Gehölzbestände ist dauerhaft zu erhalten.<br />
Die Sohle des Hohlwegs ist einerseits zur Bewirtschaftung des im Gebiet<br />
anfallenden Niederschlagswassers zu nutzen (vorzugsweise Graben/ Kaskade<br />
auf der Ostseite) und andererseits in das Fußwegesystem des Gebiets<br />
einzubinden. Befestigungen sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren.<br />
(3.2) Baumreihe auf der Westseite der Ortsrandstraße („Ö2"):<br />
Auf der Westseite der geplanten Ortsrandstraße sind mindestens 16 hochstämmige<br />
Laubbäume zu pflanzen. Die in Plan 2.1 auf der Fläche „Ö2“ dargestellten<br />
Bäume können angerechnet werden. Entlang der Ortsrandstraße<br />
ist ein alleeartiger Charakter der Bepflanzung anzustreben (siehe auch Nr.<br />
2.7).<br />
Zur Auswahl stehen insbesondere die in der Pflanzenliste Anhang A.2 genannten<br />
Baumarten.<br />
Als Unterkultur ist Grünland vorzusehen, hierzu ist eine artenreiche, standortgerechte<br />
Wiesensaatgutmischung anzusäen. Die Fläche ist dauerhaft extensiv<br />
zu pflegen (nach Möglichkeit zwei- bis dreimalige Mahd/ Jahr).<br />
(3.3) Extensiv genutzte Streuobstwiese („Ö3“):<br />
Die in Plan 2.1 entsprechend gekennzeichnete Fläche ist flächig als Streuobstwiese<br />
zu entwickeln und dauerhaft extensiv zu unterhalten.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Auf der Fläche sind mindestens 40, größtenteils starkwüchsige, breitkronige<br />
Hochstamm-Obstbäume mit einer Stammlänge von mind. 1,6 m bis zum untersten<br />
Astansatz zu pflanzen. Die Pflanzabstände dürfen 10 m nicht unterschreiten.<br />
Es sind regionaltypische Obstsorten zu verwenden. Zur Auswahl<br />
stehen insbesondere die in der Pflanzenliste Anhang A.5 genannten Arten<br />
und Sorten.<br />
Die Durchführung des Baumschnitts ist im notwendigen Umfang durchzuführen<br />
(insb. während der Erziehungsjahre). Die Düngung der Baumscheiben<br />
hat vorzugsweise mit organischem Material (bspw. organischer Mehrnährstoffdünger)<br />
zu erfolgen.<br />
Als Unterkultur ist eine Mähwiese vorzusehen. Die Entwicklung des Grünlands<br />
soll durch eine Ersteinsaat mit standortgerechten Gräsern und Kräutern<br />
erfolgen. Angestrebt wird die Entwicklung einer Typischen Glatthaferwiese<br />
mit vereinzelten Vorkommen von Arten halbruderaler Halbtrockenrasen<br />
(insb. im Bereich der Säume). Die zu entwickelnden Grünlandflächen<br />
sollen in den ersten fünf Jahren nach Anlage dreimal jährlich gemäht werden<br />
(1. Mahd nicht vor dem 15. Juni, 2. Mahd nicht vor dem 1. August,<br />
3. Mahd nicht vor dem 15. September). Nach fünf Jahren soll eine zweischürige<br />
Mahd erfolgen (1. Mahd nicht vor dem 15. Juni, 2. Mahd nicht vor dem<br />
15. September). Je nach Vegetationsentwicklung ist alternierend auch eine<br />
dreischürige Mahd möglich. Witterungsbedingte Abweichungen von diesen<br />
Terminen sind zulässig. Die Mahdtermine sind jedoch ungefähr einzuhalten.<br />
Das Mähgut ist vorzugsweise abzutransportieren. Eine Düngung der Grünlandflächen<br />
oder der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig.<br />
Mit Ausnahme von notwendigen Pflegewegen ist auf die Anlage von Wegeflächen<br />
zu verzichten.<br />
(3.4) Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereit gestellten Flächen<br />
(„Ö4“):<br />
Die in der Erlenbach-/ Flutgrabenniederung in der Gemarkung Steinweiler<br />
gelegene östliche Teilfläche des Flurstücks Nr. 6068 (Flächengröße 11.215<br />
qm) ist Teil einer Ökokontofläche (Ökokonto der Stadt <strong>Kandel</strong>, Blatt Nr. 21),<br />
der für den Ausgleich von Eingriffen herangezogen wird.<br />
Die Flächen sind als extensiv genutztes Dauergrünland (vorwiegend mittlerer<br />
Standorte, z. T. wechselfeucht) zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten.<br />
Für das Grünland ist eine zweimalige Mahd/ Jahr bzw. Mulchen in drei- bis<br />
fünfjährigem Turnus vorzusehen. Anzustreben ist bei mittleren Standortbedingungen<br />
die Entwicklung von mageren (Wechselfeuchten) Glatthaferwiesen.<br />
Bestehende Ufergehölze entlang des Flutgrabens sind extensiv zu pflegen.<br />
Die Stadt <strong>Kandel</strong> verpflichtet sich durch weitere vertragliche Regelungen,<br />
die bereits durchgeführten Maßnahmen zu unterhalten und zu pflegen.<br />
Seite 65
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 66<br />
Lage der außerhalb des Plangebiets liegenden Ökokontofläche (Flurstück Nr. 6068, Gemarkung Steinweiler), die für<br />
den Ausgleich von Eingriffen herangezogen wird (östliche Teilfläche mit einer Größe von 11.215 qm).<br />
(4) Festsetzungen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung<br />
von Boden, Natur und Landschaft (gemäß § 9 (1) Nr. 20<br />
BauGB):<br />
(4.1) In den nicht zur Bebauung/ Versiegelung vorgesehenen Grundstücksteilen<br />
sind Bodenverdichtungen zu vermeiden. Der bei Unterkellerung/ Reliefanpassung<br />
anfallende Erdaushub ist nach Möglichkeit im Rahmen der Freiflächengestaltung<br />
der Grünflächen zu integrieren und einer unmittelbaren Nutzung<br />
zuzuführen. Für Aufschüttungen oder Auffüllungen ist nur einwandfreies,<br />
nicht verunreinigtes Material zu verwenden. Dabei sind sowohl die Vorsorgewerte<br />
der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) sowie für<br />
Schadstoffe, für die in der BBodSchV keine Vorsorgewerte festgelegt sind,<br />
die Zuordnungswerte Z0 bis Z0* der Technischen Regel der LAGA „Anforderungen<br />
an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen“, Teil II TR<br />
Boden im Eluat und in Feststoffen einzuhalten. Die Verwendung von Z0*-<br />
Material ist nur unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht zulässig. Die<br />
genannten Anforderungen gelten auch als eingehalten, wenn das Bodenmaterial<br />
aus natürlich anstehenden Schichten innerhalb des Landkreises gewonnen<br />
wurde bei dem schädliche Kontaminationen aus anthropogenen<br />
Einflüssen nicht zu erwarten sind. Ein entsprechender Nachweis über Herkunft<br />
und Qualität des zur Verwendung kommenden Bodenmaterials ist der<br />
SGD Süd - Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz,<br />
Neustadt a.d.Wstr. vor Verwendung vorzulegen.<br />
In Verbindung mit § 202 BauGB (Schutz des Mutterbodens) wird festgesetzt:<br />
Der Oberboden ist vor Beginn der Erdarbeiten entsprechend DIN 18915 abzuschieben<br />
und bis zur Wiederverwertung auf Mieten von höchstens 2,0 m<br />
Höhe zu lagern.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
(4.2) Unnötige Versiegelungen sind im gesamten Plangebiet zu vermeiden. Wo<br />
immer dies technisch vertretbar ist, sind halbdurchlässige Materialien<br />
(Schottertragdeckschichten, weitfugiges Pflaster, stark durchlässiges Pflaster<br />
sog. „Öko- oder Drainpflaster“, Pflaster ohne Fugenverguss, Rasenlochsteine,<br />
Splitt, Schotterrasen u. ä.) zu verwenden.<br />
Offene Pkw-Stellplätze, Zufahrten und notwendige Lager- und Abstellflächen<br />
(soweit keine wassergefährdenden Stoffe gelagert werden) sind in wasserdurchlässigem<br />
Material mit einer Versickerungsleistung von ≥ 50 % herzustellen.<br />
(5) Festsetzungen für Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von<br />
Niederschlagswasser (gemäß § 9 (1) Nr. 14 BauGB):<br />
(5.1) Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung sind bereits auf der Fläche der<br />
Privatgrundstücke vorzunehmen. Bei Maßnahmen zur breitflächigen Versickerung<br />
von unbelastetem Oberflächen- und Dachflächenwasser auf den<br />
Grundstücksfreiflächen ist die bedingte Versickerungsfähigkeit des Bodens<br />
zu beachten. Das anfallende Dachflächenwasser kann vorzugsweise in Zisternen<br />
gesammelt und als Brauchwasser genutzt werden.<br />
Die „Öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“, das<br />
Verkehrsbegleitgrün sowie die in Plan 2.1 mit „Ö1“, „Ö2“ und „Ö3“ gekennzeichneten<br />
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung<br />
von Boden, Natur und Landschaft sollen als zentrale Retentionsflächen<br />
zur Einleitung, Rückhaltung und Versickerung von unbelastetem Oberflächenwasser<br />
genutzt werden.<br />
Die Böschungsbereiche von Mulden, Gräben und Verwallungen sind - wenn<br />
möglich - flach auszugestalten. Nach Möglichkeit sind die Böschungen und<br />
Sohlen von Mulden/ Gräben unregelmäßig zu profilieren. Aufschüttungen,<br />
insbesondere für Verwallungen, sollen eine Höhe von 1,0 - 1,5 m nicht überschreiten.<br />
Befestigungen (u. a. im Bereich von Auslässen, Gefällstrecken)<br />
sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren.<br />
(6) Zuordnung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 9 Abs. 1a<br />
BauGB:<br />
(6.1) Den zu erwartenden Eingriffen auf öffentlichen Grundstücksflächen werden<br />
die im öffentlichen Straßenverkehrsraum durchzuführenden Maßnahmen<br />
(Verkehrsbegleitgrün, zu 100 %), die auf den öffentlichen Grünflächen<br />
durchzuführenden Maßnahmen (zu 100 %) sowie die in Plan 2.1 mit „Ö2“<br />
gekennzeichnete Fläche und die darauf auszuführenden Maßnahmen zum<br />
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft<br />
(Baumreihe auf der Westseite der Ortsrandstraße, zu 100 %) zugeordnet.<br />
Seite 67
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 68<br />
Die in Plan 2.1 mit „Ö1“ (Hohlweg mit Lößsteilwand), „Ö3“ (Extensiv genutzte<br />
Streuobstwiese) und „Ö4“ (Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde<br />
bereit gestellten Flächen, Ökokontofläche Blatt Nr. 21, Gemarkung<br />
Steinweiler: Flurstück Nr. 6068, Teilfläche mit 11.215 qm) gekennzeichneten<br />
Flächen und die darauf auszuführenden Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege<br />
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden zu jeweils<br />
100 % als Sammelersatzmaßnahmen gemäß § 9 Abs. 1a BauGB den zu<br />
erwartenden Eingriffen auf Flächen, auf denen bauliche Maßnahmen ausgeführt<br />
werden können (Bauplätze), - zusätzlich zu den auf diesen Flächen getroffenen<br />
Festsetzungen - zugeordnet.<br />
Die den Privatgrundstücken zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen<br />
werden von der Stadt <strong>Kandel</strong> auf Kosten der Grundstückseigentümer<br />
durchgeführt. Die Art der Kostenermittlung und der Umfang der Kostenerstattung<br />
sind in einer eigenen Satzung der Stadt <strong>Kandel</strong> geregelt.<br />
(7) Empfehlungen zu bauordnungsrechtlichen und baugestalterischen<br />
Festsetzungen:<br />
(7.1) Zur Dacheindeckung sind unglasierte, rote bis rotbraune Ton- oder Betondachsteine<br />
zu verwenden. Solaranlagen sind zugelassen.<br />
(7.2) Einfriedungen entlang der Grenzen zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind<br />
einzeln oder in Kombination in folgenden Ausführungen zulässig:<br />
a) lebende Hecken,<br />
b) Holzzäune bis 1,25 m Höhe,<br />
c) Mauern aus Naturstein, Ziegelstein bzw. verputztem Beton oder verputztem<br />
Mauerwerk bis 1,25 m Höhe,<br />
d) Mauerpfeiler von nicht mehr als 0,6 m Breite und bis zu 1,8 m Höhe.<br />
Entlang der übrigen Grenzen sind Einfriedungen in Form von lebenden Hecken<br />
sowie in transparenter Ausführung (Holz, Drahtgeflecht, Stab-Gitter)<br />
und bis zu einer Höhe von 1,25 m zulässig. Bei Angrenzen der Schallschutzwand<br />
sind auf der der Schallschutzwand zugewandten Grundstücksseite<br />
Einfriedungen in Form von lebenden Hecken bis zu einer Höhe von 2,5<br />
m zulässig. Einfriedungen aus Drahtgeflecht/ Stab-Gitter sind mit Heckengehölzen<br />
oder Kletterpflanzen einzugrünen.<br />
Einfriedungen aus Aluminiumblech, Kunststoffglas, sonstigen Kunststoffen<br />
sowie Grundstückseinfriedungen aus reihigen Anpflanzungen von Nadelgehölzen<br />
sind unzulässig.<br />
Sichtschutzwände als Teil der Gebäudeaußenwand dürfen die Baugrenzen<br />
bis maximal 2,5 m überschreiten. Wandflächen von mehr als 30 qm sind<br />
dauerhaft zu begrünen (siehe auch Nr. 2.6).
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
(7.3) Die Artenauswahl bei der Bepflanzung der Vorgartenbereiche (Fläche zwischen<br />
der Erschließungsstraße und den Gebäuden) soll die örtlichen Traditionen<br />
berücksichtigen. Neben den in der Pflanzenliste Anhang A.1 genannten<br />
Gehölzarten sind vorwiegend ortstypische Stauden der Bauerngärten<br />
anzupflanzen. Die Vorgärten dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen genutzt<br />
werden. Stellplätze im Vorgartenbereich sind gärtnerisch in geeigneter<br />
Form in die Außenanlage einzubinden (Fahrspur, Rasengitter o. ä.).<br />
(8) Hinweise:<br />
(8.1) Mit der Vorlage von Bauunterlagen für einzelne Grundstücke sind vom Antragsteller<br />
qualifizierte Freiflächengestaltungspläne mit Darstellung und Erläuterung<br />
der grüngestalterischen Maßnahmen sowie des Versiegelungsgrads<br />
vorzulegen (i. d. R. M 1:100).<br />
(8.2) Für die Straßen- und Außenbeleuchtung sollten keine Quecksilberdampf-<br />
Hochdrucklampen (HQL) verwendet werden. Empfohlen werden Lampen<br />
mit einem Lichtspektrum über 500 Nm (z. B. Natriumdampf-Niederdrucklampen).<br />
(8.3) Die in Plan 2.1 eingetragenen, zur Erhaltung festgesetzten Gehölzbestände<br />
sind lagemäßig nicht eingemessen. Es wird empfohlen, vor Beginn der Baumaßnahmen<br />
die genauen Standorte nach Lage und Höhe der Gehölze einzumessen<br />
und zu kartieren.<br />
(8.4) Bei der Pflanzung von Bäumen und Sträuchern sind die Bestimmungen des<br />
Nachbarrechts zu beachten (§ 44ff. NachbG Rheinland-Pfalz).<br />
(8.5) Schutz von unterirdischen Leitungen:<br />
Bei der Verlegung von Leitungen sind die bestehenden und die im Bebauungsplan<br />
festgesetzten Gehölzstandorte freizuhalten (gemäß Merkblatt über<br />
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen, FGSV<br />
939).<br />
Seite 69
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 70<br />
Anhang A: Auswahlliste sowie Qualitätsanforderungen für Gehölze zu den<br />
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans „<strong>NORDWEST</strong>,<br />
<strong>Teilbereich</strong> K 2“, Stadt <strong>Kandel</strong><br />
A.1:<br />
Bäume (außer Obstbäume): Hochstämme oder Stammbüsche mit einem Stammumfang<br />
von mindestens 18 - 20 cm (3 x verpflanzt);<br />
Sträucher: Mindestgröße 60 - 100 cm (2 x verpflanzt).<br />
a) Arten der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation:<br />
Bäume:<br />
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus<br />
Eberesche Sorbus aucuparia<br />
Feld-Ahorn Acer campestre<br />
Feld-Ulme Ulmus minor<br />
Flatter-Ulme Ulmus laevis<br />
Gemeine Esche Fraxinus excelsior<br />
Hainbuche Carpinus betulus<br />
Rot-Buche Fagus sylvatica<br />
Spitz-Ahorn Acer platanoides<br />
Stiel-Eiche Quercus robur<br />
Trauben-Eiche Quercus petraea<br />
Vogel-Kirsche Prunus avium<br />
Winter-Linde Tilia cordata<br />
Sträucher:<br />
Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea<br />
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus<br />
Hasel Corylus avellana<br />
Hunds-Rose Rosa canina<br />
Kreuzdorn Rhamnus cartharticus<br />
Kriechende Rose Rosa arvensis<br />
Liguster Ligustrum vulgare<br />
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus<br />
Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum<br />
Sal-Weide Salix caprea<br />
Schlehe Prunus spinosa<br />
Schwarzer Holunder Sambucus nigra<br />
Weißdorn, eingriffelig Crataegus monogyna<br />
Weißdorn, zweigriffelig Crataegus laevigata
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
b) kulturraumtypische Arten der Gärten:<br />
Bäume:<br />
Obstbäume: Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge<br />
in nach Möglichkeit regionaltypischen Sorten<br />
(z. B. Brettacher, Landsberger Renette, Gellerts Butterbirne,<br />
Pastorenbirne, Große Schwarze Knorpel, Hedelfinger<br />
Riesenkirsche, Bühler Frühzwetschge, Deutsche Hauszwetschge)<br />
Aprikosenbaum Prunus armeniaca<br />
Eß-Kastanie Castanea sativa<br />
Mandelbaum Amygdalus communis<br />
Maulbeerbaum Morus alba<br />
Mispel Mespilus germanica<br />
Pfirsichbaum Prunus persica<br />
Quitte Cydonia oblonga<br />
Speierling Sorbus domestica<br />
Walnuss Juglans regia<br />
Sträucher:<br />
Flieder Syringa vulgaris<br />
Gartenjasmin Philadelphus coronarius<br />
Kornelkirsche Cornus mas<br />
Schmetterlingsstrauch Buddleja davidii<br />
Sommerflieder Buddleja alternifolia<br />
Strauchrosen Rosa spec.<br />
Weißer Hartriegel Cornus alba<br />
Beerensträucher<br />
Auf das Anpflanzen von Nadelgehölzen sollte generell verzichtet werden.<br />
A.2:<br />
Bereich von baulichen Anlagen sowie von Nebenanlagen und Flächen für Stellplätze<br />
und Garagen:<br />
Hochstämme mit einem Stammumfang von mindestens 12 - 14 cm (3 x verpflanzt).<br />
Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen:<br />
Solitärs bzw. Hochstämme mit einem Stammumfang von mindestens für a) 18 - 20<br />
cm resp. für b) 16 - 18 cm (3 x verpflanzt), falls wg. Lichtraumprofil entlang von<br />
Verkehrsflächen erforderlich: Hochstämme mit besonders hohem Kronenansatz.<br />
a) Mittelgroße Bäume und Großbäume:<br />
Gemeine Esche Fraxinus excelsior (auch Sorten `Atlas`,<br />
`Diversifolia`, `Geessink`, Westhofs´s Glorie`)<br />
Hainbuche Carpinus betulus<br />
Seite 71
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 72<br />
Feld-Ahorn Acer campestre<br />
Spitz-Ahorn Acer platanoides (auch Sorte `Cleveland`)<br />
Stiel-Eiche Quercus robur<br />
Trauben-Eiche Quercus petraea<br />
Winter-Linde Tilia cordata (auch Sorten `Erecta`, `Greenspire`)<br />
b) Kleinbäume sowie mittelgroße Bäume mit Kronenbreite < 10 m (bei beengten<br />
Wuchsverhältnissen/ klein dimensionierten Straßenräumen):<br />
A.3:<br />
Echter Rotdorn Crataegus laevigata `Pauls Scarlet`<br />
Kegel-Feldahorn Acer campestre `Elsrijk`<br />
Gefüllte Vogel-Kirsche Prunus avium `Plena`<br />
Kugel-Esche Fraxinus excelsior `Globosa`<br />
Pyramiden-Hainbuche Carpinus betulus `Fastigiata`<br />
Säulen-Stieleiche Quercus robur `Fastigiata`<br />
Säulen-Weißdorn Crataegus monogyna ´Stricta`<br />
Schwed. Mehlbeere-Sorte Sorbus intermedia `Brouwers`<br />
Spitz-Ahorn-Sorten Acer platanoides `Columnare` oder `Globosum`<br />
Winter-Linde-Sorte Tilia cordata `Rancho`<br />
Nicht auf Rankhilfe angewiesene Pflanzen, wie z. B.:<br />
Efeu Hedera helix<br />
Wilder Wein Parthenocissus tricuspidata<br />
Pflanzen, die Rankhilfen benötigen:<br />
A.4:<br />
Blauregen Wisteria sinensis<br />
Jelängerjelieber Lonicera caprifolium<br />
Kletter-Hortensie Hydrangea petiolaris<br />
Kletterrosen Rosa in Sorten<br />
Schlingknöterich Fallopia aubertii<br />
Waldrebe Clematis - Wildformen<br />
Spalierobst<br />
Weinreben<br />
Bäume: Hochstämme oder Stammbüsche mit einem Stammumfang von mindestens<br />
12 - 14 cm (3 x verpflanzt), Bäume II. Ordnung auch Heister mit Höhe mind.<br />
200 - 250 cm (3 x verpflanzt);<br />
Sträucher: Mindestgröße 60 - 100 cm (2 x verpflanzt).
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
a) Arten der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation:<br />
Bäume:<br />
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus<br />
Eberesche Sorbus aucuparia<br />
Feld-Ahorn Acer campestre<br />
Feld-Ulme Ulmus minor<br />
Flatter-Ulme Ulmus laevis<br />
Gemeine Esche Fraxinus excelsior<br />
Hainbuche Carpinus betulus<br />
Rot-Buche Fagus sylvatica<br />
Spitz-Ahorn Acer platanoides<br />
Stiel-Eiche Quercus robur<br />
Trauben-Eiche Quercus petraea<br />
Vogel-Kirsche Prunus avium<br />
Winter-Linde Tilia cordata<br />
im Bereich der Retentionsflächen auch:<br />
Rötliche Bruchweide Salix x rubens<br />
Schwarz-Erle Alnus glutinosa<br />
Silber-Weide Salix alba<br />
Sträucher:<br />
Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea<br />
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus<br />
Hasel Corylus avellana<br />
Hunds-Rose Rosa canina<br />
Kreuzdorn Rhamnus cartharticus<br />
Kriechende Rose Rosa arvensis<br />
Liguster Ligustrum vulgare<br />
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus<br />
Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum<br />
Sal-Weide Salix caprea<br />
Schlehe Prunus spinosa<br />
Schwarzer Holunder Sambucus nigra<br />
Weißdorn, eingriffelig Crataegus monogyna<br />
Weißdorn, zweigriffelig Crataegus laevigata<br />
im Bereich der Retentionsflächen auch:<br />
Faulbaum Frangula alnus<br />
Grau-Weide Salix cinerea<br />
Korbweide Salix viminalis<br />
Mandel-Weide Salix triandra<br />
Purpur-Weide Salix purpurea<br />
Traubenkirsche Prunus padus<br />
Seite 73
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 74<br />
b) kulturraumtypische Arten:<br />
A.5:<br />
Bäume:<br />
Obstbäume: Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge<br />
in nach Möglichkeit regionaltypischen Sorten<br />
(z. B. Brettacher, Landsberger Renette, Gellerts Butterbirne,<br />
Pastorenbirne, Große Schwarze Knorpel, Hedelfinger<br />
Riesenkirsche, Bühler Frühzwetschge, Deutsche Hauszwetschge)<br />
Aprikosenbaum Prunus armeniaca<br />
Eß-Kastanie Castanea sativa<br />
Mandelbaum Amygdalus communis<br />
Maulbeerbaum Morus alba<br />
Mispel Mespilus germanica<br />
Pfirsichbaum Prunus persica<br />
Quitte Cydonia oblonga<br />
Speierling Sorbus domestica<br />
Walnuss Juglans regia<br />
Sträucher:<br />
Gartenjasmin Philadelphus coronarius<br />
Strauchrosen Rosa spec.<br />
Beerensträucher div.<br />
Hochstamm-Obstbäume mit einer Stammlänge von mind. 1,6 m bis zum untersten<br />
Astansatz<br />
Speierling Sorbus domestica<br />
Walnuss Juglans regia<br />
Äpfel: Alte Sternrenette, Berlepsch, Bohnapfel, Brettacher, Gewürzluiken,<br />
Gravensteiner, Haberts Renette, Heimeldinger, Jakob<br />
Fischer, Jakob Lebel, Kaiser Wilhelm, Ontario, Landsberger<br />
Renette, Rheinischer Winterrambour, Roter Boskoop, Rote<br />
Sternrenette, Schöner von Boskoop, Winterglockenapfel, Wollenschläger<br />
Birnen: Clapps Liebling, Gelbmöstler, Gellerts Butterbirne, Gute<br />
Graue, Köstliche von Charneau, Pastorenbirne, Petersbirne,<br />
Schweizer Wasserbirne, Vereinsdechantsbirne<br />
Sonstige: Bühler Frühzwetschge, Czar-Pflaume, Deutsche Hauszwetschge,<br />
<strong>Kandel</strong>er Zuckerzwetschge, Graf Althanns Reneklode,<br />
Nancy-Mirabelle, Große Schwarze Knorpelkirsche,<br />
Schneiders Späte Knorpelkirsche, Teickners Schwarze Herzkirsche<br />
oder andere alte, robuste Lokal-/ Regionalsorten der Pfalz.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
4.3 Begründung der landschaftspflegerischen und grünordnerischen<br />
Festsetzungen<br />
4.3.1 Flächen mit Pflanzbindungen und Pflanzgeboten gemäß § 9 (1) Nr. 25<br />
BauGB<br />
Flächen mit Erhaltungsbindungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen<br />
Bepflanzungen<br />
Im Geltungsbereich werden fünf ältere Walnussbäume, eine mehrtriebige Hainbuche<br />
sowie Teile der Baum- und Strauchhecken im Bereich des Hohlwegs (z. T. mit<br />
älteren Eschen, Walnuss) mit einer Erhaltungsbindung belegt14 . Darüber hinaus<br />
stehen im Böschungsbereich randlich der geplanten Brücke über die Bahntrasse<br />
zwei alte Eiche (außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans), die ebenfalls<br />
zu erhalten sind.<br />
Der Erhaltung vorhandener, insbesondere älterer Einzelbäume kommt aus ökologischer<br />
Sicht ein hoher Stellenwert zu. In Abhängigkeit vom Entwicklungsalter stellen<br />
ältere Gehölze eine biologisch wertvolle Nahumgebung (Durchwurzelung, Pilzbewuchs,<br />
Bodenlebewesen) dar, deren Qualitäten durch Neupflanzungen nicht<br />
ohne Weiteres ersetzt werden können. Die Gehölze gehen in ein Altersstadium<br />
über, in dem sie stärkeres Totholz und teils mit Mulm gefüllte Höhlen aufweisen.<br />
Damit steigt ihre Lebensraumfunktion für heimische Tiere stark an; so können sie<br />
spezialisierten Insekten (z. B. Prachtkäfer) sowie höhlenbrütenden Vogelarten der<br />
Kulturlandschaft Vermehrungsmöglichkeiten und Fledermäusen Tagesquartiere<br />
bieten. Darüber hinaus übernehmen die Gehölzbestände wichtige Funktionen zur<br />
Gliederung und Eingrünung des zukünftigen Baugebiets; aufgrund ihre Größe und<br />
exponierten Lage können sie stadtbildprägend wirken.<br />
Durch die zu erhaltenden Gehölzbestände können vorhabensbedingte Beeinträchtigungen<br />
des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds vermieden und gemindert<br />
werden.<br />
Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen<br />
Die Vorgabe eines zeitlichen Rahmens für die Anlage von Vegetationsflächen soll<br />
eine rasche Funktionserfüllung unter den Aspekten des Klimaschutzes und der<br />
Landschafts-/ Stadtbildgestaltung sowie der Biotopfunktion gewährleisten. Vegetationsflächen<br />
übernehmen bioökologische Funktionen und dienen der optischen<br />
Gestaltung und Gliederung des Gebiets. Die Auswahl an Pflanzenarten soll deshalb<br />
standortgerecht sein und den natur- und kulturräumlich typischen Vegetationsstrukturen<br />
entsprechen. Nach Möglichkeit soll autochthones Saat-/ Pflanzgut<br />
verwendet werden (vgl. § 40 BNatSchG). Bei Berücksichtigung der entsprechenden<br />
Artenauswahl werden nicht nur Beeinträchtigungen des Gebietscharakters<br />
vermindert, sondern es wird zugleich ein Nahrungsangebot für siedlungsrandbe-<br />
14 Da die genaue Lage der Gehölze nicht eingemessen wurde, können sich ihre in Plan 2.1 dargestellten<br />
Standorte bei Vermessung des Geländes noch verschieben.<br />
Seite 75
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 76<br />
wohnende Tierarten geschaffen. Gehölzbestände aus einheimischen Arten übernehmen<br />
Lebensraumfunktionen für die gebietstypische Tierwelt, insbesondere im<br />
Hinblick auf die Bedeutung der Flächen als Trittsteinbiotope bzw. als lineare Verbundelemente.<br />
• Nicht überbaubare Grundstücksfläche / gärtnerisch anzulegende Freiflächen<br />
Eine eindeutige Abgrenzung der nicht überbaubaren Grundstücksfläche / gärtnerisch<br />
anzulegenden Freiflächen im Plan ist nicht möglich, da ihre genaue Abgrenzung<br />
im Bereich des Baufensters nicht darstellbar ist. Die gärtnerisch anzulegenden<br />
Freiflächen werden als prozentualer Anteil an der Baulandfläche festgesetzt.<br />
Der Mindestanteil an Garten- und Grünflächen soll im bebauten und befestigten<br />
Bereich - neben dem Arten- und Biotopschutz - vorrangig der Verbesserung bzw.<br />
der Erhaltung der natürlichen Bodenfunktionen, der Versickerung von Niederschlägen<br />
und der Beschattung / Luftbefeuchtung durch Vegetationsbestände dienen.<br />
Grünflächen sind darüber hinaus bedeutsame Gestaltungsmittel im Städtebau (optische<br />
Raumwirksamkeit, Identifikation, Charakterisierung eines Raums). Die angeführten<br />
positiven ökologischen und gestalterischen Wirkungen gelten insbesondere<br />
für Gehölzbestände. Aus diesen Gründen wird für die gärtnerisch anzulegenden<br />
Freiflächen der Baugrundstücke die Anpflanzung von freiwachsenden, standortheimischen<br />
Gehölzen festgesetzt. Die Anpflanzung von Obstbäumen in den<br />
Hausgärten dient der Erhaltung kulturraumtypischer Landschaftselemente im Siedlungsbereich.<br />
Bei einer entsprechenden Gestaltung können die gärtnerisch anzulegenden<br />
Grünflächen vorhabensbedingte Beeinträchtigungen des Naturhaushalts<br />
und des Landschaftsbilds vermeiden bzw. mindern. Die detaillierte Verortung der<br />
Standorte für die Gehölzpflanzungen im Plan ist nicht erforderlich, da die Bauflächen<br />
allseitig von öffentlichen Grünflächen umgeben sind und hierdurch bereits die<br />
landschaftliche Einbindung des Gebiets gewährleistet werden kann (siehe unten).<br />
• Bauliche Anlagen, Nebenanlagen, Flächen für Stellplätze und Garagen<br />
Die Festsetzung zur Pflanzung von hochstämmigen Laubbäumen im Bereich größerer<br />
Stellplatzanlagen dient vorrangig der Durchgrünung und optischen Gliederung<br />
des Gebiets sowie der Versickerung von Niederschlägen und der Beschattung<br />
/ Luftbefeuchtung. Um den Charakter der Stellplatzanlagen städtebaulich zu<br />
prägen, sollen nur bestimmte Gehölzarten Verwendung finden.<br />
Die Begrünung von Wandflächen trägt in der Umgebung der begrünten Fläche zur<br />
Anreicherung bodennaher Luftschichten mit Wasserdampf und zur Bremsung beschleunigter<br />
Windströmungen bei. Durch die Filterwirkung der Blätter kann die<br />
Schadstoffbelastung in der Luft gemindert werden. Des Weiteren besitzen Fassadenbegrünungen<br />
bauphysikalische Positivwirkungen (z. B. verbesserte Wärmedämmung,<br />
Förderung eines ausgeglichenen Innenraumklimas). Die Begrünung<br />
der Lärmschutzwand sowie von fensterlosen, ungegliederten Fassadenteilen wirkt<br />
sich darüber hinaus positiv auf das Landschaftsbild aus. Die Lärmschutzwand<br />
kann zudem alternativ über Baumpflanzungen auf angrenzenden Flächen eingegrünt<br />
werden, falls bspw. eine Gabionenwand errichtet wird.<br />
Die genannten Maßnahmen tragen ebenfalls zur Vermeidung und Minderung vorhabensbedingter<br />
Beeinträchtigungen im Hinblick auf den Naturhaushalt und das<br />
Landschafts-/ Stadtbild bei.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
• Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Die Festsetzung zur Pflanzung von mindestens 98 hochstämmigen Laubbäumen<br />
im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen (Ortsrandstraße, Verlängerung der<br />
Hubstraße sowie Ringstraße inkl. Verbindung) dient vor allem der Durchgrünung<br />
und optischen Gliederung des Straßenraums (optische Raumwirksamkeit, Identifikation,<br />
Charakterisierung eines Raums) sowie der Beschattung und Luftbefeuchtung.<br />
Um einen Alleecharakter im Bereich der Ortsrandstraße und der Verlängerung der<br />
Hubstraße zu prägen, sollen bestimmte Abstände zwischen den Baumstandorten<br />
nicht überschritten werden, nur bestimmte Gehölzarten Verwendung finden sowie<br />
häufige Wechsel der Artenauswahl vermieden werden. Zusammen mit der im Bereich<br />
der Fläche „Ö2“ zu pflanzenden Baumreihe entsteht eine ± geschlossene,<br />
beidseitige, städtebaulich prägende Bepflanzung entlang der Ortsrandstraße.<br />
In der ringförmigen Erschließungsstraße wird eine optische Gliederung des Straßenraums<br />
durch Bäume (von jedem Abschnitt aus soll mindestens ein Baum sichtbar<br />
sein) für ausreichend erachtet, so dass - im Gegensatz zur Ortsrandstraße/<br />
Verlängerung der Hubstraße - kein regelmäßiges Pflanzraster erforderlich ist. Die<br />
Baumstandorte werden teilweise als ca. 4 qm große Drei-/ Vierecke von den privaten<br />
Baugrundstücken abgegrenzt und dem öffentlichen Straßenverkehrsraum zugeordnet<br />
(Verkehrsbegleitgrün). Durch die Zuordnung zum öffentlichen Verkehrsraum<br />
sind die Realisierung sowie die einheitliche Gestaltung der Pflanzmaßnahmen<br />
gesichert.<br />
Im Bereich der Verlängerung der Hubstraße zur Ortsrandstraße kann die Eingrünung/<br />
Gliederung des Straßenraums auch durch Gehölzpflanzungen im Bereich<br />
der angrenzenden öffentlichen Grünflächen ergänzt bzw. gefördert werden.<br />
Die festgesetzten Abstände zwischen den Stellplätzen bzw. Zufahrten und den<br />
Baumstandorten sowie die festgesetzte Mindestgröße der Pflanzflächen sollen<br />
mögliche Schäden im Bereich der anzupflanzenden Bäume verhindern.<br />
Insbesondere die Einsaat einer standortgerechten Wiesensaatgutmischung im Bereich<br />
der Baumscheiben sowie der verbleibenden Grünflächen entlang der Verkehrswege<br />
ermöglicht deren extensive, boden- und grundwasserschonende Pflege.<br />
• Öffentliche Grünflächen<br />
Als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ wird im Wesentlichen<br />
der zentrale, der südliche und der südöstliche Grünbereich des Plangebiets<br />
ausgewiesen. Ihm kommt aufgrund seiner Lage und Erschließung eine besondere<br />
Bedeutung für die wohnungsnahe Erholungsfunktion zu. Teilweise sind<br />
bereits heute Wegebeziehungen vorhanden (z. B. über zentralen Hohlweg, Weg<br />
entlang der Bahntrasse), die aufgegriffen und zu einem Rundweg weiterentwickelt<br />
werden können (siehe Gestaltungsvorschlag in Plan 2.1).<br />
Die Festsetzung zur Pflanzung von standortheimischen Laubgehölzen im Bereich<br />
der „Spielplätze“ / „Parkanlagen“ dient vorrangig der optischen Einbindung und<br />
Durchgrünung der Grünflächen. Die Verwendung duftender oder aromatischer<br />
Gehölze im Bereich der Kinderspielplätze fördert den Geruchssinn der Kinder. Eine<br />
extensive Nutzung des Offenlandes begünstigt die Entwicklung arten- und blü-<br />
Seite 77
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 78<br />
tenreicher Wiesenbestände. Grünflächen können eine Verbesserung aller Naturhaushaltsbereiche<br />
bewirken. Ihre Bedeutung steigt mit der Gesamtgröße der<br />
Grünfläche sowie dem Anteil an naturnahen, extensiv genutzten Teilen. Um die<br />
Trittsteinfunktion der Grünflächen (Parkanlage) für Arten und Biotope zu fördern,<br />
sollen Trenn- und Verinselungseffekte durch ein engmaschiges Wegenetz vermieden<br />
werden. Wege und Platzaufweitungen werden deshalb auf maximal 15 % der<br />
erschlossenen Grünzone begrenzt. Die Beschränkung der Wegebreiten dient dem<br />
sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden.<br />
Die Anlage von Wiesenbeständen und gebietstypischen Gehölzen trägt zudem zur<br />
Kompensation vorhabensbedingter Verluste entsprechender Biotopbestände bei.<br />
Die Entwicklung extensiv genutzter Wiesen unterschiedlicher Standortbedingungen<br />
trägt zur Erhöhung der Lebensraumvielfalt im Siedlungsbereich bei. Als Folge<br />
der extensiven Nutzung entwickeln sich blütenreiche Bestände, die einen Lebensund<br />
Nahrungsraum für zahlreiche Vogelarten und Insekten, vor allem für zahlreiche<br />
Tagfalterarten darstellen. In den tieferen Stellen der zeitweise wasserführenden<br />
Gräben und Retetentionsmmulden werden sich u. a. Flutrasenbestände entwickeln,<br />
die aufgrund ihrer lockeren Struktur die Ansiedlung von Amphibienarten<br />
begünstigen. Insbesondere die in Rheinland-Pfalz gefährdete Wechselkröte (Bufo<br />
viridis) bevorzugt als Besiedler des Offenlandes sonniges, vegetationsarmes Gelände<br />
und junge Kleingewässer. Östlich der mit einer Erhaltungsbindung versehenen<br />
Walnussbäume ist im Bereich des Geländeversprungs zudem die Anlage einer<br />
offenen Lößabbruchkante möglich. Eingestreute und randliche Gehölzstrukturen<br />
sollen den ansonsten offenlandgeprägten Lebensraum ökologisch und landschaftsästhetisch<br />
bereichern.<br />
4.3.2 Maßnahmen/ Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur<br />
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft<br />
• Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von<br />
Boden, Natur und Landschaft<br />
Die Flächen „Ö1", „Ö2“, „Ö3“ und „Ö4“ übernehmen sowohl Vermeidungs- und Minimierungsfunktionen<br />
für die durch die Überbauung/ Versiegelung zu erwartenden<br />
Beeinträchtigungen als auch Kompensationsfunktionen für die nach Errichtung des<br />
Baugebiets bestehenden Beeinträchtigungen. Unter den vielfältigen Funktionen<br />
des Naturhaushalts soll dabei der Schwerpunkt im Arten- und Biotopschutz liegen<br />
15 . Die Festsetzungen beinhalten vorwiegend Maßnahmen zur Entwicklung<br />
bzw. Neuschaffung ökologisch wertvoller Bereiche sowohl innerhalb des Baugebiets<br />
als auch auf externen Flächen. Das Maßnahmenkonzept orientiert sich dabei<br />
einerseits an den Strukturen, die durch die Überbauung in Anspruch genommen<br />
werden und andererseits an der Förderung besonders landschaftstypischer Elemente<br />
(insb. Hohlweg, Grünland, Streuobst und sonstige gebietstypische Gehölz-<br />
15 Dessen ungeachtet wirken sich die Maßnahmen auch positiv auf die übrigen Schutzgüter, insbesondere<br />
den Boden, den Wasserhaushalt, das Klima und das Landschaftsbild bzw. die Erholungsnutzung<br />
aus (Multifunktionalität).
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
bestände)<br />
Die externe Ausgleichsfläche (Teilfläche der Ökokontofläche Blatt Nr. 21, Flurstück<br />
Nr. 6068, Gemarkung Steinweiler) liegt etwa rund 3 km (Luftlinie) nordwestlich des<br />
Plangebiets, so dass der funktionale und räumliche Zusammenhang der externen<br />
Ausgleichsfläche zur Eingriffsfläche noch gegeben ist.<br />
Der im Zentrum des Plangebiets liegende Hohlweg ist derzeit dicht mit Gehölzen<br />
bewachsen, seine Sohle ist mit Betonplatten versiegelt. Mit der Maßnahme „Ö1“<br />
soll der typische Hohlwegscharakter wiederhergestellt werden. Hierzu sollen die<br />
Gehölzbestände auf der westlichen Böschungsseite entfernt und eine offene Lößsteilwand<br />
hergestellt werden. Die auf der Böschungsschulter stehenden Gehölzbestände<br />
sollen erhalten werden. Um eine ausreichende Besonnung der Steilwand<br />
zu erzielen, werden die Gehölzbestände auf der östlichen Böschungsseite/ -<br />
oberkante stark aufgelichtet. Ältere und prägende Gehölze sollen dabei größtenteils<br />
erhalten bleiben. Die Lebensraumfunktionen für gehölzbewohnende Arten<br />
sowie die Leitlinienfunktion der Gehölzbestände bleiben somit weiterhin bestehen.<br />
Durch die Schaffung einer offenen Steilwand wird jedoch die Strukturvielfalt deutlich<br />
erhöht. So werden offene, fast senkrechte Lößwände als Lebensraum für Spezialisten<br />
(insb. wärmeliebende Hautflügler) und als Aufwärm- und Rendezvousplatz<br />
genutzt sowie von spezialisierten Flechten und Moosen besiedelt (vgl. KITT &<br />
HÖLLGÄRTNER 2002). Jungstadien von Hohlwegen mit weitgehend besonnten und<br />
unbewachsenen Lößsteilwänden sind heute kaum noch vorhanden, da in den<br />
noch bestehenden Hohlwegen wegen der meist befestigten Hohlwegsohle keine<br />
natürliche Eintiefung mehr erfolgen kann und die durch Erosion V-förmigen Böschungen<br />
in der Regel dicht mit Gehölzen sind.<br />
Die Maßnahme trägt somit dazu bei, den Arten- und Strukturreichtum und die vielfältigen<br />
ökologischen Funktionen des Hohlwegs zu optimieren. Die Spanne der unterschiedlichen,<br />
stark verzahnten Kleinlebensräume wird zukünftig von einer im<br />
Sommer extrem heißen Lößsteilwand über Ruderalgesellschaften und Halbtrockenrasen<br />
bis hin zu Einzelbäumen, Hecken und Gebüschen mit feuchtem Kleinklima<br />
reichen. Hier kann eine Vielzahl seltener und bestandsbedrohter Pflanzen<br />
und Tiere einen Lebensraum, Teillebensraum oder ein Rückzugsgebiet finden.<br />
Die so genannten „Hohlen“ mit Lößsteinwänden sind charakteristische, kulturhistorisch<br />
bedeutsame Landschaftselemente der südpfälzischen Lößriedel. Mit der geplanten<br />
Maßnahme wird damit auch der klassische Hohlwegscharakter optisch<br />
aufgewertet und für den Betrachter besser wahrnehmbar werden; es entsteht eine<br />
Landschaftsstruktur mit einer hohen landschaftlichen Attraktivität.<br />
Die bestehende Hohlwegssohle ist zudem ausreichend breit, um sowohl Retentionsfunktionen<br />
im Zuge der Bewirtschaftung des Niederschlagswassers im Plangebiet<br />
wahrzunehmen (Graben, Kaskade o. ä. zur Ableitung von Niederschlagswasser<br />
in südlich liegende Retentionsflächen) als auch eine Fußwegeverbindung aufzunehmen<br />
(Einbindung in das Fußwegenetz). Im Zuge der Niederschlagswasserbewirtschaftung<br />
kann auch die Außengebietsentwässerung des Hohlwegs sicher<br />
gestellt werden.<br />
Seite 79
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 80<br />
Auf der Westseite der neuen Ortstrandstraße wird zudem eine Baumreihe aus gebietstypischen<br />
Laubbaumarten angelegt („Ö2“); die Maßnahme dient der Kompensation<br />
von Gehölzverlusten im Plangebiet sowie der landschaftlichen Einbindung<br />
der Verkehrstrasse (vgl. auch oben, Straßenbegleitgrün) und des neuen Baugebiets.<br />
Darüber hinaus kann der Gehölzstreifen Verbundfunktionen wahrnehmen<br />
(insb. Trittstein zwischen südlich angrenzender Streuobstwiese und den Gehölzbeständen<br />
entlang der Bahntrasse).<br />
Der im Nordosten des Plangebiets zu entwickelnden Streuobstbestand („Ö3“) ist<br />
ebenfalls aus bioökologischer Sicht bedeutsam. So dienen Streuobstwiesen beispielsweise<br />
als Ansitzwarte für Greifvögel, Singwarte für Vögel (wie z. B. Baumpieper),<br />
als Deckung vor Feinden und Witterung und als Überwinterungshabitate<br />
für verschiedene Feldarten. Auch wenn - aufgrund der geringen Flächengröße des<br />
zu entwickelnden Streuobstbestands - nicht davon auszugehen ist, dass sich Rote<br />
Liste-Vogelarten (wie bspw. Wendehals, Steinkauz, Grünspecht) ansiedeln werden,<br />
zeigen Bestandsaufnahmen, dass diesem Ökosystem wegen seines Artenund<br />
Individuenreichtums generell eine große Bedeutung für den Naturhaushalt zukommt<br />
(BLAB 1993). Gerade Streuobstwiesen kleinerer Ausprägung zählen oft zu<br />
den wenigen extensiv genutzten Flächen inmitten intensiv ackerbaulich genutzter<br />
Flächen und sind vor allem als Nahrungs- und Entwicklungshabitat für verschiedenste<br />
Tierarten unabdingbar (siehe MFUF & LFUG 1997). Diversen holzbewohnenden<br />
Insekten (z. B. Düsterkäfer-Arten, Großer Wespenbock) genügen auch<br />
kleinere Flächen mit alten Obstbäumen. Darüber hinaus werden mit der Neuanlage<br />
am Siedlungsrand Verbundstrukturen geschaffen: Zusammen mit der Streuobstwiese<br />
im Baugebiet „Am Höhenweg“, der oben genannten Baumreihe sowie<br />
den Gehölzbeständen entlang der Bahntrasse entsteht eine zusammenhängende<br />
Vernetzungslinie für den lokalen Biotopverbund.<br />
Streuobstbestände sind darüber hinaus kulturraumtypische Landschaftselemente<br />
des Siedlungsrands.<br />
Die in den Festsetzungen genannten Vorgaben zur Entwicklung und Pflege des<br />
Streuobstbestands sichern dessen ökologische Wirksamkeit. Die Pflege der Fläche<br />
soll nach Möglichkeit durch Pflege- bzw. Pachtverträge mit interessierten Personen<br />
oder Vereinen (z. B. Obst- und Gartenbauverein, Schulklassen, Naturschutzverbände)<br />
dauerhaft gesichert werden.<br />
Die Entwicklung von extensiv genutztem Dauergrünland (vorwiegend mittlerer<br />
Standorte resp. z. T. wechselfeucht) auf der externen Kompensationsfläche (Ökokonto-Fläche<br />
Blatt Nr. 21, Gemarkung Steinweiler: Flurstück Nr. 6068, davon Teilfläche<br />
mit 11.215 qm, „Ö4“) ist ein Baustein in der Entwicklung eines durchgängigen,<br />
gewässerbegleitenden Grünlandzuges in der größtenteils intensiv genutzten<br />
Erlenbachniederung und entspricht den Zielaussagen bestehender landespflegerischer<br />
Planwerke (Planung vernetzter Biotopsysteme, Landschaftsplanung<br />
zur Flächennutzungsplanung, Gewässerpflege- und Entwicklungsplan Erlenbach/<br />
Flutgraben). Neben der Lebens- bzw. Nahrungsraumfunktion auch für anspruchsvollere<br />
Arten kommt den Flächen eine wichtige Verbundfunktion zwischen<br />
anderen Biotopbeständen ähnlicher Ausprägung zu. Daneben tragen sie zur Aufwertung<br />
z. T. bestehender, angrenzender, aus bioökologischer Sicht höherwertiger
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Bereiche bei.<br />
• Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur<br />
und Landschaft<br />
Im Plangebiet sind vorhabensbedingt umfangreiche Bodenabgrabungen, Bodenumlagerungen<br />
oder Aufschüttungsmaßnahmen vorgesehen. Eine zusätzliche Beeinträchtigung<br />
des Bodens auf den verbleibenden Flächen muss aus Gründen der<br />
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Bodens sowie seiner Bedeutung als landschaftsgeschichtliches<br />
Dokument unterbleiben.<br />
Die Verwendung von unbelastetem Bodenmaterial für Aufschüttungen oder Auffüllungen<br />
ist aus Gründen des Boden- und Grundwasserschutzes erforderlich.<br />
Im Bereich des niederschlagsarmen "Vorderpfälzer Tieflandes" kommt der Versickerung<br />
von Niederschlägen vor Ort eine besondere Bedeutung zu. Im Bereich<br />
von offenen Pkw-Stellplätzen, Zufahrten sowie Lager- und Abstellflächen sind<br />
demzufolge wasserdurchlässige Beläge (z. B. Pflaster, Rasenpflaster, Splitt,<br />
Schotterrasen) zu verwenden, die die Filterfunktion des Bodens erhalten und die<br />
Infiltration von Niederschlägen in das Grundwasser ermöglichen. Die Maßnahme<br />
dient zugleich dem Stadtbild, da entsprechend befestigte Flächen in der Regel "natürlicher"<br />
wirken und so das Bild des Neubaugebiets mitprägen.<br />
4.3.3 Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser<br />
Die Einleitung und breitflächige Rückhaltung/ Versickerung von unbelastetem Oberflächenwasser<br />
im Bereich der öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung<br />
„Parkanlage“, des Straßenbegleitgrüns sowie im Bereich der Flächen für<br />
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und<br />
Landschaft dient der Förderung von Biotopen und Lebensgemeinschaften wechselfeuchter<br />
bis wechselnasser Standorte. Bei naturnaher Ausgestaltung der Retentionsflächen<br />
tragen die Maßnahmen zur Erhöhung der Biotop- und Strukturvielfalt<br />
im Gebiet bei.<br />
Die Sammlung und Versickerung von anfallendem unbelastetem Niederschlagswasser<br />
vor Ort trägt wesentlich zur Stabilisierung und Verbesserung des Wasserhaushaltes<br />
bei. Rückhalteanlagen führen zu einer deutlichen Verringerung der Abflussmengen<br />
der für die Entwässerung mitbenutzten oberirdischen Fließgewässer<br />
(Vorfluter) und zu einer merklichen Dämpfung hochwassergefährdender Abflussspitzen.<br />
Überlastungen der Kanalisation und in Folge der Kläranlagen mit dem Effekt,<br />
dass unzureichend gereinigtes Schmutzwasser direkt in den Vorfluter eingeleitet<br />
wird, können vermieden werden. Die Versickerung von Niederschlagswasser<br />
vor Ort fördert darüber hinaus die Grundwasserneubildung. Die mengenmäßige<br />
Erhöhung der Grundwasserneubildungsrate durch Ausnutzung und Wiederbelebung<br />
natürlicher Versickerungs- und Filtervorgänge des Oberbodens kann im Zusammenwirken<br />
mit einer verlängerten Untergrundpassage des Wassers die Trinkwasservorräte<br />
auch qualitativ verbessern. Der Bodenwasserhaushalt und damit<br />
die Lebensraumfunktion für Bodenlebewesen bzw. oberirdische Tier- und Pflanzenarten<br />
werden gefördert.<br />
Seite 81
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 82<br />
4.3.4 Empfehlungen zu bauordnungsrechtlichen und baugestalterischen<br />
Festsetzungen<br />
Die Empfehlungen zur Art und Farbgebung der Dächer fördern die landschaftliche<br />
Einbindung und den gebietstypischen Charakter des Neubaugebiets.<br />
Gestaltungsvorgaben im Hinblick auf Einzäunungen dienen ebenfalls der landschaftlichen<br />
Einbindung sowie der inneren Gestaltung des Neubaugebiets.<br />
Gestaltungsvorgaben für die Vorgartenbereiche tragen zur inneren Gestaltung des<br />
Neubaugebiets sowie zur Schaffung von harmonischen Übergängen zwischen<br />
dem öffentlichen Straßenraum und der privaten Grundstücksfläche bei.<br />
Die nächtliche Beleuchtung von Gebäuden, entlang von Straßen oder von Wegen<br />
im Bereich öffentlicher Grünflächen zieht bei gewissen Lichtspektren eine Vielzahl<br />
nachtaktiver Insekten an und wirkt dadurch als tödliche Falle. Dies kann durch eine<br />
entsprechende Wahl des Lichtspektrums verhindert werden.<br />
4.4 Maßnahmenvorschläge für das Monitoring<br />
Umweltauswirkung Indikator Informationen der<br />
Behörden<br />
Fehlentwicklungen<br />
bei der Durchführung<br />
bzw. fehlende/ mangelndeFunktionserfüllung/<br />
Wirkung der<br />
Pflanzgebote und der<br />
Maßnahmen zum<br />
Ausgleich<br />
Verkehrslärm (über<br />
das prognostizierte<br />
Maß hinaus)<br />
Hinweise von ehrenamtlichenNaturschützern,Naturschutzbeauftragten,<br />
Biotopbetreuern etc.<br />
Verkehrsaufkommen,<br />
Anteile Pkw/<br />
Lkw<br />
Erst ab einer Verdopplung<br />
des Verkehrsaufkommens<br />
kommt es zu erheblichen<br />
zusätzlichen<br />
Lärmbelastungen,<br />
soweit keine verstärkenden<br />
Faktoren<br />
(wie Lärmreflexionen,<br />
hohe Vorbelastungen,<br />
hoher Lkw-<br />
Anteil) hinzukommen<br />
Beschwerden von<br />
Anwohnern/ Betroffenen<br />
Überwachung des Bestands<br />
durch die Untere<br />
Naturschutzbehörde<br />
Verkehrszählungen<br />
der Straßenverkehrsbehörde,<br />
soweit diese<br />
an Orten durchgeführt<br />
werden, die Rückschlüsse<br />
auf die verkehrsbedingtenBelastungen<br />
des Plangebiets<br />
zulassen (turnusmäßig<br />
alle 5 Jahre). <br />
Verkehrsmengenkarten,<br />
Dauerzählstellen,<br />
Verkehrsgutachten<br />
Einzelerhebungen<br />
nach Beschwerden<br />
von Betroffenen im<br />
Ermessen der zuständigen<br />
Behörde<br />
Zusätzliche Überwachungsmaßnahmen<br />
der Gemeinde<br />
Begehung bzw. fachkundigeZustandsüberprüfung<br />
und Dokumentation<br />
In der Regel keine<br />
Verkehrszählungen,<br />
soweit die regulären<br />
Verkehrszählungen<br />
der Straßenverkehrsbehörde<br />
keine ausreichendenRückschlüsse<br />
zulassen und nur<br />
bei besonderer Indikation<br />
erhöhter Verkehrsbelastungen<br />
Zeitpunkt der zusätzlichen<br />
Überwachung/<br />
mögliche Abhilfemaßnahmen<br />
Jeweils 1 Jahr nach Abschluss<br />
der Herstellung/<br />
Fertigstellung bzw. Abnahme,<br />
bei Bedarf zu wiederholen<br />
Durchführung zusätzlicher<br />
Pflege-/ Entwicklungsmaßnahmen<br />
Im Bedarfsfall Prüfung und<br />
evtl. Anordnung von Immissionsschutzauflagen
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
5 Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich (Bilanz)<br />
5.1 Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich (Bilanz)<br />
Für die zusammenfassende Bewertung des mit der geplanten Bebauung/ Versiegelung/<br />
Flächenumwidmung verbundenen Gesamteingriffs werden zum einen eine<br />
schutzgutbezogene Gesamtbilanzierung und zum anderen eine Flächenbilanzierung<br />
für das Schutzgut Tiere und Pflanzen vorgenommen. Grundlage der vorliegenden<br />
Bilanzierungen sind für den heutigen Zustand die im Gebiet erfassten biotischen<br />
und abiotischen Faktoren (insb. die Erfassung der Biotop- und Strukturtypen,<br />
siehe Kap. 2). Für den zukünftigen Zustand sind die im Bebauungsplan-Entwurf<br />
vom Mai 2011 (Wsw & Partner GmbH, Kaiserslautern) dargestellte zukünftige<br />
Flächennutzung sowie die im vorangegangenen Kapitel genannten landschaftspflegerischen<br />
und grünordnerischen Festsetzungen relevant.<br />
In der Gesamtbilanz (siehe Tab. 4) werden - bezogen auf die jeweiligen Schutzgüter<br />
bzw. Umweltbelange (siehe Kap. 1.3) - die funktions- und flächenbezogenen<br />
Eingriffe und Auswirkungen sowie die vorgesehenen Vermeidungs-, Minderungs-<br />
und Kompensationsmaßnahmen nach Art und Umfang dargestellt und beurteilt.<br />
An die Gesamtbilanz in Tabelle 4 schließt sich eine Flächenbilanzierung an (Tab.<br />
5), in der der ökologische Wert des heutigen Bestands im Gebiet des Bebauungsplans<br />
dem Wert des zukünftigen Zustands gegenübergestellt wird (Flächenbilanzierung<br />
des Schutzguts Tiere und Pflanzen).<br />
Seite 83
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Tab. 4: Bewertung von Eingriff und Ausgleich - Schutzgut Tiere und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt)<br />
(V = Vermeidungsmaßnahme, M = Minderungsmaßnahme, A = Ausgleichsmaßnahme, E = Ersatzmaßnahme)<br />
Tiere und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt)<br />
Kurzbeschreibung: Plangebiet vorwiegend durch Intensiväcker, zu kleineren Teilen auch durch Fettwiesen/ Fettweiden geprägt; im Süden auch Nutzgärten mit z. T. altem Baumbestand (insb. Walnüsse, Obstbaum); im Zentrum asphaltierter<br />
Hohlweg mit überwiegend strauchigen Feldhecken an den Flanken; östlich angrenzend naturnahe Baum-Strauch-Hecken beiderseits der Bahntrasse mit Altholzanteil; überwiegend mittel-gering- und geringwertige Vegetationsbestände; Grünlandbestände<br />
z. T. von mittlerer Bedeutung, Gehölzbestände hochwertig; Gehölzbestände mit Lebensraumfunktionen insb. für Vögel, Insekten, Fledermäuse; Vernetzungslinien/ Trittsteine mit Bedeutung für den lokalen Biotopverbund.<br />
Auswirkungen der Planung/ Potentielle erhebliche<br />
Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Auswirkungen:<br />
Evtl. Beeinträchtigung randlicher bzw. angrenzender<br />
höherwertiger Gehölzbestände<br />
Baubedingte Stoffeinträge (eher unwahrscheinlich)<br />
Beeinträchtigung von Tierarten durch Lärm, Licht,<br />
Bewegungsunruhe oder Erschütterungen während der<br />
Bauphase (vermutlich keine störungsempfindlichen<br />
Arten betroffen, falls dennoch ausreichend Ersatzlebensräume<br />
mit entsprechenden Teillebensraumfunktionen<br />
in der Umgebung vorhanden)<br />
Anlagebedingte Auswirkungen:<br />
Dauerhafter Verlust von Biotopstrukturen, insb. von<br />
mittel-, mittel-hoch- und hochwertigen Grünland- und<br />
Gehölzbeständen durch Befestigung/ Versiegelung<br />
bzw. Flächenumwidmung, weitere Einschränkung der<br />
Lebensraumfunktion des Gebiets<br />
Nutzungs-/ betriebsbedingte Auswirkungen:<br />
Zunahme der kfz-/ nutzungsbedingten Störwirkungen<br />
(durch Lärm-, Lichtemissionen, Bewegungsunruhe)<br />
für die Tierwelt (vermutlich keine störungsempfindlichen<br />
Arten betroffen, geringe Verkehrsbelastung zur<br />
Hauptaktivitätszeit von Fledermäusen)<br />
Erhöhung des Kollisionsrisikos für Tiere durch den<br />
zusätzlichen Kfz-Verkehr (voraussichtlich nicht über<br />
das allgemeine Lebensrisiko hinausgehend)<br />
Sogwirkungen/ Verwirbelungen durch die Vorbeifahrt<br />
(untergeordnet wirksam/ unerheblich)<br />
Kfz-bedingte Stoffeinträge insbesondere durch Spritzwasser<br />
in angrenzende Vegetationsbestände (unerheblich)<br />
Seite 84<br />
Betroffene<br />
Fläche<br />
(qm)<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
Nettoneuversiegelung<br />
ca.<br />
6,5 ha<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
Vermeidung / Minderung / Ausgleich (Ersatz)<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M/ A<br />
V+M/ A<br />
V+M<br />
V+M<br />
Ordnungsgemäßer und sachgerechter Umgang mit Baufahrzeugen, Baumaschinen und<br />
Betriebsstoffen (Genehmigungs-/ Ausführungsplanung)<br />
Nutzung von befestigten/ versiegelten Flächen als Fahrwege und Lagerplätze im Zuge<br />
der Baumaßnahmen (Genehmigungs-/ Ausführungsplanung)<br />
Falls erforderlich Schutz randlicher bzw. angrenzender Vegetationsbestände gemäß<br />
DIN 18920 (Genehmigungs-/ Ausführungsplanung)<br />
Weitgehender Erhalt hochwertiger Gehölzbestände (Einzelbäume, Baum-/ Strauchhecken<br />
im Bereich des Hohlwegs)<br />
Verwendung natur- und kulturraumtypischer Pflanzenarten<br />
Sicherung eines Mindestanteils an Vegetationsflächen mit Pflanzbindungen auf den<br />
Baugrundstücken: nicht überbaubare Grundstücksfläche / gärtnerisch anzulegende<br />
Freiflächen (mittel-geringe bioökologische Bedeutung)<br />
Pflanzung von gebietstypischen Laubbäumen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen<br />
(Straßenbegleitgrün), extensive Pflege der Flächen (mittel-geringe bioökologische Bedeutung)<br />
Pflanzung von gebietstypischen Laubbäumen/ Sträuchern sowie Entwicklung von Grünlandbeständen<br />
im Bereich der öffentlichen Grünflächen (insb. Parkanlage), extensive<br />
Pflege der Flächen (mittlere bioökologische Bedeutung)<br />
Ausweisung von Vegetationsflächen mit ökologischer Zielsetzung und mittlerer, mittel-<br />
hoher bzw. hoher bioökologischer Bedeutung:<br />
- Ö1: Hohlweg mit Lößsteilwand<br />
- Ö2: Baumreihe auf der Westseite der Ortsrandstraße<br />
- Ö3: Extensiv genutzte Streuobstwiese<br />
- Ö4: Fläche zum Ausgleich: Extensiv genutztes Dauergrünland (mittlerer Standorte<br />
resp. z. T. wechselfeucht) auf dem Flurstück Nr. 6068, Gemarkung Steinweiler<br />
in der Erlenbach-/ Flutgrabenniederung<br />
Förderung wechselfeuchter/ wechselnasser Standortbedingungen durch Rückhaltung/<br />
Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers vor Ort (naturnahe Retentionsflächen)<br />
Verwendung von Beleuchtungsanlagen mit geringer Anlockwirkung für Insekten<br />
Flächengröße<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
6 St., ca.<br />
400 qm (s.<br />
u.)<br />
k. A.<br />
ca.<br />
24.916 qm<br />
mind.<br />
98 St.<br />
ca.<br />
13.800 qm<br />
1.830 qm<br />
2.685 qm<br />
4.450 qm<br />
11.215 qm<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
Festsetzung<br />
Nr.<br />
(Kap. 4.2)<br />
-<br />
-<br />
-<br />
1.1<br />
Anhang A<br />
2.3/ 2.4<br />
2.7/ 2.8<br />
2.9<br />
3.1<br />
3.2<br />
3.3<br />
3.4<br />
5.1<br />
8.2<br />
Bewertung von Eingriff und Ausgleich<br />
Mögliche baubedingte Beeinträchtigungen<br />
lassen sich im Zuge der Ausführung<br />
vermeiden (u .a. evtl. Schutz<br />
randlicher Vegetationsbestände, Regelung<br />
im Rahmen der Genehmigungs-/<br />
Ausführungsplanung).<br />
Mögliche anlage-/ nutzungsbedingte<br />
Beeinträchtigungen des Schutzguts<br />
Tiere und Pflanzen (inkl. biologische<br />
Vielfalt) können durch die vorgesehenen<br />
grünordnerischen/ landschaftspflegerischen<br />
Maßnahmen im Plangebiet<br />
selbst nicht vollständig vermieden,<br />
vermindert bzw. kompensiert werden.<br />
Dies betrifft v. a. die weitere Einschränkung<br />
der Lebensraumfunktion<br />
des Gebiets.<br />
Mögliche Beeinträchtigungen im Hinblick<br />
auf das Schutzgut können jedoch<br />
durch die Entwicklung von Extensivgrünland<br />
im Bereich der Erlenbach-/<br />
Flutgrabenniederung kompensiert werden<br />
(Flurstück Nr. 6068, Gemarkung<br />
Steinweiler, Ökokonto-Fläche Nr. 21,<br />
Flächengröße 11.215 qm).<br />
Die externe Maßnahme zum Ausgleich<br />
ist im Zuge eines entsprechenden<br />
städtebaulichen Vertrags näher zu<br />
regeln.<br />
Zustand und Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen<br />
sollen 1 Jahr nach<br />
Fertigstellung/ Abnahme der jeweiligen<br />
Maßnahme geprüft werden.<br />
Das Eintreten von Verbotstatbeständen<br />
gemäß § 44 BNatSchG ist nicht<br />
wahrscheinlich. Bei Gehölzrodungen<br />
sind die Bestimmungen des § 39<br />
BNatSchG zu beachten.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Fortsetzung Tab. 4: Bewertung von Eingriff und Ausgleich - Schutzgut Boden<br />
(V = Vermeidungsmaßnahme, M = Minderungsmaßnahme, A = Ausgleichsmaßnahme, E = Ersatzmaßnahme)<br />
Boden<br />
Kurzbeschreibung: größtenteils basenreiche Parabraunerden bzw. Tschernosem-Parabraunerden, z. T. Rigosole, keine gefährdeten oder seltenen Bodentypen; schluffig-tonige/ schluffig-lehmige Oberböden, teilw. mit Fein-/ Mittelsanden mit hohem bis<br />
sehr hohem Wasserrückhalte- und physiko-chemischen Filtervermögen, Nähr-/ Schadstoffbelastungen infolge diffuser Einträge bzw. intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, Belastung unterhalb Vorsorgewerte der Bundesbodenschutzverordnung; hohe<br />
bis sehr hohe natürliche Ertragsfähigkeit für die landwirtschaftliche Nutzung, sehr hohe Erosionsanfälligkeit.<br />
Auswirkungen der Planung/ Potentielle erhebliche Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Auswirkungen:<br />
Bodenverdichtung, qualitative Veränderung der Bodeneigenschaften<br />
(z. B. Porenvolumen) im Bereich verbleibender oder randlicher<br />
Freiflächen<br />
Schadstoffanreicherung durch Emissionen von Baufahrzeugen<br />
(Wahrscheinlichkeit des Eintretens gering)<br />
Anlagebedingte Auswirkungen:<br />
Zerstörung der gewachsenen Bodenhorizontierung, Beeinträchtigung<br />
der natürlichen Bodenentwicklung und des natürlichen Bodengefüges<br />
durch Umlagerungen, Aufschüttungen, Verdichtungen<br />
o. ä.<br />
Evtl. Nähr-/ Schadstoffbelastung durch Aufschüttungen/ Auffüllungen<br />
(Fremdmaterial)<br />
Funktionsverlust durch Flächenbefestigung/ -versiegelung / -<br />
überbauung (Nettoneuversiegelung)<br />
Nutzungs-/ betriebsbedingte Auswirkungen:<br />
Schadstoffeinträge/ -anreicherung durch Emissionen des Kfz-<br />
Verkehrs in den Böden am Straßenrand<br />
Kontaminationen bei Unfällen (kein besonderes Risiko)<br />
Vermehrte Trittbelastung auf angrenzenden Freiflächen<br />
Betroffene<br />
Fläche<br />
(qm)<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
ca. 10 ha<br />
k. A.<br />
ca. 6,5 ha<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
Vermeidung / Minderung / Ausgleich (Ersatz)<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M/ E<br />
V+M/ E<br />
V+M<br />
Nutzung von befestigten/ versiegelten Flächen für Fahrwege und Lagerplätze im<br />
Rahmen der Baumaßnahmen (Regelung im Zuge der Genehmigungs-/ Ausführungsplanung)<br />
Schonender, sachgerechter Umgang mit zu beseitigendem Oberboden<br />
Abtransport überschüssigen Bodenmaterials und ordnungsgemäße Wiederverwendung<br />
(Regelung im Zuge der Genehmigungs-/ Ausführungsplanung)<br />
Verwendung von einwandfreiem, nicht verunreinigtem Material für mögliche<br />
Aufschüttungen/ Auffüllungen<br />
Ordnungsgemäßer und sachgerechter Umgang mit Baufahrzeugen, Baumaschinen<br />
und Betriebsstoffen (Regelung im Zuge der Genehmigungs-/ Ausführungsplanung)<br />
Verwendung natur- und kulturraumtypischer Pflanzen, wodurch der Einsatz von<br />
Pflanzenbehandlungsmitteln vermieden werden kann<br />
Begrenzung der Flächenversiegelung und Sicherung eines Mindestanteils an<br />
Vegetationsflächen auf den Baugrundstücken: nicht überbaubare Grundstücksfläche<br />
/ gärtnerisch anzulegende Freifläche<br />
Ausweisung von öffentlichen Grünflächen (insb. Parkanlage) und von Grünflächen<br />
entlang von öffentl. Verkehrsflächen (Verkehrsbegleitgrün) mit extensiver<br />
Pflege<br />
Ausweisung von Vegetationsflächen mit ökologischer Zielsetzung und extensiver<br />
Pflege:<br />
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,<br />
Natur und Landschaft („Ö1“, „Ö2“, „Ö3“, „Ö4“)<br />
Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für offene Pkw-Stellplätze, Zufahrten,<br />
Lager- und Abstellflächen<br />
Flächengröße<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
ca.<br />
24.916 qm<br />
ca. 18.660<br />
qm<br />
20.180 qm<br />
k. A.<br />
Festsetzung<br />
Nr.<br />
(Kap. 4.2)<br />
-<br />
4.1<br />
-<br />
4.1<br />
-<br />
2.1<br />
2.3, 2.4<br />
2.7, 2.8, 2.9<br />
3<br />
4.2<br />
Bewertung von Eingriff und Ausgleich<br />
Mögliche baubedingte Beeinträchtigungen<br />
lassen sich durch entsprechende<br />
Textfestsetzungen sowie im<br />
Zuge der Ausführung vermeiden und<br />
minimieren.<br />
Die Nettoneuversiegelung von ca. 6,5<br />
ha Boden als nicht regenerierbarem<br />
Naturgut ist größtenteils nicht ausgleichbar,<br />
die Maßnahmen beschränken<br />
sich weitgehend auf Vermeidung<br />
und Minimierung. Ein Teil der Beeinträchtigungen<br />
kann durch die Ausweisung<br />
von Vegetationsflächen mit extensiver<br />
Pflege im Plangebiet (insb.<br />
öffentliche Grünflächen, Verkehrsbegleitgrün,<br />
Flächen für Maßnahmen<br />
zum Schutz, zur Pflege und<br />
zur Entwicklung von Boden, Natur und<br />
Landschaft) als - jedoch nicht ausgleichende<br />
- Ersatzmaßnahme kompensiert<br />
werden. Die verbleibenden<br />
Defizite werden durch die Rücknahme<br />
von Bodenbelastungen (insb. Reduzierung<br />
der Bewirtschaftungsintensität) im<br />
Bereich der externen Fläche zum Ausgleich<br />
kompensiert (Flurstück Nr. 6068,<br />
Gemarkung Steinweiler, Ökokonto-<br />
Fläche Nr. 21, Flächengröße 11.215<br />
qm).<br />
Seite 85
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Fortsetzung Tab. 4: Bewertung von Eingriff und Ausgleich - Schutzgut Wasser<br />
(V = Vermeidungsmaßnahme, M = Minderungsmaßnahme, A = Ausgleichsmaßnahme, E = Ersatzmaßnahme)<br />
Wasser<br />
Kurzbeschreibung: keine klassifizierten, dauerhaften Oberflächengewässer vorhanden; geringe Grundwasserhöffigkeit, (mittlere bis) hohe Grundwasserflurabstände, mittlere bis geringe Grundwasserneubildungsrate und geringe Verschmutzungsempfindlichkeit,<br />
geringe bis sehr geringe Nitratauswaschungsempfindlichkeit; hohe Bedeutung der Wasserrückhaltung aufgrund der geringen Jahresniederschläge (im Sommer negative klimatische Wasserbilanz); keine wasserrechtlichen<br />
Schutzgebietsausweisungen.<br />
Auswirkungen der Planung/ Potentielle erhebliche<br />
Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Auswirkungen:<br />
Reduzierung der Sickerwassermenge durch Bodenverdichtungen<br />
im Zuge von Baumaßnahmen (kleinräumig)<br />
Potentielle Verunreinigungen des Grundwassers durch<br />
Emissionen von Baufahrzeugen (Wahrscheinlichkeit des<br />
Eintretens gering)<br />
Anlagebedingte Auswirkungen:<br />
Verminderung der Grundwasserneubildung bzw. des<br />
Wasserrückhaltevermögens der Landschaft durch Befestigung/<br />
Versiegelung/ Überbauung<br />
Evtl. Verunreinigung durch Aufschüttungen/ Auffüllungen<br />
(Fremdmaterial)<br />
Offenlegung von Grundwasser bei tieferen Abgrabungen<br />
(evtl. im Süden des Plangebiets)<br />
Nutzungs-/ betriebsbedingte Auswirkungen:<br />
Schadstoffeinträge ins Grundwasser durch Emissionen<br />
des Kfz-Verkehrs<br />
Kontaminationen bei Unfällen (kein besonderes Risiko)<br />
Vermehrte Trittbelastung auf angrenzenden Freiflächen<br />
und in der Folge Reduzierung der Sickerwassermenge<br />
(untergeordnet)<br />
Seite 86<br />
Betroffene<br />
Fläche<br />
(qm)<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
Nettoneuversiegelung<br />
ca. 6,5 ha<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
Vermeidung / Minderung / Ausgleich (Ersatz)<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M/<br />
A+E<br />
Nutzung von befestigten/ versiegelten Flächen für Fahrwege und Lagerplätze im<br />
Rahmen der Baumaßnahmen (Regelung im Zuge der Genehmigungs-/ Ausführungsplanung)<br />
Verwendung von einwandfreiem, nicht verunreinigtem Material für mögliche Aufschüttungen/<br />
Auffüllungen<br />
Ordnungsgemäßer und sachgerechter Umgang mit Baufahrzeugen, Baumaschinen<br />
und Betriebsstoffen (Regelung im Zuge der Genehmigungs-/ Ausführungsplanung)<br />
Wasserrückhaltung:<br />
Begrenzung der Flächenversiegelung und Sicherung eines Mindestanteils an Vegetationsflächen<br />
auf den Baugrundstücken: nicht überbaubare Grundstücksfläche/<br />
gärtnerisch anzulegende Freifläche<br />
Größtmögliche Versickerung der Niederschläge: Verwendung wasserdurchlässiger<br />
Beläge für offene Kfz-Stellplätze, Zufahrten, Lager- und Abstellflächen<br />
Weitestgehende Rückhaltung des anfallenden, unbelasteten Oberflächenwassers im<br />
Bereich der Grundstücksflächen (flächenhafte Versickerung oder Speicherung bzw.<br />
Kombinationsrückhaltung, Verwendung als Brauchwasser)<br />
Rückhaltung der verbleibenden Oberflächenabflüsse in zentralen Retentionsflächen<br />
(siehe öffentliche Grünflächen/ Parkanlage, „Ö1“, „Ö2“, „Ö3“), breitflächige Versickerung<br />
qualitativer Grundwasserschutz:<br />
Verwendung natur- und kulturraumtypischer Pflanzen, wodurch der Einsatz von<br />
Pflanzenbehandlungsmitteln vermieden werden kann<br />
Extensive Pflege der öffentlichen Grünflächen (insb. Parkanlage), der Grünflächen<br />
entlang von Verkehrswegen (Verkehrsflächen) und der Flächen für Maßnahmen zum<br />
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Ö1“,<br />
„Ö2“, „Ö3“ und „Ö4“)<br />
Flächengröße<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
ca.<br />
24.916 qm<br />
k.A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
ca.<br />
38.840 qm<br />
Festsetzung<br />
Nr.<br />
(Kap. 4.2)<br />
-<br />
4.1<br />
-<br />
2.3, 2.4<br />
2.4<br />
5.1<br />
5.1<br />
2.1<br />
2.7, 2.8,<br />
2.9, 3<br />
Bewertung von Eingriff und<br />
Ausgleich<br />
Die Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts<br />
sind durch die dargestellten<br />
Maßnahmen, insbesondere<br />
durch die Ausweisung<br />
von Retentionsflächen für das<br />
anfallende, unbelastete Niederschlagswasser<br />
vor Ort und die<br />
Ausweisung von Vegetationsflächen<br />
mit extensiver Pflege (öffentliche<br />
Grünflächen, Verkehrsbegleitgrün,<br />
Flächen für Maßnahmen<br />
zum Schutz, zur Pflege<br />
und zur Entwicklung von Boden,<br />
Natur und Landschaft) größtenteils<br />
vermeidbar bzw. minimierbar.<br />
In Teilen der Freiflächen findet<br />
gegenüber der derzeitigen<br />
Situation eine Reduzierung von<br />
Nähr-/ Schadstoffeinträgen statt.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Fortsetzung Tab. 4: Bewertung von Eingriff und Ausgleich - Schutzgut Klima / Luft sowie Mensch/ Bevölkerung (Gesundheit)<br />
(V = Vermeidungsmaßnahme, M = Minderungsmaßnahme, A = Ausgleichsmaßnahme, E = Ersatzmaßnahme)<br />
Klima/ Luft sowie Mensch/ Bevölkerung (Gesundheit)<br />
Kurzbeschreibung: Lage inmitten einer ausgeprägten Wärmeinsel, geringe Niederschlagsrate, häufige Inversionswetterlagen, großräumig bioklimatisch belastende Bedingungen, Luftqualität ausreichend bis schlecht; Freiflächen wirken entlastend<br />
und ausgleichend (Freiland-Klimatop, Übergangsbereiche zwischen Freiland- und Wald-Klimatop); angrenzende Bebauung mit Vorbelastungen (u. a. erhöhtes Temperaturniveau); Frisch- und Kaltluftabfluss je nach Geländegefälle in nördliche,<br />
östliche bzw. südliche Richtung, allerdings nur schwach ausgeprägt; vermutlich geringe Wirksamkeit lokaler Windsysteme, Gleiskörper der Bahnlinie als Luftleitbahn; Verkehr als hauptsächlicher Verursacher von Lärm.<br />
Auswirkungen der Planung/ Potentielle erhebliche<br />
Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Auswirkungen:<br />
Evtl. Beschädigung/ Beeinträchtigung von randlichen oder<br />
angrenzenden klimawirksamen Vegetationsbeständen<br />
(insb. Gehölzbestände)<br />
Erhöhung der Immissionsbelastung (Luft, Lärm) durch den<br />
Baubetrieb (unerheblich)<br />
Anlagebedingte Auswirkungen:<br />
Verlust von Frisch- und Kaltluftproduktionsflächen bzw.<br />
Ausgleichsflächen mit direktem Bezug zum Siedlungsraum<br />
durch Befestigung/ Versiegelung/ Bebauung, Minderung<br />
der Ausgleichs-/ Entlastungswirkungen des Gebiets<br />
Behinderung von lokalklimatischen Luftaustausch- und<br />
Strömungsverhältnissen (unerheblich)<br />
Nutzungs-/ betriebsbedingte Auswirkungen:<br />
Zusätzliche Luftschadstoffbelastung durch nutzungsbedingte<br />
Kfz-Emissionen (lediglich Umverteilung, keine wesentliche<br />
Änderung der Luftqualitätsparameter)<br />
Von einer Verträglichkeit der benachbarten schutzwürdigen<br />
Nutzungen (insb. Wohnbebauung) mit dem Kfz-<br />
Verkehr auf der Ortsrandstraße bzgl. Lärmemissionen ist<br />
auszugehen (siehe schalltechnisches Gutachten von GSB<br />
- SCHALLTECHNISCHES BERATUNGSBÜRO PROF.<br />
DR. KERSTIN GIERING 2011)<br />
Von einer Verträglichkeit der im Raum vorhandenen Nutzungen<br />
mit der geplanten Wohnnutzung ist ebenfalls auszugehen.<br />
Energienutzung/ -verbrauch<br />
Betroffene<br />
Fläche<br />
(qm)<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
Nettoneuversiegelung<br />
ca. 6,5 ha<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
Vermeidung / Minderung / Ausgleich (Ersatz)<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M/ A<br />
V+M/ A<br />
V+M/ A<br />
V+M<br />
Falls erforderlich Schutz randlicher bzw. angrenzender Gehölzbestände (Regelung<br />
im Zuge der Genehmigungs-/ Ausführungsplanung)<br />
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, technischen Normen und Richtlinien<br />
zur Vermeidung von Baulärm und Rauchbelästigung während der Baumaßnahmen<br />
(Regelung im Zuge der Genehmigungs-/ Ausführungsplanung)<br />
Weitgehender Erhalt klimatisch entlastender Gehölzbestände (Einzelbäume,<br />
Baum-/ Strauchhecken im Bereich des Hohlwegs)<br />
Begrenzung der Flächenversiegelung und Sicherung eines Mindestanteils an<br />
Vegetationsflächen auf den Baugrundstücken: nicht überbaubare Grundstücksfläche/<br />
gärtnerisch anzulegende Freifläche mit Pflanzbindungen<br />
Begrünung ungegliederter Wandflächen, evtl. Lärmschutzwand<br />
Intensive Ein- und Durchgrünung des Plangebiets, insb durch:<br />
Festsetzung von Grünflächen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen inkl.<br />
Anpflanzen gebietstypischer Gehölzbestände (Verkehrsbegleitgrün) mit klimatisch<br />
entlastenden Funktionen<br />
Ausweisung von Vegetationsflächen mit lokalklimatisch entlastenden Funktionen<br />
(wie Frischluft- und Kaltluftproduktion, Minderung der Wärmerückstrahlung<br />
und Erhöhung der Verdunstung, Filterfunktion): öffentliche Grünflächen<br />
mit Pflanzbindungen (insb. Parkanlage) sowie Flächen für Maßnahmen für<br />
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur<br />
und Landschaft (Ö1“, „Ö2“, „Ö3“ und extern „Ö4“)<br />
Weitestgehende Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers auf den<br />
privaten Grundstücken und sowie Einleitung und breitflächige Versickerung in<br />
zentralen Retentionsflächen (Erhöhung der Verdunstung, siehe öffentliche<br />
Grünflächen/ Parkanlage, „Ö1“, „Ö2“, „Ö3“)<br />
Flächengröße<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
6 St., ca.<br />
400 qm<br />
ca.<br />
24.916 qm<br />
k. A.<br />
ca.<br />
2.415 qm<br />
ca.<br />
36.425 qm<br />
k. A.<br />
Festsetzung<br />
Nr.<br />
(Kap. 4.2)<br />
-<br />
-<br />
1.1<br />
2.3, 2.4<br />
2.6<br />
2.7, 2.8<br />
2.9, 3<br />
5.1<br />
Bewertung von Eingriff und Ausgleich<br />
Beeinträchtigungen des Klimas und der<br />
Luft bzw. im Hinblick auf die menschliche<br />
Gesundheit können durch die dargestellten<br />
Maßnahmen, insbesondere durch die Ausweisung<br />
von Vegetationsflächen mit Pflanzbindungen<br />
(inkl. Anpflanzung von Gehölzbeständen),<br />
weitgehend vermieden, vermindert<br />
bzw. kompensiert werden (Minderung<br />
der Wärmerückstrahlung und Erhöhung<br />
der Verdunstung).<br />
Die in der Erlenbach-/ Flutgrabenniederung<br />
gelegene Fläche zum Ausgleich übernimmt<br />
zusätzlich dauerhaft lokalklimatisch entlastende<br />
Funktionen (Frischluft- und Kaltluftproduktion).<br />
Geringfügige lokale nachteilige Veränderungen<br />
können jedoch nicht ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Von einer Verträglichkeit der benachbarten<br />
schutzwürdigen Nutzungen mit den Lärmemissionen<br />
des Kfz-Verkehrs auf der neuen<br />
Ortsrandstraße ist auszugehen.<br />
Eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien<br />
in Form von Sonnenkollektoren oder<br />
Solarzellen ist möglich.<br />
Seite 87
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Fortsetzung Tab. 4: Bewertung von Eingriff und Ausgleich - Schutzgut Landschaft sowie Mensch/ Bevölkerung (Erholung/ Freizeit)<br />
(V = Vermeidungsmaßnahme, M = Minderungsmaßnahme, A = Ausgleichsmaßnahme, E = Ersatzmaßnahme)<br />
Landschaft sowie Mensch/ Bevölkerung (Erholung/ Freizeit)<br />
Kurzbeschreibung: Teil des Landschaftstyps einer leicht gewölbten Lößplatte, hier: „<strong>Kandel</strong>er Lößriegel“; deutliche Höhenunterschiede im Süden des Gebiets; weiträumige Sichtbeziehungen; Plangebiet v. a. durch offene, flächenhaft wirksame Ackerflächen<br />
geprägt, geringer Anteil an naturnahen gliedernden, kleinteiligeren Strukturen, insb. Hohlweg als charakteristisches Landschaftselement des Lößriedels, Feldgärten mit z. T. altem Baumbestand, Gehölzbestände an der angrenzenden Bahntrasse;<br />
insgesamt mittel-geringe Qualität des Landschaftsbilds; angrenzender Ortsrand z. T. mit Gestaltungsmängeln; als Naherholungsraum für die Kurzzeit-, Tages- und Feierabenderholung von untergeordneter Bedeutung.<br />
Auswirkungen der Planung/ Potentielle erhebliche Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Auswirkungen:<br />
Evtl. Beschädigung von randlichen/ angrenzenden landschaftsbildprägenden<br />
Vegetationsstrukturen (insb. Gehölzbestände)<br />
Erhöhung der Immissionsbelastung (Luft, Lärm, Gerüche) sowie<br />
erhöhte Bewegungsunruhe durch den Baubetrieb, evtl. vorübergehende<br />
eingeschränkte Nutzbarkeit von Wegeverbindungen (unerheblich)<br />
Anlagebedingte Auswirkungen:<br />
Verlust von naturnahen prägenden Landschaftselementen (insb.<br />
Grünland-, Gehölzbestände), nachhaltige Veränderung der Oberflächengestalt<br />
durch Bodenabgrabungen/ Reliefveränderungen,<br />
evtl. monotone, ortsuntypische Bepflanzung (Ziergrün), visuelle Störungen<br />
durch Baukörper, Einfriedungen, bauliche Anlagen u. ä.,<br />
zunehmende Überprägung des Landschaftsbilds<br />
Verlust von Freiraum für die Naherholung (nur eingeschränkt wirksam/<br />
von untergeordneter Bedeutung, deshalb unerheblich)<br />
keine Veränderung/ Unterbrechung von Wegebeziehungen<br />
Nutzungs-/ betriebsbedingte Auswirkungen:<br />
Schadstoff-/ Lärmbelastung durch nutzungsbedingte Emissionen<br />
(insb. Kfz-Verkehr) (unerheblich)<br />
Seite 88<br />
Betroffene<br />
Fläche<br />
(qm)<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
Vermeidung / Minderung / Ausgleich (Ersatz)<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M<br />
V+M/ A<br />
V+M/ A<br />
V+M/ A<br />
V+M/<br />
A<br />
V+M<br />
V+M<br />
Falls erforderlich Schutz randlicher bzw. angrenzender Gehölzbestände (Regelung im<br />
Zuge der Genehmigungs-/ Ausführungsplanung)<br />
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, technischen Normen und Richtlinien zur Vermeidung<br />
von Baulärm und Rauchbelästigung während der Baumaßnahmen (Regelung<br />
im Zuge der Genehmigungs-/ Ausführungsplanung)<br />
Weitgehender Erhalt der Wegeverbindungen während der Bauphase (Regelung im<br />
Zuge der Genehmigungs-/ Ausführungsplanung)<br />
Weitgehender Erhalt prägender Gehölzbestände (Einzelbäume, Baum-/ Strauchhecken<br />
im Bereich des Hohlwegs) sowie des Hohlwegs<br />
Verwendung natur- und kulturraumtypischer Pflanzen für Begrünungen<br />
Gliederung der überbaubaren Fläche durch Sicherung eines Mindestanteils an Vegetationsflächen<br />
und Festsetzungen zur Pflanzung von gebietstypischen Gehölzen:<br />
nicht überbaubare Grundstücksfläche / gärtnerisch anzulegende Freifläche<br />
Begrünung ungegliederter Wandflächen, evtl. Lärmschutzwand<br />
Intensive Ein- und Durchgrünung des Plangebiets, insb durch:<br />
Festsetzung von Grünflächen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen inkl. Anpflanzen<br />
gebietstypischer hochstämmiger Laubbäume (Verkehrsbegleitgrün)<br />
Ausweisung von Vegetationsflächen mit Anlage bzw. Aufwertung kultur- und naturraumtypischer<br />
Landschaftselemente mit einer hohen Bedeutung für das Landschaftserleben:<br />
öffentliche Grünflächen mit Pflanzbindungen (insb. Parkanlage) sowie Flächen<br />
für Maßnahmen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,<br />
Natur und Landschaft (Ö1“, „Ö2“, „Ö3“ und extern „Ö4“)<br />
Förderung von Feuchtbiotopen durch die Einleitung und breitflächige Versickerung von<br />
unbelastetem Oberflächenwasser in Vegetationsflächen, naturnahe, gebietstypische<br />
Gestaltung von Retentionsflächen (siehe öffentliche Grünflächen/ Parkanlage, „Ö1“,<br />
„Ö2“, „Ö3“)<br />
Anlage eines landschaftlich betonten Fußwegenetzes möglich<br />
Empfehlungen zur Außengestaltung der Gebäude (insb. Dacheindeckung), Festsetzungen<br />
zur Gestaltung der Einfriedungen<br />
Flächengröße<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
6 St., ca.<br />
400 qm<br />
k. A.<br />
ca.<br />
24.916 qm<br />
k. A.<br />
ca.<br />
2.415 qm<br />
ca.<br />
36.425 qm<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
k. A.<br />
Festsetzung<br />
Nr.<br />
(Kap. 4.2)<br />
-<br />
-<br />
-<br />
1.1<br />
2.1<br />
2.3, 2.4<br />
2.6<br />
2.7, 2.8<br />
2.9, 3<br />
5.1<br />
-<br />
7<br />
Bewertung von Eingriff und<br />
Ausgleich<br />
Die Beeinträchtigung des Stadtbildes<br />
(Innenwirkung) und des<br />
Landschaftsbildes (Außenwirkung)<br />
wird durch die Einbindung<br />
in ein Gesamtkonzept (gestalterische<br />
Vorgaben für die Vegetationsflächen),<br />
insbesondere durch<br />
die Ausweisung von öffentlichen<br />
Grünflächen, Verkehrsbegleitgrün<br />
und Flächen mit ökologischer<br />
Zielsetzung und einer hohen Bedeutung<br />
für das Landschaftserleben<br />
weitgehend vermieden,<br />
minimiert bzw. kompensiert.<br />
Es erfolgt eine intensive Ein- und<br />
Durchgrünung des neuen Baugebiets.<br />
Mit der Wiederherstellung<br />
des typischen Charakters des<br />
Hohlwegs erfolgt eine deutliche<br />
Aufwertung des gebietstypischen<br />
Landschaftselements.<br />
Zur Kompensation der verbleibenden<br />
Beeinträchtigungen werden<br />
außerhalb des Plangebiets<br />
Freiflächen landschaftlich aufgewertet<br />
(Fläche zum Ausgleich in<br />
der Erlenbach/- Flutgrabenniederung).<br />
Hierdurch wird erholungswirksamer<br />
Freiraum aufgewertet.<br />
Zustand und Wirksamkeit der<br />
Kompensationsmaßnahmen sollen<br />
1 Jahr nach Fertigstellung/<br />
Abnahme der jeweiligen Maßnahme<br />
geprüft werden.<br />
Wegebeziehungen werden nicht<br />
verändert/ unterbrochen; durch<br />
die mögliche Anlage eines Rundweges<br />
verbessert sich das erholungswirksame<br />
Wegenetz.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Fortsetzung Tab. 4: Bewertung von Eingriff und Ausgleich - Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter<br />
(V = Vermeidungsmaßnahme, M = Minderungsmaßnahme, A = Ausgleichsmaßnahme, E = Ersatzmaßnahme)<br />
Kultur- und sonstige Sachgüter<br />
Kurzbeschreibung: Hohlweg als charakteristisches, kulturhistorisch bedeutsames Landschaftselement der Lößriegel des Vorderpfälzer Tieflands (ursprünglicher Hohlwegscharakter nur noch rudimentär vorhanden); Landwirtschaftswege<br />
mit Haupterschließungsfunktionen; diese werden zudem von Spaziergängern sowie von Radfahrern als zwischenörtliche Verbindungen zwischen den nördlich gelegenen Ortschaften und der Stadt genutzt; angrenzend<br />
Abschnitt der im Einschnitt verlaufenden Regional-Bahnlinie Karlsruhe/ Wörth a.Rh. - Neustadt a.d.Wstr.<br />
Auswirkungen der Planung/ Potentielle erhebliche<br />
Beeinträchtigungen<br />
Beanspruchung eines kulturhistorisch bedeutsamen<br />
Landschaftselements (Hohlweg)<br />
Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche (Abwägung<br />
bereits auf Ebene der Flächennutzungsplanung erfolgt)<br />
Landwirtschaftliche Wegeverbindungen werden erhalten.<br />
Bahntrasse wird vorhabensbedingt nicht verändert.<br />
Betroffene<br />
Fläche<br />
(qm)<br />
k. A.<br />
ca.<br />
11,4 ha<br />
-<br />
-<br />
Vermeidung / Minderung / Ausgleich (Ersatz)<br />
V+M/ A<br />
Teilweiser Erhalt der Baum-/ Strauchhecken im Bereich des Hohlwegs<br />
sowie Aufwertung des typischen Hohlwegscharakters<br />
-<br />
Flächengröße <br />
Festsetzung<br />
Nr.<br />
(Kap. 4.2)<br />
1.1, 3.1<br />
Bewertung von Eingriff und Ausgleich<br />
-<br />
Seite 89
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 90<br />
Die nachfolgende Flächenbilanzierung im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen<br />
(inkl. biologische Vielfalt) dient insbesondere der zusätzlichen Bestätigung der naturschutzrechtlichen<br />
Ausgleichbarkeit des Vorhabens (unter Einbeziehung der externen<br />
Maßnahme für den Ausgleich).<br />
Die im Rahmen der Flächenbilanzierung durchzuführende Werteinstufung der bestehenden<br />
und zukünftigen Biotop- und Strukturtypen erfolgt auf der Grundlage der im Anhang<br />
1 dargestellten 16-stufigen Wertskala und Bewertungskriterien. Nähere Angaben zum<br />
ökologischen Wert der bestehenden Biotop- und Strukturtypen im Bereich des geplanten<br />
Baugebiets finden sich in Kapitel 2.1.3. Der bioökologische Wert der gemäß den landespflegerischen<br />
und grünordnerischen Festsetzungen im Plangebiet zu entwickelnden<br />
Grünflächen mit Pflanzbindungen wird je nach Ausgestaltung, Flächengröße und Störungsintensität<br />
als hoch (Hohlweg mit Lößsteilwand), als mittel-hoch (extensiv genutzte<br />
Streuobstwiese), als mittel (Baumreihe auf der Westseite der Ortsrandstraße, öffentliche<br />
Grünfläche - Parkanlage) bzw. als mittel-gering (öffentliche Grünfläche - Kinderspielplatz,<br />
Verkehrsbegleitgrün, private Gartenflächen) eingestuft. Bei der öffentlichen Grünfläche -<br />
Parkanlage wird von einem Mischwert von mittel-hochwertigen Vegetationsstrukturen in<br />
Verbindung mit in Teilen versiegelten/ befestigten Flächen (wie Wege oder Plätze) ausgegangen.<br />
Der Wert der Verkehrsflächen mit einem wasserdurchlässigen Belag ist gering<br />
zu beurteilen (Wertstufe 1); die zukünftigen versiegelten Verkehrsflächen, die Lärmschutzwand<br />
und die bebauten Flächen sind ohne bioökologischen Wert (Wertstufe 0). Da<br />
im gesamten Allgemeinen Wohngebiet Doppelhäuser zulässig sind und die Grundstücksgrößen<br />
noch nicht endgültig festliegen, wird im Sinne einer worst-case-Betrachtung von<br />
einer möglichen Überschreitung der GRZ von 0,4 um 0,2 ausgegangen (vgl. Kap. 1.4).<br />
Die Flächengröße der Fläche für den Gemeinbedarf - Kindergarten beträgt gemäß Bebauungsplan-Entwurf<br />
1.520 qm; zur möglichen Überbauung/ Versiegelung der Fläche<br />
trifft der Bebauungsplan-Entwurf keine näheren Aussagen; vorliegend wird von einer Überbauung/<br />
Versiegelung von max. 80 % der Grundstücksfläche ausgegangen (1.216<br />
qm). Darüber hinaus wird angenommen, dass eventuell entlang der Ortsrandstraße anzulegende<br />
Stellplätze versiegelt werden (vgl. Stellplätze entlang der Ortsrandstraße auf<br />
Höhe des Baugebiets „Am Höhenweg“).<br />
Tabelle 5 gibt das Ergebnis der Berechnung von Wertstufe und Flächenausdehnung sowohl<br />
für den Bestand als auch für die Planungssituation im Geltungsbereich des Bebauungsplans<br />
wieder.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Tab. 5: Flächenbilanzierung des Eingriffs in das Schutzgut Tiere und Pflanzen (inkl. biologische<br />
Vielfalt) im Plangebiet „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“<br />
BESTAND BESTAND<br />
FLÄCHENKATEGORIE Wertstufe (qm) Wertäquivalent<br />
Schlehen-Hecke, Strauchhecke aus Arten der Schlehen-Weißdorngebüsche, Feldulmen-Hecke,<br />
Baumhecke aus Esche o. Stieleiche/ Hainbuche/ Feldulme u. Arten der Schlehen-Weißdorngeb. 13 1.491 19.383<br />
Baum-/ Strauchhecken aus/ mit Esche/ Feldahorn/ Feldulme 12 144 1.728<br />
Typische Glatthaferwiese 7 3.902 27.314<br />
Holundergebüsch<br />
Typische/ Ruderale Glatthaferwiese, Fettweide/ Neueinsaat, Mischtyp aus Nutz- und Ziergarten,<br />
ruderaler Glatthaferbestand, sonstige grasreiche, ausdauernde Ruderalvegetation,<br />
6 8 48<br />
z. T. Brennnessel-Bestand, Kratzbeeren-Gestrüpp<br />
Naturraum- und standortfremde Hecken und Gebüsche, Ruderale/ Fragmentarische/ intensiv<br />
genutzte Glatthaferwiese, Ackerbrache, Nutzgarten, Trittrasen, ruderaler Glatthaferbestand,<br />
4 11.901 47.604<br />
z. T. Brennnessel-Bestand, Graswege, Erdwege<br />
Intensivacker, mehrjährige Sonderkultur, Feldgarten, Nieder-/ Halbstammobstkulturen, Zierrasen/<br />
Vielschnittwiese, vegetationsarme oder -freie Bereiche, Brennholzlager, sonstige grasreiche,<br />
3 3.671 11.013<br />
ausdauernde Ruderalvegetation, Weg/ Trittrasen 2 97.570 195.140<br />
Pflanzenbeet mit Zierstrauchpflanzung, Acker mit Folienhaus, Kies- oder Schotterweg 1 961 961<br />
Versiegelte Straßen und Wege, Wohngebäude, Schuppen 0 5.212 0<br />
Summe 124.860 303.191 303.191<br />
PLANUNG PLANUNG<br />
FLÄCHENKATEGORIE / MAßNAHMENKATEGORIE Wertstufe (qm) Wertäquivalent<br />
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, davon:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Ö1: Hohlweg mit Lößsteilwand (und Erhaltungsbindungen)<br />
Ö2: Baumreihe auf der Westseite der Ortsrandstraße<br />
Ö3: Extensiv genutzte Streuobstwiese<br />
13<br />
6<br />
8<br />
1.830<br />
2.685<br />
4.450<br />
23.790<br />
16.110<br />
35.600<br />
Öffentliche Grünfläche (insg. 17.780 qm), davon:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Parkanlage<br />
Spielplatz<br />
Lärmschutzwand<br />
5<br />
3<br />
1<br />
16.245<br />
735<br />
800<br />
81.225<br />
2.205<br />
800<br />
Private Grünfläche 4 895 3.580<br />
Fläche für die Landwirtschaft<br />
Gemeinbedarfsfläche - Kindergarten (insg. 1.520 qm), davon:<br />
2 340 680<br />
20% gärtnerisch anzulegende Freifläche 3 304 912<br />
80% bebaute und versiegelte Fläche<br />
Allgemeine Wohngebiete (insg. 61.530 qm), GRZ 0,4 zzgl. zulässiger Überschreitung:<br />
0 1.216 0<br />
40% gärtnerisch anzulegende Freifläche 3 24.612 73.836<br />
60% bebaute und versiegelte Fläche 0 36.918 0<br />
Öffentliche Verkehrsfläche (insg. 33.200 qm), davon:<br />
• Verkehrsbegleitgrün 3 2.415 7.245<br />
• Verkehrsfläche, wasserdurchlässig befestigt (Parkplätze) 1 935 935<br />
• Verkehrsfläche, versiegelt 0 29.850 0<br />
Fläche für Bahnanlagen, davon:<br />
• Ruderale Krautbestände stickstoffreicher Standorte 4 120 480<br />
• Bahnlinie (Gleis-/ Schotterkörper) 1 60 60<br />
• versiegelt/ überbaut 0 400 0<br />
Fläche für Versorgungsanlage (Trafo-Station) 0 50 0<br />
Summe 124.860 247.458 247.458<br />
Gemäß der Flächenbilanzierung in Tabelle 5 beträgt der heutige bioökologische Wert<br />
des betrachteten Gebiets 303.191 Wertäquivalente. Nach Verwirklichung der geplanten<br />
Flächenumwidmung weist das Gebiet eine Wertigkeit von 247.458 Wertäquivalenten auf.<br />
Aus bioökologischer Sicht verbleibt mit Umsetzung der geplanten Maßnahmen somit ein<br />
Differenz<br />
(Wertäquivalent) -55.733<br />
Seite 91
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 92<br />
Defizit von 55.733 Wertäquivalenten.<br />
Zusätzliche Ausgleichsflächen stehen im Plangebiet selbst nicht zur Verfügung. Für den<br />
noch zu erbringenden Bedarf an Kompensationsmaßnahmen kann jedoch eine Fläche im<br />
Bereich der Erlenbach-/ Flutgrabenniederung herangezogen werden, und zwar das Flurstück<br />
Nr. 6068, Gemarkung Steinweiler mit einer Flächengröße von insgesamt 13.305<br />
qm (Ökokonto-Fläche Blatt Nr. 21). Die Fläche war ehemals z. T. als Grasweg, z. T. ackerbaulich<br />
bzw. als Intensivgrünland genutzt und wurde mittlerweile zu Extensivgrünland<br />
mittlerer Standorte entwickelt.<br />
Tabelle 6 stellt für das genannte Flurstück die Wertäquivalente des Bestands vor Realisierung<br />
der Extensivierungsmaßnahme denen des Zustands nach Realisierung der Extensivierungsmaßnahme<br />
gegenüber. Je nach ursprünglicher Nutzung ist der Vorwert der<br />
Fläche als mittel-gering resp. als mittel einzustufen. Das nach Extensivierung der Fläche<br />
vorliegende Dauergrünland (mittlerer Standorte resp. z. T wechselfeucht) weist eine mittel-hohe<br />
bioökologische Bedeutung auf (Wertstufe 9).<br />
Tab. 6: Flächenbilanzierung der Aufwertung im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen<br />
(inkl. biologische Vielfalt) im Bereich der Ökokonto-Fläche in der Erlenbach-/ Flutgrabenniederung<br />
- Flurstück Nr. 6068, Gemarkung Steinweiler<br />
BESTAND BESTAND<br />
FLÄCHENKATEGORIE Wertstufe (qm) Wertäquivalent<br />
Wiese mittlerer Standorte, intensiv genutzt 7 4.941 34.587<br />
Grasweg 3 2.240 6.720<br />
Acker 2 6.124 12.248<br />
Summe 13.305 53.555 53.555<br />
PLANUNG PLANUNG<br />
FLÄCHENKATEGORIE / MAßNAHMENKATEGORIE Wertstufe (qm) Wertäquivalent<br />
"Ö5": Extensiv genutztes Dauergrünland:<br />
Wiese mittlerer Standorte, extensiv genutzt 9 13.305 119.745<br />
Summe 13.305 119.745 119.745<br />
Differenz<br />
(Wertäquivalent) insg. 66.190<br />
Aufwertung Wertäquivalent je qm<br />
Mit Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen weist die genannte Fläche eine Wertigkeit<br />
von 119.745 Wertäquivalenten auf. Die Fläche hat somit eine Wertsteigerung von 66.190<br />
Wertäquivalenten erfahren. Das Aufwertungspotential beträgt damit je Quadratmeter<br />
Grundstücksfläche 4,97 Wertäquivalente.<br />
Verrechnet man das Defizit, das bei Realisierung der vorliegenden Bebauungsplanung<br />
entsteht (55.733 Wertäquivalente), mit der Wertsteigerung, die je Quadratmeter der Ökokonto-Fläche<br />
erzielt wird (4,97 Wertäquivalente/ qm), so ergibt sich - rein rechnerisch -<br />
ein Ausgleichsflächenbedarf von rund 11.215 qm. Dem vorliegenden Eingriff wird deshalb<br />
eine 11.215 qm große Teilfläche im Osten des Flurstücks Nr. 6068 zugeordnet. Mit<br />
der vorliegenden Abbuchung verbleibt eine übrige, noch als Ökokonto-Fläche verwend-<br />
4,97
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
bare Teilfläche des Flurstücks von 2.090 qm.<br />
Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass mit Umsetzung der in Kapitel 4 genannten landschaftspflegerischen/<br />
grünordnerischen Maßnahmen die zu erwartenden negativen Auswirkungen<br />
der Planung (gemäß Bebauungsplan-Entwurf vom Mai 2011) vermieden, verringert<br />
und ausgeglichen werden können. Mit Realisierung der Maßnahmen ist der naturschutzrechtliche<br />
Ausgleich für den geplanten Eingriff zu erreichen; die Belange des Umweltschutzes,<br />
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, wie sie in § 1<br />
Abs. 6 Nr. 7 sowie in § 1a BauGB benannt werden, werden berücksichtigt. Das Eintreten<br />
von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG ist nicht wahrscheinlich. Bei Gehölzrodungen<br />
sind die Bestimmungen des § 39 BNatSchG zu beachten.<br />
5.2 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativenprüfung)<br />
Standortalternativen<br />
Die vorliegende Planung entspricht den Darstellungen des rechtskräftigen Flächennutzungsplans<br />
der <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Kandel</strong> (SCHARA + FISCHER 2002 zzgl. 8. Änderung/<br />
Fortschreibung, genehmigt am 17.12.2009). Die Ausweisung von Wohnbauflächen nordwestlich<br />
der Ortslage wurde aus landespflegerischer Sicht als vertretbar beurteilt (vgl.<br />
auch MIESS & MIESS 1993). Im Hinblick auf die Bewertungskategorien, die zur Einstufung<br />
der Umweltverträglichkeit zukünftiger Bauflächen herangezogen wurden, stellt dies<br />
die günstigste Beurteilungsstufe dar. Bei den Flächen handelt es sich insgesamt betrachtet<br />
bzw. vergleichsweise um ökologisch weniger wertvoller Bereiche. Im Vergleich dazu<br />
schneidet beispielsweise die Neuausweisung von Wohnbauflächen im Niederungsbereich<br />
im Süden von <strong>Kandel</strong> (wie die im früheren Flächenutzungsplan enthaltene Bebauung<br />
„Hubhofwiesen“ als Alternativstandort) aus Umweltsicht deutlich unverträglicher ab<br />
(vgl. MIESS & MIESS 1993).<br />
Gestaltungsalternativen<br />
Der nordöstliche <strong>Teilbereich</strong> des geplanten Baugebiets „Nord-West“, das sog. Baugebiet<br />
„Nord-West B“, wurde in den vergangenen Jahren bereits mehrfach überplant. Für diesen<br />
Bereich existieren verschiedene Bebauungs- und Gestaltungskonzepte (der Planungsbüros<br />
WELLER bzw. WSW & Partner GmbH bzw. für Teilflächen auch des Ingenieurbüros<br />
MILTNER) sowie ein Bebauungsplan aus dem Jahr 2000, der jedoch nicht<br />
rechtskräftig wurde. Für das vorliegende Plangebiet „K2“ wurden ebenfalls verschiedene<br />
Strukturkonzepte entwickelt (siehe Planungsbüro Wsw Partner GmbH, u. a. November<br />
2007), die sich im Wesentlichen durch verschiedene Varianten des internen Erschließungsgerüsts<br />
unterscheiden. In allen Konzepten sind der Erhalt des zentralen Hohlwegs<br />
sowie eine randliche Eingrünung der Wohnbauflächen vorgesehen. Insgesamt betrachtet<br />
ist davon auszugehen, dass die verschiedenen Gestaltungskonzepte zu vergleichbaren<br />
Auswirkungen auf die Umwelt führen, da sie sich hinsichtlich Art und Maß der baulichen<br />
Nutzung, der Trassenführung der Ortsrandstraße sowie des Grünkonzepts nicht wesentlich<br />
voneinander unterscheiden.<br />
Seite 93
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 94<br />
6 Zusammenfassung<br />
Die Stadt <strong>Kandel</strong> beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplans „<strong>NORDWEST</strong>“<br />
die Ausweisung von Wohnbauflächen am nordwestlichen, derzeit landwirtschaftlich genutzten<br />
Ortsrand. Aufgrund der Größe des Gebiets (insg. ca. 37,4 ha) ist eine abschnittsweise<br />
Realisierung des Baugebiets vorgesehen. Im ersten Abschnitt soll das<br />
westlich der Bahntrasse gelegene Teilgebiet „K 2“ realisiert werden. Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens<br />
ist zudem die Weiterführung der vom südwestlich angrenzenden<br />
Neubaugebiet „Am Höhenweg“ kommenden Ortsrandstraße in Richtung Landauer Straße<br />
(L 542) - vorliegend bis auf Höhe der am Ostrand des Plangebiets liegenden Bahntrasse.<br />
Die Größe des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong><br />
K 2“ beträgt rund 12,5 ha.<br />
Gemäß Entwurf des Bebauungsplans (WSW & PARTNER GMBH, Stand Mai 2011) wird<br />
das Plangebiet als „Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt, in dem frei stehende Einfamilienhäuser<br />
und Doppelhäuser entstehen sollen. Für das „Allgemeine Wohngebiet“ werden<br />
eine GRZ von 0,4, eine GFZ von 0,8 sowie maximale Firsthöhen von 9,50 m bzw. 11,00<br />
m (im Süden/ Südosten) mit offener Bauweise festgelegt. Im Bereich der bestehenden<br />
Hubstraße wird zudem eine Gemeinbedarfsfläche zur Errichtung eines Kindergartens<br />
festgesetzt.<br />
Die Haupterschließung des neuen Baugebiets erfolgt zum einen über die geplante Ortsrandstraße,<br />
die im Westen bzw. Norden an die neue Bebauung angrenzt und vorerst bis<br />
zur kreuzenden Bahntrasse geführt wird; zum anderen wird die Hubstraße in Richtung<br />
Norden/ Nordwesten verlängert und dann ebenfalls an die Ortsrandstraße angebunden.<br />
Für die innere Erschließung des Neubaugebiets sind eine ringförmige Sammel- und davon<br />
abzweigende Stichstraßen (Wohnstraßen) vorgesehen. Das Baugebiet wird im<br />
Trennsystem entwässert werden. Aufgrund des anstehenden, nur wenig durchlässigen<br />
Untergrunds sollen die Regenwasserabflüsse in Grabensysteme eingeleitet bzw. in im<br />
Gebiet liegende Retentionsmulden abgeleitet und dort zurückgehalten werden (flächige<br />
Retention). Die im Zentrum bzw. am Rande der neuen Bebauung angeordneten Grünbereiche<br />
(öffentliche Grünflächen) sollen je nach Funktion als Park-/ Spielbereiche und/ oder<br />
Retentionsflächen gestaltet werden.<br />
Der Zustand der einzelnen Schutzgüter im Plangebiet, die voraussichtlichen erhebliche<br />
Umweltauswirkungen der Planung sowie geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung<br />
und zum Ausgleich von erheblichen negativen Auswirkungen (Beeinträchtigungen)<br />
lassen sich wie folgt zusammenfassen:<br />
Tiere und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt)<br />
Zustand: vorwiegend durch Intensiväcker, zu kleineren Teilen auch durch Fettwiesen/ Fettweiden<br />
geprägt; im Süden auch Nutzgärten mit z. T. altem Baumbestand (insb. Walnüsse, Obstbaum); im<br />
Zentrum asphaltierter Hohlweg mit überwiegend strauchigen Feldhecken an den Flanken; östlich<br />
angrenzend naturnahe Baum-Strauch-Hecken beiderseits der Bahntrasse mit Altholzanteil; überwiegend<br />
mittel-gering- und geringwertige Vegetationsbestände; Grünlandbestände z. T. von mittlerer<br />
Bedeutung, Gehölzbestände hochwertig; Gehölzbestände mit Lebensraumfunktionen insb. für<br />
Vögel, Insekten, Fledermäuse; Vernetzungslinien/ Trittsteine mit Bedeutung für den lokalen Biotopverbund.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
Voraussichtliche erhebliche Auswirkungen der Planung: baubedingt: Evtl. Beeinträchtigung<br />
randlicher bzw. angrenzender höherwertiger Gehölzbestände; anlagebedingt: Dauerhafter Verlust<br />
von Biotopstrukturen, insb. von mittel-, mittel-hoch- und hochwertigen Grünland- und Gehölzbeständen<br />
durch Befestigung/ Versiegelung bzw. Flächenumwidmung, weitere Einschränkung der Lebensraumfunktion<br />
des Gebiets.<br />
Voraussichtliche unerhebliche Auswirkungen der Planung: baubedingt: Baubedingte Stoffeinträge<br />
sind eher unwahrscheinlich, Beeinträchtigung von Tierarten durch Lärm, Licht, Bewegungsunruhe<br />
oder Erschütterungen während der Bauphase (vermutlich keine störungsempfindlichen/ anspruchsvolleren<br />
Arten betroffen, falls dennoch ausreichend Ersatzlebensräume mit entsprechenden<br />
Teillebensraumfunktionen in der Umgebung vorhanden); nutzungs-/ betriebsbedingt: Zunahme der<br />
kfz-bedingten Störwirkungen (durch Lärm-, Lichtemissionen, Bewegungsunruhe) für die Tierwelt<br />
(vermutlich keine störungsempfindlichen Arten vorhanden, geringe Verkehrsbelastung zur Hauptaktivitätszeit<br />
von Fledermäusen), Erhöhung des Kollisionsrisikos für Tiere durch den zusätzlichen Kfz-<br />
Verkehr (voraussichtlich nicht über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehend), Sogwirkungen und<br />
Verwirbelungen durch die Vorbeifahrt untergeordnet wirksam, Kfz-bedingte Stoffeinträge insbesondere<br />
durch Spritzwasser in angrenzende Vegetationsbestände unerheblich.<br />
Boden<br />
Zustand: größtenteils basenreiche Parabraunerden bzw. Tschernosem-Parabraunerden, z. T. Rigosole,<br />
keine gefährdeten oder seltenen Bodentypen; schluffig-tonige/ schluffig-lehmige Oberböden,<br />
teilw. mit Fein-/ Mittelsanden mit hohem bis sehr hohem Wasserrückhalte- und physikochemischem<br />
Filtervermögen, Nähr-/ Schadstoffbelastungen infolge diffuser Einträge bzw. intensiver<br />
landwirtschaftlicher Nutzung, Belastung unterhalb Vorsorgewerte der Bundesbodenschutzverordnung;<br />
hohe bis sehr hohe natürliche Ertragsfähigkeit für die landwirtschaftliche Nutzung, sehr hohe<br />
Erosionsanfälligkeit.<br />
Voraussichtliche erhebliche Auswirkungen der Planung: baubedingt: Bodenverdichtung, qualitative<br />
Veränderung der Bodeneigenschaften (z. B. Porenvolumen) im Bereich verbleibender oder<br />
randlicher Freiflächen; anlagebedingt: Zerstörung der gewachsenen Bodenhorizontierung, Beeinträchtigung<br />
der natürlichen Bodenentwicklung und des natürlichen Bodengefüges durch Umlagerungen,<br />
Aufschüttungen, Verdichtungen o. ä., evtl. Nähr-/ Schadstoffbelastung durch Aufschüttungen/<br />
Auffüllungen (Fremdmaterial), Funktionsverlust durch Flächenbefestigung/ -versiegelung/ -<br />
überbauung (Nettoneuversiegelung ca. 6,5 ha).<br />
Voraussichtliche unerhebliche Auswirkungen der Planung: baubedingt: Schadstoffanreicherung<br />
durch Emissionen von Baufahrzeugen (Wahrscheinlichkeit des Eintretens gering); nutzungs-/<br />
betriebsbedingt: Schadstoffeinträge/ -anreicherung durch Emissionen des Kfz-Verkehrs in den Böden<br />
am Straßenrand, Kontaminationen bei Unfällen (kein besonderes Risiko), vermehrte Trittbelastung<br />
auf angrenzenden Freiflächen.<br />
Wasser<br />
Zustand: keine klassifizierten, dauerhaften Oberflächengewässer vorhanden; geringe Grundwasserhöffigkeit,<br />
(mittlere bis) hohe Grundwasserflurabstände, mittlere bis geringe Grundwasserneubildungsrate<br />
und geringe Verschmutzungsempfindlichkeit, geringe bis sehr geringe Nitratauswaschungsempfindlichkeit;<br />
hohe Bedeutung der Wasserrückhaltung aufgrund der geringen Jahresniederschläge<br />
(im Sommer negative klimatische Wasserbilanz); keine wasserrechtlichen Schutzgebietsausweisungen.<br />
Voraussichtliche erhebliche Auswirkungen der Planung: baubedingt: Reduzierung der Sickerwassermenge<br />
durch Bodenverdichtungen im Zuge von Baumaßnahmen (kleinräumig); anlagebedingt:<br />
Verminderung der Grundwasserneubildung bzw. des Wasserrückhaltevermögens der Landschaft<br />
durch Befestigung/ Versiegelung/ Überbauung (Nettoneuversiegelung ca. 6,5 ha) - bei Re-<br />
Seite 95
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 96<br />
tention vor Ort unerhebliche Auswirkung, evtl. Verunreinigung durch Aufschüttungen/ Auffüllungen<br />
(Fremdmaterial), evtl. Offenlegung von Grundwasser bei tieferen Abgrabungen (evtl. im Süden des<br />
Plangebiets).<br />
Voraussichtliche unerhebliche Auswirkungen der Planung: baubedingt: Potentielle Verunreinigungen<br />
des Grundwassers durch Emissionen von Baufahrzeugen (Wahrscheinlichkeit des Eintretens<br />
gering); nutzungs-/ betriebsbedingt: Schadstoffeinträge ins Grundwasser durch Emissionen<br />
des Kfz-Verkehrs, Kontaminationen bei Unfällen (kein besonderes Risiko), vermehrte Trittbelastung<br />
auf angrenzenden Freiflächen und in der Folge Reduzierung der Sickerwassermenge.<br />
Klima/ Luft sowie Mensch/ Bevölkerung (Gesundheit)<br />
Zustand: Lage inmitten einer ausgeprägten Wärmeinsel, geringe Niederschlagsrate, häufige Inversionswetterlagen,<br />
großräumig bioklimatisch belastende Bedingungen, Luftqualität ausreichend bis<br />
schlecht; Freiflächen wirken entlastend und ausgleichend (Freiland-Klimatop, Übergangsbereiche<br />
zwischen Freiland- und Wald-Klimatop); angrenzende Bebauung mit Vorbelastungen (u. a. erhöhtes<br />
Temperaturniveau); Frisch- und Kaltluftabfluss je nach Geländegefälle in nördliche, östliche<br />
bzw. südliche Richtung, allerdings nur schwach ausgeprägt; vermutlich geringe Wirksamkeit lokaler<br />
Windsysteme, Gleiskörper der Bahnlinie als Luftleitbahn; Verkehr als hauptsächlicher Verursacher<br />
von Lärm.<br />
Voraussichtliche erhebliche Auswirkungen der Planung: baubedingt: Evtl. Beschädigung/ Beeinträchtigung<br />
von randlichen oder angrenzenden klimawirksamen Vegetationsbeständen (insb.<br />
Gehölzbestände); anlagebedingt: Verlust von Frisch- und Kaltluftproduktionsflächen mit direktem<br />
Bezug zum Siedlungsraum durch Befestigung/ Versiegelung/ Bebauung, Minderung der Ausgleichs-/<br />
Entlastungswirkungen des Gebiets (Nettoneuversiegelung ca. 6,5 ha).<br />
Voraussichtliche unerhebliche Auswirkungen der Planung: baubedingt: Erhöhung der Immissionsbelastung<br />
(Luft, Lärm) durch den Baubetrieb; anlagebedingt: Behinderung von lokalklimatischen<br />
Luftaustausch- und Strömungsverhältnissen; nutzungs-/ betriebsbedingt: Zusätzliche Luftschadstoffbelastung<br />
durch nutzungsbedingte Kfz-Emissionen (lediglich Umverteilung, keine wesentliche<br />
Änderung der Luftqualitätsparameter); von einer Verträglichkeit der benachbarten schutzwürdigen<br />
Nutzungen (insb. Wohnbebauung) mit dem Kfz-Verkehr auf der neuen Ortsrandstraße bzgl. Lärmemissionen<br />
ist auszugehen (siehe schalltechnisches Gutachten von GSB -<br />
SCHALLTECHNISCHES BERATUNGSBÜRO PROF. DR. KERSTIN GIERING 2011); von einer<br />
Verträglichkeit der im Raum vorhandenen Nutzungen mit der geplanten Wohnnutzung ist ebenfalls<br />
auszugehen; Energieverbrauch (effiziente Nutzung der Sonnenenergie möglich).<br />
Landschaft sowie Mensch/ Bevölkerung (Erholung/ Freizeit)<br />
Zustand: Teil des Landschaftstyps einer leicht gewölbten Lößplatte, hier: „<strong>Kandel</strong>er Lößriegel“;<br />
deutliche Höhenunterschiede im Süden des Gebiets; weiträumige Sichtbeziehungen; Plangebiet v.<br />
a. durch offene, flächenhaft wirksame Ackerflächen geprägt, geringer Anteil an naturnahen gliedernden,<br />
kleinteiligeren Strukturen, insb. Hohlweg als charakteristisches Landschaftselement des<br />
Lößriedels, Feldgärten mit z. T. altem Baumbestand, Gehölzbestände an der angrenzenden Bahntrasse;<br />
insgesamt mittel-geringe Qualität des Landschaftsbilds; angrenzender Ortsrand z. T. mit<br />
Gestaltungsmängeln; als Naherholungsraum für die Kurzzeit-, Tages- und Feierabenderholung von<br />
untergeordneter Bedeutung.<br />
Voraussichtliche erhebliche Auswirkungen der Planung: baubedingt: Evtl. Beschädigung/ Beeinträchtigung<br />
von randlichen oder angrenzenden landschaftsbildprägenden Vegetationsstrukturen<br />
(insb. Gehölzbestände); anlagebedingt: Verlust von naturnahen prägenden Landschaftselementen<br />
(insb. Grünland- und Gehölzbestände), nachhaltige Veränderung der Oberflächengestalt durch Bodenabgrabungen/<br />
Reliefveränderungen, evtl. monotone, ortsuntypische Bepflanzung (Ziergrün), visuelle<br />
Störungen durch Baukörper, Einfriedungen, bauliche Anlagen u. ä., zunehmende Überprä-
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
gung des Landschaftsbilds.<br />
Voraussichtliche unerhebliche Auswirkungen der Planung: baubedingt: Erhöhung der Immissionsbelastung<br />
(Luft, Lärm, Gerüche) sowie erhöhte Bewegungsunruhe durch den Baubetrieb, evtl.<br />
vorübergehende eingeschränkte Nutzbarkeit von Wegeverbindungen; anlagebedingt: Verlust von<br />
Freiraum für die Naherholung (nur eingeschränkt wirksam/ von untergeordneter Bedeutung, deshalb<br />
unerheblich), keine Veränderung/ Unterbrechung von Wegebeziehungen; nutzungs-/ betriebsbedingt:<br />
Schadstoff-/ Lärmbelastung durch nutzungsbedingte Emissionen (Kfz-Verkehr).<br />
Kultur- und sonstige Sachgüter<br />
Zustand: Hohlweg als charakteristisches, kulturhistorisch bedeutsames Landschaftselement der<br />
Lößriegel des Vorderpfälzer Tieflands (ursprünglicher Hohlwegscharakter nur noch rudimentär vorhanden);<br />
Landwirtschaftswege mit Haupterschließungsfunktionen; diese werden zudem von Spaziergängern<br />
sowie von Radfahrern als zwischenörtliche Verbindungen zwischen den nördlich gelegenen<br />
Ortschaften und der Stadt genutzt; angrenzend Abschnitt der im Einschnitt verlaufenden Regional-Bahnlinie<br />
Karlsruhe/ Wörth a.Rh. - Neustadt a.d.Wstr.<br />
Voraussichtliche erhebliche Auswirkungen der Planung: anlagebedingt: Beanspruchung eines<br />
kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftselements (Hohlweg).<br />
Voraussichtliche unerhebliche Auswirkungen der Planung: Landwirtschaftliche Wegeverbindungen<br />
werden erhalten; Bahntrasse wird vorhabensbedingt nicht verändert.<br />
Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen für die voraussichtlichen erheblichen<br />
Auswirkungen (Nr. der Festsetzung siehe Kap. 4.2)<br />
Soweit im Bebauungsplan regelbar, werden folgende grünordnerische/ landschaftspflegerische<br />
Festsetzungen formuliert, die in den Bebauungsplan übernommen worden sollen oder im Zuge eines<br />
entsprechenden städtebaulichen Vertrags zu regeln sind (externe Fläche zum Ausgleich):<br />
- Schonender, sachgerechter Umgang mit zu beseitigendem Oberboden (4.1),<br />
- Verwendung von einwandfreiem, nicht verunreinigtem Material für mögliche Aufschüttungen/<br />
Auffüllungen (4.1),<br />
- Weitgehender Erhalt von ökologisch höherwertigen, prägenden Gehölzbestände (Einzelbäume,<br />
Baum-/ Strauchhecken im Bereich des Hohlwegs, 1.1),<br />
- Verwendung natur- und kulturraumtypischer Pflanzenarten für Begrünungen (2.2, Pflanzenlisten<br />
Anhang A),<br />
- Sicherung eines Mindestanteils an Vegetationsflächen mit Pflanzbindungen auf den Baugrundstücken:<br />
nicht überbaubare Grundstücksfläche / gärtnerisch anzulegende Freiflächen<br />
(2.3, 2.4),<br />
- Begrünung ungegliederter Wandflächen, evtl. Lärmschutzwand (2.6),<br />
- Pflanzung von gebietstypischen Laubbäumen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßenbegleitgrün),<br />
extensive Pflege der Flächen (2.7, 2.8),<br />
- Pflanzung von gebietstypischen Laubbäumen/ Sträuchern sowie Entwicklung von Grünlandbeständen<br />
im Bereich der öffentlichen Grünflächen (insb. Parkanlage), extensive Pflege der Flächen<br />
(2.9),<br />
- Ausweisung von Vegetationsflächen mit ökologischer Zielsetzung und mittlerer, mittel- hoher<br />
bzw. hoher bioökologischer Bedeutung: Ö1: Hohlweg mit Lößsteilwand, Ö2: Baumreihe auf der<br />
Westseite der Ortsrandstraße, Ö3: Extensiv genutzte Streuobstwiese, Ö4: Fläche zum Ausgleich:<br />
Extensiv genutztes Dauergrünland auf dem Flurstück Nr. 6068, Gemarkung Steinweiler<br />
in der Erlenbach-/ Flutgrabenniederung (3),<br />
- Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für offene Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Lager- und Abstellflächen<br />
(4.2),<br />
Seite 97
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 98<br />
- Anlage naturnaher Retentionsflächen zur Rückhaltung/ Versickerung des anfallenden, unbelas-<br />
teten Oberflächenwassers vor Ort (5.1),<br />
- Empfehlungen zur Außengestaltung der Gebäude (insb. Dacheindeckung), Festsetzungen zur<br />
Gestaltung der Einfriedungen (7),<br />
- Verwendung von Beleuchtungsanlagen mit geringer Anlockwirkung für Insekten (8.2).<br />
Ein Teil der Maßnahmen betreffen Regelungen, die im Rahmen der nachgelagerten Genehmigungsverfahren<br />
zu beachten sind. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:<br />
- Ordnungsgemäßer und sachgerechter Umgang mit Baufahrzeugen, Baumaschinen und Betriebsstoffen,<br />
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, technischen Normen und Richtlinien zur<br />
Vermeidung von Baulärm und Rauchbelästigung während der Baumaßnahmen,<br />
- Nutzung von befestigten/ versiegelten Flächen als Fahrwege und Lagerplätze im Rahmen der<br />
Baumaßnahmen,<br />
- Falls erforderlich Schutz randlicher bzw. angrenzender Vegetationsbestände (insb. Gehölzbestände)<br />
gemäß DIN 18920,<br />
- Abtransport überschüssigen Bodenmaterials und ordnungsgemäße Wiederverwendung,<br />
- Weitgehender Erhalt der Wegeverbindungen während der Bauphase,<br />
- Anlage eines landschaftlich betonten Fußwegenetzes.<br />
Für das Monitoring werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:<br />
- Überprüfung der Funktionserfüllung/ Wirkung der Pflanzgebote und der Maßnahmen zum Ausgleich,<br />
insbesondere auf den internen Flächen jeweils 1 Jahr nach Abschluss der Herstellung/<br />
Fertigstellung bzw. Abnahme; bei Bedarf zu wiederholen.<br />
Für die zusammenfassende Bewertung des mit den geplanten Änderungen verbundenen<br />
Gesamteingriffs (insb. im Hinblick auf die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) wird<br />
zum einen eine schutzgutbezogene Gesamtbilanzierung und zum anderen eine Flächenbilanzierung<br />
für das Schutzgut Tiere und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt) vorgenommen.<br />
Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass mit Umsetzung der in Kapitel 4 genannten<br />
landschaftspflegerischen/ grünordnerischen Maßnahmen die zu erwartenden negativen<br />
Auswirkungen der Planung (gemäß Bebauungsplan-Entwurf vom Mai 2011) vermieden,<br />
verringert und ausgeglichen werden können. Mit Realisierung der Maßnahmen ist der naturschutzrechtliche<br />
Ausgleich für den geplanten Eingriff zu erreichen; die Belange des<br />
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, wie sie in<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 sowie in § 1a BauGB benannt werden, werden berücksichtigt.<br />
Das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG ist nicht wahrscheinlich.<br />
Bei Gehölzrodungen sind die Bestimmungen des § 39 BNatSchG zu beachten.<br />
Die Festsetzung der externen Fläche zum Ausgleich bzw. die Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen<br />
sind im Zuge eines separaten städtebaulichen Vertrags zu regeln.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
7 Literatur<br />
ARSU (ARBEITSGRUPPE FÜR REGIONALE STRUKTUR- UND UMWELTFORSCHUNG GMBH,<br />
1998): Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 2, Ausbaustrecke Hamburg - Berlin. Biologische<br />
Begleituntersuchungen (Monitoring) zur Ermittlung baubedingter Auswirkungen auf<br />
die Tierwelt (1993-1997) - Abschlussbericht. - Im Auftrag der Planungsgesellschaft Bahnbau<br />
Deutsche Einheit mbH (PB DE), unveröffentlicht.<br />
ARUM - ARBEITSGEMEINSCHAFT UMWELTPLANUNG (1990): Umsetzungsorientierte Konzeption<br />
zur Stilllegung oder Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen aus landschaftsökologischer<br />
Sicht. Hannover/ Garbsen.<br />
BLAB, J. (1993): Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere. Bonn-Bad Godesberg.<br />
BUNZEL, A. (2005): Umweltprüfung in der Bauleitplanung. Arbeitshilfe Städtebaurecht.<br />
Herausgeber: Deutsches Institut für Urbanistik. 156 S. Berlin.<br />
DEUTSCHER WETTERDIENST (1957): Klima-Atlas von Rheinland-Pfalz. Bad Kissingen.<br />
GARNIEL, A., DAUNICHT, W.D., MIERWALD, U. & U. OJOWSKI (2007): Vögel und Verkehrslärm.<br />
Quantifizierung und Bewältigung entscheidungserheblicher Auswirkungen von<br />
Verkehrslärm auf die Avifauna. Schlussbericht November 2007/ Kurzfassung. FuE-<br />
Vorhaben 02.237/2003/LR des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung.<br />
273 S. Bonn, Kiel.<br />
GSB - SCHALLTECHNISCHES BERATUNGSBÜRO PROF. DR. KERSTIN GIERING (2011):<br />
Stadt <strong>Kandel</strong> Bebauungsplan „Nord-West“ - Schalltechnisches Gutachten. 14 S. zzgl.<br />
Anhang. Nohfelden-Bosen.<br />
INGENIEURBÜRO HOHLWEGLER (1996): Gutachterliche Gegenüberstellung der Oberflächenentwässerung<br />
für die Plangebiete „Nord-West B“ und „Am Höhenweg“. November<br />
1996. Karlsruhe.<br />
INSTITUT FÜR LANDESKUNDE (Hrsg., 1969): Geographische Landesaufnahme 1:200.000<br />
- Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 160 Landau i.d. Pfalz. Bearbeiter: PEMÖLLER,<br />
A. Bad Godesberg.<br />
IUS - INSTITUT FÜR UMWELTSTUDIEN (2000): Landespflegerischer Planungsbeitrag zum<br />
Bebauungsplan „Nord-West B“, Stand März 2000. <strong>Kandel</strong>.<br />
KIEFER, A. (2004): Start- und Landebahnverlängerung des Flughafen Frankfurt-Hahn.<br />
Kartierung potenzieller Fledermaus-Quartierbäume und Untersuchung potenzieller Ultraschallemissionen<br />
von Flugzeugen. Unpubl. Bericht, 6 S + Karten.<br />
KITT, M. & M. HÖLLGÄRTNER (2002): Ökologische Untersuchung der Lößböschungen<br />
und Hohlwege bei Freckenfeld mit Pflege- und Entwicklungskonzept. April 2002. Im Auftrag<br />
der Unteren Landespflegebehörde der Kreisverwaltung Germersheim.<br />
KORNPROBST, M. (1994): Landschaftspflegekonzept Bayern, Band II.5: Lebensraumtyp<br />
Streuobst. München.<br />
LFU - LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (2004): Luftqualitätsindex<br />
für langfristige Wirkungen (LAQx) – Modellentwicklung und Anwendung für aus-<br />
Seite 99
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Seite 100<br />
gewählte Orte in Baden-Württemberg. Karlsruhe.<br />
LFUG - LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND GEWERBEAUFSICHT RHEINLAND-PFALZ<br />
(Hrsg., 1979): Heutige potentielle natürliche Vegetation Rheinland-Pfalz. Blatt Nr. 6915<br />
NW, Maßstab 1:10.000. Oppenheim.<br />
LFUG (Hrsg., 1998): Biotopkartierung Rheinland-Pfalz, Kartierjahr 1997, TK25-Nr. 6915.<br />
Oppenheim.<br />
LFUG (2003): Monats- und Jahresberichtes über die Messergebnisse des Zentralen Immissionsmessnetzes/<br />
ZIMEN für Rheinland-Pfalz 01/2003 - 12/2003. Mainz.<br />
LUWG - LANDESAMT FÜR UMWELT, WASSERWIRTSCHAFT UND GEWERBEAUFSICHT<br />
(2004/ 2005/ 2006): Monats- und Jahresberichtes über die Messergebnisse des Zentralen<br />
Immissionsmessnetzes/ ZIMEN für Rheinland-Pfalz. Mainz.<br />
LVA - LANDESVERMESSUNGSAMT RHEINLAND-PFALZ (Hrsg., 1980): Bodenkundliche<br />
Landesaufnahme Rheinland-Pfalz - Bodenarten / Bodengüte. Karten im M. 1:10.000.<br />
Blatt 6915 NW.<br />
MADER, H.-J., SCHELL, C. & P. KORNACKER (1988): Feldwege - Lebensraum und Barriere.<br />
In: Natur und Landschaft 63 (6): 251-256.<br />
MALSCH, W. (1953): Bodenwindverhältnisse in Karlsruhe. In: Beitrag zur naturkundlichen<br />
Forschung Südwestdeutschland 13 Heft 2.<br />
MAYER, H. (1972): Inversionen in der bodennahen Atmosphäre über Karlsruhe. In: Meteorol.<br />
Rdsch. 25. S.153-161.<br />
MFU - MINISTERIUM FÜR UMWELT RHEINLAND-PFALZ (Hrsg., 1991): Rote Liste der bestandsgefährdeten<br />
Biotoptypen in Rheinland-Pfalz - Stand: 1.12.1989, 2. Aufl. Bearbeiter:<br />
BUSHART, M.; HAUSTEIN, B.; LÜTTMANN, J. & P. WAHL. Mainz.<br />
MFU & MFUG - MINISTERIUM FÜR UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG & MINISTERIUM FÜR<br />
UMWELT UND GESUNDHEIT RHEINLAND-PFALZ (Hrsg., 1988): Hydrogeologische Kartierung<br />
und Grundwasserbewirtschaftung im Raum Karlsruhe-Speyer. Stuttgart-Mainz.<br />
MFUF - MINISTERIUM FÜR UMWELT UND FORSTEN RHEINLAND-PFALZ (Hrsg., 2005):<br />
Schutzwürdige und schutzbedürftige Böden in Rheinland-Pfalz. Mainz.<br />
MFUF & LFUG - MINISTERIUM FÜR UMWELT UND FORSTEN & LANDESAMT FÜR UMWELT-<br />
SCHUTZ UND GEWERBEAUFSICHT (1997): Planung vernetzter Biotopsysteme - Bereich<br />
Landkreis Germersheim. Mainz, Oppenheim.<br />
MIESS & MIESS (1993): Landschaftsplanung <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Kandel</strong>. Phase I und<br />
Phase II. Karlsruhe.<br />
MODUS CONSULT ULM GMBH (2007): Verkehrsuntersuchung <strong>Kandel</strong> - Verkehrswirksamkeit<br />
einer Ortsrandstraße, August 2007, Ulm.<br />
NEIDHARDT, CH. & U. V. BISCHOPINCK (1994): UVP- Teil Boden: Überlegungen zur Bewertung<br />
der Natürlichkeit anhand einfacher Bodenparameter. In: Natur und Landschaft,<br />
69.Jg. (1994) Heft 2; S. 49-53.
Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />
PLANUNGSGEMEINSCHAFT RHEINPFALZ (2004): Regionaler Raumordnungsplan Rheinpfalz<br />
2004. Mannheim.<br />
PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT GMBH (2003): Länderfinanzprogramm „Wasser<br />
und Boden“, Themenschwerpunkt „Empfehlungen zur Klassifikation von Böden für<br />
räumliche Planungen“ - Zusammenfassung und Strukturierung von relevanten Methoden<br />
und Verfahren zur Klassifikation und Bewertung von Bodenfunktionen für Planungs- und<br />
Zulassungsverfahren mit dem Ziel der Vergleichbarkeit. Endbericht. Auftraggeber: Bund-<br />
/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO). Hannover.<br />
RENNWALD, E. (2000): Verzeichnis und Rote Liste der Pflanzengesellschaften Deutschlands.<br />
- Schriftenreihe für Vegetationskunde, Heft 35. Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.).<br />
RIECKEN, U., FINCK, P., RATHS, U., SCHRÖDER, E. & A. SSYMANK (2006): Rote Liste<br />
der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands, zweite fortgeschriebene Fassung 2006. - Naturschutz<br />
und Biologische Vielfalt, Heft 34. Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.).<br />
SCHARA & FISCHER (2002): Flächennutzungsplan <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Kandel</strong>. Erläuterungsbericht<br />
und Karte inkl. Änderungen. Mannheim.<br />
SCHMID-EGGER, C., RISCH, S. & O. NIEHUIS (1995): Die Wildbienen und Wespen in<br />
Rheinland-Pfalz. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 16. Landau.<br />
SPORBECK, O., BALLA, S., BORKENHAGEN, J. & K. MÜLLER-PFANNENSTIEL (1997): Arbeitshilfe<br />
zur praxisorientierten Einbeziehung der Wechselwirkungen in Umweltverträglichkeitsstudien<br />
für Straßenbauvorhaben. Bonn.<br />
STEIOF, K. (1996): Verkehrsbegleitendes Grün als Todesfalle für Vögel. Natur und Landschaft,<br />
71. Jg. (1996) Heft 12: 527 - 532.<br />
TÜXEN, R. (1956): Die heutige potentielle natürliche Vegetation als Gegenstand der Vegetationsforschung.<br />
In: Angew. Pflanzensoziologie 13: 5 - 42.<br />
UM BA-WÜ & MUFV RLP - UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG & MINISTE-<br />
RIUM FÜR UMWELT, FORSTEN UND VERBRAUCHERSCHUTZ RHEINLAND-PFALZ (2007):<br />
Hydrogeologische Kartierung und Grundwasserbewirtschaftung im Raum Karlsruhe-<br />
Speyer. Fortschreibung 1986 - 2005. Beschreibung der geologischen, hydrogeologischen<br />
und hydrologischen Situation. Stuttgart - Mainz.<br />
UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG (1995): Bewertung von Böden nach ihrer<br />
Leistungsfähigkeit - Leitfaden für Planungen und Gestattungsverfahren. Bearbeitung: Arbeitskreis<br />
Bodenschutz beim Umweltministerium Baden-Württemberg. Stuttgart.<br />
Seite 101
IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />
Werteinheit<br />
Seite 102<br />
Wertstufe<br />
sehr hoch 15 Rote Liste-<br />
Biotoptypen<br />
Anhang 1: Bioökologisches Potential: Wertstufen und Bewertungskriterien<br />
Gefährdung Gefährdungsgrad<br />
(nicht gefährdete:<br />
Spezifität)<br />
Sicherungsrang*<br />
1<br />
14 " Sicherungsrang<br />
1, 2<br />
hoch 13 " Sicherungsrang<br />
1, 2, 3<br />
mittelhoch <br />
Standortbedingungen<br />
Seltene Sonderstandorte<br />
Etwas häufigere<br />
Sonderstandorte<br />
Wiederherstellbarkeit/Ersetzbarkeit <br />
(Entwicklungsdauer)<br />
Ausgeschlossen<br />
(> 150 Jahre)<br />
Unwahrscheinlich<br />
(50-150 Jahre)<br />
" Langfristig möglich<br />
(15-50 Jahre)<br />
Beziehung zu<br />
umgebenden Flächen<br />
Sehr empfindlich<br />
gegenüber Verän-<br />
Lebensraumfunktion<br />
für<br />
Tierarten<br />
Zahlreiche Rote<br />
Liste-Arten<br />
derungen der Um- "<br />
gebung<br />
" "<br />
12 " " Mittlere Standorte " Empfindlich gegenüber<br />
Verände-<br />
11 " Sicherungsrang<br />
2, 3, 4<br />
10 " Sicherungsrang<br />
3, 4<br />
Seltene Sonderstandorte<br />
Mittlere Standorte,<br />
Verbreitete Sonderstandorte<br />
Mittelfristig möglich<br />
(5-15 Jahre)<br />
" Kurzfristig möglich<br />
(0-5 Jahre)<br />
rungen der Umgebung<br />
" " Vereinzelt Rote<br />
Liste-Arten<br />
" "<br />
9 Zwischenstufe: Beeinträchtigte Bestände von 10, insb. Flächen unter dem Maß des § 30 BNatSchG/ § 28<br />
LNatSchG, oder besonders gut ausgebildete Bestände von 8, häufig vorkommend<br />
8 Nicht gefährdet<br />
Typisch für traditionelleKulturlandschaft<br />
Naturbelassene,<br />
verbreitete Standortbedingungen<br />
mittel 7 " " Anthropogen veränderteStandortbedingungen<br />
6 " " Anthropogen stark<br />
veränderte Standortbedingungen <br />
mittelgering<br />
5 " Kulturbedingt,<br />
mit dominanten<br />
Defiziten<br />
Mittel- oder kurzfristig<br />
möglich<br />
" Landespflegerisch<br />
nicht wünschenswert<br />
Gegenüber der<br />
Umgebung weitgehend<br />
neutral<br />
"<br />
Vereinzelt Rote<br />
Liste-Arten<br />
" " "<br />
" " "<br />
" V. a. Allerweltsarten,<br />
teils Eignung<br />
für seltene<br />
Arten<br />
4 " " " " " V. a. Allerweltsarten,<br />
teils<br />
Funktionen für<br />
seltene Arten<br />
3 " " " " " Wenige Allerweltsarten<br />
2 " " " " Angrenzende Flächen<br />
belastend<br />
"<br />
gering 1 " " " " " Kein dauerhafter<br />
Lebensraum<br />
für heim. Arten,<br />
nur einige Lebensraumfunktionen<br />
ohne 0 " " " " " Keine Lebens-<br />
Wert<br />
raumfunktionen<br />
* = Sicherungsränge gemäß Rote Liste der bestandsgefährdeten Biotoptypen von Rheinland-Pfalz (MFU 1991)