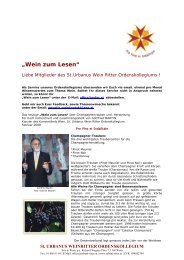„Wein zum Lesen“
„Wein zum Lesen“
„Wein zum Lesen“
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Außerdem förderte Dom Perignon die Verwendung englischen Glases,<br />
welches dem Druck des Schaumweines besser standhielt und führte den<br />
Korken wieder ein. Korken aus der Rinde der Korkeichen waren für die<br />
schäumenden Weine besser geeignet, da sie den Druck besser aushielten.<br />
Dazu gibt es auch zwei Geschichten: Die eine besagt, dass Dom Perignon<br />
eine Zeitlang in der Abtei von Alcantara verbrachte und den Korken von<br />
dort mit nach Hautevillers brachte. Eine andere, dass spanische Mönche<br />
auf Ihrem Weg von Santiago de Compostela nach Norden in Hautesviller<br />
Station machten und Dom Perignon die Korkverschlüsse ihrer Flaschen<br />
auffielen. Er bat sie, ihm einen Vorrat des Materials zu schicken.<br />
Bruder Oudart war für die Weingüter von Saint-Pierre-aux-Monts verantwortlich. Wie auch<br />
Dom Perignon benutzte er Korken und war der erste, der Liqueur de tirage (Fülldosage)<br />
verwendete. Dom Perignon und Bruder Oudart besuchten sich des öfteren und tauschten Wissen<br />
aus, um zusammen den perfekten (Schaum-) Wein zu komponieren.<br />
Dom Perignon ging nun daran, den Glasbruch, welcher bei ca. 50 % lag, in den Griff zu bekommen.<br />
Das französische und das englische Glas wurde zuerst noch mit Holzkohle geschmolzen. Die<br />
Temperaturen waren entsprechend niedrig und das Glas somit nicht sonderlich stabil.<br />
Der englische Admiral Sir Robert Mansell hatte Angst um den Baumbestand in England, denn damit<br />
sollten schließlich Schiffe gebaut werden. Deshalb überredete er 1615 König Jakob I., die<br />
Holzfeuerung in Glasschmelzen zu verbieten. Die Glashersteller benutzten daraufhin Kohle als<br />
Brennmaterial. Durch höhere Temperaturen beim Glasschmelzen wurde das hergestellte Glas<br />
härter als das mit Holzfeuerung geschmolzene. Man benannte dieses Glas nach dem<br />
Herstellungsland verre anglaise - Englisches Glas.<br />
Wein in Flaschen zu lagern war eine englische Sitte. Die<br />
Franzosen lagerten ihren Wein lieber in Fässern. Bei langen<br />
Transporten, z.B. an den Königlichen Hof in Paris, ging das<br />
meiste Kohlendioxid verloren. Der Schaumwein war, so<br />
vermutet man, eine ziemlich lasche und saure<br />
Angelegenheit. In England bestand das Problem nicht in<br />
diesem Ausmaß. Der Schaumwein wurde zwar auch in<br />
Fässern nach England geliefert, doch bevor er ganz vergoren<br />
war, in Flaschen abgefüllt und konnte nochmals gären, ohne<br />
dass die stärkeren englischen Flaschen zersprangen.<br />
Wie Dom Perignon von diesem Glas erfahren hat, ist unklar. Doch somit hatte der Mönch aus<br />
Hautevillers nun alles, was er brauchte: Eine vernünftige Gärung, einen dichten Verschluss und<br />
eine Flasche, die dem Druck einigermaßen standhält.<br />
Um den Glasverbrauch zu minimieren, gab es später weitere Experimente.<br />
Einige Franzosen versuchten Mitte des 19. Jahrhunderts, ein Großraumgärverfahren zu entwickeln,<br />
und 1903 wurde das erste Patent für ein solches Verfahren in den USA angemeldet. Doch erst<br />
Charmat und Chaussepied entwickelten ein wirklich gut funktionierendes Ablaufsystem.<br />
Die endgültige Perfektionierung des Verfahrens erfolgte in Deutschland nach dem zweiten<br />
Weltkrieg. Heute wird nahezu der ganze deutsche und österreichische Sekt auf diese Weise<br />
hergestellt.<br />
Das „versehentliche Abfüllen unfertigen Weines“ wurde in der Folge zu<br />
einer regelrechten Kunst entwickelt und immer weiter verfeinert. Dem<br />
Siegeszug des edlen Tropfens sollte sich fortan niemand mehr in den<br />
Weg stellen können. Das zunächst nur in Adelskreisen verbreitete<br />
Getränk eroberte rasch die Gunst zahlreicher Künstler und Intellektueller<br />
wie Voltaire oder Goethe, mit steigender Verbreitung dann auch das<br />
gehobene Bürgertum. Reichskanzler Bismarck wurde genau wie<br />
Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. ein ausgesprochenes Faible für den<br />
Champagner nachgesagt. Winston Churchill wird mit den Worten zitiert:<br />
„Bei Siegen hat man ihn verdient, bei Niederlagen braucht man ihn."<br />
Und Hoolywood Starlets sollen sogar in Champagner gebadet haben.<br />
Gleichzeitig haftete dem leicht perlenden Getränk ein Hauch von wohlig -<br />
sündiger Verruchtheit an, den es bis heute behalten hat. Kurz gesagt:<br />
Der Champagner wurde das Modegetränk der Reichen und Schönen und<br />
steht bis heute als Symbol für Exklusivität und Luxus.<br />
St. URBANUS WEINRITTER ORDENSKOLLEGIUM<br />
Sitz in Wien, p.a. Richard-Wagner-Platz 7, 1160 Wien<br />
Fax: 01 405 61 69 | E-Mail: office@urbani-ritter.at | www.urbani-ritter.at | ZVR: 694882794