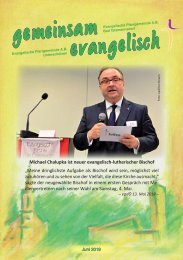Gemeindebote September-November 2020
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6 gemeinsam evangelisch
gemeinsam evangelisch 7
Erwin Schranz:
Woher kommen die Namen unserer Feiertage?
Die Namen unserer großen Feiertage
sind höchst aufschlussreich
für unsere kulturelle, kirchliche und
volkskundliche Entwicklung und Geschichte.
Alle „heiligen drei Zeiten“
– Ostern, Pfingsten und Weihnachten
– sind („erstarrte“) Mehrzahlwörter,
und zwar im dritten Fall Mehrzahl. Im
burgenländisch-hianzischen Dialekt
heißt es immer noch „Za d(ie) Ostern,
za d`Pfingsten, za d´Weihnochtn“. So
lassen sich die Mehrzahlwörter auch
gut mit dem nachgestellten Ausdruck
„Feiertag(en)“ kombinieren, etwa „Za
d´Oster-Feiertag“.
Ostern als das älteste christliche
Fest zur Feier der Auferstehung Christi
hat allerdings wahrscheinlich heidnischen
(Namens-)Ursprung. Nach
Jacob Grimm ist die germanische
Göttin des Frühlings “Austro/Ost(a)
ra“, altindisch „usra“ = Morgenröte,
althochdeutsch Mz. „Ost(a)run“, lateinisch
„aurora“ Pate gestanden. Leicht
erkennbar ist noch der sprachliche
Zusammenhang zur Himmelsrichtung
Osten, wo frühmorgens die Sonne
aufgeht. – Auch eine Ableitung von
den lichten, weißen Gewändern sowohl
der Täuflinge als auch der Priester
an diesem traditionellen Tauf-Tag
ist möglich: lateinisch „albas“ = weißes
Gewand, althochdeutsch „ost(a)run“,
altenglisch „eastron“ = easter. Das
kirchenlateinische „pasca“, von dem
romanische Sprachen ihr Wort für
Ostern beziehen, leitet sich vom hebräischen
Pascha-Fest her, kann aber
auch mit „pascua“ = lateinisch „Weide“
zu tun haben. In Norddeutschland
war lange Zeit „Paschen“ die gängige
Bezeichnung für Ostern.
Die Karwoche wird in etlichen europäischen
Sprachen als „heilige Woche“
bezeichnet, zum Beispiel englisch
„Holy Week“, französisch „semaine
sainte“ oder italienisch „settimana
santa“.
Gründonnerstag ist einer der drei
Kartage während der Karwoche und
erinnert an das letzte Abendmahl
Christi. Da an diesem Tag besonders
gern das erste grüne Gemüse gegessen
wurde, wird – zumindest seit dem
14. Jh. – dieser Tag Gründonnerstag
genannt und ist auch heute noch
oft mit einer fleischlosen Mahlzeit,
wie Spinat mit Spiegelei, verbunden;
außerdem erfolgte um diese Zeit
meist die Frühlingsaussaat und ließ
die Felder wieder grünen. Daneben
gibt es noch drei weitere sprachliche
Deutungsversuche: Die traditionell
am Donnerstag vor Ostern wieder
in die Kirche aufgenommenen Büßer
wurden (nach Lukas 23,31) als
„grünes Holz“ bezeichnet. Die mittelalterliche
liturgische Farbe war in
vielen Gegenden „grün“. Oder das
„Greinen“, althochdeutsch „grinen“,
das Weinen mit Mundverziehen (ins
Lachende) der Büßer, wurde volksetymologisch
in den „Gründonnerstag“
umgedeutet.
Der Karfreitag, der Tag der Kreuzigung,
des Leidens und Sterbens Jesu
und der Freitag vor Ostern in der
Karwoche, leitet sich vom althochdeutschen
Wort „karen“ = wehklagen,
mittelhochdeutsch „kar“ für Trauer
und Klage, ab und ist noch gut aus
dem englischen „care“ für Sorge,
Kummer nachvollziehbar. Allgemein
wird der Karfreitag in vielen Regionen
als „stiller Tag“ betrachtet, an dem
keine Lustbarkeiten stattfinden. – In
der beginnenden Neuzeit erfolgte im
protestantischen Bereich eine gewisse
Umdeutung von lateinischem „carus“
= lieb, gut, teuer zum „guten Freitag“,
der uns den „Sieg über Hölle, Tod und
Grab“ gebracht hat. Im englischen
Sprachraum zeigt sich dies noch im
„Good Friday“.
Der Karfreitag gilt landläufig als
höchster Feiertag der Evangelischen,
doch ist auch für Protestanten genau
genommen Ostern, die Auferweckung
Christi, das höchste Fest, der Karfreitag
allerdings ein ganz besonderer
Feiertag.
Weihnachten als das Fest der
Geburt Christi wird erstmals in der
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts
als „zu (der) wihen naht“ = heilige
Nacht bezeichnet und ab dem 13.
Jahrhundert heißt es als Mehrzahlwort
„Weihnachten“. Im Gotischen
hieß das Wort „heilig“ weiho, mittelhochdeutsch
wich, was sich für diese
besondere Winternacht bis heute
gehalten hat. Auch im „Weihen“ von
Gegenständen oder Personen kommt
diese heilige Handlung sprachlich
noch zum Ausdruck. Das winterliche
Jul-Fest unserer Vorfahren zur Winter-
Sonnenwende, in Skandinavien noch
immer gefeiert, wurde also mit christlichem
Inhalt versehen.
Pfingsten, das Fest der Ausgießung
des Heiligen Geistes, ist zugleich der
Gründungstag der christlichen Kirche.
Das Wort stammt aus dem griechischen
„pentekosté“, dem fünfzigsten
Tag nach Ostern. In der gotischen
Wulfila-Bibel heißt es „pantekuste“
für den 50. Tag, an dem der Heilige
Geist im Kreise der Jünger zu wirken
begann. Interessant, dass über die
gotisch-arianische Mission Wörter wie
Pfingsten, Pfaffe, Samstag, Taufe oder
Teufel in die deutsche Sprache Eingang
gefunden haben. – Im Althochdeutschen
ist „(fona)fünfchustim“
im 9. Jh. nachgewiesen, mittelhochdeutsch
„phingesten“, und daraus
entstand unser Mehrzahlwort (die)
Pfingsten.
Die Namen unserer großen Feiertage
spiegeln also eine beachtliche kulturgeschichtliche
Vielfalt wider, was
auch zum Wesen Europas gehört. O