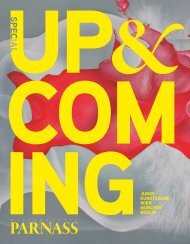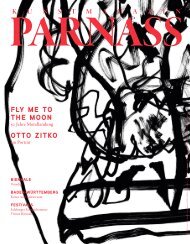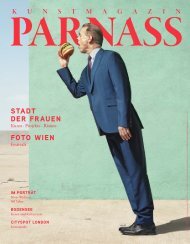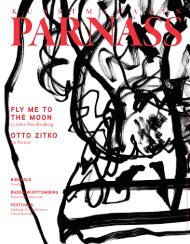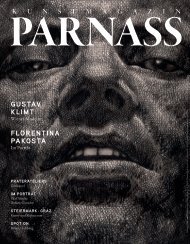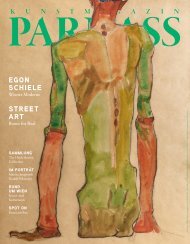PARNASS 03/2020 Leseprobe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kolumne
THOMAS TRENKLER | Foto: Rita Newman
KRIEGSGEHEUL
IM VERTEILUNGS-
KAMPF
Albertina-Direktor Klaus Albrecht
Schröder schlug vor, eine Zeit lang auf
das Theater zu verzichten. Er entfachte
damit einen Sturm der Entrüstung,
der ihn selbst überrascht haben dürfte.
THOMAS TRENKLER
ei manchen Kulturmanagern
liegen die
Nerven blank. Eigentlich
wollte ich
mit Klaus Albrecht
Schröder nur über die neue Dependance
reden. Aber dann hielt
der Albertina-Direktor beinahe einen
Monolog – über Corona und
die Auswirkungen. Er meinte, dass
uns die Krise „die nächsten zwei,
drei bis zu fünf Jahre beschäftigen“
werde: „Wir werden weit mehr
Arbeitslose haben, die Kaufkraft
wird nachlassen. Das wird nicht
nur den Automobilsektor und die
Luftfahrtindustrie treffen, das trifft
auch die Kulturindustrie, das trifft
selbstverständlich auch die Theater
und Museen.“
Diesem Befund wird man wohl
oder übel zustimmen müssen.
Doch die Schlüsse, die Schröder
im KURIER-Interview zog, brachten
viele in Rage. Man beklagte
unter anderem eine anhebende
Entsolidarisierung. Denn der
Albertina-Chef spielte, als sei er
bereits mitten im Verteilungskampf,
die bildende gegen die darstellende
Kunst aus. Wenn die
Zahl der Sitzplätze stark reduziert
werden müsse, steige der Subventionsbedarf
pro Karte – bei manchen
Opernproduktionen auf
mehrere hundert Euro. „Und da
stellt sich die Frage, ob man am
bisherigen Premierenreigen festhält
oder ob man nicht lieber zuwartet,
bis die Krise vorbei ist.“
Simpel gedacht: Die Theater
spielen nicht – und daher bleiben
mehr Mittel für die Museen
übrig. Die Zahlen legen diesen
Schluss sogar nahe: Die Albertina
erhielt 2018 als Basisabgeltung
7,75 Millionen Euro, die Staatsoper
71,4 Millionen. Die Albertina
hatte eine Million Besucher, die
Staatsoper 609.000. Folglich wurde
jeder Besuch der Albertina im
Durchschnitt mit 7,70 Euro gestützt
– und jeder der Staatsoper
mit 117,25 Euro.
Bei einer Triage also: Wen soll
die Kulturpolitik vor dem staatlichen
Sauerstoffzelt verrecken lassen?
Für Schröder scheint die Sache
klar. Und er führt noch einen
weiteren Grund ins Treffen: „Meiner
Meinung nach ist das basa-
le Grundrecht auf Gesundheit und
Unversehrtheit höher zu bewerten
als Kunst und Kultur. Das ist auch
der Grund, warum wir derzeit in
der Albertina keine Großveranstaltungen
– keine Eröffnungen mit
tausenden Besuchern, keine Konzerte
und keine Lesungen – anbieten.
Weil ich nicht will, dass die
Albertina ein Super-Spreader wird.“
Implizit unterstellte Schröder damit
den Theaterhäusern, eine
potenzielle Gefahrenquelle zu
sein. Bogdan Roščić, der neue
Staatsoperndirektor, ließ sich dies
nicht gefallen: Er konstatierte eine
Dreieckskombination aus „Hybris,
Ahnungslosigkeit und Perfidie“.
Schröder ruderte in der Folge zurück
und wies die Schuld von sich.
Herbert Föttinger, Direktor des
Josefstädter Theaters, gewann, wie
er zu Protokoll gab, nach einem
Telefonat mit dem Albertina-Chef
den Eindruck, dass „eine gewisse
Tendenz in den Fragen“ zu den
Aussagen geführt hätten. Es erstaunt
mich, wenn man glaubt, den
eloquentesten Redner unter den
Museumsdirektoren derart leicht
manipulieren zu können. Nein,
man kriegt einen Schröder nicht
dazu, Aussagen gegen seine Überzeugungen
zu tätigen. Und ja, es
ist nicht alles ganz falsch, was der
Albertina-Chef sagt.
Natürlich bringt es kurzfristig
nichts, Vorstellungen abzusagen,
weil die Verträge lange Laufzeiten
haben. Aber viele von uns werden
sich die Frage stellen, ob es in dieser
Situation sinnvoll ist, sich zum
Beispiel eine Repertoirevorstellung
anzuschauen. Zumal die Theater –
im Gegensatz zu den Salzburger
Festspielen – keinen Corona-Spielplan
erstellt haben: Sie wollen große
Stücke zeigen und auch Pausen
ansetzen.
Möge die Übung gelingen.
Denn so bedenklich die „Jedermann“-Premiere
war (aufgrund des
einsetzenden Regens stürmten alle
ins Große Festspielhaus), so grandios
war die „Elektra“. Man stellte
kurz fest, dass die Musiker derart
zusammengepfercht im Orchestergraben
sitzen, als gebe es keine Abstandsregeln.
Aber dann vergaß
man trotz Mund-Nasen-Schutz für
zwei Stunden alle Widrigkeiten.
PA R NASS 03/2020