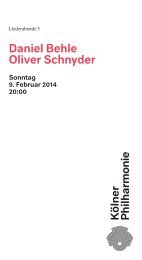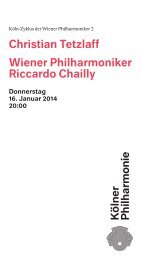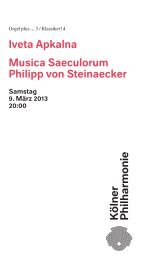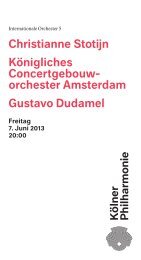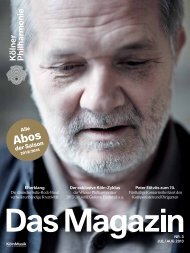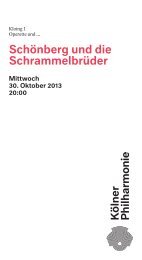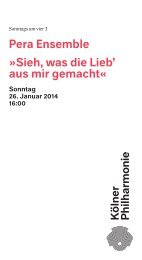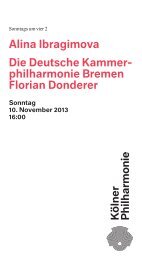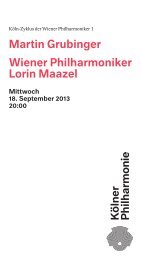24 - Kölner Philharmonie
24 - Kölner Philharmonie
24 - Kölner Philharmonie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Kölner</strong> Sonntagskonzerte 3<br />
Düsseldorfer Symphoniker<br />
Andrey Boreyko<br />
Sonntag<br />
15. Januar 2012<br />
18:00
Bitte beachten Sie:<br />
Ihr Husten stört Besucher und Künstler. Wir halten daher für Sie an den Garderoben<br />
Ricola-Kräuterbonbons bereit und händigen Ihnen Stoff taschen tücher des Hauses<br />
Franz Sauer aus.<br />
Sollten Sie elektronische Geräte, insbesondere Handys, bei sich haben: Bitte<br />
schalten Sie diese zur Vermeidung akustischer Störungen aus.<br />
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Bild- und Tonaufnahmen aus urheberrechtlichen<br />
Gründen nicht gestattet sind.<br />
Wenn Sie einmal zu spät zum Konzert kommen sollten, bitten wir Sie um Verständnis,<br />
dass wir Sie nicht sofort einlassen können. Wir bemühen uns, Ihnen so schnell wie<br />
möglich Zugang zum Konzertsaal zu gewähren. Ihre Plätze können Sie spätestens<br />
in der Pause einnehmen.<br />
Sollten Sie einmal das Konzert nicht bis zum Ende hören können, helfen wir Ihnen<br />
gern bei der Auswahl geeigneter Plätze, von denen Sie den Saal störungsfrei (auch<br />
für andere Konzertbesucher) und ohne Verzögerung verlassen können.
<strong>Kölner</strong> Sonntagskonzerte 3<br />
Düsseldorfer Symphoniker<br />
Andrey Boreyko Dirigent<br />
Sonntag<br />
15. Januar 2012<br />
18:00<br />
Pause gegen 18:40<br />
Ende gegen 19:45
PROGRAMM<br />
Dmitrij Schostakowitsch 1906 – 1975<br />
Gamlet (Hamlet) op. 116a (1963/64)<br />
Suite für Orchester aus der Filmmusik<br />
zusammengestellt von Levon Atovm’jan<br />
Einleitung<br />
Ball im Schloß<br />
Das Gespenst<br />
Im Garten<br />
Vergiftungsszene<br />
Auftritt der Schauspieler<br />
Ophelia<br />
Duell und Tod Hamlets<br />
Pause<br />
Richard Strauss 1864 – 1949<br />
Also sprach Zarathustra op. 30 TrV 176 (1896)<br />
Tondichtung für großes Orchester nach Friedrich Nietzsche<br />
Sehr breit – Von den Hinterweltlern: Weniger breit – Von der<br />
großen Sehnsucht: Bewegter – Von den Freuden- und Leidenschaften:<br />
Bewegt – Das Grablied: Etwas ruhiger, andachtsvoll –<br />
Von der Wissenschaft: Sehr langsam – Der Genesende:<br />
Energisch – Das Tanzlied – Nachtwandlerlied<br />
2
ZU DEN WERKEN DES HEUTIGEN KONZERTS<br />
Dmitrij Schostakowitsch:<br />
Gamlet (Hamlet) op. 116<br />
»Wir brauchen ein Stipendium«, sagte Alexander Glasunow zu<br />
Maxim Gorki, »obwohl unser Kandidat sehr jung ist.« »Wie alt ist<br />
er?«, fragte Gorki. »Fünfzehn. Sohn einer Musiklehrerein. Er spielt<br />
während der Vorstellungen im Kino ›Selekt‹. Neulich brannte unter<br />
ihm der Fußboden, und er spielte weiter, damit keine Panik aufkam«.<br />
Der Kinopianist, der 1921 die Stummfilme im Petersburger<br />
Selekt begleitete und von dem hier die Rede ist, war Dmitrij<br />
Schostakowitsch. Das Stipendium, um das Glasunow bei dem<br />
Kulturpolitiker Gorki warb, galt jedoch nicht dem Musiker, sondern<br />
dem Komponisten Schostakowitsch und dies obwohl Glasunow<br />
über die Werke des Teenagers sagen musste: »Sie sind<br />
abscheulich … aber das tut nichts zur Sache – die Zeit gehört diesem<br />
Jungen, und nicht mir.« Überliefert wurde dieses Gespräch<br />
durch den Schriftsteller Viktor Schklowski, der an anderer Stelle<br />
eindrücklich die Not der Petersburger Bevölkerung in dieser Zeit,<br />
den Bürgerkrieg, den Hunger und die Inflation schilderte. Der<br />
chronisch unterernährte Schostakowitsch erkrankte noch dazu<br />
an Tuberkulose und musste teure Heilbehandlungen auf der Krim<br />
in Anspruch nehmen. So war es auch nicht nur die Begeisterung<br />
für das junge Medium Film, die ihn an das Klavier des Kinosaals<br />
führte, sondern auch die Chance, sich sein Überleben zu sichern.<br />
Beides sollte sich zu Konstanten in der Biographie Schostakowitschs<br />
entwickeln.<br />
Kein anderer der großen Komponisten hat derart viel für den Film<br />
geschrieben – bei Schostakowitsch macht dies rund ein Drittel<br />
seines Œuvres aus, 34 seiner Filmpartituren nahm er in sein<br />
Werkverzeichnis auf. Und es gibt eine ungebrochene Kontinuität<br />
dieser Arbeit für den Film – auch und gerade in den Zeiten der<br />
öffentlichen Angriffe, Diffamierungen und Bedrohungen durch die<br />
stalinistische Kulturbürokratie wie in den Jahren 1936 und 1948.<br />
Die Partitur für die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Verfilmung<br />
des Hamlet durch Grigori Kosinzew aus dem Jahr 1964 zählt<br />
neben der Musik zu Das neue Babylon (1929) und Die Bremse (1955)<br />
gewiss zu den gewichtigsten Filmmusiken Schostakowitschs. Der<br />
3
Rezensent der New York Times lobte in seiner Besprechung des<br />
Hamlet an der Musik ihre »Erhabenheit und Tiefe und gelegentlich<br />
eine angemessene Wildheit und passende Leichtfertigkeit.« Von<br />
der Qualität seiner Hamlet-Musik, deren Einspielung in den Leningrader<br />
Filmstudios er selbst überwachte, war auch der Komponist<br />
überzeugt, und er plante zwischenzeitlich ihre Umarbeitung zu<br />
einer sinfonischen Dichtung. Besonders dieser Filmmusik traute<br />
er das Schwierigste zu: Bestehen zu können auch ohne den Film.<br />
Den Weg vom Kino- in den Konzertsaal fand zunächst eine von<br />
Levon Atovm’jan arrangierte achtteilige Suite, die jedoch rund<br />
die Hälfte der Partitur unterschlägt. Erst seit kurzem widmet man<br />
sich in Einspielungen und Aufführungen der Filmmusik in ihrer<br />
Gesamtheit – mit überraschenden Einsichten.<br />
Wo der Musik die alleinige Aufmerksamkeit gilt und die Stücke<br />
ohne Unterbrechung aneinandergereiht werden, wo auch diejenigen<br />
Passagen in den Vordergrund rücken, die im Film nur im Hintergrund<br />
von Dialogen zu hören sind, werden Zusammenhänge<br />
hörbar, die sich im Film allenfalls unterschwellig mitteilen. Von<br />
der Musikwissenschaftlerin Tatiana Egorova ist die These formuliert<br />
worden, die Filmmusik zu Hamlet folge in ihrem Aufbau der<br />
Sonatenhauptsatzform. Die Exposition stelle zwei Themen vor,<br />
das Hamlet-Thema und das Geist-Thema, die in der Durchführung<br />
verschiedene Wandlungen erfahren und mit anderem Material,<br />
etwa dem zu Ophelia, konfrontiert und verflochten werden, bis<br />
sie schließlich in der Reprise, dem Duell zwischen Hamlet und<br />
Laertes, in umgekehrter Reihenfolge wiederkehren. Selbst wenn<br />
man dieser Engführung nicht zustimmt, nehmen die vielfachen<br />
internen Bezüge der Partitur, die über die bloße Wiederkehr der<br />
filmmusiktypischen Leitmotive weit hinausreichen, den Hörer ein.<br />
Die Einleitung setzt mit markanten Akkorden ein und schafft<br />
sogleich die dunkel-bedrohliche Atmosphäre, die die gesamte<br />
Partitur beherrscht. Gewiss, Hamlet ist keine Komödie, doch auch<br />
hinter der ausgeprägt unwirtlichen und feindseligen Bildsprache<br />
Kozinsews bleibt Schostakowitsch nicht zurück: »Stein, Eisen,<br />
Feuer, Erde und das Meer« nannte der Regisseur als seine archaischen<br />
Gestaltungselemente. Schostakowitsch präsentiert dazu<br />
gleich zu Beginn das dann beständig wiederkehrende musikalische<br />
Material der Hamletfigur: des isolierten, melancholischen<br />
4
Helden, der den Mord an seinem Vater rächen soll und sich dabei<br />
in einem Netz aus Intrigen, Heuchelei und Mordplänen bewegen<br />
muss. Später wird für das grüblerische Wesen des Helden<br />
in den Monologen noch ein charakteristisches Klarinettenmotiv<br />
hinzukommen. Die höfische Welt wirkt falsch, der Ball im Schloß<br />
freudlos, der Tanz eckig, die Fanfaren zu schrill. Die Forderung<br />
nach Aufklärung und Rache, die im Film der Geist von Hamlets<br />
ermordetem Vater in voller Rüstung im peitschenden Wind und<br />
mit dem Rücken zum tosenden Meer formulierte, ist daher auch<br />
ohne solche Bilder unmissverständlich: ein wuchtiger Choral aus<br />
Blechbläsern und Schlagzeug. Doch bereits vor diesem fulminanten<br />
Auftritt war der Geist musikalisch präsent, als er sich in der<br />
Geschichte von Horatio und dem Geist in ein Gespräch zwischen<br />
Hamlet und Horatio schlich – ein Verfahren, das Schostakowitsch<br />
auch im weiteren Verlauf mehrfach einsetzen wird, um die Präsenz<br />
dieser Macht aus dem Zwischenreich von Leben und Tod deutlich<br />
zu machen. Die bisweilen ungewöhnliche Orchestrierung wie hier<br />
mit Harfe, Klavier und viel metallischem Schlagzeug verleiht der<br />
Partitur einen weiteren Reiz. So etwa auch wenn Schostakowitsch<br />
in der Vergiftungsszene, also dem für Hof, Witwe und Bruder aufgeführten<br />
Stück der Theatertruppe, in dem die Ermordung von<br />
Hamlets Vater zur Überführung der Täter nachgestellt wird, auf<br />
Pauken, große Trommel und Holzblock setzt und deren unerbittliche<br />
Schläge mit Streicherpizzicati und einer aggressiv pickenden<br />
Oboenphrase kombiniert.<br />
Daneben gibt es freilich auch lieblichere Szenen wie etwa Im Garten.<br />
Vor allem die Ophelia zugeordnete Musik wird von den zarten<br />
Klängen des Cembalos dominiert und speist sich aus tänzerischen<br />
und volksliedhaften Melodien. Umso leichter jedoch lässt<br />
sie sich überlagern und verdrängen, etwa in der Szene mit Hamlets<br />
Trennung von Ophelia, die ihren späteren Untergang in Wahnsinn<br />
und Selbstmord vorbereitet.<br />
Die Duellszene zwischen Laertes und Hamlet schließlich, in der<br />
beide Kämpfer sterben und sich Hamlets Mutter nebenbei versehentlich<br />
vergiftet, lässt die Militärmusik und die Fanfaren des<br />
Hofes auf die Themen von Hamlet und dem Geist treffen und folgt<br />
der Choreografie der Fechthiebe, die schließlich in die Ermordung<br />
des illegitimen Königs und Brudermörders mündet. Doch auch<br />
5
Hamlet stirbt durch eine vergiftete Klinge und wird vom neuen<br />
Herrscher Fortinbras ehrenvoll zu Grabe getragen.<br />
Schostakowitsch gelang mit der Filmmusik zu Kosinzews Hamlet<br />
eine Partitur, die mit großem Orchesteraufwand auch ohne die<br />
Bilder des Films die Shakespearsche Tragödie zu erzählen vermag<br />
und in ihren besten Momenten selbst von diesem Bezug noch<br />
ablösbar ist.<br />
Richard Strauss:<br />
Also sprach Zarathustra op. 30<br />
Fest verklammert mit einem Film sind auch die Eröffnungstakte<br />
von Richard Strauss’ Also sprach Zarathustra. Stanley Kubrick lieh<br />
sich 1968 die triumphalen Eröffnungsfanfaren für den Sonnenaufgang<br />
im Vorspann seines Films 2001: A Space Odyssey. Dafür kann<br />
Strauss freilich nichts. Er band seine Musik an das philosophische<br />
Kultbuch seiner Zeit: Friedrich Nietzsches Also sprach Zarthustra.<br />
Ursprünglich schwebte Strauss noch der Untertitel »Sinfonischer<br />
Optimismus in Fin de siècle-Form, dem 20. Jahrhundert gewidmet«<br />
vor, er entschied sich dann jedoch dafür, den Anfang von<br />
Nietzsches Buch über seine Partitur zu setzen. Dort verkündet<br />
Zarathustra der aufgehenden Sonne nach 10-jähriger Einsiedelei<br />
in den Bergen, nun wieder zu den Menschen hinabzusteigen.<br />
Für Eduard Hanslick, den Großkritiker des 19. Jahrhunderts, ging<br />
dies entschieden zu weit. Musik als vertonte Philosophie? Nietzsches<br />
Also sprach Zarathustra als Sinfonie? »Was soll uns, so fragen<br />
wir, diese Sensationsmacherei, welche das Interesse für ein<br />
reines Instrumentalwerk von einem der Musik ganz fremden, ja<br />
unmusikalischen Stoff herüber nötigt?« Und was für einem Stoff:<br />
»Die Tausende von Aphorismen, die Nietzsche in seinen vier<br />
Büchern ›Zarathustra‹ aneinanderreiht, enthalten geniale, glänzende<br />
Gedanken, aber ebenso viele abstruse, erkünstelte Einfälle<br />
und abstoßende Sophismen. Wer nach der Lektüre dieses Buches<br />
[…] ernstlich behaupten kann, Nietzsche sei damals noch vollkommen<br />
bei Verstand gewesen, dem ist nicht zu helfen.« So kann<br />
6
Hanslick in dem ganzen Strauss’schen Unternehmen nur einen<br />
Etikettenschwindel sehen.<br />
Den selbstbewussten Richard Strauss dürfte diese Kritik wenig<br />
berührt haben. Von seinem Rückgriff auf das hymnische Buch<br />
über den unmoralischen Übermenschen versprach er sich nicht<br />
nur Zustimmung, sondern antizipierte die Kritik schon im Januar<br />
1896 in einem Brief: »Jetzt nagle ich eine Orchesterdichtung: ›Also<br />
sprach Zarathustra‹ zusammen; wenn sie gelingt, so kenn’ ich<br />
viele, die sich darüber ärgern werden – dass sie’s so gar nicht<br />
verstehen!« Doch die Entstehungsgeschichte dieses Werkes reicht<br />
weiter zurück. Um eine Lungenentzündung auszukurieren, spendierte<br />
ein Onkel 1892/93 dem jungen Komponisten eine Reise nach<br />
Griechenland und Ägypten. Als Reiselektüre führte der Nietzsche<br />
mit sich und berichtet darüber später in seiner Autobiographie:<br />
»Als ich in Ägypten mit Nietzsches Werken bekannt geworden,<br />
dessen Polemik gegen die christliche Religion mir besonders aus<br />
dem Herzen gesprochen war, wurde meine seit meinem fünfzehnten<br />
Jahr mir unbewusste Antipathie gegen diese Religion,<br />
die den Gläubigen vor der eigenen Verantwortung für sein Tun<br />
und Lassen (durch die Beichte) befreit, bestärkt und begründet.«<br />
Im Sommerurlaub 1895 dann, mitten in den Dolomiten, arbeitete<br />
Strauss erste Ideen, die er sich im Jahr zuvor notiert hatte, zu einer<br />
Komposition über den »Zarathustra« aus, und schloss im Juli 1896<br />
die Klavierskizze ab. Es folgte die Instrumentierung, und am <strong>24</strong>.<br />
August 1896 war die Partitur fertig. Die Uraufführung folgte am<br />
27. November in Frankfurt.<br />
In das einsätzige Werk »frei nach Nietzsche«, wie es ausdrücklich<br />
heißt, fügte Strauss Zwischenüberschriften ein, die sich – mit<br />
Ausnahme des Nachtwandlerliedes – an den Kapiteln des Buches<br />
orientierten, wenn auch in anderer Reihenfolge. »Die Sonne geht<br />
auf. Das Individuum tritt in die Welt oder die Welt ins Individuum«,<br />
notierte Strauss zu den Eingangstakten. Für die beiden Pole wählte<br />
Strauss die Tonarten C und H und führte sie zu einer raffinierten<br />
Symbiose, auf die er am Ende der Komposition wieder zurückkommt,<br />
ohne jedoch die Spannung aufzuheben. »Der Mensch<br />
(H-Dur) fragte: Wann? – Wann? – und die Natur antwortete tief<br />
unten in ihrem C-Dur: Nie – nie – wird’s schönes Wetter!« schrieb<br />
Strauss dazu an Max von Schillings – ein Beleg dafür, wie wenig<br />
7
Nietzsches humorloses Pathos Sache des lebensfrohen Strauss<br />
war.<br />
Mit Nietzsche verbindet Strauss jedoch gewiss die Respektlosigkeit<br />
gegenüber dem Tradierten. Dafür spricht das Grundprinzip<br />
der übrigen Abschnitte seiner Komposition. Es besteht, vereinfacht<br />
gesagt, im Aufgreifen und ironischen Zerstören überlieferter<br />
Formen. In Von den Hinterweltlern ist der Blick in die Vergangenheit<br />
gerichtet, auf das gregorianische Credo und Magnificat, deren<br />
periodische Ordnung in Von der großen Sehnsucht erstmals angegriffen<br />
wird. Fortgeführt wird dies im Abschnitt Von der Wissenschaft<br />
in Gestalt einer spröden Fuge, und das Tanzlied gerät nach<br />
der Generalpause, die als Zarathustras Zusammenbruch gedeutet<br />
wurde, und dem Genesenden schließlich zur lebensbejahenden<br />
und befreienden Walzerparodie.<br />
Wie begeistert Strauss über sein Opus 30 war, ist einem Brief an<br />
seine Frau zu entnehmen: »Zarathustra ist herrlich – weitaus das<br />
Bedeutendste, Formvollendeste, Inhaltsreichste, Eigentümlichste<br />
meiner Stücke. Der Anfang ist herrlich, alle die vielen Streichquartettstellen<br />
sind mir famos geglückt; das Leidenschaftsthema<br />
ist hinreißend, die Fuge grauslich und das Tanzlied einfach entzückend<br />
… kurz und gut, ich bin doch ein ganzer Kerl und habe<br />
wieder mal ein bisschen Freude an mir.«<br />
Hanslick konnte diese Begeisterung nicht teilen, auch wenn er<br />
nicht umhin konnte, noch in der Ablehnung die Qualitäten und das<br />
Innovative des Stücks zu benennen: »Die Komposition, ungemein<br />
schwach und gequält als musikalische Erfindung, ist eigentlich nur<br />
ein raffiniertes Orchesterkunststück, ein klingender Farbenrausch.<br />
Als geistreiche Kombination neuer, origineller, aber auch abenteuerlicher<br />
und beleidigender Klangeffekte ist das Stück gewiss<br />
interessant und unterhaltend. Aber diese fabelhafte Orchestertechnik<br />
war nach meiner Empfindung dem Komponisten weniger<br />
ein Mittel als vielmehr Zweck und Hauptsache. Die instrumentale<br />
Armee, welche R. Strauss zu diesem philosophischen Feldzug<br />
aufgeboten hat, steht auf einem bisher ungeahnten Kriegsfuß.«<br />
Es war das Studium just dieser Partitur, das einen jungen, sensiblen<br />
Klaviervirtuosen 1902 in Budapest nach einer zweijährigen<br />
8
Pause wieder ermutigte zu komponieren, nachdem die ersten<br />
Schritte auf diesem Gebiet von seinem Kompositionslehrer scharf<br />
kritisiert worden waren: »das von dem meisten dortigen Musikern<br />
mit Entsetzen angehörte Werk«, berichtet er rückblickend in seiner<br />
Autobiographie, »erfüllte mich mit dem größten Enthusiasmus;<br />
endlich erblickte ich eine Richtung, die Neues barg. Ich stürzte<br />
mich auf das Studium der Strausschen Partituren und begann<br />
wieder zu komponieren.« Der Name dieses Pianisten war Béla<br />
Bartók.<br />
9<br />
Tilman Fischer
BIOGRAPHIEN<br />
Düsseldorfer Symphoniker<br />
Die Düsseldorfer Symphoniker sind das Hausorchester der Tonhalle<br />
Düsseldorf. Die Arbeit in der Tonhalle und in der Oper am<br />
Rhein gibt den Symphonikern ein ganz eigenes Profil. Mit regelmäßigen<br />
Konzertreisen – nach Holland, Österreich, Tschechien, in<br />
die Schweiz, nach Spanien, China und Japan – trägt das Orchester<br />
den Ruf Düsseldorfs als Kulturstadt in die Welt.<br />
Schon im 18. Jahrhundert arbeiteten international gefeierte Künstler<br />
mit der »Düsseldorfer Hofkapelle«, unter ihnen Georg Friedrich<br />
Händel und Arcangelo Corelli. Als der Hof aufgelöst wurde, gingen<br />
viele der Musiker nach Mannheim zu einem der berühmtesten<br />
Orchester seiner Zeit. 1818 entstand dann in Düsseldorf ein Verein,<br />
der bis heute Bestand hat und zur Wiege der Düsseldorfer<br />
Symphoniker wurde: Der Städtische Musikverein zu Düsseldorf<br />
ist einer der ältesten gemischten Konzertchöre der Welt, hat<br />
eine große ununterbrochene Tradition und kann auf eine beeindruckende<br />
Liste von Musikdirektoren zurückblicken, von denen<br />
10
Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann heute die<br />
berühmtesten sind. Schumann hatte in Düsseldorf die einzige<br />
Festanstellung seines Lebens. 1864 wurden die Symphoniker<br />
eigenständig und damit zweitältestes städtisches Orchester in<br />
Deutschland. Auch im frühen 20. Jahrhundert arbeiteten viele<br />
internationale Größen des Musiklebens – als Solisten Edwin<br />
Fischer, Elly Ney, Vladimir Horowitz, als Dirigenten Richard Strauss<br />
und Jascha Horenstein – mit den Symphonikern.<br />
Der Wiederaufbau des Orchesters, das während des Nationalsozialismus<br />
neben den Berliner Philharmonikern und dem Brucknerorchester<br />
Linz eines der Reichsorchester war, lag nach 1945<br />
in den Händen von Heinrich Hollreiser. Ihm folgten als Generalmusikdirektoren<br />
Eugen Szenkar, Jean Martinon, Rafael Frühbeck<br />
de Burgos, Henryk Czyz, Willem van Otterloo, Bernhard Klee,<br />
David Shallon, Salvador Mas Conde und John Fiore. Carlos Kleiber,<br />
Hans Wallat, Christian Thielemann und Fabio Luisi standen im<br />
Operngraben am Pult des Orchesters. Seit 2009 ist Andrey Boreyko<br />
GMD der Düsseldorfer Symphoniker. Den Titel »Schumann-Gast<br />
der Düsseldorfer Symphoniker« trägt der Schweizer Dirigent<br />
Mario Venzago. Im Schumannjahr 2010 wurde in Düsseldorf das<br />
Ganze Werk von Robert Schumann mit Künstlern wie Christoph<br />
Eschenbach, Thomas Zehetmair, Daniel Barenboim, Paavo Järvi,<br />
Riccardo Chailly, Thomas Hampson, Rudolf Buchbinder, Midori,<br />
Helene Grimaud und Frank Peter Zimmermann aufgeführt. Im<br />
Mittelpunkt: die Düsseldorfer Symphoniker. 2011 nahm sich das<br />
Orchester des vokalsinfonischen Schaffens von Gustav Mahler<br />
an. Aufführungen mit internationalen Größen wie Christiane<br />
Oelze, Thomas Quasthoff und Robert Dean Smith schlugen so den<br />
Bogen vom Klagenden Lied bis zum Lied von der Erde.<br />
Neben der Konzerttätigkeit hat die Musikvermittlung einen hohen<br />
Stellenwert bei den Düsseldorfer Symphonikern. In intensiver<br />
Zusammenarbeit mit Schulen werden fächerübergreifend Themen<br />
rund um Musik und Komponisten behandelt und Workshops<br />
für junge Musiker angeboten. Schultourneen des Orchesters und<br />
Schulbesuche einzelner Orchestermusiker gehören ebenso zum<br />
Alltag wie der Tonhallenbesuch von Schulklassen. Zum bundesweit<br />
beachteten Aushängeschild wurde die Konzertreihe<br />
»3 – 2 – 1 IGNITION«, die klassische Musik für Jugendliche als<br />
11
Freizeitvergnügen etablieren möchte. Für die aktive musikalische<br />
Nachwuchsarbeit engagieren sich die Orchestermusiker als Tutoren<br />
im eigenen Jugendsinfonieorchester (dem deutschlandweit<br />
einzigen in einem Konzerthaus) und arbeiten als Mentoren in der<br />
orchestereigenen Akademie.<br />
Die Diskographie der Düsseldorfer Symphoniker umfasst CD-Produktionen<br />
von Konzert- und Opernmitschnitten sowie Einspielungen<br />
mit dem Städtischen Musikverein zu Düsseldorf. Die Aufnahme<br />
mit Richard Strauss’ Tondichtung Also sprach Zarathustra<br />
(2004) wurde von der Presse überschwänglich besprochen. 2009<br />
hat der englische Geiger Matthew Trusler mit den Düsseldorfer<br />
Symphonikern, die Violinkonzerte von Erich Wolfgang Korngold<br />
und Miklos Rozsa aufgenommen. Unter GMD Andrey Boreyko<br />
erschien zuletzt die Aufnahme von Tschaikowsky Manfred. Immer<br />
wieder gibt es CD-Produktionen von Live-Mitschnitten aus der<br />
Tonhalle, wie Schumanns dritte Sinfonie mit Mario Venzago. Unter<br />
Venzago haben die Symphoniker gerade Bruckners fünfte Sinfonie<br />
eingespielt, die im Rahmen eines Bruckner-Sinfonien-Zyklus<br />
erscheinen wird. Auf DVD ist im August 2011 die Produktion von<br />
Schumanns Manfred mit der Live-Visualisierung von Johannes<br />
Deutsch als weltweit erste Filmversion erschienen.<br />
In der <strong>Kölner</strong> <strong>Philharmonie</strong> waren die Düsseldorfer Symphoniker<br />
zuletzt im September 2001 zu Gast.<br />
12
Die Besetzung<br />
der Düsseldorfer Symphoniker<br />
Violine I<br />
Franziska Früh<br />
Egor Grechishnikov<br />
Roland Faber<br />
Ekkehard Fucke<br />
Michael Schwab<br />
Danuta Knuth<br />
Sakuko Hayashi<br />
Elke Mehlin<br />
Karin Schott-Hafner<br />
Martin Schäfer<br />
Ildiko Antalffy<br />
Dr. Berta Metz-Kukuk<br />
Bernhard Schöps<br />
Futaba Sakaguchi<br />
Katrin Schüppenhauer<br />
Florin Iliescu<br />
Violine II<br />
Pascal Théry<br />
Nicola Borsche *<br />
Jutta Bunnenberg<br />
Katrin Beyer<br />
Margaret Sbarcea-Ferrett<br />
Benedikt Kramer-Rouette<br />
Robert Schumann<br />
Boguslaw Markwica<br />
Beate Kleinert<br />
Uta Ehnes<br />
Sven Hartung<br />
Ileana Leca<br />
Aleksandra Glinka<br />
Dana Ransburg (FA)<br />
Viola<br />
Ralf Buchkremer<br />
Gabriel Sorel Bala-Ciolanescu<br />
Yury Bondarev<br />
Kerstin Beavers<br />
Christian Atanasiu<br />
Ludmilla Matters<br />
Gudela Blaumer<br />
Klaus-Günter Hollmann<br />
Markus Münchmeyer<br />
Tomoyuki Togawa<br />
David Krotzinger<br />
Marlena Ulanicki<br />
13<br />
Violoncello<br />
Doo-Min Kim<br />
Laurentiu Sbarcea<br />
Jerome Tetard<br />
Gilad Kaplansky<br />
Jan Vymyslicky<br />
Martina Gerhard<br />
Stefan Ueberschaer<br />
Martin Holtzmann<br />
Lukasz Pawlik (FA)<br />
Hoang Nguyen (A)<br />
Kontrabass<br />
Wlodzimierz Gula<br />
Vlado Zatko<br />
Margaret Vaughn-Gößmann<br />
Klaus Theilacker<br />
Gottfried Engels<br />
Claus Körfer<br />
Joachim Breitling<br />
Markus Vornhusen<br />
Flöte<br />
Ruth Legelli<br />
Friedericke Krost-Lutzker<br />
Birgit Roth<br />
Verena Theilacker<br />
Oboe<br />
Taskin Oray<br />
Manfred Hoth<br />
Andreas Boege<br />
Ulrich Brokamp<br />
Klarinette<br />
Wolfgang Esch<br />
Adolf Münten<br />
Georg Stump<br />
Markus Strohmeier<br />
Fagott<br />
Veikko Breame<br />
Martin Kevenhörster<br />
Katharina Groll<br />
Simon van Holen
Horn<br />
Leo Halsdorf<br />
Theo Molberg<br />
Gernot Scheibe-Matsutani<br />
Ralf Warné<br />
Tim Lorenzen<br />
Balthasar Davids<br />
Trompete<br />
Alan Lee Kirkendall<br />
Frank Ludemann<br />
Tilmann Bollhöfer<br />
Josef Koczera<br />
Gabor Janosi (A)<br />
Posaune<br />
Martin Hofmeyer<br />
Jürgen Odenhoven<br />
Arno Pfeuffer<br />
Tuba<br />
Lothar Schumacher<br />
Hideyuki Takahashi *<br />
14<br />
Harfe<br />
Fabiana Trani<br />
Sophie Schwödiauer<br />
Pauke<br />
Thomas Steimer<br />
Schlagzeug<br />
Alfred R. Scholz<br />
Helmut Huy<br />
Dirk Neuner<br />
Egmont Kraus *<br />
Falko Oesterle *<br />
Klavier/Cembalo<br />
Kristi Becker *<br />
Orgel<br />
Udo Flaskamp<br />
(A) = Orchesterakademie<br />
(FA) = feste Aushilfe<br />
* = Gast
Andrey Boreyko<br />
Andrey Boreyko, seit der Saison<br />
2009/2010 Generalmusikdirektor der<br />
Düsseldorfer Symphoniker, wurde in<br />
St. Petersburg geboren und absolvierte<br />
seine musikalische Ausbildung am Konservatorium<br />
seiner Heimatstadt in den<br />
Fächern Dirigieren und Komposition bei<br />
Elisaveta Kudriavzewa und Alexander<br />
Dmitriev.<br />
Andrey Boreyko ist neben seiner Tätigkeit<br />
als Generalmusikdirektor der Düsseldorfer Symphoniker außerdem<br />
Erster Gastdirigent des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart<br />
des SWR sowie Principal Guest Conductor des Orquesta Sinfónica<br />
de Euskadi San Sebastian/Spanien. Zudem hat er mit dem<br />
Orchestre National de Belgique einen 5-Jahresvertrag unterzeichnet<br />
und tritt dort sein Amt als Chefdirigent im September 2012 an.<br />
Er war Chefdirigent des Berner Symphonieorchesters, des Poznan<br />
Philharmonic Orchestra, der Jenaer <strong>Philharmonie</strong>, der Hamburger<br />
Symphoniker und des Winnipeg Symphony Orchestra sowie<br />
Principal Guest Conductor der Vancouver Symphony Orchestra. Er<br />
ist Ehrendirigent der Jenaer <strong>Philharmonie</strong>, der während der fünfjährigen<br />
Tätigkeit von Andrey Boreyko als Chefdirigent vom Vorstand<br />
des Deutschen Musikverleger-Verbandes die Auszeichnung<br />
für die besten Konzertprogramme in drei aufeinanderfolgenden<br />
Spielzeiten zuerkannt wurde.<br />
Andrey Boreyko hat mit nahezu allen bedeutenden Orchestern<br />
der Welt musiziert. Er dirigierte mit großem Erfolg die führenden<br />
europäischen und amerikanischen Orchester, darunter die Berliner<br />
Philharmoniker, die Münchner Philharmoniker, die Sächsische<br />
Staatskapelle Dresden, das Russian National Orchestra, das<br />
Gewandhausorchester Leipzig, das Königliche Concertgebouworchester<br />
Amsterdam, das Rotterdams Philharmonisch Orkest, das<br />
Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Filharmonica della Scala,<br />
das Orchestre de la Suisse Romande, die Wiener Symphoniker,<br />
das Tonhalle-Orchester Zürich, das London Symphony Orchestra,<br />
15
das Philharmonia Orchestra, das BBC Symphony Orchestra, das<br />
Orchestre Philharmonique de Radio France, das New York Philharmonic,<br />
das Los Angeles Philharmonic sowie die Sinfonieorchester<br />
von Boston, Chicago, Cleveland und Philadelphia.<br />
Zahlreiche CDs sowie Fernseh- und Radioaufzeichnungen dokumentieren<br />
die künstlerische Vielseitigkeit Andrey Boreykos. Zu<br />
seinen CD-Aufnahmen zählen Lamentate von Arvo Pärt sowie die<br />
Sinfonie Nr. 6 von Valentin Silvestrov, eingespielt mit dem Radio-<br />
Sinfonieorchester Stuttgart des SWR. 2006 erschien außerdem<br />
als Live-Mitschnitt – wiederum mit dem Radio-Sinfonieorchester<br />
Stuttgart des SWR – eine CD mit der Sinfonie Nr. 4 sowie der<br />
Uraufführung der Originalfassung der Suite op. 29 a aus der Oper<br />
Lady Macbeth of Mtsensk von Schostakowitsch. Mit den Düsseldorfer<br />
Symphonikern hat Andrey Boreyko 2009 Tschaikowskys<br />
Sinfonie Manfred h-Moll op. 58 (1885) aufgenommen. In der <strong>Kölner</strong><br />
<strong>Philharmonie</strong> dirigierte Andrey Boreyko zuletzt im März vergangenen<br />
Jahres, damals die Junge Deutsche <strong>Philharmonie</strong>.<br />
16
Januar<br />
S A<br />
21<br />
20:00<br />
Vokalensemble <strong>Kölner</strong> Dom<br />
WDR Rundfunkorchester Köln<br />
Niklas Willén Dirigent<br />
A tribute to James Horner<br />
Musik aus den Filmen »Titanic«,<br />
»Rocketeer«, »Willow« u. a.<br />
KölnMusik gemeinsam mit dem<br />
Westdeutschen Rundfunk<br />
SO<br />
22<br />
11:00<br />
Karnevalistische Matinee zugunsten<br />
des <strong>Kölner</strong> Rosenmontagszuges<br />
KölnMusik gemeinsam mit dem<br />
Festkomitee <strong>Kölner</strong> Karneval<br />
DI<br />
<strong>24</strong><br />
20:00<br />
Emmanuel Pahud Flöte<br />
Kammerakademie Potsdam<br />
Trevor Pinnock Dirigent<br />
Friedrich dem Großen zum 300.<br />
Joseph Haydn<br />
Ouvertüre C-Dur zur Oper<br />
»L’anima del fi losofo« Hob. Ia:3<br />
Sinfonie G-Dur Hob. I:92<br />
»Oxford-Sinfonie«<br />
Johann Joachim Quantz<br />
Konzert für Flöte und Orchester G-Dur<br />
Carl Philipp Emanuel Bach<br />
Sinfonie D-Dur Wq 183, 1<br />
Konzert für Flöte, Streicher und<br />
Basso continuo A-Dur Wq 168<br />
Franz Benda<br />
Konzert für Flöte und Streicher e-Moll<br />
Baroque … Classique 4<br />
KÖLNMUSIK-VORSCHAU<br />
17<br />
SA<br />
28<br />
20:00<br />
Martina Janková Sopran<br />
Bernarda Fink Mezzosopran<br />
Michael Schade Tenor<br />
Thomas Quasthoff Bariton<br />
Justus Zeyen Klavier<br />
Camillo Radicke Klavier<br />
Robert Schumann<br />
Spanische Liebeslieder op. 138<br />
für fünf Singstimmen und Klavier zu vier<br />
Händen<br />
Johannes Brahms<br />
Liebeslieder. Walzer op. 52<br />
für Gesang und Klavier zu vier Händen<br />
u. a.<br />
Die Kunst des Liedes 4<br />
SO<br />
29<br />
16:00<br />
Kremerata Baltica<br />
Gidon Kremer Violine und Leitung<br />
The Art of Instrumentation –<br />
Hommage à Glenn Gould<br />
Werke von<br />
Johann Sebastian Bach,<br />
Ludwig van Beethoven u. a.<br />
in Bearbeitungen von Alexander<br />
Raskatow, Gidon Kremer u. a.<br />
Sonntags um vier 3
Februar<br />
MI<br />
01<br />
20:00<br />
Cappella Andrea Barca<br />
András Schiff Klavier und Leitung<br />
Wolfgang Amadeus Mozart<br />
Konzert für Klavier und Orchester<br />
Nr. 9 Es-Dur KV 271<br />
»Jeunehomme«<br />
Franz Schubert<br />
Sinfonie Nr. 2 B-Dur D 125<br />
Ludwig van Beethoven<br />
Konzert für Klavier und Orchester<br />
Nr. 5 Es-Dur op. 73<br />
Klassiker! 3<br />
D I<br />
07<br />
20:00<br />
Arditti Quartet<br />
Alban Berg<br />
Streichquartett op. 3<br />
Wolfgang Rihm<br />
Streichquartett Nr. 13<br />
Deutsche Erstaufführung<br />
James Dillon<br />
Streichquartett Nr. 6<br />
Iannis Xenakis<br />
Tetras<br />
Quartetto 4<br />
18<br />
IHR NÄCHSTES<br />
ABONNEMENT-KONZERT<br />
SO<br />
26<br />
Februar<br />
18:00<br />
Vilde Frang Violine<br />
MCO Academy NRW<br />
Mahler Chamber Orchestra<br />
Esa-Pekka Salonen Dirigent<br />
Jean Sibelius<br />
Pohjolas Tochter op. 49<br />
Sinfonische Fantasie<br />
Konzert für Violine und Orchester<br />
d-Moll op. 47 (1903 – 04)<br />
Olivier Messiaen<br />
Un Sourire (1989)<br />
für Orchester<br />
Esa-Pekka Salonen<br />
Foreign Bodies (2001)<br />
für großes Orchester<br />
Förderer der MCO Residenz NRW:<br />
KUNSTSTIFTUNG NRW • MINISTERIUM<br />
FÜR FAMILIE, KINDER, JUGEND,<br />
KULTUR UND SPORT DES LANDES<br />
NORDRHEIN-WESTFALEN<br />
<strong>Kölner</strong> Sonntagskonzerte 4
Maurice Ravel<br />
Konzert für Klavier<br />
und Orchester G-Dur<br />
Gustav Mahler<br />
Sinfonie Nr. 4 G-Dur<br />
Sonntag<br />
13. Mai 2012<br />
20:00<br />
Riccardo Chailly Dirigent<br />
Hélène Grimaud Klavier<br />
Gewandhausorchester Leipzig<br />
Luba Orgonášová Sopran<br />
»Die himmlischen Freuden«<br />
Erstmalig gastiert Hélène Grimaud gemeinsam mit dem Gewandhausorchester<br />
Leipzig in der <strong>Kölner</strong> <strong>Philharmonie</strong>. Dass nun Grimaud<br />
als Pianistin, die auch für ihren Eigensinn berühmt ist, das Ravel’sche<br />
Klavierkonzert spielt, passt besonders gut. So wurde die Uraufführung<br />
1932 auch von einer eigensinnigen Pianistin übernommen: Marguerite<br />
Long. Mit dieser Darbietung brachte sie ihre frauenfeindlichen Widersacher<br />
am Pariser Konservatorium endgültig zum Verstummen.<br />
Riccardo Chailly, seit 2005 Chefdirigent des Orchesters, dirigiert in der<br />
zweiten Hälfte Gustav Mahlers 4. Sinfonie. Das Werk, dem das Publikum<br />
bei seiner Uraufführung vor 80 Jahren nur wenig Respekt zollte,<br />
wurde nicht allein wegen seines letzten Satzes später zu einem der<br />
beliebtesten Mahlers.
<strong>Philharmonie</strong>-Hotline 0221.280 280<br />
koelner- philharmonie.de<br />
Informationen & Tickets zu allen Konzerten<br />
in der <strong>Kölner</strong> <strong>Philharmonie</strong>!<br />
Kulturpartner der <strong>Kölner</strong> <strong>Philharmonie</strong><br />
Herausgeber: KölnMusik GmbH<br />
Louwrens Langevoort<br />
Intendant der <strong>Kölner</strong> <strong>Philharmonie</strong><br />
und Geschäftsführer der<br />
KölnMusik GmbH<br />
Postfach 102163, 50461 Köln<br />
koelner- philharmonie.de<br />
Redaktion: Sebastian Loelgen<br />
Corporate Design: hauser lacour<br />
kommunikationsgestaltung GmbH<br />
Textnachweis: Der Text von Tilman Fischer<br />
ist ein Original beitrag für dieses Heft.<br />
Fotonachweise: Susanne Diesner S. 10<br />
und 15<br />
Gesamtherstellung:<br />
adHOC Printproduktion GmbH
New York<br />
Philharmonic<br />
koelner-philharmonie.de<br />
Roncalliplatz, 50667 Köln<br />
direkt neben dem <strong>Kölner</strong> Dom<br />
(im Gebäude des Römisch-<br />
Germanischen Museums)<br />
Alan<br />
Gilbert<br />
Dirigent<br />
Frank Peter<br />
Zimmermann<br />
Violine<br />
Neumarkt-Galerie<br />
50667 Köln<br />
(in der Mayerschen<br />
Buchhandlung)<br />
Ludwig van Beethoven<br />
Konzert für Violine und Orchester<br />
D-Dur op. 61<br />
Sergej Prokofjew<br />
Sinfonie Nr. 5 B-Dur op. 100<br />
Donnerstag<br />
02.02.2012<br />
20:00<br />
<strong>Philharmonie</strong>-Hotline<br />
onnie-Hotline<br />
0221-280 2280<br />
80