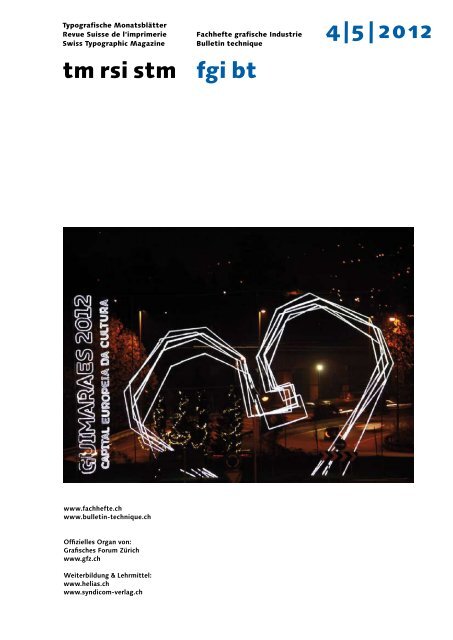4|5|2012 tm rsi stm fgi bt - Fachhefte grafische Industrie
4|5|2012 tm rsi stm fgi bt - Fachhefte grafische Industrie
4|5|2012 tm rsi stm fgi bt - Fachhefte grafische Industrie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Typo<strong>grafische</strong> Monatsblätter<br />
Revue Suisse de l’imprimerie<br />
Swiss Typographic Magazine<br />
<strong>Fachhefte</strong> <strong>grafische</strong> <strong>Industrie</strong><br />
Bulletin technique<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong><br />
www.fachhefte.ch<br />
www.bulletin-technique.ch<br />
Offizielles Organ von:<br />
Grafisches Forum Zürich<br />
www.gfz.ch<br />
Weiterbildung & Lehrmittel:<br />
www.helias.ch<br />
www.syndicom-verlag.ch<br />
<strong>4|5|2012</strong>
René Buri<br />
Redaktion<br />
Editorial<br />
Möchten Sie Abläufe automatisieren?<br />
Liebe Leserin,<br />
lieber Leser<br />
Die <strong>grafische</strong> Branche hat sich in den letzten<br />
Jahren sehr stark verändert: Der technische<br />
Fortschritt ist gewaltig. Die Zahl der Beschäftigten<br />
hat drastisch abgenommen.<br />
Dieser personelle Aderlass ist jedoch keineswegs<br />
abgeschlossen: immer schnellere<br />
und einfacher zu bedienende Druck- und<br />
Falzmaschinen brauchen immer weniger<br />
«persönliche» Betreuung. Damit einher geht<br />
immer auch eine Erhöhung der Kapazitäten.<br />
Wer dabei nicht mitzieht, steht auf verlorenem<br />
Posten, muss unter Umständen den<br />
Standort aufgeben oder sogar den Betrieb<br />
schliessen. Der Markt als Ganzes wächst<br />
aber kaum, die Maschinen sind nicht ausgelastet,<br />
also beginnt der Teufelskreis von<br />
vorn . . .<br />
Was ist zu tun? Aussteigen? Umsteigen?<br />
Aufsteigen auf den Zug mit den neuen Medien?<br />
So neu sind die nun auch wieder nicht<br />
mehr. Also lieber dranbleiben und nach<br />
neuen Wegen für die alten Medien suchen.<br />
So oder so. Ohne Leser, resp. Benutzer,<br />
gi<strong>bt</strong> es weder alte noch neue Medien. Wenn<br />
Sie also ein altes Medium suchen, das sich<br />
immer wieder neu erfindet, dann liegen Sie<br />
bei uns richtig. Ihr Abonnement bei <strong>tm</strong>/<strong>fgi</strong><br />
sichert ein Stück Zukunft.<br />
Wer schon Abonnent ist, sollte Freunde,<br />
Kollegen und Bekannte dazu animieren, sich<br />
auch ein Abo zu leisten. Für Mitglieder der<br />
syndicom gi<strong>bt</strong>s das zum halben Preis! Deshalb<br />
Ihre Bestellung am besten mit einem<br />
Mail an diese Adresse:<br />
yvonne.scheurer@syndicom.ch<br />
Oder per Post:<br />
syndicom – Gewerkschaft Medien und<br />
Kommunikation<br />
z.H. Yvonne Scheurer-Arnet<br />
Monbijoustrasse 33, Postfach 6336,<br />
3001 Bern<br />
Schon im Voraus herzlichen Dank<br />
Ihre Redaktion FGI<br />
Auf www.fachhefte.ch finden Sie praktische AppleScripts<br />
für QuarkXPress und InDesign (Mac OS 9.x und Mac OS X)<br />
sowie nützliche JavaScripts für InDesign CS2, CS3, CS4 und<br />
CS5 (Mac OS X und Windows).<br />
Chère lectrice,<br />
cher lecteur<br />
La branche des arts graphiques a subi de profonds<br />
changements ces dernières années: les<br />
progrès techniques sont énormes. Le nombre<br />
des employés a baissé de façon dramatique.<br />
Pourtant, cette hémorragie de personnel<br />
est loin d’être terminée: de plus en plus de<br />
presses et de plieuses mécaniques ont besoin<br />
de moins en moins d’entretien «personnel».<br />
Ce phénomène s’accompagne toujours d’une<br />
augmentation des capacités. Et celui qui<br />
n’arrive pas à suivre est perdu d’avance et<br />
doit, le cas échéant, abandonner son site de<br />
production, voire même fermer l’entreprise.<br />
Le marché, dans son ensemble, ne croît pratiquement<br />
pas, les machines ne tournent pas<br />
à plein temps, le cercle vicieux recommence<br />
. . .<br />
Que faire? Abandonner? Se recycler?<br />
Prendre le train en marche avec les nouveaux<br />
médias? Et ces derniers ne sont plus vraiment<br />
de première fraîcheur. Alors, mieux vaut<br />
s’accrocher et chercher de nouvelles ressources<br />
pour les médias dits «vieux».<br />
D’une manière ou d’une autre, sans<br />
lecteurs, respectivement sans utilisateurs, ni<br />
vieux, ni nouveaux médias. Donc, si vous<br />
êtes à la recherche d’un ancien média qui se<br />
réinvente toujours, alors vous êtes à la bonne<br />
adresse chez nous. Un abonnement de <strong>tm</strong>/<strong>fgi</strong><br />
assure un bout d’avenir.<br />
Celui qui est déjà abonné devrait encourager<br />
ses amis, ses collègues et ses relations à<br />
se payer aussi un abonnement. Les membres<br />
de syndicom l’ont à moitié prix! Le mieux est<br />
d’envoyer votre commande directement par<br />
mail à cette adresse:<br />
yvonne.scheurer@syndicom.ch<br />
ou par la poste:<br />
syndicom – Syndicat des médias et de la communication<br />
A l’att. de Yvonne Scheurer-Arnet<br />
Monbijoustrasse 33, case postale 6336,<br />
3001 Berne<br />
Nous vous en remercions par avance<br />
Votre rédaction BT<br />
Voudriez-vous automatiser des actions?<br />
Sur le site www.bulletin-technique.ch vous trouverez des<br />
AppleScripts pratiques, pour QuarkXPress et InDesign<br />
(Mac OS 9.x et Mac OS X), ainsi que des JavaScripts pour<br />
InDesign CS2, CS3, CS4 et CS5 (Mac OS X et Windows).<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 147
Drucktechnik<br />
Plattenproduktion in Perfektion: Licht ins Dunkel!<br />
Heidelberg News Team<br />
Im Grunde steckt auch in modernen Computer-to-Plate-Belichtern<br />
ein kleines Fotolabor:<br />
Zwar kann man hier auf die Entwicklung<br />
von Negativen (Filmen) verzichten,<br />
aber die Bilder (Platten) wollen noch immer<br />
korrekt belichtet sein – und dazu müssen<br />
z.B. Belichtungszeit und -energie stimmen.<br />
Auch Entwicklungschemikalien sowie weitere<br />
Prozessparameter erfordern regelmässige<br />
Kontrolle. Läuft hier etwas schief, macht<br />
sich später im Druck womöglich das sogenannte<br />
Banding bemerkbar: feine Linien<br />
bzw. Streifen in circa 1 bis 2,5 mm Abstand,<br />
die das Druckbild verunstalten.<br />
Bevor die Ursachenforschung an der<br />
Druckmaschine kostbare Zeit verschlingt,<br />
sollte man also einen Blick in die Druckvorstufe<br />
werfen, um beispielsweise die Einstellungen<br />
des Belichters zu prüfen. Denn<br />
obwohl moderne CtP-Geräte die Leistung<br />
des Lasers permanent überwachen und anpassen,<br />
führen falsche Settings fast zwangsläufig<br />
zu unerwünschten Effekten. Unabhängig<br />
vom Hersteller des Belichters kann<br />
es auch nicht schaden, die Lade- bzw. Entlademechanik<br />
des Geräts regelmässig auf<br />
Verschleisserscheinungen zu untersuchen.<br />
Und die Platten? Die sollten vorschriftsmässig<br />
gelagert werden, damit ihre Empfindlichkeit<br />
und so auch ihr Belichtungsverhalten<br />
berechenbar bleiben.<br />
In der Entwicklungsmaschine spielt natürlich<br />
auch die Chemie eine wichtige Rolle.<br />
Damit der Entwickler keine «Ermüdungserscheinungen»<br />
aufweist, müssen zum Beispiel<br />
Verbrauch und Verdunstung richtig<br />
ausgeglichen werden – und zwar ständig.<br />
Das funktioniert aber nur, wenn man die<br />
Nicht nur die Chemie muss stimmen: Optimale Druckergebnisse lassen sich nur dann<br />
erzielen, wenn auch die eigentliche Trägerin von Schrift- und Bildinformationen<br />
makellos ist: die Druckplatte. Ihre thermale Belichtung und Weiterverarbeitung ist<br />
zwar keine Hexerei, erfordert aber durchaus ein wenig «Laborantenwissen».<br />
Abb. 1: Ursachen für das sogenannte Banding können z.B. falsche Einstellungen<br />
des Belichters oder ein Verschleiss von Lade- bzw. Entlademechanik sein.<br />
erforderliche Verbrauchs- und Oxidationsregenerierung<br />
auch im Tagesgeschäft im<br />
Auge behält. Ansonsten büsst der Entwickler<br />
schleichend an Wirksamkeit ein.<br />
Ähnliches kann passieren, wenn Wasser<br />
aus den Quetschwalzen zurückläuft. Damit<br />
eine Verdünnung der Entwicklungsflüssigkeit<br />
vermieden wird, sollten also auch die<br />
Einstellung der Walzen sowie die Position<br />
des Sprührohrs überprüft werden. Der Zustand<br />
des Entwicklers lässt sich entweder<br />
per pH-Wert-Messung (bei Entwicklern für<br />
Fotopolymerplatten) oder Leitwer<strong>tm</strong>essung<br />
(bei vielen Thermalplatten) beurteilen.<br />
Wenn die Chemie stimmt und sich im<br />
Druck dennoch eine gewisse Wolkigkeit bemerkbar<br />
macht, lohnt sich womöglich ein<br />
genauerer Blick auf den Plattentransport:<br />
Falls bei durchlaufender Platte der Entwickler<br />
in einer Welle zurückläuft, könnte das<br />
ein Hinweis darauf sein, dass Kettenspannung<br />
oder Walzen am Antrieb nachjustiert<br />
werden müssen. Nicht zuletzt besteht – wie<br />
in jedem konventionellen Fotolabor – auch<br />
die Möglichkeit, dass die Entwicklungsflüssigkeit<br />
schlicht zu warm oder zu kalt ist. Um<br />
herauszufinden, ob Heizung oder Kühlung<br />
defekt ist, benutzt man sicherheitshalber<br />
ein digitales bzw. ein Alkoholthermometer<br />
– weil konventionelle Quecksilberthermometer<br />
die Gefahr bergen, dass sie bei einem<br />
Bruch die ganze Maschine ruinieren. Die<br />
Idealtemperatur der Entwicklungsflüssigkeit<br />
kann man beim Lieferanten der Platten<br />
in Erfahrung bringen.<br />
Im Sinne eines reibungslos laufenden<br />
Druckbetriebs ist man also gut beraten,<br />
wenn man die Plattenproduktion in Schuss<br />
hält. Die Testformen, die in Belichtern aus<br />
dem Hause Heidelberg bereits systemtechnisch<br />
hinterlegt sind, können massgeblich<br />
dazu beitragen: Sie erleichtern die tägliche<br />
Kontrolle erheblich, zumal die Formen auch<br />
Rückschlüsse auf den Entwicklungsvorgang<br />
als solchen zulassen – mit anderen Worten:<br />
Dem Anwender stehen nützliche Hilfsmittel<br />
zur Verfügung, die für einen stabilen Prozess<br />
sorgen. Platten und Verarbeitungschemikalien<br />
aus der Saphira-Palette von Heidelberg<br />
tragen ihr Übriges dazu bei, dass das<br />
«Fotolabor» in der Druckvorstufe reibungslos<br />
funktioniert – ebenso wie massgeschneiderte<br />
Instandhaltungsprogramme, die man<br />
mit dem Systemservice von Heidelberg vereinbaren<br />
kann. Um Stillstandszeiten so weit<br />
wie eben möglich zu minimieren, können<br />
entsprechend ausgestattete Suprasetter sogar<br />
Infos über den eigenen Zustand oder<br />
den bald erforderlichen Austausch eines<br />
Serviceteils an einen Spezialisten von Heidelberg<br />
übermitteln. Das geht via Internet<br />
in Sekundenschnelle. Stimmt der moderne<br />
«Laborant» in der Prepress-A<strong>bt</strong>eilung der<br />
Datenübermittlung zu, schont er Geld, Zeit<br />
und Nerven – zum Wohle all seiner Kollegen!<br />
www.heidelberg-news.com<br />
www.ch.heidelberg.com<br />
Abb. 2: Unregelmässige Ergebnisse mit einem unruhigen Druckbild können auf<br />
einem fehlerhaften Plattentransport beruhen.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 148
Glosse<br />
Ferien im Krisengebiet<br />
Kurt Mürset, Basel<br />
Von Griechenland reden wir schon gar<br />
nicht mehr. Da haben wir doch erst neulich<br />
– so das kollektive nordeuropäische<br />
Bewusstsein – diese Griechen vom osmanischen<br />
Joch befreit, mit einem König ausgestattet,<br />
Lord Byron vorbeigeschickt, Lehranstalten<br />
«Gymnasion» genannt und ganze<br />
Generationen mit Griechischem geimpft,<br />
von Alpha bis Omega, respektive von Aristoteles<br />
bis Onassis. Und jetzt liegen die uns<br />
nicht nur auf der Tasche, sondern bringen<br />
uns noch an den Bettelstab. Na ja, wir sind<br />
hier in der Schweiz und also nicht wirklich<br />
in Europa, aber bedenklich den Kopf schütteln<br />
bei der täglichen Zeitungslektüre, das<br />
dürfen wir schon.<br />
Aber auch wenn wir die Griechen weglassen,<br />
blei<strong>bt</strong> immer noch das eine oder andere<br />
unserer Ferienländer übrig, wo es mit<br />
dem Wachstum hapert, wo die Wirtschaft<br />
wackelt und die Staatsanleihen mehr Zins<br />
bieten als amerikanische Junkbonds vor<br />
2008. Jeder bessere Wirtschaftsteil orakelt<br />
von Griechenland, über Portugal und<br />
Spanien nach Italien und prophezeit den<br />
ganzen Südstaaten schwärzeste Zukünfte.<br />
Also ich war da und ich kann Ihnen<br />
sagen: Die Sonne scheint wie immer. Es<br />
ist heiss. Über Mittag sind weiterhin nur<br />
Touristen unterwegs. Die Menschen sind<br />
freundlich. Der Euro ist immer noch allgemein<br />
anerkanntes Zahlungsmittel und wird<br />
gerne genommen. Und weil mein Spanisch<br />
dürftig ist, mein Portugiesisch quasi inexistent<br />
und mein Italienisch bescheiden, verstand<br />
ich meist nicht Krise, sondern einfach<br />
nur Bahnhof.<br />
Aber Spass beiseite. Was ich gesehen<br />
habe, waren viele EU-finanzierte Infrastruktur-Projekte.<br />
Von einigen habe ich in<br />
meinen Ferien durchaus auch profitiert.<br />
Von Umweltprojekten wie einem Dünenwanderweg,<br />
über moderne Eisenbahnen<br />
Banken beinahe bankrott, Volkswirtschaften im Eimer, Europa ein Schimpfwort, der<br />
Süden ein einziges Notstandsgebiet – wer will denn da noch an Ferien denken? Ich<br />
zum Beispiel. Hier mein Augenschein.<br />
bis hin zu Museen und Kulturzentren. Das<br />
war in Portugal und in Spanien.<br />
Dabei ist mir die Geschichte Italiens<br />
durch den Kopf gegangen. Seriöse Historiker<br />
zeigen auf, wie nach der politischen Einigung<br />
die Industrialisierung des Nordens<br />
auf Kosten des agrarischen Südens vonstatten<br />
ging. Heute gi<strong>bt</strong> es laute Schreier im<br />
Norden, die diesen Süden gerne los wären.<br />
Geschichte und irgendwelche grösseren Zusammenhänge<br />
hin oder her – die dort unten<br />
bleiben faul, korrupt und unfähig. Letzteres<br />
Denken hat sich nicht nur in norditalienischen<br />
Köpfen festgesetzt, es ist mittlerweile<br />
zum Exportgut geworden und wird heutzutage<br />
europaweit verbreitet.<br />
Bleiben wir aber beim ersten Gedankengang.<br />
Auch wenn dieser etwas mehr an<br />
geistiger Regsamkeit verlangt. Übertragen<br />
wir das italienische Beispiel mal einfach so<br />
theoretisch auf das ganze Europa. So gesehen<br />
wären der Dünenwanderweg in Praia<br />
de Ancora und das Museum in Guimaraes<br />
so etwas wie eine Rückerstattung. Ein Art<br />
Ausgleich für all die teuren Waren, die der<br />
Süden im Norden kauft, beziehungsweise<br />
all die billigen Produkte, die der Norden<br />
im Süden kauft. Oder aber wir nennen es<br />
eine Wiedergu<strong>tm</strong>achung. Denn das poli-<br />
tische Europa hat schliesslich während<br />
langer Jahrzehnte starr wie das Mäuslein<br />
vor der Schlange nach Osten geguckt. Das<br />
war praktisch, denn so musste man die<br />
rückständigen Diktatoren im Süden nicht<br />
ansehen.<br />
Sie können mir jetzt gerne vorwerfen,<br />
dass ich da viel zu blauäugig bin. Schliesslich<br />
ist allgemein bekannt, wie sehr die Südstaatler<br />
das Abzocken in Brüssel perfektioniert<br />
haben. Sie können mir gerne nachsagen, ich<br />
sei halt auch nur so ein Billig-Flieger, der die<br />
Bierpreise vergleicht und daraus den Schluss<br />
zieht, dass die Lebenshaltungskosten hier an<br />
der Sonne schon recht tief seien. Sie können<br />
auch gerne erzählen, ich sei ein halblinker<br />
Träumer, der immer noch nicht glauben<br />
wolle, dass alle Menschen mit den gleichen<br />
Chancen geboren werden. Und vielleicht<br />
haben Sie ja recht. Aber etwas um die Ecke<br />
denken, schadet nicht. Und manchmal ist<br />
auch ein Kurz-Schluss so falsch nicht.<br />
Eines meiner Ferienerlebnisse möchte<br />
ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich habe einen<br />
veritablen Bergarbeiterstreik erle<strong>bt</strong>. Bis<br />
dahin wusste ich nicht, dass es in Asturien<br />
und Kastilien überhaupt noch Bergwerke<br />
gi<strong>bt</strong>. Und dann habe ich eine Solidaritätskundgebung<br />
gesehen für die streikenden<br />
Arbeiter. Der Slogan hiess «Wir sind alle<br />
Bergarbeiter» – ein durchaus bedenkenswerter<br />
Satz. Aber auch auf die Gefahr hin<br />
jetzt überheblich zu tönen: es war wie aus<br />
einer vergangenen Zeit.<br />
Eine mögliche Zukunft habe ich kurz<br />
darauf erle<strong>bt</strong>. Auf dem Schiff, das mich von<br />
Barcelona nach Genua brachte. Die Fähre<br />
beginnt ihre Reise in Marokko. An Bord sind<br />
immer viele Marokkaner, die in Italien arbeiten.<br />
Unterwegs in eine bessere Zukunft.<br />
Also für diese Menschen liegt schon der<br />
Süden Italiens im hohen Norden!<br />
Fotos: Das Logo der Kulturhauptstadt 2012 –<br />
Guimarães ist zusammen mit Maribor in Slowenien<br />
Kulturhauptstadt Europas 2012<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 149
PrePress<br />
InDesign-Dokumente einfach übersetzen<br />
Christian Schmelcher, Bad Reichenhall (D)<br />
Rosetext steht rund um die Uhr online zur<br />
Verfügung. Dadurch wird eine reibungslose,<br />
weltweite Zusammenarbeit aller Beteiligten<br />
auch ohne DTP-Erfahrung zu jeder<br />
Zeit ermöglicht. Gerade für nationale und<br />
internationale Unternehmen bedeutet dies<br />
nicht nur einen absatzpolitischen Vorsprung,<br />
sondern ermöglicht ein schnelles<br />
Reagieren auf Marktveränderungen.<br />
Nach dem Hochladen eines finalen In-<br />
Design-Masterdokuments auf den Rosetext-<br />
Server stehen die Texte des Projektes zur<br />
Übersetzung bereit. Die Zielsprachen, in<br />
die übersetzt wird, können frei definiert<br />
werden.<br />
Durch das integrierte Workflowmanagement<br />
(Übersetzen, Texte Korrektur lesen,<br />
PDF erzeugen, Dokument freigeben) ist bis<br />
zur Auslieferung des PDFs sichergestellt,<br />
dass weder Texte ungeprüft in das InDesign-<br />
Dokument einfliessen, noch eine Datei ohne<br />
Prüfung das Unternehmen verlässt. Grundlage<br />
des Workflows ist dabei durchgängig<br />
das Vier-Augen-Prinzip. Das integrierte<br />
Translation-Memory-System erkennt bereits<br />
übersetzte Texte und fügt diese automatisch<br />
in das jeweilige Dokument ein. Dadurch<br />
bleiben Übersetzungen auch bei Änderungen<br />
am Layout erhalten. Der fehleranfällige<br />
Prozess, Texte per «copy and paste» in ein<br />
Dokument einzufügen, entfällt komplett.<br />
Rosetext setzt automatisch den richtigen<br />
Text an der richtigen Stelle ein und ermöglicht<br />
so ein schnelles Arbeiten – in allen<br />
Sprachen. Zusätzlich können Daten aus<br />
Excel-Tabellen in ID-Dokumente übernommen<br />
werden. Masseinheiten, Gewichte<br />
oder Währungen rechnet Rosetext bei Bedarf<br />
in andere Einheiten um.<br />
Alternativ zum Kauf der Software bietet<br />
die Rosetext den Übersetzungsworkflow<br />
auch als Dienstleistung an. Umfang der<br />
Dienstleistung sind dabei nicht nur die Anpassungen<br />
der InDesign-Dokumente, sondern<br />
auch das Anlegen aller Benutzer nach<br />
Kundenvorgabe bis hin zur fertigen PDF-<br />
Erstellung in fast allen Sprachen. Rosetext<br />
setzt neue Workflow-Standards. Einfaches<br />
Handling, übe<strong>rsi</strong>chtliche Darstellungen sowie<br />
die transparente Terminübe<strong>rsi</strong>cht aller<br />
Teilschritte ermöglichen die Erstellung von<br />
Fremdsprachendokumenten.<br />
Der kurze Text lässt doch einige Fragen<br />
offen, die zum Teil auf der Website beantwortet<br />
werden. Gerne gi<strong>bt</strong> auch Christian<br />
Schmelcher weitere Auskünfte – so auch auf<br />
unsere dringendsten Fragen: Die Überset-<br />
Sprachen sind der Schlüssel zu neuen Absatzmärkten und Distributionsstrukturen.<br />
Mit dem InDesign Add-On Rosetext können Dokumente einfach verwaltet, übersetzt<br />
und publiziert werden.<br />
zungen werden nicht automatisch von einem<br />
Programm generiert, sondern von echten<br />
lebenden ÜbersetzerInnen. Bei Fremdsprachen<br />
immer ein Problem – länger laufende<br />
Texte, was zum Teil einen Neuumbruch<br />
nötig machen kann. Auch dieses Problem ist<br />
gelöst, bedingt allerdings, dass das ID-Master-Dokument<br />
auch entsprechend sauber<br />
aufgebaut ist. Damit dies denn auch wirklich<br />
so «einfach» klappt wie beschrieben, ist<br />
die angebotene Schulung ein Muss. Für<br />
Fragen: christian.schmelcher@rosetext.de<br />
Rosetext wird von der Ebdac Software<br />
GmbH in Bad Reichenhall entwickelt und<br />
vertrieben. Seit 1998 stellt Ebdac professionelle<br />
Software her und verfügt über weitreichende<br />
Erfahrung in der Prozessautomatisierung.<br />
www.rosetext.de<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 151
Sehen lernen<br />
Out of Photoshop – endlich einmal lustvoll<br />
Ralf Turtschi, Adliswil<br />
Wiederholt stelle ich fest, dass sich Bildverarbeitungsprofis<br />
wie Eichhörnchen<br />
im weit ausladenden Photoshop-Geäst<br />
bewegen, wo allerdings ausser einem kurzen<br />
Rascheln nichts Auffälliges passiert. Da<br />
wird die Gradationskurve um weniges gelupft,<br />
das Histogramm um ein «Mü» gespreizt,<br />
der Schärfungsradius etwas erhöht.<br />
Doch, das Bild wird etwas besser, bis im<br />
Druck die ganze Pracht im regelrechten Sinn<br />
erdrückt wird. Viel Aufwand, wenig Ertrag.<br />
Wenn sich die Photoshöpler mehr um<br />
die visuellen Gesetzmässigkeiten kümmern<br />
würden, wäre es um ihre Verbissenheit besser<br />
bestellt.<br />
Das Gesetz der Ähnlichkeit besagt, dass<br />
wir keine übereinstimmende Ähnlichkeit<br />
mit der Originalszene benötigen, um ein<br />
Bild zu deuten. Im Gegenteil, sogar Teilbilder<br />
oder ein kleiner Ausschnitt genügen,<br />
dass wir daraus aufs Motiv schlies sen können.<br />
Es gi<strong>bt</strong> eine ganze Reihe von gut dokumentierten<br />
Gesetzen, nach denen wir alle<br />
sehen:<br />
– Gesetz der Prägnanz<br />
– Gesetz von Figur und Grund<br />
– Gesetz der Nähe<br />
– Gesetz der Kontinuität (Gesetz der<br />
fortgesetzt durchgehenden Linie)<br />
– Gesetz der Geschlossenheit<br />
– Gesetz der gemeinsamen Region<br />
– Gesetz der Verbundenheit<br />
– Gesetz der Einfachheit<br />
– Gesetz der Symmetrie<br />
Adobes Creative Suite ist von keinem professionellen Desktop wegzudenken. Im<br />
mächtigen Schatten von Photoshop wachsen unbemerkt sanfte Bildverarbeitungspflänzchen,<br />
die Kreative beim Dominator vermissen.<br />
Mit der App «Picturesque» kann man mit drei, vier Klicks solche Icons erstellen:<br />
Schatten, Rahmendicke, Farbe, Eckenradius, Perspektive usw. In Photoshop<br />
dauert das garantiert länger und braucht Know-how.<br />
Man müsste dieses Grundlagenwissen<br />
der Photoshop-Kompetenz voranstellen, es<br />
relativiert all die komplizierten Bildeingriffe,<br />
denen wir heute so voller Verve leid-<br />
und lustvoll frönen.<br />
Weg vom Leid, hin zur Lust führen die<br />
kleinen Nischenprodukte, die ich eingangs<br />
erwähnte. Es sind Apps, die für wenig Geld<br />
im App Store für MacOS oder Tablets heruntergeladen<br />
werden können. Man staunt,<br />
wie einfach und mit wie wenigen Schritten<br />
überraschende Ergebnisse entstehen. Das<br />
reprotechnische Bildwissen ist nicht gefragt,<br />
das wurde durch die Erschaffer dieser kleinen<br />
Wunderwerke unter die Oberfläche<br />
verbannt. Of<strong>tm</strong>als entsorgt ein Tutorial (ein<br />
Clip mit Beispielen, die man zum Üben<br />
brauchen kann) die letzten Zweifel an der<br />
Funktionstüchtigkeit.<br />
Apps – und dies ist das eigentliche Druckmittel<br />
für Adobe & Co. – sind intuitiv zu<br />
bedienen, weil für einen grossen Massenmarkt<br />
gedacht, für Anwender, die nicht Tausende<br />
von Franken in Funktionen zu investieren<br />
bereit sind, die man einmal im Leben<br />
braucht. Apps funktionieren und machen<br />
jede Menge Lust aufs Ausprobieren. Fernab<br />
von jeglichen Problemen des Druckes rollt<br />
da ein Bildverarbeitungs- Tsunami auf uns<br />
zu. Man höre: Viele Apps sind auf die Auflösung<br />
2048 2048 Pixel beschränkt, was<br />
dem neuen iPad entspricht. Sie sind nicht in<br />
erster Linie dafür gedacht, einer kleinen <strong>grafische</strong>n<br />
Branche zu dienen, sondern zielen<br />
Richtung E-Mail, Twitter und Facebook, das<br />
interne Album wird bestückt. Wer braucht<br />
dort mehr Auflösung? Den Sonderfall Druck<br />
kann man getrost vernachlässigen. Die Drucker<br />
sind sowieso die Einzigen, die sich an<br />
einem rückständigen Farbmodell, genannt<br />
CMYK (oder noch anachronistischer: Pantone),<br />
festklammern. Einfach blöd, dass<br />
man in der Branche aus ökonomischen<br />
Gründen immer noch mit vier statt mit<br />
sechs oder acht Farben druckt. Um dann<br />
wenigstens mit einigem Brimborium das<br />
Maximum aus dieser bescheidenen Beschränktheit<br />
herauszuholen. Ist es denn so<br />
undenkbar, dass eine entsprechende Software<br />
in den RIPs für eine Umrechnung<br />
von RGB in CMYK + Orange + Violett + Blau<br />
sorgt? Wir schlagen wir uns auf Stufe Anwender<br />
mit so archaischen Problemen wie<br />
Settings, Farbprofilen und PDF-Einstellungen<br />
herum. Ein PDF würde genügen, das<br />
Herunterrechnen müssten die Herren des<br />
Ausgabekanals besorgen.<br />
Die Apps und Tablets deuten in eine andere<br />
Richtung: mehr Bildkontrolle, mehr<br />
Intuition, mehr Interpretation. Schieberegler<br />
und das «über den Bildschirm wischen»<br />
sind die Nachfolger der Häkchen-Setzer, in<br />
einer Art internationaler Fingersprache.<br />
Nicht dass ich falsch verstanden werde:<br />
Die Reproduktionskompetenz ist immer<br />
noch gefragt und wichtig, sie erhält aber<br />
zunehmend Konkurrenz von Apps, die Spass<br />
machen. Erst sie zeigen, wie wenig inspirierend<br />
Photoshop im Grunde funktioniert.<br />
iPad-App «Snapseed»: Mit den Plus-Punkten kann ein Kreis mit Verlaufsmaske<br />
beliebig in das Bild gesetzt werden. Mit horizontalem Wischen werden<br />
Kon trast, Helligkeit, Sättigung, Ambiente und Schärfung punktuell bearbeitet.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 152
Die iPad-App «SketchMee» wandelt ein importiertes<br />
Bild in verschiedenen Stilen zeichnerisch um. Als<br />
Papierhintergrund diente hier ein Häuschenpapier.<br />
Sehen lernen Out of Photoshop – endlich einmal lustvoll<br />
Die App «Big Aperture» (für Mac OS) wartet mit allen möglichen<br />
Vintage-Effekten. Hier mit punktueller Schärfung über den Augen,<br />
einer Verblassung und mit dem Polaroid-Rahmen.<br />
Die iPad-App «LensFlare» enthält Dutzende von Linseneffekten, die man so nicht<br />
kennt. Die Lichteffekte kann man beliebig ins Bild setzen, skalieren, drehen und<br />
in der Intensität und Farbe aussteuern.<br />
Die App für Mac OS, die hier verwendet wurde, heisst «Flare». Damit lassen sich sehr viele Effekte anwenden,<br />
die bis ins Detail ausgesteuert werden können. Die Details allerdings liegen optional unter der Oberfläche und<br />
interessieren erst die Enthusiasten.<br />
Ein importiertes Bild kann in «SketchMe» (iPad) mit verschiedenen Malwerkzeugen<br />
und Farben übermalt werden. Deckkraft und Weichheit können eingestellt werden,<br />
so dass eine Kombination zwischen Airbrush und Foto entsteht.<br />
«AutoGrafitti» importiert Bilder und wandelt sie automatisch in eine Grafitti um.<br />
Es stehen acht verschiedene Mauerwerke und Farbgebungen mit einem Texteditor<br />
zur Verfügung. Solche Werke entstehen in 10 Sekunden.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 153
PrePress<br />
Exklusivvertrieb für Suprasetter 106 UV<br />
Jürg Marti, Illnau<br />
Zur Drupa 2012 präsentierte die Heidelberger<br />
Druckmaschinen AG (Heidelberg)<br />
ihr gemeinsam mit der Lüscher AG Maschinenbau<br />
(Lüscher) entwickeltes CtcP-System<br />
für UV-sensitive Druckplatten. Der neue Belichter<br />
vereint das bewährte konstruktive<br />
Konzept der Suprasetter-Technologie von<br />
Heidelberg mit einem in Zusammenarbeit<br />
mit Lüscher entstandenen UV-Belichterkopf.<br />
Der Suprasetter 106 UV wird vollumfänglich<br />
durch Heidelberg am Standort Wiesloch-<br />
Walldorf unter Einhaltung der geltenden<br />
Qualitätsvorgaben produziert und mit der<br />
bewährten Lüscher UV Dioden-Technologie<br />
komplettiert.<br />
Bestes Kosten-Qualitäts-Verhältnis<br />
Nach einem erfolgreich abgeschlossenen<br />
Feldtest bei der Kromer Print AG in Lenzburg<br />
wird das CtcP-System ab Herbst 2012<br />
lieferbar sein. Angesprochen sind Druckereibetriebe<br />
mit einem Plattenbedarf, der<br />
jährlich 10 000 Quadra<strong>tm</strong>eter übersteigt,<br />
oder jene, die mit UV-Druckfarben arbeiten<br />
wollen (z.B. Etikettendrucker).<br />
Mit einem Gesamtpaket von Heidelberg,<br />
das neben dem Suprasetter 106 UV dessen<br />
Einbindung in den Druckerei-Workflow<br />
Prinect und das Plattenmaterial aus dem<br />
Saphira-Portfolio umfasst, steht diesen<br />
Anwendern eine wirtschaftliche Lösung<br />
mit einem herausragenden Kosten-Qualitäts-Verhältnis<br />
zur Verfügung. Die UV-sensitive<br />
Saphira-Platte verspricht ein gutes<br />
Auflösungsvermögen, ein hohes Mass an<br />
Stabilität zwischen den einzelnen Chargen<br />
und eine hohe Auflagenbeständigkeit.<br />
Mit dem in Kooperation zwischen Heidelberg und Lüscher entwickelten Suprasetter<br />
106 UV steht dem Markt ein neues CtcP-System für die Arbeit mit UV-sensitiven<br />
Druckplatten zur Verfügung. Die Heidelberg Schweiz AG ist in der Schweiz exklusiv<br />
für Vertrieb und Service des Plattenbelichters verantwortlich.<br />
Bekannte Suprasetter-Flexibilität<br />
Der neue Suprasetter 106 UV ist in der<br />
Grundausstattung mit manueller Plattenbeschickung<br />
erhältlich. Optional kann er mit<br />
Automatic Cassette Loader ACL (automatisches<br />
Beladen mit einem Plattenformat) und<br />
mit Dual Cassette Loader DCL (automatisches<br />
Beladen mit zwei Plattenformaten)<br />
ausgestattet werden. Das Basismodell ist<br />
jederzeit auf die Ve<strong>rsi</strong>on ACL und DCL nachrüstbar.<br />
Dank Smart Plate Handling ist es<br />
möglich, einen mit ACL oder DCL ausgerüs-<br />
Die Funktion Plate on demand gestattet es dem<br />
Drucktechnologen, die Druckplattenbelichtung am<br />
Leitstand Prinect Press Center auszulösen.<br />
teten Belichter auch manuell mit dem<br />
Plattenmaterial zu beschicken. Demzufolge<br />
schliessen die vollautomatische und die<br />
manuelle Beladung einander nicht aus,<br />
sondern sind beim Suprasetter 106 UV<br />
zwei gleichwertige Optionen.<br />
In seiner vollen Ausbaustufe leistet der<br />
UV-CtcP-Belichter bei Auflösungen von<br />
2400 dpi und 2540 dpi maximal 25 Platten<br />
pro Stunde im Vollformat. Die verarbeitbaren<br />
Plattenformate reichen von 370 x 323<br />
mm bis 930 x 1050 mm, die Materialstärken<br />
von 0,15 bis 0,35 mm. Als Option sind im<br />
Suprasetter 106 UV bis zu vier interne Stanzpaare<br />
möglich.<br />
Einbindung in den Prinect-Workflow<br />
Mit ihrer modularen Architektur sichert<br />
Heidelberg die Integration des Suprasetter<br />
106 UV in den Druckerei-Workflow Prinect<br />
und in beliebige andere Workflow-Umgebungen.<br />
Der Prinect Prepress Manager und der<br />
Prinect Renderer ermöglichen die vollautomatische<br />
Aufbereitung von Druckaufträgen<br />
bis zur Ausgabe der fertigen Druckplatte.<br />
Eine Einbindung ist auch für jene Anwender<br />
möglich, die mit dem RIP-Workflow Prinect<br />
Meta Dimension arbeiten. Über den Prinect<br />
Shooter ist zudem die Anbindung an Workflow-Systeme<br />
von Drittanbietern gewährleistet.<br />
Mit der Funktion Plate on demand kann<br />
der Drucktechnologe bei Bedarf die Druckplattenausgabe<br />
am Leitstand Prinect Press<br />
Center der Speedmaster-Druckmaschinen<br />
auslösen.<br />
Der Suprasetter 106 UV unterstützt die<br />
verschiedenen Rasterverfahren, vom konventionellen<br />
AM-Raster über die FM-Rastertechnologie<br />
bis zum Prinect Hybrid-<br />
Screening von Heidelberg. Auch die Ausgabe<br />
von Druckformen unter Anwendung des<br />
Lentikular-Software-Pakets von Heidelberg<br />
mit den Modulen Prinect Screening Editor<br />
und Resolution Adjus<strong>tm</strong>ent ist mit dem<br />
Suprasetter 106 UV gesichert.<br />
Der Suprasetter 106 UV ist eine gemeinsame<br />
Entwicklung von Heidelberg und Lüscher.<br />
www.ch.heidelberg.com<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 154
Drupa 2012<br />
Silber für drupa report Nr. 3<br />
Monika Kissing, Düsseldorf (D)<br />
Der schon vielfach prämierte drupa report hat bereits zum zweiten Mal in Folge den<br />
«Best Of Corporate Publishing Award» in Silber als Sonderpreis in der Kategorie<br />
«Druck & Innovation» gewonnen.<br />
Der drupa report wird erneut als herausragendes Beispiel für<br />
Druckveredelung, Materialmix und Druckweiterverarbeitung<br />
geehrt. Der Preis des Forums Corporate Publishing wird<br />
alljährlich durch eine hochkarätige Expertenjury vergeben.<br />
Über 700 eingereichte Publikationen überzeugten die Jury mit<br />
neuen Ideen und Innovationspotenzial.<br />
«Der drupa report ist der beste Beweis, dass Print auch im<br />
digitalen Zeitalter immer noch voller Innovationskraft und<br />
Kreativität steckt», erklärt Manuel Mataré, Director der drupa<br />
bei der Messe Düsseldorf GmbH.<br />
So kamen im drupa report Nr. 3 sieben unterschiedliche<br />
Papiersorten zum Einsatz. Auch das Format wechselte auf den<br />
62 Seiten mehrfach: von DIN A4, über Ausklapper bis hin zum<br />
Altarfalz in der Mitte des Magazins. Dadurch kommt Papier in<br />
all seinen Facetten, seiner Haptik und seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten<br />
eindrucksvoll zur Wirkung.<br />
Hochwertige Veredelungen, wie Laserstanzungen auf der<br />
Titelseite, Heissfolienkaschierungen und Duftdruck, machen<br />
den drupa report zu einem besonders werthaltigen Stück Print.<br />
Für das Design des Qualitäts-Magazins zeichnet Holger Giffhorn/Giffhorn<br />
Design, Wuppertal verantwortlich.<br />
Bereits seit der ersten drupa 1951 berichtet der drupa report<br />
als Messezeitung über das Geschehen rund um die Weltlei<strong>tm</strong>esse<br />
– damals noch unter dem Namen «DRUPA-Presse». Seine<br />
über sechzigjährige Erfolgsgeschichte ist dabei eng mit den<br />
Entwicklungen und technischen Möglichkeiten der Druckindustrie<br />
verbunden – er ist immer State of the Art. Auch deshalb<br />
konnte er neben dem BCP Award in Silber 2011 und 2012 viele<br />
weitere Preise einstreichen.<br />
www.drupa.de / www.bcp-award.com<br />
Der jetzt ausgezeichnete drupa report Nr. 3 ist im Mai 2011 erschienen; mit dieser Ausgabe haben wir uns<br />
am diesjährigen BCP-Award beteiligt und die aktuelle Silbermedaille in Berlin gewonnen.<br />
Die Zählweise der drupa reporte startet nach jeder drupa wieder von vorne – sprich: der nächste drupa<br />
report erscheint im Herbst 2013, trägt die Nummer 1 und richtet sich bereits auf die drupa 2016 aus.<br />
Prägefoliendruck<br />
Hologramm-Prägedruck<br />
Etikettenprägedruck<br />
Blindprägedruck<br />
PRÄVAG AG Prägedruck + Veredelung AG<br />
Sägestrasse 73 • Postfach • CH-3098 Köniz-Bern<br />
Tel. +41 31 972 33 88 • Fax +41 31 972 12 14<br />
www.praevag.ch<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 155
Tablet Publishing mit InDesign und Adobe DPS<br />
Beat Kipfer, PubliCollege, Burgdorf<br />
Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sind<br />
mit ihren grösseren Titeln schon fast<br />
lückenlos auf dem App-Markt für digitale<br />
Magazine präsent. Viele von ihnen arbeiten<br />
mit Redaktionssystemen von Woodwing.<br />
Dieser Hersteller brachte sehr früh eine<br />
bahnbrechende Technologie zur Aufbereitung<br />
von InDesign-Dateien für das iPad auf<br />
den Markt. Es wurde dabei viel in Software<br />
und Knowhow investiert; diese Investitionen<br />
haben sich bisher in den meisten Fällen<br />
noch nicht amortisiert: Die meisten Titel<br />
machen mit Apps noch zu wenig Umsatz.<br />
Die Tendenz ist aber eindeutig: Die Print-<br />
Auflagen gehen sukzessive zurück, die Anzahl<br />
Downloads steigt von Monat zu Monat.<br />
Mit kleinen Projekten beginnen<br />
Wenn Sie weder ein Redaktionssystem betreiben<br />
noch grosse Zeitschriftentitel im<br />
Portefeuille haben, ist der Workflow mit der<br />
Adobe Digital Publishing Suite und InDesign<br />
ab Ve<strong>rsi</strong>on CS5.0 für Sie ideal. Sie brauchen<br />
nichts Weiteres anzuschaffen; die notwendigen<br />
Programmerweiterungen lassen sich<br />
kostenlos herunterladen und installieren.<br />
Kosten entstehen erst, wenn eine App<br />
erstellt und auf dem AppStore (resp. Android<br />
Market) veröffentlicht werden soll. Je<br />
nach Zielsetzung Ihres Projekts ist dies vielleicht<br />
gar nicht notwendig: Digitale Publikationen<br />
lassen sich für definierte Benutzergruppen<br />
kostenlos verteilen. Link zu den<br />
Details der Adobe Businessmodelle am<br />
Schluss dieses Artikels.<br />
Typische Einsteigerprojekte können sein:<br />
Firmen- oder Produktepräsentationen, Verkaufsdokumentationen,<br />
Anleitungen oder<br />
Lehrgänge. Die Erstellung einer solchen –<br />
nicht zu umfangreichen – Dokumentation<br />
gi<strong>bt</strong> Ihnen Gelegenheit, die Technik zu erlernen<br />
und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.<br />
Abgrenzung zu bestehenden Medien<br />
Was ist denn so Besonderes an digitalen Magazinen<br />
für Tablets? Oder, anders gefragt:<br />
Gi<strong>bt</strong> es Bedürfnisse, welche durch Print und<br />
Internet nicht abgedeckt sind? Haben Apple<br />
und seine Mitbewerber einfach technische<br />
Wunderwerke geschaffen, für die krampfhaft<br />
noch ein Markt gesucht wird?<br />
Wer einmal mit einem iPad gut gestaltete<br />
Publikationen oder eine schön gestaltete<br />
www.publicollege.ch<br />
Adobe Creative Suite 6<br />
Apple hat 2011 über 40 Millionen iPads verkauft, Tendenz steigend. Samsung und andere<br />
Hersteller ziehen mit Android-Tablets kräftig nach. Damit wird definitiv klar, dass<br />
hier ein neuer Markt entsteht. Wieder einmal wird vom Publishing-Kuchen ein Stück<br />
von Print nach Digital verschoben. Als Anwender/-in von InDesign mit Gestaltungskompetenz<br />
haben Sie jedoch ideale Voraussetzungen zur Erstellung digitaler Inhalte !<br />
Abb. 1: Das iPad ist das prädestinierte Medium für hochwertige Firmen- oder Produktepräsentationen.<br />
Produktepräsentation betrachtet hat, kann<br />
die Antwort rasch geben: Kein anderes<br />
Medium ist in der Lage, Bilder und Illustrationen<br />
in so hervorragender Qualität darzustellen.<br />
Schon der Bildschirm des iPad 2 ist<br />
sensationell gut, das Retina Display des<br />
iPad 3 ermöglicht fotorealistische Wiedergabe<br />
mit höchster Brillanz. Zusammen mit<br />
dem schnörkellosen, leichten Design dieser<br />
Geräte bietet sich eine ideale Plattform für<br />
mobile Präsentationen. Hochwertige Produkte<br />
kommen dabei bestens zur Geltung,<br />
wie in einem edlen Showroom.<br />
Besuchten Sie etwa den letzten Autosalon<br />
in Genf? Dort waren wahrscheinlich mehr<br />
iPads als Autos in den Messehallen vorhanden.<br />
Ähnlich ging es an der Uhren- und<br />
Schmuckmesse in Basel zu. Kein Fabrikant<br />
hatte alle Modelle auf dem Stand; was nicht<br />
live zu bewundern war, kam auf dem iPad –<br />
nett präsentiert – bestens zur Geltung. Sei es<br />
mit Fotos, Diashows, kurzen Filmen, Texten,<br />
Tabellen, Charts …<br />
Wie erwähnt, lassen sich solche Projekte<br />
mit InDesign und den DPS-PlugIns in hoher<br />
Qualität realisieren. Die grundlegenden<br />
Techniken dazu erlernen geü<strong>bt</strong>e InDesign-<br />
Anwender/-innen an einem Eintageskurs.<br />
Aufwand für erstes Projekt budgetieren,<br />
Layout und Overlays planen<br />
Welche Faktoren beeinflussen die Kosten für<br />
ein iPad-Projekt der genannten Art? Wir gehen<br />
dabei von einem Projekt aus, das nur auf<br />
einigen wenigen iPads gezeigt werden soll<br />
und deshalb ohne App-Erstellungskosten<br />
auskommt.<br />
Basis für die Offerte ist ein Drehbuch.<br />
Ähnlich wie für eine Website muss die Anzahl<br />
Seiten (horizontal und/oder vertikal)<br />
bekannt sein. Der Aufwand zum Layouten<br />
der Seiten ist mit demjenigen für Print-<br />
produkte vergleichbar.<br />
Was kommt dazu? In erster Linie die Beschaffung<br />
von hochwertigem Bildmaterial;<br />
ein iPad-Auftritt le<strong>bt</strong> von guten Bildern, also<br />
sollte in diesem Bereich nicht gespart werden.<br />
Oft ist dieses Material ja schon von<br />
Printprodukt her vorhanden – Datenmehrfachnutzung<br />
und RGB-Workflow sind dabei<br />
wichtige Argumente!<br />
Weiter können kurze Filme eine Präsentation<br />
bereichern. Movie-Dateien lassen<br />
sich wie Bilder in InDesign platzieren, dies<br />
ergi<strong>bt</strong> keinen Zusatzaufwand. Für die Erstellung,<br />
das Schneiden und Vertonen eines<br />
Kurzfilms ist ein grösserer Budgetposten<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 156
vonnöten – oft kommt noch der Übersetzungsaufwand<br />
dazu.<br />
Die Folio Overlays bieten noch einige weitere,<br />
sehr attraktive Interaktivitätsformen.<br />
Bestimmt müssen diese nicht von A–Z in einem<br />
iPad-Projekt enthalten sein, denn die<br />
Beschaffung all dieser Originaldaten beeinflusst<br />
ein Budget wesentlich. Für Produktpräsentationen<br />
sind Bildsequenzen sehr belie<strong>bt</strong>:<br />
das Bild kann beliebig im Raum gedreht<br />
und von allen Seiten betrachtet werden. Einige<br />
Fotostudios sind für die Aufnahme solcher<br />
Sequenzen eingerichtet. Geht es um<br />
Liegenschaften, Wohnungen, Hotels usw.<br />
sind 360°-Panoramas sehr belie<strong>bt</strong>. Dabei handelt<br />
es sich um Bilder, die in jeder Richtung<br />
gedreht werden können. Zur Erstellung gi<strong>bt</strong><br />
es spezielle Software (z. B. Pano2VR), mit welcher<br />
6 Bilder aller vier Seiten plus oben und<br />
unten zusammengesetzt werden. Für professionelle<br />
Ansprüche lohnt es sich, auch dieses<br />
Bildmaterial beim Spezialisten einzukaufen.<br />
Mit weniger Aufwand verbunden sind die<br />
Funktionen «Schaltflächen» (Buttons mit<br />
Links zu anderen Artikeln usw.), «Webinhalt»<br />
(Verknüpfung mit einer HTML-Website online<br />
oder offline), «Schwenken und Zoomen»<br />
(Bildausschnitt kann verschoben werden),<br />
«Durchlaufbarer Rahmen» zum Scrollen von<br />
Textartikeln mit oder ohne Bildmaterial. Solche<br />
Elemente können leicht selber erstellt<br />
und eingebaut werden.<br />
Die Kosten für ein iPad-Projekt variieren<br />
demnach zwischen wenigen Hundert und<br />
einigen Tausend Franken. Sie hängen zum<br />
grössten Teil davon ab, ob Bildmaterial, Videos,<br />
Panoramabilder usw. erwünscht und<br />
bereits vorhanden sind, oder ob dieses<br />
Material eingekauft werden muss. Der Aufwand<br />
für das «Zusammenbauen» im Layout<br />
ist dagegen gut überblickbar. Mit etwas<br />
Routine ist ein einfaches Projekt in wenigen<br />
Stunden realisiert.<br />
Layout mediengerecht gestalten<br />
Der iPad-Bildschirm hat eine Auflösung von<br />
1024 ×768 Pixel; beim iPad 3 je das Doppelte,<br />
also 2048 ×1536 Pixel. Bei beiden beträgt<br />
die Bildschirmdiagonale 24,6 cm (9,7<br />
Zoll). Sie können bei der Gestaltung davon<br />
ausgehen, dass bei dieser Auflösung auch<br />
Serifenschriften gut zur Geltung kommen.<br />
Aufgrund des trotz allem relativ kleinen<br />
Bildschirms wäre es gar nicht sinnvoll, bestehende<br />
Drucksachenlayouts 1:1 auf das<br />
iPad zu übernehmen. Eine mehrspaltige<br />
A4-Seite auf dem Tablet zu lesen, wäre alles<br />
andere als komfortabel.<br />
Es führt also kein Weg daran vorbei, dass<br />
neue Layouts speziell für die Tablet-Ve<strong>rsi</strong>on<br />
Ihrer Publikation erstellt werden müssen. Oft<br />
will man neben der iPad-Ve<strong>rsi</strong>on zugleich<br />
eine solche für Android-Geräte (z. B. Samsung)<br />
mit 1280 × 800 Pixel-Monitor erstellen. Dazu<br />
ist die neue Funktion von InDesign CS6 «Liquid<br />
Layout» zusammen mit der Möglichkeit,<br />
Inhalte zu verknüpfen, sehr hilfreich.<br />
Adobe Creative Suite 6 Tablet Publishing mit InDesign und Adobe DPS<br />
Die Layouts lassen sich relativ einfach parallel<br />
an die leicht unterschiedlichen Proportionen<br />
der beiden Geräte anpassen. Überlegen<br />
Sie sich auch gut, ob Sie wirklich die gleichen<br />
Inhalte jeweils hoch und quer layouten<br />
möchten, oder ob Sie sich auf eine Ausrichtung<br />
beschränken.<br />
Arbeitsablauf<br />
Layout erstellen: Sind Bilder, Texte und die<br />
erwünschten Overlay-Elemente vorhanden,<br />
wird in InDesign das Layout erstellt. In-<br />
Design CS6 kann das horizontale und das<br />
vertikale Layout parallel im gleichen Dokument<br />
erstellt werden. Umfangreichere Dokumente<br />
werden sinnvollerweise in mehrere<br />
Dokumente (=Artikel) aufgeteilt.<br />
Overlays einbauen und testen: Diashows,<br />
Panoramabilder, Videos etc. mit Hilfe der<br />
Funktionen im Fenster «Folio Overlays» im<br />
Layout platzieren und Optionen definieren.<br />
Mit der Funktion «Vorschau» öffnet sich der<br />
Adobe Content Viewer auf dem Desktop;<br />
damit können alle Funktionen in einer Simulation<br />
des iPads überprüft werden.<br />
Dokumente verpacken: Die altbekannte Funktion<br />
«Verpacken» sammelt jetzt nicht nur die<br />
verwendeten Bilder, Grafiken und Fonts, sondern<br />
auch die Overlay-Objekte. Sind die Layouts<br />
fertig erstellt, wird jeder Artikel verpackt,<br />
der Verpackungsordner logisch benannt und<br />
in einem Projektordner gesammelt.<br />
Lokales Folio erstellen: Mit dem Folio Builder<br />
wird ein neues, lokales Folio erstellt.<br />
Diesem Folio werden nun die erstellten Artikel<br />
hinzugefügt. Diese werden beim Laden<br />
auf Fehler geprüft. Danach steht wiederum<br />
die Desktop-Vorschau zur Verfügung, mit<br />
welcher das Zusammenspiel der Funktionen<br />
der gesamten Publikation geprüft wird.<br />
Folio hochladen: Aus dem Folio Builder meldet<br />
man sich mit der persönlichen Adobe-ID<br />
an und kann die Dateien anschliessend auf<br />
den Adobe-Server hochladen. Mit dem Folio<br />
Producer können die Dateien noch weitgehend<br />
modifiziert und mit weiteren Informationen<br />
(Metadaten) versehen werden. Bei<br />
Bedarf kann das Folio für andere Benutzer<br />
(Adobe IDs) freigegeben werden.<br />
Folios auf dem iPad öffnen: Adobe Content<br />
Viewer aus dem AppStore aufs iPad herunterladen,<br />
unter der gleichen Adobe ID anmelden,<br />
unter welcher das Folio hochgeladen<br />
wurde (oder für welche es freigegeben<br />
wurde): Schon steht die Publikation zur Verwendung<br />
bereit.<br />
Damit ist der hier beschriebene Workflow<br />
beendet. Zur Veröffentlichung für ein breites<br />
Publikum kann nachfolgend eine App erstellt<br />
werden. Dazu muss die entsprechende Lizenz<br />
bei Adobe gekauft werden und die App mittels<br />
Viewer Builder online aufbereitet werden.<br />
Dazu stehen unterschiedliche Modelle<br />
zur Verfügung. Für einmalige Publikationen<br />
empfiehlt sich dazu die Single Edition. Mehr<br />
zu den Preismodellen: www.adobe.com/ch_de/<br />
products/digital-publishing-suite-family.h<strong>tm</strong>l.<br />
Abb. 2: Erstellen eines neuen lokalen Folios mit dem<br />
Folio Builder.<br />
Begriffe zum Adobe Digital Publishing<br />
AdobeDPS: Digital Publishing Suite, Programmerweiterungen<br />
für InDesign zur Erstellung von digitalen<br />
Publikationen für das Tablet Publishing.<br />
Adobe ID: Die individuelle Identifikation bei Adobe<br />
ist notwendig, um Folios hochzuladen. Publikationen<br />
können nur über den Adobe Server auf<br />
Tablets verfügbar gemacht werden. Die IDs sind<br />
gratis, es können beliebig viele davon erstellt<br />
werden (z. B. für mehrere Projekte).<br />
Folio: Dateityp für Tablet-Publikationen. Es enthält<br />
Elemente von PDF und von HTML 5. Grundlage<br />
ist eine Seite als Bi<strong>tm</strong>ap; auf einem zusätzlichen<br />
Layer befinden sich alle Overlays.<br />
Artikel: Teil einer Folio-Datei, vergleichbar mit<br />
den einzelnen Kapiteln (Dateien) für ein Buch.<br />
Artikel können eine oder mehrere horizontale<br />
und/oder vertikale Seiten enthalten.<br />
Folio Overlays: Bezeichnung für die interaktiven<br />
Elemente einer Publikation. Dies sind im Einzelnen<br />
Hyperlinks, Diashows, Bildsequenzen, Audio<br />
und Video, Panoramas, Webinhalte, Schwenken<br />
und Zoomen sowie durchlaufbare Rahmen.<br />
FolioBuilder: InDesign PlugIn zur Erstellung von<br />
Folios. Im Folio Builder werden Folio-Dateien<br />
angelegt und ihnen die Artikel hinzugefügt.<br />
Adobe Content Viewer: Tools zum Betrachten und<br />
Testen von Publikationen im Folio-Format. Steht<br />
als Desktop-Ve<strong>rsi</strong>on für den Computer und als<br />
Ve<strong>rsi</strong>on für iPad- resp. iPhone sowie für Android-<br />
Tablets zur Verfügung.<br />
Folio Producer: Online-Tool auf dem Adobe Server<br />
zum Editieren von hochgeladenen Folios.<br />
Viewer Builder: Online-Tool auf dem Adobe Server<br />
für die App-Konfiguration.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 157
QuarkXpress 9.3<br />
Per Xpress zum eBook<br />
Johannes Steil, Hamburg (D)<br />
Kern des XPress-ePub-Workflows ist eine<br />
neu eingeführte Reflow-Ansicht des Layouts.<br />
Sie ähnelt stark einem Texteditor und<br />
bietet eine grobe Vorschau des ePub-<br />
Layouts. Weiter gi<strong>bt</strong> es neue Paletten – Reflow-Tagging<br />
und Reflow-Inhaltsverzeichnis<br />
– und Menübefehle: im Objekt-Menü Digitales<br />
Publizieren, im Layout-Menü eBook<br />
Metadaten und eine Möglichkeit, Seiten zur<br />
Reflow-Ansicht hinzuzufügen. Zwischen<br />
der Reflow- und der Layout-Ansicht wechselt<br />
man entweder im Menü Ansicht oder<br />
mit dem Tastaturkürzel Befehl-9. Der Punkt<br />
Exportieren im Menü Ablage wurde um die<br />
nötigen Möglichkeiten ePub und Kindle ergänzt,<br />
das geht genauso über einen Button<br />
am unteren Fensterrand.<br />
Die Reflow-Ansicht können wir auf zwei<br />
Wegen erreichen, je nachdem, ob wir ein<br />
bestehendes Print-Layout in ein eBook umwandeln<br />
oder ein reines eBook erstellen<br />
wollen. In diesem Fall wählen wir beim<br />
Anlegen des neuen Projekts einfach den<br />
Punkt eBook (ePub, Kindle) aus, geben<br />
die gewünschte Grösse der Titelseite ein<br />
und erhalten zwei Layouts angezeigt: ein<br />
Print-Layout mit formatfüllendem Bildrahmen<br />
und daneben die Reflow-Ansicht<br />
des Projekts, bis auf den ersten Artikel mit<br />
der ersten Komponente leer. Starten wir von<br />
einem Print-Layout, wählen wir aus dem<br />
Menü Ansicht den Punkt Reflow-Tagging.<br />
Auch hier wird der Bildschirm geteilt, auch<br />
hier enthält die Reflow-Ansicht nur einen<br />
Artikel mit einer leeren Komponente. Aus<br />
dem Layout mit dem Bildrahmen wird<br />
beim Export das in Reader angezeigte<br />
Titelbild unseres eBooks – selbstverständlich<br />
kann man den Titel auch rein typografisch<br />
ohne ein Bild gestalten –, aus der<br />
Reflow-Ansicht kommt der Inhalt des<br />
eBooks.<br />
Reflow-Tags<br />
In der Reflow-Ansicht sehen wir in etwa, wie<br />
der eBook-Reader mit dem Text umgeht.<br />
Hier wird nicht visuell gestaltet, sondern es<br />
werden nur semantische Tags vergeben. Erstellen<br />
wir ein eBook aus einer Textdatei,<br />
müssen die Auszeichnungen, die im unteren<br />
Bereich des Reflow-Tagging-Fensters angezeigt<br />
werden, manuell zugewiesen werden,<br />
entweder in der Palette oder über das Kontex<strong>tm</strong>enü.<br />
Für Zeichenstile geht die Markierung<br />
nur über die Palette.<br />
Mit XPress 9 führte Quark auch die ePub-Erstellung ein, bis zur aktuellen Ve<strong>rsi</strong>on 9.3<br />
wurden die Möglichkeiten immer wieder ergänzt. Inzwischen stehen zwei Methoden<br />
der Erstellung einer ePub-Datei – aus Stehsatz und direkt als eBook-Projekt –<br />
zur Wahl und mehrere Ausgabemöglichkeiten: neben dem weit verbreiteten ePub 3<br />
das Amazon-eigene Format mobi sowie das in Europa seltene Blio-Format für den<br />
Blio-Reader, der schon früh interaktive eBooks möglich machte.<br />
Wandeln wir ein Print-Layout um und<br />
haben mit Stilvorlagen gearbeitet, haben<br />
wir es einfacher. Stilvorlagen werden in der<br />
Palette Reflow-Tagging den eBook-Tags zugeordnet,<br />
die Palette findet sich im Menü<br />
Objekt unter dem Punkt Digitales Publishing<br />
oder im Kontex<strong>tm</strong>enü. Es geht kaum<br />
übe<strong>rsi</strong>chtlicher: für jedes Absatzformat sieht<br />
man sofort, welches Reflow-Tag ihm zugeordnet<br />
ist, wir müssen uns nicht wie in anderen<br />
Lösungen durch alle Absatzformate<br />
durcharbeiten, und die Zuordnung ist völlig<br />
unabhängig von den Formaten, sie tritt erst<br />
bei Bedarf auf und belastet keine anderen<br />
Einstellungen und Menüs. Manche Elemente<br />
sollen nicht übernommen werden?<br />
Dann wählen wir den Punkt «Nicht extrahieren»,<br />
zum Beispiel für Seitenzahlen oder<br />
Kolumnentitel.<br />
Artikel und Komponenten<br />
Im eBook will man im allgemeinen keinen<br />
endlosen Textfluss, der alle Kapitel ohne Unterbrechung<br />
aneinanderreiht, sondern die<br />
einzelnen Kapitel sollen auf einer neuen<br />
Seite – auf einem neuen Bildschirm? – er-<br />
Abb. 1: Wollen wir im<br />
Einzellayou<strong>tm</strong>odus eine<br />
Reflow-Ansicht erstellen,<br />
erscheint eine Fehlermeldung.<br />
scheinen. Dafür gi<strong>bt</strong> es in XPress die Artikel:<br />
die sorgen beim Export genau dafür. Jeder<br />
Artikel enthält mindestens eine Komponente.<br />
So lange nur Text vorkommt, kann<br />
das genügen, aber Bild-, Video- oder Audio-<br />
Elemente benötigen jeweils eigene Komponenten.<br />
Neue Artikel und neue Komponenten<br />
erstellen wir mit den beiden Schaltflächen<br />
links oben im Reflow-Tagging-Fenster.<br />
Für die Umwandlung eines Print-Layouts<br />
wählen wir im Menü Layout die Funktion<br />
Seiten zur Reflow-Ansicht hinzufügen, die<br />
Palette bietet uns verschiedene Möglichkeiten<br />
für die Artikelerstellung. Mal wird die<br />
seitenweise die richtige sein, mal die integrierte<br />
mit einem einzigen Artikel. Zu beachten<br />
ist im ersten Fall, dass eine Textkette<br />
immer Teil der Seite ist, auf der sie beginnt,<br />
sie wird nicht in mehrere Artikel getrennt.<br />
Haben wir mithilfe des Linkster-Fensters die<br />
Textkette an den Kapitelanfängen unterbrochen,<br />
erhalten wir mehrere Artikel entsprechend<br />
der Kapitelstruktur. Wir können aber<br />
auch den Textfluss erst in der Reflow-Ansicht<br />
in mehrere Artikel auftrennen: Zum<br />
einen mit dem Cursor an die gewünschte<br />
Trennstelle gehen und im Kontex<strong>tm</strong>enü den<br />
Punkt Komponente auftrennen wählen, um<br />
anderen für jedes Kapitel einen neuen Artikel<br />
anzulegen, in den die neuen Komponenten<br />
mit der Maus verschoben werden.<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Jedes eBook braucht ein Inhaltsverzeichnis,<br />
seine Erstellung geht in QuarkXpress (fast)<br />
von alleine, wir müssen nur einstellen, welche<br />
Tags übernommen werden sollen. Dafür<br />
einmal auf den Stift links oben im Inhaltsverzeichnisfenster<br />
klicken, die gewünschten<br />
Tags (maximal fünf) auswählen und in die<br />
richtige Reihenfolge bringen. Oder wir las-<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 158
QuarkXpress 9.3 Per Xpress zum eBook<br />
Abb. 2: Für das neue Layout<br />
wählen wir den Layou<strong>tm</strong>odus<br />
eBook (ePub, Kindle), geben<br />
Grösse und Rand ein . . .<br />
Abb. 3: . . . und erhalten diese<br />
Ansicht: Die Einzelseite links<br />
wird beim Export zum<br />
Titelbild des eBooks, in die<br />
Reflow-Ansicht rechts kommt<br />
der Inhalt des eBooks.<br />
Abb. 4: Schon bei der<br />
Zuordnung der Tags zu<br />
Absatzstilen können Elemente<br />
von der Übernahme<br />
ausgeschlossen werden.<br />
Abb. 4: Schon bei der<br />
Zuordnung der Tags zu<br />
Absatzstilen können Elemente<br />
von der Übernahme<br />
ausgeschlossen werden.<br />
Abb. 5: Die Auswahlpalette für<br />
das Hinzufügen von Seiten zur<br />
Reflow-Ansicht, hier wird der<br />
gesamte Text ein einziger<br />
Artikel.<br />
sen es direkt aus der Artikelstruktur erstellen,<br />
jeder Artikel erhält dabei automatisch<br />
einen Inhaltsverzeichniseintrag.<br />
Bilder im eBook<br />
Für Bilder erstellen wir eine Bildkomponente<br />
und wählen das Bild aus, wobei sich<br />
das untere Feld der Reflow-Tagging-Palette<br />
ändert. Wir können die Bildgrösse über<br />
Breite, Höhe oder einen Prozentwert einstellen<br />
oder auf die Schaltfläche Beschneiden<br />
klicken. Es öffnet sich ein neues Dokument<br />
mit dem Bild, das wir auf die XPress-übliche<br />
Weise bearbeiten können – allerdings nur<br />
über die Masspalette, nicht über den Modifizieren-Dialog.<br />
Zum Abschluss der Bearbeitungen<br />
schliessen wir das Fenster einfach<br />
und bestätigen die Bearbeitungen.<br />
Audio und Video<br />
Nicht viel anders gehen wir mit Audio- oder<br />
Videokomponenten vor, der grösste Unterschied<br />
ist, dass wir zusätzlich ein «Standbild»<br />
einfügen können. XPress fügt einen Audio-<br />
bzw. Videoplatzhalter ein, der im fertigen<br />
eBook zu einem Standard-Controller wird.<br />
Wenn wir mit ctrl- oder rechter Maustaste<br />
darauf klicken, können wir aus dem Kontex<strong>tm</strong>enü<br />
den Befehl Importieren auswählen,<br />
ein Bild importieren und dafür wie gewohnt<br />
Ausschnitt, Grösse und Rahmeneinstellungen<br />
festlegen. Fertig.<br />
Raus aufs Internet<br />
Selbstverständlich lassen sich auch Hyperlinks<br />
in ein eBook integrieren: dafür markieren<br />
wir die entsprechende Textstelle, rufen<br />
das Kontex<strong>tm</strong>enü auf, wählen den Punkt<br />
Hyperlink, geben einen Namen und die<br />
URL an.<br />
eBook-Metadaten<br />
Im Menü Layout finden wir die Funktion<br />
eBook Metadaten, die unbedingt ausgefüllt<br />
werden muss: es sind die Daten, unter denen<br />
unser eBook in allen Verzeichnissen auftaucht.<br />
Wichtig ist hier vor allem, dass für<br />
jedes einzelne Ausgabeformat eine eigene<br />
ISBN angegeben wird, die übrigen Angaben<br />
sind identisch.<br />
Der Export<br />
Wenn wir alles fertig getaggt und mit interaktiven<br />
Elementen versehen haben, kommt<br />
der Export. Entweder über das Menü Ablage,<br />
Punkt Exportieren, oder über den kleinen<br />
grünen Pfeil in der Reflow-Fussleiste, als<br />
ePub oder als Kindle. Für den Kindle-Export<br />
muss man sich erst noch bei Amazon den<br />
KindleGen runterladen, kann dessen Installations-<br />
und Aktivierungsangaben aber einfach<br />
übergehen: es ist beim Kindle-Export<br />
lediglich der Speicherort des Programms anzugeben.<br />
Beim Export haben wir einige wenige Einstellmöglichkeiten:<br />
Für Bilder können wir<br />
die Auflösung, die Art JPEG oder PNG und<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 159
QuarkXpress 9.3 Per Xpress zum eBook<br />
Wer wir<strong>bt</strong>, gewinnt.<br />
Ganz einfach: Sie werben für uns einen neuen<br />
Abonnenten - und gewinnen dieses OSPAAAL-<br />
Buch im Wert von CHF. 100.45<br />
Abbi. 6: So teilen wir<br />
Komponenten in der<br />
Reflow-Ansicht: Cursor an<br />
die gewünschte Stelle<br />
setzen und per Kontex<strong>tm</strong>enü<br />
«Komponente<br />
auftrennen». Das Inhaltsverzeichnis<br />
ist automatisch mit<br />
der Tagzuordnung erstellt<br />
worden.<br />
Abb. 7: Die Standardeinstellung<br />
des Inhaltsverzeichnis.<br />
Wir können noch zwei Ebenen<br />
ergänzen, ihre Reihenfolge mit<br />
den kleinen Pfeilen anpassen<br />
– und sollten die «Titelzeilen»<br />
gegen die «Titel» austauschen,<br />
sonst steht der Buchtitel im<br />
Inhaltsverzeichnis.<br />
Abb, 8: Gleich sind wir fertig:<br />
Die Einstellungen für den<br />
Export sind praxisgerecht<br />
angelegt.<br />
So einfach funktionierts:<br />
Adresse neuer Abonnent – Adresse wo das Geschenk hin soll – an:<br />
yvonne.scheurer@syndicom.ch<br />
Oder per Post: syndicom – Gewerkschaft Medien und Kommunikation<br />
z.H. Yvonne Scheurer-Arnet Monbijoustrasse 33, Postfach 6336, 3001 Bern<br />
So viele Jobs.<br />
Da können Sie lange googeln.<br />
für Erstere auch die Qualität in fünf Stufen<br />
einstellen. Ausserdem lässt sich festlegen, ob<br />
die Bild-spezifischen Einstellungen überschrieben<br />
werden sollen. Für das Inhaltsverzeichnis<br />
können wir die Artikelstruktur oder<br />
das selbst zusammengestellte aus der Inhaltsverzeichnispalette<br />
wählen. Weiter können<br />
eigene Bezeichnungen für das Cover<br />
und das HTML-Inhaltsverzeichnis vergeben<br />
werden. (Ostasiatische Einstellmöglichkeiten<br />
übergehe ich hier.) Diese Export-Einstellungen<br />
können gespeichert werden, um sie<br />
bei Gelegenheit wieder zu verwenden.<br />
Wenn man die Anzeige-Einstellungen für<br />
sein eBook ändern möchte, kann man die<br />
CSS-Datei des eBooks bearbeiten. Beim Export<br />
greift XPress immer auf eine bestimmte<br />
CSS-Datei zurück, wir finden sie im Preferences-Ordner<br />
unter Digital Publishing/Templates/css<br />
und heisst style.css. Sie kann bearbeitet<br />
werden, muss aber diesen Namen<br />
behalten, weswegen man sich sinnvollerweise<br />
vor der Bearbeitung eine Kopie anlegt.<br />
Im Ordner Templates neben der CSS-Datei<br />
finden sich einige andere Style Sheets, die<br />
man auch verwenden kann, wenn man die<br />
«originale» CSS-Datei durch sie ersetzt. Eine<br />
andere Möglichkeit der CSS-Bearbeitung<br />
ist die nachträgliche mit einem eBook-Bearbeitungsprogramm<br />
wie Calibre, aber das<br />
ist eine andere Geschichte.<br />
(Der Autor dankt dem P. Kirchheim Verlag München<br />
für die Nutzung des Buches «Beckenbauer<br />
taucht nicht auf» von Armin Kratzert.)<br />
www.brotschrift.de<br />
Das Buch über das revolutionäre OSPAAAL-Plakat – ein Zeitspiegel<br />
der Befreiungskämpfe in Afrika, Asien und Lateinamerika.<br />
448 Seiten; 340 vierfarbige Plakatreproduktionen;<br />
alle Texte deutsch, spanisch, englisch und französisch.<br />
Der Online-Stellenmarkt für die Schweizer Kommunikationsbranche<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 160<br />
Pantone 646C
Fibre to the Home<br />
Glasfaser: Swisscom baut heute<br />
das Netz der Zukunft<br />
Giorgio Tebaldi, Zürich<br />
Laut verschiedenen internationalen Studien<br />
verfügt die Schweiz bereits heute<br />
über das beste Telekomnetz Europas. Damit<br />
das auch in Zukunft so blei<strong>bt</strong>, muss bereits<br />
heute mit dem Bau des schnellen Netzes von<br />
morgen begonnen werden. Erstens, weil<br />
sich die Datenmenge im Festnetz alle 16<br />
Monate verdoppelt. Zweitens, weil unsere<br />
Kunden auch weiterhin immer höhere Geschwindigkeiten<br />
nachfragen. Drittens, weil<br />
der Ausbau eines Glasfasernetzes viele Jahre<br />
in Anspruch nimmt. Wollen wir unsere<br />
weltweit hervorragende Stellung halten,<br />
müssen wir jetzt handeln. Das tun wir: Der<br />
Glasfaserausbau in der Schweiz schreitet<br />
zügig voran. Vor allem in den grossen Städten,<br />
aber auch im Oberwallis oder in einer<br />
kleinen Gemeinde wie Pfyn erschliessen<br />
Elektrizitätswerke, Swisscom und auch<br />
Kabelnetzbetreiber die Wohnungen und<br />
Geschäfte mit Glasfaser.<br />
Glasfaser: Von der Nachbarschaft<br />
bis ins Haus<br />
Der Glasfaserausbau bei Swisscom findet<br />
bereits seit 1978 statt: Damals wurde in<br />
Bern das erste Glasfaserkabel verlegt. Nach<br />
und nach wurden die Telefonzentralen untereinander<br />
mit Glasfaser verbunden. Dann<br />
wurde das schnelle Netz bis zu einem Verteiler<br />
in der direkten Nachbarschaft der<br />
Empfänger verlegt (Fibre to the Curb, FTTC).<br />
Die letzten Meter bis zum Kunden erfolgen<br />
über das bestehende Kupfernetz; dank diesem<br />
VDSL-Netz erhalten die Kunden hohe<br />
Bandbreiten und Swisscom TV. Bereits heute<br />
profitieren über 90 Prozent der Haushalte<br />
von Swisscom TV, mehr als 80 Prozent sogar<br />
vom hochauflösenden Fernsehen (HDTV).<br />
Im Herbst 2008 begann Swisscom mit<br />
der letzten Etappe im Glasfaserausbau: Glasfasern<br />
werden bis in Wohnungen der Kunden<br />
verlegt (Fibre to the Home, FTTH). Dadurch<br />
werden auch für Privatkunden in<br />
Zukunft ultraschnelle Datengeschwindigkeiten<br />
und neue Telekommunikations- und<br />
Unterhaltungsdienste möglich sein. Dank<br />
einem koordinierten Vorgehen von Swisscom,<br />
den Elektrizitätswerken sowie auch<br />
von Kabelnetzbetreibern erfolgt in der<br />
Der Glasfaserausbau in der Schweiz schreitet zügig voran. Vor allem in den grossen<br />
Schweizer Städten verlegen Elektrizitätswerke, Swisscom und Kabelnetzbetreiber<br />
Glasfaser bis in die Wohnungen und Geschäfte der Kunden (Fibre to the Home, FTTH).<br />
Bis Ende Juni 2012 wurden in der Schweiz bereits rund 420 000 Wohnungen und<br />
Geschäfte mit Glasfaser erschlossen. Bis Ende 2015 sollen es rund eine Million sein<br />
– dies entspricht einem Drittel der Schweizer Bevölkerung. Doch auch ausserhalb der<br />
Ballungszentren wird die Glasfaser immer näher an die Häuser gebaut, was ultraschnelles<br />
Internet und multimediale Unterhaltungsdienste in fast der ganzen Schweiz<br />
ermöglicht.<br />
Schweiz ein rascher Ausbau des Glasfasernetzes,<br />
während in anderen europäischen<br />
Ländern noch um einen Ausbau gestritten<br />
wird.<br />
Gemeinsames Vorgehen beim<br />
Glasfaserausbau<br />
Um einerseits den Glasfaserausbau zu beschleunigen<br />
und andererseits auch die<br />
Kosten zu senken, gehen die investitionsbereiten<br />
Unternehmen beim Bau des neuen<br />
Netzes gemeinsam vor. So baut Swisscom<br />
wenn immer möglich zusammen mit Elektrizitätswerken<br />
und Kabelnetzbetreibern das<br />
Glasfasernetz. Durch das gemeinsame Vorgehen<br />
werden Doppelspurigkeiten beim<br />
Bau vermieden. Dies kommt nicht zuletzt<br />
den Anwohnern zugute, die von unnötigen<br />
Bauarbeiten verschont bleiben. In 15 Städten,<br />
Gemeinden und Regionen baut Swisscom<br />
im Rahmen einer solchen Kooperation.<br />
Um den Glasfaserausbau voranzutreiben,<br />
erschliesst Swisscom zudem auch in Gebieten,<br />
wo das Unternehmen (noch) keine<br />
Kooperationspartner hat, Wohnungen und<br />
Geschäftsliegenschaften alleine mit Glas-<br />
faser. Bis Ende Juni 2012 haben Swisscom<br />
und die Kooperationspartner bereits rund<br />
420 000 Wohnungen und Geschäfte mit<br />
Glasfasern erschlossen.<br />
Ultraschnelles Breitband auch in den<br />
Regionen und im Mobilfunk<br />
Swisscom hat sich das Ziel gesetzt, gemeinsam<br />
mit ihren Kooperationspartnern bis<br />
Ende 2015 rund einen Drittel der Schweizer<br />
Haushalte mit Glasfaser zu erschliessen. In<br />
Zahlen ausgedrückt bedeutet dies: Eine Million<br />
Haushalte. Dafür investiert das Unternehmen<br />
rund 2 Milliarden Schweizer Franken.<br />
Trotz dieser Dynamik: es ist unrealistisch<br />
zu glauben, man könne überall gleichzeitig<br />
bauen. Der FTTH-Ausbau ist ein Generationenprojekt,<br />
das mehr als zehn Jahre in<br />
Anspruch nehmen wird.<br />
Um ultraschnelles Internet und multimediale<br />
Dienste auch in Gebieten anzubieten,<br />
die in den kommenden Jahren noch nicht<br />
mit FTTH erschlossen werden, setzt Swisscom<br />
deshalb auf den Glasfaserausbau bis<br />
kurz vor die Gebäude (Fibre to the Street,<br />
FTTS). Ende 2013 wird Swisscom damit beginnen,<br />
Glasfaser bis rund 200 Meter vor<br />
die Häuser und damit wesentlich näher zum<br />
Kunden zu bauen. Für die verbleibende<br />
Strecke bis in die Wohnungen wird die<br />
bestehende Kupferverkabelung eingesetzt.<br />
Diese Glasfaser-Hybridtechnologie ermöglicht<br />
Bandbreiten von bis zu 100 Megabit<br />
pro Sekunde. In den kommenden drei bis<br />
vier Jahren werden sogar Bandbreiten von<br />
400 Megabit pro Sekunde und höher möglich<br />
sein.<br />
Auch im Mobilfunk trei<strong>bt</strong> Swisscom die<br />
Erhöhung der Bandbreiten stetig voran, insbesondere<br />
mit dem Ausbau der neuen Mobilfunktechnologie<br />
4G/LTE, welche mobile<br />
Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s<br />
ermöglicht. Nach erfolgreichen Pilotversuchen<br />
in Tourismusgebieten und ausgewählten<br />
Swisscom Shops wird Swisscom ab<br />
Dezember 2012 in zwölf Städten der<br />
Schweiz 4G anbieten. Bereits ab 2013 wird<br />
der flächendeckende Ausbau starten. Dann<br />
beginnt ein neues Zeitalter im mobilen Internet.<br />
Möglich werden schnelles Online<br />
Gaming, Videokonferenzen, TV in einer<br />
sehr hohen Qualität, innert Sekunden Fotos<br />
hochladen und noch schnelleres Surfen.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 161
Urheberrecht / Buchbesprechung<br />
Von Märchen und Autorenrechten<br />
Es war einmal eine junge Prinzessin, tugendvoll<br />
und wunderschön. Ein blauer<br />
Prinz, stark und tapfer, ist bereit, jede Mutprobe<br />
zu bestehen, um an ihrer Seite zu sein.<br />
Es folgen Abenteuer und Romantik. Und<br />
schliesslich der ersehnte Moment, in dem<br />
beide sich vermählen. «So le<strong>bt</strong>en sie glücklich<br />
und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben<br />
sind, dann leben sie noch heute.»<br />
Märchen enthalten Grundmuster, in die<br />
Werte eingeschrieben sind, die eine Gesellschaft<br />
zu verewigen sucht. Vladimir Propp<br />
identifizierte über dreissig solcher Märchen-<br />
Muster. Wir kennen sie als «die Funktionen<br />
von Propp». Eines dieser Elemente ist die<br />
Vermählung, die den glücklichen Ausgang<br />
der durchle<strong>bt</strong>en Abenteuer abschliesst. Das<br />
«So le<strong>bt</strong>en sie glücklich und zufrieden …»<br />
beschrei<strong>bt</strong> die Illusion eines immerwährend<br />
glücklichen Lebens, die sich nicht auf ein<br />
beliebiges Familienmodell bezieht, sondern<br />
auf die Bindung zwischen Mann und Frau.<br />
In unserer kolumbianischen Gesellschaft<br />
heisst das: Das Glück hängt vom Modell der<br />
traditionellen, katholischen Ehe ab; unter<br />
Ausschluss aller anderen Optionen.<br />
Gesellschaften verfügen über viele solcher<br />
Grundmuster, die sich wie Legosteine<br />
verschieden zusammenbauen lassen, doch<br />
sie bleiben im Bauwerk gut erkennbar, denn<br />
sie kennzeichnen die Argumentationslinien,<br />
Carolina Botero Cabrera und Julio Cesar Gaitán, Bogota (K)<br />
Die hergebrachte Erzählung vom Urheberrecht funktioniert nicht mehr für alle<br />
kreativen Milieus. Ein neuer Gesellschaftsvertrag sollte nicht nur die industriellen,<br />
sondern auch die freien Formen der Kulturproduktion anerkennen, so die kolumbianischen<br />
Juristen Carolina Cabrera und Julio Gaitán.<br />
die auch auf andere Realitäten und Handlungen<br />
übertragen werden können.<br />
Wir schlagen nun vor, uns mit den<br />
Grundmustern der Copyright-Debatte auseinanderzusetzen*.<br />
Schliesslich wird der<br />
Erfolg eines Urhebers – zumindest bei uns<br />
– in der Regel mit dem Begriff des «Copyrights»<br />
verbunden. So ähnlich wie unser<br />
Wohlergehen an das Konzept der märchenhaften<br />
traditionellen Ehe gekoppelt wird.<br />
Kontrolle als Standard<br />
In unserer von katholischen Werten geprägten<br />
kolumbianischen Gesellschaft wird unaufhörlich<br />
wiederholt, dass die Ehe der<br />
rechte Weg zur Familie sei, dass sie aus<br />
* In Deutschland und anderen Ländern schützt<br />
das Urheberrecht die Rechte des Urhebers eines<br />
Werkes. Das anglo-amerikanische Copyright hingegen<br />
bezeichnet das Recht, ein Werk wirtschaftlich<br />
zu nutzen («the right to copy»). Der angloamerikanische<br />
Copyright-Vermerk gi<strong>bt</strong> in der<br />
Regel den Rechteinhaber an und nicht den Urheber.<br />
Der konzeptionelle Unterschied zwischen<br />
Urheberrecht und Copyright ist sehr wichtig, für<br />
das zentrale Argument dieses Beitrags ist er allerdings<br />
kaum von Belang.<br />
Mann und Frau bestehe und ihr Zweck die<br />
Fortpflanzung sei. Ganz ähnlich hören wir<br />
ständig, dass es ohne Copyright keine Kreativität<br />
gi<strong>bt</strong>, dass viele Arbeitsplätze wegfallen<br />
werden und dass das Wohlergehen<br />
der Kulturschaffenden vom Copyright abhängt.<br />
Nach dieser Auffassung wird das Copyright<br />
fast ausschliesslich als Rechtsschutz für<br />
geistige Schöpfungen verstanden, der es<br />
dem Inhaber erlau<strong>bt</strong>, die Verwendung seiner<br />
Werke durch Dritte (Reproduktion, Bearbeitung,<br />
Verbreitung) zu kontrollieren,<br />
um den eigenen Aufwand und die Produktionskosten<br />
zu decken. Es wird angenommen,<br />
dies sei der einzige Weg, Kreative zu<br />
entlohnen. Das Copyright gilt so im Wesentlichen<br />
als ein Element der Wertschöpfungskette<br />
der Kulturbranche, «die beim Schöpfer<br />
beginnt, die Produktion durchläuft, sich<br />
über Vertrieb und Marketing fortsetzt, und<br />
schliesslich in der Öffentlichkeit endet, die<br />
die Nutzung dieser Inhalte beansprucht» –<br />
diese Formulierung wird in Kolumbien zur<br />
Beschreibung der Rechte an «geistigem Eigentum»<br />
genutzt.<br />
Kreative aller Sparten hoffen auf die Unterzeichnung<br />
von Verträgen, die ihnen im<br />
Rahmen dieses Kreativwirtschaf<strong>tm</strong>odells<br />
das glückliche Ende ihrer eigenen märchenhaften<br />
Geschichte versprechen. Doch wer<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 162
die Realität des Kulturbetriebs genau betrachtet,<br />
wird feststellen, dass die Unterhaltungsindustrie<br />
– die Rechteverwerter – mit<br />
etwa 20 Prozent der erfolgreichen Künstler<br />
die Investitionen des Unternehmens deckt,<br />
die es für die Investition in die übrigen<br />
braucht. Es sind eben diese 20 Prozent,<br />
die mit dem Urheberrecht «glücklich und<br />
zufrieden leben, bis an ihr Lebensende»<br />
(Tatsächlich erstreckt sich das Recht zur exklusiven<br />
Verwertung über das Ableben hinaus, in<br />
der Regel bis zu 70 Jahre nach dem Tod des<br />
Urhebers, die konkrete Schutzdauer hängt vom<br />
Entstehungszusammenhang ab).<br />
Die restlichen 80 Prozent der Kreativen<br />
profitieren kaum von der Logik der Kulturindustrie.<br />
Vor allem aber haben diejenigen,<br />
die keine Verträge bekommen, gar nichts<br />
von dieser Kalkulation. Die meisten von uns<br />
sind weder Prinzen noch Prinzessinnen.<br />
Vielfalt zählt<br />
Es geht aber auch anders. Das dem derzeitigen<br />
Copyright zugrunde liegende Muster<br />
trägt nicht mehr in der elektronischen Umwelt<br />
des Internets. Zahlreiche Studien beschreiben,<br />
wie Communitys mit den herkömmlichen<br />
Grundmustern des Copyrights<br />
brechen, wie sie freie Software verwalten,<br />
wie die Idee der Freien Kultur funktioniert<br />
und wie Freie Kultur geschützt werden<br />
kann. Viele Arbeiten zeigen auch, warum<br />
eine Veränderung dieser Grundmuster geboten<br />
ist, damit das Copyright auch anderen<br />
Zielen dienen kann als jenem der Kontrolle.<br />
Die Communitys haben Instrumente geschaffen<br />
(allgemeine öffentliche Lizenzen<br />
und freie Lizenzen), die ihre Ziele in Rechtsform<br />
giessen. Obwohl Anhänger und Nutzer<br />
dieser Lizenzen nicht auf die herkömmliche<br />
Kernidee des Copyrights zurückgreifen<br />
und sich um eine andere Achse drehen als<br />
jene der totalen Kontrolle über ihre Werke,<br />
sind sie wirtschaftlich produktiv.<br />
Natürlich wird auch innerhalb des Copyrigh<strong>tm</strong>odells<br />
der an sich exklusive und umfassende<br />
Verwertungsanspruch gelegentlich<br />
flexibilisiert, um wegen ihrer gesellschaftlichen<br />
Relevanz bestimmte Nutzungen zu<br />
gestatten. Diese Nutzungen sind als «Ausnahmen»,<br />
«…Schranken» oder «Fair Use»<br />
bekannt (entsprechend dem jeweiligen<br />
Rechtssystem). Auch Ausnahmen und<br />
Schranken wirken zurück auf das wirtschaftliche<br />
Handeln, von dem Arbeitsplätze und<br />
Steuern abhängen. Deshalb wollen die Befürworter<br />
eines traditionellen Copyrights in<br />
der Regel nur wenige und eng begrenzte<br />
Ausnahmen oder «Fair Use»-Bestimmungen.<br />
Die Gesellschaft braucht aber sehr viele<br />
solcher «Ausnahmen» von den exklusiven<br />
Rechten! Beispielsweise für Werke, die in<br />
öffentlichen Bibliotheken benötigt werden.<br />
Bibliotheken folgen einer anderen Logik.<br />
Sie funktionieren gerade dank dieser Ausnahmen<br />
und Schranken. Die öffentliche<br />
Ausleihe ist ein Schatz, der der Gesellschaft<br />
Urheberrecht Von Märchen und Autorenrechten<br />
Dieser Beitrag erschien zuerst im Buch «Commons<br />
– Für eine Politik jenseits von Markt und<br />
Staat» (transcript 2012), herausgegeben von Silke<br />
Helfrich und der Heinrich-Böll-Stiftung.<br />
Carolina Botero Cabrera (Kolumbien) ist Aktivistin,<br />
Beraterin und Rechtsanwältin. Sie leitet die<br />
Arbeitsgruppe Recht, Internet und Gesellschaft<br />
der Stiftung Karisma und ist Creative-Commons-<br />
Projektleiterin für Kolumbien sowie Co-Managerin<br />
von Creative Commons für Lateinamerika.<br />
Julio Cesar Gaitán (Kolumbien) ist Jurist und<br />
Direktor des Prüfungsamtes für Rechtswissenschaften<br />
der Unive<strong>rsi</strong>dad del Rosario, Bogotá.<br />
erheblichen Nutzen bringt, und sollte deshalb<br />
nicht ausschliesslich vom Willen der<br />
Autoren abhängig sein und noch viel weniger<br />
von den Zäunen, die auf dem Markt errichtet<br />
werden.<br />
Die meisten Gesetze erkennen dies an<br />
und sehen Ausnahmen für Bibliotheken vor,<br />
insbesondere für Werke, die Bibliotheken in<br />
Obhut gegeben wurden, um sie zu erhalten.<br />
Dennoch wird in Ländern wie Kolumbien<br />
immer mal wieder betont, dass die öffentliche<br />
Ausleihe nicht vom Copyright geregelt<br />
werde und daher die Arbeit der Bibliotheken<br />
von den Rechteinhabern nur toleriert<br />
würde. Die Idee der absoluten Kontrolle ist<br />
hier sehr stark. Verstärkt wird dies durch<br />
technische Schutzmassnahmen, die die Nutzung<br />
kontrollieren und einschränken.<br />
Neue Grundmuster des Copyrights<br />
Auch wenn wir im traditionellen (kolumbianischen)<br />
Familienmodell Vorteile und einen<br />
gewissen Nutzen erkennen, ist es eine<br />
Tatsache, dass man Familien auch anders<br />
begreifen kann. Genauso gi<strong>bt</strong> es mehrere<br />
Möglichkeiten, jenseits oder im Rahmen<br />
des Copyrights kreativ tätig zu sein. Das ist<br />
heute so, und es war früher nicht anders.<br />
Neue Technologien vervielfachen tendenziell<br />
das Potential anderer Schöpfungs- und<br />
Nutzungsmuster, denn sie bieten neue Umgebungen<br />
für die Produktion, die Verbreitung<br />
und den Zugang zu Inhalten und Werken.<br />
Und selbstredend bieten sie auch<br />
andere Erfolgsmöglichkeiten als jene, die<br />
die Kreativindustrie offeriert, weil die neuen<br />
Technologien es den Kreativen unter geringem<br />
Ressourceneinsatz ermöglichen, das<br />
weltweit öffentlich zu machen, was bislang<br />
nur im lokalen oder privaten Umfeld möglich<br />
war. Das Internet offenbart sich in der<br />
Realität als ein neues, die Autonomie der<br />
Kreativen förderndes und der Gesellschaft<br />
dienendes Produktionsmodell, in dem Freiwillige<br />
nicht unbedingt ihre Urheberrechte<br />
als einen Mechanismus zur individuellen<br />
finanziellen Belohnung nutzen, vielmehr<br />
nutzen sie es zur Stärkung der Gemeinschaft<br />
und ihrer Prinzipien. Diese Art des Handelns<br />
generiert geteilten Wohlstand.<br />
Dieses neue Produktionsmodell kann<br />
vom Markt nicht einfach ignoriert werden,<br />
sondern es wird mit der Zeit für Regierungen,<br />
Unternehmen und die Gesellschaft sogar<br />
unerlässlich. Inzwischen ist klar: Parallel<br />
zur traditionellen «Wirtschaft des Handelns»<br />
hat sich eine «Wirtschaft des Teilens» entwickelt.<br />
Das Umfeld, in dem sich diese Ökonomie<br />
des Teilens entwickelt, entspricht<br />
gerade nicht den traditionellen Mustern<br />
und Strukturen des Marktes; und ihre Beziehung<br />
zum Copyright entspricht tatsächlich<br />
nicht dem, was das Gesetz als legitim definiert<br />
hat.<br />
Kurz, die Rahmenbedingungen für die<br />
Produktion, Verteilung und Nutzung von<br />
kreativen Werken nicht nur der Kunst und<br />
Unterhaltung, sondern auch von Bildung<br />
und Wissenschaft haben sich geändert, und<br />
mit ihnen ändern sich die (normativen)<br />
Grundmuster. Wir müssen diese neuen<br />
Muster identifizieren – und es müssen sich<br />
Personen finden, die ein neues Drehbuch<br />
schreiben mit einer Fülle von Modellen, die<br />
eine andere Botschaft vermitteln und eine<br />
andere Sprache sprechen als jene des Copyrights<br />
und der unbedingten Kontrolle.<br />
Es gi<strong>bt</strong> kreative Milieus, die vom Copyright<br />
als Kontrollmechanismus profitieren,<br />
aber wir müssen auch anerkennen, dass es<br />
noch etwas anderes gi<strong>bt</strong>, das nicht überrollt<br />
werden darf. Wir sollten uns nicht auf eine<br />
einzige Möglichkeit fixieren, kreative Leistungen<br />
hervorzubringen, und stattdessen<br />
einen Gesellschaftsvertrag (und eine Rechtsordnung)<br />
annehmen, der Platz für alle Formen<br />
bietet, mit kreativen Werken umzugehen.<br />
Stellen wir uns ein Rechtssystem vor,<br />
in dem alle Formen der Kulturproduktion<br />
anerkannt werden, die der industriellen,<br />
aber auch die der Freien Technologien, der<br />
Freien Kultur, der traditionellen Gemeinschaften,<br />
der Wissenschaft und der städtischen<br />
Kulturprojekte. Das wäre eine Herausforderung<br />
für Gesetzgeber und Richter!<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 163
Grundlagen<br />
Screenshots ... eigentlich eine einfache Sache ...<br />
Hans Häsler, Lausanne<br />
Das Erstellen eines Screenshots ist eigentlich<br />
einfach. Man wählt sein bevorzugtes<br />
Programm (z. B. « SnagIt » unter Windows<br />
oder das Mac-Dienstprogramm « Bildschirmfoto<br />
») und führt einen Tastenkürzel aus oder<br />
startet den Schnappschuss durch die Wahl<br />
eines Menüartikels.<br />
Was sollte denn schwierig sein ?<br />
Die Anspielungen (« eigentlich einfach ») beziehen<br />
sich nur auf Screenshots, die man in<br />
Dokumente lädt, welche später mit professionellen<br />
Verfahren gedruckt werden.<br />
Doch auch wenn das Zielmedium ein<br />
PDF-Dokument ist, welches « nur » am Bildschirm<br />
betrachtet oder auf einem Laserdrucker<br />
ausgegeben wird, lohnt es sich,<br />
gewisse Regeln einzuhalten.<br />
Vorbereitung<br />
Meistens will man den Mauszeiger auch<br />
im Bild haben, um eine Auswahl deutlicher<br />
zu kennzeichnen. « Bildschirmfoto » starten,<br />
den Artikel « Einstellungen » wählen und auf<br />
den gewünschten Zeigertyp klicken :<br />
Abb. 1: Durch Klick auf das Symbol den gewünschten<br />
Zeiger wählen. « Mit Ton » aktiviert : Beim Erzeugen<br />
sind je nach Art des Fotos bis zu drei Töne zu hören.<br />
Allerdings werden spezielle Zeigerformen<br />
(z. B. die Ergänzung mit dem kleinen<br />
Quadrat, wenn sich der Zeiger über einem<br />
auswählbaren InDesign-Objekt befindet) im<br />
Screenshot durch einen gewöhnlichen Pfeil<br />
ersetzt. Man muss versuchen, die richtige<br />
Art in einem Hilfe-Dokument zu finden oder<br />
in Photoshop selber zu zeichnen.<br />
Und los geht’s !<br />
Im Menü « Foto » (Abb. 2) einen der vier<br />
Artikel wählen (oder den entsprechenden<br />
Kürzel ausführen). Die Namen sind selbsterklärend.<br />
Zudem wird jedes Mal ein Dialog<br />
mit Anweisungen angezeigt. Dieser Dialog<br />
erscheint nicht im Foto. Er muss aber ab und<br />
zu verschoben werden, damit man sieht,<br />
was man macht.<br />
Zum Illustrieren eines Ablaufs in einem Programm liegt es nahe, die entsprechenden<br />
Bereiche des Bildschirms zu « fotografieren ». Dazu benötigt man ein Progrämmchen.<br />
Es sei denn, man benutze die integrierten Funktionen des Systems. Unter Windows ist<br />
das « Print Screen ». Mit Mac OS X der Tastaturkürzel Befehl + Umschalt + 3 (oder 4).<br />
Abb. 2 : Die Erzeugung des Screenshots mit der Wahl eines der vier Artikel starten.<br />
Abb. 3 : Der Dialog erklärt, was man ausführen soll. Er würde nicht im Foto erscheinen, falls er sich mal innerhalb<br />
der roten Begrenzung des Auswahlrechtecks befinden sollte. Im gelben Feld : Breite und Höhe der Auswahl.<br />
Wichtig ist : Per Umschalter (Befehl +Tab)<br />
erneut das Programm anzeigen, in welchem<br />
der Screenshot gemacht werden soll, damit<br />
Menüs und Fenster aktiviert sind.<br />
Ausgewählter Bereich Mit dem Mauszeiger<br />
ein Auswahlrechteck ziehen (Abb. 3) und<br />
loslassen. Nach einer Sekunde erscheint ein<br />
Fenster « Ohne Titel », welches mit « Sichern »<br />
in eine Datei gespeichert werden kann.<br />
Fenster Im Dialog auf « Fenster auswählen »<br />
klicken und dann auf das gewünschte Fenster.<br />
Aber zuerst in den Einstellungen den<br />
Zeigertyp « Keiner » wählen, sonst muss meistens<br />
der Pfeil wegretouchiert werden.<br />
Bildschirm Der gesamte Bildschirm wird er-<br />
fasst. Die Datei kann man so speichern oder<br />
auch davon einen Bereich auswählen.<br />
Selbstauslöser Wenn ein geöffnetes Menü<br />
abgebildet werden soll (siehe Abb. 2), dann<br />
kann man nicht gleichzeitig davon einen<br />
Bereich auswählen. Also zuerst den Selbstauslöser<br />
starten. Man hat zehn Sekunden<br />
Zeit (der Countdown wird rechts<br />
neben der Kamera angezeigt), um<br />
das Menü zu öffnen und einen Artikel<br />
auszuwählen. Anschliessend kann man<br />
im Ergebnis den Bereich ausschneiden, den<br />
man benötigt.<br />
Trickreich vorgehen<br />
Wie soeben erwähnt, ist es nicht immer<br />
möglich, den geplanten Screenshot mit einer<br />
einzigen Aktion zu bekommen.<br />
Um die Wahl des Zeigertyps (Abb. 1) zu<br />
knipsen, musste der Selbstauslöser gestartet<br />
werden, weil sonst der Dialog nicht aktiv ist.<br />
Bei der Abbildung 3 war es komplizierter.<br />
Zuerst per Selbstauslöser eine Aufnahme<br />
machen, auf welcher die Wahl des Artikels<br />
zu sehen ist. Dann das Ergebnis (das Fenster<br />
ohne Titel) auf die gewünschte Grösse zurechtziehen,<br />
mit + A die Aufnahme starten,<br />
den Dialog positionieren, den Bereich<br />
auswählen und mit + + 3 ein Foto des<br />
gesamten Bildschirms auslösen.<br />
Weitere Vorbereitungen<br />
Bevor wir richtig mit dem « Fotografieren »<br />
loslegen, müssen ein paar Einstellungen geändert<br />
werden, um die Qualität der Screenshots<br />
zu verbessern. Doch je nach Bildschirmtyp<br />
und OS hat man das eine Problem<br />
nicht oder kann das andere nicht lösen ...<br />
Die folgenden Ratschläge gelten nur für<br />
Flachbildschirme, Mac OS X 10.6.x (Snow<br />
Leopard), 10.7.x (Lion) und die Bearbeitung<br />
der Dateien mit Photoshop.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 164
Erstes Problem : die Schriftglättung<br />
Beim Bearbeiten der ersten Screenshots ab<br />
Flachbildschirm fällt einem auf, dass bei<br />
schwarzem Text die Zeichen farbig und versetzt<br />
erscheinen (Abb. 5, linke Spalte). Wenn<br />
es beim Druck Passerdifferenzen gi<strong>bt</strong>, dann<br />
wird dieses Problem noch verstärkt.<br />
Abhilfe : Die Systemeinstellungen öffnen,<br />
auf « Erscheinungsbild » klicken und bei der<br />
Zeile « LCD-Schriftglättung verwenden » den<br />
Haken der Checkbox wegklicken (Abb. 4).<br />
Wie gesagt, hat man bei anderen Systemen<br />
andere Optionen. Sowohl mit Tiger als<br />
auch mit Leopard bietet ein lokales Menü<br />
fünf Artikel an. Aber die farbige Wiedergabe<br />
von schwarzen Texten lässt sich damit leider<br />
nicht ganz unterbinden.<br />
Ohne LCD-Schriftglättung sind die Buchstaben<br />
zwar nur in Schwarz, aber sie werden<br />
trotzdem geglättet, d. h. die Mehrzahl der<br />
Pixel sind in Grau-Abstufungen.<br />
Früher konnte auch diese Glättung abgestellt<br />
werden (klappt heute nicht mehr) : Im<br />
lokalen Menü «Text nicht glätten für Schriftgrösse<br />
X und kleiner » den Wert aufs Maximum<br />
setzen. So bekam man nur Pixel in<br />
100 % Schwarz. Doch dadurch waren erstens<br />
die Zeichen viel zu dünn und zweitens zeigte<br />
Photoshop beim Start eine Warnmeldung.<br />
Zurück zur Abbildung 5 : Der Text nur in<br />
Schwarz (zweite Spalte) ist naturgemäss etwas<br />
feiner als jener, bei welchem die Farben<br />
hervorschauen. Aber : Negativer Text wird<br />
zu fein und schmiert zu. Man sollte also die<br />
LCD-Schriftglättung wieder aktivieren und<br />
den Screenshot für diese Partien wiederholen.<br />
Doch das ist aufwendig, weil erstens die<br />
Änderung in den Systemeinstellungen erst<br />
nach einem Neustart (oder : ab- und wieder<br />
anmelden) wirksam wird und zweitens die<br />
Montage in Photoshop vorgenommen werden<br />
muss. Aber lohnen würde es sich ...<br />
Zweites Problem : die Farbseparierung<br />
Das reine Schwarz für Texte, welches in der<br />
Abbildung 5 in der zweiten Spalte gezeigt<br />
wird, bedingt auch eine gewisse Einstellung<br />
in Photoshop. Diese ist noch fast wichtiger,<br />
weil damit bei der Umwandlung von RGB zu<br />
CMYK neutrale Flächen erzielt werden : Grau<br />
blei<strong>bt</strong> grau, ein Farbstich wird vermieden.<br />
Photoshop starten, dann im Menü « Bearbeiten<br />
» den Artikel « Farbeinstellungen...»<br />
wählen. Der gleichnamige Dialog öffnet<br />
sich. Jetzt im Abschnitt «Arbeitsfarbräume »<br />
das lokale Menü « CMYK» öffnen und den<br />
Artikel « Eigenes CMYK...» wählen.<br />
Dieser Dialog öffnet sich und man kann<br />
per Radiobutton auf die Separationsart GCR<br />
(Gray Component Replacement = englisch für<br />
Unbuntaufbau) umschalten (Abb. 6) und im<br />
lokalen Menü « Schwarzaufbau » den Artikel<br />
« Maximum » wählen. Schliesslich mit Klick<br />
auf « OK» die Dialoge schliessen.<br />
Der Unterschied zwischen den beiden<br />
Einstellungen wird mit den Abbildungen 7<br />
und 8 demonstriert.<br />
Grundlagen Screenshots ... eigentlich eine einfache Sache ...<br />
Abb. 4 : Die Checkbox « LCD-Schriftglättung » deaktivieren, damit schwarzer Text nicht farbig wird.<br />
a a<br />
b b<br />
c c<br />
d d<br />
e e<br />
Abb. 5 : Die RGB-Screenshots mit Photoshop in CMYK konvertiert. Linke Spalte : LCD-Schriftglättung aktiviert ;<br />
rechte Spalte : LCD-Schriftglättung deaktiviert. Die Auszüge zeigen deutlich, dass mit aktivierter LCD-Schrift-<br />
glättung ein eigentlich schwarzer Text mehrheitlich farbig ist : a) CMYK ; b) Cyan ; c) Magenta ; d) Yellow ; e) Black.<br />
Abb. 6 : Mit der Wahl der Separationsart « GCR » und dem Schwarzaufbau « Maximum » werden die Grautöne<br />
neutral gehalten, weil die CMY-Anteile null Prozent betragen.<br />
Abb. 7 : Mit « UCR » setzt sich der Hintergrund des<br />
Dialoges aus drei Farben zusammen (C 11, M 6, Y 7).<br />
Ein Farbstich ist programmiert.<br />
Abb. 8 : Mit « GCR » ist der Hintergrund des Dialoges<br />
nur in Schwarz 12 %. Vorteil : Bei Schwankungen in der<br />
Farbführung wird nur dieser Tonwert verändert.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 165
Die Weiterverarbeitung<br />
Die gespeicherten Dateien sind natürlich in<br />
RGB und mit dem Suffix «.tiff » versehen. Je<br />
nach Zielmedium ist es notwendig, nach<br />
CMYK zu konvertieren. Wenn auch noch<br />
Retouchen vorgenommen werden müssen,<br />
startet man am besten Photoshop.<br />
Drittes Problem : die Auflösung<br />
Ein Macintosh-Bildschirm hat 72 Pixel pro<br />
Inch. Und diese Auflösung findet man auch<br />
im rohen Screenshot wieder. Aber weil gescannte<br />
Bilder für einen normalen 60er-<br />
Raster üblicherweise mit 300 ppi bereitgestellt<br />
werden, haben viele Anwender das<br />
Gefühl, sie müssten ihre Bildschirmfotos<br />
ebenfalls so « anreichern » (Abb. 9).<br />
Zu ihrer Verteidigung : Manche haben<br />
keine Wahl, weil in ihrem Workflow eine<br />
gewisse Grenze, z. B. 200 ppi, effektiv errechnet,<br />
nicht unterschritten werden darf.<br />
Aber wer das Glück hat, dass sein Produkt<br />
weder zurückgewiesen noch automatisch<br />
« hochgerechnet » wird, der sollte die<br />
Auflösung nicht ändern.<br />
Nur zur Dokumentation<br />
Dennoch wollen wir die verschiedenen<br />
Möglichkeiten ausprobieren (Abb. 10). Je<br />
nach gewählter Methode fällt das Ergebnis<br />
mehr oder weniger unscharf aus.<br />
« Ohne Interpolation » macht keinen Sinn.<br />
Wenn das Original 72 ppi aufweist und man<br />
im Feld «Auflösung » die Zahl 300 eingi<strong>bt</strong>,<br />
wird die Bildoberfläche auf 24 % verkleinert.<br />
Nach dem Importieren muss dass Bild<br />
entsprechend stark vergrössert werden : auf<br />
416.666 %. Und das wiederum bringt den<br />
effektiven ppi-Wert zurück auf die ursprünglichen<br />
72.<br />
« Pixelwiederholung » scheint die bessere<br />
Lösung zu sein. Aber aufgepasst : Wenn man<br />
jetzt aus lauter Gewohnheit 300 eintippt,<br />
dann wird das Bild verfälscht. Die Rechnung<br />
(300 geteilt durch 72) ergi<strong>bt</strong> keine Ganzzahl,<br />
sondern 4.1666666 und das bedeutet, dass<br />
pro Inch 12 Pixel eingefügt werden müssen.<br />
Jeder Pixel des Originals wird in 16 Pixel<br />
aufgeteilt. Und ab und zu kommt eine Reihe<br />
und /oder eine Spalte von neuen Pixeln dazu.<br />
Das ist gut erkennbar im stark vergrösserten<br />
Ausschnitt des OK-Buttons (Abb. 11).<br />
Also : nicht 300, sondern 288 ppi (= 72 × 4)<br />
wählen. Die Rechnung geht auf, die Fläche<br />
jedes ursprünglichen Pixels wird in exakt 16<br />
neue Pixel aufgeteilt (Abb. 12).<br />
Wie man es nicht machen sollte<br />
Abschliessend nochmals ein Beispiel. Mit<br />
der Interpolation wird zwar der Treppeneffekt<br />
bei Rundungen gemildert (Abb. 13a).<br />
Aber zugleich wirkt die Illustration unscharf<br />
und schwammig.<br />
Wenn die Auflösung nicht geändert wird<br />
(Abb. 13b), dann sind die Texte schärfer und<br />
die Hintergründe neutraler. Das Betrachten<br />
solcher Illustrationen ist viel angenehmer.<br />
Grundlagen Screenshots ... eigentlich eine einfache Sache ...<br />
Abb. 9 : Der Dialog « Bildgrösse » des Menüs « Bild ». Die Checkbox « Interpolationsverfahren » aktivieren, dann<br />
im Textfeld «Auflösung » den ppi-Wert ändern und im lokalen Menü ein Verfahren wählen.<br />
a) Das Original in 72 ppi.<br />
b) 300 ppi, ohne Interpolation. c) 288 ppi, Pixelwiederholung. d) 300 ppi, bilinear.<br />
e) 300 ppi, bikubisch. f) 300 ppi, bikubisch glatter. g) 300 ppi, bikubisch schärfer.<br />
Abb. 10 : Die sechs Möglichkeiten, um die Auflösung eines Bildes zu ändern. Fast alle sind in 100 % dargestellt.<br />
Nur beim Bild « b » musste 416.666 % eingetippt werden. Und das bringt die effektive ppi-Zahl zurück auf 72 ...<br />
Abb. 11 : « Pixelwiederholung » mit 300 ppi. Fast alle<br />
ursprünglichen Pixel sind in 16 neue Pixel aufgeteilt<br />
worden. Aber ab und zu wurde eine fünfte Reihe<br />
und /oder eine fünfte Spalte von Pixeln eingefügt.<br />
a b<br />
Abb. 12 : « Pixelwiederholung » mit 288 ppi. Alle Pixel<br />
des Originals sind in 16 neue Pixel aufgeteilt worden.<br />
Die Rechnung geht auf (288 geteilt durch 72 sind 4) ;<br />
es müssen keine Pixel eingefügt werden.<br />
Abb. 13 : Zum Schluss zwei Mal dieselbe Illustration (in der Hoffnung, dass ein Unterschied sichtbar ist :-).<br />
a) Wie man es nicht machen sollte : Schriftglättung aktiviert, Separierung mit UCR, die Auflösung auf 300 ppi<br />
geändert und neuberechnet mit dem Verfahren « bikubisch ».<br />
b) So ist es besser : Schriftglättung deaktiviert, GCR-separiert und die Auflösung auf 72 ppi belassen.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 166
Adobe InDesign CS5 bis CS6<br />
Problem mit «Alles auf Druckbogen entsperren »<br />
Hans Häsler, Lausanne<br />
Es ist praktisch, dass gesperrte Rahmen<br />
mit einem Vorhängeschloss versehen<br />
werden. Weniger gut ist das Entsperren gelöst.<br />
Zwar können mehrere gesperrte Rahmen<br />
ausgewählt werden. Das bedingt das<br />
Deaktivieren der Checkbox «Auswahl von<br />
gesperrten Objekten verhindern » in den<br />
Voreinstellungen. Doch diese Rahmen können<br />
nicht wie früher auf einen Schlag entsperrt<br />
werden. Nebst dem einzelnen Lösen<br />
per Klick auf das Vorhängeschloss – am Rahmen<br />
selbst oder in der Ebenenpalette – gi<strong>bt</strong><br />
es nur « Alles auf Druckbogen entsperren ».<br />
Nicht zu Ende gedacht ...<br />
... haben die Entwickler den Einsatz dieses<br />
Befehls. Auf den ersten Blick ist zwar alles<br />
wie gewünscht : Die Vorhängeschlösser des<br />
aktiven Druck bogens sind verschwunden.<br />
Aber es gi<strong>bt</strong> einen Fall, bei welchem die<br />
Sperrung nicht gelöst werden sollte.<br />
Das Verankerte-Rahmen-Problem<br />
Wenn die Checkbox « Manuelle Positionierung<br />
verhindern » aktiviert wird (Abb. 1),<br />
dann kann zwar der Textrahmen, welcher<br />
das gesperrte Objekt enthält, immer noch<br />
frei verschoben werden. Aber es ist unmöglich,<br />
den verankerten Rahmen wissentlich<br />
oder versehentlich zu bewegen. Das ist so in<br />
Ordnung und zu empfehlen.<br />
Ein Mitglied des InDesign-Forums auf<br />
www.hilfdirselbst.ch postete Mitte Juli seine<br />
Entdeckung : Nachdem alles auf dem Druckbogen<br />
entsperrt ist (Abb. 2), kann der verankerte<br />
Rahmen manuell verschoben werden.<br />
Doch in den Optionen ist die Checkbox<br />
immer noch aktiviert (Abb. 3). Was soll das ?<br />
Rückgängig machen<br />
Die verankerten Rahmen nacheinander auswählen<br />
und mit + L wieder sperren. Oder<br />
das JavaScript VerankertesSperren einsetzen.<br />
Per Radiobuttons kann bestimmt werden,<br />
dass nur die Rahmen des aktiven Druckbogens<br />
behandelt werden sollen. Oder des<br />
ganzen Dokuments. Oder des (später) bestimmten<br />
Seitenbereichs.<br />
Zusätzlich kann man wünschen, dass nur<br />
Rahmen, bei welchen die manuelle Positionierung<br />
verhindert ist, erneut gesperrt werden<br />
sollen. Oder alle verankerten Objekte.<br />
Das Entsperren gar nicht erst zulassen<br />
Besser wäre allerdings das Vorbeugen. Den<br />
Menüartikel « Alles auf Druckbogen entsperren<br />
» nicht benutzen und stattdessen das<br />
Ab CS5 war das Sperren und Entsperren von Rahmen nicht mehr wie gewohnt. Zudem<br />
wurde Mitte Juli 2012 entdeckt, dass es nach der Wahl des Menüartikels «Alles auf<br />
Druckbogen entsperren » bei verankerten Rahmen ein Problem gi<strong>bt</strong>. Dessen Ursache<br />
kann man zwar nicht als « Bug » bezeichnen. Eher als « nicht zu Ende gedacht ».<br />
Abb. 1: Der verankerte Bildrahmen kann dank der aktivierten Checkbox « Manuelle Positionierung verhindern »<br />
nicht mehr versehentlich und unbemerkt verschoben werden. Das ist hilfreich und zu empfehlen.<br />
Abb. 3 : Die Sperrung des verankerten Rahmens ist auch aufgehoben und er kann manuell verschoben werden.<br />
So weit, so gut. Aber : In den Optionen ist die Checkbox immer noch aktiviert. Da stimmt doch etwas nicht ...<br />
Abb. 4 : Statt den Artikel «Alles auf Druckbogen entsperren<br />
» zu wählen, das JavaScript «AllesEntsperren »<br />
starten. Es ist vielseitiger (fünf Bereichs-Möglichkeiten)<br />
und verankerte Rahmen können beim Entsperren<br />
übergangen werden. Einen eventuellen Seitenbereich<br />
kann man in einem weiteren Dialog eingeben.<br />
Abb. 2 : Die Sperrung der Rahmen des<br />
aktiven Druckbogens wird aufgehoben.<br />
JavaScript AllesEntsperren starten. Wie beim<br />
vorher erwähnten Script kann man im Dialog<br />
(Abb. 4) bestimmen, wo das Entsperren<br />
ausgeführt werden soll.<br />
Wenn der Button « In einem bestimmten<br />
Seitenbereich » gewählt ist, kommt ein weiterer<br />
Dialog mit einem Textfeld, in welchem<br />
der Bereich (oder mehrere) eingegeben werden<br />
kann.<br />
Die Scripts herunterladen<br />
Sowohl VerankertesSperren.js als auch Alles<br />
Entsperren.js sind nur für CS5 erhältlich. Sie<br />
sollten aber auch mit CS6 funktionieren.<br />
http://www.fachhefte.ch aufrufen, auf die<br />
Links Java Scripts, Mac OS X deutsch (oder<br />
Windows deutsch), InDesign CS5 klicken.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 167
Essay<br />
Renaissance der Druckerschwärze<br />
von Peter Littger, Berlin<br />
Es gi<strong>bt</strong> diesen Wunsch nach einer gewissen<br />
Balance – weniger auf Monitore zu<br />
starren und zu klicken, sondern mehr zu<br />
blättern. Auf Papierseiten Ruhe und eine<br />
wohlig al<strong>tm</strong>odische Art der Erkenntnis zu<br />
finden. Ist das Berühren, das Lesen und das<br />
Betrachten von Papier ein Grundbedürfnis<br />
– eines, das sich in 560 Jahren seit Gutenbergs<br />
Druckmaschine in unseren Genen verankert<br />
hat??<br />
Es gi<strong>bt</strong> einige starke Anzeichen dafür<br />
Zum Beispiel in der Oranienburger Strasse<br />
84 in Berlin. Dort erscheint seit dem September<br />
2009 das – noch – Onlinemagazin<br />
von Dr. Dr. Alexander Görlach: «The European».<br />
Lukasz Gadowski, Erfinder der Website<br />
«Spreadshirt» und Co-Finanzierer von<br />
Görlachs Redaktion, hatte es schon bevor es<br />
offiziell wurde während einer Partynacht<br />
im Berliner Club Cookies ausgeplaudert:<br />
«Wir werden den ‹European› bald drucken.»<br />
Ihm war ein gewisser Stolz ob dieses verwegenen<br />
Plans anzumerken: In der Cluba<strong>tm</strong>osphäre<br />
klang «Wir drucken» wie «Wir<br />
sind ein bisschen verrückt!». Mit anderen<br />
Worten: Let’s go crazy, let’s print!<br />
Es muss erwähnt werden, dass Chefredakteur<br />
und Herausgeber Görlach damit erst<br />
einmal unfreiwillig in die Fussstapfen des<br />
unseligen Robert Maxwell tritt, der 1990<br />
schon einmal eine Zeitung «The European»<br />
herausgegeben hatte und ein Jahr später verstarb,<br />
nachdem er von seiner Yacht gefallen<br />
war. Maxwells erster «European» wurde<br />
dann von den Barclay-Brüdern gekauft<br />
und vollkommen defizitär im Jahr 1998 geschlossen.<br />
Allerdings sollten sich Gadowski und vor<br />
allem Görlach von dieser Vorgeschichte<br />
nicht irritieren lassen, denn erstens besitzen<br />
sie keine Yachten, zweitens publizieren sie<br />
ihren «European» in vollkommen anderen<br />
Zeiten, in denen europäische Themen Hochkonjunktur<br />
haben, drittens gehen sie kein<br />
Risiko ein mit (vorerst) nur vier Ausgaben<br />
pro Jahr – und, Gott sei Dank, agieren sie<br />
ja nicht aus England heraus, sondern von<br />
Berlin aus.<br />
Früher war alles verdammt digital. Früher – das war noch vor drei Jahren. Seitdem ist<br />
das gedruckte Wort wieder da. Entschleunigung durch gelegentliches Erscheinen.<br />
Schaulust auf dem Coffeetable. Haptik durch Papier.<br />
Sie folgen damit einem Prinzip, das vor<br />
zwei Jahren schon auf der «Rue89» in Paris<br />
erfolgreich getestet worden ist – allerdings<br />
in einer etwas anderen politischen Ecke als<br />
der «European»: Fünf Journalisten protestierten<br />
2007 gegen die Übernahme ihrer<br />
Tageszeitung «Liberation» durch den Magnaten<br />
Edouard de Rothschild. Der verstand<br />
die Befreiung anders als sie: runter von<br />
Redaktionskosten und weg mit linker Ideologie.<br />
Sie gründeten eine eigene Redaktion<br />
mit der revolutionären Chiffre 89. Frankreich<br />
1789. Europa 1989. Und das Internet,<br />
ebenfalls 1989, denn damals wurde das<br />
TCP/ IP Protokoll populär. «Eine globale<br />
Revolution», betont Chefredakteur Pascal<br />
Riché.<br />
Mitgenommen von «Liberation» hatten<br />
die fünf Journalisten eine Vorliebe für pointierte<br />
Texte und anschauliche Illustrationen.<br />
«Das passte gut ins Internet. Ausserdem hatten<br />
wir kaum Geld», erinnert sich Riché.<br />
Also gründete man nur – pardon! – eine<br />
Website: «rue89.com». Nachdem sie zwei<br />
Millionen so genannte page visitors angezogen<br />
hatte, etwa mit Skandalgeschichten rund<br />
um die Wahl von Präsident Nicolas Sarkozy,<br />
entschieden die Gründer im Jahr 2010, mit<br />
den Themen der Website eine Monatszeitschrift<br />
herauszugeben: «Rue89». Das Magazin<br />
hat sich etabliert. Es ist meinungsstark,<br />
farbig, eindringlich – eine veritable Konkurrenz<br />
für «Liberation», wenn auch noch eine<br />
kleine.<br />
Die Massentitel verlieren ihre Masse<br />
Viele Thesen sind in den letzten 20 Jahren<br />
über die Zukunft von gedruckten Medien<br />
aufgestellt worden. Die meisten waren pessimistisch.<br />
Bücher, Magazine, Kataloge, Zeitungen<br />
– allem wurde das Ende prophezeit.<br />
2006 fragte der englische «Economist»:<br />
«Who killed the newspaper?» Die Antwort<br />
war salomonisch: Das Internet sei der Mörder,<br />
aber es verdränge nur das Papier – nicht<br />
den Journalismus. Die Macht der vierten<br />
Gewalt werde im Netz neu aufblühen. Und<br />
das ist nicht ganz falsch, wenn man nur an<br />
all die Wikis denkt – oder auch an die sagenhafte<br />
Entwicklung des «Economist» selbst,<br />
der als Trendsetter agiert. Das Magazin (mit<br />
Nachdem sie zwei Millionen so genannte page visitors<br />
angezogen hatten, entschieden die Gründer im Jahr<br />
2010, mit den Themen der Website eine Monatszeitschrift<br />
herauszugeben: «Rue89».<br />
weniger als 100 Journalisten!) erle<strong>bt</strong> wie<br />
kein anderes seit Jahren einen berauschenden<br />
Zuwachs der eigenen Auflage. Sie beträgt<br />
mittlerweile 1,5 Millionen Exemplare,<br />
30 Prozent davon allerdings bereits nicht<br />
mehr auf Papier, sondern als iPad- oder Android-Ve<strong>rsi</strong>onen.<br />
Der Medienforscher Philip Meyer, der<br />
selber einmal Reporter war, erklärte 2006 in<br />
seinem Buch «The Vanishing Newspaper»,<br />
dass die Zeitungen langsam ausstürben wie<br />
die Marktschreier im Mittelalter. Vor allem<br />
der so genannte General Interest, die Berichterstattung<br />
über Gott und die Welt, das<br />
grosse Allerlei der Zeitungen, die über<br />
Kriege und Tagescremes schreiben – dies<br />
alles erscheine schon bald nicht mehr auf<br />
Papier, wenn überhaupt irgendwo. Wäre<br />
diese Entwicklung eine lineare, es gäbe in<br />
ziemlich genau 30 Jahren keine Zeitungen<br />
mehr.<br />
Meyers Szenario gleicht einer tödlichen<br />
Spirale: Alles wandert ab in die digitalen<br />
Medien, erst die Themen, dann die Leser<br />
und dann die Werbung. Und tatsächlich verlieren<br />
die gedruckten Massentitel ihre<br />
Masse. Das Schrumpfen der gedruckten<br />
Auflagen von «Bild» (minus zwei Millionen)<br />
oder «Stern» (minus eine Million) seit 1990<br />
zeigt es alleine in Deutschland.<br />
Trotzdem gi<strong>bt</strong> es Beispiele für eine Rolle<br />
rückwärts: eine Renaissance von Print. Sie<br />
wird im Fachjargon «Reverse Publishing»<br />
genannt. In den letzten Jahren erschienen<br />
eine Reihe neuer Zeitschriften, die ihre<br />
Themen direkt aus dem Internet beziehen.<br />
Offline gehen, ohne etwas zu verpassen<br />
«Hacker Monthly» ist so eine, originell gestaltet<br />
und inhaltlich besonders krass. Denn<br />
sie richtet sich an Programmierer, die sich<br />
auch in gedruckter Form ausführlich über<br />
Probleme wie die «diskrete Mathematik»<br />
informieren möchten – nachdem sie darüber<br />
bereits im Blog «Hacker News» lesen<br />
konnten. Der Internet-Unternehmer Lim<br />
Cheng Soon aus Malaysia, der sich als<br />
«Hacker News Junkie» bezeichnet, hatte<br />
dieses monatliche «Best of» 2010 mit der<br />
Begründung geschaffen, dass er «offline<br />
gehen können möchte ohne etwas zu verpassen».<br />
Rund 4500 Menschen sind bereit, zwischen<br />
29 und 88 US-Dollar jährlich zu bezahlen,<br />
um das PDF oder das gedruckte Heft<br />
zu bekommen. Die meisten wollen übrigens<br />
lieber das PDF und drucken es selber – oder<br />
vielleicht doch nicht …<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 168
Essay Renaissance der Druckerschwärze<br />
Auch die grossen Social-Media-Dienste<br />
Twitter, Facebook, Google und Linkedin<br />
finden sich seit 2011 in Magazinen wieder:<br />
Der Verlag GSG World Media macht für<br />
jeden Giganten gleich ein eigenes Heft,<br />
Auflage: 250 000. Während sich Titel wie<br />
«Tweeting & Business» recht langweilig im<br />
FAQ-Stil an Geschäftsleute richten, gründete<br />
ein gewisser Bob Fine mit viel Liebe<br />
zum journalistischen Detail «The Social Media<br />
Monthly» – ein wirklich schönes Magazin,<br />
das viel Beachtung findet, aber das auch<br />
dringend Geld braucht. Ende 2011 hatte<br />
Fine (immerhin!) 22 928 Dollar gesammelt,<br />
per Annonce auf dem Spendenforum «kickstarter.com».<br />
Das Beispiel zeigt, dass die<br />
Existenz von – man könnte sie «Cross-over-<br />
Medien» nennen – unsicher ist. Ein deutsches<br />
«Ebay Magazin» wurde 2009 nach<br />
wenigen Ausgaben wieder eingestellt.<br />
Reichweite versus Geldregen<br />
«Dass Zeitungen ins Web gehen, ist ein alter<br />
Hut. Dass jedoch aus Websites Printtitel<br />
werden, das beobachte ich immer häufiger»,<br />
berichtet John Wilpers aus Boston. Jedes<br />
Jahr schrei<strong>bt</strong> er für den Weltverband FIPP<br />
der Magazin-Verleger den Bericht «Innovations<br />
in Magazines». Medien zu drucken<br />
und unter die Leute zu bringen, kostet relativ<br />
viel Geld. Andererseits bringt Werbung<br />
in Magazinen und Zeitungen heute noch<br />
deutlich mehr Geld ein als online. Das liegt<br />
daran, dass Menschen, die Zeitungen und<br />
Zeitschriften kaufen – und hoffentlich lesen<br />
–, in der Werbewelt mehr wert sind als<br />
Menschen, die Websites besuchen und dort<br />
das machen, was im Jargon «verweilen»<br />
heisst. (Wo in Wahrheit intensiver gelesen<br />
wird, weiss niemand genau; es gi<strong>bt</strong> darüber<br />
unterschiedliche Annahmen.) Fest steht,<br />
dass durch ein Online-Medium schneller<br />
Bekanntheit erzeugt und das geschaffen<br />
werden kann, was Verlagsmanager «Reichweite»<br />
nennen. Zugleich kann sich mit<br />
einem Druckmedium schneller Geld verdienen<br />
lassen. «Verlage, die beide Vorteile zu<br />
kombinieren wissen, gewinnen», konstatiert<br />
Wilpers.<br />
Eine besonders rentable Form der Kombination<br />
von digitalen und gedruckten Inhalten<br />
demonstriert das Magazin «The<br />
Knot», das im Jahr 2000 aus der 1997 gegründeten<br />
Website «theknot.com» hervorging.<br />
Die Redaktion bildet das Zentralorgan<br />
für Amerikaner, die Inspiration für ihre<br />
Hochzeit suchen – offenbar 80 Prozent aller<br />
Paare. Die Zeitschrift erscheint viermal pro<br />
Jahr, aktuelle Auflage: mehr als 1,2 Millionen<br />
Exemplare. Ein wichtiger Grund, die<br />
digitalen Inhalte zur Druckerpresse zu tragen,<br />
liege in der Kooperation mit zahlreichen<br />
Geschäften, erklärt der Verlag. Die<br />
Zusammenarbeit gestalte sich auf Papier viel<br />
leichter und rentabler als digital.<br />
Auch in der amerikanischen Politikberichterstattung<br />
erle<strong>bt</strong> Print eine Renaissance<br />
– und das sogar einige Nummern grösser als<br />
auf der «Rue89». Im Januar 2007 gründeten<br />
die Reporter John Harris und Jim VandeHei<br />
von der «Washington Post» die Redaktion<br />
«politico.com». Sie wollten alles rund um<br />
den Capitol Hill noch besser beleuchten und<br />
beschreiben als andere – die Manöver der<br />
Lobbyisten, die Schlachten der Politiker und<br />
die Präsidentenwahlen mit ihren megateuren<br />
Kampagnen. Sie setzen auf gründliche<br />
Recherchen und Analysen genauso wie auf<br />
Gerüchte für Politikjunkies, denn davon<br />
gi<strong>bt</strong> es in Washington reichlich. Elf Millionen<br />
Menschen nutzten «politico.com» bereits<br />
zur Wahl von Barack Obama.<br />
Parallel zur Website konzentriert sich die<br />
Zeitung «Politico» mit nur 24 Seiten auf<br />
Hintergründe, nicht auf Nachrichten. Die<br />
«New York Times» attestiert, «Politico» sei<br />
kritisch, investigativ, unterhaltsam – und<br />
mittlerweile unverzichtbar in der politischen<br />
Arena. Je nachdem, ob der Kongress<br />
tagt oder nicht, erscheint die Zeitung täglich<br />
oder wöchentlich. Auch der Preis variiert:<br />
Während Abonnenten 200 Dollar zahlen,<br />
wird die Zeitung mit einer Auflage von<br />
34 000 Exemplaren an vielen Ecken in<br />
Washington sowie in den Pendlerzügen<br />
gratis verteilt. Mit einem Umsatz von knapp<br />
17 Millionen Dollar und einem Team von<br />
rund 100 festen Mitarbeitern ist «Politico»<br />
profitabel. Vermutlich wäre es ohne die gedruckte<br />
Ausgabe schon pleite. Aber ohne<br />
die Website wahrscheinlich auch, denn<br />
dann hätte die Marke niemals ihre grosse,<br />
internationale Bekanntheit erlangt.<br />
Doch welchen besonderen Nutzen hat<br />
nun Papier für die Leser, den das Internet<br />
nicht erfüllen kann?<br />
Sie treffen den Nerv<br />
Immer wieder erscheinen Magazine aus<br />
dem Nichts, die den Nerv einer bestimmten<br />
Gruppe von Menschen treffen: Zum Beispiel<br />
«Premier Guitar», 2007 von Gitarrenfreaks<br />
gegründet. Seine Existenzberechtigung<br />
auf Papier liegt wohl in vielen Noten<br />
zum Nachspielen und in Postern, die man<br />
sich in die Küche, übers Bett und in den Probenraum<br />
hängen kann. Es hat heute 650 000<br />
Abonnenten. Auch dem deutschen Magazin<br />
«Landlust» eines unabhängigen Landwirtschaftsverlags<br />
ist es gelungen, einen Nerv zu<br />
Peter Littger ist Deutschland-Chef von Innovation<br />
Media Consulting in London. Dort ist er unter<br />
anderem für die Entwicklung neuer Redaktionsmodelle<br />
verantwortlich – was die Integration<br />
von Print und Digital genauso umfasst wie das<br />
Coaching für erfolgreiche Erzählformen. Darüber<br />
hinaus ist er Autor, etwa für die «SZ am Wochenende».<br />
Er hat Geschichte, Volkswirtschaft in Berlin<br />
und Literatur, Soziologie und Medienökonomie<br />
an der London School of Economics<br />
studiert.<br />
treffen. Alle grossen Verlage haben es mittlerweile<br />
kopiert. Es spricht Menschen an,<br />
die gerne Kartoffeln züchten, Bauernsuppe<br />
kochen oder Holzmöbel renovieren. Die<br />
Auflage wuchs seit 2011 alleine innerhalb<br />
eines Jahres um 100 000 Exemplare auf nunmehr<br />
eine Million Ausgaben pro Monat,<br />
und allem Anschein nach ist das eine so genannte<br />
harte, also tatsächlich verkaufte Auflage.<br />
Bemerkenswert ist, dass die Redaktion<br />
«landlust.de» zwar besitzt, aber noch nicht<br />
einen Cent in digitale Inhalte investiert hat,<br />
die über das hinausgehen, was gedruckt<br />
wird.<br />
Der kanadische Medienwissenschaftler<br />
Marshall McLuhan hat den berühmten<br />
Gedanken formuliert: «The medium is the<br />
message» – jedes Medium hat eine bestimmte<br />
eigene Bedeutung. Jeder kennt das:<br />
Mit den einen kommuniziert man per E-<br />
Mail, Facebook oder SMS, mit anderen telefoniert<br />
es sich besser, und einigen Kollegen<br />
schrei<strong>bt</strong> man Notizen auf Zettel.<br />
Die Haptik von Papier schafft eine Unmittelbarkeit,<br />
nach der sich zum Beispiel landlustige<br />
Menschen sehnen. Darüber hinaus<br />
haben Druckmedien einen enormen Souvenircharakter.<br />
Sie schaffen Gefühle von Zugehörigkeit<br />
und Entschleunigung, wenn nicht<br />
sogar von Unvergänglichkeit. Viele Leser –<br />
wie übrigens auch Anzeigenkunden – halten<br />
Print oft für glaubwürdiger als Online. Zwar<br />
ist es schwierig zu beweisen, ob diese Annahme<br />
berechtigt ist. Doch solange sie existiert,<br />
steigert sie den Wert journalistischer<br />
Marken, wenn sie gedruckt erscheinen –<br />
und sie sich finanzieren lassen.<br />
Dass Online weniger Vertrauen geniesst,<br />
hat umgekehrt damit zu tun, dass digitale<br />
Inhalte keinerlei Souvenirwert haben. Sie<br />
werden als flüchtig empfunden, schliesslich<br />
können sie weder ausgerissen und eingerahmt<br />
werden. Doch solange ihre Riesenspeicher<br />
nicht gelöscht oder ihre Gestalt<br />
manipuliert werden, ist diese Annahme ein<br />
totaler Irrtum. Denn in Wahrheit sind gedruckte<br />
Inhalte flüchtig: Sie werden nach<br />
der Lektüre zerknüllt, zerrissen oder zerknickt<br />
und landen im Altpapier. Archiviert<br />
wird nach dem Zufallsprinzip – was sich der<br />
Leser merkt, also wenig und davon die<br />
Hälfte richtig. (Das meiste wird später wieder<br />
vergessen.)<br />
Für Unternehmen in Krisen oder Politiker<br />
in Erklärnöten wäre es deshalb ein Segen,<br />
wenn Journalisten über sie – wie früher<br />
– nur auf Papier berichteten. Keine Blogs.<br />
Keine Archive. Kein Google.<br />
So al<strong>tm</strong>odisch wie ein Strickschal<br />
Wer das zu Ende denkt, versteht schnell,<br />
dass Print mehr mit Lifestyle und Gefühlen<br />
zu tun hat als mit Aufklärung. Wer also vom<br />
Journalismus verlangt, als vierte Gewalt zu<br />
dienen, darf sich ruhig den digitalen Medien<br />
zuwenden. Jill Abramson, seit 2011<br />
Chefredakteurin der «New York Times», be-<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 169
tont, wie wichtig gerade die digitalen Methoden<br />
der Speicherung und Verbreitung<br />
für aufwendig recherchierte Themen sind.<br />
Trotzdem kommt es vielen Menschen so<br />
vor, als ginge mit dem Rückschritt von einem<br />
neuen in ein älteres Medium ein Qualitätssprung<br />
einher – ganz so, als entstehe<br />
etwas Höherwertiges. Wie wenn ein Kinofilm<br />
in ein Theaterstück, ein Popsong in eine<br />
Sinfonie oder ein Comic in einen Roman<br />
umgeschrieben wird. Gut möglich, dass<br />
manche auch glauben, Wikipedia in lateinischer<br />
Sprache (die «Vicipaedia») sei von<br />
besserer Qualität.<br />
Keine Frage: Eine Zeitung zu lesen, ist<br />
genauso al<strong>tm</strong>odisch wie einen Strickschal zu<br />
tragen, von der «Mark» zu sprechen oder<br />
von der «Platte» eines Sängers. Dabei muss<br />
man nicht einmal ein al<strong>tm</strong>odischer «Net-<br />
Migrant» sein – hippe «Net Natives» sind ja<br />
auch manchmal Liebhaber von Vinyl.<br />
Druckerschwärze als Zeichen<br />
der Distinktion<br />
Wer Print mag, dem geht es vor allem um<br />
eine bewusste Haltung – Druckerschwärze<br />
als Zeichen der Distinktion. Als Ausdruck<br />
eines kulturellen Trends gegen die glatte,<br />
perfekte Ästhetik der digitalen Welt, die sich<br />
in Apple und jedem Kleinwagen-Cockpit<br />
widerspiegelt. Der Modedesigner Wolfgang<br />
Joop und der Soziologe Richard Sennett<br />
loben seit Jahren das Handwerk. Und der<br />
deutsche Versandhandel «Manufactum»<br />
le<strong>bt</strong> gut davon.<br />
Unter dem Titel «Ein Bild sagt mehr als<br />
tausend Worte – was aber, wenn man Bilder<br />
nicht sehen kann?» fand am 13. Juni<br />
2012 ein GFZ-Guerilla-Seminar am Tatort<br />
statt.<br />
Während der Besichtigung der SBS<br />
(Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh-<br />
und Lesebehinderte) konnten die Teilnehmenden<br />
unter anderem erleben, wie Buchseiten<br />
auf einer Heidelberg-Maschine in nur<br />
einem Maschinendurchgang beidseitig in<br />
Brailleschrift geprägt werden, wie man als<br />
Blinder Notizen erstellen kann, wie Menschen<br />
mit Lesebehinderung Sudoku und<br />
Kreuzworträtsel lösen, wie für Mathematikunterricht<br />
reliefartige geometrische Formen<br />
erzeugt werden, wie Computerdrucker<br />
beidseitige «Ausdrucke» erzeugen oder wie<br />
Hörbücher aufgezeichnet werden.<br />
Das anschliessende Referat von Frau<br />
Thinh-Lay Bosshart gab tief gehende Infor-<br />
Essay Renaissance der Druckerschwärze<br />
Manufactum – setzt konsequent auf Handwerk, dazu<br />
gehören auch sehenswerte Printprodukte.<br />
So ist es konsequent, dass auch «Dawanda»,<br />
ein im Jahr 2006 gegründeter «Online-Marktplatz<br />
für Handgefertigtes», die<br />
Rolle rückwärts macht und einen Katalog<br />
druckt: das «Lovebook». «Dawanda» bietet<br />
viele Millionen Sachen feil, die früher bitte<br />
niemals unter den Weihnachtsbaum durften:<br />
zum Beispiel ein «Vintage Strickpullunder,<br />
Folklore, handgestrickt» für 20 Euro.<br />
Das Netz als Beta-Ve<strong>rsi</strong>on<br />
Im Herbst 2011 brachten die Macher der<br />
Berliner Website «freundevonfreunden.<br />
com» ein Buch mit ihren besten Fotos heraus.<br />
Es zeigt mehr oder weniger Prominente<br />
in ihren mehr oder weniger hippen Stadtwohnungen<br />
(mit vielen Plattenspielern).<br />
Das Internet diente hier nur noch als Beta-<br />
Ve<strong>rsi</strong>on – als grosser Test, dessen schöpferische<br />
Vollendung in ein Buch mündete.<br />
Wenn die Bilderwelt verschlossen blei<strong>bt</strong>!<br />
mationen über Barrierefreiheit und Internet-Zugänglichkeit.<br />
Bereichert wurden die<br />
Ausführungen durch praktische Beispiele,<br />
durch die Analyse unserer Webseite gfz.ch<br />
und durch Demos auf dem iPhone. Der<br />
hochprofessionelle Vortrag hat vielen der<br />
Teilnehmenden die Augen für bisher unbekannte<br />
Probleme geöffnet.<br />
Nach dem Vortrag konnte beim Nachtessen<br />
im Restaurant Blinde Kuh das Gehörte<br />
selbst erfühlt werden, und das hat bei allen<br />
einen bleibenden Eindruck hinterlassen.<br />
Rückmeldungen von begeisterten<br />
Teilnehmenden:<br />
«Die Ausführungen im SBS, inklusive des<br />
Teils der Hörbucherstellung, und der anschliessende<br />
sehr aufschlussreiche Vortrag<br />
von Frau Thinh-Lay Bosshart waren hochinteressant.<br />
Danke vielmals für die Organisation.<br />
Gerade solche Seminare sind eine<br />
echte Bereicherung.» [Elmar Metzer, Ugra]<br />
Im Februar 2012 erschien in Hamburg ein<br />
Buch, das sich ausgerechnet an die gesamte<br />
deutsche Medienbranche richtet und die<br />
«Top 100 Medienmacher 2012» kürte. Gemacht<br />
hatte es das Team von Dirk Manthey,<br />
der in den Neunzigerjahren das Magazin<br />
«Max» herausgab und den Verlag Milch strasse<br />
führte. Nachdem er diesen an den Burda-<br />
Verlag verkauft hatte, gründete er 2008<br />
«meedia.de», das «Online Medien-Portal» –<br />
und nun gi<strong>bt</strong> es davon das erste Jahrbuch.<br />
Dem Souvenircharakter von Print werden<br />
solche Publikationen in ganz besonderer<br />
Weise gerecht, weil sie auf die Eitelkeit des<br />
Personals bauen – und spekulieren. Was<br />
einst in Stein gemeisselt wurde, kann seit<br />
ungefähr 1450 auf Papier gedruckt werden.<br />
Seit der Revolution von TCP/IP macht das<br />
besonderen Sinn für alles Digitale, das viel<br />
geklickt oder als vorzüglich bewertet wird<br />
– und sich auch auf Bücherregalen, Nachttischen<br />
und Coffeetables gut macht. Das bedeutet:<br />
Papier transportiert immer mehr<br />
eine Botschaft über unser Verhalten und unsere<br />
Vorlieben im Netz. Papier hält unser<br />
Verhalten und unsere Vorlieben im Netz fest.<br />
Papier wird damit zur Manifestation des<br />
Digitalen. Und wir werden noch sehr lange<br />
blättern.<br />
Der Beitrag ist ein aktualisierter Abdruck des<br />
Essays «Zurück in die Zeitung», das am 12. Mai<br />
2012 im «Handelsblatt» erschienen ist.<br />
www.innovation-mediaconsulting.com<br />
littger@innovation-mediaconsulting.com<br />
«Ein Nachmittag, welcher mir die Welt<br />
meiner sehbehinderten und blinden Mi<strong>tm</strong>enschen<br />
nähergebracht hat. Was, wenn<br />
man die Welt nicht sehen kann? Andere<br />
Sinne werden stärker, wird gesagt, und spätestens<br />
im Dunkelrestaurant Blinde Kuh hat<br />
sich mir gezeigt, wie sehr ich Hören, Fühlen,<br />
Schmecken und Riechen bisher vernachlässigt<br />
habe. Wie hilflos ich in der Dunkelheit<br />
bin und wie geräuschlos und souverän sich<br />
unsere Bedienung im Dunkeln bewegt!»<br />
[Mark Reuter, GFZ]<br />
Informationen zum GFZ und den Guerilla-Seminaren:<br />
www.gfz.ch<br />
Weiterführende Infos zum Thema «Access for all».<br />
www.access-for-all.ch<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 170
Typografie<br />
Die Neue Aachen – serifenbetont und solide<br />
www.linotype.com/de<br />
Die von Colin Brignall gezeichnete und<br />
im Jahr 1969 von Letraset veröffentlichte<br />
Aachen Bold wird 1977 in Zusammenarbeit<br />
mit Alan Meeks durch die Aachen<br />
Medium ergänzt. Damit erfreuen sich die<br />
markanten Formen der Aachen nun schon<br />
seit mehreren Jahrzehnten grosser Belie<strong>bt</strong>heit.<br />
Abgeleitet von serifenbetonten Egyptienne-Schriften<br />
vom Anfang des 20. Jahrhunderts<br />
zeigt die Aachen zwar eine sehr<br />
fette, aber im Vergleich zur Egyptienne<br />
deutlich verkürzte Serifenform. Geometrische<br />
Elemente wie rechte Winkel und gerade<br />
Linien geben den schmal laufenden<br />
Buchstaben der Aachen einen leicht technischen,<br />
schablonenhaften Charakter. Trotzdem<br />
wirken die soliden Buchstaben der<br />
Aachen nicht statisch, sondern dynamisch,<br />
und die für Headlines ausgelegte Schrift erfreut<br />
sich vor allem im Sport- und Fitness-<br />
Bereich grosser Belie<strong>bt</strong>heit.<br />
Jim Wasco, seit vielen Jahren Schriftdesigner<br />
bei Monotype Imaging, erkennt das<br />
Potential der Aachen und beschliesst, die<br />
Schrift zur kompletten Familie auszubauen.<br />
Er übernimmt die bestehende Aachen Bold<br />
und konstruiert zunächst die leichteren<br />
Schnitte Thin und Regular. Wasco erzählt,<br />
dass vor allem die Formen der Thin für ihn<br />
eine Herausforderung waren. Er brauchte<br />
mehrere Anläufe, bis die Buchstaben der<br />
Thin in sich stimmig waren und trotzdem<br />
ausreichend gestalterischen Bezug zur ursprünglichen<br />
Aachen Bold aufwiesen. Letztendlich<br />
gelingt es ihm aber, sowohl die kurzen<br />
Serifen als auch den schmalen und leicht<br />
geometrischen Charakter der Buchstaben<br />
für die Thin zu übernehmen. Durch Interpo-<br />
Von der Qualität der ursprünglich 1969 für Letraset gezeichneten Aachen überzeugt<br />
baut Jim Wasco von Monotype Imaging die robuste Display-Schrift zu einer kompletten<br />
Familie aus.<br />
lation entstehen die Strichstärken Light,<br />
Book, Medium und Semibold. Mit den<br />
schliesslich noch ergänzten Schnitten Extralight<br />
und Extrabold steht die Neue Aachen<br />
mit stolzen neun Strichstärken zur Verfügung.<br />
Für die neuen Italic-Schnitte folgt Wasco<br />
zunächst seiner Vorliebe für echte ku<strong>rsi</strong>ve<br />
Buchstaben. Allerdings zeigen diese ersten<br />
Experimente, dass die weichen Kurven einer<br />
Ku<strong>rsi</strong>ven nicht mit der Aachen harmonieren<br />
und zu viel des ursprünglichen Charakters<br />
verloren geht. Wasco entscheidet<br />
sich also für einen Kompromiss aus schräg-<br />
gestellten und ku<strong>rsi</strong>ven Buchstaben. Die<br />
Neue Aachen Italic ist schliesslich etwas<br />
schmaler als die aufrechten Schnitte gestaltet,<br />
das gemeine «a» wechselt in die geschlossene<br />
Form und das «f» bekommt eine<br />
Unterlänge, auf zusätzliche Schwünge in<br />
den Buchstaben wird aber verzichtet.<br />
Der Zeichenvorrat wird deutlich ausgebaut,<br />
so dass nicht nur die west-, sondern<br />
auch zentraleuropäische Sprachen unterstützt<br />
werden. Ausserdem ergänzt Wasco<br />
das doppeläugige gemeine «g» und verspricht<br />
sich von der über die Formatsätze zu<br />
erreichenden Buchstaben-Alternative eine<br />
bessere Lesbarkeit der Neue Aachen im<br />
Textsatz.<br />
Sieben neue Strichstärken und eine komplett<br />
neue Italic erweitern die Einsatzmöglichkeiten<br />
der Aachen und den Gestaltungsspielraum<br />
für den Designer enorm. Haben<br />
sich die Bold-Schnitte als Displayschrift<br />
schon unter Beweis gestellt, eignen sich die<br />
neuen Book- und Regular-Schnitte vor allem<br />
für den Textsatz. Und die besondere Finesse<br />
der Ultra Light gi<strong>bt</strong> Ihren Gestaltungen<br />
nochmal ein ganz eigenes Flair. Nutzen Sie<br />
die neuen Möglichkeiten und Freiheiten in<br />
Gestaltung und Einsatz der Neue Aachen<br />
nicht nur in klassischen Printproduktionen,<br />
sondern mit den verfügbaren Webfonts<br />
auch auf Internetseiten.<br />
Lesen Sie auch das ausführliche Interview<br />
mit Jim Wasco, in dem er sich über seinen<br />
beruflichen Werdegang und die Neue<br />
Aachen äussert – www.linotype.com/de/7/<br />
schriftenmagazin.h<strong>tm</strong>l<br />
Informationen und Bestellung: www.fonts-pc-mac.ch<br />
oder franziska.brunner@heidelberg.com<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 171
Papier<br />
Papier – ein Blatt mit vielen Gesichtern<br />
EMC 2 -Team, Schwalbach (D)<br />
Es soll Informationen mehr oder weniger<br />
lange bereithalten. Doch tatsächlich gi<strong>bt</strong><br />
es heute mehr als 3000 verschiedene Sorten,<br />
deren Produktion extrem aufwendig ist.<br />
Seit seiner Erfindung vor etwa 2000 Jahren<br />
ist Papier heute längst nicht mehr nur Trägermedium,<br />
sondern erfüllt selbst zahlreiche<br />
Funktionen. Es kann Informationen<br />
besonders präzise wiedergeben oder die<br />
Echtheit von Informationen durch spezielle<br />
Sicherheitsmerkmale beglaubigen. Zudem<br />
kann es durch Temperatur-, Feuchtigkeitsund<br />
Lichtbeständigkeit sowie durch Reissfestigkeit<br />
besonders langlebig sein. Moderne<br />
Sorten haben Eigenschaften, als<br />
hätten sie die Forschungsa<strong>bt</strong>eilung eines<br />
Hightech-Unternehmens entwickelt.<br />
Papier ist konkurrenzlos<br />
Papier ist trotz voranschreitender Digitalisierung<br />
weiterhin der Informationsträger<br />
schlechthin. Neben Uhr und Computer bestimmt<br />
kaum eine andere Erfindung den<br />
Arbeitsalltag der Moderne so sehr wie<br />
dieses Material. Die Vision vom «papier-<br />
losen Büro» geistert seit über 30 Jahren<br />
durch die Öffentlichkeit – von ihrer Umsetzung<br />
sind wir entfernter denn je. Und dies,<br />
obwohl es mittlerweile zahlreiche Lösungen<br />
namhafter Software-Anbieter gi<strong>bt</strong>, die dabei<br />
helfen, Arbeitsabläufe zu vereinfachen, effizienter<br />
zu gestalten und Medienbrüche zu<br />
vermeiden. Dank PDF und digitaler Signatur<br />
könnten Abstimmungsprozesse innerhalb<br />
von Unternehmen, zwischen verschiedenen<br />
A<strong>bt</strong>eilungen oder Projektpartnern<br />
Holz wird mechanisch oder chemisch in seine Pflanzenfasern zerlegt. Anschliessend<br />
wird das pflanzliche Material mit reichlich Wasser vermengt. So entsteht ein Brei,<br />
den Experten simpel als «Stoff» oder «Zeug» bezeichnen. Das Ganze wird wieder auf<br />
einem Sieb entwässert. So entsteht ein Blatt Papier – ein auf den ersten Blick wenig<br />
aufregendes Material, das zum Beschreiben oder Bedrucken gedacht ist.<br />
mittlerweile rein elektronisch ablaufen.<br />
Und dennoch – die in Unternehmen, Verwaltungen<br />
und privaten Haushalten benötigte<br />
Papiermenge steigt konstant.<br />
Der Pro-Kopf-Papierverbrauch in Europa<br />
hat sich in den letzten 55 Jahren ve<strong>rsi</strong>ebenfacht.<br />
Mit rund 255 Kilogramm – etwa 100<br />
Packungen Druckerpapier – haben zum Beispiel<br />
die Deutschen pro Kopf im vergangenen<br />
Jahr mehr Papier verbraucht als Lateinamerika<br />
und Afrika zusammen. Diese Zahl<br />
ist auch ein Zeichen unseres Wohlstandes.<br />
Aber Hand aufs Herz: Können Sie sich ein<br />
«papierloses Leben» vorstellen? Das Ticket<br />
für die U-Bahn, die Tageszeitung für die<br />
Fahrt ins Büro, der 5-Euro-Schein für den<br />
grossen Kaffee mit Milch, Post-Its und<br />
Druckerpapier, Briefpapier für die Korrespondenz<br />
mit den Geschäftspartnern oder<br />
die gute alte Visitenkarte. Ohne die auf<br />
Papier aufgebrachten Informationen sähe<br />
unser Alltag entschieden anders aus.<br />
Papierherstellung früher – Ein zeitgenössischer<br />
Vers sagt werbewirksam über diese Maschine:<br />
«Mit fettdicht Pergamyn und Seiden führt<br />
Nummer sieben sich uns ein. Die beiden mach ich<br />
gerne leiden, weil sie im Griff so zart und fein;<br />
gewickelt ein in Pergamyn schmeckt´s Butterbrod<br />
noch mal so schön».<br />
Foto: Archiv Sappi Alfeld GmbH, Alfeld / Fotograf:<br />
unbekannt<br />
Papierhestellung heute – Die von Voith gelieferte<br />
Perlen PM 7 (Schweiz) produziert hochwertige<br />
Zeitungsdruckpapiere. Bei einer Produktionsgeschwindigkeit<br />
von bis zu 1900 m/min produziert<br />
die Anlage bis zu 360 000 Tonnen Papier pro Jahr.<br />
Foto: www.voith.com<br />
Zeig, was in dir steckt!<br />
Es sind nicht nur die Informationen auf dem<br />
Papier, die uns täglich begleiten. Auch das<br />
Papier selbst kann heute Botschaften übermitteln.<br />
Papiere mit Hightech-Funktionen<br />
kommen heutzutage beispielsweise in der<br />
Lebensmittelindustrie zum Einsatz: Fast alle<br />
Nahrungsmittel, die im Supermarkt erhältlich<br />
sind, müssen zum Schutz der Verbraucher<br />
mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum<br />
gekennzeichnet sein. Doch wenn Lager- und<br />
Transportvorschriften versagen, ist das Verfallsdatum<br />
kein zuverlässiger Indikator für<br />
die Frische von Lebensmitteln. Auf das<br />
Papier aufgebrachte RFID-Leiterbahnen<br />
bieten ein Vielfaches an Informationen über<br />
Inhalt oder Transportweg einer Verpackung.<br />
Deutlich günstiger, aber nicht minder Hightech-gemäss<br />
sind System-Etiketten aus Papier<br />
mit einer speziellen Farbe, die ebenfalls<br />
zusätzliche Funktionen übernehmen.<br />
Die für unterschiedliche Nahrungsmittel<br />
und Getränke konzipierten Indikatoren erfassen<br />
präzise die Frische des Produktes. Sie<br />
sind in Zeiten von Gammelfleischskandalen<br />
ein wirksames Alarmsignal, da sie sich bei<br />
Unterbrechung der Kühlkette und daraus<br />
resultierender Temperaturschwankung verfärben.<br />
Je nach Zustand zeigen sie die «Farben»<br />
von «frisch» über «noch zum Verzehr<br />
geeignet» bis «nicht mehr verzehrbar» an. In<br />
Zukunft könnten diese Indikatoren auch für<br />
die Kennzeichnung in der medizinischen<br />
<strong>Industrie</strong>, beispielsweise für Arzneimittel,<br />
Blutkonserven und Impfstoffe, eingesetzt<br />
werden.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 172
Papier Ein Blatt mit vielen Gesichtern<br />
Ein halbes Leben lang<br />
Doch nicht nur die zuverlässige Dokumentation<br />
der Haltbarkeit und Qualität von Arzneimitteln<br />
ist im medizinischen Bereich<br />
eine Herausforderung. In der Medizin werden<br />
in den verschiedensten Untersuchungen<br />
wertvolle Patientendaten gewonnen,<br />
die zu Dokumentationszwecken zum Teil<br />
über Jahre in der Patientenakte aufbewahrt<br />
werden und daher lesbar bleiben müssen.<br />
Hier kommen spezielle Thermopapiere zum<br />
Einsatz, auf denen das Schriftbild lichtbeständig<br />
ist und ohne zu verblassen erhalten<br />
blei<strong>bt</strong>. Bei Thermopapieren wird die Farbe<br />
nicht aufgedruckt. Stattdessen sind Farbbildner<br />
und Farbentwickler als funktionale<br />
Bestandteile auf der Druckseite integriert.<br />
Unter Wärmeeinwirkung wird ein physikalischer<br />
Schmelzvorgang erzeugt, durch den<br />
sich die haltbare Schrift entwickelt. So bleiben<br />
die Daten bis zu 25 Jahre lesbar. In der<br />
Notfallmedizin ist absolute Präzision gefragt,<br />
denn die schnelle Verfügbarkeit von<br />
Informationen über den Zustand eines Patienten<br />
und seine Krankengeschichte kann<br />
über Leben und Tod entscheiden. Die exakte<br />
Aufzeichnung der Ergebnisse aus EKGs und<br />
Ultraschalluntersuchungen ist daher unerlässlich.<br />
Spezialpapiere, die hier eingesetzt<br />
werden, eignen sich für besonders schnelle<br />
Drucker und zeigen ein einwandfreies<br />
Druckkopfverhalten sowie exzellente Druckergebnisse.<br />
So werden dank der richtigen<br />
Papiersorte die kostbaren Daten zuverlässig<br />
aufgezeichnet und wiedergegeben.<br />
New York, Rio, Tokio<br />
Auch auf Reisen kommt Hightech zum<br />
Einsatz – selbst wenn es dabei weniger um<br />
Präzision als vielmehr um Widerstands-<br />
fähigkeit geht. Ob Koffer oder Reisetasche,<br />
abhanden gekommenes Gepäck ist ein Ärgernis,<br />
wenn um liebgewonnene Mitbringsel<br />
oder um den Prototyp samt Bauanleitung<br />
gezittert werden muss. Um Gepäckverluste<br />
zu verhindern, setzen Fluggesellschaften daher<br />
auf zuverlässige und extrem haltbare<br />
Gepäckanhänger aus Thermopapier. Auf<br />
diese wird direkt am Check-in-Schalter ein<br />
Barcode aufgedruckt, der sämtliche Passagierdaten<br />
enthält. Das funktioniert kostengünstig,<br />
jedoch vor allem einfach und<br />
schnell, weshalb sich elektronische Speicherchips<br />
bisher nicht behaupten konnten.<br />
Die robusten Etiketten trotzen Hitze, Kälte<br />
und Feuchtigkeit auf den Rollfeldern der<br />
Welt und bleiben auch bei noch so unsensibler<br />
Behandlung am Koffer kleben. Sie<br />
identifizieren zuverlässig das Gepäckstück,<br />
den dazugehörigen Reisenden und den Bestimmungsort.<br />
Nur ein Koffer von 10 000<br />
verloren gegangenen verschwindet für immer,<br />
die meisten können innerhalb der<br />
nächsten 24 Stunden mittels dieses Etiketts<br />
identifiziert und an ihren Bestimmungsort<br />
gebracht werden. Auch Eintrittskarten für<br />
Veranstaltungen, Flugtickets und Fahrkar-<br />
ten, die in der Bahn gekauft werden, sind<br />
auf Thermopapier gedruckt. Sie müssen<br />
nicht nur haltbar, sondern vor allem fälschungssicher<br />
sein. Dazu werden Sicherheitsmerkmale<br />
mitunter direkt in die Struktur<br />
des Papiers eingebracht. Dies sind<br />
beispielsweise Melierfasern, die unter ultraviolettem<br />
Licht leuchten. Bei sogenannten<br />
Scratch-Tickets, die als Konzertkarten verwendet<br />
werden, ist zusätzlich zur Perforation<br />
ein Farbstoff im Papier integriert. Der<br />
Abschnitt der Eintrittskarte verfär<strong>bt</strong> sich<br />
beim Entwerten und bestätigt die Echtheit<br />
des Dokuments.<br />
Von wegen Wegwerfgesellschaft<br />
Nicht immer kommt es darauf an, Informationen<br />
über Jahre aufzubewahren oder spezifische<br />
Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.<br />
Papier wird in jedem Büro vor allem in<br />
seiner simpelsten Form – beispielsweise als<br />
Kopier- und Druckerpapier – benötigt. Viele<br />
Dokumente wie E-Mails oder Korrekturabzüge<br />
werden im Arbeitsalltag häufig nur für<br />
einen sehr kurzen Gebrauch ausgedruckt<br />
und danach nicht mehr benötigt. Zum<br />
Wohle der Umwelt hat sich mittlerweile in<br />
vielen Ländern die Wiederverwertung des<br />
Rohstoffs Papier durchgesetzt: Mit einer Altpapiereinsatzquote<br />
von 67 Prozent ist die<br />
deutsche Papierindustrie führend. Dabei<br />
wird nicht nur der Rohstoff mehrfach ver-<br />
Herzlichen Dank der EMC Corporation für die<br />
Abdruckrechte.<br />
Die EMC Corporation bietet Produkte und<br />
Services, die Menschen und Unternehmen auf<br />
der ganzen Welt dabei helfen, durch die Erstellung<br />
von Informationsinfrastrukturen und<br />
virtuellen Infrastrukturen vom maximalen<br />
Nutzen ihrer Informationen zu profitieren.<br />
Viele Angebote von EMC – aus Bereichen wie<br />
Netzwerkspeicher, Backup und Recovery von<br />
Daten, Backup-Management, Datenarchivierung,<br />
Security, Backup mit Datendeduplizierung,<br />
Datenkonsolidierung, Datenreplikation,<br />
Content-Management und Informationssicherheit<br />
– ermöglichen Unternehmen die<br />
Nutzung des Informationsmanagements der<br />
nächsten Generation und damit den Wandel<br />
zum Private-Cloud-Computing.<br />
Derzeit beschäftigt EMC rund 53 500 Mitarbeiter<br />
weltweit, 40 Prozent davon ausserhalb<br />
der USA. Die 1993 gegründete EMC Computer<br />
Systems AG mit Hauptsitz in Zürich und<br />
Geschäftsstellen in Bern und Gland/VD betreut<br />
gemeinsam mit Partnern und ihren mehr<br />
als 200 Mitarbeitern mehr als 400 Kunden.<br />
EMC Computer Systems<br />
www.emc2.ch<br />
wendet, auch benötigt man dafür weniger<br />
Energie und Wasser. Ohne frische Fasern<br />
funktioniert der Kreislauf jedoch nicht,<br />
denn nach sechs bis sieben Durchläufen<br />
verbinden sich die Papierfasern nicht mehr.<br />
Es gi<strong>bt</strong> aber auch Innovationen, die eine<br />
neue Art des Recyclings ermöglichen: Die<br />
Forschungsa<strong>bt</strong>eilung eines Druckerpapierherstellers<br />
ist dabei, ein Spezialpapier mit<br />
besonderen Eigenschaften zu entwickeln,<br />
das sich mehrfach bedrucken lässt. Das<br />
«Erasable Paper» ist mit einer speziellen<br />
Beschichtung versehen, die unter Einfluss<br />
von Licht und Wärme ihre Konsistenz verändert<br />
und die aufgedruckten Buchstaben<br />
im Laufe des Tages verblassen lässt. Nach<br />
maximal 24 Stunden ist es bereits wieder<br />
verwendbar. Die Forscher haben auch den<br />
Prototypen des passenden Druckers entwickelt,<br />
der das lichtempfindliche Papier<br />
beschreiben kann. Damit setzt in naher<br />
Zukunft der Recyclingprozess schon direkt<br />
im Büro an.<br />
Mehr Papier aus dem gleichen Baum<br />
Holz ist kostbar – nicht zuletzt für die Umwelt.<br />
Deshalb baut die Papierindustrie schon<br />
lange Holz gezielt für die Papierproduktion<br />
an. Doch das ist nicht alles. Darüber hinaus<br />
bemüht sich die Branche nachdrücklich, die<br />
Herstellungsverfahren zu optimieren und<br />
den nachwachsenden Rohstoff noch effi-<br />
zienter einzusetzen. So kann aus einem<br />
Baum heute doppelt so viel Papier hergestellt<br />
werden wie mit traditionellen Verfahren.<br />
Zudem bedarf es für die Herstellung der<br />
neuen Sorte in einer mit erneuerbaren Energien<br />
betriebenen Anlage weit weniger<br />
Chemikalien und Wasser als früher. Der<br />
gesamte Prozess soll so die Treibhausgasemissionen<br />
um rund 75 Prozent im Vergleich<br />
zu traditionellen Abläufen reduzieren.<br />
Das «Superpapier» der Zukunft?!<br />
Aber es sind für die Zukunft auch noch andere<br />
Modelle denkbar. Ein «Superpapier»,<br />
das sowohl wiederverwendbar als auch<br />
durch Feuerfestigkeit nahezu unzerstörbar<br />
ist und zugleich nicht aus Holzfasern besteht,<br />
wäre an Hightech-Funktionalität kaum<br />
zu überbieten. Das Beste daran ist: Diese<br />
Vision ist schon Realität. Denn der amerikanische<br />
Forscher Ryan Tian und seine Kollegen<br />
haben ein Papier entwickelt, das nicht<br />
aus pflanzlicher Zellulose besteht. Ausgangsstoff<br />
ist stattdessen das mineralische Pigment<br />
Titandioxid. Dies ist ungiftig, preiswert<br />
und kommt schon heute beispielsweise<br />
in Sonnencremes, als weisses Farbpigment<br />
in Lacken oder als Lebensmittelzusatzstoff<br />
zum Einsatz. Daraus können weisse Fasern<br />
gewonnen werden, die in jede Form – ob<br />
DIN A4 oder Notizzettel – gepresst und wie<br />
profanes Drucker- und Kopierpapier eingesetzt<br />
werden können. Und das Recyceln<br />
funktioniert so einfach wie bei Papier aus<br />
pflanzlichem Rohstoff.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 173
Nigglis Buchbesprechung<br />
Grundlagen der Gestaltung – Von wem? Für wen?<br />
Grundlagen der Gestaltung zeigt die vielschichtigen<br />
Wege kreativer Prozesse<br />
auf, indem das dafür nötige Handwerkszeug<br />
anschaulich beschrieben und vermittelt<br />
wird. Dargestellt werden ers<strong>tm</strong>als die entscheidenden<br />
Wahrnehmungsstandpunkte,<br />
unter denen sich Prozesse, Projekte und Produkte<br />
analysieren und thematisieren lassen.<br />
Egal, ob es sich um das Entwickeln einer<br />
Schrift, ein urbanistisches Konzept, ein<br />
Erscheinungsbild, Kunst am Bau, Design,<br />
Kommunikation oder Forschung handelt –<br />
die genaue Wahrnehmung definiert die Problemstellung,<br />
woraus sich mithilfe unterschiedlicher<br />
Methoden mögliche Lösungen<br />
entwickeln: gegenständlich, realistisch, sinnhaft,<br />
kreativ, brauchbar. Welche Möglichkeiten<br />
gi<strong>bt</strong> es und welche Bedingungen sind zu<br />
berücksichtigen?<br />
Für Architekten, Designer aller Couleur,<br />
Informatiker, Fotografinnen, Grafikerinnen<br />
und Typografen, Art Directors, Texter, Vermittler,<br />
Verantwortliche im Kulturmanagement,<br />
Studierende und Dozierende, Projektleiter<br />
und Künstlerinnen – kurz: kreative<br />
Menschen – dafür sind die Grundlagen der<br />
Gestaltung gemacht.<br />
In mehr als siebenjähriger Forschungs- und Recherchearbeit hat der Autor André<br />
Vladimir Heiz unzählige Fallbeispiele und Projektdarstellungen aus Ateliers und<br />
persönlichen Archiven zusammengetragen. Die Grundlagen der Gestaltung sind also<br />
von Gestaltern für Gestalter entwickelt und realisiert worden – im Hinblick auf ihre<br />
Gewohnheiten und Bedürfnisse.<br />
Der Autor<br />
Seit seinem «Satz zum Gesamtkunstwerk»<br />
für Harald Szeemann setzt André Vladimir<br />
Heiz Zeichen – in Wort und Bild: Ausstellungen,<br />
Romane, Lyrik und zahlreiche Essays<br />
über Typografie, Fotografie, Design, Medien<br />
und Kunst zeigen das.<br />
Er promovierte an der Unive<strong>rsi</strong>tät Zürich<br />
und widmete sich an der EHESS, Paris, der<br />
Analyse visueller Zeichen. Als Designforscher<br />
der ersten Stunde unterrichtete er unter<br />
anderem an der Zürcher Hochschule der<br />
Künste (ZHdK), der Hochschule der Künste<br />
Bern (HKB), an der ENSBA in Lyon und ist<br />
heute Dozent an der renommierten Ecole<br />
cantonale d’art de Lausanne (ECAL).<br />
André Vladimir Heiz<br />
Grundlagen der Gestaltung<br />
4 Bände im Schuber<br />
1436 Seiten (Bd.1: 388, Bd.2: 372, Bd.3: 304,<br />
Bd.4: 372)<br />
Buchformat: 16,3 x 23 cm<br />
Schuber: 17 x 25,5 x 13 cm<br />
Broschur, deutsch<br />
CHF 168.–, Euro (D) 133.–, Euro (A) 136.70<br />
ISBN 978-3-7212-0805-4<br />
Bestellen:<br />
Niggli Verlag I Steinackerstrasse 8 I CH-8583 Sulgen<br />
Tel. +41 71 644 91 11 I Fax +41 71 644 91 90<br />
info@niggli.ch I www.niggli.ch<br />
Für alle Leserinnen<br />
der TM/FGI gi<strong>bt</strong> es bei<br />
Bestellungen auf diesen<br />
Titel 20% Rabatt –<br />
gilt bis zum 31.10.2012<br />
www.niggli.ch<br />
Portofreie Lieferung<br />
in Europa<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 174
Unternehmen, Produkte, Service<br />
Speedmaster SM 52-4+L für A. Boss + Co AG<br />
Für ihre anspruchsvollen Druckaufträge aus dem<br />
eigenen ABC-Kartenverlag und aus dem Akzidenzgeschäft<br />
hat die A. Boss + Co AG (Urtenen-Schönbühl)<br />
in eine Speedmaster SM 52-4+L investiert.<br />
Gemäss dem Produktionsleiter Jürg Gosteli fiel die<br />
Wahl auf eine Druckmaschine mit überragenden technischen<br />
Qualitäten und einem überzeugenden Preis-<br />
Leistungs-Verhältnis. Zudem setzt die A. Boss + Co AG<br />
auf einen Lieferanten, dessen Service-Leistungen seit<br />
vielen Jahren anerkannt und geschätzt sind.<br />
Die Vierfarbenmaschine mit Kammerrakellackierwerk<br />
verfügt über alle Automatismen, die schnelle Rüstvorgänge<br />
und eine effiziente Weiterverarbeitung begünstigen.<br />
Neben frei wählbaren Waschprogrammen für<br />
Farb-/Feuchtwalzen, Gummitücher und Gegendruckzylinder<br />
und dem Plattenwechsler Autoplate bilden<br />
die prozessorientierte Bedienerführung Intellistart<br />
und die im Leitstand Prinect Press Center integrierte<br />
Farbregelanlage Prinect Easy Control zwei Schlüsselkomponenten<br />
für den Produktivitätszuwachs.<br />
Die A. Boss + Co AG wählt Heidelberg: der Produktionsleiter<br />
Jürg Gosteli (links), sein Stellvertreter Harry<br />
Steiner (Mitte) und das Drucktechnologenteam, mit<br />
Ruedi Schulthess, Heidelberg Schweiz AG (rechts).<br />
Bei der Hertig+Co. AG wird erneut investiert<br />
Kurz vor Weihnachten 2011 investierte die<br />
Hertig+Co. AG in Lyss in eine Speedmaster SM 52-<br />
4. Soeben folgte der nächste Modernisierungsschritt.<br />
Im Juni ging anstelle einer älteren Speedmaster SM<br />
102-2-P eine moderne Maschine gleicher Bauweise in<br />
Betrieb. Die Wendemaschine ist das zuverlässige Arbeitspferd<br />
für die Produktion beidseitig bedruckter<br />
Packungsbeilagen auf 40-Gramm-Papier. Im insgesamt<br />
Walter Siegrist, Geschäftsleiter Hertig+Co. AG, Peter<br />
Berner, Direktor und Delegierter des Verwaltungsrates<br />
der Merkur Druck Gruppe und Ruedi Schulthess, Heidelberg<br />
Schweiz AG (v.l.), vor der neuen 40-Gramm-<br />
Wendespezialistin, einer Speedmaster SM 102-2-P.<br />
18 Druck- und Lackierwerke von Heidelberg zählenden<br />
Maschinenpark bildet die Zweifarbenmaschine<br />
für die Drucktechnologenlehrlinge zudem das ideale<br />
Lernwerkzeug bei der Aneignung der Kompetenzen zur<br />
selbstständigen Arbeit im Bogenformat 70 x 100 cm.<br />
Mit dem Kauf der Speedmaster SM 102-2-P<br />
bekräftigt die Merkur Druck Gruppe, zu welcher<br />
die Hertig+Co. AG seit Frühjahr 2011 gehört,<br />
ihr Bekenntnis zum wichtigen Standort Lyss.<br />
www.ch.heidelberg.com<br />
ictjobs.ch – neues Stellenportal für die<br />
Informatikbranche<br />
medienjobs.ch, der spezialisierte Online-Stellenmarkt<br />
der Medien- und Kommunikationsbranche,<br />
und die auf Informatik spezialisierte Online-Zeitung<br />
inside-it.ch tun sich zusammen und lancieren heute<br />
gemeinsam ictjobs.ch.<br />
ictjobs.ch ist das erste von Personaldienstleistern unabhängige<br />
IT-Stellenportal für Fach- und Führungskräfte<br />
sowie Arbeitgeber aus allen Bereichen der Informatik<br />
und Telekommunikation, von IT-Management<br />
über Beratung/Consulting, Software-Entwicklung,<br />
Systemengineering/Systemintegration, System-/<br />
Netzwerktechnik/Security/VoiP, Support/IT-Services<br />
bis hin zu Webpublishing und Webdesign. Die Stellenangebote<br />
von ictjobs.ch sind zusätzlich auf insideit.ch<br />
als eigene Service-Rubrik integriert. Zudem werden<br />
die Stellenangebote von ictjobs.ch auch auf medienjobs.ch<br />
abgebildet.<br />
www.medienjobs.ch<br />
Buchbinderei Scherrer AG bestellt bei Gramag<br />
Mit Investitionen im Jahresrhythmus hält die<br />
Buchbinderei Scherrer AG in Urdorf ihren Maschinenpark<br />
auf technisch modernstem Niveau.<br />
Hansjürg Scherrer mit seinem Bruder Peter und Sohn<br />
Michael (1., 3. und 4. von links) sowie Rolf Müller<br />
(Gramag), vor der neuen MBO K800.2 KTZ.<br />
Soeben erhielt mit einer Kombifalzmaschine MBO<br />
K800.2 KTZ und einem Achttaschenfalzautomaten<br />
von Herzog + Heymann der Falzmaschinenpark eine<br />
Erneuerung. Damit zählt die 32-köpfige Buchbinderei<br />
insgesamt neun Falzmaschinen der Marken MBO und<br />
Herzog + Heymann. Mit zwei neuen Palamides Alpha<br />
700 und einer Alpha 500 wurde auch im Auslagebereich<br />
für ein bewährtes Produkt aus dem Portfolio der<br />
Gramag Grafische Maschinen AG entschieden.<br />
www.gramag.ch<br />
Fogra-Anwenderforum UV-Druck<br />
Die Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. veranstaltet<br />
in München am 30. und 31. Oktober 2012<br />
ihr sie<strong>bt</strong>es Anwenderforum rund um den UV-Druck.<br />
Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass der Stellenwert<br />
des UV-Drucks weiter ansteigt. So bietet die<br />
schnelle Härtung in Verbindung mit dem erzielbaren<br />
hohen Glanz der Lackierungen vielfältige und konkurrenzlose<br />
Möglichkeiten zur Veredelung der Druckprodukte.<br />
Damit kann ein Druckbetrieb, der mit der UV-<br />
Trocknung arbeitet, Nischen besetzen bzw. neu schaffen,<br />
in denen Qualität und nicht nur der Preis an<br />
oberster Stelle steht.<br />
www.fogra.org<br />
drupa 2012 – Ein voller Erfolg für Canon<br />
Canon und Océ haben auf rund 3750 m2 ihr vereintes<br />
Portfolio in acht marktspezifischen Zonen präsentiert.<br />
Auf der diesjährigen drupa brachte insbesondere<br />
die Canon (Schweiz) AG den Besuchern das<br />
Thema Crossmedia in Form der Produktion von<br />
Web-TV näher.<br />
Canon und Océ präsentierten an der drupa das branchenweit<br />
umfangreichste Sortiment an Lösungen für<br />
den Produktionsdruck – angefangen bei den Varioprint<br />
Ultra-Produktionssystemen, über Wide Format<br />
Systeme hin zum gesamten Lösungsportfolio in den<br />
Bereichen Crossmedia Workflow Colour Management<br />
und VDP.<br />
Speziell mit Velocity, einem Printsystem, das bis zu<br />
500 A0-Drucke pro Stunde ausgi<strong>bt</strong> und dem Océ<br />
ColorWave 650 Poster Printer, der sich an den Pointof-Sale<br />
Markt richtet, bot Canon den Besuchern neue<br />
Innovationen, Anregungen und Perspektiven. Fachleute<br />
aus aller Welt besuchten den Canon-Stand, um<br />
die Trends von morgen zu sehen und zu erleben.<br />
www.canon.ch<br />
Bizerba BRL90-Etikett Thermoetikett<br />
Das Bizerba Etikettenwerk in Bochum produziert<br />
Thermoetiketten, die für den Einsatz in besonders<br />
rauen Umgebungen konzipiert sind.<br />
Das BRL90-Etikett kann vollständig oder teilweise lackiert<br />
werden. Bilder, Schriften und Barcodes sind somit<br />
bestens geschützt vor Wasser, Fett, Lösungsmitteln<br />
und UV-Licht und halten Temperaturen von bis<br />
zu minus 40° Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von<br />
bis zu 80 Prozent stand. Für eine ausreichende Haftung<br />
sorgt ein breites Spektrum an Klebstoffen, das<br />
unter anderem Tiefkühl- und Permanentklebstoffe<br />
umfasst.<br />
www.bizerba.com<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 175
Niggli – Compte rendu<br />
Les bases de la création: une visite de chantiers<br />
Les bases de la création vous offrent des<br />
outils et des méthodes fiables et viables<br />
du savoir-faire. D’emblée le regard et le<br />
point de vue entrent en jeu. Faire «quelque<br />
chose» en émane, forme et substance sous<br />
la main et sous les yeux. Les techniques et<br />
les concepts, les visualisations, médiatisations<br />
et matérialisations en découlent. Les<br />
états et les étapes se dessinent à portée de la<br />
main.<br />
Les bases de la création remontent à ce<br />
moment crucial où des décisions artistiques<br />
s’imposent. D’une idée initiale à une réalisation<br />
pertinente. Pourquoi et comment?<br />
Face aux conditions qui s’inscrivent dans<br />
les processus et dans le développement de<br />
vos projets, les bases de la création font le<br />
tour des possibilités idéelles et réelles qui se<br />
présentent au carrefour de la perception et<br />
de la production, du ça-voir et du faire.<br />
Cette anatomie ou grammaire du savoirfaire<br />
touche à tous les domaines de la création.<br />
Sans œillères idéologiques les mots et<br />
les images se mettent au service de la pratique<br />
et de la théorie, exemples à l’appui. Sur<br />
mesure, ces bases de la création sont faites<br />
pour les étudiantes et étudiants, les architectes<br />
et urbanistes, les designers et graphistes,<br />
les photographes et typographes, les concepteurs<br />
et médiateurs, les artistes et artisans,<br />
bref: pour la communauté des créateurs et<br />
créatrices.<br />
Sept ans de recherche passionnante et passionnée en quête des observations et<br />
des questions pertinentes. Les exemples et des propositions concrètes sont mis en<br />
évidence. Des solutions à l’horizon d’une application personnelle affichent couleur.<br />
Aimer faire et faire aimer, tout est là, quelle que soit la problématique artistique.<br />
Les bases de la création ont leur place dans chaque atelier.<br />
L‘Auteur<br />
Auteur et sémioticien,<br />
André Vladimir<br />
Heiz enseigne et écrit.<br />
Des romans et nombre<br />
de publications<br />
consacrées aux enjeux<br />
des signes et des médias, du design et de l’art<br />
en témoignent. Ses cours et ateliers de<br />
recherche au sein d’écoles d’art mettent les<br />
approches théoriques et esthétiques au diapason<br />
de la création.<br />
Après un doctorat à l’Unive<strong>rsi</strong>té de Zurich,<br />
un passage remarqué dans l’univers de la<br />
publicité et de l’opéra, il fit des études de<br />
sémiotique à l’EHESS à Paris sous la direction<br />
d’Algirdas Julien Greimas. Il a dirigé –<br />
entre autres – le département Communication<br />
visuelle à la HdK de Zurich, a animé des<br />
séminaires à l’ENSBA de Lyon et enseigne<br />
actuellement à l’ECAL.<br />
André Vladimir Heiz<br />
Les Bases de la création<br />
4 volumes sous emboîtage<br />
1408 pages, Format du livre: 16,3 x 23 cm,<br />
Emboîtage: 17 x 25,5 x 13 cm, Broché, français<br />
CHF 168.–, Euro (D) 133.–<br />
ISBN 978-3-7212-0839-9<br />
Niggli Verlag I Steinackerstrasse 8 I CH-8583 Sulgen<br />
Tel. +41 71 644 91 11 I Fax +41 71 644 91 90<br />
info@niggli.ch I www.niggli.ch<br />
Pour tous les<br />
lecteurs de la RSI/BT,<br />
20% de rabais pour<br />
une commande jusqu’au<br />
31 octobre 2012<br />
www.niggli.ch<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 176<br />
Livraison franco<br />
domicile en Europe<br />
désigner, marquer, mentionner… …signifier!<br />
objet secondaire<br />
fonction<br />
relation<br />
forme<br />
objet premier<br />
identité visuelle<br />
propriétés<br />
marques distinctives<br />
imaginations<br />
Images intérieures<br />
Désir<br />
Besoin, nécessité<br />
représentations<br />
Matérialisations<br />
Médiatisations<br />
Produits, résultats<br />
Situations<br />
noyau<br />
dénotation<br />
Dénominateur commun<br />
Qualités<br />
Caractéristiques<br />
enveloppe<br />
connotations<br />
Images<br />
Imaginations<br />
identité primaire<br />
identité secondaire
Commentaire<br />
Vacances en région instable<br />
Ne parlons déjà plus de la Grèce. Voilà<br />
que nous avons récemment – dixit le<br />
conscience collective nord européenne –<br />
libéré les grecs du joug ottoman, leur avons<br />
donné un roi, envoyé Lord Byron les voir,<br />
renommé des instituts pédagogiques en<br />
«Gymnase» et seriné des générations entières<br />
de grecque, d’Alpha à Omega, respectivement<br />
d’Aristote à Onassis. Et voilà que<br />
non seulement ils nous pèsent sur la bourse,<br />
mais nous mettent également sur la paille.<br />
Bon, nous sommes bien sûr en Suisse, donc<br />
pas vraiment en Europe, mais cela n’empêche<br />
que nous avons tout de même le droit<br />
de branler du chef d’un air préoccupé à la<br />
lecture quotidienne des journaux.<br />
Mais même si nous faisons abstraction des<br />
grecs, il nous reste l’une ou l’autre de nos<br />
destinations de villégiature où la croissance<br />
cafouille, l’économie vacille et les emprunts<br />
d’état offrent des taux d’intérêt plus élevés<br />
que les Junk bonds américains avant 2008.<br />
Chaque partie prenante économique qui se<br />
respecte vaticine de la Grèce à l’Italie, en passant<br />
par le Portugal et l’Espagne, et prophétise<br />
aux pays du Sud des futurs plus noirs les<br />
uns que les autres.<br />
Bon, mais j’y étais et je peux vous le dire:<br />
le soleil brille comme d’habitude. Il fait<br />
chaud. Seuls les touristes continuent à ce promener<br />
à midi. Les gens sont aimables. L’Euro<br />
reste encore un moyen de paiement généralement<br />
reconnu et est encaissé avec plaisir. Et<br />
parce que mon espagnol est rudimentaire,<br />
mon portugais quasiment inexistant et mon<br />
italien modeste, non seulement la majeur<br />
partie du temps je ne comprenais pas le mot<br />
crise, mais qui plus est, pas un mot du tout.<br />
Kurt Mürset, Bâle / Traduction: Norbert Li-Marchetti, Berne<br />
Banques pratiquement en banqueroute, économies nationales foutues, l’Europe un<br />
gros mot, le Sud une zone entière sinistrée – qui pourrait encore penser à faire des<br />
vacances? Moi, par exemple. Ci-dessous mon coup d’œil.<br />
Trêve de plaisanteries! Ce que j’ai vu, sont<br />
de nombreux projets d’infrastructure financés<br />
par l’UE. J’ai bien sûr pu profiter de quelques-uns<br />
de ceux-ci pendant mes vacances.<br />
De projets environnementaux tels qu’un chemin<br />
de randonnée dans les dunes, en passant<br />
par des trains modernes jusqu’à des musées<br />
et des centres culturels. C’était au Portugal et<br />
en Espagne.<br />
Ce faisant, l’histoire de l’Italie m’a traversé<br />
l’esprit. Des historiens sérieux démontrent<br />
comment, après l’unification politique, l’industrialisation<br />
du Nord a pris son essor au<br />
dépend du Sud agraire. On trouve aujourd’hui<br />
dans le Nord des brailleurs qui aimeraient se<br />
débarrasser de ce Sud. Histoire ou contexte,<br />
qu’importe – ceux-là, là en bas, restent feignants,<br />
corrompus et incapables. Cette dernière<br />
façon de penser ne s’est pas seulement<br />
incrustée dans les têtes nord italiennes, elle<br />
est devenue entre-temps un article d’exportation<br />
et s’est disséminée de nos jours dans<br />
toute l’Europe.<br />
Mais restons-en à notre premier raisonnement.<br />
Même si celui-ci exige un peu plus<br />
d’activité cérébrale. Reportons l’exemple italien,<br />
de manière simplement théorique, sur<br />
toute l’Europe. Vu ainsi, le chemin de randonnée<br />
dans les dunes à Praia de Ancora et<br />
le musée à Guimarães seraient une sorte de<br />
remboursement. Une sorte de compensation<br />
pour toutes les marchandises onéreuses que<br />
le Sud achète au Nord, respectivement tous<br />
les produits bon marché que le Nord achète<br />
au Sud. Ou alors nous l’appelons une réparation.<br />
Car en effet, tel le souriceau devant le<br />
serpent, l’Europe politique a fixé son regard<br />
figé pendant de longues décennies vers<br />
l’Est.<br />
Vous pouvez bien sûr me reprocher maintenant<br />
d’être beaucoup trop naïf. Après tout,<br />
il est de notoriété publique que les états du<br />
Sud ont perfectionné l’arnaque à Bruxelles.<br />
Vous pouvez bien sûr dire de moi que je ne<br />
suis qu’un usager des vols soldés, qui compare<br />
le prix de la bière et qui en conclu que<br />
le coût de la vie, ici, au soleil, est bien bas.<br />
Vous pouvez aussi raconter, si cela vous chante,<br />
que je suis un rêveur à moitié gauchiste<br />
qui ne veut toujours pas croire que tous les<br />
hommes naissent avec les mêmes chances. Et<br />
peut-être que vous avez raison. Mais réfléchir<br />
un peu au-delà de son pré carré ne peut pas<br />
faire de mal. Et parfois, même un court-circuit<br />
n’est pas tout à fait inutile.<br />
Je ne voudrais pas vous cacher l’une des<br />
expériences vécues pendant mes vacances.<br />
J’ai été témoin d’une véritable grève de<br />
mineurs. Jusqu’à ce moment-là, je ne savais<br />
pas du tout qu’il existait encore des mines<br />
dans les Asturies et en Castille. Et puis j’ai vu<br />
les manifestations de solidarité pour les travailleurs<br />
en grève. Le slogan était «Nous sommes<br />
tous des mineurs» – une phrase on ne<br />
peut plus remarquable. Et même en prenant<br />
le risque de passer pour un peu arrogant:<br />
c’était comme par le passé.<br />
J’ai vécu un avenir possible peu après. Sur<br />
le bateau qui me transportait de Barcelone à<br />
Gênes. Le ferry commence son voyage au<br />
Maroc. A bord, beaucoup de marocains qui<br />
travaillent en Italie. En route pour un avenir<br />
meilleur. Donc, pour ses gens-là, le Sud de<br />
l’Italie se situe déjà dans le grand Nord!<br />
Photos: le logo de la Capitale de la Culture 2012<br />
– Guimarães, ensemble avec Maribor en Slovénie,<br />
est Capitale culturelle de l’Europe 2012<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 177
Impression sur métal<br />
Le métal – un support d’impression<br />
pas comme les autres<br />
Le fer blanc peut prendre bien d’autres formes<br />
encore: bombe aérosol pour le rasage<br />
quotidien, pot pour le rasage quotidien, pot<br />
pour peintures et vernis, boîte de biscuits<br />
pour le café du dimanche, boîte à tabac pour<br />
les fumeurs, jouets pour enfants, couvercle<br />
de pot de confi ture, capsule de canette de<br />
bière et boîte de chocolats en forme de cœur<br />
à offrir à sa bien-aimée.<br />
Tout commence par un ruban d’acier . . .<br />
La boîte en métal naît dans une aciérie. Un<br />
ruban d’acier est laminé pour o<strong>bt</strong>enir l’épaisseur<br />
requise, entre 0,12 et 0,49 mm selon<br />
les applications. Afin de réduire le poids et<br />
d’économiser le matériau, l’épaisseur est<br />
même de plus en plus souvent réduite à<br />
0,1 mm. Le ruban est cisaillé à la longueur<br />
désirée, puis découpé en plaques rectangulaires.<br />
Là où l’on parlerait pour du papier de<br />
format 4 ou grand format, les imprimeurs<br />
sur métal se contentent de chiffres bruts:<br />
largeur maximale de 1200 mm et longueur<br />
Derrick Straka, kba-metalprint, Stuttgart (D)<br />
La boîte en fer blanc évoque celle attachée avec une fi celle à la voiture des mariés,<br />
celle empilée dans les rayons du supermarché, que l’on saisit adroitement en ayant<br />
soin de choisir la plus attrayante, ou encore la boîte cabossée qui sert de vide-poches<br />
sur un bureau. La valorisation des boîtes métal par l’impression est la spécialité de<br />
KBA MetalPrint à Stuttgart.<br />
maximale de 1000 mm. Le poids d’une<br />
plaque atteint rapidement un kilo et demi,<br />
voire plus.<br />
. . . qui est ensuite verni . . .<br />
Ces plaques sont tout d’abord vernies par<br />
l’imprimeur. Il peut s’agir d’un vernis or<br />
pour l’intérieur de la boîte, qui fera fonction<br />
de barrière de protection entre le métal et le<br />
contenu, ou d’un vernis blanc, utilisé pour<br />
des raisons esthétiques pour les boîtes de<br />
tomates. L’intérieur des boîtes de biscuits<br />
n’est pas verni, les produits étant généralement<br />
conditionnés sous plastique. La dépose<br />
du vernis sur le métal s’effectue au moyen<br />
de vernisseuses spécialement conçues pour<br />
cette application, la précision constituant à<br />
cet égard un critère décisif. D’une part,<br />
l’épaisseur de la couche doit être ajustable<br />
très précisément de manière à minimiser la<br />
consommation de vernis et à réduire les<br />
coûts, et d’autre part, la couche de vernis<br />
doit être homogène afin d’éviter des pro-<br />
blèmes de qualité ultérieurs. Après le vernissage,<br />
les plaques passent dans un tunnel de<br />
séchage fonctionnant en continu où elles<br />
sont cuites par de l’air à 200 °C. Le séchage<br />
dure en général douze minutes.<br />
. . . et enfin imprimé<br />
On peut alors passer à l’impression proprement<br />
dite. Les exigences concernant la qualité<br />
d’impression sont très élevées car la<br />
boîte est un emballage qui doit inciter le<br />
consommateur à l’achat en quelques fractions<br />
de seconde. Toutes les boîtes métal<br />
sont par conséquent imprimées en offset.<br />
Les canettes de bière et autres boissons<br />
constituent une exception: pour des raisons<br />
de coûts, l’impression s’effectue directement<br />
sur les boîtes rondes, les exigences<br />
graphiques étant dans ce cas bien moindres.<br />
L’impression sur métal remonte à la<br />
fin du XIX è siècle. Fondée en 1867 à Bad<br />
Canstatt, l’usine de machines d’imprimerie<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 178
Entrée du sécheur<br />
Mailänder existe toujours: entrée dans le<br />
giron de KBA-MetalPrint, la filiale de KBA à<br />
Stuttgart, elle met au point des presses offset<br />
spéciales pour l’impression sur métal. Le<br />
procédé est très différent de l’impression<br />
sur papier – non seulement du fait de la<br />
rigidité du matériau, qui exige une grande<br />
résistance de la machine, mais aussi parce<br />
que l’encre ne peut pas pénétrer dans le support<br />
d’impression. L’encre restant humide à<br />
la surface des plaques, le conducteur doit<br />
faire preuve de beaucoup de doigté pour<br />
parvenir à un réglage optimal de l’eau de<br />
mouillage et des paramètres d’impression<br />
de manière que l’encre adhère au substrat.<br />
L’imperméabilité du support d’impression<br />
constitue d’ailleurs une qualité essentielle<br />
du produit fini. À l’abri de l’air, les aliments<br />
ainsi conditionnés peuvent, après appertisation,<br />
se conserver longtemps sans ajout de<br />
conservateurs. Le métal empêche aussi la<br />
pénétration de contaminants extérieurs.<br />
Comme à l’issue du vernissage, la plaque<br />
imprimée encore humide est ensuite séchée<br />
dans un tunnel de séchage, cette fois à<br />
Impression sur métal Le métal – un support d’impression pas comme les autres<br />
160 °C seulement. L’utilisation d’encres UV,<br />
permettant un séchage rapide au moyen de<br />
lampes UV, est également possible. Enfin,<br />
lors d’une dernière étape, les plaques imprimées<br />
sont de nouveau vernies. Le vernis de<br />
protection transparent appliqué évite les<br />
rayures et confère un effet brillant à l’ensemble.<br />
Au cours de cette même étape de process,<br />
les plaques pour le fond et le couvercle<br />
des boîtes sont vernies et éventuellement<br />
imprimées.<br />
On peut ensuite passer à l’étape suivante.<br />
Les plaques terminées sont découpées ou<br />
estampées. Les flans sont ensuite mis en<br />
forme et soudés (la soudure est visible sur<br />
le côté de la boîte finie), le fond et le couvercle<br />
sont fixés par sertissage. Ceci après<br />
avoir, bien entendu, préalablement rempli<br />
la boîte!<br />
Un emballage écologique<br />
L’environnement est un aspect important<br />
de l’emballage métallique. Constituée de<br />
métal entièrement recyclable sans perte de<br />
qualité, la boîte en fer blanc est par défi-<br />
nition écologique, contrairement aux emballages<br />
en plastique ou complexe.<br />
Le processus de fabrication a lui aussi été<br />
nettement optimisé ces dernières années.<br />
Les vernis ont une teneur en solvants pouvant<br />
atteindre 60 %. Au lieu d’être rejetés<br />
dans l’environnement, ceux-ci sont utilisés<br />
pour le chauffage des tunnels de séchage. Un<br />
kilogramme de solvants remplace ainsi un<br />
mètre cube de gaz naturel. L’utilisation<br />
d’échangeurs thermiques, dont le rendement<br />
est adapté aux besoins énergétiques<br />
du sécheur, ainsi que de systèmes de commande<br />
intelligents, permet de réduire considérablement<br />
la consommation de gaz des<br />
lignes modernes.<br />
14 boîtes par seconde<br />
Par rapport au carton, l’impression sur métal<br />
est un marché de niche. Toutefois, il en<br />
va autrement si l’on considère uniquement<br />
le marché de l’emballage: le débit moyen<br />
d’une ligne d’impression sur métal moderne<br />
atteint un million de plaques par mois.<br />
Ceci correspond à 28 millions de boîtes, à<br />
raison de 850 boîtes par minute, soit 14<br />
par seconde!<br />
Le résultat se trouve dans les rayons de<br />
nos supermarchés: boîte d’olives vertes<br />
espagnoles à l’impression plus vraie que<br />
nature, fines feuilles de chocolat dans une<br />
élégante boîte rectangulaire vernie noire,<br />
bonbons à la menthe en étui plat avec<br />
paysage alpin imprimé en qualité photo à<br />
l’intérieur du couvercle, ou encore assortiment<br />
de chocolats dans une boîte rouge en<br />
forme de cœur décorée de fleurs en relief.<br />
Servez-vous!<br />
www.kba-metalprint.de<br />
info@printassist.ch<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 179<br />
Ligne de vernissage<br />
avec sécheur à air chaud
Même les graveurs «Computer-to-Plate»<br />
modernes renferment en fait un petit<br />
labo photo. Cette technique permet certes<br />
de renoncer au long développement de<br />
négatifs (films), mais il faut toujours flasher<br />
correctement les images (plaques) – et donc<br />
bien régler, par exemple, la durée et l’énergie<br />
d’insolation. Les produits chimiques de<br />
développement et autres paramètres du process<br />
exigent, eux aussi, un contrôle régulier.<br />
Si quelque chose dérive à ce niveau, on peut<br />
voir apparaître ultérieurement du «banding»:<br />
de fines lignes ou bandes espacées<br />
d’environ 1 à 2,5 mm, qui dégradent<br />
l’impression. (Fig. 1).<br />
Avant de passer des heures précieuses à<br />
en rechercher les causes sur la presse, il est<br />
donc préférable de jeter un coup d’œil sur<br />
le prépresse. Il est notamment conseillé de<br />
vérifier les réglages du graveur. En effet,<br />
bien que les CtP modernes, comme le Suprasetter<br />
de Heidelberg, surveillent et adaptent<br />
en permanence la puissance du laser, de<br />
mauvais réglages mènent quasi inéluctablement<br />
à des effets indésirables. Quel que soit<br />
le fabricant du graveur, il est utile de vérifier<br />
régulièrement que le mécanisme de chargement/déchargement<br />
du graveur ne présente<br />
pas de traces d’usure. Et les plaques? Il<br />
convient de les stocker afin que leur sensibilité<br />
et donc leur comportement à l’insolation<br />
restent prévisibles. (Fig. 2).<br />
Dans la développeuse, la chimie joue<br />
bien sûr aussi un rôle important. Pour que<br />
le révélateur ne présente pas de «phénomènes<br />
de fatigue», il faut, par exemple, compenser<br />
correctement l’épuisement et l’éva-<br />
Technologies Impression – Trucs et astuces<br />
Un peu de lumière dans la chambre noire!<br />
Heidelberg-News-Team, Heidelberg<br />
Il n’y a pas que la chimie qui doit être correcte: O<strong>bt</strong>enir des résultats optimaux à<br />
l’impression n’est possible que si le support proprement dit des informations de<br />
texte et d’image – la plaque – est lui aussi parfait. Son insolation thermique et sa<br />
finition n’ont rien de sorcier, mais exigent néanmoins quelques «connaissances de<br />
laborantin».<br />
Fig. 1: Le «banding» peut être dû, par exemple, à de mauvais réglages du<br />
graveur ou à une usure du mécanisme de chargement/déchargement.<br />
poration – et ce en permanence. Mais ces<br />
efforts sont vains si, même au quotidien, on<br />
ne veille pas à la régénération évitant l’épuisement<br />
et l’oxydation. Le révélateur perd<br />
sinon peu à peu de son efficacité. La même<br />
chose peut d’ailleurs aussi arriver quand de<br />
l’eau est refoulée par les rouleaux essoreurs.<br />
Pour éviter la dilution du révélateur, il<br />
convient donc aussi de contrôler le réglage<br />
des rouleaux ainsi que la position du tuyau<br />
d’aspe<strong>rsi</strong>on. L’état du révélateur peut s’apprécier<br />
soit par mesure de pH (révélateurs<br />
pour plaques photopolymères), soit par<br />
mesure de conductivité (nombreuses plaques<br />
thermiques).<br />
Si la chimie est correcte et qu’il apparaît<br />
néanmoins une certaine nébulosité à l’impression,<br />
il peut être utile d’examiner de<br />
plus près le transport des plaques: le retour<br />
en vague du révélateur au passage de la plaque<br />
peut être un indice de la nécessité<br />
d’ajuster la tension de la chaîne ou les rouleaux<br />
d’entraînement. Enfin – comme dans<br />
tout laboratoire photo classique – il est aussi<br />
possible que le révélateur soit tout simplement<br />
trop chaud ou trop froid. Pour déterminer<br />
s’il y a défaillance du chauffage ou du<br />
refroidissement, on utilisera pour plus de<br />
sécurité un thermomètre numérique ou à<br />
alcool – les modèles classiques au mercure<br />
risquant de ruiner toute la machine s’ils se<br />
cassent. La température idéale du révélateur<br />
peut s’o<strong>bt</strong>enir auprès du fournisseur des plaques.<br />
Dans l’optique d’un bon fonctionnement<br />
de l’imprimerie, on a donc intérêt à<br />
maintenir en permanence au top la production<br />
des plaques. Les formes de contrôle,<br />
déjà systématiquement intégrées aux gra-<br />
veurs d’origine Heidelberg, peuvent y<br />
contribuer pour beaucoup: elles facilitent<br />
considérablement le contrôle quotidien.<br />
Et ce d’autant plus qu’elles permettent aussi<br />
de tirer des enseignements sur le développement<br />
en tant que tel – autrement dit: l’utilisateur<br />
dispose en permanence d’outils<br />
assurant un fonctionnement stable du process.<br />
Les plaques et produits chimiques de<br />
la gamme Saphira de Heidelberg contribuent<br />
quant à eux à ce que le «laboratoire photo»<br />
fonctionne parfaitement au prépresse – tout<br />
comme les programmes de maintenance sur<br />
mesure pouvant être convenus avec le<br />
«Systemservice» de Heidelberg.<br />
Afin de minimiser autant que faire se<br />
peut les immobilisations, des Suprasetter<br />
équipés en conséquence peuvent même<br />
transmettre à un spécialiste du SAV Heidelberg<br />
des informations sur l’état de l’équipement<br />
ou sur la nécessité imminente du remplacement<br />
d’une pièce d’usure. Et ce, en<br />
quelques secondes, par Internet. En donnant<br />
son accord à la transmission de données,<br />
le «laborantin» moderne du prépresse<br />
fait gagner du temps, ménage les finances et<br />
les nerfs – pour le plus grand bien de tous<br />
ses collègues!<br />
www.ch.heidelberg.com<br />
www.heidelberg-news.com<br />
Fig. 2: Les résultats inhomogènes, avec nébulosité à l’impression, sont souvent<br />
dus à un mauvais transport des plaques.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 180
Adobe InDesign CS5 à CS6<br />
«Tout déverrouiller sur la planche »: un problème<br />
Hans Häsler, Lausanne<br />
Le fait que les blocs verrouillés soient munis<br />
d’un cadenas est bien pratique. En revanche,<br />
le déverrouillage laisse à désirer. Certes,<br />
on peut sélectionner un choix de blocs verrouillés.<br />
Cela nécessite la désactivation de<br />
la case à cocher « Empêcher la sélection de<br />
blocs verrouillés » dans les préférences. Mais<br />
ces blocs ne peuvent plus être libérés d’un<br />
coup. Il faut cliquer à tour de rôle sur le<br />
cadenas de chaque bloc (ou dans la palette<br />
« Calques ») ou bien sélectionner l’article de<br />
menu «Tout déverrouiller sur la planche ».<br />
Ce n’est pas très bien réfléchi...<br />
... de la part des développeurs de cette commande<br />
globale. Au premier coup d’œil, tout<br />
est comme désiré par l’utilisateur : il n’y a<br />
plus de cadenas sur la planche active. Mais,<br />
parfois, le verrouillage ne devrait pas être<br />
supprimé.<br />
Le problème des blocs ancrés<br />
Quand la case à cocher « Empêcher le positionnement<br />
manuel » des options du bloc<br />
ancré est activée (fig. 1), le bloc texte conteneur<br />
peut être déplacé librement. Mais il est<br />
impossible de bouger le bloc ancré volontairement<br />
ou par accident. Rien à dire jusquelà,<br />
cette mesure est vivement conseillée.<br />
Un membre du forum InDesign chez<br />
www.hilfdirselbst.ch a publié sa découverte<br />
en juillet 2012 : après le déverrouillage des<br />
blocs sur la planche (fig. 2), un bloc ancré<br />
peut être déplacé manuellement. Jusque-là,<br />
tout va bien. Mais la case à cocher est toujours<br />
activée (fig. 3), et cela n’est pas normal.<br />
Revenir en arrière<br />
Sélectionner les blocs ancrés à tour de rôle<br />
et les verrouiller par + L. Une solution bien<br />
plus rapide : lancer le JavaScript Verrouiller<br />
Ancres.js. Le dialogue permet de définir à<br />
l’aide de boutons radio les blocs qui doivent<br />
être traités : seulement ceux de la planche<br />
active ou ceux du document entier ou en core<br />
ceux d’une rangée de pages à définir.<br />
De plus, il est possible de choisir si le<br />
verrouillage doit être rétabli uniquement<br />
aux blocs dont le positionnement manuel<br />
est interdit ou à chaque objet ancré.<br />
Ne pas les déverrouiller<br />
On a meilleur temps de ne pas sélectionner<br />
l’article de menu « Tout déverrouiller sur<br />
la planche », mais de lancer le JavaScript<br />
ToutDeverrouiller.js. Celui-ci ressemble au<br />
script mentionné ci-dessus et on peut définir<br />
A partir de la ve<strong>rsi</strong>on CS5, le déverrouillage des blocs n’était plus comme on en avait<br />
l’habitude. De plus, en juillet 2012, un problème a été découvert, concernant le choix<br />
de l’article de menu «Tout déverrouiller sur la planche» quand il y a des blocs ancrés.<br />
On ne peut pas appeler cela un « bug ». C’est plutôt du « pas très bien réfléchi »...<br />
Fig. 1 – Le bloc image ancré ne peut plus être déplacé, ni volontairement ni par accident, cela grâce à la case<br />
à cocher « Empêcher le positionnement manuel » activée. C’est à conseiller ; ainsi, on est tranquille.<br />
Fig. 3 – Le verrouillage du bloc ancré est également annulé et on peut le déplacer manuellement (à la verticale).<br />
Jusque-là, tout va bien. Mais la case à cocher des options est toujours activée. Donc, il y a un problème...<br />
Fig. 4 – Au lieu de sélectionner « Tout déverrouiller<br />
sur la planche », on peut utiliser le JavaScript «Tout-<br />
Deverrouiller ». Celui-ci offre des options supplémen-<br />
taires et il permet de définir que le verrouillage des<br />
blocs ancrés ne soit pas annulé. Une rangée de pages<br />
peut être saisie dans un second dialogue.<br />
Fig. 2 – Le verrouillage de tous les blocs<br />
de la planche active sera annulé.<br />
par les boutons radio du dialogue (fig. 4)<br />
où le déverrouillage doit être fait. On peut<br />
aussi demander de ne pas toucher aux blocs<br />
ancrés ou de les déverrouiller également.<br />
Lorsque le bouton « dans une rangée de<br />
pages à définir » est sélectionné, un second<br />
dialogue permet d’entrer la rangée désirée<br />
dans un champ de texte.<br />
Télécharger les scripts<br />
Les deux scripts VerrouillerAncres.js et Tout<br />
Deverrouiller.js ne sont disponibles que pour<br />
ID CS5 (pour l’instant). Mais ils devraient<br />
également fonctionner avec ID CS6. Aller à<br />
http://www.bulletin-technique.ch, cliquer<br />
sur les liens JavaScripts, Mac OS X français<br />
(ou Windows français) et InDesign CS5.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 181
Des bases<br />
Les captures d’écran... faciles à faire. Ou bien ?<br />
Hans Häsler, Lausanne<br />
La confection d’une capture d’écran est<br />
assez simple. Lancer son logiciel préféré<br />
(par exemple « SnagIt » sous Windows ou<br />
l’utilitaire Macintosh « Capture ») et déclencher<br />
l’action par un raccourci clavier ou par<br />
le choix d’un article de menu.<br />
Cela a l’air simple, mais...<br />
Certes, ce n’est pas très compliqué, mais les<br />
réglages à faire sont assez cachés. Et il faut<br />
connaître les quelques pièges. Cela vaut la<br />
peine de produire des captures soignées.<br />
Peu importe qu’elles soient utilisées dans<br />
une marche à suivre à sortir sur une imprimante<br />
laser ou dans un article à faire paraître<br />
dans un magazine qui est imprimé sur une<br />
machine professionnelle.<br />
La préparation<br />
Le plus souvent, le pointeur de la souris doit<br />
être visible dans la capture, afin de démontrer<br />
une sélection. Il faut donc lancer l’utilitaire<br />
« Capture », sélectionner l’article « Préférences...<br />
» et cliquer sur le type de pointeur<br />
désiré (fig. 1).<br />
Fig. 1 – Sélectionner un pointeur par un clic sur son<br />
symbole. « Activer le son » : jusqu’à trois sons signalent<br />
la fin de l’action, selon le genre de la capture.<br />
Cependant, les formes de flèches spéciales<br />
(comme la flèche blanche dans InDesign<br />
ou le petit carré qui apparaît quand le pointeur<br />
est positionné sur un objet sélectionnable)<br />
seront remplacées par la flèche noire<br />
standard. Il va falloir tenter de trouver un<br />
modèle dans un document «Aide » ou de<br />
faire la retouche dans Photoshop.<br />
Allons-y !<br />
Sélectionner l’un des quatre articles du<br />
menu « Capture » (fig. 2) ou exécuter le raccourci<br />
correspondant. Les noms des articles<br />
sont parlants. De plus, à chaque fois, un dialogue<br />
explique ce qu’il faut faire. Ce dialogue<br />
n’apparaît pas dans la capture, mais on<br />
doit le déplacer de temps à autre, afin de voir<br />
ce que l’on fait.<br />
Quand on doit illustrer une marche à suivre, il va de soi de « photographier » les parties<br />
correspondantes de l’écran. Pour ce faire, on a besoin d’un petit programme. A moins<br />
d’utiliser les fonctions du système. Sous Windows, il s’agit de « Print Screen ». Et on<br />
se sert du raccourci clavier Commande + Majuscules + 3 (ou 4) sous Mac OS X.<br />
Fig. 2 – Lancer la capture par la sélection de l’un des quatre articles du menu « Capture ».<br />
Fig. 3 – Le dialogue expliquant l’action à exécuter ne paraîtra pas dans la capture s’il devait se trouver à l’intérieur<br />
du rectangle de sélection (en rouge). Le champ jaune contient les valeurs largeur et hauteur de la sélection.<br />
Il est très important de revenir dans le<br />
programme dans lequel la capture doit être<br />
faite, à l’aide des raccourcis Cmd + Tab, afin<br />
que les menus et les fenêtres soient actifs.<br />
Sélection Dessiner un rectangle de sélection<br />
(fig. 3) et relâcher le bouton de la souris. Une<br />
fenêtre « Sans titre » apparaît après un délai<br />
d’une seconde et on peut enregistrer ce<br />
résultat dans un fichier.<br />
Fenêtre Cliquer sur le bouton « Sélectionner<br />
la fenêtre » et, par la suite, sur la fenêtre désirée.<br />
Mais il faudra d’abord modifier le type<br />
de pointeur à «Aucun », sinon la flèche doit<br />
être supprimée le plus souvent.<br />
Écran La surface totale de l’écran est photographiée.<br />
On peut enregistrer le résultat ou<br />
bien en découper une partie.<br />
Écran (en différé) Quand on aimerait capturer<br />
un menu ouvert (voir fig. 2), il n’est<br />
pas possible de sélectionner en même temps<br />
l’extrait correspondant. Il faut donc commencer<br />
par lancer la prise d’un autoportrait.<br />
Ensuite, cliquer sur le bouton « Lancer la<br />
minuterie » du dialogue. On dispose de dix<br />
secondes pour revenir dans le programme,<br />
ouvrir le menu et sélectionner un<br />
article. Le compte à rebours est indiqué<br />
à droite de l’appareil photo.<br />
Quelques astuces<br />
Comme déjà mentionné, il n’est pas toujours<br />
possible d’o<strong>bt</strong>enir une capture par une<br />
seule action.<br />
Pour l’image du dialogue proposant les<br />
types des pointeurs (fig. 1), il fallait lancer<br />
« Écran (en différé) ». Sinon, le dialogue ne<br />
pouvait pas être activé.<br />
Pour o<strong>bt</strong>enir le fichier de la figure 3,<br />
c’était plus compliqué. Il fallait commencer<br />
par lancer l’autoportrait pour capturer la<br />
sélection de l’article du menu. Ensuite,<br />
agrandir la fenêtre « Sans titre », lancer la capture<br />
pour une sélection par + A, positionner<br />
le dialogue, dessiner le rectangle de<br />
sélection et, finalement, déclencher la capture<br />
de l’écran entier par + + 3.<br />
Des préparatifs supplémentaires<br />
Avant de produire une série de captures, il<br />
faut modifier quelques réglages, afin d’améliorer<br />
la qualité des images. Mais selon le<br />
type de l’écran et de la ve<strong>rsi</strong>on du système,<br />
on n’a pas l’un des problèmes mentionnés<br />
ou on ne peut pas résoudre un autre.<br />
Les conseils suivants ne sont valables que<br />
pour des écrans plats et les Mac OS X 10.6.x<br />
(Snow Leopard) et 10.7.x (Lion).<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 182
Le premier problème : le lissage du texte<br />
Lors de la retouche de la première capture<br />
d’un écran plat, on découvre que les caractères<br />
des textes en noir sont composés de<br />
couleurs dont la position est décalée (fig. 5,<br />
la colonne de gauche). Ce problème sera renforcé<br />
lors de l’impression, quand le repérage<br />
laisse à désirer.<br />
Le remède : ouvrir le dialogue « Préférences<br />
Système », cliquer sur « Apparence » et<br />
désactiver la case à cocher devant la ligne<br />
« Utiliser le lissage des polices pour écran<br />
LCD si disponible » (fig. 4).<br />
Les options sont différentes sous d’autres<br />
ve<strong>rsi</strong>ons du système. Dans «Tiger » ainsi que<br />
dans « Leopard », un menu local offre cinq<br />
articles. Mais il n’est pas possible d’empêcher<br />
que les textes noirs soient coloriés.<br />
De retour dans « Snow Leopard » : avec le<br />
lissage désactivé, les caractères des textes<br />
noirs sont uniquement en noir, mais ils sont<br />
lissés tout de même. La plupart des pixels<br />
sont en niveaux de gris.<br />
Autrefois, on pouvait également désactiver<br />
ce lissage : sélectionner la taille 12 du<br />
menu local « Désactiver le lissage du texte ».<br />
Les pixels étaient en Noir 100 % et les lettres<br />
beaucoup trop fines. Cela ne fonctionne plus<br />
avec un écran plat, mais Photoshop montre<br />
toujours son message d’avertissement lors<br />
du lancement.<br />
Revenons à la figure 5 : le texte en noir<br />
(deuxième colonne) est légèrement plus fin<br />
que celui qui se compose de couleurs. C’est<br />
également le cas du texte en négatif qui a<br />
tendance à se boucher. Il faudrait donc activer<br />
le lissage LCD et répéter la capture pour<br />
ces parties. Mais c’est laborieux, parce que la<br />
modification des réglages du système nécessite<br />
un redémarrage (ou une fermeture de<br />
la session). Ensuite, il faudrait procéder au<br />
montage dans Photoshop. Laborieux, mais<br />
cela en vaudrait la peine...<br />
Le deuxième problème : la séparation<br />
Le noir pur du texte de la deuxième colonne<br />
de la figure 5 nécessite également un certain<br />
réglage dans Photoshop. Cette modification<br />
est presque plus importante que la désactivation<br />
du lissage des polices. Les fonds gris<br />
deviennent neutres lors de la conve<strong>rsi</strong>on de<br />
RVB en CMJN : du gris reste du gris. Une<br />
dominante de couleur est impossible.<br />
Lancer Photoshop, sélectionner l’article<br />
« Couleurs...» du menu « Edition ». Un dialogue<br />
est ouvert. Sélectionner l’article « CMJN<br />
personnalisé...» du menu local « CMJN » de<br />
la section « Espaces de travail ».<br />
Un nouveau dialogue est ouvert (fig. 6).<br />
Cliquer sur le bouton radio « GCR » (Gray<br />
Component Replacement = création des parties<br />
grises de l’image) et sélectionner l’article<br />
« Maximum » du menu local « Densité du<br />
noir ». Finalement, fermer les dialogues par<br />
des clics sur « OK».<br />
La différence des deux réglages est visible<br />
en comparant les figures 7 et 8 ci-contre.<br />
Des bases Les captures d’écran... faciles à faire. Ou bien ?<br />
Fig. 4 – Désactiver la case à cocher « Utiliser le lissage », afin que les textes noirs ne sortent pas en couleurs.<br />
a a<br />
b b<br />
c c<br />
d d<br />
e e<br />
Fig. 5 – Les captures en RVB sont converties en CMJN. Colonne de gauche : le lissage LCD est activé.<br />
Colonne de droite : le lissage LCD est désactivé. a) CMJN ; b) Cyan ; c) Magenta ; d) Jaune ; e) Noir. La séparation<br />
des couleurs démontre le problème du lissage LCD activé : du texte noir est composé de couleurs.<br />
Fig. 6 – Les fonds en gris vont être neutres grâce à la sélection du type de séparation « GCR » et au réglage de la<br />
densité du noir à « Maximum ». Les parts CMJ des fonds seront à zéro pour cent.<br />
Fig. 7 – La séparation en « UCR » : le fond gris du<br />
dialogue se compose de trois valeurs (C 11, M 6, Y 7).<br />
Une dominante de couleur est inévitable.<br />
Fig. 8 – La séparation en « GCR » : le fond du dialogue<br />
est en Noir 12 %. L’avantage : lors d’un encrage<br />
variable, il n’y aura pas de dominante de couleur.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 183
La suite de l’opération<br />
Les fichiers enregistrés sont au format RVB<br />
et dotés du suffixe «.tiff ». Dépendant du<br />
médium cible, il est souvent nécessaire de<br />
convertir les images en CMJN. Et quand il<br />
faut effectuer des retouches, on doit lancer<br />
Photoshop.<br />
Le troisième problème : la résolution<br />
On compte 72 pixels par pouce sur un écran<br />
Macintosh. Cette résolution se retrouve dans<br />
la capture brute. Mais les utilisateurs savent<br />
que, normalement, des images scannées<br />
sont réglées à 300 ppp pour une trame de<br />
60 lignes par centimètre. Donc ils « enrichissent<br />
» leurs captures ainsi (fig. 9).<br />
Ne jugeons pas trop vite : certains sont<br />
obligés d’agir de la sorte. Leur flux de travail<br />
impose une limité inférieure (par exemple<br />
200 ppp) qui ne doit pas être franchie.<br />
Mais ceux qui ont la chance que leurs<br />
fichiers ne seront ni refusés ni recalculés<br />
automatiquement, ne devraient pas modifier<br />
la résolution.<br />
Seulement à titre indicatif<br />
Nous allons tout de même appliquer les<br />
diverses possibilités (fig. 10). Juste pour<br />
voir. Le résultat est plus ou moins flou,<br />
dépendant de la méthode choisie.<br />
« Sans rééchantillonnage » ne fait pas de<br />
sens. Quand l’original a 72 ppp et on insère<br />
le chiffre 300 dans le champ « Résolution »,<br />
la surface de l’image est réduite à 24 %.<br />
Importée dans un document, elle doit être<br />
agrandie à 416.666 %. Et cela ramène la<br />
valeur ppp effective aux 72 initiales...<br />
La méthode «Au plus proche » semble être<br />
une meilleure solution. Mais attention : en<br />
tapant 300 (comme d’habitude), l’image est<br />
détériorée. Le résultat du calcul (300 divisé<br />
par 72) n’est pas un chiffre entier, mais<br />
4.1666666. Et cela signifie que douze pixels<br />
doivent être insérés par pouce. Chaque pixel<br />
de l’original est subdivisé en seize pixels. Et<br />
de temps à autre une colonne et /ou une rangée<br />
de nouveaux pixels sont insérées. Cela<br />
est bien visible dans l’agrandissement d’une<br />
partie du bouton « OK» (fig. 11).<br />
Donc : ne pas taper 300 ppp, mais 288.<br />
Le résultat de la division (288 : 72) est un<br />
chiffre entier, la surface de chaque pixel<br />
d’origine est subdivisée en 16 nouveaux<br />
pixels (fig. 12).<br />
Un mauvais exemple<br />
En conclusion, encore un modèle qu’on ne<br />
devrait pas copier. Certes, la pixellisation<br />
des arrondis est réduite grâce au rééchantillonnage<br />
(fig. 13a). Mais, du coup, l’aspect<br />
de l’image est flou, les textes sont bouchés<br />
et le fond gris vire au bleu.<br />
Quand la résolution n’est pas modifiée,<br />
les textes sont plus nets (fig. 13b), la séparation<br />
en GCR garantit un fond gris neutre.<br />
Il est nettement plus agréable de consulter<br />
de telles captures.<br />
Des bases Les captures d’écran... faciles à faire. Ou bien ?<br />
Fig. 9 – Le dialogue « Taille de l’image » du menu « Image ». Activer la case à cocher « Rééchantillonnage »,<br />
modifier la valeur ppp du champ de texte « Résolution » et sélectionner un article du menu local.<br />
a) L’original en 72 ppp.<br />
b) 300 ppp, sans rééchantillonnage. c) 288 ppp, au plus proche. d) 300 ppp, bilinéaire.<br />
e) 300 ppp, bicubique. f) 300 ppp, bicubique plus lisse. g) 300 ppp, bicubique plus net.<br />
Fig. 10 – Les six possibilités pour modifier la résolution d’une image. Toutes les illustrations sont présentées<br />
à 100 %, sauf l’image « b » où il fallait taper 416.666 %. Et cela ramène la valeur ppp effective aux 72 initiales...<br />
Fig. 11 – « Au plus proche », avec 300 ppp. La plupart<br />
des pixels d’origine sont subdivisés en seize pixels.<br />
Mais de temps à autre, une cinquième rangée et /ou<br />
une cinquième colonne de pixels ont été insérées.<br />
a b<br />
Fig. 12 – « Au plus proche », avec 288 ppp. Tous les<br />
pixels de l’original sont subdivisés en seize pixels.<br />
Le résultat du calcul (288 divisé par 72) est un chiffre<br />
entier (4), pas besoin d’insérer des pixels.<br />
Fig. 13 – Pour finir en beauté, deux fois la même illustration (dans l’espoir que les différences soient visibles :-).<br />
a) Ce qu’on ne devrait pas faire : activer le lissage des polices, demander une séparation en UCR, modifier la<br />
résolution à 300 ppp et forcer le rééchantillonnage avec l’option « bicubique ».<br />
b) C’est mieux ainsi : désactiver le lissage des polices, séparer en GCR, ne pas toucher à la résolution de 72 ppp.<br />
<strong>tm</strong> <strong>rsi</strong> s<strong>tm</strong> <strong>fgi</strong> <strong>bt</strong> <strong>4|5|2012</strong> 184