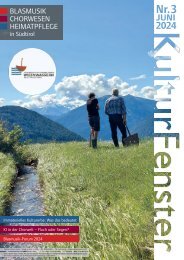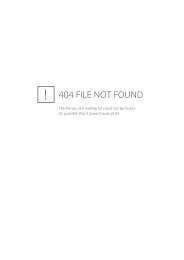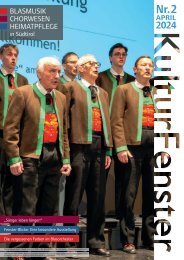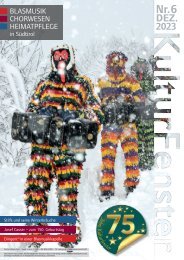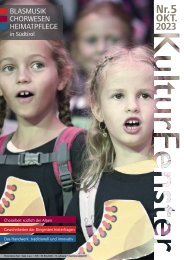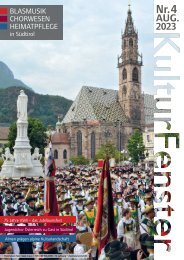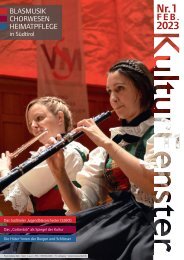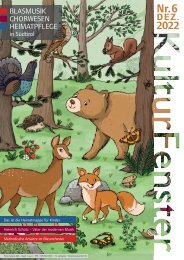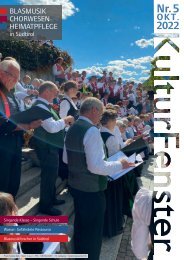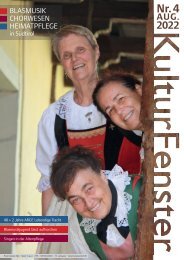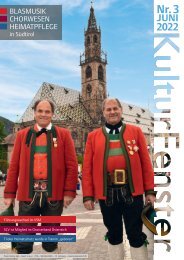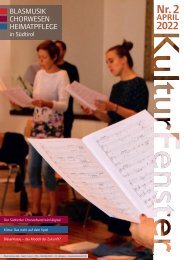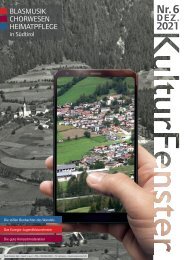Kulturfenster Nr. 01|2022 - Februar 2022
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
BLASMUSIK<br />
CHORWESEN<br />
HEIMATPFLEGE<br />
in Südtirol<br />
<strong>Nr</strong>. 1<br />
FEBRUAR<br />
<strong>2022</strong><br />
Die Marchingband showband.CH<br />
Singende Buben – Schicksal oder Auftrag?<br />
Heimat – ein umstrittener Begriff<br />
Poste Italiane SpA – Sped. in a.p. | -70% – NE BOLZANO – 74. Jahrgang – Zweimonatszeitschrift
vorausgeschickt<br />
Mundwerbung<br />
ist die beste Werbung<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
im Namen des gesamten Redaktionsteams<br />
bedanke ich mich bei Ihnen für das entgegengebrachte<br />
Vertrauen und für die zahlreichen<br />
Rückmeldungen. Sie bestärken<br />
uns in unserer Arbeit und helfen uns, die<br />
Zeitschrift stetig weiterzuentwickeln. Wenn<br />
Ihnen das „KulturFenster“ gefällt, sagen<br />
Sie es weiter. Damit können Sie uns helfen,<br />
unsere Geschichten hinauszutragen,<br />
aus unseren Probe- und Vereinslokalen hinaus<br />
– dorthin, wo sich die Menschen treffen:<br />
im Dorfgasthaus, im Vorzimmer des<br />
Arztes, im Friseursalon oder in der örtlichen<br />
Bibliothek. Mundwerbung ist bekanntlich<br />
die beste Werbung. Deshalb laden wir Sie<br />
ein, die Zeitschrift unter die Leute zu bringen,<br />
damit wir unsere Leserfamilie erweitern<br />
können.<br />
Auch diesmal präsentieren wir wiederum<br />
interessante Themen. Alle drei Verbände<br />
rücken in ihren Berichten die Jugend –<br />
die Zukunft unserer Vereine – in den Fokus.<br />
Den Beginn dazu macht die Blasmusik<br />
mit einem interessanten Porträt der<br />
Marchingband „showband.CH“ aus der<br />
Schweiz mit ihrem erfolgreichen Konzept<br />
in der Jugendarbeit, von dem man sich<br />
auch beim Workshop Ende April in Südtirol<br />
überzeugen kann. Der Heimatpfl egeverband<br />
hat „Heimat und Jugend“ zu seinem<br />
heurigen Jahresthema gemacht und<br />
dazu spannende Initiativen geplant. Und<br />
schließlich präsentiert der Chorverband die<br />
Jugendarbeit in Salzburg. Dort gelingt es,<br />
den Trend des Chorwesens zu brechen und<br />
vermehrt auch Buben und junge Männer<br />
für den Gesang zu motivieren.<br />
Und schließlich darf ich Sie noch auf das<br />
Hauptthema des Heimatpflegeverbandes<br />
hinweisen, mit dem der Begriff „Heimat“<br />
aus mehreren Perspektiven beleuchtet wird,<br />
um diesen auch von seinem ideologischen<br />
Beigeschmack zu befreien: „Wie das Wetter<br />
und der Blick auf die Stadt, so ist auch<br />
der Heimatbegriff nichts Statisches, sondern<br />
etwas Dynamisches.“<br />
Dazu gibt es die gewohnten Rubriken, in<br />
denen die einzelnen Verbände ihre Tätigkeiten<br />
dokumentieren und bereichsspezifische<br />
Themen aufarbeiten. Ich wünsche<br />
Ihnen dazu wiederum eine unterhaltsame,<br />
aber auch informative Lektüre und einen<br />
aufschlussreichen Blick durch unser „KulturFenster“.<br />
Stephan Niederegger<br />
„<br />
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann<br />
trommle nicht die Männer zusammen<br />
um die Aufgaben zu verteilen, sondern<br />
lehre den Männern die Sehnsucht nach<br />
„<br />
dem endlosen, weiten Meer.<br />
Antoine de Saint-Exupéry<br />
„<br />
Südtirol wäre ein ideales Testfeld für<br />
einen offenen Heimatbegriff, dessen<br />
Realisierung aber werde ich nicht mehr<br />
erleben.<br />
„<br />
Hans Heiss<br />
„<br />
„<br />
Wer auf Instrumenten spielt, muß des<br />
Singen kündig seyn. Also präge man<br />
das Singen jungen Leuten fleißig ein.<br />
Georg Philipp Telemann<br />
KulturFenster<br />
2 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Inhalt<br />
In dieser Ausgabe<br />
Blasmusik<br />
showband.CH rüttel Marschszene auf ................................. 4<br />
Workshop mit showband.CH in Südtirol................................ 7<br />
Stabführerin Karin Schuster im Porträt ................................. 8<br />
EUREGIO Jugendblasorchester:<br />
50 Jahre Zweites Autonomiestatut........................................ 9<br />
(K)ein Wertungsspiel <strong>2022</strong> ................................................. 10<br />
Landeswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ verschoben... 11<br />
Neue Termine für<br />
VSM-Bezirks- & Verbandsversammlungen.......................... 12<br />
Blasmusik im Rundfunk..................................................... 12<br />
Jungbläsertage Passeiertal 2021 ........................................ 13<br />
Die Jugendkapelle der<br />
MK Peter Mayr Pfeffersberg im Porträt ............................... 14<br />
Begeisternde Konzerte des BJBO Bruneck 2021................ 16<br />
Cäcilienkonzert der Musikkapelle Auer ............................... 18<br />
Sepp Thalers musikalisches Erbe – Eine Analyse ................ 19<br />
Zum 80. Geburtstag von Rudolf „Rudl“ Troger.................... 22<br />
Der Komponist Heinrich Unterhofer im Porträt.................... 23<br />
Heimatpege<br />
Warum Heimat eine Einladung an alle ist............................ 40<br />
Heimat in der Klimakrise – Beitrag von Hans Heiss............. 43<br />
Was ist Heimat? – Der HPV-Vorstand antwortet................... 45<br />
Interview:<br />
Heimat – ein Begriff, der sich nicht definieren lässt ............ 46<br />
Ein Positionspapier als Erklärung.........................................48<br />
Im Jahr <strong>2022</strong> steht die Jugend im Mittelpunkt.................... 49<br />
Dinge des Alltags: Der Rucksack........................................ 50<br />
Waale: Immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe als Ziel ........ 51<br />
Kornelkirsche läutet den Frühling ein ................................. 52<br />
Flurnamen aus der Agrargeschichte (6).............................. 54<br />
Säulenbildstock in Lana renoviert ....................................... 55<br />
Gedenkschrift über Heimatforscher<br />
Blasius Marsoner vorgestellt............................................... 56<br />
Großes Interesse am Tag des offenen Denkmals ................. 57<br />
Oskar Mulley – Kunst mit Südtirolbezug.............................. 58<br />
Ein Hauch von Orient auf dem Tiroler Trachtenhut.............. 59<br />
„Cäcilien-Messe“ von Gottfried Veit .................................... 26<br />
Young Stars -<br />
„Die kleine Orchesterschule“ von Willibald Tatzer ............... 26<br />
kurz notiert – Neues von den Musikkapellen....................... 27<br />
Chorwesen<br />
Singende Buben – Ist Salzburg seiner Zeit voraus? ............. 30<br />
Der Südtiroler Chorverband hat eine<br />
neue Mitarbeiterin: Monika Mair......................................... 33<br />
Kinder- und Jugendchor Vahrn im Porträt........................... 34<br />
„Im Leb’n’“ – Hochzeitslied/Volkslied für<br />
gemischten Chor von Helmut Pertl ..................................... 36<br />
Musikpionier Josef „Sepp“ Egger geehrt ............................. 37<br />
kurz notiert – Neues von den Chören.................................. 38<br />
Impressum<br />
Mitteilungsblatt<br />
- des Verbandes Südtiroler Musikkapellen<br />
Redaktion: Stephan Niederegger, kulturfenster@vsm.bz.it<br />
- des Südtiroler Chorverbandes<br />
Redaktion: Paul Bertagnolli, info@scv.bz.it<br />
- des Heimatpflegeverbandes Südtirol<br />
Redaktion: Florian Trojer, florian@hpv.bz.it<br />
Anschrift:<br />
Schlernstraße <strong>Nr</strong>. 1 (Waltherhaus), I-39100 Bozen<br />
Tel. +39 0471 976 387 – info@vsm.bz.it<br />
Raiffeisen-Landesbank Bozen<br />
IBAN = IT 60 S 03493 11600 000300011771<br />
SWIFT-BIC = RZSBIT2B<br />
Jahresabonnement = 20,00 Euro<br />
Ermächtigung Landesgericht Bozen <strong>Nr</strong>. 27/1948<br />
presserechtlich verantwortlich: Stephan Niederegger<br />
Druck: Ferrari-Auer, Bozen<br />
Das Blatt erscheint zweimonatlich am 15. <strong>Februar</strong>, April, Juni, August, Oktober und<br />
Dezember. Redaktionsschluss ist der 15. des jeweiligen Vormonats.<br />
Eingesandte Bilder und Texte verbleiben im Eigentum der Redaktion und werden nicht<br />
zurückerstattet. Die Rechte an Texten und Bildern müssen beim Absender liegen bzw.<br />
genau deklariert sein. Die Verantwortung für die Inhalte des Artikels liegt beim Verfasser.<br />
Die Wahrung der Menschenwürde und die wahrheitsgetreue Information der Öffentlichkeit<br />
sind oberstes Gebot. Der Inhalt der einzelnen Beiträge muss sich nicht mit<br />
der Meinung der Redaktion decken. Nachdruck oder Reproduktion, Vervielfältigung jeder<br />
Art, auch auszugsweise, sind nur mit vorheriger Genehmigung der Redaktion erlaubt.<br />
Sämtliche Formulierungen gelten völlig gleichrangig für Personen beiderlei Geschlechts.<br />
– gefördert von der Kulturabteilung<br />
der Südtiroler Landesregierung<br />
KulturFenster<br />
3 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Wo die showband.CH<br />
aufkreuzt, erregt<br />
sie Aufsehen.<br />
KulturFenster<br />
4 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
präsentiert<br />
Schweizer Leuchtturm-Formation<br />
showband.CH rüttelt Marschmusikszene auf<br />
Raffinierte Formationen aus Musik, Rhythmus<br />
und Tanz überraschen und verzaubern das<br />
Publikum auf nationalen und internationalen<br />
Bühnen. Präzision und beeindruckender Leistungswille<br />
bilden die solide Basis von showband.CH.<br />
Seit 2006 verfolgt showband.CH<br />
die Idee der traditionellen kanadisch-amerikanischen<br />
Marchingbands. Heute ist der<br />
50-köpfige Cast eine Leuchtturm-Formation<br />
für andere Vereine: showband.CH steht<br />
nicht nur jedes Jahr mit einer neuen, dynamischen<br />
Show auf der Bühne, sondern gibt<br />
ihr Wissen und ihre Erfahrung auch weiter.<br />
„Wer isch dä Trend?“ – der Schlachtruf<br />
hallt über den Rasen, bevor die Schweizer<br />
Marchingband showband.CH überhaupt<br />
einen ersten Fuß auf die Auftrittsfläche<br />
gesetzt hat. Und dann geht es Schlag<br />
auf Schlag: in den nächsten Minuten legt<br />
die Marchingband, bestehend aus Blasorchester,<br />
Drumcorps und Tanzcrew, einen<br />
trittsicheren, atmungsaktiven und schlagfertigen<br />
Auftritt hin.<br />
Eine Kombination aus Musik,<br />
Rhythmus und Bewegung<br />
In mehreren Probenwochenenden studieren<br />
die Jugendlichen im Alter zwischen 16<br />
und 25 Jahren moderne Musikliteratur sowie<br />
entsprechende Choreographien ein. Das<br />
Endprodukt: eine Show, in der sich Musik,<br />
Rhythmus und Bewegung optimal ergänzen.<br />
So begeistert showband.CH jedes<br />
Jahr mit einem neuen, populären Repertoire<br />
an Rasen- und Bühnenshows sowie<br />
Paraden. Das sorgt im In- und Ausland für<br />
Auftrittserlebnisse, die bleiben!<br />
Der ursprüngliche Gedanke von showband.CH<br />
war es schon immer, mit kreativen<br />
Choreographien zu modernen Stücken<br />
die Marschmusikszene aufzurütteln<br />
und aus einer neuen Sicht darzustellen.<br />
Auf den Punkt – jeder Auftritt von showband.CH wird zum Highlight.<br />
Das Potenzial, Blasmusik für das Publikum<br />
attraktiv zu verpacken, erkannten die beiden<br />
Initianten Jean-Luc Kühnis und Fabian<br />
Wohlwend schon vor einigen Jahren:<br />
2006 fand sich eine Gruppe junger<br />
Erwachsener zusammen. Mit dem Slogan<br />
„We are the trend“ setzte sich die<br />
Schweizer Marchingband ein hohes<br />
Ziel – mit Erfolg. Gemeinsam wurde<br />
2008 eine Show aufgeführt, wie sie die<br />
Schweiz noch nicht gesehen hatte –<br />
ganz nach den Vorbildern der im Vorfeld<br />
besuchten Marchingbands in Kanada<br />
wurde der Traum umgesetzt. Bis<br />
heute verfolgt showband.CH die Idee<br />
der traditionellen kanadisch-amerikanischen<br />
Marchingbands.<br />
Eine Show, wie sie die Schweiz<br />
noch nicht gesehen hat<br />
Bein- und Kopfarbeit – erfolgreiche Auftritte bedingen ein ausgeklügeltes Trainingskonzept.<br />
KulturFenster<br />
5 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
präsentiert<br />
Musikalität und Präzision der Bewegungsabläufe vereinen sich in den Marching-Shows von showband.CH.<br />
Wissen und Erfahrung<br />
weitergeben<br />
Heute ist showband.CH eine Leuchtturm-<br />
Formation für andere Marchingbands im<br />
Bereich Parademusik: Sie zeigt, was durch<br />
Ausprobieren und Experimentieren an<br />
neuen Elementen alles möglich ist.<br />
So steht die rund 50-köpfige Marchingband<br />
nicht nur selbst auf der Bühne, sondern<br />
gibt die Erfahrung, die in unzähligen Planungs-<br />
und Probestunden erlangt wurde,<br />
unter anderem in Workshops an Musikvereine<br />
und Tambouren-Sektionen weiter.<br />
Ein wichtiger Schwerpunkt liegt zudem auf<br />
der Nachwuchsförderung: Jedes Jahr im<br />
Herbst findet das beliebte Marchingband<br />
Jugendcamp statt.<br />
Marchingband-Luft<br />
schnuppern<br />
musiziert, hier sammelt man unvergessliche<br />
Erinnerungen und Freundschaften<br />
fürs Leben werden geschlossen. Und oft<br />
trudeln nach der Lagerwoche bereits die<br />
ersten Anmeldungen für die nächste showband.CH-Saison<br />
ein – das Jugendcamp ist<br />
der Nachwuchs von showband.CH und<br />
vergrößert jährlich den Cast.<br />
Saison <strong>2022</strong> abgesagt!<br />
<strong>2022</strong> steht für showband.CH ganz unter<br />
dem Motto „There are far better things<br />
ahead than any we leave behind!“ Trotzdem<br />
hat sich der Vorstand von showband.CH<br />
schweren Herzens aufgrund der Entwicklung<br />
der Pandemie bereits im vergangenen<br />
Dezember dazu entschieden, die Saison<br />
<strong>2022</strong> abzusagen. Aber sie denken bereits<br />
darüber nach, „wie und wo wir unsere<br />
Füße auf den nächsten Hallenboden setzen<br />
könnten“. Schon jetzt steht ein Jahreshighlight<br />
fest: vom 9. bis zum 15. Oktober<br />
<strong>2022</strong> findet in Disentis die 10. Ausgabe des<br />
Marchingband-Jugendcamps statt. Und<br />
auch sonst wartet noch die eine oder andere<br />
Überraschung – stay tuned!<br />
Sina Schmid (Fotos: fotorubin.ch)<br />
Weitere Informationen<br />
finden Sie unter<br />
www.showband.CH und<br />
auf dem YouTube-Kanal<br />
Inmitten der Bündner Berge können Jugendliche<br />
im Alter von 12 bis 22 Jahren<br />
eine Woche lang Marchingband-Luft<br />
schnuppern. Abschluss und Höhepunkt des<br />
Camps ist eine energiegeladene Show vor<br />
Publikum. Nach nur einer Lagerwoche mit<br />
zahlreichen Probestunden und selbstverständlich<br />
ausreichend Lager-Fun sitzt die<br />
Show – die Instrumente verharren noch in<br />
der Luft und man wartet auf den verdienten<br />
Applaus. Hier wird nicht nur gemeinsam<br />
Begeisterung,<br />
die begeistert,<br />
dafür steht<br />
showband.CH.<br />
KulturFenster<br />
6 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Blasmusik<br />
Workshop in Südtirol<br />
Anmeldungen innerhalb 31. März<br />
– natürlich ohne Spiel, mit Musik im Hintergrund,<br />
damit wir uns auf die Handhabung<br />
der Instrumente und die Stabführung<br />
konzentrieren können.<br />
Obwohl showband.CH die Saison <strong>2022</strong> abgesagt<br />
hat, ist es gelungen, sie dennoch<br />
für eine Zusammenarbeit mit dem VSM<br />
zu gewinnen. Die Initiative dazu ging von<br />
Verbandsstabführer Klaus Fischnaller aus.<br />
KulturFenster: Wie kam es zur Zusammenarbeit<br />
mit showband.CH?<br />
Klaus Fischnaller: Die Zusammenarbeit ist<br />
aus der Idee entstanden, eine Jungbläserwoche<br />
mit dem Schwerpunkt „Musik in<br />
Bewegung“ anzubieten. Im Internet bin<br />
ich zufällig auf die showband.CH gestoßen<br />
und habe gesehen, dass sie schon<br />
seit längerem Jugendcamps mit dem<br />
Schwerpunkt „Musik in Bewegung“ anbieten<br />
– also genau das, was wir suchen.<br />
Daraufhin habe ich sie direkt kontaktiert.<br />
KF: Welches werden die Inhalte des Workshops<br />
sein?<br />
Fischnaller: Auch wenn ihr Ziel in erster<br />
Linie auf Marchingbands ausgerichtet ist,<br />
so hat mich vor allem ihr Konzept interessiert,<br />
wie sie mit Jugendlichen arbeiten.<br />
Mit unserem Workshop wollen wir nicht<br />
nur die Jugend ansprechen, sondern auch<br />
die Stabführer*innen und alle, die sich<br />
für die Musik in Bewegung interessieren.<br />
Gerade im Bereich der Marschshows haben<br />
wir noch Aufholbedarf, aber auch das<br />
Potential, uns weiterzuentwickeln.<br />
KF: Sollen aus unseren Musikkapellen<br />
Marchingbands werden?<br />
Fischnaller: Nein, auf keinen Fall – das<br />
wäre ein ganz falscher Weg! Wir können<br />
aber immer nur lernen. Es ist klar,<br />
dass wir von einer Showband nicht alles<br />
1:1 übernehmen können – und<br />
auch nicht müssen, aber wir können sicherlich<br />
viele Inputs für unsere zukünftige<br />
Arbeit mitnehmen. Ich möchte mit<br />
diesem Workshop ein Fenster öffnen,<br />
wovon ich überzeugt bin, dass es uns<br />
weiterbringt und dass wir die Musik in<br />
Bewegung auch jugendgerechter gestalten<br />
können.<br />
KF: Welche Schwerpunkte wird es im<br />
Workshop noch geben?<br />
Fischnaller: Mit Sicherheit wird der Workshop<br />
sehr praxisorientiert sein. Abgesehen<br />
von dem Aufbau, der Musikwahl bis<br />
hin zur Show, wird es einen kreativen Teil<br />
geben, wobei wir in Gruppen versuchen,<br />
einige Showelemente zu erarbeiten. Wir<br />
laden die Teilnehmer*innen ein, ihre Instrumente<br />
und den Tambourstab mitzubringen,<br />
damit wir auch versuchen können,<br />
das Erlernte in die Praxis umzusetzen<br />
KF: Dies klingt sehr vielversprechend.<br />
Fischnaller: Ja, das ist es auch. In den<br />
Vorgesprächen mit der Koordinatorin<br />
Sina Schmid – durch sie ist der Kontakt<br />
entstanden – haben wir uns darauf geeinigt,<br />
dass wir uns nicht nur auf eine Musikrichtung<br />
bzw. Show konzentrieren werden.<br />
Die Ideen und Anregungen, welche<br />
die showband.CH mitbringt, sind vielfältig<br />
und reichen vom Aufmarsch über die<br />
Parademusik bis hin zur Show am Platz.<br />
Dasselbe gilt für die Musik, wobei die Einfachheit<br />
und das gute Musizieren im Vordergrund<br />
stehen werden.<br />
KF: Wann fi ndet der Workshop statt?<br />
Fischnaller: Der ganztägige Workshop<br />
findet am 30. April <strong>2022</strong> ab 9 Uhr im<br />
Probelokal der MK Jenesien statt. Dabei<br />
werden mit Kervin Schrag, dem künstlerischen<br />
Leiter der showband.CH, und<br />
seinem Team die einzelnen Schritte einer<br />
Marschshow – von der Planung über die<br />
Probenarbeit bis zum Auftritt – erarbeitet.<br />
Anmeldungen werden über das VSM-<br />
Office innerhalb 31. März angenommen.<br />
Genauere Informationen sind auch auf<br />
der VSM-Homepage abrufbar.<br />
KF: Danke für das Gespräch.<br />
Fischnaller: Danke sagen mein Team<br />
und ich. Die Fachgruppe „Musik in Bewegung“<br />
freut sich, wenn viele dieses<br />
tolle Angebot annehmen und am Workshop<br />
teilnehmen.<br />
Gespräch: Stephan Niederegger<br />
Im jährlichen Jugendcamp können Jugendliche im Alter von 12 bis 22 Jahren eine Woche lang Marchingband-Luft schnuppern.<br />
KulturFenster<br />
7 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
ewegt<br />
Alle folgen auf Karins Kommando<br />
Karin Schuster geht der Musikkapelle Prags als Stabführerin voran<br />
Die heurige Ausgabe des Frauenkalenders<br />
„Alchemilla“ steht<br />
unter dem Titel „überMut tut<br />
Frauen gut!“ und widmet sich<br />
couragierten Frauen. Dazu hat<br />
Berta Linter in ihrem Beitrag<br />
(S.265) auch in der VSM-Statistik<br />
gestöbert und die „Frauen<br />
im Verband Südtiroler Musikkapellen“<br />
in den Fokus gerückt.<br />
Während eine Frau am<br />
Dirigentenpult oder als Obfrau<br />
bei den Südtiroler Musikkapellen<br />
keine Seltenheit mehr ist, sind<br />
Stabführerinnen noch die Ausnahme – derzeit<br />
ist Karin Schuster von der Musikkapelle<br />
Prags die einzige.<br />
Erste Frauen in den<br />
Südtiroler Musikkapellen<br />
1973 war Helga Huber aus Terlan die erste<br />
Frau, die einer Musikkapelle beigetreten ist.<br />
Als Flavia Crepaz 1983 den Taktstock der<br />
Musikkapelle Morter übernahm, war sie die<br />
erste Kapellmeisterin in Südtirol. Mittlerweile<br />
(Stand: Juni 2021) stehen 14 Kapellmeisterinnen<br />
am Dirigentenpult, 22 Musikkapellen<br />
werden von einer Obfrau geführt und<br />
596 Marketenderinnen marschieren in den<br />
210 Musikkapellen. Derzeit hat aber nur die<br />
Musikkapelle Prags eine Stabführerin. Im<br />
folgenden beschreibt die 34-jährige Karin<br />
Schuster ihren musikalischen Werdegang,<br />
ihre Motivation und ihre Zukunftspläne.<br />
Seit 21 Jahren Musikantin<br />
Seit zwei Jahren ist Karin Schuster Stabführerin<br />
der Musikkapelle Prags.<br />
Foto: Elisabeth "Lissy" Moser<br />
Musik begleitet mich schon seit meiner<br />
Kindheit und ist aus meinem Leben nicht<br />
mehr wegzudenken. Mit dem Erlernen der<br />
Blockflöte begannen meine ersten musikalischen<br />
Erfahrungen. Nach dem Besuch einiger<br />
Musikanten in der Grundschule stand<br />
für mich fest, dass ich Querflöte und später<br />
dann auch das Piccolo erlernen wollte.<br />
So sind es nun schon 21 Jahre, dass ich<br />
bei der Pragser Musikkapelle bin. Durch<br />
mein Studium der Krankenpflege und später<br />
auch durch meine Arbeit in Innsbruck<br />
war ich zwar nicht ständig zu Hause, dennoch<br />
konnte ich mich nicht vom gemeinsamen<br />
Musizieren in der Musikkapelle verabschieden.<br />
Vor ca. sieben Jahren bin ich<br />
schließlich wieder ganz in meine Heimat zurückgekehrt.<br />
Mittlerweile bin ich verheiratet,<br />
wohne in Sexten und habe zwei Jungs im<br />
Alter von ein und vier Jahren. Auch wenn<br />
es mich ständig in verschiedene geografische<br />
Richtungen in meinem Leben gezogen<br />
hat, blieb ich meinem Dorf und seiner<br />
Musikkapelle stets treu. Die netten Kameradschaften,<br />
welche sich in unserer Kapelle<br />
entwickelt haben, bedeuten mir nach wie vor<br />
viel. Deshalb pendle ich so oft es mir möglich<br />
ist von Sexten nach Prags, um an Proben<br />
und Auftritten teilzunehmen.<br />
Das Amt der Stabführerin als<br />
persönliche Herausforderung<br />
Vor rund fünf Jahren besuchte ich den<br />
Grundkurs für Stabführer*innen. Ich bin<br />
ständig offen für Neues. Für mich stand<br />
daher nach kurzem Überlegen fest, dass<br />
ich mich in diese Materie einlernen wollte,<br />
und sammelte so meine ersten Erfahrungen.<br />
Schon nach kurzer Zeit stellte ich fest, dass<br />
das Erlernen des Stabführens einiges an<br />
Können und Übung erfordert. Dies spornte<br />
mich noch mehr an, dieses Amt irgendwann<br />
auch offiziell ausüben zu können. Von Anfang<br />
an war mir klar, dass ich mich in dieser<br />
Männerdomäne zunächst einmal behaupten<br />
musste. Die Akzeptanz war aber von Anfang<br />
an da. Dennoch dauerte es nochmals<br />
weitere zwei Jahre, bis ich<br />
das Amt der Stabführerin gemeinsam<br />
mit meinem Musikkollegen<br />
Alfred übernahm. Zu<br />
diesem Zeitpunkt war ich mit<br />
meinem zweiten Kind schwanger.<br />
Daher beschlossen wir,<br />
dass wir dieses Amt gemeinsam<br />
ausüben wollten, damit<br />
wir uns gegenseitig ersetzen<br />
können, wenn einer ausfällt.<br />
Mit Herzklopfen stand ich<br />
schließlich vor meinem allerersten<br />
offiziellen Auftritt. Tausende Gedanken<br />
schwirrten in meinem Kopf umher, ob<br />
ich die Kommandos und Abfolgen alle richtig<br />
machte, aber schließlich konnte ich diesen<br />
Auftritt gut meistern. Somit legte sich auch<br />
die Nervosität bei den folgenden Auftritten.<br />
Positive Rückmeldungen<br />
und Zukunftspläne<br />
Schön fand ich die vielen positiven Kommentare<br />
und Rückmeldungen aus der Pragser<br />
Bevölkerung. Es erfüllt mich mit Stolz und<br />
Freude, wenn wir mit der Kapelle aufmarschieren<br />
können und das Publikum mit unserem<br />
Auftritt begeistern.<br />
Die Frage, warum es in Südtirol nicht mehr<br />
Stabführerinnen gibt, kann ich leider auch<br />
nur schwer beantworten. Sicherlich braucht<br />
es einiges an Mut und Freude, aber wie bei<br />
vielen Dingen im Leben kann man alles erlernen,<br />
wenn man die nötige Motivation mit<br />
sich bringt. Deshalb wäre es schön, wenn<br />
sich auch mehrere Frauen für das Amt der<br />
Stabführerin begeistern ließen.<br />
Ein kurzfristiges Ziel für die Zukunft ist die<br />
Teilnahme an einem großen Umzug, welcher<br />
situationsbedingt in den letzten zwei Jahren<br />
leider nicht stattfinden konnte. Ein langfristiges<br />
Ziel ist die Teilnahme an einem Marschierwettbewerb.<br />
Wohin mich mein weiterer<br />
Weg als Stabführerin führen wird, lass<br />
ich mir noch offen. Da ich nun in Sexten<br />
wohne, würde ich irgendwann auch gerne<br />
Mitglied der dortigen Musikkapelle werden.<br />
Und wer weiß, vielleicht ist es auch dort<br />
möglich, dass ich mein Amt als Stabführerin<br />
nicht ganz an den Nagel hängen muss.<br />
Karin Schuster<br />
KulturFenster<br />
8 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
VSM intern<br />
50 Jahre<br />
Zweites Autonomiestatut<br />
Uraufführung durch das EUREGIO Jugendblasorchester<br />
Die drei Dirigenten (v. l.) Johann Finatzer (Südtirol), Franco Puliafito (Trient) und Wolfram<br />
Rosenberger (Tirol) des EUREGIO Jugendblasorchesters<br />
Wie bereits in der Oktoberausgabe des<br />
„KulturFensters“ angekündigt (S.49), hat<br />
der Südtiroler Landtag anlässlich des Jubiläums<br />
„50 Jahre 2. Autonomiestatut 1972-<br />
<strong>2022</strong>“ einen Wettbewerb für eine Komposition<br />
für symphonisches Blasorchester<br />
ausgeschrieben.<br />
VSM-Verbandsjugendleiter Johann Finatzer<br />
wurde als Koordinator des Projektes<br />
und Präsident der Wettbewerbsjury eingesetzt.<br />
Die Siegerkomposition wird im Rahmen<br />
der alljährlichen Feierlichkeiten zum<br />
Europatag am 9. Mai vom EUREGIO Jugendblasorchester<br />
uraufgeführt.<br />
Neben der klassischen Sommerwoche<br />
vom 23. bis zum 31. Juli <strong>2022</strong> in Toblach<br />
mit Konzerten in allen drei Landesteilen<br />
fi nden bereits vom 14. bis zum 16. April<br />
und vom 5. bis zum 8. April zwei Probenwochenenden<br />
des EUREGIO Jugendblasorchesters<br />
in Algund bzw. Bozen statt.<br />
Die Teilnahme an diesem Frühjahrsprogramm<br />
ist kostenlos.<br />
Weitere Informationen zum Kompositionswettbewerb<br />
können auf der Homepage<br />
des Südtiroler Landtags (www.<br />
landtag-bz.org) und des Südtiroler Künstlerbundes<br />
(www.kuenstlerbund.org) eingesehen<br />
werden.<br />
Details zum EUREGIO<br />
Jugendblasorchester<br />
gibt es unter:<br />
www.europaregion.<br />
info/musiccamp<br />
Stephan Niederegger<br />
Medienreferent im VSM<br />
KulturFenster<br />
9 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
VSM intern<br />
(K)ein Wertungsspiel <strong>2022</strong><br />
Neuer Termin, neue Ausrichtung<br />
Wenn zurzeit Proben auch möglich<br />
sind, so stellt die aktuelle Situation unsere<br />
Musikkapellen doch vor enorme<br />
Herausforderungen.<br />
Steigende Infektionszahlen verunsichern<br />
viele Vereinsmitglieder und an<br />
einen normalen entspannten Probenbetrieb<br />
ist wohl kaum zu denken. Wie<br />
wertvoll und motivierend Wertungsspiele<br />
auch sein mögen, die Rahmenbedingungen<br />
wie regelmäßige planbare Proben<br />
sind wohl eine Grundvoraussetzung,<br />
um an einem Wertungsspiel teilzunehmen.<br />
Gemeinsam mit dem VSM-Bezirk<br />
Schlanders haben wir uns dafür ausgesprochen,<br />
das im kommenden Mai<br />
geplante Wertungsspiel auf den Herbst<br />
zu verschieben. Auch die Ausrichtung<br />
wird eine etwas andere sein. So wird es<br />
nicht ein Wertungsspiel im herkömmlichen<br />
Sinn sein, sondern vielmehr ein<br />
Kritikspiel, bei dem die Musikkapellen bereits<br />
in der Vorbereitungsphase – wenn<br />
es gewünscht ist – eine Unterstützung in<br />
Form eines Coachings erhalten. Auch die<br />
Bewertung wird nicht in Form von Punkten<br />
oder Prädikaten erfolgen, sondern in<br />
Form eines Jurygespräches. Wir möchten<br />
so die Musikkapellen unterstützen und<br />
ihnen ein Ziel anbieten. Dabei soll die<br />
Freude am Proben und gemeinsamen<br />
Musizieren ohne Leistungsdruck im Vordergrund<br />
stehen.<br />
Meinhard Windisch<br />
Verbandskapellmeister im VSM<br />
BLASMUSIK<br />
CHORWESEN<br />
HEIMATPFLEGE<br />
in Südtirol<br />
Aboaktion<br />
Seit Dezember 1948 berichten wir unter dem Titel „Die Volksmusik“, ab September<br />
1953 als „Südtiroler Volkskultur“, ab März 1979 als „Tiroler Volkskultur“ und seit<br />
2008 als „KulturFenster“ lebendig, bunt und vielfältig über die Musikkapellen,<br />
die Chöre, die Heimatpflege, den Volkstanz und das Trachtenwesen in Südtirol -<br />
derzeit in einer Gesamtauflage von rund 3.300 Stück pro Ausgabe.<br />
Sie möchten keine<br />
Ausgabe verpassen?<br />
Dann rufen Sie uns an (Tel. 0471 976 387)<br />
oder schreiben uns eine Email an: info@vsm.bz.it<br />
Sie bekommen das "KulturFenster"<br />
sechs Mal im Jahr direkt nach Hause geschickt.<br />
Weitere Informationen finden Sie im<br />
Impressum auf Seite 3 dieser Ausgabe.<br />
KulturFenster<br />
10<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Blasmusik<br />
13. Landeswettbewerb<br />
„Musik in kleinen Gruppen“<br />
… auf den 14. Mai <strong>2022</strong> verschoben<br />
Aufgrund der vorherrschenden Situation<br />
und der Prognosen über die allgemeine<br />
pandemische Lage hat der Verbandsvorstand<br />
beschlossen, den Landeswettbewerb<br />
„Musik in kleinen Gruppen“ vom<br />
ursprünglichen Termin am 12. <strong>Februar</strong><br />
<strong>2022</strong> in die sicherere warme Jahreszeit<br />
zu verschieben.<br />
Somit findet der Wettbewerb am Samstag,<br />
dem 14. Mai <strong>2022</strong>, in der Musikschule<br />
und Aula Magna in Auer statt.<br />
Bereits angemeldete Ensembles und<br />
Gruppen müssen sich nicht erneut<br />
anmelden, für sie ändert sich nur das<br />
Austragungsdatum.<br />
Durch die längere Vorbereitungszeit und<br />
den neuen Termin ist es natürlich auch<br />
möglich, dass sich weitere, bisher noch<br />
nicht gemeldete Ensembles für den Wettbewerb<br />
interessieren. Diese können sich<br />
innerhalb <strong>Februar</strong> anmelden.<br />
Dem Ensemblespiel im Allgemeinen und<br />
diesem Wettbewerb im Besonderen kommt<br />
eine wichtige Rolle zu – gerade in Pandemiezeiten,<br />
wenn viele Musikkapellen nicht<br />
in der vollen Besetzung proben (können).<br />
Die bereits jetzt überdurchschnittliche Zahl<br />
von mehr als 20 angemeldeten Ensembles<br />
bezeugt dies eindrucksvoll.<br />
Ich bedanke mich ganz persönlich wie<br />
auch im Namen des Verbandes bei Ale-<br />
xandra Pedrotti, der Direktorin der Musikschule<br />
Unterland, und Thomas Rech,<br />
dem Obmann der Musikkapelle Auer. Sie<br />
stellen uns freundlicherweise die Räumlichkeiten<br />
in Auer wie auch bei anderen<br />
Verbandsveranstaltungen zur Verfügung<br />
und waren zudem zuvorkommend und<br />
hilfsbereit bei der notwendigen Terminverschiebung.<br />
Ich freue mich auf viele jung- und junggebliebene<br />
Musikbegeisterte, welche sich<br />
auf den besonderen Moment des musikalischen<br />
Wettstreites einlassen.<br />
Johann Finatzer<br />
Verbandsjugendleiter im VSM<br />
Impressionen vom Wettbewerb 2018<br />
KulturFenster<br />
11 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
VSM intern<br />
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben<br />
Neue Termine für Bezirks- & Verbandsversammlungen <strong>2022</strong><br />
MAI<br />
Bereits seit November steht das Jahresprogramm<br />
des VSM für das heurige<br />
Tätigkeitsjahr fest und ist im Jahreskalender<br />
<strong>2022</strong> niedergeschrieben.<br />
Mit viel Freude und neuer Hoffnung<br />
auf die Durchführbarkeit hat der Verbandsvorstand<br />
geplant und vorausgeblickt.<br />
Leider hat die Pandemie in den letzten<br />
Wochen wieder derart „Fahrt aufgenommen“,<br />
dass auf Grund der hohen<br />
Inzidenz einige Vorhaben zum<br />
wiederholten Male nicht planmäßig<br />
abgewickelt werden können. In erster<br />
Linie sind die großen Mitgliederversammlungen<br />
der sechs Bezirke<br />
Bozen, Bruneck, Meran, Brixen, Schlanders<br />
und Sterzing betroffen, welche an<br />
verschiedenen Wochenenden zwischen<br />
dem 15. Jänner und dem 5. März <strong>2022</strong><br />
vorgesehen waren. Zudem trifft es auch<br />
die am 12. März <strong>2022</strong> in Bozen geplante<br />
74. VSM-Mitgliederversammlung.<br />
Da in allen Bezirken und im Verband<br />
Neuwahlen anstehen, wollen wir versuchen,<br />
die Versammlungen möglichst in<br />
Präsenz abzuhalten. Um dies zu erreichen,<br />
haben wir als ersten Schritt eine<br />
Verschiebung der Versammlungen ins<br />
Auge gefasst: die Mitgliederversammlung<br />
des Verbandes wird auf Samstag, dem 7.<br />
Mai <strong>2022</strong>, verlegt.<br />
Die neuen Termine der<br />
Bezirksversammlungen:<br />
Bezirk Meran - 12. März in Nals<br />
Bezirk Bruneck - 26. März in Reischach<br />
Bezirk Brixen - 26. März in Mühlbach<br />
Bezirk Bozen - 9. April in Gries<br />
Bezirk Sterzing - 23. April in Ratschings<br />
Bezirk Schlanders - noch festzulegen<br />
Wir alle hoffen stark, dass die hohe Inzidenz<br />
der Corona-Pandemie bis dahin<br />
abgeflacht ist und die Zusammenkünfte<br />
zur ordentlichen Abwicklung der vorgesehenen<br />
Tagesordnungspunkte möglich<br />
werden.<br />
Pepi Fauster<br />
Verbandsobmann im VSM<br />
BLASMUSIK IM RUNDFUNK<br />
jeden Montag<br />
von 17 bis 18 Uhr<br />
„Dur und Schräg“<br />
Traditionelle und neue<br />
Blasmusik mit Norbert Rabanser<br />
jeden Freitag<br />
von 18 bis 19 Uhr<br />
„Blasmusik“ mit Dieter Scoz<br />
jeden Samstag<br />
von 18 bis 19 Uhr<br />
„Faszination Blasmusik“<br />
mit Arnold Leimgruber<br />
(Wiederholung<br />
am Sonntag um 10 Uhr)<br />
jeden Freitag<br />
von 18 bis 19 Uhr<br />
„Das Platzkonzert“<br />
mit Peter Kostner<br />
KulturFenster<br />
12 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Blasmusik<br />
jung musiziert<br />
..<br />
Jungblasertage Passeiertal 2021<br />
Sieben Musikkapellen und Verein „Guitart“ arbeiten zusammen<br />
40 Jungmusikant*innen aus sieben Musikkapellen nahmen im<br />
Sommer 2021 an den Jungbläsertagen des Passeiertales teil.<br />
Bereits zum 11. Mal wurden im August<br />
2021 die „Jungbläsertage Passeiertal“ abgehalten.<br />
Das Ziel dieser Musiktage war<br />
von Beginn an Jungmusikant*innen aller<br />
Musikkapellen des Tales zu vereinen und<br />
eine gemeinsame musikalische Woche zu<br />
verbringen.<br />
Seit einigen Jahren läuft das Projekt parallel<br />
zum Bandcamp des Vereins „Guitart“;<br />
gemeinsam erarbeiten sich Bandmitglieder<br />
und Jungbläser ein abwechslungsreiches<br />
Konzertprogramm.<br />
Im vergangenen Sommer fanden die Jungbläsertage<br />
Passeiertal vom 23. bis zum<br />
27. August in St. Martin in Passeier statt.<br />
Die Schüler*innen waren jeweils von 9 bis<br />
17 Uhr in der Obhut der Lehrpersonen und<br />
kehrten anschließend wieder nach Hause<br />
zurück. Im Laufe des Tages gab es Unterricht<br />
mit den Instrumentallehrpersonen, Register-<br />
und Tuttiproben und einen Workshop<br />
zu Improvisation, Rhythmus und Harmonie.<br />
Nach dem coronabedingten Ausfall der<br />
Jungbläsertage 2020 konnte man dieses<br />
Jahr 40 Jungmusikant*innen aus sieben<br />
Musikkapellen begeistern. Sieben Lehrpersonen<br />
begleiteten die Schüler*innen durch<br />
die Woche und teilten ihr Wissen mit dem<br />
musikalischen Nachwuchs. Durch die Förderung<br />
der Jugendarbeit des Verbandes<br />
Südtiroler Musikkapellen und durch die Un-<br />
terstützung der Gemeinden St. Martin, St.<br />
Leonhard, Moos und Riffian konnte in dieser<br />
anregenden Woche auch ein Video erstellt<br />
werden. Daniel Felderer begleitete die<br />
Teilnehmer der Jungbläsertage am letzten<br />
Tag und hielt dabei Proben und Konzert in<br />
einem Kurzvideo fest. Das Abschlusskonzert<br />
fand am Freitag, dem 27. August, auf<br />
dem Dorfplatz in St. Martin statt.<br />
Weitere Eindrücke der<br />
„Jungbläsertage Passeier“<br />
sind im Video unter<br />
folgendem Link zu<br />
sehen.<br />
KulturFenster<br />
13 01 <strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Kleine “<br />
Piezn“ spielen groß auf<br />
Die Jugendkapelle der Musikkapelle Peter Mayr Pfeffersberg im Portait<br />
Beim jährlichen Hüttenlager wird stets fleißig musiziert,<br />
wie auch diese Aufnhame aus dem Jahr 2019 beweist.<br />
und Mahr. Diese gehören allesamt zur Gemeinde<br />
Brixen und befinden sich zwischen<br />
550 und 1450 m ü. d. M. an der Westseite<br />
des Brixner Talkessels. Wir sind eine sehr<br />
junge Truppe, unsere Jungmusikant*innen<br />
sind im Durchschnitt neun Jahre „alt“.<br />
Grundsätzlich dürfen die Kinder bereits<br />
nach dem ersten Lernjahr bei uns einsteigen.<br />
Zur Zeit sind mehr Mädchen als<br />
Buben dabei.<br />
Klein, aber oho! Treffender könnte man die<br />
„Pfeffersberger Piezn“ kaum beschreiben.<br />
Seit nunmehr knapp 20 Jahren musiziert der<br />
Nachwuchs der Musikkapelle Peter Mayr<br />
Pfeffersberg gemeinsam.<br />
Steckbrief<br />
Name: Pfeffersberger Piezn<br />
Musikkapelle: Musikkapelle Peter Mayr<br />
Pfeffersberg<br />
Anzahl der Mitglieder: 19<br />
Musikalische Leitung: Bernhard Reifer<br />
Jugendleiterin: Sabine Leitner Reifer<br />
Im folgenden Gespräch mit Sabine Leitner<br />
Reifer, der Jugendleiterin der Musikkapelle<br />
Peter Mayr Pfeffersberg, wird die Jugendkapelle<br />
vorgestellt.<br />
Bernhard Reifer dirigiert die Bläserklasse<br />
Pfeffersberg (Dezember 2021)<br />
<strong>Kulturfenster</strong>: Sabine, wann wurde eure Jugendkapelle<br />
gegründet und wie seid ihr auf<br />
diesen ausgefallenen Namen gekommen?<br />
Sabine Leitner Reifer: Unsere Jugendkapelle<br />
wurde im September 2002 gegründet. Unser<br />
damaliger Jugendleiter und heutiger Kapellmeister<br />
Bernhard Reifer hatte diesen besonderen<br />
Namen vorgeschlagen: Er meinte,<br />
ein „Piez“ wäre etwas Kleines, wie etwa ein<br />
Küken, und die Jungmusikant*innen seien<br />
nicht viel größer gewesen.<br />
KF: Woher kommen eure Mitglieder und<br />
wie alt sind sie im Durchschnitt?<br />
Reifer: Unsere Jungmusikant*innen kommen<br />
von den acht Streuweilern des Pfeffersbergs:<br />
Gereuth, Tils, Pinzagen, Pairdorf,<br />
Tschötsch, Tötschling, Untereben<br />
KF: Welche sind die Höhepunkte in eurem<br />
Vereinsjahr?<br />
Reifer: Unser jährlicher Höhepunkt ist<br />
das mehrtägige Hüttenlager im Sommer,<br />
welches wir meistens auf einer urigen Berghütte<br />
verbringen. Dabei haben wir schon einiges<br />
an Abenteuern erlebt: Wir waren auf<br />
Hütten ohne Strom, schliefen im Heu oder<br />
mussten zum Zähneputzen ins Freie zum<br />
Brunnen. Zwischen Unwettern mit herumfliegenden<br />
Zelten und einer Hubschrauberlandung<br />
des Bergrettungsdienstes war alles<br />
dabei. Als wir 2019 auf der Seiser Alm<br />
waren, musste der Rettungshubschrauber<br />
des Aiut Alpin neben unserer Hütte eine<br />
Zwischenlandung machen, da es andernorts<br />
nicht möglich war. Zufällig handelte es<br />
sich beim Piloten um den Vater einer unserer<br />
Jungmusikantinnen.<br />
Was das restliche Jahr betrifft, so beginnt<br />
unsere Probenarbeit in der Regel nach<br />
dem Frühjahrskonzert der Musikkapelle.<br />
Wir versuchen im Laufe des Jahres immer<br />
ein bis zwei Konzerte zu organisieren, auch<br />
in Zusammenarbeit mit Kapellen aus der<br />
Umgebung. So hat beispielsweise bereits<br />
in Teis und in Villnöß ein Jugendkapellentreffen<br />
stattgefunden. Wir waren auch<br />
schon beim Brixner Faschingsumzug mit<br />
dabei. Weiters kommen bei uns außermusikalische<br />
Aktivitäten nicht zu kurz. So hat<br />
es auch öfters einen Kinoabend in unserem<br />
Probelokal gegeben.<br />
KF: Seid ihr im Moment musikalisch aktiv?<br />
Reifer: Im Moment macht unsere Jugendkapelle<br />
eine Pause, dafür haben wir unsere<br />
Kräfte in den letzten Monaten auf ein<br />
anderes Projekt konzentriert, und zwar auf<br />
die „Bläserklasse Pfeffersberg“. Da unser<br />
Tag der offenen Tür bereits zweimal nicht<br />
KulturFenster<br />
14 01 <strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
stattfinden konnte, haben wir einen anderen<br />
Weg gesucht, um neue Jungmusikant*innen<br />
zu gewinnen. Mit Unterstützung der beiden<br />
Grundschulen Tils und Tschötsch, der Musikschule<br />
Brixen und natürlich der Eltern<br />
der Schüler*innen, konnten wir das Projekt<br />
von Anfang Oktober bis Mitte Dezember<br />
durchführen. Insgesamt 44 Kinder im<br />
Alter zwischen sechs und elf Jahren waren<br />
mit dabei und erhielten in der Zweiergruppe<br />
einmal wöchentlich 40 Minuten Unterricht<br />
von ausgebildeten und motivierten<br />
Musikpädagog*innen. Die erste Phase des<br />
Projekts, die noch für alle verpflichtend war,<br />
endete mit einem Abschlusskonzert im Dezember.<br />
Die Mühen haben sich für die Musikkapelle<br />
auf jeden Fall gelohnt: Von den<br />
44 beteiligten Kindern haben sich etwas<br />
mehr als die Hälfte dafür entschieden, ihr<br />
Instrument weiter zu lernen.<br />
KF: Habt ihr auch euer persönliches Lieblingsstück?<br />
Reifer: Unsere Jungs und Mädels spielen<br />
am liebsten Filmmusik. Wir haben zwar kein<br />
Lieblingsstück an sich, möchten den Lesern<br />
zum Abschluss aber den Refrain unserer<br />
eigenen Hymne präsentieren. Die Melodie<br />
entspricht dem bekannten „Zwergenlied“.<br />
Der Text der acht Strophen wird bei jedem<br />
Hüttenlager etwas angepasst.<br />
Ein Piez ist grösser als man glaubt,<br />
ein Piez das Größte überhaupt,<br />
ein Piez spielt immer was er soll,<br />
ein Piez findet die Musig toll!<br />
Jugendleiterin Sabine Leitner Reifer<br />
Zwei Jungmusikantinnen der<br />
Pfeffersberger Piezn“ stellen sich naher vor:<br />
“<br />
Name: Amelie Unterrainer<br />
Alter: 10 Jahre<br />
Ich spiele: Fagott<br />
Darum habe ich mich für mein Instrument entschieden:<br />
Das Fagott hat mir immer schon gefallen.<br />
Das gefällt mir bei der Jugendkapelle am besten:<br />
Das Hüttenlager im Sommer<br />
Mein Lieblingsstück: „Der Herbst“ von Antonio Vivaldi<br />
Ein lustiges Ereignis bei der Jugendkapelle: Als es während einer Gemeinschaftsprobe<br />
beim Hüttenlager regnete, mussten wir die Probe in<br />
die Hütte verlegen - nur die Schlagzeuger mussten von draußen aus<br />
mitspielen, da sie nicht mehr Platz hatten. Natürlich öffneten wir die<br />
Fenster, dass wir uns gegenseitig hören konnten.<br />
Name: Annalena Stockner<br />
Alter: 11 Jahre<br />
Instrument: Klarinette<br />
Darum habe ich mich für mein Instrument entschieden:<br />
Die Klarinette hat mir immer schon sehr gut gefallen. Ich habe mit der<br />
Es-Klarinette angefangen, habe dann auf die C-Klarinette gewechselt<br />
und mittlerweile spiele ich die B-Klarinette.<br />
Das gefällt mir bei der Jugendkapelle am besten:<br />
Mir gefällt es, mit meinen Freunden zusammen zu musizieren und<br />
Spaß zu haben. Ich freue mich schon jetzt auf unser nächstes Konzert.<br />
Mein Lieblingsstück: „Circle of Life“ aus „Der König der Löwen“<br />
Ein lustiges Ereignis bei der Jugendkapelle: Toll ist immer unser Hüttenlager<br />
im Sommer. Unsere Betreuer denken sich immer super tolle<br />
Spiele aus. Einmal haben wir uns mit altem Zeitungspapier unsere eigenen<br />
Kleidungsstücke kreiert und haben dann eine Modenschau<br />
veranstaltet. Unser Hüttenlager ist einfach immer ein tolles Erlebnis.<br />
Interviews: Hannes Schrötter<br />
KulturFenster<br />
15 01 <strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
gehört & gesehen<br />
Das Bezirksjugendblasorchester<br />
rockt den Gustav-Mahler-Saal<br />
Begeisternde Konzerte des BJBO Bruneck in St. Johann und Toblach<br />
Mit der „Hymne für die Gefallenen“ aus dem Film „Der Soldat James Ryan“ und dem festlich gespielten „Schönfeld-Marsch“ bedankte<br />
sich das BJBO Bruneck für den Applaus.<br />
Zu Weihnachten spielte wieder das Bezirksjugendblasorchester<br />
Bruneck. Nach<br />
der Absage im Vorjahr und trotz der sich<br />
dauernd ändernden Coronaregeln haben<br />
die Verantwortlichen im Bezirksausschuss<br />
der Pustertaler Musikkapellen am Projekt<br />
festgehalten – mit Erfolg. Mit traditioneller<br />
Blasmusik und modernen Rhythmen begeisterten<br />
die jungen Musikantinnen und Musikanten<br />
unter der Leitung von Daniel Niederegger<br />
zum Jahresende das Publikum im<br />
Ahrntal und im Hochpustertal.<br />
Eigentlich hätte das Orchesterprojekt bereits<br />
im Vorjahr verwirklicht werden und<br />
gleichzeitig das Diplomkonzert von Daniel<br />
Niederegger sein sollen. Coronabedingt<br />
musste das Vorhaben aufgeschoben werden.<br />
Der junge Musiker, seines Zeichens<br />
Bezirkskapellmeister-Stellvertreter im Pustertal<br />
sowie Kapellmeister der Musikkapellen<br />
von St. Martin/Gsies und St. Jakob/<br />
Ahrntal, hat inzwischen sein Dirigierstudium<br />
abgeschlossen. Er freute sich umso<br />
mehr, dass das Konzertprojekt nun doch<br />
noch verwirklicht werden konnte.<br />
Mit der Rhapsodie „Prevision“ beschreibt<br />
Jan de Haan eindrucksvoll das Aufwachsen<br />
und Erwachsenwerden seines Enkels.<br />
Niederegger hat dieses Werk nicht zufällig<br />
gewählt. Zum einen steht es symbo-<br />
Trotz der unsicheren<br />
Coronalage haben sie<br />
am Projekt des BJBO<br />
Bruneck 2021 festgehalten<br />
(v.l.) - Bezirksobmann<br />
Johann<br />
Hilber, Daniel Niederegger<br />
und Bezirksjugendleiter<br />
Matthias<br />
Kirchler<br />
KulturFenster<br />
16 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Redaktionsschluss für<br />
Blasmusik<br />
lisch für die musikalische Entwicklung der<br />
jungen Orchestermitglieder, zum anderen<br />
stand es bereits 2010 auf dem Programm<br />
des Bezirksjugendblasorchesters, als er<br />
selbst als junger Posaunist unter der Leitung<br />
von Friedl Pescoller und Sigisbert Mutschlechner<br />
mitspielte. Mit der 3-sätzigen<br />
Suite „Tirol 1809“ von Sepp Tanzer, die<br />
der Dirigent für seinen Studienabschluss<br />
neu instrumentiert hatte, der schwungvollen<br />
„Emperata Ouvertüre“ von Claude<br />
T. Smith und den norwegischen Impressionen<br />
„Mandålen Landscapes“ von Philip<br />
Sparke begeisterte das junge Orchester<br />
das Publikum am 23. Dezember im<br />
Mehrzwecksaal von St. Johann und am<br />
Stephanstag im Gustav-Mahler-Saal in<br />
Toblach. Die Verantwortlichen rund um<br />
Bezirksobmann Johann Hilber, Bezirksjugendleiter<br />
Matthias Kirchler und den Dirigenten<br />
verstanden es, während der intensiven<br />
Probenzeit seit Mitte Oktober die<br />
Corona-Fragen auszublenden und die 60<br />
Musikantinnen und Musikanten aus 22<br />
Pusterer Musikkapellen für die Musik zu<br />
begeistern. Man habe sich laufend an die<br />
veränderten Situationen angepasst, bestätigte<br />
Kirchler. Seit Anfang Dezember<br />
wurden alle – Geimpfte und Ungeimpfte<br />
– vor jeder Probe und den Auftritten getestet:<br />
„Das ist ein entsprechender organisatorischer<br />
und fi nanzieller Mehraufwand,<br />
aber es lohnt sich allemal.“ Zudem<br />
musste die ursprünglich geplante „Rhapsodie<br />
in Blue“ von George Gershwin, bei<br />
der Prof. Walter Ratzek den Solopart spielen<br />
sollte, kurzfristig wegen der unklaren<br />
„<br />
Die Spielfreude, aber vor allem<br />
auch die Freude, endlich wieder vor<br />
Publikum zu spielen, war bei den<br />
beiden Konzerten förmlich sichtund<br />
hörbar.<br />
„<br />
Stephan Niederegger<br />
und unsicheren Reisebestimmungen gestrichen<br />
werden.<br />
Die Spielfreude, aber vor allem auch die<br />
Freude, endlich wieder vor Publikum zu<br />
spielen, war bei den beiden Konzerten förmlich<br />
sicht- und hörbar. Ein selten gespieltes<br />
Medley der schwedischen Popgruppe<br />
ABBA, aus der Feder von Guido Rennert,<br />
dem Haus- und Hofarrangeur des Musikkorps<br />
Deutschen Bundeswehr, war der fulminante<br />
Abschluss dieses Konzertreigens.<br />
Nach dem Konzert fragte einer der jungen<br />
Posaunisten den Dirigenten, wann<br />
die nächste Probe sei. Ein schöneres Lob<br />
könnte es wohl kaum geben.<br />
Stephan Niederegger<br />
Hörbeispiele<br />
Hymn to The Fallen<br />
Schönfeld-Marsch<br />
Aus der Redaktion<br />
Ihre Beiträge (Texte und Bilder) für die Blasmusikseiten<br />
senden Sie bitte an: kulturfenster@vsm.bz.it<br />
die nächste Ausgabe des<br />
„KulturFensters“ ist:<br />
Freitag, 11. März <strong>2022</strong><br />
KulturFenster<br />
17 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
hinausgeblickt<br />
bewegt<br />
Musik in Bewegung<br />
Workshop mit der showband.CH<br />
in Jenesien<br />
https://vsm.bz.it<br />
30.04.<strong>2022</strong><br />
Cäcilienkonzert der<br />
Musikkapelle Auer<br />
Erinnerung an den 120. Geburtstag von Sepp Thaler<br />
Die Musikkapelle Auer beim Cäcilienkonzert 2021 in der Aula Magna in Auer<br />
Fotos: Peter Simonini<br />
Nach einem Jahr Pause fand am 13. November<br />
2021 in der Aula Magna in Auer wieder<br />
das traditionelle Cäcilienkonzert der<br />
Musikkapelle Auer statt.<br />
Im Gedenken an den 120. Geburtstag von<br />
Sepp Thaler umrahmten zwei seiner Werke<br />
das Konzertprogramm, welches Kapellmeister<br />
Arnold Leimgruber in sehr gelungener<br />
Weise zusammengestellt hatte. So<br />
begrüßten etwa die herrlichen Blechbläserklänge<br />
aus Thalers Werk „Präludium<br />
Heroicum“ die Zuhörer*innen.<br />
Weiter ging es im Programm, hervorragend<br />
moderiert von Maria Magdalena<br />
Graiff-Zwerger, mit Arthur Sullivans Operette<br />
„The Pirates of Penzance“, in einer<br />
Bearbeitung von John Philip Sousa.<br />
Das melodische und gänsehautreife, aber<br />
auch mitreißende Stück „Emperor“ von<br />
Thierry Deleruyelle ließ die Zuhörer endgültig<br />
in die Welt der Blasmusik eintauchen.<br />
Direkt darauf folgte das bekannte<br />
Werk „Gabriel’s Oboe“ von Ennio Morricone.<br />
Die Hauptmelodie wurde dabei bravourös<br />
von der Solistin Anna Sofia Franceschini<br />
interpretiert.<br />
Auch Oliver Waespis dreiteilige Komposition<br />
"Caledonia" überzeugte mit solistischen<br />
Passagen, dynamischen Kadenzen<br />
und ausgewogenen Tutti-Klängen.<br />
Ein sehr bekanntes Stück präsentierte die<br />
Musikkapelle anschließend mit Dimitri Shostakovitchs<br />
„The Second Waltz“, dessen<br />
Melodie in den Ohren des einen oder anderen<br />
Zuhörers vielleicht noch nachhallt.<br />
Mit dem Pasodoble „Puenteareas“ von<br />
Reveriano Soutullo wurde das Publikum<br />
nochmals in die spanische Musikwelt entführt.<br />
Ausgefeilt kontrastierende Piano- und<br />
Fortestellen charakterisieren dieses Werk.<br />
Einen weiteren Ausflug in die Filmmusik<br />
wagte die Musikkapelle Auer am Ende des<br />
Programms mit dem spannungsgeladenen<br />
Medley „At the Movies With Danny Elfman“.<br />
Auf den langanhaltenden Applaus des Publikums<br />
folgten zum Abschluss die beiden<br />
Zugaben „Perfect“ von Ed Sheeran und der<br />
Marsch „Schloss Auer“ von Sepp Thaler,<br />
die das Konzert treffend abrundeten.<br />
Jasmine Oberrauch<br />
KulturFenster<br />
18 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
persönlich<br />
Sepp Thalers musikalisches Erbe<br />
Eine Analyse von VSM-Ehrenkapellmeister Gottfried Veit<br />
Im „KulturFenster“ <strong>Nr</strong>. 3/2021 (S.39) hat<br />
VSM-Ehrenkapellmeister Gottfried Veit bereits<br />
an den großen (Blas-)Musikpionier<br />
Südtirols anlässlich seines 120. Geburtstages<br />
am 9. Juni erinnert. Am kommenden<br />
10. März jährt sich zum 40. Mal Sepp Thalers<br />
Todestag. Veit analysiert dazu im folgenden<br />
Beitrag, was von Thalers vielfältigem<br />
musikalischen Erbe geblieben ist.<br />
Kreativität als<br />
„Lebenselixier“<br />
Die deutsche Schriftstellerin Hedwig Maria<br />
Staffa sagte einmal: „Kreativität kennt<br />
weder Monotonie noch Langeweile, sie ist<br />
eine optimale Begleiterin, in guten wie in<br />
schlechten Lebenslagen“. Sepp Thaler war<br />
ohne Zweifel in mehrerlei Hinsicht ein kreativer<br />
Mensch. Dies kommt nicht nur in<br />
seinen über 100 Kompositionen, sondern<br />
auch in seinem Leben immer wieder deutlich<br />
zum Ausdruck.<br />
Um sich ein musikalisches Fundament zu<br />
schaffen, ging Sepp Thaler bereits als Kind<br />
regelmäßig zum damaligen Kooperator Nikolaus<br />
Pfaffstaller in Auer, um Gesangs- und<br />
Klavierunterricht zu nehmen. Da seine Vorfahren<br />
Kaufleute waren, wurde Sepp Thaler<br />
in seinen jungen Jahren in die Handelsschule<br />
nach Feldkirch geschickt. Auch dort<br />
war er kreativ genug, neben der Ausbildung<br />
zum Kaufmann bei Prof. Alois Both Unterricht<br />
in Klavier- und Orgelspiel zu nehmen.<br />
In seine engere Heimat zurückgekehrt, betätigte<br />
er sich – neben seinen Brotberuf als<br />
Kaufmann – spontan und mit größter Begeisterung<br />
auch als Kapellmeister, Chorleiter<br />
und Organist. 1937 trat Thaler als Aktivist<br />
dem Völkischen Kampfring Südtirol<br />
bei. Als ervom damaligen faschistischen<br />
Regime aus politischen Gründen in einem<br />
„Scheinprozess“ vom Tribunal in Trient zu<br />
fünf Jahren Haft verurteilt wurde, setzte er<br />
wieder seine Kreativität ein und gründete<br />
im Gefängnis von Trient mit seinen Leidensgenossen<br />
einen Männerchor, der sogleich<br />
das Südtiroler Heimatlied „Wohl ist<br />
die Welt so groß und weit“ anstimmte. Dies<br />
wurde von der Gefängnisleitung alles eher<br />
als gerne gesehen, aber brachte Licht in<br />
Anm.d.Red.: Zur historischen Einordnung von Sepp Thalers Tätigkeit und Wirken wird auf die im<br />
Universitätsverlag Wagner erschienene Publikation „In Treue fest durch die Systeme“ verwiesen.<br />
diese dunkle Zeit. Als er im Zuge der Option<br />
vorzeitig das Gefängnis verlassen durfte,<br />
jedoch des Landes verwiesen wurde, kam<br />
er nach Innsbruck. In der Tiroler Landeshauptstadt<br />
kam er schon bald in Kontakt<br />
mit Josef Eduard Ploner und Sepp Tanzer,<br />
die zur damaligen Zeit zu den prominentesten<br />
Vertretern des Tiroler NS-Musikbetriebes<br />
zählten. Obwohl Sepp Thaler dort<br />
u. a. auch die Innsbrucker HJ-Kapelle lei-<br />
KulturFenster<br />
19 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
persönlich<br />
Das „Präludium<br />
heroicum“ mit der<br />
Widmung an den<br />
Lehrer Josef Eduard<br />
Ploner<br />
Im Werk „Die Etsch“<br />
beschreibt Sepp<br />
Thaler mit musikalischen<br />
Ausdrucksmitteln<br />
den Verlauf<br />
des Flusses von seinem<br />
Ursprung bis<br />
zur Mündung.<br />
Der Marsch „Mein<br />
Heimatland“ beinhaltet<br />
im Trio<br />
das bekannte Lied<br />
„Wohl ist die Welt<br />
so groß und weit“.<br />
KulturFenster<br />
20 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Blasmusik<br />
Mit spitzem Humor<br />
nimmt Sepp Thaler,<br />
der selbst passionierter<br />
Kartenspieler<br />
war, im „Perlagger-<br />
Lied“ die Kartenspieler<br />
und ihre Weinseligkeit<br />
aufs Korn.<br />
tete, war er wieder kreativ genug, um parteipolitisch<br />
eher im Hintergrund zu bleiben.<br />
Er nützte beispielsweise spontan die<br />
Gelegenheit, beim damals sehr geschätzten<br />
Tiroler Komponisten Josef Eduard Ploner<br />
Unterricht in Harmonielehre und Kontrapunkt<br />
zu nehmen. Als Thaler im Jahre<br />
1943 wieder nach Südtirol zurückkehren<br />
durfte, war seine musikalische Kreativität<br />
natürlich allerorts gefragt. Er leitete<br />
Musikkapellen und Chöre, wurde in Auer<br />
wieder Organist und erhielt auch den Auftrag,<br />
das Blasmusikwesen in Südtirol zu<br />
reorganisieren. Der damalige Höhepunkt<br />
seiner musikalischen Karriere war sicherlich<br />
die Ernennung zum Landeskapellmeister<br />
des Verbandes Südtiroler Musikkapellen<br />
im Jahre 1948. Im VSM hatte er dann<br />
bis 1980 – ganze 32 Jahre lang – die Möglichkeit,<br />
all sein musikalisches Können und<br />
Wissen vielfältig einzusetzen.<br />
Das kreative Schaffen<br />
Sepp Thalers<br />
Denkt man an die Kreativität Sepp Thalers,<br />
so bringt man diese vor allem mit seinen<br />
Kompositionen in Verbindung. Zu seinem<br />
kompositorischen Gesamtwerk zählen die<br />
symphonische Dichtung „Die Etsch“, fünf<br />
Konzertouvertüren, acht festliche Blasmusikstücke,<br />
zwei Suiten, fünf Potpourris,<br />
drei Konzertwalzer, fünf Solostücke mit<br />
Blasorchesterbegleitung, rund 40 Märsche,<br />
acht kirchliche Blasmusikwerke, über 20<br />
volkstümliche Männerchorlieder, drei Singspiele<br />
und eine ganze Reihe Gelegenheitskompositionen.<br />
Sepp Thaler ist zudem auch<br />
Verfasser mehrerer Gedichte.<br />
Zu seinem 40. Todestag ist es legitim, sich<br />
die Frage zu stellen: „Was ist von all seinen<br />
Werken geblieben?“ Für einen Komponisten<br />
ist es ebenfalls legitim zu fragen:<br />
„Welche Werke werden ihn möglichst lange<br />
überleben?“ Bei Sepp Thaler könnten dies<br />
vor allem vier Werke sein: das „Präludium<br />
heroicum“, die symphonische Dichtung<br />
„Die Etsch“, der Marsch „Mein Heimatland“<br />
und das „Perlagger-Lied“.<br />
Blasmusik von<br />
nachhaltigem Wert<br />
Das heldenhafte Vorspiel für Blasorchester<br />
mit dem Titel „Präludium heroicum“ entstand<br />
noch während seiner Lehrzeit bei<br />
Josef Eduard Ploner, erschien aber erst im<br />
Jahre 1961 beim Philipp Grosch-Verlag in<br />
München im Druck. Diese Komposition verarbeitet<br />
vordergründig zwei markante Themen<br />
– beinhaltet u. a. ein ausdruckstarkes<br />
Fugato – und besticht den Hörer auch ohne<br />
falsches Pathos.<br />
Seine umfangreichste Komposition für Blasorchester<br />
„Die Etsch“ bezeichnet Sepp<br />
Thaler als „dreiteiliges Werk“. Es gehört<br />
eindeutig zur Gattung der Programm-Musik<br />
und erzählt mit klanglichen Mitteln den<br />
Werdegang des größten Flusses Südtirols,<br />
von seiner Quelle bis zur Mündung. Erstmals<br />
erklungen ist dieses Blasorchesterwerk<br />
beim Festkonzert anlässlich des ersten<br />
Südtiroler Landesmusikfestes 1951<br />
im Kursaal von Meran. Die Uraufführung<br />
wurde von der Musikkapelle Algund übernommen,<br />
die zu diesem besonderen Anlass<br />
Sepp Thaler selbst dirigierte. Das Notenmaterial<br />
dieser Komposition wurde damals<br />
noch im Lichtpausverfahren von Emil Hornof<br />
vervielfältigt, um es auch anderen Klangkörpern<br />
zugänglich zu machen. Die eigentliche<br />
Drucklegung erfolge erst 18 Jahre<br />
später, als der deutsche Musikverlag Wilhelm<br />
Halter „Die Etsch“ 1969 in sein Verlagsprogramm<br />
aufnahm. Seither erlebte<br />
diese „Originalkomposition für Blasorchester“,<br />
wie man damals mit Nachdruck anmerkte,<br />
zahlreiche Aufführungen.<br />
Von den rund 20 im Druck vorliegenden<br />
und einer ungefähr gleichen Anzahl nicht<br />
gedruckter Märsche aus der Feder Sepp<br />
Thalers sticht vor allem einer hervor: es<br />
ist der Marsch „Mein Heimatland“. Diese<br />
wohl meistgespielte Marschkomposition<br />
Thalers entstand bereits im Jahre 1944,<br />
wurde aber erst 1966 beim Musikverlag<br />
Georg Bauer in Karlsruhe veröffentlicht.<br />
Sie ist bewusst traditionell gehalten, verhältnismäßig<br />
leicht ausführbar und verdankt<br />
ihre Popularität nicht zuletzt jenem<br />
Umstand, dass sie im Trio das allseits beliebte<br />
Südtiroler Heimatlied „Wohl ist die<br />
Welt so groß und weit“ beinhaltet. Dieser<br />
praxisorientierte Marsch, der die Musikalität<br />
der Ausführenden besonders anspricht,<br />
wurde im Laufe der Zeit sozusagen zur inoffiziellen<br />
Hymne Südtirols.<br />
Eine Gasthausepisode wird<br />
zum bekannten Lied<br />
Von den zahlreichen dialektalen Männerchorliedern,<br />
die am Schreibtisch Sepp Thalers<br />
entstanden sind, ist eines besonders<br />
oft zu hören: das „Perlagger-Lied“. Wie<br />
bei allen seinen Männerchorliedern verfasste<br />
Thaler auch bei diesem Lied nicht<br />
nur den Text und die Melodie selbst, sondern<br />
steuerte auch noch einen hübschen,<br />
ins Ohr gehenden, vierstimmigen Satz bei.<br />
Das „Perlagger-Lied“ ist inhaltlich die authentische<br />
Schilderung einer wahren Begebenheit<br />
anlässlich eines Kartenspiels<br />
im Gasthaus „Zur Rose“ in Auer, dem Geburts-<br />
und Wohnort Sepp Thalers. Dieses<br />
mit viel Humor gespickte Lied liegt bereits<br />
seit vielen Jahren beim Musikverlag Carl<br />
Haslinger in Wien gedruckt vor.<br />
Gottfried Veit<br />
KulturFenster<br />
21 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
hinausgeblickt<br />
EUREGIO JBO<br />
Uraufführung: 50 Jahre<br />
Zweites Autonomiestatut<br />
im Kursaal Meran<br />
https://vsm.bz.it<br />
07.05.<strong>2022</strong><br />
Die Blasmusik ist<br />
sein Leben<br />
Zum 80. Geburtstag von Rudolf Troger<br />
Der Jubilar Rudolf Troger mit Erwin Hölzl im Kreise seiner „Goldies"<br />
Vor Kurzem hat Rudolf "Rudl" Troger seinen<br />
80. Geburtstag gefeiert. Da er weit über<br />
Girlan hinaus bekannt ist, trudelten Gratulationen<br />
aus allen Himmelsrichtungen ein.<br />
Bereits am Vorabend des 18. Dezember<br />
überraschte eine Abordnung der<br />
Bürgerkapelle Gries mit Kapellmeister<br />
Georg Thaler den Jubilar mit einem Geburtstagsständchen.<br />
Riesenfreude<br />
Nicht minder freute sich Rudl über den<br />
musikalischen Weckruf am Geburtstagsmorgen,<br />
der ihm vom VSM-Ausschuss des<br />
Bezirks Bozen überbracht wurde, ein Zeichen<br />
des Dankes für die langjährige Tätigkeit<br />
Trogers als Kassier und Obmann<br />
des Bezirkes Bozen.<br />
Man darf getrost sagen, dass der Jubilar<br />
sein Herz an die Blasmusik verloren<br />
hat. Viele Jahrzehnte hindurch war er in<br />
verschiedenen Funktionen für den VSM<br />
tätig. So ist Rudolf Troger Ehrenmitglied<br />
der Bürgerkapelle Gries, Ehrenobmann<br />
des Bezirks Bozen im VSM und Gründer<br />
der Seniorenkapelle „Die Goldies“.<br />
Der Geburtstag war wie aus dem Bilderbuch:<br />
strahlender Sonnenschein und<br />
ein Bläser-Quartett von Freunden empfingen<br />
den Jubilar, die Familie und geladenen<br />
Gäste im Hotel „Holzner“ in Oberbozen<br />
mit klingendem Spiel. Eine Gruppe<br />
der „Goldies“ wartete mit zwei Uraufführungen<br />
auf, die eigens für den Jubilar<br />
komponiert wurden: „Ein Hoch dem Jubilar“<br />
von Konrad Kofler und die „Rudl-<br />
Polka“ von Karl Hanspeter, arrangiert von<br />
Dieter Viehweider.<br />
Organisator und Freund Erwin Hölzl überreichte<br />
Rudolf Troger einen Abzug der<br />
beiden Musikstücke im Bildformat. Von<br />
Musik und Gesang begleitet endete die<br />
überaus gelungene Feier. Erfreut über<br />
viele freundschaftliche Begegnungen und<br />
gut gelaunt verabschiedete der Jubilar<br />
die Geburtstagsgäste mit dem Wunsch,<br />
alle schon bald gesund wiederzusehen.<br />
Veronika Andrich<br />
KulturFenster<br />
22 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
komponiert<br />
„Elegia Amarcord“<br />
von Heinrich Unterhofer<br />
Eine Nostalgie der Vergangenheit ...<br />
vom Blechbläserquintett zum Blasorchester<br />
Heinrich Unterhofer, ein künstlerisch<br />
begabter wie weltoffener<br />
Südtiroler Musiker mit<br />
Sarner Wurzeln, kann auf eine<br />
ebenso vielfältige wie erfolgreiche<br />
Tätigkeit als Komponist,<br />
Dirigent und Videokünstler<br />
verweisen.<br />
Musikalischer<br />
Werdegang<br />
Heinrich Unterhofer, 1958 in<br />
Sarnthein geboren, erlangte<br />
nach dem Beginn seines Studiums<br />
am Konservatorium<br />
„Claudio Monteverdi“ in Bozen<br />
bei Francesco Valdambrini<br />
(Komposition) und Orgel-Unterstufe<br />
bei Ezechiele<br />
Podavini 1992 sein Diplom<br />
in Komposition bei Maestro<br />
Azio Corghi am Konservatorium<br />
„Giuseppe Verdi“ in Mailand.<br />
1985/86 besuchte er<br />
Kompositionskurse in Siena<br />
an der „Accademia Chigiana”.<br />
1987/88 nahm er am<br />
Kompositionskurs bei Sylvano Bussotti in<br />
Fiesole teil.<br />
Akademische und<br />
didaktische Tätigkeit<br />
Heinrich Unterhofer unterrichtete Harmonielehre<br />
am Konservatorium „Pedrollo" in<br />
Vicenza und Komposition an den Konservatorien<br />
von Bari und Cosenza. Seit dem<br />
Jahr 1992 hat er die Professur für Komposition<br />
am Konservatorium „Claudio Monteverdi“<br />
in Bozen inne. Von 1993 bis 1995<br />
war Heinrich Unterhofer künstlerischer<br />
Leiter der Abteilung Musik im Südtiroler<br />
Künstlerbund (SKB) Bozen. Von 2014 bis<br />
2017 war er Rektor der Hochschule für<br />
Musik „Claudio Monteverdi“ in Bozen.<br />
Zurzeit unterrichtet er dort Komposition<br />
und Komposition für Elektronische Musik.<br />
Für das Jahr 2018/19 hat er einen Lehrauftrag<br />
im Fachbereich Medienproduktion<br />
„Freies Projekt“ an der Hochschule<br />
OWL in Detmold erhalten.<br />
Heinrich Unterhofer<br />
als Komponist<br />
Als wichtige Auftragswerke komponierte<br />
er die Kinderoper „UFO” für den Südtiroler<br />
Sängerbund, das Singspiel „Der große<br />
Mäuseprozess zu Glurns” für die Vereinigten<br />
Bühnen Bozen (VBB), die Kirchenoper<br />
„Genesis Requiem” für das Festival<br />
Musik und Kirche von<br />
Trient, Bozen und Klausen<br />
und für das Kunstfestival<br />
von Sella di Borgo Valsugana.<br />
2004/2005 wurde die<br />
Konzertsaison des Haydn-<br />
Orchesters von Bozen und<br />
Trient mit seinem sinfonischen<br />
Werk „Arcus pulcher<br />
aeteri" eröffnet und<br />
2005 seine Komposition<br />
für Orchester „Francesco e<br />
Chiara D’Assisi“ im Rahmen<br />
der „Incontri di musica Sacra<br />
Contemporanea“ unter<br />
eigenem Dirigat in Klausen<br />
und Rom uraufgeführt. Auch<br />
gibt es mehrere Aufnahmen<br />
und Aufzeichnungen für die<br />
RAI in Bozen und Trient,<br />
für den ORF in Innsbruck<br />
und für das Mailänder Label<br />
M.A.P. Seine Werke wurden<br />
von Rugginenti (Mailand),<br />
Edipan (Rom), Pizzicato<br />
(Udine), Kliment (Wien) und<br />
A. Böhm & Sohn (Augsburg)<br />
veröffentlicht. Sein Liederzyklus<br />
„Polnische Dörfer” zu<br />
Texten von Sepp Mall wurde am ORF Innsbruck<br />
uraufgeführt und verzeichnete bei<br />
der Wiederaufführung durch das „Amarida<br />
Ensemble" großen Erfolg.<br />
Sein Streichquartett „SUDOKU“ wurde<br />
vom Minguett Quartett (Köln) uraufgeführt.<br />
Im April 2014 wurde die Uraufführung<br />
seines Werkes „Canticum Ascensionum<br />
IV“ durch das Haydnorchester von<br />
Bozen und Trient gespielt. Im Mai 2014<br />
wurde seine multimediale Oper „Das<br />
Narrenschiff“, eine Auftragskomposition<br />
für die OWL Biennale mit Einbeziehung<br />
der Wellenfeldsynthese, an der HfM in<br />
Detmold uraufgeführt. 2018 wurde sein<br />
„Amor Requiem“ für Frauenchor, Viola<br />
und Orgel in der Kathedrale San Vitale<br />
in Ravenna uraufgeführt.<br />
KulturFenster<br />
23 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
komponiert<br />
„Elegia<br />
Amarcord“<br />
Als ich noch ein junger Komponist war, habe<br />
ich mir dieses Stück für ein Blechbläserquintett<br />
ausgedacht. Es blieb in der Schublade,<br />
wie es bei neuer Musik oft der Fall<br />
ist, aber vor Kurzem nahm sich ein gutes<br />
Blechbläserquintett die Mühe es aufzuführen.<br />
Ich persönlich war begeistert und<br />
gleichzeitig auch ein bisschen verlegen,<br />
schließlich war es eine jugendliche Komposition,<br />
und so besuchte ich das Konzert<br />
eher widerwillig. Zu meiner großen Überraschung<br />
war die Aufführung wirklich bewegend<br />
und hatte eine große Wirkung auf<br />
mich und das Publikum.<br />
Nachdem ich das Stück und sein kompositorisches<br />
Potenzial wiederentdeckt hatte,<br />
dachte ich daran, es für ein symphonisches<br />
Orchester zu entwickeln. Also überlegte ich<br />
mir, die Komposition wieder aufzunehmen,<br />
die Idee zu vertiefen und auszuarbeiten.<br />
Das ursprüngliche kompositorische Material<br />
wollte ich aber beibehalten und es erneut<br />
dem Blechbläserquintett anvertrauen, um<br />
es dann mit der großen Textur eines symphonischen<br />
Blasorchesters zu verschmelzen.<br />
Die Herausforderung, die ich anscheinend<br />
gewonnen habe, bestand darin, die<br />
kompositorische Sprache meiner Jugend<br />
mit meiner heutigen künstlerisch-kreativen<br />
Vision zu verbinden.<br />
Der Untertitel „Amarcord", den ich instinktiv<br />
mit dem berühmten Film von Federico<br />
Fellini verbinde, erklärt das Thema, mit<br />
dem ich mich beschäftige: persönliche<br />
Erinnerungen, die Nostalgie der Vergangenheit,<br />
die musikalisch auftaucht und<br />
eine Art Programmmusik hervorbringt,<br />
und von Momenten, die ein Musiker und<br />
Mensch erlebt hat.<br />
Heinrich Unterhofer<br />
Ottavino<br />
Flauto 1-2<br />
Oboe 1-2<br />
Clarinetto in Mib<br />
Clarinetto in Sib 1<br />
Clarinetto in Sib 2-3<br />
Clarinetto contralto in Mib<br />
Clarinetto basso in Sib<br />
Clarinetto contrabbasso in Sib<br />
Fagotto 1-2<br />
Sax contralto in Mib 1<br />
Sax contralto in Mib 2<br />
Sax tenore in Sib<br />
Sax baritono in Mib<br />
Tromba in Sib 1<br />
Tromba in Sib 2<br />
Tromba in Sib 3<br />
Corno in Fa 1-3<br />
Corno in Fa 2-4<br />
Cornetta in Sib 1-2<br />
{<br />
{<br />
°<br />
{<br />
{<br />
Trombone 1<br />
{<br />
Trombone 2<br />
Trombone 3<br />
Trombone basso<br />
Eufonio 1-2<br />
Tuba 1-2<br />
Timpani<br />
Incudine<br />
Triangolo<br />
Campane tubolari<br />
Piatto sospeso<br />
Piatti<br />
Tam-tam<br />
Tambourine<br />
Rullante<br />
Gran cassa<br />
Glockenspiel<br />
Vibrafono<br />
Marimba<br />
Contrabbasso a corde<br />
Con ampio respiro q = 54<br />
°<br />
& ∑ ∑ ∑ ∑<br />
?<br />
¢<br />
∑ ∑ ∑ ∑<br />
°<br />
& # # # ∑ ∑ ∑ ∑<br />
¢ & # # # ∑ ∑ ∑ ∑<br />
?<br />
¢<br />
∑ ∑ ∑ ∑<br />
Con ampio respiro q = 54<br />
° ? ∑ ∑ ∑ ∑<br />
¢ / ∑ ∑ ∑ ∑<br />
°<br />
/ ∑ ∑ ∑ ∑<br />
& ∑ ∑ ∑ ∑<br />
/ ∑ ∑ ∑ ∑<br />
/ ∑ ∑ ∑ ∑<br />
¢ / ∑ ∑ ∑ ∑<br />
°<br />
/ ∑ ∑ ∑ ∑<br />
/ ∑ ∑ ∑ ∑<br />
¢ / ∑ ∑ ∑ ∑<br />
°<br />
{ & ∑ ∑ ∑ ∑<br />
{<br />
{<br />
5<br />
4<br />
5<br />
4<br />
mf p mp mf p mf<br />
Solo<br />
∑ b nœ<br />
b nœ<br />
‰ œ b œ n˙<br />
œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙<br />
><br />
> > ><br />
mp mf mf p p mf p<br />
Solo<br />
> > ><br />
b˙<br />
b˙<br />
œ ∑ ‰ œ b œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙<br />
><br />
mf p p p p mf p<br />
mf p p p p mf p<br />
? ∑ ∑ ∑ ∑<br />
Solo<br />
?<br />
˙<br />
b˙<br />
w<br />
œ<br />
˙ ˙ œ œ œ œ ˙<br />
><br />
mf p mf p<br />
ppp f p<br />
? ∑ ∑ ∑ ∑<br />
5<br />
4<br />
ELEGIA<br />
Amarcord<br />
& ∑ ∑ ∑ ∑<br />
& ∑ ∑ ∑ ∑<br />
& # # # ∑ ∑ ∑ ∑<br />
& # # ∑ ∑ ∑ ∑<br />
& # # ∑ ∑ ∑ ∑<br />
& # # # ∑ ∑ ∑ ∑<br />
& # # ∑ ∑ ∑ ∑<br />
& # # ∑ ∑ ∑ ∑<br />
& # # # ∑ ∑ ∑ ∑<br />
& # # ∑ ∑ ∑ ∑<br />
& # #<br />
& # #<br />
Con ampio respiro q = 54<br />
> Solo > n><br />
œ<br />
˙<br />
œ ˙ œ nœ<br />
b<br />
∑ ‰ œ nœ<br />
b nœ<br />
b nœ<br />
nœ<br />
b œ œ n> œ œ ˙ œ œ<br />
œ œ<br />
& # # ∑ ∑ ∑ ∑<br />
&<br />
& ∑ ∑ ∑ ∑<br />
& # # ∑ ∑ ∑ ∑<br />
?<br />
œ<br />
œ œ œ<br />
> > ˙<br />
> ˙ b ><br />
Solo b˙<br />
b<br />
œ œ œ œ œ b œ œ ˙<br />
∑ ‰<br />
b œ ˙<br />
? ∑ ∑ ∑ ∑<br />
& ∑ ∑ ∑ ∑<br />
& ∑ ∑ ∑ ∑<br />
? ∑ ∑<br />
¢<br />
∑ ∑<br />
° ? ∑ ∑ ∑ ∑<br />
¢<br />
Edited by: EDIZIONI MUSICALI M.BOARIO & C. S.a.s. C.so Galileo Ferraris, 7- Torino - Italy - Phone +39.3392791793<br />
Copyright 2021 by Edizioni Musicali M. Boario & C. S.a.s. Tutti i diritti riservati - Tous droits réservés - All rights reserved<br />
Printed in Italy - Imprimé en Italie.<br />
E.B. 158<br />
3<br />
Heinrich Unterhofer<br />
Ein Ausschnitt aus der Partitur zu “Elegia Amarcord”<br />
und der QR-Link zum Probehören<br />
3<br />
3<br />
œ œ # œ<br />
b œ<br />
1<br />
In folgenden Links zu Soundcloud und YouTube sind Beispiele des künstlerischen Schaffens von Heinrich Unterhofer zu finden.<br />
https://soundcloud.com/<br />
heinrichunterhofer<br />
https://www.youtube.com/watch?v=ky_DR_VuL1A<br />
https://www.youtube.com/watch?v=Aik3qYmds-I<br />
https://www.youtube.com/watch?v=bjsHdxODtQ8<br />
https://www.youtube.com/watch?v=oqPZZg87PxA<br />
KulturFenster<br />
24 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Blasmusik<br />
Medium Film und<br />
Videokunst<br />
Sein Schaffen hat er auf das Medium Film<br />
und Videokunst ausgedehnt. In beiden Disziplinen<br />
ist er sehr erfolgreich, was ihm anlässlich<br />
seiner Auftritte beim Festival „TV<br />
Zero“ (Premio speciale) in Meran, beim<br />
Filmmusikwettbewerb „Rimusicazioni Harlock“<br />
in Bozen (dritter Preis) und beim internationalen<br />
Festival „Religion Today“ in<br />
Trient bestätigt wurde. Sein Werk „Train“<br />
aus seiner multimedialen Oper „Borderline“<br />
wird zunächst exklusiv vom ORF und<br />
anschließend anlässlich des Transart-Festivals,<br />
ausgestrahlt. Seine experimentelle<br />
Musik wird im Rahmen wichtiger Ausstellungen<br />
uraufgeführt,wie u.a. in „Augenmusik“,<br />
„Words Place“ im Museum für<br />
Zeitgenössische Kunst in Genf, bei „Seven<br />
Sins“ und bei „POINT OF LIGHT“,<br />
einer Ausstellung im Museion – Museum<br />
für Moderne und Zeitgenössische Kunst<br />
in Bozen.<br />
Vielseitiger Dirigent<br />
Neben der vorrangigen Tätigkeit als Komponist<br />
ist Heinrich Unterhofer auch als<br />
Dirigent tätig, wobei das Hauptaugenmerk<br />
auf die Verwirklichung neuer Musikprojekte<br />
für Orchester und Ensembles<br />
gerichtet ist. Sein Dirigatstudium<br />
begann im Jahre 2004 an der Akademie<br />
von Pescara mit Maestro Gilberto<br />
Serembe. 2005 studierte er bei Maestro<br />
Romolo an der Europäischen Akademie<br />
in Vicenza. Im selben Jahr besuchte er<br />
Dirigatkurse für Neue Musik in Monza<br />
bei Maestro Sandro Gorli. Von 2006 bis<br />
2011 studierte er bei Edgar Seipenbusch<br />
in Innsbruck, mit welchem er sich in das<br />
romantische und moderne Repertoire<br />
sowie in das Opernrepertoire vertiefte.<br />
Er dirigierte eigene Werke wie „Borderline”<br />
(1997), “Francesco e Chiara degli<br />
Angeli” mit dem Cantelli-Orchester von<br />
Mailand (2007), König Yu” nach einem<br />
Märchen von Hermann Hesse und die<br />
Kirchenoper „Genesis Requiem” (2012)<br />
sowie eine große Bandbreite klassischer<br />
Werke namhafter Komponisten. Aber auch<br />
Kompositionen junger Komponisten aus<br />
Bozen und Udine brachte er 2013 für<br />
ein Austauschprojekt zwischen beiden<br />
Hochschulen zur Aufführung. Im September<br />
2018 dirigierte er sein „Amor Requiem“<br />
für Frauenchor, Viola und Orgel<br />
in der Kathedrale San Vitale in Ravenna.<br />
Die Komposition „Elegia Amarcord“ für<br />
Blasorchester wurde beim dritten Kompositionswettbewerb<br />
für Symphonisches<br />
Blasorchester „Angelo Inglese“ mit einer<br />
„Menzione Speciale“ ausgezeichnet. Die<br />
Partitur wurde im Verlag M. Boario in Turin<br />
veröffentlicht (https://www.mboario.com/<br />
epages/990428805.sf/it_IT/?ObjectPath=/<br />
Shops/990428805/Products/203).<br />
Andere Uhraufführungen seiner Werke<br />
mussten coronabedingt leider vertagt<br />
werden und kommen daher erst im kommenden<br />
Jahr zur Aufführung.<br />
Heinrich Unterhofer<br />
KulturFenster<br />
25 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
entdeckt<br />
„Cäcilien-Messe“ von Gottfried Veit<br />
Plenar-Messe für gemischten Chor, Kantor,<br />
Volksgesang und Blasorchester (oder Orgel)<br />
Am Cäcilien-Sonntag 2019 erlebte die<br />
„Cäcilien-Messe“ von Gottfried Veit eine<br />
denkwürdige Uraufführung in der weiträumigen<br />
Heilig-Kreuz-Kirche von Lana. Bei<br />
dieser erstmaligen Darbietung wirkten nicht<br />
weniger als fünf Chöre, ein Kantor, die Bürgerkapelle<br />
Lana sowie das Kirchenvolk von<br />
Lana mit. Die Gesamtleitung lag dabei in<br />
den bewährten Händen von Martin Knoll.<br />
Leider gab es von dieser Messkomposition<br />
coronabedingt bis heute keine weitere<br />
Aufführung mehr.<br />
Diese mit elf Messteilen breit angelegte sakrale<br />
Komposition ist in mehrerlei Hinsicht<br />
eine „Plenarmesse“: zum einen deckt sie<br />
sowohl die Ordinariums- als auch die Propriumsgesänge<br />
ab und zum anderen vereint<br />
sie besetzungsmäßig alle musikalischen<br />
Kräfte einer Dorfgemeinschaft. Sie stellt somit<br />
im wahrsten Sinne des Wortes eine „Gemeinschaftsmesse“<br />
dar. Stilistisch ist diese<br />
neue „Cäcilien-Messe“ zwar streng tonal gehalten,<br />
weist aber mit ihrer etwas neueren<br />
Tonsprache ebenso auch in die Zukunft.<br />
Natürlich können davon auch nur einzelne<br />
Teile, die allesamt eine unüberhörbare Geschlossenheit<br />
aufweisen, aufgeführt werden.<br />
Der Schwierigkeitsgrad der vier Chorstimmen<br />
bewegt sich bewusst in relativ engen<br />
Grenzen. Auch die Instrumentation des Blasorchesters<br />
ist so angelegt, dass sämtliche<br />
Solo-Stellen von sogenannten „Mangelinstrumenten“<br />
in adäquaten anderen Instrumentalstimmen<br />
als Stichnoten aufscheinen. Für<br />
Darbietungen in kleinerer Besetzung kann<br />
das Blasorchester zudem durch eine Kirchenorgel<br />
ersetzt werden.<br />
Die ansprechend und übersichtlich gestaltete<br />
Notenausgabe besteht aus einer Gesamtpartitur,<br />
einer Chorpartitur, Instrumentalstimmen<br />
für großes Blasorchester, einer<br />
Orgelstimme sowie einer Singstimme für<br />
den Gemeindegesang.<br />
Ferruccio Delle Cave<br />
Die „Cäcilien-Messe“ von Gottfried Veit ist<br />
eine Gemeinschaftsmesse, die viel Raum<br />
für aktive Beteiligung bietet.<br />
Erschienen im Tirol Musikverlag<br />
noten@tyrolis.com<br />
Meilstrasse 36, A-6170-Zirl<br />
Tel.: 0043(0)5238/515<br />
Young Stars<br />
„Die kleine Orchesterschule“ von Willibald Tatzer<br />
Sieht man einmal von der Corona-Pandemie<br />
ab, so kann man sagen: Noch nie<br />
haben so viele Kinder und Jugendliche<br />
ein Blas- oder Schlaginstrument erlernt<br />
wie heute. Sowohl im Einzel- als auch im<br />
Gruppenunterricht können derzeit junge<br />
Leute ein beachtliches musikalisches Niveau<br />
erreichen. Neben dieser begrüßenswerten<br />
Aus- und Weiterbildung mangelt es<br />
mancherorts jedoch an der ebenso wichtigen<br />
Pflege des Zusammenspiels. Gerade<br />
die Fähigkeiten im Ensemblespiel sind vor<br />
allem beim Eintritt in eine Musikkapelle<br />
von großer Bedeutung.<br />
Um diesem Manko entgegenzutreten, verfasste<br />
der niederösterreichische Komponist<br />
und Verleger Willibald Tatzer mehrere<br />
einfache Musikstücke in ebenso<br />
einfachen Ton- wie Taktarten und instrumentierte<br />
diese für eine kleine Bläserbesetzung,<br />
in der alle gebräuchlichen Instrumente<br />
eines Blasorchesters vorkommen.<br />
Das Positive dieser Veröffentlichung ist<br />
zweifelsohne die Tatsache, dass alle Instrumente<br />
in einem geringen Tonumfang<br />
und mit einfacher Rhythmik musizieren,<br />
eben nach dem Motto einer "kleinen Orchesterschule".Unter<br />
den ausgewählten<br />
Spielstücken befinden sich zum einen<br />
bekannte Weisen, wie zum Beispiel<br />
„Hänschen klein“ oder „Guten Abend,<br />
gute Nacht“, zum andern zeitnahe Musiknummern<br />
wie „Haki Paki Monster“ oder<br />
„Hipp Hopp Rock“, die der Autor selbst<br />
beigesteuert hat.<br />
Nachdem das Musizieren im deutschen<br />
Sprachgebrauch mit „Spielen“ bezeichnet<br />
wird, können Kinder und Jugendliche<br />
mit dieser Musiksammlung sozusagen<br />
„spielend“ ins „Orchesterspiel“<br />
eingeführt werden.<br />
Gottfried Veit<br />
KulturFenster<br />
26 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
kurz notiert<br />
kurz notiert –<br />
das neue „Musikpanorama“<br />
… für Nachrichten aus den Musikkapellen<br />
Wenn wieder Proben, Auftritte und<br />
Veranstaltungen von Musikkapellen<br />
möglich sind, laden wir auch wieder<br />
ein, uns Berichte davon zukommen<br />
zu lassen. Im Zuge der Neugestaltung<br />
des „KulturFensters“ ist die<br />
ehemalige Rubrik „Musikpanorama“<br />
in „kurz notiert“ unbenannt worden;<br />
sie soll aber weiterhin als Plattform für<br />
die Berichterstattung aus den Musikkapellen<br />
und damit zu einem regen<br />
Erfahrungsaustausch genutzt werden.<br />
Damit aber alle Artikel Platz fi nden<br />
können, ist es notwendig, dass die jeweiligen<br />
Texte nicht mehr als 1.500<br />
Zeichen (inkl. Leerzeichen) umfassen.<br />
Die Berichterstatter*innen der Musikkapellen<br />
sind gebeten, diese Vorgabe<br />
einzuhalten. Ein aussagekräftiges und<br />
vor allem drucktaugliches Foto – in<br />
entsprechend guter Auflösung und mit<br />
Bildtext – ist ebenfalls immer sehr willkommen.<br />
Bitte auch immer den Redaktionsschluss<br />
beachten!<br />
Wir freuen uns auf viele „kurz notierte“<br />
Meldungen!<br />
Die Redaktion<br />
Musikkapelle Luttach. Projekt Klangspuren<br />
Mit neuen Ideen und Konzepten durch das Krisenjahr 2021<br />
Nichts tun und abwarten war für 60 eifrige<br />
Musikant*innen der Musikkapelle Luttach<br />
auch in Zeiten der Pandemie nie eine Option.<br />
Deshalb galt es, neue Konzepte und<br />
innovative Lösungen für Proben und Auftritte<br />
zu entwickeln. Alle Ideen und Überlegungen<br />
wurden schließlich im Projekt<br />
„Klangspuren“ kombiniert: 6 Ensembles,<br />
12 Stücke, professionelle Ton- und Videoaufnahmen.<br />
Kapellmeister Patrick Künig hat ein umfang-<br />
und abwechslungsreiches Programm<br />
zusammengestellt. Die Bandbreite reichte<br />
von besinnlichen Weisen über stimmungsvolle<br />
Polkas bis hin zu moderner zeitgenössischer<br />
Literatur. Das Probelokal wurde<br />
in ein Tonstudio verwandelt, wo in Zusammenarbeit<br />
mit dem "Newport Studio" aus<br />
St. Lorenzen die Tonaufnahmen entstanden.<br />
Im darauffolgenden Monat fanden<br />
an zwei Drehtagen die Filmaufnahmen<br />
statt, geleitet vom Team von Daniel Demichiel<br />
aus Bruneck. Orte, Hotels sowie Sehenswürdigkeiten<br />
in Luttach und im gesamten<br />
Ahrntal wurden dafür in Szene<br />
gesetzt. Ende August wurden die Stücke<br />
unserem Publikum im Rahmen eines Ensemblekonzertes<br />
in Luttach vorgestellt. Im<br />
Herbst hielten wir dann die fertige CD und<br />
die Videos in Händen; diese gingen nach<br />
und nach auf unserer Homepage und in<br />
den sozialen Medien online.<br />
Zurückblickend können wir mit Stolz behaupten,<br />
dass das Projekt ein voller Erfolg<br />
war. Wir haben vielerlei neue Erfahrungen<br />
gesammelt und viel gelernt, in musikalischer<br />
wie auch organisatorischer Hinsicht.<br />
Das Krisenjahr 2021 hat uns gezeigt, dass<br />
es sich lohnt, neue Wege einzuschlagen,<br />
um so die Motivation und Freude unserer<br />
Musikant*innen am Musizieren weiter zu<br />
fördern und unserem Publikum neue Facetten<br />
der Blasmusik nahezubringen.<br />
Musikkapelle Luttach<br />
Mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung und des Tourismusvereins Ahrntal sowie des<br />
Bildungsausschusses von Luttach konnte die Musikkapelle Luttach ein innovatives Projekt<br />
umsetzen – im Bild eine Gruppe bei Filmaufnahmen.<br />
KulturFenster<br />
27 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Beim Cäcilienkonzert der Musikkapelle<br />
Auer am vergangenen 13. November wurde<br />
die Gelegenheit genutzt, um neue Mitglieder<br />
offiziell in die Musikkapelle aufzunehmen<br />
sowie einem Mitglied die ihm zugedachte<br />
Ehrung zu überreichen.<br />
Dem ehemaligen Obmann der Musikkapelle<br />
Auer, Manfred Abram, wurde aufgrund<br />
seiner 12-jährigen Tätigkeit als<br />
Obmann (2008 bis 2020) das Verdienstzeichen<br />
in Silber des Verbandes Südtiroler<br />
Musikkapellen verliehen. Insgesamt<br />
war Manfred 26 Jahre im Ausschuss der<br />
Musikkapelle Auer tätig. Bezirksobmann<br />
Stefan Sinn sowie Kapellmeister Arnold<br />
Leimgruber und Obmann, Thomas Rech<br />
gratulierten dem Geehrten herzlich und<br />
dankten ihm für sein verdienstvolles Engagement.<br />
Außerdem freute sich die Musikkapelle,<br />
imRahmen des Konzertes acht Neuzugänge<br />
begrüßen zu können. Sonja Pircher<br />
an der Trompete und Anna Sofia<br />
Franceschini an der Oboe sind beide bereits<br />
seit 2020 bei der Musikkapelle. Sie<br />
wurden jedoch erst beim diesjährigen Cäcilienkonzert<br />
offiziell begrüßt. Neu dazukurz<br />
notiert<br />
hinausgeblickt<br />
Musik in kleinen Gruppen<br />
13. Landesmusikwettbewerb<br />
in Auer – neuer Termin<br />
https://vsm.bz.it<br />
14.05.<strong>2022</strong><br />
Neuzugänge und eine Ehrung<br />
bei der Musikkapelle Auer<br />
Großer Dank an Manfred Abram für langjährigen Einsatz<br />
Die Neuzugänge bei der MK Auer: (v. l.) Paul Oberrauch, Emma Kröss, Lena Nones, Noemi Falser, Emma Stenico, Philipp Heinz,<br />
Martin Lintner<br />
Foto: Peter Simonini<br />
gekommen in diesem Jahr sind: Martin<br />
Lintner und Paul Oberrauch (Trompete),<br />
Emma Kröss (Klarinette), Emma Stenico,<br />
Noemi Falser und Philipp Heinz (Saxo-<br />
phon), Lena Nones (Marketenderin). Die<br />
Musikkapelle wünscht allen viel Freude<br />
beim Musizieren.<br />
Jasmine Oberrauch<br />
Ehrung bei der MK Auer: (v. l.) Bezirksobmann Stefan Sinn, die Marketenderinnen Lena<br />
Nones und Claudia Lantschner, Kapellmeister Arnold Leimgruber, der ehemalige Obmann<br />
Manfred Abram, Obmann Thomas Rech (Foto: Peter Simonini).<br />
KulturFenster<br />
28 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Blasmusik<br />
Cäcilienfeier der Musikkapelle Welschnofen<br />
Ein Aperitif als Rahmen für die Ehrung verdienter Musikant*innen<br />
Bei der Cäcilienfeier der MK Welschnofen: (v. l.) Ehrenmitglied Ferdinand Kohler, Obmann<br />
Jörg Seehauser, Philipp Pardeller, Johanna Haas, Johann Haas, Mirijam Kohler, Dietmar<br />
Pardeller und Kapellmeister Karl Stuppner.<br />
Am 21. November 2021 feierte die Musikkapelle<br />
Welschnofen den traditionellen<br />
Cäciliensonntag. Nach einem Jahr Pause<br />
konnte diesmal die Feier unter Einhaltung<br />
der geltenden Coronamaßnahmen<br />
durchgeführt werden. Die Ehrungen einiger<br />
verdienter Mitglieder erfolgten bei<br />
einem Aperitif im Pausenhof der Grundschule<br />
Welschnofen.<br />
Neben den Musikant*innen mit deren<br />
Ehepartnern, Marketenderinnen, Altmusikanten,<br />
Ehrenmitgliedern und Patinnen<br />
waren auch Bürgermeister Markus<br />
Dejori, sowie Richard Dejori als Vertreter<br />
der Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten<br />
anwesend.<br />
Der festliche Anlass wurde durch die feierlichen<br />
Eröffnungsklänge der Klarinettengruppe<br />
eingeleitet. Anschließend begrüßte<br />
Obmann Jörg Seehauser alle Anwesenden.<br />
Höhepunkt der Cäcilienfeier waren die Ehrungen,<br />
die von Ehrenmitglied Ferdinand<br />
Kohler durchgeführt wurden. An Philipp<br />
Pardeller und Johanna Haas wurde das<br />
VSM-Ehrenzeichen in Bronze für ihre<br />
15-jährige Mitgliedschaft im Verein verliehen.<br />
Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft<br />
erhielten Mirjam Kohler und Dietmar Pardeller<br />
das Ehrenzeichen in Silber. Johann<br />
Haas wurde das Große Ehrenzeichen in<br />
Gold für seine 50-jährige Mitgliedschaft<br />
verliehen. Mit großem Applaus und den<br />
Klängen der „Schrammel“ aus den Reihen<br />
der „Böhmischen“ ließ man zum Geehrten<br />
hochleben.<br />
David Knollseisen<br />
Am 30. November 2021 feierte Josef Oberschmied<br />
seinen 80. Geburtstag. Dazu gratulierte<br />
ihm seine Musikkapelle Reischach<br />
mit einem Geburtstagsständchen und einer<br />
schlichten Feier im „Haus am Anger“.<br />
Josef Oberschmied trat am Josefitag des<br />
Jahres 1955 als 14-jähriger Klarinettist in<br />
die Musikkapelle Reischach ein, wo er immer<br />
noch die 1. Klarinette spielt. Schnell<br />
machte sich Josef Oberschmied als Musikant<br />
und später als Kapellmeister auch weit<br />
über Reischach hinaus einen Namen. 1973<br />
begann er seine Tätigkeit als Kapellmeister<br />
in St. Georgen. 1982 trat er in Reischach<br />
die Nachfolge von Alois Regensberger an<br />
und übernahm das Amt des Kapellmeisters<br />
der Musikkapelle Reischach, das<br />
Zum 80. Geburtstag von<br />
Josef Oberschmied<br />
Die Musikkapelle Reischach gratuliert<br />
ihrem Ehrenkapellmeister<br />
er 27 Jahre lang (1982-1987 und 1991-<br />
2012) ausübte. Neben seiner Tätigkeit in<br />
Reischach leitete er auch über einen längeren<br />
Zeitraum – und teilweise parallel –<br />
die Bürgerkapelle Bruneck und die Musikkapelle<br />
Percha.<br />
Ein ganz besonderes Anliegen war<br />
ihm stets die Jugendarbeit. Unzählige<br />
Jungmusikant*innen fanden in Josef Oberschmied<br />
ihren Lehrer, der sie förderte, motivierte<br />
und in der Ausbildung begleitete.<br />
Seine Tätigkeit als Instrumentallehrer an der<br />
Musikschule Bruneck wird noch heute als<br />
„kleine Revolution“ bezeichnet. Er brachte<br />
nämlich den Aufbau der Holzblasregister in<br />
den Pusterer Kapellen in Gang und trieb ihn<br />
voran. Von 1968 bis 2001 war Josef Oberschmied<br />
in mehreren Funktionen im VSM<br />
Bezirk Bruneck tätig, unter anderem auch<br />
als Bezirkskapellmeister.<br />
Im Jahr 2009 wurde Josef Oberschmied in<br />
der Innsbrucker Hofburg die Verdienstmedaille<br />
des Landes Tirol für besondere Leistungen<br />
im Bereich der Blasmusik verliehen.<br />
2018 wurde er mit dem Verdienstkreuz in<br />
Gold des Verbandes Südtiroler Musikkapellen<br />
ausgezeichnet.<br />
Florian Lahner<br />
Geburtstagsgratulation für den Ehrenkapellmeister:<br />
Kapellmeister und VSM-VerbandsobmannPepi<br />
Fauster, Josef Oberschmied,<br />
Musikobmann Florian Lahner (v. l.)<br />
KulturFenster<br />
29 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Für Jugendliche muss<br />
es auf jeden Fall<br />
erstrebenswert sein,<br />
im Chor oder in einem<br />
Ensemble zu singen.<br />
Es soll das Gefühl bei<br />
den jungen Menschen<br />
entstehen, mit ihren<br />
Fähigkeiten gebraucht<br />
zu sein.<br />
KulturFenster 30<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
hinausgeblickt<br />
Wo sind die singenden Buben?<br />
Schicksal oder ein Auftrag für die Chorleitung<br />
Seit einigen Jahren ist es in Salzburg wieder<br />
selbstverständlich, dass zahlreiche Jugendliche,<br />
vermehrt auch junge Männer, in<br />
Chören singen. Wie ist es möglich, dass<br />
hier der Trend des Chorwesens durchbrochen<br />
wird? Ist hier die Zeit stehen geblieben<br />
oder ist Salzburg seiner Zeit voraus?<br />
Was steckt dahinter – Zufall oder von langer<br />
Hand geplante und strukturierte pädagogische<br />
Arbeit?<br />
Für Jugendliche muss es auf jeden Fall erstrebenswert<br />
sein, im Chor oder in einem<br />
Ensemble zu singen. Es soll das Gefühl bei<br />
den jungen Menschen entstehen, mit ihren<br />
Fähigkeiten gebraucht zu sein.<br />
Das Interesse eines Jugendlichen am Chorgesang<br />
spannt sich zwischen einem sogenannten<br />
Motivationsquadrat: das Interesse<br />
an der Musik und die Literaturauswahl,<br />
Formen der Präsentation, gesellschaftliche<br />
Faktoren und musikfremde Eindrücke.<br />
Die geschickte Literaturauswahl ist die<br />
"halbe Miete", aber auch nicht mehr. Nicht<br />
zu selten überschätzen Chorleiter*innen<br />
bei Jugendlichen das allumfassende Interesse<br />
an Musik. Zwar konsumieren viele<br />
Jugendliche tagtäglich stundenlang Musik,<br />
das heißt aber meist nicht, dass Carl Orff<br />
oder Renaissancemusik über das Handy<br />
wiedergegeben werden. Wie kann ich also<br />
Jugendliche von der groovigen Pop-Nummer<br />
auch zum Beispiel zu Mozarts Requiem<br />
begleiten, ohne hier wertend zu sein.<br />
Es sind dabei also weitere Motivationsfaktoren<br />
zu beachten, und plötzlich<br />
singt eine Schülergruppe im<br />
Linienbus lautstark das Dies Irae.<br />
Was verbirgt sich nun hinter den<br />
anderen Ecken des Motivationsquadrats?<br />
Formen der Präsentation sind im ersten<br />
Moment nicht immer positiv besetzt. Doch<br />
jeder Musiker lebt bekanntlich auch vom<br />
Applaus, von der Rückmeldung des Publikums,<br />
der Freunde oder der Familie. "Gehen<br />
wir hinaus und zeigen, was wir können."<br />
Interessante Spielstätten, Konzerte<br />
und Konzertreihen mit Medieninteresse,<br />
Der SCV bietet auch Singwochen speziell für Jungs an.<br />
originelle Projekte und nicht zuletzt eine<br />
gute PR-Arbeit sind daher unerlässlich.<br />
Gesellschaftliche Faktoren beziehen sich<br />
auf alle Formen von chorübergreifenden<br />
Projekten, Konzertreisen und alle weiteren<br />
Aktivitäten, die das gewohnte<br />
Chorumfeld verlassen.<br />
Zur Person<br />
Über den Tellerrand hinausblicken, heißt<br />
bei chorübergreifenden Projekten, sich<br />
auch in die Karten blicken zu lassen, die<br />
Qualitäten des eigenen Chores und der<br />
anderen Chorleiter*innen erkennen zu<br />
lassen und einen Vergleich in der Chorarbeit<br />
zuzulassen. Auch sämtliche weitere<br />
gemeinschaftliche Erlebnisse außerhalb<br />
Moritz Guttmann unterrichtet Musik, Chor und Vokalensemble<br />
am Erzbischöflichen Privatgymnasium Borromäum<br />
und an der privaten Bildungsanstalt für Elementarpädagogik<br />
(BAfEP) in Salzburg. Außerdem lehrt er Didaktik des vokalen Musizierens,<br />
Stimmbildung, Jugendchorpraktikum und Literatur für Kinder- und<br />
Jugendchor an der Universität Mozarteum und an der Pädagogischen Hochschule<br />
Salzburg. Er leitet zahlreiche Chöre und Ensembles in Salzburg.<br />
2010 wurde er mit dem Erwin-Ortner-Preis für Chorleitung ausgezeichnet.<br />
Moritz Guttmann ist Referent bei diversen Chorleiterseminaren und Juror<br />
bei Chorwettbewerben.<br />
31<br />
KulturFenster 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
hinausgeblickt<br />
Die Chorleitung darf gerade bei Buben nicht vergessen, dass auch die männliche Identitätsfindung mitberücksichtigt werden muss –<br />
im Bild der Salzburger Chor "Vok Schock".<br />
der Probenarbeit fallen unter diesen Motivationsbereich.<br />
Musikfremde Eindrücke beziehen sich auf<br />
Aktivitäten und besondere Sehenswürdigkeiten<br />
auf Ausflugsfahrten oder den Eindruck<br />
eines besonderen Aufführungsorts.<br />
Fehlt die Spannung an einer dieser Ecken,<br />
werden dies andere Bereiche kompensieren<br />
müssen, was nicht immer möglich<br />
sein wird und der Chor läuft Gefahr, Motivationskraft<br />
und in der Folge Mitglieder<br />
zu verlieren.<br />
Folgende grundlegende Gedanken sind<br />
für das Singen mit Knaben und jungen<br />
Männern wichtig:<br />
Identitätsfindung und Rollenbild<br />
Der singende Knabe und junge Mann<br />
braucht im nicht als besonders männlich<br />
besetzten Feld des Chorsingens eine besondere<br />
Rolle. Es hat auch im weitesten<br />
Sinne etwas mit Prestige zu tun. Was denken<br />
meine Freunde über mich als Chorsänger?<br />
Das reicht von Belächeln bis Bewunderung<br />
mit allen Abstufungen, die<br />
dazwischen liegen. Die Chorpädagog*innen<br />
müssen ich diese Facette im Auge behalten<br />
und diese Prozesse der Peergroup<br />
(Gruppe von etwa gleichaltrigen Kindern<br />
oder Jugendlichen mit gleichen oder ähnlichen<br />
Interessen, die als primäre soziale<br />
Bezugsgruppe neben das Elternhaus tritt)<br />
regelrecht mitplanen.<br />
Berührpunkt Singen<br />
Ein jahrelang gehegter Wunsch aller<br />
Chorpädagog*innen ist das tägliche Singen<br />
in der Schule. Singen ist nicht nur einer<br />
kleinen, talentierten Schar von „Sonderlingen“<br />
vorbehalten, sondern ist das einzige<br />
Instrument, das alle in sich tragen. Der<br />
Schritt von der Rezeption zur Produktion,<br />
vom passiven Erleben zum aktiven Musizieren<br />
steht im Mittelpunkt. Dies ist übrigens<br />
für das gesamte Chorwesen von großer<br />
Bedeutung. Die Grundlage für die Freude<br />
am Singen ist mittlerweile die Schule, früher<br />
war es meist die Familie.<br />
Rückzugsbereiche und individuelle Förderung<br />
Die Koedukation, d.h. die gemeinsame<br />
Bildung und Erziehung von Mädchen und<br />
Jungen, hat im musischen Bereich nur bedingt<br />
einen Platz. Für das Singen sollte die<br />
Schule oder der Chor einen musikalischen<br />
Rückzugsbereich für Burschen bieten,<br />
eventuell in Form von getrennten Chorproben,<br />
getrenntem Einsingen und stellenweise<br />
getrenntem Chorprogramm. Vor<br />
allem die Zeit des Stimmwechsels kann<br />
mit diesen Rückzugsbereichen gut begleitet<br />
werden – und die jungen Männer bleiben<br />
uns im Chor erhalten.<br />
Vielleicht können diese Gedanken anregen,<br />
neue Wege im Chorgesang zu gehen, standortbezogene<br />
Strategien zu entwickeln und<br />
sich vor allem vom unentwegten Lamentieren<br />
über die ach so bedauerliche Situation in<br />
Bildung und Gesellschaft zu verabschieden.<br />
Moritz Gutmann<br />
KulturFenster 32<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
SCV-Intern<br />
Chorwesen<br />
„Ich freue mich auf eine<br />
spannende Zeit!“<br />
Südtiroler Chorverband hat neue Mitarbeiterin<br />
Seit Dezember hat die Geschäftsstelle des<br />
Südtiroler Chorverbands eine neue Mitarbeiterin:<br />
Monika Mair.<br />
Jahrgang 1974 und in Bozen aufgewachsen<br />
zog sie 1994 zum Studieren nach Innsbruck,<br />
wo sie nach ihrem Abschluss einige<br />
Jahre gelebt und gearbeitet hat. 2004<br />
kehrte sie mit ihrem späteren Mann nach<br />
Bozen zurück. Seit einigen Jahren leben<br />
sie mit ihren zwei Töchtern in Mölten. Ihr<br />
Wunsch, sich beruflich neu zu orientieren,<br />
hat sie zum Chorverband geführt.<br />
KulturFenster: Wo liegt Ihr Aufgabenbereich?<br />
Monika Mair: Im Moment unterstütze ich<br />
Helga Huber, die langjährige gute Seele<br />
der Geschäftsstelle in Bozen, bei den Tätigkeiten<br />
im Büroalltag. Ich versuche so<br />
schnell und so viel wie möglich von ihr zu<br />
lernen, um auf längere Sicht ihren Platz<br />
einnehmen zu können. Helga wird in den<br />
wohlverdienten Ruhestand wechseln. Bis<br />
dahin kann ich von ihrem großen Erfahrungsschatz<br />
profitieren und mich einarbeiten.<br />
Es geht darum, die allgemeinen<br />
Büroarbeiten auszuführen, Obmann<br />
Erich Deltedesco und die Mitglieder der<br />
Verbandsgremien sowie Geschäftsführer<br />
Dietmar Thanei in ihrer Arbeit zu unterstützen,<br />
organisatorische Aufgaben bei<br />
den Fortbildungsangeboten und den Verbandstätigkeiten<br />
zu erledigen und Auskünfte<br />
und Hilfestellung bei Fragen der<br />
Mitgliedschöre zu geben.<br />
KF: Und Sie fühlen sich wohl hier beim<br />
Chorverband?<br />
Mair: Ich befinde mich noch ziemlich am<br />
Anfang meiner Zeit beim SCV, aber ich<br />
kann jetzt schon mit Gewissheit sagen,<br />
dass ich den für mich doch sehr großen<br />
Schritt in eine neue Tätigkeit nicht bereue.<br />
Das Team hat mich herzlich aufgenommen,<br />
es ist eine Freude, mit netten Kollegen<br />
zu arbeiten und täglich Neues zu<br />
lernen. Helga ist eine überaus geduldige<br />
Lehrmeisterin und es macht Spaß, jeden<br />
Tag vielfältige Arbeiten zu erledigen. Es gibt<br />
verwaltungstechnische Aufgaben ebenso<br />
wie organisatorische, aber ich kann mich<br />
auch kreativ einbringen und lerne jeden<br />
Tag neue Menschen aus dem weiten Bereich<br />
der Chormusik kennen – dies aufgrund<br />
der momentanen Lage leider noch<br />
meistens telefonisch, aber früher oder<br />
später werde ich sicher auch mal die Gesichter<br />
zu den Stimmen zu sehen bekommen.<br />
Auf alle Fälle freue ich mich auf eine<br />
spannende Zeit.<br />
KF: Haben Sie auch einen persönlichen Bezug<br />
zu Chorgesang und Musik?<br />
Mair: Chorsingen ist mein großes Hobby.<br />
Ich war in meiner Jugend Mitglied einer Jugendband<br />
in unserer Pfarrgemeinde in Bozen<br />
und über zehn Jahre lang beim „Chor<br />
der deutschen Pfarrgemeinde J. Bosco”<br />
(heute „Maria in der Au”), auch während<br />
eines Großteils meines Studiums in Innsbruck.<br />
Schließlich ließ sich das Chorsin-<br />
gen in einem Verein nicht mehr mit meinen<br />
Lebensumständen vereinen und so<br />
musste ich vorläufig pausieren. Doch die<br />
Musik blieb immer ein wichtiger Teil meines<br />
Lebens. Viele liebe Menschen in meiner<br />
Familie sind talentierte Sänger und Musiker,<br />
sodass Musik und Gesang<br />
immer präsent waren<br />
und nach wie vor<br />
sind. Seit 2017 lebe<br />
ich mit meiner Familie<br />
in Mölten. Dort bin<br />
ich natürlich gleich als<br />
erstes in den Kirchenchor<br />
eingetreten.<br />
Interview: Paul<br />
Bertagnolli<br />
Monika Mair, die neue Mitarbeiterin<br />
in der Geschäftsstelle des Südtiroler<br />
Chorverbands. © Athesia/ Martina Jaider<br />
Aus der Redaktion<br />
Ihre Beiträge (Texte und Bilder) für das Chorwesen<br />
senden Sie bitte an: info@scv.bz.it (Südtiroler Chorverband)<br />
Für etwaige Vorschläge und Fragen erreichen Sie uns unter<br />
folgender Nummer: +39 0471 971 833 (SCV)<br />
Redaktionsschluss für<br />
die nächste Ausgabe des<br />
„KulturFensters“ ist:<br />
Freitag, 11. März <strong>2022</strong><br />
33<br />
KulturFenster 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Jung+<br />
Stimmgewaltig<br />
Kinder- und Jugendchor Vahrn<br />
Name:<br />
Kinder- und Jugendchor Vahrn<br />
Gründungsjahr: 2020<br />
Mitglieder:<br />
aktuell 11 Kinder (8 Mädchen, 3 Buben)<br />
im Alter von 8 bis 12 Jahren<br />
Unser Motto lautet:<br />
Komm, sing mit!<br />
Wer sind wir, was macht uns aus? Was ist<br />
unsere Motivation?<br />
Der Kinder- und Jugendchor Vahrn ist ein<br />
„Gewächs“ des Vahrner Kirchenchors. Unser<br />
Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen<br />
aus dem Dorf und der Gemeinde das Singen<br />
und Musizieren näher zu bringen. Die<br />
Kinder sollen das schönste Instrument,<br />
die menschliche Stimme, hautnah erleben<br />
dürfen. Uns motiviert auch die Notwendigkeit,<br />
Kinder und Jugendliche in<br />
einer immer technischer und digitaler werdenden<br />
Welt in ihrer ganzheitlichen Entwicklung<br />
unterstützen. Dabei kommt der<br />
musischen Herzensbildung eine wichtige<br />
Rolle zu. Musik selbst zu erleben und zu<br />
gestalten, ist eine gute Investition in die<br />
Zukunft unserer Jugend, die dadurch die<br />
Möglichkeit erhält, das eigene Können<br />
weiterzutragen.<br />
Wie kam es zur Gründung?<br />
Dem Vorstand des Vahrner Kirchenchors<br />
war es schon seit längerer Zeit ein Anliegen,<br />
Kinder und Jugendliche fürs Singen zu<br />
begeistern. Treibende Kraft war dabei Michl<br />
Baur, damals Obmann des Kirchenchors.<br />
Nachdem er Rudi Chizzali als Chorleiter und<br />
Pius Leitner als „Paten“ gewonnen hatte,<br />
erfolgte im <strong>Februar</strong> 2020 die Gründung.<br />
Der unmittelbar darauf folgende Ausbruch<br />
der Corona-Epidemie und die einschränkenden<br />
Maßnahmen konnten den Enthusiasmus<br />
nicht bremsen, auch wenn die<br />
Tätigkeit nur eingeschränkt möglich war.<br />
Rudi Chizzali schafft es hervorragend, auf<br />
spielerische und einfühlsame Weise, die<br />
KulturFenster<br />
34 01 <strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Kinder zu begeistern und ihnen den Umgang<br />
mit der eigenen Stimme zu vermitteln.<br />
Welches waren unsere bisherigen<br />
Höhepunkte?<br />
Trotz der widrigen Umstände unmittelbar<br />
nach der Gründung konnte der Kinderund<br />
Jugendchor am Ende des Schuljahres<br />
mit einem Abschlusskonzert glänzen und<br />
die Dorfbevölkerung erfreuen und begeistern.<br />
Im laufenden Schuljahr wirkte er<br />
bei der Gestaltung des Martinsumzugs<br />
und der Kinderchristmette mit.<br />
Was sind unsere Pläne für die Zukunft?<br />
Wenn es die Umstände erlauben, wird<br />
der Kinder- und Jugendchor im Fasching<br />
auftreten und wieder ein Abschlusskonzert<br />
zum Schulende geben, vielleicht in<br />
Form eines Musicals.<br />
Grundsätzlich möchten wir noch mehr<br />
Kinder und Jugendliche fürs Singen und<br />
Musizieren begeistern, sie in ihrer ganzheitlichen<br />
Entwicklung unterstützen und<br />
ihnen die Möglichkeit bieten, die Freizeit<br />
sinnvoll zu gestalten.<br />
Dazu meint Chorleiter Chizzali: „Singen<br />
gehört zum Wesen des Menschen. So wie<br />
das Kind reden lernt, muss es auch singen<br />
lernen, um das Glück, die Gesundheit,<br />
den Reichtum, die Freuden des Lebens<br />
auszuschöpfen.<br />
Wir gehen zusammen<br />
den Weg zur Freude an<br />
der Stimme, wie schön<br />
es ist zu singen.“<br />
Bei uns sind alle Kinder<br />
aus dem Gemeindegebiet<br />
ab der 3. Klasse<br />
Grundschule bis zur 2.<br />
Klasse Mittelschule herzlich<br />
willkommen. Während des Schuljahres<br />
bieten wir wöchentlich eine Stunde<br />
Musikerziehung im Probelokal des Kirchenchors<br />
an.<br />
Wer kann bei uns mitmachen?<br />
Wie kann man bei<br />
uns mitmachen?<br />
Chorleiter<br />
Rudi<br />
Chizzali<br />
Wir suchen EUCH und eure Geschichten!<br />
Ihr seid „jung“ und „stimmgewaltig“?<br />
Ihr seid ein Kinderchor, ein Jugendchor, ein junges Ensemble oder<br />
eine junge Singgruppe? … dann würden wir euch gerne unseren<br />
Leser*innen vorstellen und zeigen, dass es euch gibt.<br />
Wir berichten auch gerne laufend<br />
über eure Konzerte, Projekte und<br />
Aktivitäten.<br />
Schreibt uns einfach eine Mail an<br />
info@scv.bz.it<br />
Wir freuen uns schon, eure<br />
Geschichten zu teilen!<br />
KulturFenster<br />
35 01 <strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
entdeckt<br />
Im Leb'n<br />
Hochzeitslied/Volkslied für gemischten Chor<br />
Dieses Hochzeits-/Volkslied vom österreichischen<br />
Komponisten Helmut Pertl<br />
ist im vergangenen Sommer entstanden.<br />
„Mein musikalischer Bereich liegt<br />
zwar eher in der Blasmusik, aber durch<br />
einige Jahre Chormitgliedschaft konnte<br />
ich auch in dieser Sparte so manche Arrangements<br />
und Lieder verfassen“, erklärt<br />
er: „In der Hoffnung, dass wir alle<br />
bald wieder befreit singen und musizieren<br />
können, wünsche ich dabei viel Freude<br />
mit meinem Lied“.<br />
Die vollständige 4-stimmige Partitur<br />
(SATB) ist kostenlos für Chöre zur Probe<br />
bzw. Aufführung beim Südtiroler Chorverband<br />
verfügbar.<br />
Bei Interesse wird sie gerne per E-Mail<br />
zugeschickt.<br />
Sopran<br />
<br />
<br />
q = 86<br />
<br />
1.Un's<br />
2.Au<br />
re<br />
f'n<br />
3.Wonn de<br />
Im Leb'n<br />
Hochzeitslied/Volkslied für gemischten Chor<br />
Her - zen geh'n<br />
Weg kimp oft<br />
Zeit<br />
a<br />
längst<br />
ge - mein-sam<br />
wos<br />
on - ders,<br />
va - gon - ga,<br />
<br />
durch des<br />
ois<br />
ma<br />
uns' re<br />
Leb'n<br />
glab<br />
Kin<br />
Helmut Pertl<br />
<br />
<br />
des uns ge -<br />
und vi - re -<br />
- der ö - ter<br />
Pertl Helmut<br />
geboren 1969 in Tamsweg<br />
im Lungau, Salzburg.<br />
Er gehörte 1989<br />
bis 1990 der Militärmusik<br />
Salzburg an und absolvierte<br />
1998 bis 2001<br />
das Lehramtsstudium in<br />
Salzburg. Am Johann-<br />
Joseph-Fux-Konservatorium<br />
in Graz studierte<br />
er Blasmusikkomposition<br />
und Direktion bei<br />
Franz Cibulka und Armin<br />
Suppan.<br />
5<br />
9<br />
<br />
<br />
14<br />
<br />
<br />
geb'n.<br />
plant.<br />
wer'n.<br />
wor.<br />
Berg.<br />
Leb'n.<br />
Gen -gan<br />
Schritt für Schritt<br />
noch<br />
O - ba moch da koa - ne Sor - g'n,<br />
Gra - e Hoor und a poor Foi - tn,<br />
Wei im Hiaz is<br />
Glei nit auf-geb'n<br />
und<br />
O<br />
Donk-<br />
schea<br />
bun - den<br />
- ba<br />
Donk -schea<br />
sogn<br />
sogn<br />
bis<br />
stringendo . . . . .<br />
oas<br />
in<br />
in<br />
zan<br />
is<br />
un - ser Le - b'n,<br />
ver - zo - g'n,<br />
oh - ne Zwei-fel,<br />
Herr - gott,<br />
Herr-<br />
gott,<br />
Gor - wer'n,<br />
dass<br />
er<br />
dass er<br />
oh - ne<br />
vi<br />
- re, oh - ne<br />
un - ser<br />
zoagn de<br />
soi ma glück-lich<br />
sei<br />
is's<br />
a Liacht des uns<br />
dass ma uns<br />
un -ser'n<br />
Weg<br />
di<br />
is<br />
hoib<br />
no<br />
un -ser'n Weg losst<br />
<br />
hin - ter-z'schau'n<br />
wos<br />
Liab'<br />
Johr<br />
va - setzt an<br />
<br />
in<br />
be gleit'.<br />
un<br />
im - mer meg'n.<br />
losst geah.<br />
so<br />
-<br />
sern<br />
und z'fried'n. Der -fn<br />
1.2.<br />
geah.<br />
Der fn<br />
San ver<br />
<br />
<br />
2.Au - f'n<br />
3.Wonn de<br />
<br />
3.<br />
18<br />
summen bis *<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
* singen<br />
<br />
schea. m m m m m m m m m m m m m m m San ver-<br />
23<br />
<br />
<br />
bun<br />
<br />
<br />
rit.<br />
- den bis zan Gor - wer'n, oh - ne di is hoib so schea.<br />
KulturFenster 36<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
kurz notiert<br />
Mehr als ein halbes<br />
Jahrhundert für die<br />
Musik in Nals<br />
Musikpionier Josef Egger<br />
Josef Egger<br />
(zweiter von<br />
rechts) wurde<br />
für seine langjährige<br />
Einsatz<br />
für die Musik in<br />
Nals geehrt.<br />
Vorsitzende des Südtiroler Chorverbandes,<br />
und Heinrich Walder, der Vorsitzende des<br />
Verbandes der Kirchenmusik: „Ich weiß,<br />
mit welchem Verständnis und mit welchem<br />
Fachwissen, aber auch mit welchem theologischen<br />
und liturgischen Wissen du an die<br />
Sache herangehst“, sagte Walder in seiner<br />
Laudatio. „Du hast die Tradition gepflegt,<br />
aber dich auch in musikalisches Neuland<br />
gewagt.“ Seinem Dank stellte er voran: „Du<br />
bist eine Institution geworden im Dorf, aber<br />
auch ein Vorbild und Beispiel für alle Chorleiter<br />
in unserem Land. Durch deine Arbeit<br />
mit dem Chor hast du vielen eine Heimat<br />
gegeben, hast die Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit<br />
gefördert und hast viele<br />
vielleicht auch zum Glauben herangeführt.<br />
Du hast einen unschätzbaren Beitrag geleistet<br />
in und für die Kirche, aber auch für<br />
das kulturelle Vereinsleben des Dorfes und<br />
unseres Landes.“<br />
60 Jahre als Musikant<br />
und Kapellmeister<br />
Am Cäciliensonntag haben Kirchenchor und<br />
Bürgerkapelle Nals einen ganz besonderen<br />
Musiker in ihren Reihen ehren können: Josef<br />
Egger leitet seit 50 Jahren den Kirchenchor,<br />
spielt die Orgel und ist eine wichtige Stütze<br />
der Pfarrgemeinde in Nals. Seit 60 Jahren<br />
ist er außerdem Musikant der Bürgerkapelle.<br />
Mit großem Wissen und menschlichem Feingefühl<br />
hat er sein Dorf über Jahrzehnte zum<br />
Klingen gebracht – und tut es auch weiterhin<br />
mit unvermindertem Engagement.<br />
Josef Egger gehört zu jenen Südtiroler Musikpionieren,<br />
deren positiven Einfluss auf<br />
die kulturelle Entwicklung des Landes man<br />
nicht hoch genug schätzen kann. Für viele<br />
Nalser ist „der Seppl“ ein Fixpunkt und bereichert<br />
das Leben in seiner Gemeinde und<br />
darüber hinaus.<br />
„Schon als Ministrant war Seppl fasziniert<br />
vom Chorgesang. Mit den Worten 'Moch du's<br />
weiter' übergab ihm der frühere Chorleiter<br />
Sepp Tarfußer im Jahr 1970 den Taktstock“,<br />
erzählt die Obfrau des Kirchenchores, Marvi<br />
Habicher: „Seppl war der erste Absolvent<br />
des neu geschaffenen Studiengangs der Kirchenmusik<br />
am Bozner Konservatorium bei<br />
Professor Herbert Paulmichl.“<br />
Seine Begeisterung hat Seppl an viele junge<br />
Menschen weitergegeben. „Seppl gehen“<br />
hieß die Nachwuchsschulung einfach, die er<br />
über Jahrzehnte wöchentlich im Pfarrheim<br />
unentgeltlich anbot. Durch seinen großen<br />
Einsatz gelang es ihm auch, das musikalische<br />
Niveau des Dorfchores beständig zu<br />
steigern: Wer Mitglied des Chores werden<br />
wollte, musste bei einer Prüfung beweisen,<br />
was er in Theorie und Praxis gelernt hatte.<br />
„Es war ihm immer wichtig zu zeigen, dass<br />
ein Kirchenchor kein fader Verein ist, sondern<br />
wie lebendig Kirchenmusik ist und wie<br />
viel Freude, Trost und Bereicherung sie uns<br />
schenkt“, hebt die Obfrau hervor.<br />
Tradition gepegt und<br />
Neuland betreten<br />
„Seppl steht auch an der Orgel immer zur<br />
Verfügung, wenn er gebraucht wird. Ihm<br />
ist es zu verdanken, dass unsere wunderbare<br />
Orgel in den 1980er Jahren gründlich<br />
erneuert wurde und daher eines der<br />
besten Instrumente des Landes blieb“, erinnert<br />
Habicher.<br />
Auch in den Zeiten der Pandemie bemühte<br />
sich Seppl, die Gottesdienste mit Orgelklang<br />
und Kleingruppen weiterhin musikalisch zu<br />
bereichern. „Ohne diesen großartigen, engagierten,<br />
nimmermüden Musiker Seppl wären<br />
wir wohl alle um einiges ärmer“, fasst<br />
Habicher zusammen.<br />
Als Zeichen der Wertschätzung, auch über<br />
die Dorfgrenzen hinaus, waren anlässlich<br />
seiner Ehrung am Cäciliensonntag 2021<br />
die Obmänner beider Südtiroler Sängerverbände<br />
anwesend: Erich Deltedesco, der<br />
Bei der Cäcilienfeier wurde Josef Egger auch<br />
von der Bürgerkapelle Nals geehrt: für 60<br />
Jahre als Klarinettist, 25 davon als Kapellmeister<br />
und Stabführer. Allein daran wird offenkundig,<br />
wie groß der musikalische, aber<br />
auch menschliche Einsatz ist, den Egger für<br />
sein Dorf und Südtirol im Allgemeinen leistet.<br />
„Nach seinem Militärdienst bei der renommierten<br />
„Banda dell'esercito“ in Rom war<br />
unser Seppl in den 1970er und 1980er<br />
Jahren im Verband Südtiroler Musikkapellen<br />
(VSM) tätig, zuerst als Bezirksvizejugendleiter,<br />
später als Bezirksjugendleiter<br />
und als Bezirkskapellmeisterstellvertreter.<br />
Seppl unterrichtete auch viele Jahre<br />
beim Kapellmeisterkurs des VSM und erhielt<br />
von seinem Kollegen Peter Wesenauer<br />
2002 als Abschiedsgeschenk eine eigene<br />
Kantate, die „Guiseppl-Kantate“, sagte der<br />
Obmann der Bürgerkapelle Nals, Christian<br />
Mahlknecht. „Seppl setzte auch, als einer<br />
der ersten Kapellmeister, auf die klassischen<br />
Instrumente in der Besetzung der<br />
Kapelle: die Oboe und das Fagott. Legendär<br />
ist wohl das erste Wertungsspiel in<br />
Feldkirch mit nur 30 Musikanten und dem<br />
Resultat 1. Rang mit Auszeichnung.“ Das<br />
Niveau der Kapelle stieg stetig an und die<br />
Kapelle wuchs auch mit den Erfolgen, erinnert<br />
der Obmann: „Seppl führte auch die<br />
ersten Mädchen bei der Kapelle ein. Zur<br />
damaligen Zeit noch eine Sensation.“ Im<br />
Jahr 2000 erhielt Josef Egger für seinen<br />
ehrenamtlichen Einsatz für Dorf und Musik<br />
die Verdienstmedaille des Landes Tirol.<br />
KulturFenster 37<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
kurz notiert<br />
Die Gaulsänger<br />
Gottesdienstgestaltung in Meran<br />
Am zweiten Sonntag nach Weihnachten,<br />
dem Fest der Hl. Familie, wurde<br />
in der Kapuzinerkirche von Meran ein<br />
feierlicher Gottesdienst gehalten. Die<br />
Messfeier zelebrierte P. Robert Prenner.<br />
Musikalisch gestalteten die Gaulsänger<br />
aus Lana die Messfeier - in Hirtenkleidung<br />
und mit weihnachtlichen Weisen.<br />
Der Andachtsjodler und das zum<br />
Abschluss gesungene Lied "Wir wünschen<br />
euch zum Neuen Jahr" gaben<br />
der Festfeier eine besondere Note. Die<br />
Die Gaulsänger Marlene Platter, Martha<br />
Schrötter, Maria Theresia Rufinatscha,<br />
Alfred Sagmeister, P. Robert Prenner,<br />
Theresia Paris, Maria Sagmeister und<br />
Maria Sulzer (v.l.)<br />
Gaulsänger wurden 1998 in Lana gegründet,<br />
um Theateraufführungen einen<br />
musikalischen Rahmen zu geben.<br />
Seither singt der Chor vor allem alpenländisches<br />
Liedgut und Jodler, sei es<br />
weltliche wie geistliche Werke.<br />
Besondere Ehrungen wurden am Cäciliensonntag<br />
2021 im Pfarrchor Lana vorgenommen.<br />
Der Tag begann mit einem festlichen<br />
Gottesdienst in der Hl. Kreuzkirche<br />
mit der Aufführung der „Kleinen Messe“<br />
von Benedikt Baldauf. Bei der weltlichen<br />
Feier im Pfarrsaal, zu dem auch Dekan<br />
P. Peter Unterhofer OT gekommen war,<br />
wurden langjährige, verdiente Mitglieder<br />
geehrt. Aufgrund der aktuellen Situation<br />
waren alle Teilnehmer*innen mit dem<br />
„Green Pass“ ausgestattet. Albert Ungerer<br />
wurde für seine 50-jährige musikalische<br />
Tätigkeit – unter anderem auch<br />
als fl eißiger und umsichtiger Notenwart<br />
– mit der Ehrenurkunde vom Südtiroler<br />
Dank und Anerkennung<br />
Ehrungen im Pfarrchor Lana<br />
Chorverband und vom Verband der Südtiroler<br />
Kirchenmusik ausgezeichnet und<br />
gewürdigt. Claudia Insam erhielt die Ehrenurkunde<br />
für 15 Jahre Singen im Chor,<br />
zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Dank<br />
und Anerkennung gab es zudem für Ingrid<br />
Rieder Ebnicher. Sie leitet seit über 15<br />
Jahren erfolgreich, mit viel Engagement<br />
und Fachkönnen den Pfarrchor Lana.<br />
Dekan P. Peter. Unterhofer OT, Claudia Insam, Albert Ungerer, Chorobmann Reinhard<br />
Ladurner und Chorleiterin Ingrid Rieder Ebnicher (v.l.)<br />
Cäciliensonntag mit strengen Corona-Regeln<br />
Kirchenchor Nals<br />
Gemeinsam feierten Kirchenchor und<br />
Bürgerkapelle den Cäciliensonntag – unter<br />
Einhaltung strenger Anti-Covid-Regeln<br />
mit Green Pass und Schnelltestmöglichkeit<br />
– bei der Festmesse und anschließend<br />
im Vereinshaus.<br />
Geehrt wurden neben Chorleiter<br />
Josef Egger (siehe Seite 37) die<br />
Sänger*innenMartin Kompatscher (40<br />
Jahre), Martin Egger (25 Jahre), Franz<br />
Ladurner (25 Jahre), Marvi Habicher<br />
(15 Jahre), und die Musikanten Ulrich<br />
Windegger (40 Jahre), Martin Huber (40<br />
Jahre), Sara Stanger (25 Jahre), Werner<br />
Schwarz (25 Jahre), Margit Passler (15<br />
Jahre) und Peter Mathá (15 Jahre). Die<br />
Ehrung für Walter Brugger (50 Jahre im<br />
Kirchenchor) wird zu einem späteren<br />
Zeitpunkt nachgeholt. Auch Seelsorger<br />
Richard Sullmann, Bürgermeister Ludwig<br />
Busetti, der Obmann des VSM-Bezirks<br />
Meran, Andreas Augscheller, das<br />
Ehrenmitglied des Kirchenchores, Hilda<br />
Ebner, der Kommandant der Freiwilligen<br />
Feuerwehr Christian Malpaga und die Direktorin<br />
der Raiffeisenkasse Etschtal, Susanne<br />
Huber, feierten mit.<br />
KulturFenster 38<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Chorwesen<br />
75 Jahre Kapuzinerchor Lana<br />
Neue Sänger*innen sind willkommen<br />
Coronabedingt sind im Bild nur vier der Geehrten zu sehen: (von links nach rechts) Dieter<br />
Laner, Martha Rösch Aspmair, Annemarie Gasser Fabi und Luis Hanspeter.<br />
Am Cäciliensonntag 2021 feierte der Kapuzinerchor<br />
Lana sein 75-jähriges Bestandsjubiläum.<br />
Bei der Messfeier verwies Pater<br />
Bruno auf die ehrenamtliche Tätigkeit<br />
des Chores und dankte für die erbauliche<br />
Mitgestaltung der Gottesdienste. Er erinnerte<br />
daran, dass der Chor im Jahre 1946<br />
vom Flüchtlingspriester Anton Radanovic<br />
als Kinderchor gegründet wurde, um die<br />
10-Uhr-Messe aufzuwerten. Ihm zur Seite<br />
stand Kathi Leitgeb als Organistin. Ihre Arbeit<br />
übernahm später Franz Hanspeter bis<br />
1988. Auf ihn folgte Paolo Valenti, der bis<br />
heute den Chor ehrenamtlich auf der Orgel<br />
begleitet. Seit 1978 leitet Frau Erika Pedoth-<br />
Kerschbamer unermüdlich den Chor, und<br />
seit 1998 fungiert Renate Häser-Kaserer als<br />
Obfrau. Im Laufe seines 75-jähriges Bestehens<br />
hat der Chor hauptsächlich an Feiertagen<br />
und Jubiläen in der Kapuzinerkirche<br />
gesungen. Die Messe im Juli am Vigiljoch,<br />
Rorate in der St. Peter Kirche, Maiandachten<br />
in St. Agatha, Helmsdorf und Johanneskirche<br />
durften nicht fehlen. Gerne sang<br />
der Chor mit dem Pfarrchor bei den Prozessionen<br />
und Messen zu Fronleichnam,<br />
Herz Jesu, Maria Geburt und Allerheiligen.<br />
Er beteiligte sich auch immer an Gemeinschaftskonzerten<br />
mit allen Chören und der<br />
Bürgerkapelle. Das letzte Konzert war die<br />
Aufführung der Cäcilienmesse von Gottfried<br />
Veit. Gute Zusammenarbeit pflegt der Chor<br />
auch mit den Bäuerinnen beim „Sträußleinbinden<br />
für einen guten Zweck“ am Hoch-<br />
Unser-Frauentag. Diesmal fiel die weltliche<br />
Cäcilien- und Jubiläumsfeier coronabedingt<br />
aus. Aber Ehrungen gab es trotzdem. Der<br />
Dank für ihre langjährige Tätigkeit zum<br />
Wohle der Kirchengemeinschaft ging an Annemarie<br />
Gasser Fabi (70 Jahre), Dieter Laner<br />
(60 Jahre), Luisl Hanspeter (35 Jahre),<br />
Josef Margesin (35 Jahre), Christian Höller<br />
(30 Jahre), Hans Troger (30 Jahre), Martha<br />
Rösch Aspmair (20 Jahre) und Monika Hintner<br />
Lösch (20 Jahre). Doch der Dank gilt<br />
auch allen anderen Chormitgliedern für ihren<br />
unermüdlichen Einsatz, besonders in<br />
dieser schwierigen Coronazeit. Der Kapuzinerchor,<br />
der sich schon sehr auf ein geregeltes<br />
Vereinsleben freut, lädt alle Interessierten<br />
ein, sich bei ihm zu melden und<br />
Mitglied des Chors zu werden.<br />
Rückblick auf ein gelungenes Adventskonzert<br />
Singkreis Runkelstein<br />
Für Liebhaber alpenländischer Adventsmusik<br />
waren die Konzerte des Singkreis<br />
Runkelstein am vergangenen 27. November<br />
in der Franziskanerkirche in Bozen ein<br />
Geschenk. Chorleiterin Petra Sölva hat es<br />
verstanden, den Stimmen Zartheit, Innigkeit<br />
und Kraft zu entlocken. Das Programm<br />
wurde einfühlsam auf den Advent<br />
wie „Hiatz kimmb a wunderbare Zeit“ sowie<br />
auf die Jahreszeit „Is‘ finster draußt"<br />
und "Still, ganz still is da Winta hiatz keman“<br />
abgestimmt. Auch der darauf folgende<br />
8. Dezember zum Fest Mariä Empfängnis<br />
wurde thematisch durch mehrere<br />
Marienlieder beleuchtet – etwa mit „Maria<br />
ging übers Gebirge“, wobei die erste Strophe<br />
vom Männerchor, die zweite Strophe<br />
mit drei Solostimmen von Frauen, die dritte<br />
Strophe vom gesamten Chor und abschließend<br />
vom Männerchor vorgetragen wurde.<br />
Das Quartett „Holzsound“ vom Ritten unter<br />
der Leitung von Andreas Mair unterstrich<br />
mit dem „Advent Boarischer“ und<br />
anderen Melodien, wie „Es wird ein Stern<br />
aufgehen", die Fröhlichkeit der Adventszeit.<br />
Das Konzert wurde mit dem schlichten<br />
Lied „ An Friedn dafragn“ und dem<br />
Andachtsjodler würdig beendet.<br />
Der Singkreis Runkelstein gestaltete in der Franziskanerkirche in Bozen ein besinnliches<br />
Adventskonzert.<br />
KulturFenster<br />
39<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Der Begriff Heimat lässt sich weder<br />
übersetzen noch ersetzen – Heimat ist<br />
etwas ganz Besonderes.<br />
KulturFenster 40<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
verwurzelt<br />
„Heimat ist eine Einladung“<br />
Versuche einer Begriffsdefinition – Das sagt der Heimatpflegeverband<br />
„Heimat, immer noch? – Zur Dauer und Aktualität<br />
eines Begriffes“ – unter diesem Titel<br />
fand im Dezember 2021 an der Freien<br />
Universität Bozen eine Tagung statt. Die<br />
Veranstaltung ist Anlass für den Heimatpflegeverband,<br />
den nicht unumstrittenen<br />
Begriff, den er in seinem Namen trägt, näher<br />
zu beleuchten. Jeder und jede kann<br />
und sollte sich vielleicht einmal die Frage<br />
stellen: Was ist Heimat? Auf dieser und<br />
den folgenden Seiten gibt es einige Inspirationen<br />
für den ganz persönlichen Heimatbegriff.<br />
Für den Heimatpflegeverband Südtirol<br />
nahm Obfrau Claudia Plaikner an der Tagung<br />
„Heimat, immer noch?“ teil. Aus ihrem<br />
Statement – hier zusammengefasst<br />
– geht klar hervor, was der Begriff Heimat<br />
für den Verband bedeutet, der ihn<br />
namentlich vertritt:<br />
„Heimat ist ein altes Wort: Verwahr ich‘s<br />
oder werf ich‘s fort?“, singt der deutsche<br />
Liedermacher und Folkmusiker Tom Kannmacher.<br />
Dass das Wort nicht weggeworfen<br />
werden kann, ist evident: Es wird von<br />
vielen Menschen mehr oder weniger bewusst<br />
gebraucht. Wissenschaftler*innen,<br />
Politiker*innen und auch Institutionen wie<br />
die Heimatverbände zerbrechen sich den<br />
Wie das Wetter und der Blick auf die Stadt, so ist auch der Heimatbegriff nichts Statisches,<br />
sondern etwas Dynamisches.<br />
Foto: IDM Südtirol/Tina Sturzenegger<br />
Kopf über Definition von Heimat. Man<br />
distanziert sich vom Begriff, weil ideologische<br />
Verstrickungen damit verbunden<br />
sind. Man entleert ihn der alten Konnotationen,<br />
versucht, einen adäquaten neuen<br />
Begriff an seiner statt zu fi nden.<br />
Es gibt auch Symbole, die man unwillkürlich<br />
mit dem Heimatbegriff verbindet.<br />
Foto: E. Runer<br />
Weder über- noch ersetzbar<br />
Heimat ist ein Wort, das schwerlich in<br />
eine andere Sprache zu übersetzen und<br />
schwerlich mit einem adäquaten anderen<br />
Wort zu ersetzen ist.<br />
Wir Südtiroler Heimatpfl eger*innen stehen<br />
ganz klar zu historischer und gesellschaftlicher<br />
Verantwortung, zu einem dynamischen,<br />
inkludierenden Heimatbegriff,<br />
der auch eine durchaus selbstkritische und<br />
dialogische Erinnerungskultur pflegt – so<br />
wie Aleida Assmann das in ihrem Buch<br />
„Die Wiederfindung der Nation“ als wichtigen<br />
integrierenden Bestandteil von Demokratisierung,<br />
Friedenssicherung und Anerkennung<br />
der Menschenrechte definiert.<br />
Erinnerungskultur lässt sich an den zwei<br />
Konstanten von Ort und Zeit festmachen.<br />
Kultur zu pflegen bedeutet laut unserem<br />
Verständnis die Vertiefung des Wissens<br />
über Herkunft, Geschichte, Sozial- und<br />
Kulturformen in einem definierten Umkreis.<br />
Sie widmet sich der wissenschaftlichen<br />
Aufarbeitung derselben und ver-<br />
KulturFenster 41<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
verwurzelt<br />
Heimatpflege – Pflege der Heimat: Der Schutz und die behutsame sowie verantwortungsbewusste Weiterentwicklung von Natur- und<br />
Kulturlandschaft gehören dazu.<br />
Foto: IDM Südtirol/Dietmar Denger<br />
sucht, daraus Handlungsräume für die<br />
aktuellen Themen und Herausforderungen<br />
zu entwickeln.<br />
Nicht statisch,<br />
sondern dynamisch<br />
Heimat ist nichts Statisches, sondern immer<br />
etwas Prozessuales, Dynamisches.<br />
Der Mensch schafft Heimat als Wahrnehmender<br />
und Agierender, und durch<br />
„<br />
Heimat ist ein Wort, das schwerlich<br />
in eine andere Sprache zu übersetzen<br />
und schwerlich mit einem adä-<br />
„<br />
quaten anderen Wort zu ersetzen ist.<br />
Claudia Plaikner<br />
die Ermöglichung von Partizipation entsteht<br />
Transformation. „Heimat entsteht<br />
aus emotionalen Bindungen und sozialer<br />
Vernetzung in einem persönlichen Handlungs-<br />
und Verantwortungsraum“. Diese<br />
Definition von Heimatverständnis, wie sie<br />
der BHU in Deutschland gibt, erscheint mir<br />
eine durchaus überzeugende und praktikable<br />
Annäherung an diesen so schwer<br />
zu fassenden Begriff zu sein.<br />
Heimat im Plural<br />
Die globalisierte Welt, die Möglichkeit des<br />
fast unbeschränkten Erkundens der Welt,<br />
forciert auf der einen Seite – im besten<br />
Fall – eine intellektuelle und gefühlsmäßige<br />
Öffnung gegenüber anderen Lebenswelten.<br />
Andererseits ruft es ein Bedürfnis<br />
nach Beheimatung oder besser Verortung<br />
hervor. Berufliche Notwendigkeiten<br />
und private Interessen führen dazu, dass<br />
wir im Laufe unseres Lebens häufig mehrere<br />
Heimaten kennenlernen. Wir nehmen<br />
aus diesen Heimaten einiges mit auf die<br />
Reise, einiges lassen wir – freiwillig oder<br />
auch notgedrungen – zurück. „Heimat entsteht<br />
durch das inspirierte Tun vieler, geprägt<br />
vom Mut, sich selbst an kulturelles<br />
und gesellschaftliches Wirken heranzuwagen<br />
…“, schrieb der Bayerische Landesverein<br />
für Heimatpflege 2019 in einem offenen<br />
Brief.<br />
Für den Heimatpflegeverband Südtirol entstehen<br />
konkrete Handlungs- und Verantwortungsräume<br />
im Schutz und in der behutsamen<br />
und verantwortungsbewussten<br />
Weiterentwicklung von Natur- und Kulturlandschaft.<br />
Wir setzen dabei zunehmend<br />
auf Netzwerkarbeit, um durch Partizipation<br />
das Engagement von Einzelpersonen<br />
und Vereinigungen mit zu unterstützen.<br />
Heimat ist in unserem Selbstverständnis<br />
prinzipiell eine Einladung.<br />
Claudia Plaikner<br />
KulturFenster 42<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Heimatpege<br />
Neu aufgewärmt?<br />
In folgendem Beitrag beleuchtet der Historiker<br />
Hans Heiss – auch er nahm an der Tagung<br />
der Uni Bozen teil – das Thema „Heimat“<br />
aus verschiedenen Blickwinkeln und<br />
kommt zum Schluss: Südtirol wäre ein ideales<br />
Testfeld für einen offenen Heimatbegriff.<br />
Die Klimakrise hat die Frage der Heimat<br />
wiederum aufs Tapet gebracht und neu<br />
aufgewärmt, im wahrsten Wortsinne. Denn<br />
die klimatischen Veränderungen zielen wie<br />
„Heimat“ auf allgemeine und größere Zusammenhänge,<br />
die in diesem Fall zudem<br />
eine globale Dimension erreichen. Sie erreichen<br />
aber auch die subjektive Dimension,<br />
wenn die Klimakrise die Frage an<br />
uns richtet: Welche Verantwortung willst<br />
du übernehmen?<br />
Heimat in der Klimakrise –<br />
Ein Beitrag des Historikers Hans Heiss<br />
Der Historiker Hans Heiss erklärt, warum<br />
Heimat in direktem Zusammenhang mit der<br />
Klimakrise steht.<br />
Nächstes und Fernstes sind eng verbunden.<br />
Wer sein bislang gewohntes CO 2<br />
-Paket<br />
weiter ungerührt in die Luft bläst, beschädigt<br />
damit nicht nur die eigene Ökosphäre,<br />
sondern auch den Lebensraum von Menschen<br />
und Gesellschaften auf einer anderen<br />
Seite des Planeten und greift ihre<br />
Heimaten an. Damit stehen persönliche<br />
Lebensführung, eigene Werthaltungen<br />
und Raumvorstellungen grundlegend auf<br />
dem Prüfstand. „Heimat“ ist mehr als das<br />
Eigene. Die Klimakrise zerbricht vertraute<br />
Zusammenhänge von Raum und Zeit, von<br />
Aktion, Umgang und Austausch, von Riten<br />
und Gewohnheiten. Und sie stellt drei<br />
grundlegende Fragen: Wo leben wir? Mit<br />
wem leben wir? Wie leben wir?<br />
Beim Versuch einer Antwort auf die drei<br />
einfachen Fragen wird sich bald zeigen, wie<br />
wenig wir darüber wissen. Es geht in der<br />
Klimakrise vorab darum, den eigenen Lebensraum<br />
neu zu bewerten und zu überprüfen,<br />
ob unser Handeln, das eigene Verhalten<br />
verträglich ist, ob sie das Prädikat<br />
„heimatgerecht“ verdienen.<br />
Die identitäre Versuchung<br />
Südtirol ist heute bestimmt vom Spannungsfeld<br />
dreier Pole: zwischen identitärer<br />
Versuchung, ökonomischer Verwertung<br />
und europäischer Verortung, die wir<br />
einer Erklärung zuführen.<br />
Die identitäre Versuchung einer autonomen<br />
und mehrsprachigen Provinz wie<br />
Südtirol liegt darin, das Prinzip des Ethnischen<br />
und des Eigenen als zentrale Logik<br />
zu begreifen. Das Bewusstsein vieler<br />
Bürger*innen, einer Sprachgruppe anzugehören<br />
und der eigenen Ethnie Vorrang<br />
zuzubilligen, ist der jüngeren Geschichte<br />
Südtirols eingeschrieben und<br />
ein Bauprinzip der Autonomie. Die lange<br />
dominante Ethnisierung hat sich aber in<br />
den letzten Jahrzehnten abgeschwächt.<br />
Zum Teil wurde sie übersetzt in den kommunikativen<br />
Prozess eines Miteinanders<br />
und Austausches, überwiegend aber in<br />
ein „Ohne einander“ (Gabiele Di Luca).<br />
Die Kunst vieler Deutsch- oder Italienischsprachiger,<br />
weniger der Ladiner, die jeweils<br />
andere Sprachgruppe zu vermeiden,<br />
hat hohe Virtuosität erreicht, in einer<br />
Form von sanfter Segregation, in der Südtirol<br />
führend ist. Und die Rivalität der traditionellen<br />
Sprachgruppen hat sich auch<br />
dadurch abgeschwächt, dass inzwischen<br />
140 weitere Nationalitäten in Südtirol leben<br />
und die nicht durchwegs geliebte multikulturelle<br />
Realität die Scheidelinie alter<br />
ethnischer Vorbehalte stark relativieren.<br />
Die identitäre Versuchung fühlt sich weiter<br />
hingezogen zu einer Abkehr von Italien, sie<br />
ist aber das Programm einer Minderheit,<br />
„<br />
Es geht in der Klimakrise vorab darum,<br />
den eigenen Lebensraum neu<br />
zu bewerten und zu überprüfen, ob<br />
unser Handeln, das eigene Verhalten<br />
verträglich ist, ob sie das Prädi-<br />
„<br />
kat „heimatgerecht“ verdienen.<br />
Hans Heiss<br />
KulturFenster 43<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
verwurzelt<br />
die auf Selbstbestimmung, einen Freistaat<br />
oder eine Rückkehr zu Österreich abzielt.<br />
Im Allgemeinen aber überwiegt die pragmatische<br />
Haltung „Wir sind nun halt einmal<br />
bei Italien“. Das Identitäre fi ndet sich<br />
schließlich in starker Betonung des Lokalismus,<br />
im Eigenleben vieler Dörfer, die als<br />
Konsens- und Konfl iktgemeinschaft das<br />
Eigene hingebungsvoll pflegen. Als Ortsgemeinschaft,<br />
vor allem im überaus regen<br />
Vereinsleben und der dialektalen Betonung.<br />
Der stete Bau an Mikroheimaten<br />
ist ein Bauprinzip der Autonomie.<br />
Die ökonomische<br />
Verwertung<br />
„<br />
Die Landschaft gilt als Ziel des Investments<br />
von Bauträgern, die nicht<br />
nur den landeseigenen Wohnbedarf<br />
und maßvolle Profitabilität im Auge<br />
haben, sondern das Anlage- wie Erholungsbedürfnis<br />
einer mobilen<br />
„<br />
Oberschicht.<br />
Hans Heiss<br />
Ein zweites Spannungsfeld liegt in der ökonomischen<br />
Verwertung des Landes. Man<br />
kennt den Leitspruch der IDM, Südtirol<br />
„zum begehrlichsten Lebensraum Europas“<br />
zu erheben. Die Ambivalenz der Devise<br />
ist erhellend, da sie zwar meint, Südtirol<br />
auf den Rang einer hoch begehrten<br />
Destination zu führen. In der Formel des<br />
„begehrlichsten Lebensraumes“ sind aber<br />
auch das eigene Begehren, die eigene Gier<br />
angesprochen. Und in der Tat: Die neben<br />
den Menschen und der Biosphäre wertvollste<br />
Ressource des Landes, die Landschaft,<br />
ist vielfältigen Begierden ausgesetzt.<br />
Sie gilt als Ziel des Investments von<br />
Bauträgern, die nicht nur den landeseigenen<br />
Wohnbedarf und maßvolle Profitabilität<br />
im Auge haben, sondern das Anlagewie<br />
Erholungsbedürfnis einer mobilen<br />
Oberschicht. Und Landschaft gilt als Expansionsraum<br />
touristischen Wachstums,<br />
das trotz aller Bettenstopp-Beteuerungen<br />
ungebrochen ist. Ein Gebirgsraum mit reicher<br />
wie vulnerabler Biosphäre, aber einer<br />
besiedelbaren Fläche von fünf Prozent,<br />
mag begehrenswert sein, erreicht<br />
aber in seiner Belastbarkeit sehr rasch<br />
seine Grenzen.<br />
Die europäische Verortung<br />
Die europäische Verortung Südtirols ist<br />
denkbar, aber nicht realistisch. Südtirol<br />
wäre denkbar als eine Region, die Nähe,<br />
Verbindlichkeit und seine oft gerühmte<br />
Herzlichkeit mit Offenheit verknüpft. Als<br />
ein Ort, der neben 230.000 Gästebetten<br />
auch ein Promille davon für Obdachlose<br />
bereitstellt. Als eine Provinz mit nicht nur<br />
einem einzigen kleinen „Haus der Solidarität“<br />
(in Brixen), sondern die durchgängig<br />
von Solidarität bestimmt ist.<br />
Südtirol als ein Lebensraum, der sich weniger<br />
nach außen abgrenzt, dafür aber innere<br />
Grenzen respektiert: seine begrenzte<br />
ökologische Belastbarkeit, die Vulnerabilität<br />
seiner Natur und Landschaft, deren Vielfalt<br />
stetig abnimmt und als Region, deren<br />
Begabteste jährlich nicht zu Hunderten in<br />
die Welt abziehen, sondern die ihnen als<br />
Ort der Innovation und Qualifikation Chancen<br />
in Fülle bietet.<br />
Kurzum: Südtirol wäre ein ideales Testfeld<br />
für einen offenen Heimatbegriff, dessen<br />
Realisierung aber werde ich nicht<br />
mehr erleben.<br />
Hans Heiss<br />
Südtirols Natur und Landschaft sind<br />
ebenso einzigartig wie verletztlich.<br />
Foto: E. Runer<br />
Aus der Redaktion<br />
Ihre Beiträge (Texte und Bilder) für die Seiten des<br />
Heimatpflegeverbandes senden Sie bitte an: florian@hpv.bz.it<br />
Für etwaige Vorschläge und Fragen erreichen Sie uns unter<br />
folgender Nummer: +39 0471 973 693 (Heimatpflegeverband)<br />
Redaktionsschluss für<br />
die nächste Ausgabe des<br />
„KulturFensters“ ist:<br />
Freitag, 11. März <strong>2022</strong><br />
44<br />
KulturFenster 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Heimatpege<br />
Was ist Heimat?<br />
Umfrage unter den Mitgliedern des HPV-Vorstandes<br />
Heimat ist für mich dort, wo mein<br />
Herz sich rundum wohl fühlt.<br />
Heimat ist für mich<br />
... jeden Sommer<br />
aufs Neue<br />
der Duft der blühenden<br />
Edelkastanie.<br />
Johannes Ortner<br />
Agnes Andergassen<br />
Heimat bedeutet<br />
für mich ein<br />
Gefühl der Geborgenheit,<br />
Zugehörigkeit<br />
und Sicherheit.<br />
Heimat gibt in der heutigen<br />
schnelllebigen Welt Orientierung,<br />
die notwendiger denn je ist.<br />
Franz Fliri<br />
Heimat besteht für mich in erfüllenden<br />
emotionalen Bindungen, in<br />
wertvollen sozialen Beziehungen<br />
und verdichtet sich in meinem Engagement<br />
für die Kultur und Natur<br />
unseres Landes.<br />
Claudia Plaikner<br />
Heimat bedeutet<br />
für mich etwas<br />
Wertvolles, das ich<br />
verbinde mit Erinnerungen<br />
und Träumen,<br />
mit Gerüchen und Geräuschen, mit<br />
Landschaft und Natur, mit Sprache<br />
und Musik, aber besonders mit Menschen,<br />
die mir nahe stehen, und Orten,<br />
an denen ich mich mehr oder weniger<br />
zuhause fühle.<br />
Josef Vieider<br />
Heimat bedeutet für mich nicht nur<br />
den Ort, wo man den Heimatschein<br />
erhält, sondern das Land der Ahnen,<br />
der Kindheit und auch des<br />
Sterbens. Kaiser Maximilian hat in<br />
diesem Sinne treffend über Tirol gesagt,<br />
und das teile ich auch: „Tirol ist wie ein<br />
Bauernkittel, er ist rau, aber er hält fest und warm.“<br />
Georg Hörwarter<br />
Heimat verspüre ich, wo ich mich empfangen fühle und einfach sein kann. Heimat<br />
bedeutet für mich kein bestimmter Ort, keine physische Gebundenheit und ist<br />
an keine bestimmte Menschengruppe geknüpft. Die Heimatbezüge sind im ständigen<br />
Wandel und werden in den verschiedenen Lebenssituationen stets neu defi<br />
niert. Heimat sind Orte des Wohlgefühls.<br />
Valentine Kostner<br />
45<br />
KulturFenster 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
verwurzelt<br />
Weltoffen und in die<br />
Zukunft gerichtet<br />
Vom Versuch, einen ganz besonderen Begriff zu erklären<br />
„KF“: Der BHU vertritt rund 500.000 Mitglieder<br />
mit vielleicht fast ebenso vielen<br />
persönlichen Interpretationen. Wie ist es<br />
gelungen, diese auf einen gemeinsamen<br />
Nenner zu bringen?<br />
Gotzmann: Wir haben unser Anliegen mit<br />
den Landesverbänden, den Fachgruppen,<br />
dem Beirat und natürlich im Vorstand eingehend<br />
diskutiert und zudem eine Tagung<br />
zum Thema „Heimat“ organisiert. Das Ergebnis<br />
dieser Arbeiten wurde zusammengefasst,<br />
erneut in den Gremien behandelt<br />
und schließlich in der Mitgliederversammlung<br />
abgestimmt. Es war ein Prozess von<br />
zwei bis drei Jahren.<br />
Wie aus der Umfrage (Seite 35) ersichtlich,<br />
hat jeder ein ganz individuelles Verständnis<br />
von Heimat. Aber wofür steht Heimat<br />
dann eigentlich? Lässt sich der Begriff<br />
überhaupt defi nieren? Mit diesen schwierigen<br />
Fragen hat sich der Bund Heimat und<br />
Umwelt (BHU) in Deutschland auseinandergesetzt<br />
und ist auf ein spannendes Ergebnis<br />
gekommen, wie Geschäftsführerin Inge<br />
Gotzmann in folgendem Interview erklärt.<br />
„KulturFenster“: Den Begriff Heimat zu<br />
definieren, scheint ein schwieriges Unterfangen.<br />
Der Bund Heimat und Umwelt<br />
(BHU) in Deutschland hat es gewagt. Wie<br />
kam es dazu?<br />
Inge Gotzmann: Als Organisation, die den<br />
Begriff im Namen trägt, kommen wir natürlich<br />
immer wieder in die Lage, uns mit Heimat<br />
auseinanderzusetzen. Und wir stoßen<br />
unwillkürlich auf die unterschiedlichsten Interpretationen.<br />
Problematisch ist aber, dass<br />
Heimat leider immer wieder mit rechtsgerichtet<br />
gleichgesetzt oder zumindest indirekt<br />
so wahrgenommen wird. Dem wollten<br />
wir entgegentreten. Wir wollten öffentlich<br />
erklären, was wir unter Heimat verstehen.<br />
„KF“: Und was versteht der BHU darunter?<br />
Gotzmann: Nun, wir sind uns in den Diskussionen<br />
schnell klar geworden, dass es keinen<br />
Sinn macht, den Begriff mit einem Satz<br />
zu definieren, weil jegliche Definition auf<br />
irgendeine Weise eingrenzend erscheint.<br />
Also haben wir uns dazu entschlossen,<br />
eine Positionsbestimmung zu verfassen<br />
und darin zu beschreiben, wofür Heimat<br />
aus unserer Sicht steht.<br />
„KF“: Laut Duden ist Heimat ein „Ort, wo<br />
man aufgewachsen ist oder sich durch<br />
ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt“. Der<br />
BHU geht in seiner Beschreibung viel weiter.<br />
Warum?<br />
Gotzmann: Wir fanden die Duden-Definition,<br />
die Heimat rein als Ort begreift, nicht<br />
mehr passend. Zum einen, weil unsere<br />
Gesellschaft heute sehr mobil ist, viele<br />
Menschen nicht mehr dort wohnen, wo<br />
sie aufgewachsen sind, und daher vielleicht<br />
zwei oder mehrere Heimaten haben.<br />
Zum anderen ist uns bewusst, dass<br />
vor allem junge Menschen Heimat eher<br />
mit einem Gefühl als mit einem Ort verbinden.<br />
Wenn man sie fragt, bedeutet<br />
Heimat für sie in erster Linie Freunde,<br />
Familie, soziale Kontakte. Ich wage die<br />
These, dass erst mit zunehmendem Alter<br />
bestimmte Orte oder Landschaften<br />
stärker als Heimat empfunden werden,<br />
da sie mit schönen Erinnerungen und<br />
Emotionen verbunden sind. Deshalb haben<br />
wir den Begriff auf das Emotionale<br />
und Soziale ausgedehnt.<br />
„KF“: Sie haben bereits angedeutet, dass<br />
der Heimatbegriff ideologisch belastet ist.<br />
Glauben Sie, dass er dieses Brandmal jemals<br />
loswerden kann?<br />
Gotzmann: Ich fürchte, dass es nicht so<br />
einfach ist, den Begriff von seinem ideologischen<br />
Beigeschmack zu befreien. Dafür<br />
gibt es leider immer noch zu viele Kräfte,<br />
die versuchen, ihn zu instrumentalisieren.<br />
Der BHU sagt allerdings auch ganz klar:<br />
Aufgeben wollen wir den Begriff nicht. Das<br />
ist wichtig, denn wir hören aus dem universitären<br />
Bereich, insbesondere jenem<br />
der Ethnologie die These, Heimat sei nicht<br />
mehr zeitgemäß und sollte daher als Begriff<br />
nicht mehr verwendet werden. Wenn<br />
wir dem folgen, überlassen wir die „Heimat“<br />
tatsächlich den Rechten.<br />
KulturFenster 46<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Heimatpege<br />
„<br />
„KF“: Reicht ein Positionspapier aus, um<br />
sich von der rechten Ecke zu distanzieren?<br />
Gotzmann: Ich glaube, es reicht für uns Heimatverbände<br />
nicht, einfach zu sagen: Wir<br />
Heimatverbände verstehen Heimat nicht<br />
als rechtsgerichtet. Vielmehr müssen wir<br />
unsere Haltung offensiv stärken und kommunikativ<br />
damit umgehen, zum Beispiel<br />
mit Veranstaltungen, im Internet, in Kulturzeitschriften.<br />
Wir sollten den Begriff zudem<br />
aktiv nutzen, ihn gestalten. Auch das<br />
Positionspapier des BHU ist nicht in Stein<br />
gemeißelt. Es kann eines Tages auch weiterentwickelt<br />
und der Zeit angepasst werden.<br />
Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Die Gestaltung<br />
unseres Positionspapieres liegt in<br />
etwa vier Jahre zurück. Die Zeit war damals<br />
vor allem in Deutschland sehr stark von der<br />
Flüchtlingsbewegung geprägt. Deshalb haben<br />
wir an manchen Stellen im Papier besonders<br />
betont, dass es auch Menschen<br />
gibt, die ihre Heimat verlieren, und dass<br />
es darum geht, offen zu sein für alle, die<br />
ankommen und hoffentlich hier bei uns<br />
Heimat fi nden. Diese Betonung hätte es<br />
früher vielleicht nicht so gegeben.<br />
„<br />
Problematisch ist, dass der Begriff Heimat leider immer<br />
wieder mit rechtsgerichtet gleichgesetzt oder zumindest<br />
indirekt so wahrgenommen wird.<br />
Ich wage die These, dass erst mit zunehmendem Alter<br />
bestimmte Orte oder Landschaften stärker als Heimat<br />
empfunden werden, da sie mit schönen Erinnerungen und<br />
Emotionen verbunden sind. Je mehr sich die Menschen bewusst<br />
werden, was Teil ihrer Heimat ist, sei es Materielles oder<br />
Immaterielles, desto wertvoller wird diese Heimat.<br />
„KF“: In seiner Definition gibt der BHU der<br />
Heimat viel Spielraum. Können Sie einige<br />
wesentliche Punkte hervorheben?<br />
Gotzmann: Ich glaube schon, dass Heimat<br />
auch als Ort eine wichtige Rolle spielt. Wesentlich<br />
sind aber auch die sozialen Beziehungen.<br />
Im Positionspapier haben wir versucht,<br />
deutlich zu machen, dass es auch<br />
um das persönliche Engagement geht. Man<br />
sollte vernetzt, Teil einer Gesellschaft sein.<br />
„KF“: Es fällt auf, dass auf die Partizipation,<br />
also die Teilhabe, Wert gelegt wird. Warum?<br />
Gotzmann: Je mehr sich die Menschen bewusst<br />
werden, was Teil ihrer Heimat ist,<br />
sei es Materielles oder Immaterielles, desto<br />
wertvoller wird diese Heimat – und damit<br />
auch die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen,<br />
sie zu gestalten oder<br />
zu erhalten.<br />
„KF“: In Südtirol ist Heimat sehr eng mit<br />
Tradition verstrickt. Wie wichtig ist Tradition?<br />
Gotzmann: Es ist interessant, dass in gewissen<br />
Gebieten wie Südtirol, Bayern, Österreich,<br />
aber auch in Schleswig Holstein<br />
Bund Heimat und Umwelt in Deutschland<br />
Inge Gotzmann<br />
Der 1904 gegründete Bund Heimat und Umwelt<br />
in Deutschland (BHU) ist der Bundesverband<br />
der Bürger- und Heimatverbände in Deutschland<br />
– vergleichbar mit dem Heimatpflegeverband<br />
in Südtirol, jedoch auf gesamtstaatlicher<br />
Ebene. Über seine 18 Landesverbände vertritt<br />
er rund 500.000 Mitglieder und ist damit die<br />
größte kulturelle Bürgerbewegung dieser Art in<br />
Deutschland.<br />
oder Mecklenburg Vorpommern Heimat<br />
stark mit Traditionen wie Tracht, Tanz und<br />
Musik verbunden ist. Wir hier in Bonn –<br />
der Sitz des BHU ist in Nordrhein-Westfalen<br />
– verbinden Heimat im Vergleich weniger<br />
mit diesen traditionellen Themen.<br />
Insofern ist das ein weiterer Aspekt, der<br />
beweist, dass Heimat ganz unterschiedlich<br />
wahrgenommen wird.<br />
„KF“: Wie könnte man Ihrer Ansicht nach<br />
junge Menschen dazu animieren, sich mit<br />
dem Heimatbegriff auseinanderzusetzen<br />
und also auch mit den Themen der Heimatverbände?<br />
Gotzmann: Jugend ist für unseren Verband<br />
ein Dauerthema, wohl auch deshalb, weil<br />
es nicht so einfach ist, jüngere Generationen<br />
mit unseren Ideen zu erreichen. Es<br />
gibt eine ganze Reihe von Initiativen, deren<br />
Erfolg aber sehr von den Personen abhängt,<br />
die mit den Kindern und Jugendlichen<br />
in Kontakt stehen. Ebenso ist es bei<br />
den Schulprojekten, die nur dort gut gelingen,<br />
wo das Engagement und Interesse<br />
von Direktoren oder Lehrpersonen entsprechend<br />
ist. Leider sind Lehrpersonen stark<br />
an Vorgaben gebunden und haben kaum<br />
die Möglichkeit, den Unterricht frei zu gestalten.<br />
Ich bin mir aber sicher, dass mit<br />
zunehmendem Alter auch das Interesse<br />
an Heimat steigt.<br />
„KF“: Die gute alte Heimatkunde wieder<br />
als Schulfach …?<br />
Gotzmann: Ich bin mir nicht sicher, ob das<br />
die Lösung ist. Kritische Stimmen sagen,<br />
dass es dann zur Pflicht würde, und wir<br />
wollen ja eigentlich die Begeisterung, das<br />
ehrliche Empfinden für den Wert der Heimat<br />
stärken. Vielleicht ist es sinnvoller, Angebote<br />
zu machen, die freiwillig sind und<br />
jungen Leuten Spaß machen.<br />
„KF“: Der BHU hat seine Haltung zum Begriff<br />
„Heimat“ auf seiner Internetseite veröffentlicht.<br />
Wie reagieren Menschen, Organisationen,<br />
die Politik?<br />
Gotzmann: Es gibt eigentlich kaum offizielle<br />
Reaktionen. Was uns aber aufgefallen<br />
ist, dass sich junge Menschen, die sich bei<br />
uns auf eine Stellenausschreibung bewerben,<br />
im Internet über uns erkundigen und<br />
wissen wollen, was wir überhaupt machen,<br />
wofür wir stehen, ob wir womöglich rechtsgerichtet<br />
sind. Sie sind dann meist positiv<br />
überrascht, wenn sie den Inhalt des Positionspapiers<br />
lesen, weil sie merken, welch<br />
weltoffene und in die Zukunft gerichtete<br />
Haltung wir haben.<br />
KulturFenster 47<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
verwurzelt<br />
Emotional, sozial, persönlich<br />
Auszüge aus der Positionsbestimmung des BHU in Deutschland<br />
➤ Heimat entsteht aus emotionalen Bindungen<br />
und sozialer Vernetzung in einem<br />
persönlichen Handlungs- und Verantwortungsraum.<br />
➤ Heimat bedeutet Verortung, die materiell<br />
und räumlich, virtuell oder in anderen<br />
Formen ausgebildet ist. Ankerpunkte<br />
für Heimat können die Landschaft, die<br />
Stadt, das Dorf oder die Nachbarschaft<br />
sein, das Natur- und Kulturerbe, aber<br />
auch Arbeit und Gemeinschaft, geteilte<br />
Überzeugungen, gemeinsame Interessen<br />
und vielfältige Weisen des realen<br />
und virtuellen Austausches von Menschen.<br />
Heimat ist dynamisch, weil es<br />
im Leben der Menschen viele Ankerpunkte<br />
geben kann.<br />
➤ Wenn Menschen sich verankert und<br />
gestärkt fühlen, empfinden sie ihr Lebensumfeld<br />
als Heimat, denn Heimat<br />
betrifft den Menschen als soziales Wesen.<br />
Als persönlicher Verantwortungsraum<br />
umspannt Heimat Lokales und<br />
Globales. Geschichtsbewusstsein und<br />
die Suche nach Erklärungen dafür, warum<br />
die Dinge so – geworden – sind, wie<br />
sie heute sind, gehören zur Aneignung<br />
von Heimat. Freude am Mitwirken und<br />
Ideen für die Zukunft sind weitere wichtige<br />
Triebfedern, wenn es darum geht, individuelle<br />
und gesellschaftliche Lebensqualität<br />
zu erhalten und zu gestalten.<br />
➤ Heimat zu fi nden, ist auch ein Vernetzungsprozess,<br />
der den sozialen Zusammenhalt<br />
stärkt. Die Grundlage dafür ist<br />
die Kommunikation, eine entscheidende<br />
Voraussetzung ist die Möglichkeit der<br />
Teilhabe und der Teilnahme für alle.<br />
➤ Um Heimat zu pflegen und zu gestalten,<br />
braucht es das Engagement der<br />
Zivilgesellschaft, der Bürgerinnen und<br />
Bürger. Heimat-, Geschichts- und Bürgervereine<br />
sowie viele neu entstandene<br />
Formen von Engagement haben große<br />
Bedeutung für das soziale Leben, im<br />
ländlichen Raum ebenso wie in den<br />
Städten. Mit ihrer Arbeit tragen diese<br />
engagierten Menschen zur Stabilität der<br />
Gesellschaft bei, zum Beispiel in Zeiten<br />
neuer Ideale des Wirtschaftens und Zusammenlebens<br />
sowie im Spannungsfeld<br />
staatlicher Hoheit und privatisierender<br />
Partizipation ist ein wichtiges Schlagwort. „Das Recht auf Mitgestaltung der Heimat …<br />
soll allen Menschen zugestanden werden“, heißt es im Positionspapier. Foto: BHU<br />
Tendenzen. Das Recht auf Heimat ist<br />
ein Menschenrecht; auch das Recht auf<br />
Partizipation verstehen wir so.<br />
➤ … Heimat endet nicht an politischen<br />
Grenzen: So mobil die Menschen sind,<br />
so mobil ist auch Heimat geworden.<br />
Heute leben und agieren viele Menschen<br />
nacheinander an mehreren, oft<br />
weit voneinander entfernten Orten, die<br />
sie als Heimat bezeichnen. Sie haben<br />
also mehrere Heimaten. Eine wichtige<br />
Aufgabe unserer Zeit ist es, Menschen<br />
den Erwerb emotionaler Bindungen an<br />
weitere Heimaten zu ermöglichen. …<br />
Aus der Überzeugung, dass Heimat<br />
dynamisch ist und den Zusammenhalt<br />
im größeren Rahmen braucht, fordern<br />
wir, dass die europäische Zusammenarbeit<br />
nicht auf wirtschaftliche Zusammenhänge<br />
verengt wird, sondern die in<br />
Europa beheimateten Bürgerinnen und<br />
Bürger in den Mittelpunkt des Handelns<br />
stellt. Deswegen müssen die Menschen,<br />
ihre Gefühle und Bedürfnisse immer im<br />
Blick behalten werden.<br />
Um Heimat zu pflegen und zu gestalten, braucht es das Engagement der Zivilgesellschaft.<br />
Foto: E. Runer<br />
KulturFenster 48<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
informiert & reektiert<br />
Heimat und Jugend<br />
Das Jahresthema <strong>2022</strong> stellt die jungen Menschen in den Mittelpunkt<br />
Der Heimatpflegeverband<br />
Südtirol setzt im<br />
laufenden Jahr den Fokus<br />
seiner Arbeit auf die<br />
Jugend. Spannende Initiativen<br />
sind geplant.<br />
Junge Menschen sind sehr wohl zu begeistern<br />
und für wichtige Themen zu<br />
bewegen.<br />
Foto: Pixabay<br />
Die Tätigkeiten des Heimatpflegeverbandes<br />
sind<br />
sehr breit gefächert, geht<br />
es doch um die Kulturund<br />
Naturlandschaft in<br />
Südtirol. Deshalb hat der<br />
HPV auch die Fokussierung<br />
auf ein Jahresthema<br />
in sein Programm aufgenommen.<br />
2021 lautete<br />
das Schwerpunktthema<br />
„Baukultur“, das mit Tagungen,<br />
Info-Veranstaltungen,<br />
Ortsbegehungen<br />
und Medienberichten behandelt<br />
wurde.<br />
<strong>2022</strong> soll im Zeichen der<br />
Jugend stehen: Die Kinder<br />
und Jugendlichen von heute sind die Erwachsenen<br />
und Entscheidungsträger*innen<br />
von morgen. Deshalb erscheint es uns<br />
wichtig, sie so früh wie möglich für viele<br />
gesellschafts- und kulturrelevante Themen<br />
zu sensibilisieren. Es bietet sich hier eine<br />
große Auswahl an Themen an, die wir als<br />
Heimatpfleger*innen auch behandeln.<br />
Über das Kennenlernen unserer Heimat<br />
wird die Wertschätzung und in der Folge<br />
im besten Fall der persönliche Einsatz für<br />
Natur und Kultur angestoßen.<br />
Schule als Partnerstruktur<br />
An welcher Stelle kann man bei Kindern<br />
und Jugendlichen ansetzen? Neben der<br />
Familie ist es vor allem die Schule, in der<br />
man junge Menschen erreichen und aktivieren<br />
kann. In Zusammenarbeit und Absprache<br />
mit erfahrenen Pädagog*innen, mit<br />
dem Katholischen Südtiroler Lehrerbund<br />
(KSL) und der Pädagogischen Abteilung<br />
des Landes Südtirol gab es bereits Vorgespräche,<br />
um zu eruieren, welche Themen<br />
und Methoden sich am besten eignen, um<br />
junge Menschen zu sensibilisieren, welche<br />
Partner*innen man hierzu braucht und für<br />
welche Themen die Erarbeitung von didaktischem<br />
Material notwendig ist.<br />
„<br />
Die Kinder und Jugendlichen von<br />
heute sind die Erwachsenen und<br />
Entscheidungsträger*innen von<br />
morgen. Deshalb erscheint es uns<br />
wichtig, sie so früh wie möglich für<br />
„<br />
viele gesellschafts- und kulturrelevante<br />
Themen zu sensibilisieren.<br />
Claudia Plaikner<br />
Da junge Menschen täglich sehr viel Zeit<br />
in der virtuellen Welt (Smartphone, Computer<br />
…) verbringen, erscheint es sinnvoll,<br />
sie wieder vermehrt zu einer bewussten,<br />
„realen“ Wahrnehmung ihres Lebensumfeldes<br />
zu bewegen, um „mit Kopf, Herz<br />
und Hand“ (Johann Pestalozzi) über das<br />
kognitive Wissen, die emotionale Beteiligung<br />
und die konkrete Aktivität möglichst<br />
ganzheitlich der Welt zu begegnen und<br />
sie mitzugestalten.<br />
Geplante Projekte<br />
Der Heimatpflegeverband möchte u. a.<br />
das Projekt „Erkunde den Ort, an dem<br />
du lebst“ angehen, einen „Heimatkoffer“<br />
bzw. eine „Heimatmappe“ in Zusammenarbeit<br />
mit pädagogisch-didaktischen<br />
Fachleuten erarbeiten sowie im Rahmen<br />
des fächerübergreifenden Lernbereichs<br />
„Gesellschaftliche Bildung“ – zu dem u.<br />
a. Kulturbewusstsein und Nachhaltigkeit<br />
gehören – in den Schulen Angebote an<br />
Lehrpersonen und Schüler*innen in den<br />
genannten Bereichen machen.<br />
Junge Menschen sind sehr wohl zu bewegen<br />
und zu begeistern – man denke an die<br />
Bewegung „Fridays for Future“. Wir möchten<br />
sie darin unterstützen, durch die Aneignung<br />
von Kenntnissen und durch die<br />
Auseinandersetzung mit den Entwicklungen<br />
in unserem Land verantwortungsbewusste<br />
Gestalter*innen ihrer Heimat zu werden.<br />
Claudia Plaikner<br />
KulturFenster 49<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
informiert & reektiert<br />
Der Rucksack<br />
Mit dem Leinen- oder Lederrucksack auf<br />
den Markt – früher war das ein alltägliches<br />
Bild.<br />
Dinge des Alltags<br />
aus Geschichte und<br />
Gegenwart<br />
Ein Rucksack gehört heute zum Alltag<br />
und zur Freizeit vieler Menschen dazu.<br />
Bereits die Kleinsten gehen mit einem<br />
Säckchen auf dem Rücken in den Kindergarten.<br />
Schulkinder verstauen in ihrem<br />
Rucksack Bücher und Hefte, Erwachsene<br />
nutzen ihn für den Transport<br />
von Laptop und anderen Geräten. Paketzusteller,<br />
die in den Städten durch die<br />
Straßen und Gassen fl itzen, verwenden<br />
ihn sowieso. Aus den Freizeitaktivitäten<br />
ist der Rucksack erst recht nicht mehr<br />
wegzudenken. Er hat es zum Universaltransportmittel<br />
geschafft.<br />
Während gegenwärtig ständig neue Modelle<br />
und gerade für Sport- und Freizeitzwecke<br />
immer leichtere Materialien auf<br />
den Markt kommen, waren Rucksäcke ursprünglich<br />
aus Leder oder starkem Leinen<br />
gemacht. Neben dem großen Beutel hatten<br />
sie zum Teil auch Außenfächer mit Riemen<br />
und Schnallen.<br />
Wann und wo der Rucksack entstanden<br />
ist, ist nicht bekannt. Im Reclam-Kostümlexikon<br />
wird er als „beutelförmige Tasche<br />
mit zwei Gurten“ beschrieben. Zur Verwendung<br />
steht Folgendes: „Bereits seit der<br />
Bronzezeit, u. a. zum Transport von Salz aus<br />
Bergwerken, erhielt er sich besonders bei<br />
Jägern und Wanderern“. Die Liste der einstigen<br />
Träger*innen ließe sich stark erweitern.<br />
So waren Rucksäcke fester Bestandteil<br />
der Ausrüstung von Soldaten. Auch Bauern,<br />
die auf einen Markt gingen, oder Handwerker<br />
auf der Stör trugen einen Rucksack<br />
auf dem Rücken.<br />
Neben diesen Funktionen als Tragegerät<br />
war ein Rucksack aber noch weit mehr.<br />
Der Inhalt des Sackes, gefüllt mit Wäsche<br />
und persönlichen Dingen, war oft alles, was<br />
ein Mensch besaß. So fand das Hab und<br />
Gut von Dienstboten, die an den Schlenggeltagen<br />
ihren Arbeitsplatz wechselten, im<br />
Rucksack Platz. Im Vintschger Museum in<br />
Schluderns ist ein Exemplar aus Leinen ausgestellt,<br />
weil „ein Rucksack und ein Wanderstab“<br />
oft das Einzige waren, das Schwabenkinder<br />
bei sich hatten, als sie ihre Heimat<br />
verließen und sich auf den Weg machten.<br />
Im Etschtal und am Tschögglberg wurde für<br />
den Rucksack der Begriff „Schnurfer“ verwendet.<br />
Diese Bezeichnung mag vom Wort<br />
schnurfen (einziehen, schrumpfen) kommen.<br />
Barbara M. Stocker<br />
Rucksäcke trugen auch Frauen, die in<br />
der Stadt einkauften oder ihre Waren<br />
verkauften.<br />
Fotos: Erika Groth-Schmachtenberger,<br />
Archiv SVM/ Inv.-<strong>Nr</strong>. 241 und 5296.<br />
50<br />
KulturFenster 01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Heimatpege<br />
Immaterielles<br />
UNESCO-Weltkulturerbe als Ziel<br />
Waale im Obervinschgau auf nationaler Liste des immateriellen Kulturerbes<br />
Die Wiesenbewässerung auf der Malser<br />
Haide ist eine jahrhundertealte Kulturtechnik,<br />
die bis heute nichts von ihrer Effizienz<br />
und Faszination eingebüßt hat. Davon ist<br />
auch das Landwirtschaftsministerium in Rom<br />
überzeugt und hat die Praktik der traditionellen<br />
Bewässerung im Obervinschgau auf<br />
die nationale Liste für landwirtschaftliche<br />
Praktiken und traditionelles Wissen gesetzt.<br />
Knapp 400 Hektar werden auf der Malser<br />
Haide noch traditionell über Waale bewässert,<br />
indem sie nach einem streng geregelten<br />
Zeitplan, der sogenannten „Road“, in<br />
regelmäßigen Abständen überflutet werden.<br />
„Die Kulturtechnik der Überflutung<br />
hat keinen musealen Charakter, sondern<br />
ist eine effiziente Technik, die heute nach<br />
wie vor so angewandt wird wie vor Hunderten<br />
von Jahren“, erklärt Verbandsobfrau<br />
Claudia Plaikner. „Aus diesem Grund<br />
sind wir der Meinung, dass sie auch eine<br />
Zukunft haben sollte.“<br />
Auf Bedeutung der Waale<br />
aufmerksam machen<br />
Der Heimatpflegeverband arbeitet zusammen<br />
mit der Bauernbund-Ortsgruppe Burgeis,<br />
der Gemeinde Mals, dem Heimatpflegeverein<br />
Mals und dem Wirtschaftsdienstleister<br />
IDM daran, die traditionelle Bewässerung im<br />
Obervinschgau über Waale zum internationalen<br />
immateriellen Weltkulturerbe zu machen.<br />
Damit soll der Öffentlichkeit der Wert<br />
und die Bedeutung dieser Kulturtechnik vor<br />
Augen geführt werden, aber auch welcher<br />
Aufwand damit verbunden ist. Gleichzeitig<br />
wären damit auch neue Projekte und Fördermittel<br />
zugänglich, um die traditionelle<br />
Bewässerung attraktiv zu halten.<br />
Nun wurde mit der positiven Bewertung des<br />
Ansuchens und der Aufnahme in das nationale<br />
Register eine erste wichtige Etappe<br />
erreicht.<br />
Nächster Schritt: Aufnahme<br />
in die Welterbe-Liste<br />
Mehrere Interessensgruppen in Deutschland,<br />
der Schweiz, Belgien, Niederlande,<br />
Luxemburg und vor allem in Österreich stellen<br />
in Kürze ein gemeinsames Ansuchen<br />
für die Aufnahme der traditionellen Bewässerung<br />
über Kanäle in die internationale Liste<br />
des immateriellen Weltkulturerbes. Nun<br />
steht fest, dass auch Südtirol dabei ist. Die<br />
italienische UNESCO-Kommission hat Mitte<br />
Jänner <strong>2022</strong> der Teilnahme an der internationalen<br />
Bewerbung zugestimmt.<br />
HPV<br />
„<br />
Die Kulturtechnik der Überflutung<br />
hat keinen musealen Charakter, sondern<br />
ist eine effiziente Technik, die<br />
„<br />
heute nach wie vor so angewandt<br />
wird wie vor Hunderten von Jahren.<br />
Claudia Plaikner<br />
Als immaterielles Weltkulturerbe<br />
könnten die Waale mehr Aufmerksamkeit<br />
erhalten.<br />
Die Kulturtechnik der Überflutung mit<br />
Hilfe von Waalen ist alt, aber dennoch<br />
modern und hocheffizient. Fotos: HPV<br />
KulturFenster 51<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
informiert & reektiert<br />
Die Kornelkirsche (Cornus mas)<br />
Natur-, Kultur- und Namensgeschichte eines besonderen Strauches<br />
„A blianete Granellschtaud hinter der Kirch“ in Vilpian<br />
Nach den kalten Wintertagen läuten die<br />
Blüten der Kornelkirsche in vielen Teilen<br />
Südtirols den Frühling ein. Grund genug,<br />
um die Kornelkirsche vorzustellen.<br />
Die Kornelkirsche (auch Gelber Hartriegel)<br />
gehört zur Familie der Hartriegelgewächse.<br />
Mit seinen schwefelgelben, vor<br />
dem Laub erscheinenden Blüten, läutet<br />
der Strauch Ende, mitunter sogar Mitte<br />
März bis Anfang April den Frühling auf<br />
unseren Mittelgebirgsterrassen ein.<br />
Das Hauptverbreitungsgebiet der Kornelkirsche<br />
erstreckt sich von Ostösterreich<br />
über den gesamten Balkan bis nach<br />
Kleinasien, den Kaukausus und die Krim,<br />
sie kommt aber auch in Italien und Frankreich<br />
vor. Die Nordgrenze bildet Mitteldeutschland.<br />
Der anspruchslose Strauch<br />
liebt sonnige Hänge, Waldränder, ist kalkhold<br />
und wird bis zu 100 Jahre alt. Einzelexemplare<br />
erreichen mitunter ein Alter von<br />
250 Jahren. Das größte bekannte Exemplar<br />
ist die „Sigrid-Dirndl“ in Michelbach<br />
(Niederösterreich) mit einem Stammumfang<br />
von 1,8 Metern.<br />
Woher die<br />
Bezeichnung kommt<br />
Der Name Kornelkirsche ist eine Entlehnung<br />
aus dem lateinischen cornus<br />
„Hartriegel“ (hart wie ein „Horn“), woraus<br />
sich die Diminutivform cornolium entwickelte,<br />
Ausgangspunkt für das im 11. Jh.<br />
belegte althochdeutsche churniboum bzw.<br />
chuirnilboum. In den verschiedenen Tiroler<br />
Mundarten wird der Strauch mit den<br />
schmackhaften roten Früchten durchwegs<br />
Granellschtaud, Garnelln, Grinelln<br />
oder Ganelln genannt. In Bayern, Salzburg,<br />
Kärnten, der Steiermark und Böhmen<br />
kennt man ihn als Dirnbaum oder Diandl;<br />
in Süd- und Mitteldeutschland wird<br />
er Dirlitz, Horlitze bzw. Herlitze genannt.<br />
Orts- und Flurnamen<br />
Von der mundartlichen Form Granell leiten<br />
sich zahlreiche Flurnamen ab, wie<br />
z’Garnella in Stilfs, Garnelln in Kaltern,<br />
Garnell in Latzfons oder der Garnellbühl<br />
in St. Oswald/Kastelruth. Im milden Westen<br />
und Süden Südtirols stößt man häufig<br />
auf den Hof- und Geländenamen Karnol<br />
(Goldrain, Naturns, Grissian, Andrian,<br />
Aldein, St. Andrä), der mundartlich oft zu<br />
KulturFenster 52<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Heimatpege<br />
Ginoal verschliffen wurde. Karnol ist eine<br />
Entlehnung aus dem Alpenromanischen<br />
*kornj la (area) „Gelände mit Kornelkirschenbewuchs“.<br />
Es gibt noch weitere Namen,<br />
in denen die Kornelkirsche steckt:<br />
Kornell in Siebeneich, Karnod in Völs und<br />
der Ort Karneid. Letzterer könnte auf ein<br />
romanisches Mengensuffix *cornēdu<br />
„Kornelkirschen-Bestand“ zurückgehen.<br />
Ein Eisenholz<br />
Die häufigen Flur-, Hof- und Ortsnamen<br />
setzen voraus, dass die Kornelkirsche früher<br />
häufig angepflanzt wurde – aus einem<br />
ganz bestimmten Grund: Es handelt sich<br />
um das härteste in Europa vorkommende<br />
Holz, das zu den sogenannten Eisenhölzern<br />
zählt. Ein Schlag auf den Stamm<br />
dieses Strauches genügt. Erstaunlich ist<br />
auch, dass das dichte Holz im Wasser<br />
nicht schwimmt.<br />
Das „Eisenholz“ ist technologiegeschichtlich<br />
bedeutsam. Es wurde dort eingesetzt,<br />
wo man beanspruchte Holzteile brauchte,<br />
also für die Herstellung von Messergriffen,<br />
Hammerschäften, Zahnrädern in Mühlwerken,<br />
Klüpfeln in der Bildhauerei, hölzerne<br />
Schusternägel, Kämme oder mathematische<br />
Instrumente. Vor allem aber<br />
benötigten Drechsler und Rädermachern<br />
das harte Holz zur Herstellung der Radspeichen.<br />
Feste Spazierstöcke wurden<br />
und werden nach wie vor aus „Granellenholz“<br />
geschnitzt.<br />
Ein Strauch für harte<br />
Männer...<br />
Einen abgehärteten Mann nennt man in<br />
Kastelruth und Völs heute noch einen<br />
„Granellenen“, die lateinische Artkennzeichnung<br />
„mas“ bedeutet „männlich“<br />
im Sinne von „hart, beständig“.<br />
Aus der Geschichte weiß man, dass die<br />
Wurfspeere der Antike, wie die sechs Meter<br />
hohen Lanzen der mazedonischen Phalanx,<br />
vorzugsweise aus dem Holz der Kornelkirsche<br />
bestanden. „Er schwang die<br />
mit Erz vorblinkende Last der Kornelle“,<br />
dichtet Ovid in den Metamorphosen und<br />
umschreibt metaphernreich den Speer.<br />
Der Dichter Pausanias überliefert, dass<br />
das Trojanische Pferd aus Granellenholz<br />
gezimmert war, um die menschliche Last<br />
in seinem Inneren zu tragen. Dass der<br />
Bogen des Odysseus aus dem Holz der<br />
Kornelkirsche bestand, versteht sich von<br />
selbst. Selbst seine in Schweine verzauberten<br />
Gefährten wurden mit Eicheln,<br />
Bucheckern und Granellen gemästet.<br />
Auf dem römischen Palatin stand der<br />
Überlieferung nach ein uralter Kornelkirschenbaum,<br />
der wieder austrieb, als<br />
Romulus und Remus ihre „kornellene“<br />
Lanze als Grenze in den Boden stießen.<br />
Früchte und Destillate<br />
Die in überreifem Zustand wohlschmeckenden<br />
Früchte werden Anfang September<br />
geerntet und zu Marmeladen, Kompotten<br />
und Fruchtsäften verarbeitet. In<br />
Albanien und in der Türkei wird daraus das<br />
Erfrischungsgetränk „Scherbet“ hergestellt.<br />
Am Balkan sind die Früchte im Herbst allgegenwärtig<br />
und bis heute ein Grundnahrungsmittel<br />
geblieben. Eine Spezialität ist in<br />
Niederösterreich der Dirndlbrand – ideal,<br />
um auf den Frühling anzustoßen.<br />
Johannes Ortner<br />
Schneaglögglen<br />
Ban Mühlbachl untn,<br />
die Schneaglögglen, die zortn,<br />
kennens foscht nimmr drwortn.<br />
Tians Köpfl gonz gwundrig zan Himml reckn;<br />
dr Winter isch long gnua gwesn,<br />
wou sie sich hom gmiaßt vrsteckn<br />
und iatz tuat sie der erschte worme Sunnenstrohl weckn.<br />
Olt und jung, olle hom drmit a Freid,<br />
wenns draußn wiedr griant und treib,<br />
dr Langes isch nimmer weit!<br />
Maria Sulzer<br />
KulturFenster 53<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
informiert & reektiert<br />
Quadra, Fascha und Gebreite<br />
Serie: Flurnamen aus der Agrargeschichte (6)<br />
Fascha<br />
Im „KulturFenster“ <strong>Nr</strong>. 06/2021 wurde<br />
das weite Themenfeld der Rodungsnamen<br />
abgeschlossen. In dieser und in den folgenden<br />
Ausgaben werden nun historische<br />
Flurnamen in Bezug auf Acker- und Feldbau<br />
vorgestellt.<br />
Quadra<br />
Fascha, Matsch;<br />
Franziszeischer Kataster 1855–1861<br />
Bei Quadres in Mals ist der<br />
quaderartige Flurblock (bestehend<br />
aus 8 Grundparzellen)<br />
noch gut zu erkennen.<br />
Franziszeischer Kataster 1855–1861<br />
Die Gebreite (mda. Gipraate)<br />
in Oberolang<br />
Franziszeischer Kataster 1855–1861<br />
Im Obervinschgau, im Tiroler Oberland<br />
und in Graubünden stößt man immer wieder<br />
auf den Flurnamentyp „Quadra“. Ein<br />
Beispiel: die Groß- und Klein-Quadra in<br />
Burgeis. Goswin von Marienberg erwähnt<br />
im Urbar von 1394 allein für Burgeis eine<br />
Quadraprada, eine Quadra de cruce und<br />
eine Quadra abbatisse). Jeweils eine Quadra<br />
ist in Schleis, Prämajur, Taufers i. M.<br />
und in Glurns zu verzeichnen, auffälligerweise<br />
jeweils bei den frühmittelalterlichen<br />
Eigenkirchen St. Jakob in Söles sowie St.<br />
Lorenz. Weitere Beispiele: Quadres in Mals<br />
und in Matsch, jeweils eine Quadrella in<br />
Taufers i. M. und in Laatsch. Ableitungen<br />
zu Quadra kennt auch das bereits früher<br />
eingedeutschte Burggrafenamt: Quadrat<br />
(mda. Ggo-drëgg) bei Partschins und vermutlich<br />
auch Gratsch bei Meran, das sich<br />
von alpenromanisch *quadratšja ableiten<br />
könnte. Im Puster-, Wipp- und Eisacktal<br />
ist „Quadra“ unbekannt.<br />
Der Begriff „Quadra“ ist lateinisch und bedeutet<br />
in etwa „Flurblock, ausgemessener<br />
Flurteil“. Bei den Quadra-Fluren handelt<br />
es sich um die Altackerareale einer Gemeinde<br />
von ausgezeichneter Bodenqualität.<br />
Diese Gunstlagen des Getreidebaus<br />
wurden im Theresianische Kataster dann<br />
auch relativ hoch besteuert.<br />
Der ungeteilte Quadra-Block wurde ursprünglich<br />
gemeinschaftlich bebaut. Erst<br />
in der Folge wurde er in Streifen parzelliert,<br />
ähnlich wie die Gewanne in Mitteldeutschland<br />
im Rahmen der Dreifelderwirtschaft.<br />
Lange und schmale Ackerparzellen waren<br />
beim Pflügen erwünscht, gerade in<br />
alpiner Hanglage. Dies hatte den Vorteil,<br />
den Pflug samt Zugtieren an den Ackerrändern<br />
selten wenden zu müssen.<br />
Im romanischen Vinschgau wurden die<br />
Ackerzeilen „Fascha“, „Faschen“ oder<br />
„Pfasch“ genannt, zu romanisch *faša<br />
„Binde, Streifen“. Auffallend ist, dass sich<br />
die „Faschen“ manchmal genau neben<br />
einer Quadra befinden... A Långs und a<br />
Geproats könnte man in Abwandlung einer<br />
bekannten Tiroler Redensart fast sagen...<br />
In Taufers im Münstertal, Schlinig (hier<br />
als Verkleinerung „Faschetta“), Schleis,<br />
Laatsch (1419 Fäsch, 1669 in Fäsches),<br />
Matsch und Prämajur gibt es jeweils Fluren<br />
dieses Namens. „Pfaschen“ fi nden sich<br />
vinschgauabwärts in Prad, Tschengls,<br />
Morter, Tschars und Tabland.<br />
Gebreite<br />
Im kaum romanisch unterschichteten Südtirol<br />
gibt es eine genaue Entsprechung zu<br />
den rätoromanischen Quadrafluren, nämlich<br />
die „Gebreite“ bzw. „Gebreitige“ (mda.<br />
Geproaten, Proatn). Im langobardisch geprägten<br />
Oberitalien gibt es den entsprechenden<br />
Flurnamen „Braida“.<br />
Gebreiten sind – wie der Name schon aussagt<br />
– „breite“ Flurkomplexe mit gutem<br />
Heu- und Kornertrag. Ganz ähnlich wie<br />
bei der Quadra hat jede Gemeinde immer<br />
nur eine auf diese Weise benannte Flur.<br />
Beispiele quer durch Südtirol: Es gibt jeweils<br />
eine Gebreite in Riffian, Gratsch, Schenna,<br />
Völlan, Nals, Latzfons, Feldthurns, Pinzagen,<br />
St. Andrä, Karnol (Hofname Gebreitner,<br />
der bereits 1268–1280 als Gepraite<br />
belegt ist), Valgenäun, Stilfes, Lüsen, Rodeneck,<br />
Terenten, Pfalzen, Montal, Gais<br />
(hier „Giproatige“), Stefansdorf, Reischach,<br />
Olang, Antholz und in Niederdorf.<br />
Johannes Ortner<br />
KulturFenster 54<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
hinausgeblickt<br />
Heimatpege<br />
Säulenbildstock beim<br />
Burgerhof renoviert<br />
Heimatschutzverein kümmert sich um Erhaltung<br />
Am 16. August 2021 zog ein heftiges Gewitter<br />
mit Sturm über Lana hinweg. Dabei wurde<br />
der 1930 errichtete neugotische Säulenbildstock<br />
beim Burgerhof am alten Braunsberger<br />
Weg am Frigeleberg umgeworfen und zerbrach<br />
in mehrere Teile.<br />
Beim Lokalaugenschein von Simon Terzer<br />
und Albert Innerhofer vom Heimatschutzverein<br />
Lana mit Regina Verdorfer und Peter<br />
Holzner vom Burgerhof wurde vereinbart,<br />
diesen Bildstock wieder herzurichten<br />
und aufzubauen. Dabei sollten vor allem die<br />
wertvollen Fresken vom Maler und Restaurator<br />
Cassian Dapoz (1874–1946) erhalten<br />
und zudem renoviert werden. Mit Hilfe von<br />
Architektin Annemarie Mitterhofer, die hierfür<br />
auch alle bürokratischen Arbeiten für<br />
das Bauamt erledigte, gelang es, eine Baufirma<br />
zu finden, die wichtige Arbeiten ausführte.<br />
Die Lananer Firma Carlucci rückte<br />
mit einem Kranauto an, um die Teile des<br />
zerstörten Bildstocks zu bergen und in die<br />
Werkstatt zu bringen.<br />
Aufwändige Arbeiten …<br />
Die Gebrüder Michele und Marco Carlucci<br />
begannen nun, den unteren, total zerstörten<br />
Säulenschaft neu in Beton zu gießen. Der<br />
gesamte Säulenbildstock wurde statisch<br />
wiederum vollständig hergestellt. Der wertvollste<br />
obere Teil mit den Fresken wurde aufgesetzt<br />
und am Schaft integriert. Auch das<br />
mit Mönch-und-Nonne-Ziegeln eingedeckte<br />
Zeltdach musste neu errichtet werden.<br />
Restaurator Hubert Mayr aus Percha reinigte<br />
anschließend die drei in Secco-Malerei<br />
ausgeführten Bilder Christus auf dem<br />
Thron (Herz Jesu), Maria und der hl. Josef.<br />
Die Malschicht wurde gefestigt, die Untergründe<br />
wurden demineralisiert und die<br />
neuen Zementteile geätzt. Die schadhaften<br />
und fehlenden Stellen wurden ergänzt, die<br />
roten Umrahmungen an den Kanten erneuert.<br />
Ein rechteckiges Feld zeigt an der<br />
Säule eine Totenbahre, die ebenfalls erneuert<br />
wurde. Dies ist ein Hinweis auf die dortige<br />
ehemalige Totenrast.<br />
… und aufwändiger Transport<br />
Nun transportierte die Firma Gufler Baustoff<br />
aus Burgstall den erneuerten Säulenbildstock<br />
in die Ultner Straße und stellte diesen<br />
noch rechtzeitig vor dem Wintereinbruch<br />
Ende November mittels eines großen Krans<br />
dort auf, wo zuvor ein neues Fundament<br />
gegossen worden war. Dank gebührt dabei<br />
der Firma Gufler für die unentgeltliche Bereitstellung<br />
des Kranautos mit Fahrer. Der<br />
Dachaufsatz mit Kugel und Kreuz wurde<br />
noch vom Spengler Günther Husnelder<br />
aus Lana erneuert und ergänzt. Die Kosten<br />
für die Erneuerung dieses Säulenbildstocks<br />
übernahmen die Familie vom Burgerhof<br />
sowie der Heimatschutzverein Lana.<br />
Dazu kamen ein Erlös aus dem Frigeleberg-<br />
Fest sowie eine Spende von Veronika und<br />
Hannes Herz. Am Dreikönigstag bedankten<br />
sich Regina Verdorfer und Peter Holzner<br />
bei einem Umtrunk bei den Sponsoren<br />
und den Nachbarn.<br />
Albert Innerhofer<br />
Der zerstörte …<br />
… und nun wieder erneuerte Säulenbildstock<br />
beim Burgerhof Fotos: Simon Terzer, Albert Innerhofer<br />
KulturFenster 55<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
hinausgeblickt<br />
Heimatforscher<br />
Blasius Marsoner<br />
Gedenkschrift vorgestellt<br />
Blasius Marsoner (1924 –1991)<br />
Zum 30. Todestag des Heimatforschers, Lyrikers<br />
und Essayisten Blasius Marsoner aus<br />
St. Pankraz wurde am 24. September 2021<br />
im Kultursaal von St. Pankraz eine Gedenkschrift<br />
vorgestellt. Herausgegeben wurde<br />
das Werk vom Verein für Kultur und Heimatpflege<br />
St. Pankraz in Zusammenarbeit<br />
mit dem Südtiroler Künstlerbund.<br />
Diese Gedenkschrift ist ein Versuch, Marsoners<br />
Leben und Werk zwischen zwei Buchdeckeln<br />
festzuhalten und seine literarischen<br />
Leistungen zu würdigen. Im Rahmen einer<br />
schlichten Feier mit musikalischer Begleitung<br />
wurde zunächst in kurzen Streiflichtern<br />
anhand von Bildern das schicksalhafte<br />
Leben Marsoners aufgezeigt.<br />
Fast 20 Jahre hat Blasisus Marsoner der<br />
Übersetzung der „Divina Commedia“ von<br />
Dante Alighieri gewidmet.<br />
Fast 20 Jahre hat Marsoner der Übersetzung<br />
der „Divina Commedia“ von Dante<br />
Alighieri gewidmet, einem der bedeutendsten<br />
Werke der Weltliteratur. Marsoner hatte<br />
ein ausgezeichnetes Sprachgefühl. Neben<br />
dieser Übersetzung ins Deutsche hat<br />
Marsoner auch mehrere „Gedichte“, eine<br />
„Geschichte des Ultentales“ und eine 200<br />
Seiten umfassende Abhandlung „Meine<br />
Weltanschauung“ verfasst.<br />
Besonders am Herzen lag Marsoner die Erhaltung<br />
echter Werte in seinem Heimattal.<br />
Er hat oft den moralischen Zeigefinger erhoben,<br />
wurde aber vielfach nur belächelt.<br />
Darunter hat er sehr gelitten.<br />
Ferruccio Delle Cave, ein Kenner der<br />
Südtiroler Literaturlandschaft, hob bei<br />
der Feier Marsoners literarische Leistungen<br />
hervor und zeigte die Besonderheiten<br />
dieser einmaligen Übersetzung<br />
der „Divina Commedia“ auf. Es ist die<br />
einzige deutsche Übersetzung im gesamten<br />
Alpenraum.<br />
In der öffentlichen Bibliothek St. Pankraz<br />
können sämtliche Texte Marsoners in kopierter<br />
Form eingesehen werden. Die Gedenkschrift<br />
ist in der Bibliothek kostenlos<br />
erhältlich.<br />
Luis Egger<br />
Verein für Heimatpflege St. Pankraz<br />
KulturFenster 56<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
Heimatpege<br />
Kapelle und Gasthaus<br />
mit Geschichte<br />
Beispiele für gelungene Renovierungen beim Tag des offenen Denkmals<br />
Im Zeichen zweier vor kurzem sanierter und<br />
renovierter Objekte am Gries in Oberlana stand<br />
der 18. Tag des offenen Denkmals. Der Heimatschutzverein<br />
und der Bildungsausschuss<br />
Lana hatten zur Besichtigung von Gasthaus<br />
und Kapelle in der Metzgergasse sowie zur<br />
Segnung der letzteren eingeladen.<br />
Der Tag des offenen Denkmals war von einer<br />
ehrenamtlichen Arbeitsgruppe vorbereitet<br />
worden, die fast drei Jahre daraufhin gearbeitet<br />
hatte. Coronabedingt hatte die Veranstaltung<br />
2020 nicht abgehalten werden können.<br />
Umso erfreulicher war es daher, als am<br />
25. September 2021 Albert Innerhofer, Obmann<br />
des Heimatschutzvereines, zahlreiche<br />
Gäste begrüßen konnte. Er umriss die seit<br />
2004 andauernden Bemühungen des Vereines,<br />
die Wiesmair-Kapelle, die seit 1990<br />
eine Denkmalschutzbindung aufweist, zu<br />
restaurieren. Mit einem Eigentümerwechsel<br />
vor wenigen Jahren konnte das Vorhaben<br />
umgesetzt werden. Unter Aufsicht des<br />
Denkmalamtes erfolgten Innen- und Außenrestaurierung,<br />
wobei u. a. die barocke Fassung<br />
mit Architekturmalerei und ein qualitätsvolles<br />
Fresko des hl. Antonius von Padova<br />
zum Vorschein kamen (einen ausführlichen<br />
Bericht dazu gibt es im „KulturFenster“ <strong>Nr</strong>.<br />
3/2020). Albert Innerhofer dankte allen, die<br />
zur Aufwertung dieses Kulturdenkmales beigetragen<br />
hatten.<br />
Authentische Gastround<br />
Hotelkultur<br />
Die Wiesmair-Kapelle wurde von Diakon Hubert Knoll gesegnet.<br />
Nach der Segnung der Kapelle durch Diakon<br />
Hubert Knoll luden Martina und Andreas<br />
Heinisch, die Betreiber des Gasthauses<br />
„Reichhalter“, zu einem Umtrunk. Gertrud<br />
Margesin, Obfrau des Bildungsausschusses,<br />
sprach Begrüßungsworte, bevor Kapelle und<br />
Gasthaus mit Führungen den ganzen Tag<br />
über besichtigt werden konnten.<br />
Eva Gadner, Christoph Gufler und Simon<br />
Terzer erklärten den knapp 100 Interessierten<br />
nicht nur die Geschichte beider Objekte,<br />
sondern auch Wissenswertes zu den<br />
Renovierungen und Revitalisierungen. Besonders<br />
das Gasthaus „Reichhalter“ konnte<br />
nach langjähriger Führung durch die bekannte<br />
Wirtin Balbina Geiser Peintner und<br />
folgendem Eigentümerwechsel in ein inzwischen<br />
weltweit bekanntes Boutiquehotel<br />
unter Führung von Klaus Dissertori umgewandelt<br />
werden. Mit viel Gespür für eine<br />
authentische Gastro- und Hotelkultur haben<br />
Architekt Zeno Bampi und Einrichtungsarchitektin<br />
Christina Biasi von Berg das ortsbildprägende<br />
Gebäude wieder zu einem inte-<br />
Fotos: Patrick Schwienbacher<br />
ressanten Begegnungsort gemacht. Gerade<br />
an der Wiesmair-Kapelle und am Gasthaus<br />
„Reichhalter“ zeigte sich in bester Weise,<br />
was der Tag des offenen Denkmals schon<br />
seit der Begründung durch Altbürgermeister<br />
Christoph Gufler bezweckt, nämlich auf<br />
wertvolle Baudenkmäler aufmerksam zu<br />
machen und dadurch beispielgebend deren<br />
Erhaltung und Renovierung zu fördern.<br />
Simon Terzer<br />
Heimatschutzverein Lana<br />
Authentisch und ortsprägend:<br />
das Gasthaus<br />
„Reichhalter“ in<br />
Lana, hier beschrieben<br />
von Christoph<br />
Gufler.<br />
KulturFenster 57<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
hinausgeblickt<br />
Südtiroler Motive für hohe Kunst<br />
Buchtipp: Der Kunstmaler Oskar Mulley und seine Werke<br />
Oskar Mulley (1891–1949) war ein bekannter<br />
Kunstmaler mit interessantem Südtirol-<br />
Bezug. Sein Urenkel und Nachlassverwalter<br />
Herbert Ascherbauer hat nun ein Buch<br />
über Mulley herausgegeben.<br />
Oskar Mulley kam in Klagenfurt zur Welt.<br />
Schon in der Realschule war das Zeichnen<br />
und Malen seine große Leidenschaft.<br />
Nach Abschluss der Kunstakademie trat<br />
der akademische Maler seinen Präsenzdienst<br />
an. Ende 1914 erfolgte die Einberufung<br />
in den Krieg, der ihn 1916 an die<br />
Südwestfront nach Südtirol führte. Dort<br />
lernte er das Hochgebirge und die obersten<br />
Siedlungen der Bauern kennen. Seine<br />
Eindrücke hat er später in zahlreichen Bildern<br />
verarbeitet.<br />
Während des Ersten Weltkrieges erregte<br />
Mulley erstmals auch im Süden Tirols<br />
Aufmerksamkeit. Im Bozner Merkantilgebäude<br />
gab es eine „Galerie heimischer<br />
Kunst“. Dort war ein „äußerst gediegenes<br />
Gemälde von Schloß Runkelstein“ ausgestellt,<br />
das Ende Oktober 1917 mit einem<br />
Artikel in der „Bozner Zeitung“ sowie in der<br />
Zeitung „Der Tiroler“ (Innsbruck) gewürdigt<br />
wurde. Im gleichen Jahr 1917 heiratete<br />
Mulley Luise Staudacher aus Bruneck,<br />
die er an ihrem Arbeitsplatz in der Bozner<br />
Sparkasse kennengelernt hatte.<br />
Zu Kriegsende 1918 wurde Mulley zum<br />
Bei seiner Arbeit ließ sich der Künstler von der Südtiroler Landschaft inspirieren.<br />
Stationskommando nach Kufstein versetzt,<br />
wo er sich mit seiner Frau niederließ. Bald<br />
schon konnte er sich als Künstler etablieren<br />
und die materielle Existenz seiner Familie<br />
– er hatte zwei Töchter – sichern.<br />
„Egger Lienz der Landschaft“<br />
Ab 1920 waren Mulleys vom Wiener Secessionismus<br />
inspirierten Bilder in zahlreichen<br />
Ausstellungen zu sehen. 1925 entstanden<br />
die ersten Bilder hochalpiner Landschaften,<br />
bei denen die mit Pinsel und Spachtel<br />
dick aufgetragene Farbe geradezu in<br />
Materie des Dargestellten übergeht. Einige<br />
Mulley-Bilder wurden ausgezeichnet.<br />
Auch wurde der Maler in die Künstlervereinigung<br />
„Wiener Secession“ aufgenommen.<br />
Die Presse bezeichnete ihn mitunter<br />
als „Egger-Lienz der Landschaft“.<br />
Mit der 1933 vom Deutschen Reich gegen<br />
Österreich verhängten „1.000 Mark-<br />
Sperre“ war Mulley von seinen deutschen<br />
Kunsthändlern abgeschnitten. Schweren<br />
Herzens verließ er deshalb das ihm zur<br />
geliebten Heimat gewordene Land Tirol<br />
und übersiedelte nach Garmisch in Bayern.<br />
Dort widmete er sich fortan in feiner<br />
Pinselmalerei und kleineren Bildformaten<br />
Motiven des Alpenvorlandes.<br />
Oskar Mulley verstarb im Jänner 1949.<br />
Seine Bilder erzielen bis heute im Kunsthandel<br />
und bei Auktionen beachtliche<br />
Preise. Zwei Bilder sind in den Bergmuseen<br />
von Reinhold Messner in Bruneck<br />
und Bozen zu sehen.<br />
Unlängst erschien ein Buch über Oskar<br />
Mulley. Es ist über Buchhandlungen erhältlich<br />
bzw. bestellbar, kann aber auch<br />
per E-Mail (mulleybuch@gmail.com) um<br />
35 Euro erstanden werden. Weitere Infos<br />
dazu sind unter www.mulley.eu abrufbar.<br />
Oskar Mulley um 1930<br />
KulturFenster 58<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
getragen<br />
Leuchtend gelbe Immortellen<br />
Ein Hauch von Orient auf Tiroler Trachtenhut<br />
Sarner Trachtenhut mit Ewigkittar<br />
Foto: KUADRAT – aus: „Die Sarner Tracht“,<br />
Orientalische Strohblume<br />
Foto: Wikimedia<br />
Trocknen der Blütenstände<br />
Foto: Internet<br />
2011, S.103, Folio-Verlag<br />
Bei der Männertracht spielt der Hut eine<br />
wichtige Rolle. So ist es nicht verwunderlich,<br />
dass man seit jeher versucht, durch<br />
unterschiedlichstes Zierwerk den Blick ganz<br />
besonders auf ihn zu lenken. Von Bändern<br />
bis Kordeln, von Federn bis Flitterwerk, von<br />
Schnallen bis Quasten findet man so ziemlich<br />
alles, was einen Trachtenhut verschönern<br />
kann. Ein besonderer Hingucker ist<br />
dabei der Blumenschmuck, der sogar einen<br />
ganz einfachen Hut gebührend aufhübschen<br />
kann.<br />
Blumen am Hut<br />
Es ist bei uns Brauch, dass je nach Jahreszeit<br />
und Anlass eine frische Blume auf<br />
den Hut gesteckt wird. Naturblumen wie<br />
die klassische Brennende Liab oder eine<br />
rote Nelke mit etwas Geranienblatt, Asparagus<br />
oder auch Eichenlaub verleihen<br />
den Hüten erst ein festliches Aussehen.<br />
Je nach Gegend kommen noch andere<br />
Blumen zum Einsatz. Auch farblich ist so<br />
ziemlich alles mit dabei. Bei Beerdigungen<br />
allerdings wird auf Blumenschmuck verzichtet<br />
und nur ein Fichtenzweig, etwas<br />
Buchs oder Efeublatt am Hut getragen.<br />
Ewigkittar<br />
Mancherorts, wie zum Beispiel im Sarntal,<br />
fallen goldgelb leuchtende Trockenblumen-Sträußchen<br />
neben der roten Nelke<br />
am Hut auf. Kleine, halbkugelige gelbe<br />
Blüten ziehen unweigerlich die Blicke auf<br />
sich. Ewigkittar, Ewigkeitsbuschn, Ewigkeitln,<br />
Immortellen – alle Bezeichnungen<br />
drücken letztendlich dasselbe aus: Diese<br />
getrockneten Blümlein halten für immer,<br />
bleiben immer gleich schön leuchtend gelb.<br />
Orientalische Strohblume<br />
„Helichrysum orientale“ – so lautet der<br />
wissenschaftliche Name dieser Pflanze<br />
aus der Familie der Korbblütler. Die Orientalische<br />
Strohblume stammt ursprünglich<br />
aus dem warmen Süden und hat von der<br />
Westtürkei über die griechischen Inseln<br />
der Ägäis ihren Weg in den mediterranen<br />
Raum gefunden. Nässe liebt sie nicht. Am<br />
wohlsten fühlt sie sich in der Vegetationszone<br />
der Macchia. Interessant ist dabei die<br />
Tatsache, dass sie trotz allem auch bei uns<br />
an sonnigen, geschützten Stellen strenge<br />
Winter mit bis zu minus zwölf Grad überstehen<br />
kann. Wie sonst hätte sie wohl den<br />
Weg auf unsere Trachtenhüte geschafft?<br />
Trocknen der Blütenstände<br />
Der immergrüne Halbstrauch ist in Südtirol<br />
eher selten anzutreffen. Er wird bei<br />
uns auch nur 20 bis 30 Zentimeter hoch.<br />
Die mehrjährige Pflanze hat silbergraue,<br />
an der Unterseite behaarte, rosettenartige<br />
Blättchen. Die kleinen, doldenförmigen<br />
Blüten erscheinen von Ende Juli<br />
bis September an langen dünnen Stängeln.<br />
Die Blüten dürfen nicht zu weit, aber<br />
auch nicht zu wenig geöffnet sein, wenn<br />
sie geschnitten, gebündelt und kopfunter<br />
hängend im Schatten getrocknet werden.<br />
Nur dann nämlich behalten sie für immer<br />
ihre leuchtendgelbe Farbe.<br />
Agnes Andergassen<br />
Arge Lebendige Tracht<br />
KulturFenster 59<br />
01/<strong>Februar</strong> <strong>2022</strong>
09.04.<strong>2022</strong><br />
Termine<br />
72. Jahreshauptversammlung<br />
des Heimatpflegeverbandes Südtirol<br />
Ort: Bürgerhaus Tramin<br />
Infos unter:<br />
https://hpv.bz.it<br />
07.05.<strong>2022</strong><br />
NEUER TERMIN: 74. Vollversammlung<br />
mit Neuwahlen des VSM<br />
im Waltherhaus Bozen – Beginn: 14 Uhr<br />
Infos unter:<br />
https://vsm.bz.it<br />
21.05.<strong>2022</strong><br />
NEUER TERMIN: 73. Vollversammlung<br />
mit Neuwahlen des SCV<br />
im Vereinshaus Nals – Beginn: 15 Uhr<br />
Infos unter:<br />
https://scv.bz.it/vollversammlung