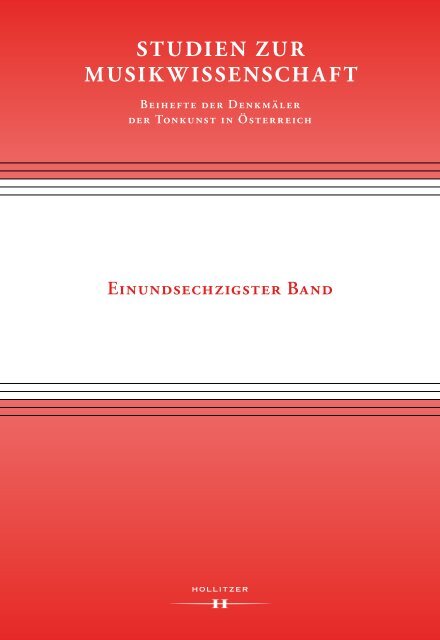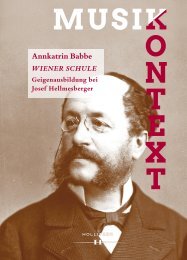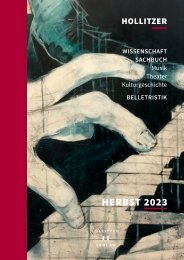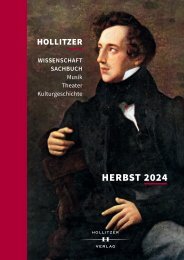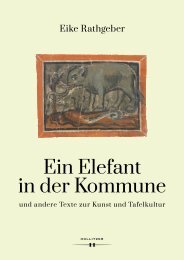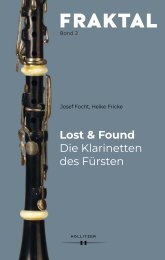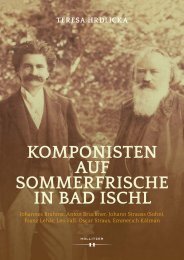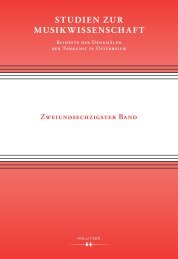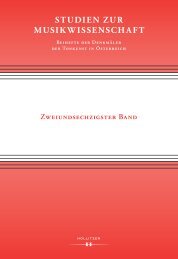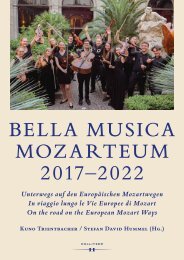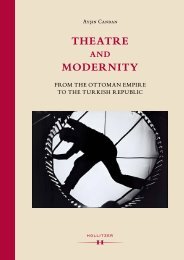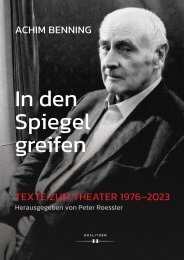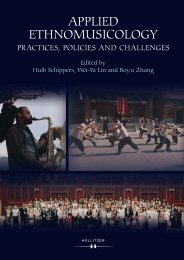Leseprobe_DTÖ Studien 61
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
STUDIEN ZUR MUSIKWISSENSCHAFT<br />
BAND <strong>61</strong>
STUDIEN ZUR<br />
MUSIKWISSENSCHAFT<br />
Beihefte der Denkmäler<br />
der Tonkunst in Österreich<br />
Unter Leitung<br />
von<br />
MARTIN EYBL<br />
und<br />
ELISABETH TH. HILSCHER<br />
im Auftrag der <strong>DTÖ</strong><br />
(Gesellschaft zur Herausgabe von Denkmälern der Tonkunst in Österreich)<br />
Einundsechzigster Band
Für den Inhalt der Abhandlungen sind die Verfasser verantwortlich.<br />
Die Wahl der Rechtschreibung (alte bzw. neue Rechtschreibung) wurde den Autoren überlassen.<br />
Die 1913 von Guido Adler gegründete Zeitschrift umfasst <strong>Studien</strong>,<br />
die in direktem Zusammenhang mit Bänden der <strong>DTÖ</strong> (Denkmäler der Tonkunst in Österreich)<br />
stehen, methodische Überlegungen zur musikalischen Philologie (Quellenkunde,<br />
Editionspraxis), Aufsätze zur Musikgeschichte Österreichs (in einem umfassenden Sinn)<br />
sowie Editionen entsprechender Textquellen (wie Tagebücher oder Korrespondenz).<br />
Founded in 1913 by Guido Adler this journal comprises studies directly connected with<br />
specific volumes of <strong>DTÖ</strong> (Denkmäler der Tonkunst in Österreich) as well as methodological<br />
considerations concerning musical bibliography (source study, editing), studies in the<br />
wider field of Austrian music history, “Austria” being defined by historical context, and editions<br />
of corresponding text sources (diaries, correspondence, etc.).<br />
Manuskripte sind bei den Herausgebern<br />
(E-Mail: elisabeth.hilscher@oeaw.ac.at oder eybl@mdw.ac.at)<br />
einzureichen und werden Begutachtungsverfahren nach internationalen Standards<br />
(peer review) unterzogen<br />
Abbildungen, Notenbeispiele etc. sind den Manuskripten druckfertig<br />
mit mindestens 300 dpi Auflösung gesondert als Grafikdatei beizugeben,<br />
die Rechte der Wiedergabe von den Autoren vorab zu klären.<br />
© HOLLITZER Verlag, Wien 2022<br />
www.hollitzer.at<br />
Umschlag und Satz: Gabriel Fischer<br />
Hergestellt in der EU<br />
Alle Rechte vorbehalten.<br />
Die Abbildungsrechte sind nach bestem Wissen und Gewissen geprüft worden.<br />
Im Falle noch offener, berechtigter Ansprüche wird um Mitteilung des Rechteinhabers ersucht.<br />
Für den Inhalt der Beiträge sind die Autorinnen bzw. Autoren verantwortlich.<br />
ISBN 978-3-99012-9<strong>61</strong>-6<br />
ISSN 0930-9578
INHALT<br />
Thomas Hochradner (Salzburg)<br />
Zur Überlieferung von Allegris Miserere nördlich der Alpen ………………… 7<br />
Claudio Bacciagaluppi (Basel)<br />
Ein unbekanntes Porträt von Carl Ditters von Dittersdorf? ………………… 33<br />
Birgit Lodes – Elisabeth Reisinger – John D. Wilson (Wien)<br />
Zwischen Wien, Bonn und Modena.<br />
Erzherzog Maximilian Franz und die kurkölnischen Musiksammlungen …… 41<br />
Stefanie Preisl (Klosterneuburg)<br />
Die Inventare des Musikarchivs im Stift Klosterneuburg …………………… 73
Thomas Hochradner (Salzburg)<br />
ZUR ÜBERLIEFERUNG VON ALLEGRIS MISERERE<br />
NÖRDLICH DER ALPEN<br />
Rückschlüsse aus den Quellen im heutigen Österreich<br />
I. EINE ANEKDOTE<br />
„Kayser Leopold [I., geb. 1640, Kaiser 1658–1705], welcher nicht nur ein Liebhaber<br />
und Gönner der Musik war, sondern auch selbst gut komponierte, befahl seinem<br />
Gesandten zu Rom, vom Pabste die Erlaubniß zu erbitten, daß er eine Abschrift<br />
von dem berühmten Miserere des Allegri zum Gebrauch der Kaiserlichen<br />
Kapelle zu Wien nehmen dürfte: als er diese Erlaubniß erhalten hatte; schrieb der<br />
päbstliche Kapellmeister es für ihn ab, und schickte es dem Kaiser zu, der damals<br />
einige von den größten Sängern seiner Zeit in Diensten hatte. Allein der Geschicklichkeit<br />
dieser Sänger ungeachtet, that diese Komposition der Erwartung des<br />
Kaisers und seines Hofes, als sie aufgeführt ward, so wenig Genüge, daß er den<br />
Schluß machte, der päbstliche Kapellmeister hätte ihn hintergangen, und, um seinen<br />
Schatz, als ein Geheimniß für sich zu behalten, eine Komposition unterschoben.<br />
Der Kaiser war darüber sehr aufgebracht, und schickte einen Kurier an Se.<br />
[Seine] Heiligkeit, sich über den Kapellmeister zu beschweren, der deswegen in<br />
Ungnade fiel, und sogleich abgesetzt ward. Der Pabst war durch den vorgeblichen<br />
Betrug seines Kapellmeisters so sehr beleidigt, daß er ihn lange Zeit hindurch<br />
weder sehen, noch seine Vertheidigung hören wollte; doch endlich übernahm es<br />
einer von den Kardinälen, Fürsprache für ihn zu thun, und sagte Se[r]. Heiligkeit,<br />
daß die in der päbstlichen Kapelle übliche Art zu singen, vornehmlich bey diesem<br />
Miserere so beschaffen wäre, daß sie nicht in Noten ausgedrückt werden, oder<br />
anders als durchs Exempel könne gelehrt, und an andern Orten eingeführt werden;<br />
weswegen diese Komposition, wäre sie auch noch so richtig abgeschrieben,<br />
ihrer Wirkung verfehlen müßte, sobald man sie anderswo aufführte. Se. Heiligkeit<br />
verstund keine Musik, und konnte gar nicht begreifen, wie die nehmlichen Noten<br />
an verschiedenen Orten so verschieden klingen könnten; indessen befahl er doch<br />
seinem Kapellmeister, eine schriftliche Vertheidigung einzugeben, welche nach<br />
Wien gesandt werden sollte: dies geschah […].“1<br />
1 Charles Burney, Tagebuch einer Musikalischen Reise durch Frankreich und Italien (Hamburg:<br />
Bode 1772). Faksimile-Nachdruck, hg. von Christoph Hust (Documenta Musicologica,<br />
Erste Reihe: Druckschriften-Faksimiles 19) Kassel u.a. 2003, S. 209–211.<br />
7
II. EINE FAMA<br />
Charles Burney überliefert diese Anekdote in seinem Tagebuch einer Musikalischen<br />
Reise, das 1772 bei Bode in Hamburg in deutscher Sprache erschien.2 Man darf<br />
annehmen, dass sie weit verbreitet war und der belesene Leopold Mozart sie kannte,<br />
als er mit seinem Sohn 1769 zur ersten italienischen Reise aufbrach. Sofern<br />
nicht über die Anekdote, hatte er wohl aus einem Reisebericht Kenntnis über<br />
Allegris Miserere erlangt und wurde so jene Neugier geweckt, die Vater und Sohn<br />
Mozart 1770 am Mittwoch der Karwoche zur Tenebrae-Liturgie in die Cappella<br />
Sistina führte.3 Gleich vielen Rom-Besuchern folgten sie der Fama des Werkes, die<br />
bereits 1715 den reisenden Kavalier Johann Friedrich Armand von Uffenbach herbeigelockt<br />
hatte:<br />
„Gegen abend fuhr nach dem St. Peter, alda in der capella paulina vor dem<br />
pabst und seiner clerisey das miserere von der capelle und allen castraten<br />
gesungen wurde, ich kam aber ein wenig zu spath so daß vor dem abscheulichen<br />
getränge nicht hinein kommen kunte außen aber hörte dem<br />
gesang ein wenig zu, die gravität des pabstes leidet nicht daß ein orgel oder<br />
instrument gespiehlet werde vor ihm in der Kirche, daher nur ein Chor<br />
der castraten, dießes miserere so erbärmlich und doch fürtrefflich sang,<br />
daß es einen recht zur andacht bewegte, es ist solches ein alt fränkisch<br />
coral music aber meisterlich und unvergleichlich gesezet, auch izo noch<br />
besser exequirt werden, der falschen und künstlichen thon waren ohnzahlig<br />
und das aushalten perfect einer resonanz der orgel gleich, so daß<br />
man geschwohren hätte es seyen keine menschen stimmen, sondern<br />
instrumente, alles war über das violet und schwarz behängt und in tiefer<br />
andacht.“4<br />
Zunächst sind es vor allem – wie Uffenbach – Protestanten, oder – wie Burney –<br />
Anglikaner, die sich an der performativen Liturgie der Tenebrae begeistern.5 Erst<br />
2 Zuvor als Charles Burney, The Present State of Music in France and Italy. London 1771,<br />
2. Auflage 1773.<br />
3 Vgl. dazu zuletzt Thomas Hochradner, „weil es eine der Geheimnisse von Rom“. Die Mozarts<br />
als verhinderte Überbringer von Allegris „Miserere“, in: Musicologica Brunensia 53 (2018)<br />
Supplementum, S. 325–337.<br />
4 Eberhard Preußner, Die musikalischen Reisen des Herrn von Uffenbach. Aus einem Reisetagebuch<br />
des Johann Friedrich A. von Uffenbach aus Frankfurt a. M. 1712–1716. Kassel-Basel 1949,<br />
S. 80.<br />
5 Zu den einschlägigen Reiseberichten siehe Katelijne Schiltz, Gregorio Allegris Miserere in<br />
Reiseberichten des 18. und 19. Jahrhunderts, in: Prinzenrollen 1715/16. Wittelsbacher in Rom<br />
und Regensburg, hg. von Andrea und Jörg Zedler. München 2016, S. 223–256, Anmerkun-<br />
8
gegen Ende des Jahrhunderts, als die kirchliche Aufklärung eine Entschlackung<br />
barocker Zeremonien bewirkt hatte, griff der Hype auch auf Katholiken über.<br />
Welch breite Resonanz Allegris Miserere nachfolgend erfuhr, lässt sich einer 1935 an<br />
der Universität Freiburg (CH) approbierten, von Julius Amann verfassten Dissertation<br />
mit dem Titel Allegris Miserere und die Aufführungspraxis in der Sixtina […]<br />
entnehmen.6 Für die Zeit ihrer Abfassung vorbildlich, diente sie zahlreichen weiteren<br />
<strong>Studien</strong> als Ausgangspunkt, während ergänzende philologische Untersuchungen<br />
zur näheren Erhellung der Quellenstreuung weitgehend unterblieben<br />
sind. Das bringt mit sich, dass Allegris Miserere als Gegenstand der ‚historischen<br />
Musikwirkungsforschung‘ nachgerade zum Exempel gerät und die zahlreich vorliegenden<br />
Reiseberichte vor allem des ausgehenden 18. und 19. Jahrhunderts entsprechend<br />
ausgewertet werden.7 Dagegen wird der Überlieferungsgeschichte der<br />
Vorzeit wenig Augenmerk geschenkt und diese weiterhin von offenen, bei Amann<br />
ungelöst gebliebenen Fragen begleitet. Das gilt – wie sich im Folgenden zeigen<br />
wird – auch für die Rezeption des Werkes im Gebiet des heutigen Österreich.<br />
Amann zog dazu nämlich – bedingt durch die seinerzeitigen Erreichbarkeiten –<br />
für seine Untersuchung nur die an der Musiksammlung der Österreichischen<br />
Nationalbibliothek vorhandenen Quellen heran und unterließ es zudem, die bei<br />
Burney überlieferte Anekdote auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen.<br />
III. DIE RÖMISCHE TRADITION<br />
Bei Gregorio Allegris zwischen 1630 und 16528 für die Cappella Sistina in Rom<br />
geschaffenem, doppelchörigem Miserere9 handelt es sich um eine von vielen Vergen<br />
S. 372–377, ferner Bernhard Schrammek, „Die Capellmusik ist undenkbar schön“ –<br />
Exotisch-sinnliche Musikvergnügen „aufgeklärter“ Reisender, in: Über den Klang aufgeklärter<br />
Frömmigkeit. Retrospektive und Progression in der geistlichen Musik, hg. v. Boje E. Hans<br />
Schmuhl und in Verb. mit Ute Omonsky (Michaelsteiner Konferenzberichte 78) Augsburg<br />
2014, S. 307–316, sowie Stefano Ragni, Il Miserere di Allegri nella tradizione della Cappella<br />
Sistina. Le suggestioni letterarie, in: Studi e documentazioni 38 (2000) S. 25–30.<br />
6 Julius Amann, Allegris Miserere und die Aufführungspraxis in der Sixtina nach Reiseberichten<br />
und Musikhandschriften (Freiburger <strong>Studien</strong> zur Musikwissenschaft [Fribourg, CH] 4)<br />
Regensburg 1935.<br />
7 Zuletzt Anne Holzmüller, Konfessioneller Transfer und musikalische Immersion im späten<br />
18. Jahrhundert, in: KmJb 101 (2017) S. 75–99; vgl. auch David R. M. Irving, „For whom the<br />
bell tolls“. Listening and its Implications. Response to John Butt, in: Journal of the Royal Musical<br />
Association 135 (2010) S. 19–24, insbesonders S. 20 f.<br />
8 Während dieser Zeitspanne wirkte Gregorio Allegri (1582–1652) in der Cappella Sistina.<br />
9 Vermutet wird für die Entstehung das Jahr 1638 – siehe Laurenz Lütteken, Perpetuierung des<br />
Einzigartigen: Gregorio Allegris ‚Miserere‘ und das Ritual der päpstlichen Kapelle, in: Barocke<br />
9
tonungen des 51. (nach griechischer Zählung des 50.) Psalms Miserere mei Deus10<br />
in einem wirkungsvoll schlichten Satz. Die Komposition folgt dem Alternatim-Prinzip;<br />
während die geraden Verse einstimmig, rezitiert auf einem Psalmton<br />
erklingen, sind die ungeraden Verse in einem von rezitierenden Abschnitten<br />
durchsetzten, akkordisch dominierten ‚Falsobordone‘-Satz zu singen. Im Wechsel<br />
werden für die ungeraden Verse ein fünfstimmiger (für die Verse 1, 5, 9, 13, 17) und<br />
ein vierstimmiger Satz (für die Verse 3, 7, 11, 15 und 19) in g-Dorisch vorgetragen.<br />
Die Aufteilung der Verse zwischen Schola und Chor war in Rom, wie vielerorts<br />
sonst, bei figuralen Miserere die Regel. Ungewöhnlich, und vor Allegris Vertonung<br />
nicht nachzuweisen, ist jedoch das effektive Ende: Der letzte, zwanzigste Vers beginnt<br />
mit dem fünfstimmigen Satz und endet in einem neunstimmigen Schlussabschnitt.11<br />
Anhand der originalen Quellen konnte Julius Amann belegen, dass 1731 in der<br />
Cappella Sistina eine grundlegende Revision des Allegrischen Miserere vorgenommen<br />
worden ist. Diese Neufassung konnte keineswegs so hermetisch gehütet<br />
werden, wie es den Anschein hat, wenn beispielsweise Leopold Mozart seiner Frau<br />
Anna Maria berichtet: „du wirst vielleicht oft von dem berühmten Miserere in<br />
Rom gehört haben, welches so hoch geachtet ist, daß den Musicis der Capellen<br />
unter der excommunication verbotten ist eine stimme davon aus der Capelle weg<br />
zu tragen, zu Copieren, oder iemanden zu geben.“12 Wie Burney in seinem<br />
Tagebuch festhält, habe ihm Padre Martini in Bologna versichert, „daß niemals<br />
mehr als zwey Abschriften auf päpstlichen Befehl davon gemacht wären, nehmlich<br />
eine für den verstorbenen König von Portugal, die andere für ihn selbst“.13 Also<br />
war das Werk prinzipiell zugänglich geworden. Als er für die Erstausgabe (siehe<br />
Inszenierung, hg. von Joseph Imorde – Fritz Neumeyer – Tristan Weddigen. Emsdetten-<br />
Zürich 1999, S. 136–145, hier: S. 139.<br />
10 Vertonungen des Bußpsalms Miserere wurden im Offizium der letzten drei Kartage gesungen,<br />
in der Sixtinischen Kapelle zum Abschluss der Tenebrae-Liturgie, die am Gründonnerstag,<br />
Karfreitag und Karsamstag Matutin und Laudes umfasste. – [Art.] Miserere<br />
mei Deus, in: RiemannL 12 1967 (Nachdruck Mainz 1996) S. 576.<br />
11 Vgl. J. Amann, siehe Anm. 6, S. 1 f.; Magda Marx-Weber, Römische Vertonungen des Psalms<br />
Miserere im 18. und frühen 19. Jahrhundert, in: Hamburger Jb. für Musikwissenschaft 8 (1985)<br />
S. 7–43, hier: S. 11; dies., Die Tradition der Miserere-Vertonungen in der Cappella Pontificia,<br />
in: Collectanea. II: <strong>Studien</strong> zur Geschichte der päpstlichen Kapelle, hg. von Bernhard Janz<br />
(Capellae apostolicae sixtinaeque collectanea acta monumenta 4) Città del Vaticano 1994,<br />
S. 265–288, hier: S. 266.<br />
12 Mozart. Briefe und Aufzeichnungen, Gesamtausgabe in 7 Bänden, hg. von der Internationalen<br />
Stiftung Mozarteum Salzburg, gesammelt von Wilhelm Adolf Bauer und Otto Erich<br />
Deutsch, auf Grund deren Vorarbeiten erläutert von Joseph Heinz Eibl. Kassel u.a. 1962–<br />
1975, hier: Bd. I, Nr. 176, Z. 46–49 (Hervorhebung im Original).<br />
13 Ch. Burney, siehe Anm. 1, S. 208.<br />
10
Abbildung 1) – trotz seiner eingehenden Befassung mit dem Werk in Rom14 –<br />
Padre Martinis Abschrift zur Grundlage seiner Edition nahm, erwähnt Burney<br />
zudem, dass er in Italien „unächte“ Niederschriften gesehen habe, „worin die Diskantstimme<br />
ziemlich richtig war, dahingegen die übrigen Stimmen sehr abweichen“.15<br />
Allegris Miserere war der Cappella Sistina also schon vor Mozarts Transkription<br />
abgelauscht worden. Selbst tat Burney ein Übriges, die Werküberlieferung<br />
zu verunklaren. Denn obwohl er im Vergleich der Abschrift Martinis mit der<br />
römischen Überlieferung zu dem Schluss kam, „bey der Vergleichung beyder Abschriften<br />
fand ich, daß sie sehr genau, vornehmlich in den ersten Verse [sic] übereinstimmten“16,<br />
ist auch der von ihm 1771 in London verantwortete Erstdruck17<br />
nicht frei von Veränderungen gegenüber den vatikanischen Quellen.18<br />
IV. ZUR RESONANZ DES ERSTDRUCKS<br />
Alles deutet zunächst auf Burneys Druck als ‚Stammvater‘ der Verbreitung hin.<br />
Seine Verfügbarkeit korrespondiert mit dem Einsetzen verlässlicher Daten über<br />
Aufführungen im deutschsprachigen Raum:<br />
„in Deutschland wurde es [das Miserere von Gregorio Allegri] wahrscheinlich<br />
zum erstenmal zwischen 1773 und 1778 von der Schweriner Hofkapelle<br />
gesungen. 1811 fand in Leipzig ein öffentliches Konzert seinen Abschluß<br />
mit dem ‚seit zweyhundert Jahren berühmten und heilig gehaltenen Miserere<br />
von Gregorio Allegri‘. […] Am Karfreitag 1812 kam die Komposition<br />
in Kassel zur Aufführung […] Im Jahre 1816 hörte man [sie] in München<br />
zu St. Michael […].“19<br />
14 Ibidem, S. 206‒209.<br />
15 Ab dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts entstanden nachweislich zahlreiche handschriftliche<br />
Kopien; vgl. J. Amann, siehe Anm. 6, S. 96 f.; Klaus Keil, „Chi si canta nella<br />
Cappella Sistina“. Quellen zur Rezeption des Repertoires der päpstlichen Kapelle, in: Festschrift<br />
für Winfried Kirsch zum 65. Geburtstag, hg. von Peter Ackermann – Ulrike Kienzle – Adolf<br />
Nowak. Tutzing 1996, S. 130–142, hier: S. 137–142.<br />
16 Ch. Burney, siehe Anm. 1, S. 208 f.<br />
17 La MUSICA / Che si Canta Annualmente / nelle FUNZIONI della SETTIMANA SANTA /<br />
nella CAPPELLA PONTIFICIA / Composta dal / PALESTRINA, ALLEGRI, e BAI / Raccolta<br />
e Pubblicata / da / CARLO BURNEY Mus. D. / Londra, Price 10:6 / Stampata per ROBERTO<br />
BRENNER, nella Strand / 1771, S. 35–42.<br />
18 Dazu vgl. J. Amann, siehe Anm. 6, S. 16‒20.<br />
19 Vgl. ibidem, S. 100 f.<br />
11
Abbildung 1: La MUSICA | Che si Canta Annualmente | nelle FUNZIONI della SETTIMANA<br />
SANTA | nella CAPPELLA PONTIFICIA | Composta dal | PALESTRINA, ALLEGRI,<br />
e BAI | Raccolta e Pubblicata | da | CARLO BURNEY Mus. D. | Londra, Price 10:6 | Stampata<br />
per ROBERTO BRENNER, nella Strand | 1771, S. 35<br />
12
Rasch wurde das Werk nun auch in die Länder der Habsburgermonarchie verbreitet:<br />
Um 1820 ist es in der Kirche des Ordens der Kreuzherren mit dem Roten Stern<br />
in Prag, und zwar in einer bereits historistisch-starken Chorbesetzung, a cappella<br />
gesungen worden20, und auch in Wien waren zu dieser Zeit Bestrebungen aufgekommen,<br />
es aufzuführen.21<br />
Angesichts dieser Daten und des Umstandes, dass die Mozarts Allegris Miserere<br />
vor ihrem Rom-Aufenthalt offenkundig nur vom Hörensagen und dem Titel<br />
nach gekannt hatten, scheint es, dass die bei Burney abgedruckte Anekdote nicht<br />
auf Tatsachen beruhe. Vielmehr wirkt naheliegend, dass Allegris Miserere über<br />
Burneys Druck der Fassung von 1731 – dieser ist übrigens zweimal im Archiv der<br />
Gesellschaft der Musikfreunde in Wien erhalten22 – allmählich nach Österreich infiltrierte.<br />
Eine Briefstelle in der Korrespondenz Pietro Metastasios lässt darüber<br />
hinaus zunächst vermuten, dass Burney den Adressaten verwechselte und in Wirklichkeit<br />
Kaiser Joseph II. – der selbst 1769 in Rom weilte – mit der Abschrift des<br />
Miserere bedacht wurde. Dementsprechend ginge der Hinweis auf Kaiser Leopold<br />
I. ins Leere, denn Burney hätte die Anekdote bewusst in historisches Gewand<br />
eingekleidet; dass „Seine Heiligkeit nichts von Musik verstund“, könnte sich auch<br />
für einen Anglikaner nicht so ohne Weiteres niederschreiben lassen.23 Zusätzlich<br />
stimmt mit dieser Lesart überein, dass die in Wien überlieferten Quellen zu Allegris<br />
Miserere erst Ende des 18. Jahrhunderts einsetzen. Die in der Anekdote genannte<br />
Abschrift eines päpstlichen Kapellmeisters ist dagegen nicht auffindbar.<br />
Wer Metastasios Schreiben genau liest, muss jedoch anders folgern: In dem<br />
besagten Brief aus Wien an Saverio Mattei in Neapel, datiert mit 5. April 1770,<br />
heißt es:<br />
„Or lo stesso famoso Miserere del celebre Palestina [sic], che mi ha rapito<br />
in estasi di piacere, e mi ha internamente commosso, cantato da questi in<br />
20 Herrn Robert Hugo (Brünn) danke ich herzlich für diesen Hinweis.<br />
21 Dazu siehe unten, S. 7.<br />
22 A-Wgm, I 25 363 / H 27 536 sowie I 74 800 (dieses Exemplar mit dem vorgeschalteten Kupferstich<br />
des Inneren der Sixtinischen Kapelle), siehe RISM BI/2, S. 244; des Weiteren eine<br />
Partiturabschrift des Druckes, A-Wgm, I 25 363 / Q 655.<br />
23 Bedenkt man den Zeitpunkt, zu dem Joseph II. von seiner Mutter Maria Theresia in die<br />
Regentschaft eingebunden wurde – 1765 –, kämen die Päpste Clemens XIII. (1758–1769)<br />
und Clemens XIV. (1769–1774) in Frage, wobei letzterer, da zum Zeitpunkt des Erscheinens<br />
von Burneys Tagebuch einer musikalischen Reise noch amtierend, wohl auszuscheiden ist.<br />
Clemens XIII. ist als den Jesuiten nahestehend in die Geschichtsbücher eingegangen, von<br />
seinen Bezügen für und wider Musik war aus der Fachliteratur nichts zu erfahren. Zur<br />
Romreise Josephs II., welche ein Interesse seinerseits sowohl stützt als auch unterläuft, siehe<br />
S. 21.<br />
13
Roma [gemeint die Cappella Sistina], è giunto ad annojarmi cantato da’<br />
musici, secondo il corrente stile eccellentissimo, eseguito in Vienna.“24<br />
Demzufolge muss Metastasio also bereits vor dem Erscheinen des Erstdrucks einer<br />
Aufführung in Wien gelauscht haben – und dies sollte zudem länger zurückliegen:<br />
die Zuschreibung des Miserere an Palestrina spricht nicht für eine sehr lebendige<br />
Erinnerung. Überdies ruft der Umstand, dass nur Leopold I. komponierte, wie in<br />
der Anekdote erwähnt, nicht aber Joseph II., die Option eines wahren Kerns der<br />
Begebenheiten zurück.<br />
V. ALTERNATIVEN DER VERBREITUNGSGESCHICHTE<br />
Tatsächlich hatte Allegris Miserere schon vor dem Erstdruck zuweilen den römischen<br />
Radius verlassen, wie gelegentliche Aufführungen in London seit spätestens<br />
Mitte der 1730er Jahre belegen. Der Earl of Egmont notierte 1734 oder 1735 in sein<br />
Tagebuch:<br />
„After dinner I went to the Royal Society and then to the Thursday Vocal<br />
Academy at the Crown Tavern, where we had 19 voices, 12 violins and<br />
5 basses. The famous Miserere of Allegri, forbid to be copied out or communicated<br />
to any under pain of excommunication [by the Pope], being<br />
reserved solely for the use of his chapel, was sung, being brought us by the<br />
Earl of Abercorn, whose brother contrived to obtain it.“25<br />
Danach ist das Werk in London offenbar immer öfter erklungen; 17<strong>61</strong> wird es als<br />
„most usually performed by the academy [Academy of Ancient Music]“ bezeichnet.26<br />
Im Weiteren fragt sich, in welcher Fassung diese Londoner Aufführungen vor<br />
sich gegangen sind. In zeitlicher Staffelung ergeben sich drei mögliche Vorlagen<br />
für diverse Überlieferungsstränge nicht nur nach England, sondern gleichermaßen<br />
über die Alpen und in das Deutsche Reich: das Original des Allegrischen Miserere,<br />
seine Überarbeitung von 1731 und schließlich deren „unächte“ Nachschriften,<br />
noch bevor der – folglich keineswegs als alleiniger Multiplikator zu wertende – von<br />
24 Lettere dell’Abate Pietro Metastasio, Poeta Cesareo. Napoli: Presso La Vedova Amula 1833,<br />
S. 194–205, hier: S. 203 f.<br />
25 Vgl. und zitiert nach Ilias Chrissochoidis, London Mozartiana. Wolfgang’s Disputed Age &<br />
Early Performances of Allegri’s Miserere, in: MT 151 (2010) Summer, S. 83–89, insbesondere<br />
S. 86‒88; Zitat: S. 87.<br />
26 Vgl. ibidem, S. 87 f.; Zitat: S. 88.<br />
14
Burney besorgte, annähernd gleichlautende Erstdruck von 1771 erschien.27 Für die<br />
Zeit danach kommt noch hinzu, dass diesem Erstdruck sehr bald, um 1800, zwei<br />
weitere Drucklegungen des Werkes folgten: ein früher, noch vor 1800 publizierter<br />
Mailänder Druck28 und ein spätestens 1809 bei Kühnel in Leipzig aufgelegter<br />
Sammeldruck, der unter anderem Allegris Miserere enthält.29<br />
Aus näherer Betrachtung dieser drei Quellen ersteht folgendes Bild: Burneys<br />
Ausgabe hält sich trotz nicht unerheblicher Veränderungen im Grunde an die<br />
römische Fassung von 1731, sie enthält keine dynamischen Angaben und wenige<br />
agogische Hinweise, der einzige schriftliche Zusatz erscheint vor dem Schlusschor:<br />
„Questo ultimo Verso si Canta Adagio, e Piano, smorzando a poco, a poco l’Armonia.“<br />
Ein Hinweis auf die choraliter vorzutragenden geraden Verse findet sich<br />
nicht. Die Kühnelsche Ausgabe entspricht der Edition Burneys.30 Die bei Giovanni<br />
Maria Giussani in Mailand, einem nachweislich zwischen 1791 und 1794<br />
tätigen Verleger31, erschienene Version folgt hingegen dem ursprünglichen Notentext<br />
der vatikanischen Quellen, also der Fassung von vor 1731 (siehe Abbildung 2).<br />
Dieser Druck gibt nur den jeweils ersten fünf- und vierstimmigen Chor sowie<br />
den neunstimmigen Schlussabschnitt wieder und operiert mit Schwellzeichen für<br />
die Dynamik. Als Notabene wird auf dem Titelblatt hinzugefügt:<br />
„NB. Che il segno < significa la messa di voce crescendo dal pianissimo al<br />
fortissimo, e viceversa il segno > significa la messa di voce dal forte dimi-<br />
27 Im Übrigen sind sämtliche genannten Quellen ohne Verzierungen notiert – Handschriften,<br />
die dies berücksichtigen, setzen erst knapp nach 1800 ein; vgl. dazu J. Amann, siehe Anm. 6,<br />
S. 43.<br />
28 IL SALMO / MISERERE MEI DEUS / ESPRESSO IN MUSICA / DAL CELEBRE<br />
MAESTRO DI CAPPELLA / GREGORIO ALLEGRI / Si canta in Roma nella Settimana<br />
Santa in Cappella Sistina / Con tal sorprendente effetto, che inspira un sacro orrore e compunzione.,<br />
Milano: „nella nuova Calcografia di Gio. Batista Giussani Incisore di Musica […]“<br />
[s. a.]; A-Wn, Fond Kiesewetter SA.67.H.57, siehe RISM AI/1, S. 50. Beigefügt ist ein handschriftliches<br />
Particell eines unbekannten Kopisten aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts,<br />
das die agogischen Zeichen nicht berücksichtigt.<br />
29 MUSICA SACRA / QUAE CANTATUR QUOTANNIS / PER HEBDOMADAM<br />
SANCTAM / ROMAE / IN SACELLO PONTIFICIO. / [Nr. 5:] Miserere. ALLEGRI.,<br />
LIPSIAE [Leipzig]: „SUMTIBUS AMBROSII KÜHNELII (Bureau de Musique.)“ [s. a.]<br />
[angezeigt 1809 in der AmZ, S. 563]; A-Wn, Fond Kiesewetter, SA.67.D.133. Mit exakt demselben<br />
Titel erfolgte wenig später eine Neuauflage bei C. F. Peters, der Kühnels Offizin<br />
übernommen hatte; ein Exemplar dieses Drucks befindet sich in A-Wgm, I 29 094 / H 27<br />
536 (alte Signatur I 8228).<br />
30 Minimale Abweichung nur in der Groß- und Kleinschreibung einiger Buchstaben, keine<br />
Abweichungen im Notentext.<br />
31 Gemäß den in der RISM Datenbank verfügbaren Einträgen.<br />
15
Abbildung 2: IL SALMO | MISERERE MEI DEUS | ESPRESSO IN MUSICA | DAL<br />
CELEBRE MAESTRO DI CAPPELLA | GREGORIO ALLEGRI | Si canta in Roma<br />
nella Settimana Santa in Cappella Sistina | Con tal sorprendente effetto, che inspira un sacro<br />
orrore e compunzione., Milano: „nella nuova Calcografia di Gio. Batista Giussani Incisore<br />
di Musica […]“ s. a. (A-Wn, Fonds Kiesewetter SA.67.H.57, fol. 1v).<br />
nuendola fin’ al pianissimo, per così conseguire buon effetto del chiar’<br />
oscuro. Il che osservandosi da tutt’ i Cantanti unitamente rende questo<br />
salmo piacevolissimo.“<br />
Darunter folgt ein Hinweis, der aus der 1711 veröffentlichten Schrift Osservazioni<br />
per ben regolare il coro dei cantori della Cappella pontificia von Andrea Adami übernommen<br />
ist32 und den in Teilen auch Burney aufgegriffen hat: „Avverta pure il<br />
Sig. Maestro, che l’ ultimo verso del Salmo termina a due Cori, e però farà la battuta<br />
adagio per finirlo piano, smorzando a poco a poco l’ armonia.“ Zwischen den<br />
Systemen des fünfstimmigen und des vierstimmigen Chores steht „Et secundum<br />
32 Andrea Adami, Osservazioni Per ben regolare il Coro dei cantori della Cappella Pontificia […],<br />
Roma: Antonio de’ Rossi 1711, dort S. 36.<br />
16
etc. risponde il Coro recitando a voce.“ [also, dass bei den geraden Versen einstimmig<br />
zu singen sei] und vor dem neunstimmigen Schlussabschnitt „Ambi li Cori<br />
insieme“, dann vor dessen vierstimmigem Chor „Osservando tutt’i piani e forti<br />
con il Coro I.“.<br />
VI. WIENER TRADITIONSBILDUNG<br />
Alle drei Ausgaben, jene von Burney, jene bei Giussani und jene bei Kühnel, befanden<br />
sich im Besitz von Raphael Georg Kiesewetter (1773‒1850), der das Werk<br />
auch eigenhändig in Partitur schrieb (wie mir aufgrund zittriger Federführung<br />
scheint, in späten Lebensjahren) und dabei Kühnels Druck als Vorlage benutzte.33<br />
Kiesewetter trug – gewohntermaßen – mit roter Tinte noch dynamische Angaben<br />
und Schwellzeichen ein und vermerkte auf gleiche Weise den Text der ungeraden<br />
Verse – mit anderen Worten: Er erstellte eine im Prinzip vollständige Partitur,<br />
wobei die – beigegebenen Erläuterungen zufolge „für solche Musik höchst unpassende“,<br />
„perhorrescirte“ ‒ Schlüsselung der Sopranstimmen vom Violin- zum<br />
C-Schlüssel verändert wurde. Abschließend heißt es dann, datiert mit 1818:<br />
„In der vorliegenden Gestalt hatte ich dieses Miserere, zum Behuf eines<br />
von mir beabsichtigten (jedoch aus einer Art heiliger Scheu und in Erwägung<br />
der manchfaltigen Schwierigkeiten ausgesetzten) Versuches einer<br />
großen Ausführung durch einen freyen Verein von Kunstfreunden und<br />
Virtuosen allhier, vor einigen Jahren hergerichtet.“<br />
Am Karsamstag 1826 brachte er dann jedoch selbst Allegris Miserere zur Aufführung34,<br />
wohl im Glauben, das Werk erstmals in Wien erklingen zu lassen. Er<br />
täuschte sich indes; dieses erste Mal betrifft allenfalls die neuere, seit 1731 geläufige<br />
Faktur. Dass das Werk zuvor schon und in anderer Fassung ins Wiener Repertoire<br />
gelangt war, zeigt die handschriftliche Überlieferung aus der Wiener Hofmusik-<br />
33 A-Wn, SA.68.Aa.81 (Partitur; Querformat, 12 fol.), Kopftitel: Gregorio Allegri. / Das berühmte<br />
Miserere, welches alljährlich zu Rom in der Charwoche, / am Mittwoch und am Charfreytag<br />
in der Sixtinischen Capelle aufgeführet wird. Eingeheftet sind einige Notizen Kiesewetters<br />
zum Werk, die größtenteils aus Wilhelm Heinses Roman Hildegard von Hohenthal,<br />
Teil 1. Berlin: Voss 1795, sowie aus Burneys Tagebuch einer musikalischen Reise extrahiert<br />
sind; datiert ist dieses Konvolut mit 1826.<br />
34 Vgl. Herfrid Kier, Raphael Georg Kiesewetter (1773–1850). Wegbereiter des musikalischen Historismus<br />
(<strong>Studien</strong> zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts 13) Regensburg 1968, S. 178 und<br />
214.<br />
17
Abbildung 3: A-Wn, Mus.Hs. 19.452 (Partitur, Querformat, 2 fol.), Titel fol. 1r: Il salmo |<br />
Miserere mei Deus | Espresso in Musica | Dal celebre Maestro di cappella | Gregorio Allegri. |<br />
Si canta in Roma nella Settimana Santa, in Cappella Sistina | con tal sorprendente effetto,<br />
che inspria un Sacro orrore e compunzione. | N: B. che il segno < significa la messa di voce,<br />
crescendo dal pianissimo al fortissimo; | e viceversa il segno > significa la messa di voce dal forte<br />
diminuendola fin’al | pianissimo, per cosi conseguire buon effetto del ciar’oscuro, il che osservandosi,<br />
da | tutt’i Cantanti unitamente, rende questo Salmo piacevolissimo | avviso: Avverta pure il<br />
Sig. Maestro, che l’ultimo verso del Salmo termina à due cori, e | però farà la battuta adagio<br />
per finirlo piano, smorzando à poco à poco l’armonia. | Del Sig: re [Rasur und überschrieben:]<br />
Gregorio Allegri. (fol. 1v).<br />
kapelle:35 Insgesamt drei Abschriften des Allegrischen Miserere liegen als Grundlage<br />
weiterer Überlegungen vor (Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek,<br />
Mus.Hs. 15.849, Mus.Hs. 19.451 und Mus.Hs. 19.452). Vorderhand wird<br />
dabei der Vermutung, Allegris Miserere könnte zur Regierungszeit Kaiser Leopolds<br />
I. nach Wien gelangt sein, widersprochen; die Quellen stammen allesamt aus<br />
der Zeit um 1800.<br />
35 Diese Provenienz ergibt sich aus den in der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek<br />
(A-Wn) dafür vergebenen Signaturen.<br />
18
Die Partiturabschrift Mus.Hs. 19.45236 ist getreu (also samt allen Zusätzen und<br />
Zwischentexten) dem Mailänder Druck abgenommen (siehe Abbildung 3). Etwas<br />
anders verhält es sich mit dem Bestand Mus.Hs. 19.45137. Er enthält neben einer<br />
Partiturabschrift auch Stimmenmaterial für die ersten beiden Sätze sowie ein Blatt<br />
„Per il Clero“, das die Disposition des Miserere in seinem Wechsel zwischen figuraliter<br />
und choraliter vorgetragenen Versen anhand der Textincipits auflistet und<br />
klein b als Tonhöhe des Chorals festlegt, verbunden mit dem Vermerk „I Bassi<br />
Cantano questo sotto voce“.<br />
Dieser Bestand, der eindeutig für die musikalische Praxis angelegt ist, entspricht<br />
zwar wiederum der älteren Fassung des Allegrischen Miserere, wie sie bei<br />
Giussani in Mailand gedruckt wurde, doch mit teils nicht unerheblichen Änderungen.<br />
Nur der Stimmensatz ist völlig kongruent dazu; die Stimmverteilung für<br />
beide Chöre, der Notentext als auch die Schwellzeichen in den Stimmen sind identisch.<br />
Der Schreiberbefund legt nahe, dass dieses Material ursprünglich zur Abschrift<br />
Mus.Hs. 19.452 gehörte und später falsch eingelegt wurde – mithin ein<br />
Hinweis auf tatsächliche Nutzung zu Aufführungszwecken, sofern die Vertauschung<br />
nicht im Rahmen der katalogischen Erfassung erfolgte.<br />
In der beiliegenden – eben nicht zugehörigen – Partitur wird dagegen in der<br />
vierstimmigen Vertonung ein Takt eingeschoben (siehe Abbildung 4). Burney hätte<br />
vielleicht von einer „unächten“ Fassung gesprochen. Des Weiteren fehlen in dieser<br />
Partitur die Schwellzeichen, stattdessen sind (wenngleich nur für die Stimmen<br />
„Soprano I mo .“ und „Basso“, doch auf die anderen Stimmen zu übertragen) für<br />
beide Sätze rasche Wechsel von Forte und Piano eingetragen, aber nicht für den<br />
neunstimmigen Schlussabschnitt. Eben diese Fassung zeigt, mit allen Annotationen<br />
zur Interpretation, auch die Partiturabschrift Mus.Hs. 15.849.38<br />
36 A-Wn, Mus.Hs. 19.452 (Partitur, Querformat, 2 fol.), Titel fol. 1r: Il salmo / Miserere mei<br />
Deus / Espresso in Musica / Dal celebre Maestro di cappella / Gregorio Allegri. / Si canta in<br />
Roma nella Settimana Santa, in Cappella Sistina / con tal sorprendente effetto, che inspira un<br />
Sacro orrore e compunzione. / N: B. che il segno < significa la messa di voce, crescendo dal pianissimo<br />
al fortissimo; / e viceversa il segno > significa la messa di voce dal forte diminuendola<br />
fin’al / pianissimo, per cosi conseguire buon effetto del ciar’oscuro, il che osservandosi, da / tutt’i<br />
Cantanti unitamente, rende questo Salmo piacevolissimo / avviso: Avverta pure il Sig. Maestro,<br />
che l’ultimo verso del Salmo termina à due cori, e / però farà la battuta adagio per finirlo piano,<br />
smorzando à poco à poco l’armonia. / Del Sig: re [Rasur und überschrieben:] Gregorio Allegri.<br />
37 A-Wn, Mus.Hs. 19.451 (Partitur, Querformat, 8 fol.), Titel fol. 1r: Miserere / Per la Settimana<br />
Sancta. / à 2. Chori. / Partes 9. / et spart: / et / una parte / per il clero. / Di Roma. Stimmenmaterial<br />
für Chor I (C, A, T1, T2, B) und Chor 2 (C1, C2, T, B) sowie ein Blatt „Per il Clero“<br />
[wobei diese Überschrift von nicht viel späterer Hand durchgestrichen wurde].<br />
38 A-Wn, Mus. Hs. 15.849 (Partitur, Querformat, 8 fol.), Titel fol. 1r: Miserere / à. 2. Chori. /<br />
Spartitura. / Del Gregorio Allegri.<br />
19
Abbildung 4: A-Wn, Mus.Hs. 19.451 (Partitur, Querformat, 8 fol.), Titel fol. 1r: Miserere |<br />
Per la Settimana Sancta. | à 2. Chori. | Partes 9. | et spart: | et | una parte | per il clero. |<br />
Di Roma. Stimmenmaterial für Chor I (C, A, T1, T2, B) und Chor 2 (C1, C2, T, B) sowie<br />
ein Blatt „Per il Clero“ [wobei diese Überschrift von nicht viel späterer Hand durchgestrichen<br />
wurde], hier: Partitur, fol. 1v.<br />
Einschneidender noch wirkt in beiden Quellen (also den Partituren Mus.Hs. 19.451<br />
und Mus.Hs. 15.489) ein Wechsel in der Zuordnung der Verse; die strenge Abfolge<br />
von figuraliter gesungenen ungeraden und choraliter gesungenen geraden Versen<br />
wird aufgegeben. Dementsprechend unterscheidet die Anweisung „Per il Clero“<br />
(siehe Abbildung 5a und 5b) zwischen Schola („Clero“) und Chor („Musica“) und<br />
schließt für die Verse 18 bis 20 lapidar mit: „La Musica canta il resto.“ Fünfstimmig<br />
erklingen folglich die Verse 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, vierstimmig die Verse 3, 6, 9, 12, 15,<br />
18 und 20a (abermals entgegen der römischen Praxis, wo dieser Halbvers dem<br />
fünfstimmigen Chor übertragen war). Von der Schola wurden nur die Verse 2, 5,<br />
8, 11, 14, 17 vorgetragen, schließlich von beiden Chören Vers 20b.<br />
Als Ergebnis der Quellenstudien ist festzuhalten: Die Abschrift Mus.Hs.<br />
19.452 mit Partitur und zugehörigem Stimmensatz (der inzwischen Mus.Hs. 19.451<br />
20