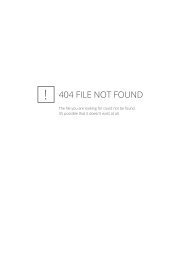KAPITeL 5 Gesundheit - SPD-Landtagsfraktion Bayern
KAPITeL 5 Gesundheit - SPD-Landtagsfraktion Bayern
KAPITeL 5 Gesundheit - SPD-Landtagsfraktion Bayern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Darstellung 5.14: Vergleich der Ärztedichte und der Wirtschaftskraft<br />
nach Landkreisen und kreisfreien Städten in BY 2005<br />
Bruttoinlandsprodukt in 1.000 €<br />
je Einwohner<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0 100 200 300 400<br />
Ärztinnen und Ärzte je 100.000 Einwohner<br />
• Landkreise • Kreisfreie Städte<br />
Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (INKAR) 2008<br />
Darstellung 5.15: Vergleich der Allgemeinärztedichte und der Wirtschaftskraft<br />
nach Landkreisen und kreisfreien Städten in BY 2005<br />
Bruttoinlandsprodukt in 1.000 €<br />
je Einwohner<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0<br />
20 40 60 80 100<br />
Allgemeinärztinnen und -ärtze je 100.000 Einwohner<br />
• Landkreise • Kreisfreie Städte<br />
Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (INKAR) 2008<br />
Der Landkreis München ist sowohl bei Ärzten insgesamt<br />
wie Allgemeinärzten ein „statistischer Ausreißer“ mit<br />
einer anderen Landkreisen entsprechenden Arztdichte,<br />
aber einem wesentlich höheren Bruttoinlandsprodukt. In<br />
letzterem wirkt sich die unmittelbare Nähe und Wechselbeziehung<br />
zur Landeshauptstadt München aus.<br />
5.8 <strong>Gesundheit</strong> und soziale laGe<br />
5.8.1 SOZIOÖKONOMISCHE FAKTOREN<br />
Zahlreiche Studien belegen inzwischen Zusammenhänge<br />
zwischen der Einkommenssituation, der Bildungsqualifikation<br />
und der Arbeitssituation einerseits und der <strong>Gesundheit</strong><br />
andererseits (vgl. Münster u. a. 2007; Albers/Meidenbauer<br />
2005; Mielck 2005; RKI 2005). Diese Zusammenhänge<br />
wirken sich am unteren Ende der Einkommensskala<br />
deutlicher aus als am oberen. So sind insbesondere von<br />
Armut betroffene Menschen häufiger durch Krankheiten<br />
beeinträchtigt, schätzen ihre <strong>Gesundheit</strong> schlechter ein und<br />
haben ein größeres Risiko, früher zu sterben. Darüber hinaus<br />
neigen sie eher zu ungesunden Verhaltensweisen wie<br />
etwa Rauchen, aber auch zu ungesunder Ernährung und<br />
geringer aktiver Sportausübung (vgl. RKI 2005: 21).<br />
Einkommen und <strong>Gesundheit</strong><br />
In Bezug auf die subjektive <strong>Gesundheit</strong>seinschätzung<br />
wurde oben bereits kurz der Zusammenhang von Einkommen<br />
und <strong>Gesundheit</strong>seinschätzung erwähnt. Hier<br />
zeigen die Daten des SOEP (2003) mit steigendem Einkommen<br />
sinkende Anteile an Frauen und Männern, die<br />
ihre <strong>Gesundheit</strong> als „weniger gut“ oder „schlecht“ beurteilen.<br />
Diese Diskrepanz zwischen den Einkommensgruppen<br />
verringert sich jedoch mit zunehmendem Alter<br />
der Befragten (vgl. Darstellung 5.16).<br />
Darstellung 5.16: Anteile der Frauen und Männer, die ihren subjektiven<br />
<strong>Gesundheit</strong>szustand als „weniger gut“ oder „schlecht“ beurteilen,<br />
nach Altersgruppen und Einkommen 8 in D (Prozent)<br />
frauen<br />
Quelle: RKI 2005: 30<br />
18-29<br />
jahre<br />
30-44<br />
jahre<br />
45-64<br />
jahre<br />
ab 65<br />
jahre insgesamt<br />
< 60% 13,7 15,0 40,6 41,5 27,2<br />
60 -< 80% 6,2 10,5 28,6 46,2 26,0<br />
80 -< 100% 6,4 10,4 25,0 34,7 21,9<br />
100 -< 150% 3,4 7,6 21,1 35,5 18,2<br />
150% und darüber 7,0 11,6 16,1 39,7 18,4<br />
Männer<br />
< 60% 4,2 16,1 35,3 35,5 21,2<br />
60 -< 80% 6,3 20,3 34,5 30,6 24,1<br />
80 -< 100% 5,9 8,6 26,4 35,3 19,7<br />
100 -< 150% 2,4 5,8 20,0 24,0 14,0<br />
150% und darüber 7,5 4,9 10,6 28,1 11,3<br />
8 Dabei wird das verfügbare Haushaltsnettoeinkommen nach Größe und Zusammensetzung des Haushaltes bedarfsgewichtet (Nettoäquivalenzeinkommen). Um<br />
die Einkommensungleichheit differenziert betrachten zu können, werden ausgehend vom gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt (Median) fünf Einkommensklassen<br />
gebildet (vgl. RKI 2005: 21).<br />
429