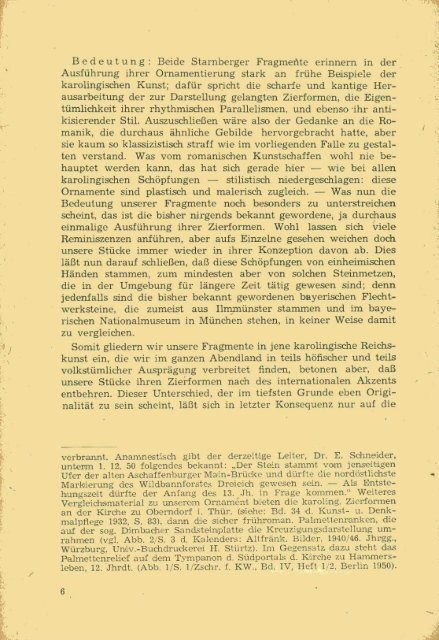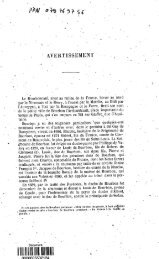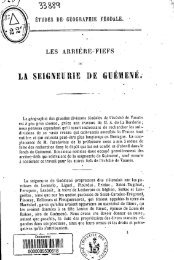Die Starnberger Fragmente
Die Starnberger Fragmente
Die Starnberger Fragmente
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bedeutung: Beide <strong>Starnberger</strong> Fragmeflte erinnern in der<br />
Ausführung ihrer Ornamentierung stark an frühe Beispiele der<br />
karolingischen Kunst; dafür spricht die scharfe und kantige Herausarbeitung<br />
der zur Darstellung gelangten Zierformen, die Eigentümlichkeit<br />
ihrer rhythmischen Parallelismen. und ebenso 'ihr antikisierender<br />
Stil. Auszuschließen wäre also der Gedanke an die Romanik,<br />
die durchaus ähnliche Gebilde hervorgebracht hatte, aber<br />
sie kaum so klassizistisch straff wie im vorliegenden Falle zu gestalten<br />
verstand. Was vom romanischen Kunstschaffen wohl nie behauptet<br />
werden kann, das hat sich gerade hier - wie bei allen<br />
karolingischen Schöpfungen - stilistisch niedergeschlagen: diese<br />
Ornamente sind plastisch und malerisch zugleich. - Was nun die<br />
Bedeutung unserer <strong>Fragmente</strong> noch besonders zu unterstreichen<br />
scheint, das ist die bisher nirgends bekannt gewordene, ja durchaus<br />
einmalige Ausführung ihrer Zierformen. Wohl lassen sich viele<br />
Reminiszenzen anführen, aber aufs Einzelne gesehen weichen doch<br />
unsere Stücke immer wieder in ihrer Konzeption davon ab. <strong>Die</strong>s<br />
läßt nun darauf schließen, daß diese Schöpfungen von einheimischen<br />
Händen stammen, zum mindesten aber von solchen Steinmetzen,<br />
die in der Umgebung für längere Zeit tätig gewesen sind; denn<br />
jedenfalls sind die bisher bekannt gewordenen bayerischen Flechtwerksteine,<br />
die zumeist aus limmünster stammen und im bayerischen<br />
Nationalmuseum in München stehen, in keiner Weise damit<br />
zu vergleichen.<br />
Somit gliedern wir unsere <strong>Fragmente</strong> in jene karolingische Reichskunst<br />
ein, die wir im ganzen Abendland in teils höfischer und teils<br />
volkstümlicher Ausprägung verbreitet finden, betonen aber, daß<br />
unsere Stücke ihren Zierformen nach des internationalen Akzents<br />
entbehren. <strong>Die</strong>ser Unterschied, der im tiefsten Grunde eben Originalität<br />
zu sein scheint, läßt sich in letzter Konsequenz nur auf die<br />
verbrannt. An'amnestisch gibt der derzeitige Leiter. Dr. E. Schneider,<br />
unterm 1. 12. 50 folgendes bekannl: „Der Stein stammt vom jenseitigen<br />
‚ Ufer der alten Aschaffenburger Main-Brücke und dürfte die nordostl:chste<br />
Markierung des Wildbannforstes Dreieich gewesen sein. - Als Entstehungszeit<br />
dürfte der Anfang des 13..Jh. in Frage kommen:' Weiteres<br />
Vergleichsmaterial zu unserem Ornarn/nt bieten die karolin g. Zierforinen<br />
an der Kirche zu Oberndorf i. Thür. (siehe: Bd. 34 d. Kunst- u. Denkmalpflege<br />
1932, S. 83). dann die sicher frühroman. Palmetl.enrarkcn. die<br />
auf der sog. Dimbacher Sandsteinplatte die Kreuzigungsdarstellung umrahmen<br />
(vgl. Abb. 2;S. 3 d. Kalenders: All friink. Bilder. 1940146. .Jhrgg.,<br />
Würzburg. Univ.-Buehdruckcroi H. Sttirtz), Im Gegensatz dazu steht das<br />
Palmettenrelief auf dem Tympanon d. Südport-als d. Kirche zu Hammersleben,<br />
12. Jhrdt. (Abb. 1/S. 1!Zschr. f. KW.. Bd. IV. Heft 1/2. Berlin 1950).