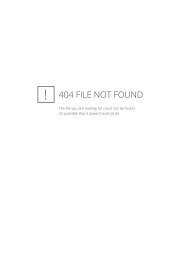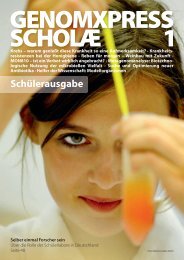wohin die reise geht – lebenswissenschaften im ... - GenomXPress
wohin die reise geht – lebenswissenschaften im ... - GenomXPress
wohin die reise geht – lebenswissenschaften im ... - GenomXPress
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Science Digest 40<br />
tute, zum Forschungserfolg: »Die Entdeckung<br />
könnte direkt zu einer neuen Behandlung<br />
maligner Melanome führen.« Mit ersten wirksamen<br />
Medikamenten rechnet Stratton allerdings<br />
erst in 15 Jahren.<br />
Das Forscherteam stellte fest, dass das Gen<br />
BRAF in 66 Prozent der malignen Melanome<br />
mutiert ist, ebenso wie in zehn Prozent bei<br />
Dickdarmkrebs und zu einem niedrigeren Prozentsatz<br />
in anderen Tumorarten. Es war bereits<br />
bekannt, dass BRAF in der Kontrolle des Zellwachstums<br />
beteiligt ist. »Das Gen ko<strong>die</strong>rt für<br />
ein Enzym, das andere Proteine mit einer Phosphatgruppe<br />
ausstattet. Eine geringfügige<br />
Mutation in Krebszellen schaltet das Gen permanent<br />
an und so erfolgt permanent ein Signal<br />
für ein Zellwachstum«, erklärte Stratton. Die<br />
Suche nach einem Medikament, das <strong>die</strong>sen On-<br />
Zustand des Gens rückgängig macht, hat<br />
bereits begonnen. Derartige Medikamente<br />
würden erwartungsgemäß das Krebswachstum<br />
stoppen. Die Hoffnung der Forscher ist groß,<br />
spielt ein Gen der selben BRAF-Familie auch<br />
eine wesentliche Rolle bei einer anderen Krebsform,<br />
der chronischen myeloiden Leukämie.<br />
Tests haben bereits gezeigt, dass ein Medikament<br />
das Gen bei <strong>die</strong>sen Leukämie-Patienten<br />
erfolgreich blockiert.<br />
Im Rahmen des CGP wurden systematisch alle<br />
Gene, <strong>die</strong> bei 48 Krebsformen des Menschen<br />
eine Rolle spielen, untersucht. Es wurden 1.500<br />
Krebszelllinien gesammelt, um <strong>die</strong>se mit gesunden<br />
Zellen zu vergleichen. Mike Dexter, Wellcome-Trust-Direktor<br />
rechnet damit, dass innerhalb<br />
der nächsten fünf Jahre das CGP einen<br />
Großteil der bei Krebs beteiligten Gene identifiziert<br />
hat. Laut Dexter sollen <strong>die</strong>se Informationen<br />
zu einer »Revolution« in der Krebsbehandlung<br />
führen <strong>–</strong> u.a. bei der Behandlung bösartiger<br />
Melanome. Maligne Melanome machen<br />
zwar »nur« elf Prozent aller Hautkrebsfälle aus,<br />
führen aber in jedem Fall zum Tod.<br />
Quelle: bdw 06.2002 (online)<br />
Erbgut bald<br />
schneller entschlüsseln?<br />
Einzelmolekül-Sequenzierung<br />
Die Sequenz des menschlichen Genoms<br />
ist weitgehend bekannt. Um <strong>die</strong> Zusammenhänge<br />
zwischen einzelnen Genomabschnitten<br />
und beispielswiese best<strong>im</strong>mten Krankheiten zu<br />
verstehen, müssen nun <strong>die</strong> entsprechenden<br />
Gensequenzen identifiziert, charakterisiert und<br />
auf Mutationen untersucht werden. »Mit herkömmlichen<br />
Sequenziermethoden ist das viel<br />
zu langwierig,« erklärt Susanne Brakmann von<br />
der Universität Leipzig. »Wenn es dagegen<br />
gelänge, einzelne DNA-Moleküle zu sequenzieren,<br />
ließen sich wesentlich längere Fragmente<br />
»ablesen« und <strong>die</strong> Sequenzinformationen um<br />
Größenordnungen schneller zusammensetzen.»<br />
Gemeinsam mit Sylvia Löbermann vom Max-<br />
Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in<br />
Göttingen hat sie gerade einen weiteren Meilenstein<br />
für <strong>die</strong>ses Konzept aufgestellt.<br />
Das Prinzip: Die DNA ist eine Doppelhelix aus<br />
zwei komplementären Strängen, zusammengehalten<br />
durch <strong>die</strong> Paarung ihrer Bausteine, der<br />
Nucleobasen A und T sowie G und C. Die beiden<br />
Stränge werden getrennt, einer der Einzelstränge<br />
<strong>die</strong>nt nun als Matrize für <strong>die</strong> Anfertigung<br />
einer Kopie <strong>–</strong> mit Nucleobasen, <strong>die</strong> mit<br />
verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen markiert<br />
wurden. Erst kürzlich war es den Forscherinnen<br />
gelungen, ein Enzym zu finden, das auch aus<br />
sperrigen, markierten Nucleobasen korrekte<br />
Kopien synthetisiert (Angew.Chem. 2001, 113,<br />
1473-1476). An winzige Kunststoffkügelchen<br />
gekoppelt lassen sich <strong>die</strong> so markierten DNA-<br />
Moleküle vereinzeln. Im nächsten Schritt muss<br />
der DNA nach dem Salamiprinzip vom Ende her<br />
eine Nucleobase nach der anderen abgeschnitten<br />
und identifiziert werden. Bereits seit zehn<br />
Jahren gibt es spektrometrische Verfahren, mit<br />
denen einzelne fluoreszierende Moleküle identifiziert<br />
werden können. Eine Hürde dagegen<br />
war bis vor kurzem, ein »Salam<strong>im</strong>esser« zu finden,<br />
ein Enzym, das <strong>die</strong> fluoreszierenden Nucleobasen<br />
wieder f<strong>reise</strong>tzt, denn <strong>die</strong> markierte<br />
DNA ist sehr sperrig und windet sich auch<br />
anders als das unmarkierte Original. Alle getesteten<br />
»Salam<strong>im</strong>esser«, sprich Exonucleasen,<br />
scheiterten zunächst. Statt weitere »Messer«<br />
zu testen, variierten <strong>die</strong> Forscherinnen <strong>die</strong><br />
Schneidbedingungen: Durch Zugabe des Lösemittels<br />
Dioxan konnten <strong>die</strong> Löslichkeit der DNA<br />
erhöht und der Schneidemodus des gewählten<br />
Enzyms, E. coli-Exonuclease III, verbessert werden.Werden<br />
außerdem nur zwei der vier Nucleobasensorten<br />
markiert, ist <strong>die</strong> DNA weniger<br />
sperrig. Wiederholt man das Exper<strong>im</strong>ent mit<br />
allen möglichen Permutationen, sollte auch so<br />
eine vollständige Sequenzanalyse gelingen.<br />
»Die Grundlagen für <strong>die</strong> Einzelmolekül-<br />
Sequenzierung sind damit gelegt,« zeigt sich<br />
Brakmann opt<strong>im</strong>istisch. »Vollautomatische<br />
Geräte könnten einzelne Abweichungen in<br />
Genabschnitten feststellen und eventuell sogar<br />
bis zu 1 Mio. Nucleobasen pro Tag entschlüsseln.«<br />
Angew. Chem. 2002, 114 (17), 3350 <strong>–</strong><br />
3352<br />
Quelle: IdW 29.08.2002<br />
<strong>GenomXPress</strong> 3/02