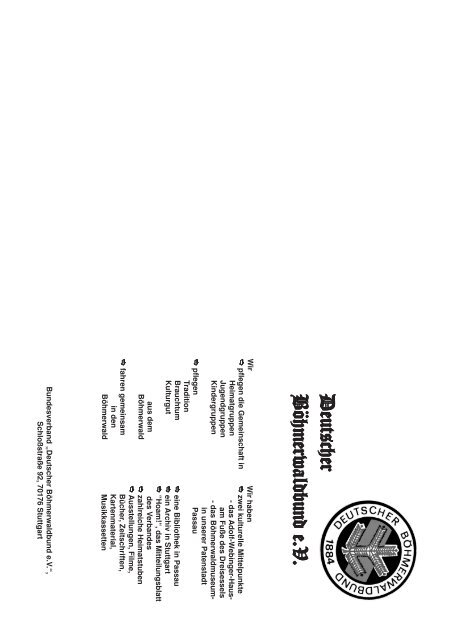Böhmerwäldler Jahrbuch 2007 - Deutscher Böhmerwaldbund eV
Böhmerwäldler Jahrbuch 2007 - Deutscher Böhmerwaldbund eV
Böhmerwäldler Jahrbuch 2007 - Deutscher Böhmerwaldbund eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1<br />
Bundesverband „<strong>Deutscher</strong> <strong>Böhmerwaldbund</strong> e.V.“,<br />
Schloßstraße 92, 70176 Stuttgart<br />
����� eine Bibliothek in Passau<br />
����� ein Archiv in Stuttgart<br />
����� “Hoam!“, das Mitteilungsblatt<br />
des Verbandes<br />
����� zahlreiche Heimatstuben<br />
����� Ausstellungen, Filme,<br />
Bücher, Zeitschriften,<br />
Kartenmaterial,<br />
Musikkassetten<br />
����� fahren gemeinsam<br />
in den<br />
Böhmerwald<br />
aus dem<br />
Böhmerwald<br />
����� pflegen<br />
Tradition<br />
Brauchtum<br />
Kulturgut<br />
Wir<br />
����� pflegen die Gemeinschaft in<br />
Heimatgruppen<br />
Jugendgruppen<br />
Kindergruppen<br />
Wir haben<br />
����� zwei kulturelle Mittelpunkte<br />
- das Adolf-Webinger-Hausam<br />
Fuße des Dreisessels<br />
- das Böhmerwaldmuseumin<br />
unserer Patenstadt<br />
Passau<br />
<strong>Deutscher</strong><br />
<strong>Deutscher</strong><br />
<strong>Böhmerwaldbund</strong> <strong>Böhmerwaldbund</strong> e.V e.V. e.V
2<br />
3<br />
Buch- und Offsetdruck Josef Dötsch, Dr.-Schott-Str. 44, 94227 Zwiesel<br />
Bundestreffen <strong>2007</strong><br />
27. bis 29. Juli <strong>2007</strong><br />
Der Deutsche <strong>Böhmerwaldbund</strong> e.V. lädt dazu in die<br />
Patenstadt Passau der <strong>Böhmerwäldler</strong> ein.<br />
Verlag „Hoam!“ Waldkirchen, Böhmerwald<br />
Sitz Stuttgart<br />
Zu bestellen bei: <strong>Deutscher</strong> <strong>Böhmerwaldbund</strong><br />
Anni Heidinger, Im Krautgarten 42, 74321 Bietigheim-Bissingen, Tel.:<br />
07147/6141, Fax: 07142/913043, e-mail: A.Heidinger@t-online.de<br />
Herausgegeben vom Deutschen <strong>Böhmerwaldbund</strong> e.V.<br />
Heimatverband der <strong>Böhmerwäldler</strong><br />
Böhmerwald-Lexikon 10,—<br />
Böhmerwald <strong>Jahrbuch</strong> 2006 5,—<br />
Roßei b´schlogn, Ingeborg Schweigel 15,30<br />
Unsere Heimat, die Stadt Krummau an der Moldau, 20,—<br />
Und immer rettet die Güte, Erich Hans, 10,50<br />
Bildband „Der Böhmerwald“, Erich Hans, 16,30<br />
Bildband „Der Böhmerwald heute“, Dieter Reisch, 33,10<br />
Hütbubensommer, Maria Frank, 10,10<br />
Die Kost der <strong>Böhmerwäldler</strong>, 7,60<br />
Das Kratzei, 7,60<br />
Böhmerwäldisches Lachen, Rudolf Kubitschek, 5,50<br />
Sudetendeutsche Heimatkunde, Heinrich, 3,—<br />
Böhmische Schmankerln, 13,—<br />
MC Waldlermesse, 10,30<br />
MC Tief drinn im Böhmerwald, 7,60<br />
Umschlagbild und Kalendarium von Josef und Gunther<br />
Fruth<br />
erarbeitet von Günther Hans<br />
CD Auf´d Wulda<br />
Lieder und Musik<br />
aus dem Böhmerwald, 13,—<br />
Artikel: Preise in Euro<br />
Bücher und Musikkassetten für die<br />
Böhmerwaldfamilie<br />
<strong>Böhmerwäldler</strong><br />
<strong>Jahrbuch</strong><br />
<strong>2007</strong>
4<br />
5<br />
Besondere Feiertage:<br />
Aschermittwoch 21. Februar; Karfreitag 06. April; Ostern 08. und 09. April;<br />
Himmelfahrt 17. Mai; Pfingsten 27. und 28. Mai; Fronleichnam 07. Juni;<br />
Tag der Deutschen Einheit 03. Oktober; Reformations-fest 31. Oktober; Allerheiligen<br />
1. November; Buß- und Bettag 21. November.<br />
8 Mo Erhard, Severin<br />
9 Di Berthold, Julian<br />
10 Mi Wilhelm, Gregor, Sebastian<br />
11 Do Werner, Tasso<br />
12 Fr Ernst, Reinhold<br />
13 Sa Hildegard, Gottfried, Veronika<br />
14 So Felix, Rainer<br />
29 Mo Valerius, Franz v. Sales<br />
30 Di Martina, Adelgunde<br />
31 Mi Johann, Ludowika, Petrus<br />
22 Mo Vinzenz, Anastasius<br />
23 Di Emmerich, Heinr., Maria Verm.<br />
24 Mi Ernst, Thimotheus<br />
25 Do Pauli Bekehrung<br />
26 Fr Alberich, Titus<br />
27 Sa Joh.Chrisostomus, Angela<br />
28 So Karl d. Gr., Thomas v.Aquin<br />
1 Mo Neujahr<br />
2 Di Namen Jesu, Abel, Gregor<br />
3 Mi Genoveva, Berthilde<br />
4 Do Rigobert, Angela, Titus<br />
5 Fr Joh.Nepomuk Neumann, Emilie<br />
6 Sa Dreikönig, Ersch.d.Herrn<br />
7 So Valentin, Raimund, Reinhold<br />
Eismond, 31 Tage<br />
15 Mo Maurus, Paul Eins.<br />
16 Di Marzellus<br />
17 Mi Antonius<br />
18 Do Petri Stuhlf., Karlmann<br />
19 Fr Maria u. Martha, Knud<br />
20 Sa Fabian, Sebastian<br />
21 So Agnes, Meinrad<br />
Was Erscheinung mir eröffnet,<br />
muss ich fassen, will ich nennen,<br />
die gebannten, rohen Kräfte<br />
recht in ihrem Grund erkennen.<br />
Durch den Raum, durch alle Zeiten,<br />
wirkt - der war und wird und ist -<br />
mir unfassbar, - und ich glaube:<br />
Vater unser, der Du bist!<br />
Jänner<br />
In der eisigen Nacht der Gipfel,<br />
in des Allerhöchstem Hauche,<br />
blenden mich kristallene Grate,<br />
Tiefen rot im Opferrauche.<br />
Bin am Weg mit leeren Händen;<br />
weiß nun sicher nur dies Wissen:<br />
Dem Verstande bleibt verborgen,<br />
was wir nicht begreifen müssen.<br />
Über den errungenen Himmeln<br />
neue Firmamente steigen,<br />
ferne, fremde Sonnen kreisen<br />
flammend den gesetzten Reigen.<br />
Daraus des Verhüllten Antlitz,<br />
seinen Namen mir gestalten,<br />
von dem Mythos zur Erkenntnis<br />
so mit ihm die Zwiesprach halten.-<br />
Irgendwo bin ich am Wege,<br />
mich mir selbst ganz zu ergründen,<br />
nach des Daseins erstem Aufschrei<br />
fragend Ziel und Ursprung finden.<br />
Dieses eine Wort am Anfang<br />
in vernünftig Regeln zwingen,<br />
allen Werdens und Vergehens<br />
Sinn und Formel mir erringen.<br />
Am Wege<br />
Ernst Quitterer<br />
Gunther Fruth:<br />
Eiszeit
6<br />
7<br />
12 Mo Reginald, Gaudentus, Eulalia<br />
13 Di Reinhilde, Gerlinde, Kath.v.R.<br />
14 Mi Cyrill u. Meth., Valentin<br />
15 Do Siegfr., Faustinus<br />
16 Fr Juliane, Julian<br />
26 Mo Alexander, Nestor<br />
27 Di Markward, Leander, Julian<br />
28 Mi Roman, Justus<br />
12 Mo Maximilian, Beatrix<br />
13 Di Paulina, Gerald, Ernst<br />
14 Mi Mathilde, Hiltibert<br />
15 Do Klemens H., Christoph, Longinus<br />
16 Fr Heribert, Cyriakus<br />
26 Mo Emanuel, Luitger<br />
27 Di Rupert, Frowein<br />
28 Mi Johann, Guntram, Malchus<br />
29 Do Berthold, Helmut, Eustachius<br />
30 Fr Dietmut, Roswitha, Quirinus<br />
31 Sa Kornelia, Guido, Amos Pr.<br />
5 Mo Agatha<br />
6 Di Dorothea, Paul, Titus<br />
7 Mi Richard, Romuald<br />
8 Do Hieronimus, Johannes v.M.<br />
9 Fr Erich, Konrad, Apolonia<br />
10 Sa Gabriel, Scholastika<br />
11 So Maria Lourdes, Adolf<br />
19 Mo Rosenmontag, Konrad,<br />
Bonifatius<br />
20 Di Fasching, Leo, Korona<br />
21 Mi Aschermittwoch, Eleonore,<br />
Petrus, Damian, Felix<br />
22 Do Petri Stuhlfeier<br />
23 Fr Sieghard, Eberhard<br />
24 Sa Mathias, Edilbert<br />
25 So Viktor, Walburga<br />
5 Mo Gerda, Friedr. Dietmar, Eusebius<br />
6 Di Friedolin, Friedrich<br />
7 Mi Rich.K., Felizitas<br />
8 Do Johann v.G.<br />
9 Fr Franziska, Bruno<br />
10 Sa Gustav, Emil, Alex, 40 Märt.<br />
11 So Ulrich, Theresia, Rosina<br />
19 Mo Josef, Nährvater<br />
20 Di Irmgard, Wolfram, Hubert, Eugen<br />
21 Mi Alexandra, Benedikt<br />
22 Do Lea, Kasimir, Oktavian<br />
23 Fr Otto v.A., Eberhard, Viktorin<br />
24 Sa Katharina, Elias, Gabriel, Simon<br />
25 So Maria Verk.,<br />
Heimkehr d.Schwalben<br />
1 Do Ignaz, Brigitte<br />
2 Fr Mariä Lichtmeß<br />
3 Sa Blasius, Ansgar<br />
4 So Andreas, Veronika<br />
17 Sa Konstantin, Konstantia<br />
18 So Simeon, Konkordia, Flavian<br />
1 Do Albin<br />
2 Fr Karl, Heinrich, Hartwin<br />
3 Sa Kunigunde<br />
4 So Kasimir, Afrikan, Luzius<br />
17 Sa Gertrud, Theodor<br />
18 So Eduard, Cyrill v.J.<br />
Hornung, 28 Tage<br />
Lenzmond, 31 Tage<br />
Feber<br />
März<br />
Gunther Fruth:<br />
Frostgebilde<br />
Gunther Fruth:<br />
Aus dem Eis
8<br />
9<br />
9 Mo Ostermontag, Waltraud, Hugo<br />
10 Di Mathilde, Hulda<br />
11 Mi Rainer, Felix, Leo P.<br />
12 Do Herta, Julius<br />
13 Fr Martin, Ida, Justus<br />
14 Sa Ernestine, Hedwig<br />
15 So Waldmann, Anastasius<br />
30 Mo Ludwig, Walburga, Kath.<br />
14 Mo Bonifatius, Matheus,<br />
Korona<br />
15 Di Sophie, Isidor<br />
23 Mo Georg, Adalbert, Gerardus<br />
24 Di Helmut, Albrecht, Georgi<br />
25 Mi Erwin, Markus<br />
26 Do Richard, Ferdinand,<br />
Trudbert<br />
27 Fr Hilda, Petrus<br />
28 Sa Peter, Ludwig, Theobald<br />
29 So Katharina v.S., Sibylla<br />
28 Mo Pfingstmontag, Wilhelm, Ludwig<br />
29 Di Erwin, Irmtrud, Maximilian<br />
30 Mi Reinhild, Ferdinand, Johanna<br />
31 Do Angela, Petronella<br />
7 Mo Gisela, Notger, Gottfried<br />
8 Di Klara, Ida, Michael<br />
9 Mi Gregor, Beatus<br />
10 Do Anton, Gordian, Isidor<br />
11 Fr Adalbert, Gangolf, Isidor<br />
12 Sa Pankratius<br />
13 So Servatius<br />
2 Mo Franz v.Paula<br />
3 Di Richard B., Agape<br />
4 Mi Isidor, Ambros, Irene<br />
5 Do Vinzenz, Emilia<br />
6 Fr Karfreitag, Wilhelm, Sixtus,<br />
Brunhilde<br />
7 Sa Joh.Babt., Luise, Hermann<br />
8 So Ostern, Walter, Klara<br />
21 Mo Herm., Jos., Konst., Richarda<br />
22 Di Julia, Rita, Emil, Helena<br />
23 Mi Joh., Renate, Helma<br />
24 Do Dagmar, Wilhelm, Ester<br />
25 Fr Maria Magdal., Gregor, Urban P.<br />
26 Sa Philipp Ner.<br />
27 So Pfingstsonntag, August v.C.,<br />
Gerda<br />
1 So Irene, Hugo, Theodor<br />
16 Mo Benedikt, Herwig<br />
17 Di Robert, Rudolf<br />
18 Mi Werner, Valerian, Apollonia<br />
19 Do Emma, Leo, Kreszenz<br />
20 Fr Viktor, Hildegund<br />
21 Sa Konrad, Anselm<br />
22 So Wolthelm, Soter u.Cajus<br />
1 Di Maifeiertag<br />
2 Mi Sigmund, Ruthard<br />
3 Do Phil. u.Jak.<br />
4 Fr Florian, Monika<br />
5 Sa Gotthard, Pius V., Angela<br />
6 So Dietrich, Judit, Gundula<br />
Ostermond, 30 Tage<br />
Wonnemond, 31 Tage<br />
16 Mi Johann v.Nepomuk<br />
17 Do Himmelfahrt, Bruno, Giselbert,<br />
Dietmar<br />
18 Fr Erich, Johann<br />
19 Sa Petrus C., Iro, Alkuin<br />
20 So Bernhard, Elfriede<br />
April<br />
Mai<br />
Gunther Fruth:<br />
Endzeit<br />
Gunther Fruth:<br />
Aufbruch
10<br />
11<br />
11 Mo Paula, Felix<br />
12 Di Joh.F., Leo, Rudolf<br />
13 Mi Anton v. Padua, Tobias<br />
14 Do Herwig, Gerold<br />
15 Fr Veit, Vitus<br />
16 Sa Benno, Luitgard<br />
25 Mo Wilhelm, Berta, Eleonore<br />
26 Di Herz-Jesu, Johann u. Paul<br />
27 Mi Alexander, Carill<br />
28 Do Leo II., Diethilde<br />
29 Fr Peter u. Paul<br />
30 Sa Otto, Ehrentraud, Pauli Ged.<br />
16 Mo Maria v.Bg., Ruth, Irmgard<br />
30 Mo Ingeborg, Petrus,<br />
Chrysostomus<br />
31 Di Ignatius v.L., Ernestine<br />
9 Mo Veronika, Gottfried, Luise<br />
10 Di Knud, Amalia, Engelb., 7 Brüder<br />
11 Mi Benedikt v.N., Olga<br />
12 Do Felix, Heinrich, Johann Gualb.<br />
13 Fr Margareta, Heinr. u. Kunigunde<br />
14 Sa Franz v.Sales, Kamilus<br />
15 So Egon, Bonaventura, Heinrich<br />
4 Mo Franz Car., Werner, Quirin<br />
5 Di Bonifatius, Winfried, Dorothea<br />
6 Mi Herbert, Bertram<br />
7 Do Fronleichnam, Robert,<br />
Lukretia, Gottfried<br />
8 Fr Medardus<br />
9 Sa Ida, Ephraim<br />
10 So Heinrich v.B., Margareta<br />
18 Mo Arnulf, Mark u. Marzell<br />
19 Di Emma, Juliana, Romuald,<br />
Gerwas<br />
20 Mi Adalbert, Berthold, Silverius<br />
21 Do Alois, Albanus<br />
22 Fr Rotraud, Paula, Paulus<br />
23 Sa Edeltraud, Basilius<br />
24 So Johannes d.Täufer<br />
23 Mo Brigitta v.Schw., Arnulf<br />
24 Di Christoph, Christ., Siegl., Ludov.<br />
25 Mi Jakob d. Ältere<br />
26 Do Anna, Joachim, Anniela<br />
27 Fr Berthold, Rudolf<br />
28 Sa Viktor, Innozenz<br />
29 So Martha, Beatrix<br />
1 Fr Konrad, Nikodemus, Gratian<br />
2 Sa Ilse, Petrus<br />
3 So Karl L., Erasmus<br />
17 So Adolf, Laura<br />
2 Mo Mariä Heimsuchung<br />
3 Di Thomas Ap., Klothilde<br />
4 Mi Elisabeth, Ulrich, Prokop<br />
5 Do Cyrill, Method, Hugo, Wilh.<br />
6 Fr Maria Gor., Gottlieb<br />
7 Sa Willibald<br />
8 So Kilian, Elisabeth<br />
1 So Dietrich, Theobald<br />
17 Di Alex, Karoline<br />
18 Mi Friedrich, Rosina, Arnulf<br />
19 Do Vinzenz v.P., Arnulf<br />
20 Fr Margareta, Hieronymus,<br />
Elias Pr.<br />
21 Sa Helga, Laurentius, Daniel<br />
22 So Maria Magdalena<br />
Heumond, 30 Tage<br />
Brachmond, 31 Tage<br />
Juni<br />
Juli<br />
Gunther Fruth:<br />
Linien am Ufer<br />
Gunther Fruth:<br />
Leben im Urwald
12<br />
13<br />
13 Mo Reinhild, Reinhold, Hipolith<br />
14 Di Eberhard, Maximilian, Eusebius<br />
15 Mi Maria Himmelfahrt<br />
27 Mo Monika, Gebhard<br />
28 Di Alfred, Augustus<br />
29 Mi Johannes Enthauptung<br />
30 Do Felix, Vinzenz, Benjamin<br />
31 Fr Raimund, Isabella, Paulinus v.Tr.<br />
10 Mo Jodokus, Diethard, Nikolaus v.T.<br />
11 Di Helga, Theodor, Felix<br />
12 Mi Maria Namen, Guido<br />
13 Do Notburga, Amatus, Tobias<br />
14 Fr Kreuzerhöhung<br />
15 Sa Mariä Schmerzen, Dolores<br />
24 Mo Rupert, Gerhard<br />
25 Di Irmfried, Firmian, Kleophas<br />
26 Mi Cyprian, Meinhard<br />
27 Do Adolf, Vinz.v.P., Cosm.u.Dam.<br />
28 Fr Wenzeslaus<br />
29 Sa Michael, Raphael, Gabriel<br />
30 So Hieronymus, Otto<br />
6 Mo Verklärung d.Herrn<br />
7 Di Adalbert, Sixtus, Afra, Kajetan<br />
8 Mi Dominikus, Herwig<br />
9 Do Roland, Roman<br />
10 Fr Laurenz, Lorenz<br />
11 Sa Hermann, Susanne, Philomena<br />
12 So Klara, Cäcilia, Radegund<br />
20 Mo Bernh.v.Clerv., Stephan K.<br />
21 Di Franz, Pius X, Balduin, Johanna<br />
22 Mi Maria Königin, Thimotheus<br />
23 Do Rosa v.Lima, Philipp<br />
24 Fr Bartholomäus<br />
25 Sa Ludwig, Josef v.C., Herm.,<br />
Egbert<br />
26 So Margarethe, Gregor<br />
3 Mo Gregor d.Gr., Seraphim<br />
4 Di Rosalia, Irmgard<br />
5 Mi Albert, Laurentia, Roswitha<br />
6 Do Beate, Magnus, Zacharias<br />
7 Fr Dietrich, Regina<br />
8 Sa Maria Geburt<br />
9 So Bruno, Wilfrieda<br />
1 Mi Alfons, Petri Kettenf.<br />
2 Do Mariä Heims., Gustav<br />
3 Fr August, Stephan, Lydia<br />
4 Sa Johannes MV., Dominik<br />
5 So Maria Schnee, Oswald<br />
17 Mo Hildegard v.B., Robert<br />
18 Di Lambert, Thomas v.V., Titus<br />
19 Mi Wilma, Sidonia, Arnulf<br />
20 Do Friederike, Traugott, Eustach<br />
21 Fr Matthäus<br />
22 Sa Moritz, Emmeran<br />
23 So Thekla, Helena, Rotraud<br />
Erntemond, 31 Tage<br />
16 Do Stef.v.Ung., Rochus, Hyazinth<br />
17 Fr Bertram<br />
18 Sa Helene, Rupert<br />
19 So Joachim T., Emilia, Ludwig<br />
1 Sa Ägidius, Verena<br />
2 So Margarethe, Emmerich, Tobias<br />
16 So Edith, Kornelius, Ludmilla<br />
Herbstmond, 30 Tage<br />
August<br />
September<br />
Gunther Fruth:<br />
Sommerschatten<br />
am Baum<br />
Gunther Fruth:<br />
Föhnstimmung
14<br />
15<br />
15 Mo Theresia, Aurelia<br />
8 Mo Brigitta, Benedikt<br />
9 Di Günther, Arnold<br />
10 Mi Franz v.Borg.<br />
11 Do Muttersch.Mariä, Bruno, Burkh.<br />
12 Fr Horst, Emil, Maximilian<br />
13 Sa Eduard, Koloman<br />
14 So Wilhelmine, Dietmar<br />
29 Mo Engelhard, Eusebia<br />
30 Di Alfons, Hertmann, Klaudius<br />
31 Mi Reformationsfest,<br />
Wolfgang v.Reg.,<br />
Christ König<br />
12 Mo Emil, Kunibert<br />
13 Di Adalbert, Eugen<br />
14 Mi Alberich, Seraphim<br />
15 Do Leopold, Albert d.Gr., Gertrud<br />
26 Mo Konrad, Gebhard<br />
27 Di Gustav, Oda, Virg., Ute<br />
28 Mi Gerhard, Berta, Günther<br />
29 Do Walter, Erhard<br />
30 Fr Andreas<br />
22 Mo Kordula, Salome<br />
23 Di Johannes v.C., Severin<br />
24 Mi Antonius, Gilbert, Rafael<br />
25 Do Wilhelmine, Ludwig<br />
26 Fr Helmut, Amand<br />
27 Sa Sabine, Wolfhard<br />
28 So Simon u.Juda<br />
5 Mo Elisabeth, Berthilde<br />
6 Di Leonhard, Eleonore<br />
7 Mi Engelbert, Brunhilde, Willibald<br />
8 Do Gottfried, Severus<br />
9 Fr Theodor, Randolf<br />
10 Sa Leo, Andreas, Justus<br />
11 So Martin v.T.<br />
1 Mo Theresia v.K.<br />
2 Di Schutzengelfest<br />
3 Mi Tag der deutschen Einheit,<br />
Ewald, Gerhard, Kanditus<br />
4 Do Erntedank, Franz v.Assisi<br />
5 Fr Raimund, Placitus<br />
6 Sa Bruno, Angela<br />
7 So Rosenkranzfest, Amalie<br />
19 Mo Elisabeth v. Thür.<br />
20 Di Felix v.V., Edm.<br />
21 Mi Buß- u.Bettag,<br />
Mariä Opfer, Amos<br />
22 Do Cäcilia, Alfons, Philomena<br />
23 Fr Klemens, Felizitas<br />
24 Sa Emilie, Joh.v.Kreuz<br />
25 So Totensonntag,<br />
Katharina v.A.<br />
1 Do Allerheiligen<br />
2 Fr Allerseelen<br />
3 Sa Hubert, Martin, Ida<br />
4 So Karl Bor., Charlotte,<br />
Zacharias<br />
Weinmond, 31 Tage<br />
16 Di Gallus<br />
17 Mi Ignaz v.Flo., Hedwig<br />
18 Do Lukas, Justus<br />
19 Fr Paul v.Kr., Ferd., Peter v.Alk.<br />
20 Sa Wendelin, Vitalis, Felizian<br />
21 So Ursula, Irmtraud<br />
Nebelmond, 30 Tage<br />
16 Fr Margareta, Otmar,<br />
Edmund<br />
17 Sa Gregor, Hugo<br />
18 So Udo, Eugen, Hilda<br />
Oktober<br />
November<br />
Gunther Fruth:<br />
Herbstliche<br />
Schatten am<br />
Gestein<br />
Gunther Fruth:<br />
Gefallener<br />
Baumriese
16<br />
17<br />
10 Mo Herbert, Emma<br />
11 Di Domasius, Sabine<br />
12 Mi Johanna, Franziska, Alexander<br />
13 Do Lucia, Ottilie<br />
14 Fr Joh.v.Kreuz, Ingeborg<br />
15 Sa Christoph, Johann, Valerian<br />
16 So 3.Advent, Adelheid, Albine<br />
31 Mo Silvester, Melanie<br />
1927 Kunstwerke von Otto Herbert Hajek, geboren am 27. 6.1927 in Kaltenbach,<br />
gest. 2005 in Stuttgart, stehen in Stuttgart und Prag ebenso wie in Moskau<br />
24 Mo Hl.Abend, Adam u. Eva<br />
25 Di 1.Weihnachtsfeiertag,<br />
Christfest<br />
26 Mi 2.Weihnachtsfeiertag,<br />
Stephanus<br />
27 Do Johannes Ev., Fabiola<br />
28 Fr Unschuldige Kinder<br />
29 Sa Hl.Familie, Thomas v.K.<br />
30 So Hermine, David, Reiner<br />
1917 Volksmusik aus dem Böhmerwald bearbeitet und neu gesetzt hat Karl Beck<br />
aus Eleonorenhain. Mit der „Neustadter Geigenmusi“ wirkte er auch an der Schallplatte<br />
„Nun brennt der Mond geruhig“ mit.<br />
3 Mo Franz Xaver<br />
4 Di Barbara, Petr., Joh.v.D.<br />
5 Mi Gerald, Julius, Judith<br />
6 Do Nikolaus<br />
7 Fr Ambrosius, Agate<br />
8 Sa Mariä Empf., Edith<br />
9 So 2.Advent, Valerie, Joachim, Peter<br />
1917 Obmann der Heimatgruppe Aalen, Bundesjugendleiter der<br />
Böhmerwaldjugend, Autor von “Gefild in den schwarzen Bergen”, Herrgottschnitzer<br />
und manches andere mehr: Konrektor Gustav Schuster aus Außergefild<br />
(19. 9. 1917 - 26. 7. 1995) war auf den verschiedensten kulturellen und kulturpolitischen<br />
Ebenen für die <strong>Böhmerwäldler</strong> aktiv.<br />
1 Sa Natalie, Erich, Edmund<br />
2 So 1.Advent, Luzius, Herta, Pauline,<br />
Brunhilde<br />
17 Mo Lazarus, Hilde, Jolanda<br />
18 Di Wunibald, Christoph<br />
19 Mi Konrad, Thea, Urban V.<br />
20 Do Christian, Christina, Eugen<br />
21 Fr Thomas, Ingomar<br />
22 Sa Jutta, Beate, Demetrius<br />
23 So 4.Advent, Viktoria, Dagobert<br />
1917 Als Heimatverbliebene - ihre Angehörigen wurden als Facharbeiter benötigt<br />
- war die Lehrerin Rosa Tahedl (geb. am 10. 8.1917) bis 1964 in den Wäldern<br />
um Guthausen als Waldarbeiterin tätig. in zahlreichen Aufsätzen, aber auch<br />
mit ihren Buchveröffentlichungen “Sternreischtn” und “Abenteuer unter dem<br />
Roten Stern” sowie “Van Wold bin i ausser” hat sie ihrem Heimatort und dessen<br />
Mundart ein unvergängliches Denkmal gesetzt.<br />
Christmond, 31 Tage<br />
Dezember<br />
1907 Am 17. 4.1907 wurde in Rosenthal die Komponistin Hilde Hager-Zimmermann<br />
geboren. Auch Lyrik von Dichtern des Böhmerwaldes hat sie vertont,<br />
wie z. B. „Da ewi Brunn“ oder „Unter einer Föhre“.<br />
1897 Felix Schuster (geb. am 7.10.1897 in Unterreichenstein) gründete nach<br />
sei-nem Prager Studium die Künstlergilde Krummau und war auch nach der Vertreibung<br />
künstlerisch gestaltend für die <strong>Böhmerwäldler</strong> tätig.<br />
1887 Josef Bürger, geboren am 24.11.1887 in Rindles bei Oberplan, hat sich als<br />
Forscher für Heimatkunde und Brauchtum einen Namen gemacht und wirkte<br />
maßgeblich am Aufbau des Böhmerwaldmuseums Passau mit.<br />
1867 Am 10. 9. 1967 verstarb der in Friedberg geborene Tondichter, Musikschriftsteller<br />
und Hoforganist Simon Sachter. Zu seinen Schülern gehörten Musiker<br />
von internationalem Rang wie zum Beispiel Anton Bruckner.<br />
1867 Af d’Wulda. . . „ - der Text dieses bekannten Böhmerwaldliedes stammt von<br />
Gymnasialprofessor Anton Wallner, geboren am 28. 1. 1867 in Pichlern bei Oberplan.<br />
Denkwürdiges 1997<br />
Gunther Fruth:<br />
Wintersonne<br />
Elfriede Fink
18<br />
19<br />
1965 schrieb Viktor Aschenbrenner: „Reichtum und Vielfalt des kulturellen Lebens<br />
sind letztlich Maßstäbe für Wert und Lebenswillen einer Volksgruppe, die<br />
als Teil einer höheren Einheit nicht nur ein Anrecht auf Eigenleben und Pflege<br />
der Eigenart besitzt, sondern die Pflicht dazu hat. Denn diese kulturellen Elemente<br />
sind es, aus denen sich das großartige Mosaik des Volkes, der Völker und<br />
schließlich der Menschheit überhaupt zusammensetzt. Es bedarf keiner besonderen<br />
Betonung, dass die Besinnung auf die kulturellen Kräfte und die Heimat vom<br />
Geist der Versöhnung getragen ist.“<br />
Ingo Hans, Bundesvorsitzender<br />
Geleitwort<br />
Ingo Hans<br />
1987 Franz Nagelmüller aus Oberlichtbuchet (gest. am 7. 6. 1987) machte<br />
sich vor allem als Holzbildhauer einen Namen. Beispiele seines Könnens<br />
wurden auch im <strong>Jahrbuch</strong> der <strong>Böhmerwäldler</strong> veröffentlicht.<br />
1987 Waldstücke, Porträts, zeitkritische Gemälde sowie Allegorien zum<br />
Thema Böhmerwald, gestaltete der Kunstmaler Lothar Sperl aus Dorf<br />
Eisenstein, gestorben am 14. 3. 1987.<br />
Als 1964 das erste <strong>Jahrbuch</strong> erschien, hatte sich bei den vertriebenen<br />
<strong>Böhmerwäldler</strong>n das Alltagsleben weitgehend normalisiert. Mein Vater, Prof. Erich<br />
Hans, der die Idee für den Almanach hatte, wollte mit dieser Publikation das<br />
geschichtliche Erbe und die vielfältige kulturelle Leistung der <strong>Böhmerwäldler</strong> in<br />
Vergangenheit und Gegenwart wieder ins Bewusstsein rücken. Diesen „Kulturauftrag“<br />
hat mein Bruder, Günther Hans, nach dem Tod unseres Vaters 1986 übernommen.<br />
Dafür möchte ich ihm im Namen aller <strong>Böhmerwäldler</strong> von Herzen danken.<br />
Denn nur durch die Herausstellung, dass das kulturelle Schaffen der<br />
<strong>Böhmerwäldler</strong> in Vergangenheit und Gegenwart auf die alte Heimat bezogen ist,<br />
wird die Vertreibung und der Heimatverlust in ihrer tiefen Bedeutung und Auswirkung<br />
– über die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme hinaus –<br />
erkennbar.<br />
1987 Rudolf Schinko gest. 5. 1. 1987 in Waldkirchen) war langjähriger<br />
Geschäfts-führer und Verlagsleiter der Zeitschrift der <strong>Böhmerwäldler</strong> „Hoam!“<br />
und Mitbegründer des Adolf-Webinger-Hauses in Lackenhäuser.<br />
1977 Durch Gedichtbände wie “Woldbauernjohr” oder “Woldsträußla” wurde<br />
der Mundartdichter Karl Winter (gest. am 25. 7. 1977) bekannt. In dem Band<br />
“Wia(r) uns da Schnobl gwochsn is”, hat er die Mundart des Bergreichensteiner<br />
Landes dokumentarisch festgehalten.<br />
1947 Hilde Bergmann, Lyrikerin von großer Aussagekraft aus Prachatitz, emigrierte<br />
1938 zusammen mit ihrem Mann nach Schweden, wo sie am 22. 11. 1947<br />
verstarb.<br />
1927 In Wallern wurde am 7. 8. 1927 Helma Flügel-Kössl geboren, eine Porträtund<br />
Landschaftsmalerin im Stil des romantischen Realismus’.<br />
Die Unbillen der Vertreibung mit dem Verlust vorgegebener bürgerlich – existenzieller<br />
Lebensgrundlagen und die Notwendigkeit des individuellen Aufbaus neuer<br />
Existenzen mit unvorhergesehenen Lebensgeleisen ließen erkennen, welch kreative<br />
Kraft im Menschen aus dem Wald vorhanden war. Diese Kreativität aus der<br />
Not heraus erinnerte an jene deutschen Kolonisten und Kultivatoren, die, vor<br />
Jahrhunderten von böhmischen Herzögen nach Böhmen und Mähren gerufen,<br />
vor allem in den gebirgigen Randgebieten des böhmischen Kessels „aus der grünen<br />
Wurzel“ durch Rodung und Bodenbearbeitung siedlungsfähige Plätze, Ortschaften<br />
und Städte schufen. Die späten Nachfahren der ersten Deutschen in<br />
Böhmen und Mähren, die nach einer erzwungenen Wanderbewegung mit 30 kg<br />
Gepäck auf dem Rücken oder auf dem Leiterwägelchen in ein darniederliegendes<br />
Nachkriegsdeutschland kamen, mussten Lebenskünstler im ursprünglichen Sinn<br />
des Wortes sein, wollten sie nicht verelenden, verkommen, verhungern. Sie vereinten<br />
Phantasie und Manuelles, erwiesen sich als Pioniere im Täglichen und im<br />
Ideologischen – und meisterten nicht allein ihr eigenes Schicksal, bauten vielmehr<br />
als Neubürger mit den Altbürgern Deutschland wieder auf.<br />
und im australischen Adelaide. Seine Farbwege, begehbaren Plastiken, Stadtzeichen<br />
sind Ausdruck urbaner Zivilisation - nicht zufällig verzichtet der weltbekannte<br />
Künstler auf die Farbe grün.<br />
Jedes <strong>Jahrbuch</strong>, das bisher erschienen ist, war ein publizistisches Forum für die<br />
geistige, künstlerische und folkloristische Artikulierung der <strong>Böhmerwäldler</strong> Volksgruppe.
20<br />
21<br />
Nun, so bist du auch entschwunden,<br />
kurze, himmelsvolle Nacht.<br />
O wie leicht sind deine Stunden<br />
und wie luftig durchgemacht!<br />
Alle Wesen, die da leben,<br />
weckt der Morgen aus der Ruh.<br />
Uns kann er nur Ruhe geben,<br />
unsere Augen schließt er zu.<br />
Morgens nach dem Balle<br />
Adalbert Stifter<br />
Heut’ war’s schö Wetta, hot oana denkt<br />
und hot sei Vertrau’n da Bundesbahn g’schenkt.<br />
Er schaut am Fahrplan, _ dass a ebs werd -<br />
wann und wia a Zug verkehrt.<br />
Kaft si a Kart’n, steigt in Zug ei ohne Frog’,<br />
schaut auf koa Richtungsschild - nur auf d’ Lok.<br />
Da Zug fahrt an, do hot er’s g’merkt<br />
Das dös die and’re Richtung werd.<br />
Er möchte - so kimt’s eahm für -<br />
aussi ni schöl bei da Tür,<br />
rennt zam mit’m Schaffner und schreit den o,<br />
dass ma a so nit wegfah’n ko.<br />
„D’ Lok is hint’n“ - schreit er entsetzt.<br />
„da ganze Zug verkehrt zamg’setzt“!<br />
In aller Ruah wird er vom Schaffner belehrt.<br />
Warum der Zug verkehrt verkehrt.<br />
Wenn Fasching war, daheim im Wald, hatten auch die Bräuche ein närrisches<br />
Gesicht. Nicht, dass da schon am Tag des heiligen Hilarius das Werken in den<br />
Wirtshäusern angefangen hätte, wie anderwärts; der Mummenschanz blieb hübsch<br />
um die eigentliche Fastnacht gerückt, wenn es auch öfter einmal eine Hochzeit<br />
gab und vom Eisensteiner Pfarrer sogar die Rede ging, dass er jetzt kaum noch<br />
Zeit hätte, sich die Virginier anzuzünden, vor lauter Brautleuten, Einschreiben,<br />
Verkünden und Trauen. Aber die närrische Zeit kam auch dem Waldler schon<br />
bald nach Dreikönig zwischen die Finger; sie ließ ihn allerhand tun, an das er<br />
sonst nicht dachte, und sie kicherte durch die Rockenstuben, wo sich die Spinnräder<br />
und die Mäuler emsiger rührten. Die Abende wurden jetzt schon kürzer und<br />
die Weiberleute mühten sich, die Flachsrocke abzuspinnen, damit ihnen nicht<br />
„der Fasching drein kam“. Hing am „gumperten Pfinsta“ noch ein Fetzen Werg<br />
am Rocken, bekam die faule Spinnerin ihr lebtaglang keine Hochzeiter. Die Bäuerin<br />
schaute auch darauf, dass Rad und Rocken zumindest am „rußigen Freitag“<br />
schon auf dem Dachboden gut versteckt wurden; denn wer in der hohen Faschingszeit<br />
über einen Spinnrocken schauen musste, dem liefen im Sommer alle Schlangen<br />
über den Weg.<br />
In diesen närrischen Wochen schlichen die Hütbuben, die Vogelnestsucher, an<br />
jedem Dienstag früh gern in den Hühnerstall und schliffen ihre Taschenfeitel am<br />
Hühnerbarren; wenn sie dann am Faschingsdienstag vor Sonnenaufgang unterm<br />
Tisch hockten und schöne, lockige Späne von einem fichtenen Klotz schnitzeln<br />
konnten, fanden sie im Sommer viel Nester. Bei jeder „Schoitn“, die sich so vom<br />
Klotz ringelte, nannten sie ein anderes Vogelnest: „Du bringst ein Dorngreilnest -<br />
du ein Grasmückennest - du ein Baumhackelnest.“ Wenn einer aber dabei erwischt<br />
wurde, musste er die ganze komisch Beschwörung um Mitternacht noch<br />
einmal probieren. (Aus: Leo Hans Mally, Der alte Böhmerwald)<br />
Verkehrt verkehrt<br />
Karl Halletz<br />
Wie getragen, Mädchen, schwebte<br />
ich an deinem Herzen hin,<br />
eine jede Pulse bebte:<br />
Liebe, liebe Tänzerin!<br />
Doch durch meine Fenster blinket<br />
schon aufs Bett das Morgengold<br />
und das matte Auge sinket -<br />
Gott der Träume, sei mir hold!<br />
Waldfasching<br />
Leo Hans Mally<br />
O wie selig will ich träumen,<br />
alles will ich wieder sehn,<br />
wieder mich in hellen Räumen,<br />
mich in lieben Armen drehn.<br />
Wieder will ich dich umschlingen<br />
in des Traumes Phantasien.<br />
Und durch süßes Flötenklingen<br />
fliegen wir im Tanze hin.
22<br />
23<br />
Lous und schau und sa gounz stad!<br />
Weil, wenn ma oamol d Wiesn maht,<br />
iss mit der Bliah und min Gsaung goa.<br />
Muaßt woachtn wieder a gounz Joahr.<br />
Als unser Erlöser Jesus Christus von Gott und der Welt verlassen am Kreuz auf<br />
Golgatha hing und alles Leid der Welt bei ihm in seiner Einsamkeit gesammelt<br />
war, da flog plötzlich ein kleines Vöglein herbei. Ein Kreuzschnabel erbarmte<br />
sich des Leidenden und versuchte mit seinem Schnäbelchen die Nägel aus den<br />
Handwunden zu ziehen.<br />
Als ihm das trotz aller Mühe nicht gelang, und sein Schnabel schon ganz verbogen<br />
war, rief es seinen Verwandten, den Gimpel zu Hilfe: „Komm Gevatter! Hilf<br />
mir das Leiden unseres Herrn zu lindern.“<br />
Sogleich flog auch der Gimpel herbei und zerrte mit seinem kräftigen Schnabel<br />
an den Nägeln. Mit aller Kraft zogen die beiden Vögel und dabei durchtränkten<br />
die blutenden Wunden Jesu das Brustgefieder der beiden Tiere, welche sich so<br />
hilfreich abmühten. Alle Mühe war vergebens; jedoch blieb dem Kreuzschnabel<br />
und seinen Nachkommen bis heute sein gekreuzter Schnabel und dem Gimpelgeschlecht<br />
der rote Brustfleck erhalten.<br />
Doch auch aus der Pflanzenwelt kam ein Zeichen des Mitfühlens, zwischen den<br />
Keilen, welche das Kreuz im Erdreich festhielten, spross ein grüner Keim mit<br />
feinen Blattfingern immer höher am Kreuzesstamm empor. Grüne Spiralen klammerten<br />
sich wie Stricke um das Holz, eine dichte Krone der Hüllblätter umzog<br />
die Blüte wie die Dornenkrone das Haupt Jesu, und im Kelch der Blüte zeigten<br />
sich die Staubgefäße wie braune Nägel. Die Passionsblume war als erster Schmuck<br />
des Kreuzstammes geboren.<br />
Und als der Felsen von Golgatha im Erdbeben erzitterte und tiefe Spalten den<br />
Boden durchpflügten, drangen lange Weidenruten aus allen Rinnen und ihre<br />
Zweige füllten sich mit silberigen Kätzchen, so dass unschuldiges Weiß um den<br />
Trauerhügel funkelte.<br />
Wie der Sieg des Erlösers über den Tod, so breitete die Natur neues Leben über<br />
die Stätte des größten Opferganges der Welt. Frisches Leben legte die Natur damals<br />
über Hass und Zerstörung durch die Menschen. Und wie es damals bei Tieren<br />
und Pflanzen war, so ist es bis heute geblieben.<br />
Der Natur wurde vom Schöpfer Macht gegeben, jedes Vernichtungswerk der<br />
Menschen mit neuem Leben zuzudecken. Sie bleibt der Sieger über Not und Zerstörung.<br />
Der Kerschbam bliaht, der oldi, af und af.<br />
Wia frischer Schnee lads af dej Astln draf.<br />
Und d Saubloaman erscht! Gounz geab leichts her.<br />
Lousin is, Mejnsch, gfrei di nea! —<br />
Sou schej iss daußat hiaz in Mai.<br />
D Starl pfeifnt, in Gugatscha heast glei<br />
van Hülzl her und va da tauin Wies<br />
steigt mit der erschtn Sunn a Lerei af gounz gwies.<br />
Gfrei di nea<br />
Anna Kangler<br />
(Aus: Waldheimat, Mai 1929)<br />
Breitend die allmächt´gen Hände<br />
Schenkte Gott gleich Baum um Baum<br />
Wonn´ge weiße Blütenspende,<br />
Uns des Lenzes Märchentraum.<br />
Wie mit flehentlicher Geste<br />
Baten noch vor kurzer Zeit,<br />
Streckend ihre kahlen Äste,<br />
Gott sie um ein Frühlingskleid.<br />
Bräutlich alle Bäume prangen,<br />
Schneeig weiß im Festgewand<br />
Stehn sie da wie traumumfangen,<br />
Frühling zog erst kaum ins Land.<br />
Eine Osterlegende<br />
Baumblut<br />
Rosa Tahedl<br />
Mila Czaftka
24<br />
25<br />
Die Nacht vom 30. April zum 1. Mai ist die Walpurgisnacht. Unsere Ahnen nannten<br />
sie auch Hexennacht. Einem alten Volksglauben nach reiten in dieser Nacht<br />
die Hexen auf einen Besen durch die Lüfte. Nach altem Volksglauben heißt es,<br />
wer in dieser Nacht zwei geerbte Eggen kreuzweise gegenüber stellt, der kann<br />
die Hexen reiten sehen. Sie reiten zu den Bergen und tanzen dort den letzten<br />
Schnee weg, anschließend ziehen sie in alle Richtungen von dannen und richten<br />
überall Schaden an. Um diese bösen Geister zu vertreiben, werden auf den Höhen<br />
Feuer anzuzünden. Das Feuer muss möglichst weithin zu sehen sein. Es heißt<br />
so weit das Feuer leuchtet sind die Hexen machtlos. Die Felder werden im kommenden<br />
Sommer fruchtbar sein, wenn der Lichtschein darauf fällt oder der Feuerrauch<br />
darüber hinweg zieht. Die Burschen wickeln um alte Besen Stroh oder<br />
Holzwolle, brennen sie an und schleudern sie fort so weit sie können.<br />
Warum diese Nacht der heiligen Walpurga gewidmet ist, das konnte nie geklärt<br />
werden. Wahrscheinlich liegt ein vorchristliches Frühlingsfest zugrunde. Eine<br />
altgermanische Göttin stand dabei wahrscheinlich im Mittelpunkt, auf die der<br />
Name Walpurga übertragen wurde. Es gibt noch eine zweite Version, Walpurga<br />
soll am 1. Mai heilig gesprochen worden sein und bekam den Vorabend darauf<br />
gewidmet. Die Heilige wurde 710 in England geboren und starb am 25. Februar<br />
780 in Heidenheim. Seit dem Mittelalter wird sie als Beschützerin der Feldfrüchte<br />
und der Heilkräuter verehrt. Sie soll gegen die Zaubernächte der Hexen Schutz<br />
Hilfe bringen und Hilfe gegen die Pest geben. Dem Volksglauben nach ist die<br />
Walpurgisnacht voller Geheimnisse. In der Nacht soll Türen und Fenster geschlossen<br />
halten. Überhaupt spielt das Geschehen der Nacht im Jahresverlauf eine besondere<br />
Rolle. Im Erzgebirge und im Egerland legte man zum Schutz vor Hexen<br />
einen Besen vor die Tür. Über Nacht sollte keine Wäsche draußen bleiben, damit<br />
sie die Hexen nicht besudeln konnten. Die Bauern räumten alles überflüssige<br />
Gerät vom Hof, besonders die Besen, damit die Hexen nicht weiter reiten konnten.<br />
Zeitig hat man am Abend die Kühe gemolken und den Stall in Ordnung gebracht.<br />
Licht durfte dabei nicht gemacht werden, damit hätte den Hexen der Weg<br />
gezeigt werden können. Dem Vieh gab man neunerlei Kräuter vermischt mit Mehl<br />
und Salz zum Fressen. Wenn die Bäuerin um Mitternacht anfing zu buttern, sollte<br />
sie fortan immer reichlich Butter haben. Aber wenn nach Sonnenuntergang noch<br />
Milch verkauft wurde, dann konnte das Vieh verhext werden.<br />
Von diesem alten Aberglauben ist lediglich die Erinnerung geblieben. Erhalten<br />
aber hat sich das Hexenfeuer, das mancherorts von der Jugend am 30. April bei<br />
Einbruch der Dunkelheit entzündet wird. Die Feuer der Walpurgisnacht leuchten<br />
weithin sichtbar auf und stimmen auf den 1. Mai ein.<br />
In den Höhenlagen bis zu 700 Meter, zu denen neben den Vorbergen die Flusstäler<br />
der Moldau bis Salnau, das Blanitztal, das Wottawatal bis Unterreichenstein<br />
und das Angeltal bis Neuern gehören, herrscht das Ackerland vor, obzwar die<br />
Talsohlen von Wiesen eingenommen werden. Das Hügelland trägt an steilen<br />
Hängen und Kuppen Kiefernbestände. Daneben treten Weißbirken auf. In den<br />
Höhenlagen von 700 bis 1100 Metern, zu denen die Hochflächen und auch die<br />
meisten Kämme zählen, tritt der Wald in den Vordergrund und neben grünen<br />
Wiesenflächen dehnen sich Hutweiden und Filze.<br />
Die Wälder dieser Region stellen das ausgedehnteste Waldgebiet Mitteleuropas<br />
dar. Die Mischwälder der tieferen Lagen setzen sich aus Tannen, Fichten und<br />
Pflanzen und Tiere des Böhmerwaldes<br />
Erich Hans<br />
Kon daitn, koa Rucka -<br />
ruahi han d’Hejnd,<br />
dej eana gounz Lejm<br />
nea d’Oarwat houm kejnt.<br />
Ban Betn hans stad gwejn<br />
houm ziadat - a wejng,<br />
s’ Herz hots schlon af gheacht<br />
d’ Söl hot si trennt.<br />
Is afi in Himml<br />
furt va da Erd’ -<br />
zruck za san Herrgoutt<br />
wia sa si g’heacht.<br />
Da Kreuzwejg is gounga.<br />
S’ Plogn hot a End.<br />
Betn werds weida<br />
i da Ewigkeit drent.<br />
D’ Liab va da Muatta -<br />
dej vaoawatn Hejnd<br />
wean uns mounchis mol dejtn<br />
va da Ewigkeit drent.<br />
Volksglaube um die Walpurgisnacht<br />
D’Muattahejnd<br />
Ernst Braun<br />
Karl Halletz
26<br />
27<br />
Buchen, aber auch Ahornen, zusammen. Zwischen ihnen wuchert Unterholz und<br />
verschiedenes Gesträuch. Mit steigender Höhenlage treten die Laubbäume zurück,<br />
bis schließlich zunächst Tanne und Fichte bestandbildend sind und zuletzt,<br />
von 1100 Metern aufwärts, nach und nach die Fichte allein herrscht. Wo die Wälder<br />
nicht zu dichtständig sind, beleben Farne und Gras den Waldboden.<br />
Moospolster überziehen Felstrümmer, Flechten hängen, besonders in höheren<br />
Lagen, von dem Geäst der Bäume herab. In den höchsten Bereichen wird auch<br />
der Fichtenwald kümmerlicher, von Wind und Wetter zerzauste, nur nach Osten<br />
zu beästete Kümmerfichten, deren Wipfel oft ganz kahl sind, behaupten sich noch,<br />
bis auch sie, wie am Arber, schließlich keine Lebensmöglichkeit mehr finden.<br />
Dort treten dann Latschenfelder und Hochwiesen auf. Aber Latschenfelder entwickeln<br />
sich auch dort, wo, wie an den Hängen des Plöckensteins und Dreisessels<br />
und wie am Lusen, das Steingeblock dem Wald noch keine Lebensmöglichkeit<br />
bietet. In Schlägen und sonstigen Kahlflächen sind Beerensträucher verbreitet:<br />
Heidelbeeren, Himbeeren, Preiselbeeren und Brombeeren locken in ihrer Reifezeit<br />
die Sammler.<br />
Die Filze der Täler und Hochflächen sind waldfrei. Hier herrschen Moose und<br />
Heide, Sumpfheidelbeere, Ried- und Sauergräser. Häufig ist der Sonnentau. Zwerghafte<br />
Sträucher, Bergföhre, Zwergbirke und Zwergweide finden ein Fortkommen.<br />
Ortsnamen wie Wolfsgrub, Wolfsau und Bärnloch erinnern daran, dass im<br />
Böhmerwald früher auch gefährliches Wild lebte. Der letzte Bär wurde am 11.<br />
November 1856 im Revier von Salnau geschossen, der letzte Wolf fiel 1756,<br />
doch wurde im Ferchenhaider Revier noch am 3. Dezember 1874 ein Wolf erlegt,<br />
der aber nicht einheimisch war. Auch der Luchs ist aus dem Böhmerwald verschwunden,<br />
später auch die Wildkatze. Schwarzwild traf man in freier Wildbahn<br />
nicht mehr. Das Hirschwild wurde im vorigen Jahrhundert fast ausgerottet. Die<br />
Fürst-Schwarzenbergische Verwaltung setzte im Schutzgebiet des Kubani eine<br />
neue Zucht an.<br />
Fast ausgerottet war zu Zeiten auch das Reh, doch haben sich in den Forsten von<br />
Großwaldbesitzern die Bestände wieder erholt. Das Kleinwild ist durch Hasen,<br />
Füchse, Dachse und Eichhörnchen vertreten.<br />
Die Vogelwelt ist artenreicher. Goldammer, Sperling und Ringdrossel sind häufig.<br />
Spechte und Kuckuck., Meisen, Lerchen, Bachstelzen, Drosseln, Zaunkönig,<br />
Rotschwänzchen, Tannenhäher, Raben, Krähen, Stieglitz, Gimpel, Kreuzschnabel,<br />
Haselhuhn, Auerhahn, Birkhuhn, Sumpfschnepfe, Wildgans, Wildente, Lappentaucher<br />
und Eisvogel, daneben im Herbst die Wacholderdrossel, sind zu nennen.<br />
Neben ihnen leben, freilich nur im Sommer, zahlreiche Zugvögel. Charakteristisch<br />
für den Böhmerwald ist das Auftreten der Habichtseule.<br />
Ausgesprochen arm ist der Böhmerwald an Kriechtieren und Lurchen, von denen<br />
die Blindschleiche, die Ringelnatter, die Kreuzotter, Eidechsen, Molche, Frösche<br />
und Kröten zu erwähnen sind.<br />
Auf der Eisenbahnstrecke Strakonitz – Winterberg - Wallern liegt in der Mitte<br />
eines mit bewaldeter Gebirgslandschaft umgebenen Tales die über dreitausend<br />
Einwohner zählende Stadt Wolin. Deren Gegend hat dem Geologen J.B. Zelizko<br />
während seiner mehr als zwanzigjährigen Forschungen, über die er bereits in<br />
verschiedenen Fachblättern berichtete, viele Funde urzeitlicher Tierwelt geliefert,<br />
sodass sie unter den mitteleuropäischen Funden heute (1933) die erste Stelle<br />
einnehmen.<br />
Die Funde beweisen, dass in der so genannten Diluvialperiode, in der die Gipfel<br />
der benachbarten Berge Kubani, Libin, Schreiner u.a. noch in eine mächtige Eisund<br />
Schneedecke gehüllt waren, ein reges Tierleben in den Niederungen des<br />
Die Tierwelt der Urzeit im Böhmerwald<br />
NN<br />
Die Bäche und Flüsse bieten der Forelle, aber auch dem Lachs gute Lebensmöglichkeiten.<br />
Karpfen werden in Teichen gezogen. In Bächen und Gräben ist<br />
der Flusskrebs häufig.<br />
Als gefährlicher Feind des Waldes erwies sich der Fichtenborkenkäfer, der<br />
besonders nach den Sturmjahren 1868 und 1870 in der Zeit von 1871 bis 1875<br />
weite Waldbestände vernichtete (bearbeitet nach Schreiber, aus: Erich Hans, Der<br />
Böhmerwald)<br />
Wildschweine im dichten Urwald des Kubani. Foto: Josef Seidel, Krummau<br />
(Sammlung Reinhold Fink)
28<br />
29<br />
Die Zucht von Edelpelztieren, in erster Linie der wertvollen Silberfüchse, hat,<br />
wie in fast allen europäischen Ländern, die sich hierfür überhaupt eignen, auch in<br />
Böhmen Aufmerksamkeit erweckt, zumal sich zahlreiche Lagen sehr gut für die<br />
Pelzentwicklung dieser Tiere eignen.<br />
So wurde auch in der unmittelbaren Nähe Egers inmitten sagenumwobenen Tillens,<br />
des letzten Ausläufers des Böhmerwaldes, unweit des Alpenvereinsschutzhauses<br />
in ruhiger Lage in 740 m über dem Meere von einigen Egerer Herren im Sommer<br />
Die Zucht von Silberfüchsen am Tillenberg<br />
Christof Pötzl<br />
Wolinkagebietes herrschte. In diesen lang vergangenen, einige Hunderttausende<br />
Jahre dauernden Zeiträumen, als in der betreffenden Gegend ein Klima überwog,<br />
das heutzutage in den teilweise nördlichen Eisregionen oder nordsibirischen Steppen<br />
existiert, weidete an den eisfreien Stellen das sibirische Nashorn, dem dann,<br />
als die Gegend sich in eine Grassteppe allmählich verwandelte, zahlreiche Rudeln<br />
des kleinen Wildpferdes (Equus Przewalski), das bis heute in den innerasiatischen<br />
Steppen lebt, folgten. Die eiszeitliche Tierwelt vervollständigte der<br />
Schneehase, der Halsband- und Obische Lemming, das Schneehuhn und andere,<br />
die vom Polarfuchs, Hermelin, Iltis und anderen Räubern verfolgt waren. Die<br />
großen Tiere wurden wiederum von Wölfen, Löwen und Füchsen gejagt. Zahlreiche<br />
Knochen der erlegten Tiere weisen von den Raubtieren stammende Bissspuren<br />
auf.<br />
Die Reste aller hier angeführten Tiere fand Geologe Zelizko in der Gegend von<br />
Wolin. Durch seine Forschungen wurde festgestellt, dass im Vorgebirge des<br />
Böhmerwaldes seit der vierten Eiszeit ein bunter, ununterbrochener Tierwechsel<br />
infolge der klimatischen Verhältnisse stattfand. Außer den eiszeitlichen Vertretern<br />
war hier auch besonders die Steppentierwelt entwickelt, welche die<br />
typischesten Arten darstellt, so den Pfeifhasen, den Steppeniltis, den rötlichen<br />
Ziesel, die sibirische Zwiebelmaus, den Reißhamster usw. Zahlreiche Wildkatzen,<br />
Luchs, Marder, Dachs, Fischotter, Nagetiere und Vögel schließen die Reihen<br />
dieser Fauna, von welchen über hundert Arten festgestellt wurden, abgesehen<br />
von zahlreichen Schneckenformen.<br />
Reste dieser so zahlreichen in der Gegend von Wolin vorkommenden Tiere wurden<br />
in dem mit Schotter und Lehm verschütteten Schlupfwinkel der Raubtiere<br />
gefunden. Die Raubtiere verschleppten die einzelnen Teile der gejagten Beute<br />
und die Kadaver größerer Säuger in ihre Verstecke. Die in den so genannten Nestern<br />
angehäuften Mäusereste hat wahrscheinlich die Schneeeule oder ein anderer<br />
Raubvogel hinterlassen. Außerdem sind noch andere Möglichkeiten für die<br />
Massenanhäufung der Knochen vorhanden. (Aus: Waldheimat, 1/1933)<br />
1926 die „Erste Böhmerwald-Edelpelztierfarm Mayer & Co.“ Nach kanadischem<br />
Muster errichtet. Die derzeit (1930) umzäunte Farmfläche beträgt 3.4 ha und ist<br />
bis über 8 ha auf einem Grundstück erweiterungsfähig. Das Gelände wurde vom<br />
ersten europäischen Sachverständigen auf diesem Gebiet, Herrn Universitäts -<br />
Professor Dr. Demoll begutachtet und sowohl bezüglich der Bodenbeschaffenheit<br />
und Hangrichtung als auch in Bezug auf Luftfeuchtigkeit und Klima als vorzüglich<br />
geeignet für die Silberfuchszucht erklärt. Auch die Gehege und Umzäunungen<br />
wurden nach Dr. Demolls Vorschlägen gebaut. Die Farmanlage liegt an<br />
einem sanften Nordwesthang, die Anfuhrwege sind bequem und die Bahnstationen<br />
Bad Königswart und Eger mit Pferdegespann in 2 bis 2 ½ Stunden erreichbar. Zu<br />
Fuß kann man von den Stationen Lindenhau und Sandau in 1-1 ½ Stunden auf<br />
schönen markierten Touristenwegen zur Farm kommen. Im November 1926 wurden<br />
vier Paare Silberfüchse in diese Farm zur Zucht eingesetzt. Es sind dies zwei<br />
Altfuchs- und zwei Jungfuchspaare, davon bereits zwei Tiere eigener Zucht. Die<br />
Tiere sind mit Ausnahme eines erst 1926 aus Kanada eingeführten Jungfuchspaares<br />
seit 1925 in Europa akklimatisiert, da sie in einer mittelfränkischen Farm zur<br />
Zucht angesetzt waren. Beim Ankauf der Zuchttiere wurde auf allerbestes Material<br />
das größte Gewicht gelegt. Die Tiere stammen von höchstprämiierten Eltern<br />
ab und sind seit vielen Generationen in Farmen gezüchtet.<br />
Die Zucht der Silberfüchse wurde zuerst in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts<br />
von kanadischen Trappern versucht, denen es aber erst nach Jahren gelang,<br />
sie erfolgreich durchzuführen. Der Hauptgrund zur Zucht dieser Edelfüchse<br />
lag darin, dass sie in der freien Wildbahn infolge all zu starken Nachstellungen<br />
immer seltener wurden und ein sehr hoher Preis für die Bälge bezahlt wurde.<br />
Während noch im Jahre 1894 viele Tausende solcher Pelze auch nach Europa,<br />
besonders nach London zur Versteigerung kamen, wurden im Jahre 1925 nur<br />
mehr 34 Silberfuchs-Wildfelle eingeliefert, alle übrigen waren Farmbälge. Die<br />
ersteren spielen also auf den Welthandelsplätzen für Edelpelze keine Rolle mehr<br />
und wenn nicht in den Farmen für die Produktion dieser edelsten Pelze gesorgt<br />
würde, wären diese im freien Handel längst verschwunden. Die Farmfelle sind<br />
übrigens, da Fütterung und Haarpflege auf eine erstklassige Fellerzeugung eingestellt<br />
sind und das Tier dann getötet werden kann, wenn es tatsächlich den Pelz<br />
am besten entwickelt hat, viel schöner und daher wertvoller als Wildfänge. In den<br />
Vereinigten Staaten und Kanada bestehen heute an die 3000 Edelpelztierfarmen,<br />
welche Nerze, Waschbären, Stinktiere (Skunk), Blaufüchse, zumeist aber Silberfüchse<br />
züchten. In den Nordstaaten Europas, dann in Deutschland, Schottland,<br />
Frankreich, Böhmen, Deutschösterreich und der Schweiz, dürften erst höchstens<br />
200 Pelztierfarmen bestehen. Zahlreiche Staaten unterstützen die neu entstehenden<br />
Farmen sehr ausgiebig mit Geldmitteln, um die Einfuhr der teuren Zuchtpaare<br />
zu ermöglichen und zu Farmgründungen anzuregen, damit nicht Millionen<br />
für Edelpelze ins Ausland wandern müssen. Japan wie Estland fanden je eine aus<br />
dem Staatssäckel bezahlte Studienkommission auf ein halbes Jahr nach Kanada.
30<br />
31<br />
Wie viele tausend Silberfüchse noch gezüchtet werden müssen, um bloß jede<br />
zehntausendste Dame damit bekannt machen zu können, kann man erst ermessen,<br />
wenn man bedenkt, dass heute unter vielen, vielen tausend Menschen auf der<br />
Welt kaum einer den echten Silberfuchspelz kennt. Zumeist stellt man sich denselben<br />
als ein silbergraues Fell vor, wie die aus Kanin oder anderen Fellen nachgeahmten.<br />
Diesen Eindruck gewann ich bei allen Besuchern der Farm. Der Silberfuchs,<br />
richtig Silberschwarzfuchs (Silber black fox), ist jedoch herrlich tief<br />
blauschwarz gefärbt mit einem wunderbaren silberigen Schimmer an Lendenund<br />
Oberrückenpartien, sowie um die Lichter. Das Ende der Lunte ist rein weiß<br />
gefärbt. Die Silberung auf den genannten Körperteilen – sie könnte auch durch<br />
Züchtung auf den ganzen übrigen Körper ausgedehnt werden (wird aber am Weltmarkt<br />
nicht gewünscht), entsteht dadurch, dass die langen Grannenhaare auf zwei<br />
Drittel der Länge tiefschwarz, dann ein Sechstel rein weiß und am obersten Sechstel<br />
wieder schwarz gefärbt sind. Die Unterwolle muss blaugrau, darf auf keinen Fall<br />
im Winter rötlich (rostig) gefärbt sein. Es ist trotz der hochentwickelten Fellfärbetechnik<br />
noch nicht gelungen, den echten Silberfuchspelz durch Umfärben<br />
des Rotfuchspelzes auch nur annähernd nachzuahmen, schon deshalb nicht, weil<br />
die Silberung nicht am Ende der Grannenhaare, sondern im fünften Sechstel der<br />
Länge liegt, noch weniger aber deshalb, weil die sehr langen Grannen an Nacken<br />
und Vorderrücken des Rotfuchs fehlen und nicht durch längere ersetzt werden<br />
können, wenigstens nicht so, dass man es nicht als Nachahmung erkennt. In<br />
Amerika ist es allgemein üblich, dass sich Tierfreunde, die keine eigene Farm<br />
errichten wollen, an den Gewinnern der Edelpelztierzucht aber teilnehmen wollen,<br />
Pensionsfüchse kaufen und in der Großfarm zur Zucht ansetzen; die Pelze<br />
der erzüchteten Tiere bilden die Zinsen. Jungfüchse wölfen ein bis drei, Alttiere<br />
zwei bis sechs Welpen. Gute und erstklassige Silberfuchsfelle wurden bei der<br />
letzten Londoner Versteigerung noch um zehn Prozent höher als auf der Frühjahrsauktion<br />
bewertet.<br />
Die derzeitige Farmanlage am Tillenberg ist auf 200m Länge und 170m Breite<br />
mit einem 1,9m hohen Stacheldrahtzaun umgeben, der die Farm nach außen absperrt.<br />
In 40m Entfernung von dieser äußeren Umzäunung läuft ein 2m hoher<br />
Bretterzaun und 2,5m davon entfernt ein 2,5m hoher Maschendrahtgeflechtzaun.<br />
Zwischen den beiden letzteren laufen nachts die sehr scharfen Wachhunde. Erst<br />
innerhalb dieses dritten Schutzzaunes befinden sich in Reihen die 130 Quadratmeter<br />
großen Doppelzwinger für die einzelnen Fuchspaare. Sowohl die letzteren,<br />
als auch der innerste Schutzzaun sind zum Schutz gegen Untergraben durch die<br />
Füchse durch ein tief in die Erde versenktes, nach innen umgelegtes, 1m breites<br />
Maschendrahtgeflecht gesichert. In jedem Doppelgehege steht ein schmucker,<br />
fester Holzbau, mit Einschließröhre und Kessel, dem Naturbau ähnlich, welcher<br />
die Fähe mit ihren Welpen aufnimmt. Der Rüde muss sich mit einem einfacheren<br />
Bau begnügen. Rüden- und Fähengehege sind durch Holzröhren miteinander<br />
verbunden, wodurch die Tiere zeitweilig nach Belieben getrennt werden können,<br />
ohne dass man sie jedes Mal einfangen muss. An den Gehegewänden sind praktisch<br />
erprobte Fütterungsvorrichtungen zur Aufnahme der Aluminiumgeschirre<br />
angebracht. Um Krankheiten und deren Übertragungen von Gehege zu Gehege<br />
zu verhüten, sind verschiedene Vorkehrungen getroffen worden. So ist für je zwei<br />
Paare ein Reservegehege vorgesehen, dass dazu dient, das eine Nachbarpaar einen<br />
Monat aufzunehmen, nachdem dessen Gehege entseucht wurde und leer steht.<br />
Hierauf wird das Reservegehege entseucht und bleibt gleichfalls einen Monat<br />
unbenutzt, worauf das zweite Nachbarpaar das Reservegehege einen Monat bezieht<br />
und so fort.<br />
Bei jeder Gehegetür sieht man eine kleine Schaufel hängen, die zum täglichen<br />
Aufnahmen der Losung (Kot) dient, und zwar nur für das betreffende Gehege.<br />
Ebenso stehen vor jeder Tür ein Paar Überschuhe, welche der Wärter in der schneefreien<br />
Zeit über seine Schuhe zieht, ehe er das Gehege betritt und gleicherweise<br />
hat jeder Fuchs sein eigenes, mit der Gehege-Nummer versehenes Fressgeschirr,<br />
all dies, um Krankheits- oder Wurmeiübertragungen von einem Gehege in die<br />
anderen möglichst hintan zuhalten. Fremde Hunde werden niemals die Farm betreten<br />
und die eigenen Wachhunde regelmäßig entwurmt und sorgfältig gepflegt.<br />
Die Fressgeschirre werden nach jeder Mahlzeit in heißem Wasser gereinigt. Jedes<br />
als Futter verwendete Fleisch wird vorher tierärztlich untersucht.<br />
Der Speisezettel der Füchse enthält allerlei gute Sachen, z.B. derzeit früh täglich<br />
einen halben Liter Milch mit je 32 Gramm gekochtem Reis und Rollgerste oder<br />
mit je 32 Gramm Haferflocken und Rollgerste, oder mit je 32 Gramm Fuchskuchen<br />
oder endlich mit je 32 Gramm Reis und Haferflocken. Abends gibt es<br />
rohes Fleisch in reicher Abwechslung, und zwar Schaf-, Rind-, Kalbfleisch, Kaninchen,<br />
Herz, Leber, Kuttel usw., aber kein Rossfleisch. Jeder Tag bringt Abwechslung,<br />
Sonntag ist Diättag – Fasttag.<br />
Dieser Küchenzettel ist nicht das ganze Jahr gleich; er ist anders in der Ranz-,<br />
anders in der Zeit der guten Hoffnung, wieder anders nach der Wölfzeit und anders<br />
in der warmen Jahreszeit, in welcher die Fleischkost zurücktritt und mehr Obst,<br />
Gemüse, Getreide, Fuchskuchen u. dgl. gereicht wird. In der schneefreien Zeit<br />
steht in jedem Gehege reines Trinkwasser bereit.<br />
Sämtliche Tiere sind an den Lauschern (Ohren) und zwar am rechten mit den<br />
Anfangsbuchstaben der Farm, am linken mit dem Anfangsbuchstaben des Rufnamens<br />
und der fortlaufenden Zahl für das ganze Leben unauslöschlich mit einer<br />
eigenen Tätowierung gekennzeichnet. Der solcherart tätowierte Fuchsbalg wird<br />
von Pelzhändlern und Kürschnern nur dann gekauft, wenn der Verkäufer dessen<br />
Herkunft nachzuweisen in der Lage ist.<br />
Diese Tätowierung dient wohl in erster Linie der Zuchtbuchführung, gleichzeitig<br />
aber auch als bewährter Schutz gegen Diebstahl, da der gezeichnete Balg durch<br />
den Dieb unverkäuflich ist, und zwar erst recht dann, wenn um die verräterische<br />
Tätowierung an den Lauschern zu entfernen, die Lauscher abgeschnitten werden<br />
sollten, denn der solcherart verstümmelte Pelz ist dann fast wertlos.
32<br />
33<br />
Da Aadara: Enterich;<br />
d Aamarin: Ammerling;<br />
d Antn: Ente;<br />
da Auahau(n): Auerhahn;<br />
da Auf, auch Rauf: Steinkauz;<br />
d Aumaroxl, d Aumpschl: Amsel;<br />
d Bamhackl: Specht;<br />
da Bamschawl: Fliegenschnäpper;<br />
d Bogstealzn, d Hoardealn: Bachstelze;<br />
da Bülghau(n), Schüldhau(n): Birkhahn;<br />
da Dachlin, s Gaugei: Dohle, Turmrabe;<br />
da Distlfink, auch Stiglitz: Distelfink;<br />
d Droschl: Drossel;<br />
d Eilin: Eule;<br />
da Fink: Fink;<br />
s Gaugei, Dachlin: Dohle;<br />
d Gau(n)s: Gans;<br />
da Gau(n)tzna: Gänserich;<br />
da Fischgeir: Möwen;<br />
da Geir: Geier;<br />
da Gimpl: Gimpel;<br />
s Giwißl: Kibitz;<br />
da Gouksch: Hahn;<br />
da Grea(n)llin: Grünling;<br />
d Grosmuggn: Grasmücke;<br />
d Grudlhein: Truthenne;<br />
da Gugatscha: Kukuck;<br />
da Guisvougl: Eisvogel;<br />
s Guldhanl: Goldhähnchen;<br />
s Gwitschei, da Kraunawittvougl:<br />
Wacholderdrossel;<br />
s Hanifei: Hänfling;<br />
da Hea(n)lgeir, auch Hawichl:<br />
Habicht;<br />
d Hea(n)r: Hühner;<br />
d Hein: Henne;<br />
d Hoardealn, Bogstealzn:<br />
Bachstelze;<br />
da Hulkrau(n): Kolkrabe;<br />
d Hultau(b)m: Holztaube;<br />
da Hulzjogl: Buchfink;<br />
da Kaunari: Kanarienvogel;<br />
s Kinigei: Zaunkönig;<br />
d Konwochtl: Wachtel;<br />
So weit die „Duchent“ reicht und der federngefüllte Kopfpolster, werden in beiden<br />
Erdhälften Federn geschlissen, vornehmlich Gänsefedern. Doch ehe ich erzähle,<br />
wie so ein Schleißabend beim Girglmathesen oder eigentlich bei des Mathesen<br />
holder Gattin absolviert wird, sei mir gestattet, vorher noch einige Worte über<br />
den Hauptlieferanten des Federnbalges zu sagen. Man sagt unüberlegter und gewohnheitsmäßiger<br />
Weise „Die dumme Gans“; die Gans ist aber nicht dumm. Man<br />
sehe sich nur einmal die Gänse in ihrem gegenseitigen Verkehr an! Wie freudig<br />
begrüßen sie eine Kameradin, welche von der Herde getrennt, wieder zu ihr zu-<br />
Beim Girglmathesn tun s´Fedrnschleißn<br />
Josef Schramek<br />
Die Volksnamen der Vögel im Böhmerwalde<br />
Anton Schacherl<br />
Außer der beschriebenen Farm am Tillenberge bestehen in der tsch. Republik<br />
noch einige deutsche und tschechische, während noch einige in Gründung begriffen<br />
sind.<br />
Alle Pelztierfarmen müssen vom Beginn der Rollzeit bis zum Absetzen der Welpen,<br />
d.i. vom 1. Jänner bis Ende Juni die Anlagen sperren, um Beunruhigungen<br />
während dieser Zeit möglichst gänzlich zu vermeiden. Ab Ende Juni wird der<br />
Zutritt zur Farm wiederum allen Interessenten gegen einen in der Geschäftsstelle<br />
erhältlichen Erlaubnisschein gerne gestattet.<br />
Überall in den Nachbarländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich,<br />
Norditalien, Dänemark, Schweden, Norwegen usw. entstehen jährlich neue Farmen<br />
und es wäre hoch an der Zeit, dass auch die heimische Land- und Forstwirtschaft<br />
diesem lohnenden Tierzuchtbetrieb die gebührende Beachtung schenkt.<br />
(Aus: Waldheimat, 2, 1930)<br />
da Krau(n): Krähe;<br />
da Kraunawittvougl:<br />
Wacholderdrossel;<br />
d Kroupftau(b)m: Kropftaube;<br />
da Krumpfschnowl:<br />
Fichtenkreuzschnabel;<br />
s Learei: Lerche;<br />
da Luseha: Ruß- oder Eichelhäher;<br />
da Man(d)lkrau(n): Mandelkrähe;<br />
da Mistfink: Bergfink;<br />
d Moisn: Meise;<br />
d Moustgoas, („Sumpfziege“):<br />
Rohrdommel;<br />
da Rewlkrau(n): Rebelkrähe;<br />
d Nochtigol: Nachtigal;<br />
da Rußbeißa: Kirschfink;<br />
da Odla: Adler;<br />
d Oistan: Elster;<br />
da Papagei: Papagei;<br />
d Pe(d)lhein: Perlhenne;<br />
da Rauf: Steinkauz;<br />
da Rob: Rabe;<br />
s Roidkreipfl: Rotkehlchen;<br />
da Roidzogl: Rotschwänzchen;<br />
da Schüldhau(n): Birkhahn;<br />
d Schwoim: Schwalbe;<br />
da Schwoimasteßei: Sperber;<br />
d Schoupfmoisn: Schopfmeise;<br />
s Schwoazblatl: Schwarzblättchen;<br />
d Spreidin: Mauerschwalbe;<br />
da Sprochmoasta, auch<br />
Stau(d)navougl:<br />
Sprachmeister, Gartenspötter,<br />
Hausgrasmücke;<br />
da Spotz: Spatz;<br />
da Starl: Star;<br />
da Steßei: Sperber;<br />
da Stiglitz: Distelfink;<br />
da Stoach: Storch;<br />
d Tau(b)m: Taube;<br />
da Tau(b)masteßei: Wanderfalke;<br />
da Tauwa: Täuber;<br />
da Toi(D)nvougl: Dreizehiger<br />
Specht;<br />
d Tuachtltau(b)m: Turteltaube;<br />
da Uhu, scherzweise auch Buhu:<br />
Uhu;<br />
da Viaschülm: Rohrdommel;<br />
d Wildantn: Wildente;<br />
d Wildgau(n)s: Wildgans;<br />
d Wildtau(b)m: Ringeltaube;<br />
da Zeisl: Zeisig;<br />
d Zoaratzn: Misteldrossel.
34<br />
35<br />
rückfindet! Die Begrüßung ist wahrlich herzlich, alle rufen (die Leute sagen<br />
„schnattern“) „Willkommen“, du schmerzlich Vermisste! Wo warst du?“ usw.<br />
Man sehe sich nur das Gebaren des sieghaften Gänserichs an, der über seinen<br />
Nebenbuhler frohlockt und höre seinen Bericht über das Duell an, usw.! Und mit<br />
welch edlem Anstand bewegen sich diese Vögel „im Gänsemarsch“, genau, wie<br />
die Indianer, wenn sich diese am Kriegspfade befinden! Die undankbaren Menschen,<br />
welche nur immer den Fraß im Kopfe haben, kennen die Gans nur von der<br />
Verbrauchsseite und singen und sagen nur: „Ene jut jebratene Jans is ene jute<br />
Jabe Jottes.“ Oder „Gänseleber und Gänsefett über alles!“ Sie loben das Vergängliche<br />
an ihr und unterschätzen das Wertbeständige an der Gans, von dem man<br />
nicht sagen kann: Heute gegessen, morgen vergessen. Ein denkender Mensch<br />
lässt der Gans volle Gerechtigkeit widerfahren und denkt beim Worte „Gans“<br />
nicht nur an den knusperig gebratenen Vogel, sondern auch daran, dass dieser<br />
nicht bloß aus einem schmackhaften Korpus besteht, sondern auch einer Umhüllung,<br />
einem Kleide, aus dem die Menschen warme Bettenfüllungen herzustellen<br />
vermögen. Erfrieren müssten wir im Winter, wenn wir kein Federbett hätten!<br />
Nachdem man aber nicht die ganzen Federn, wie sie die Gans mit und an sich<br />
herschleppt, in die Schüttziechen stopfen kann, muss man sie eben erst schleißen;<br />
und damit komme ich endlich zur Schilderung dieser verdienstlichen und auch<br />
vergnügungsreichen Beschäftigung und wähle dazu als Vorbild nachfolgende<br />
Wiedergabe eines Federschleißabends bei der Frau Girglmathesenagerl.<br />
Die Girglmathesenleut´ haben außer einem Stammhalter noch drei Töchter, von<br />
denen jede mindestens zwei oder drei komplette Betten mitbekommen muss, von<br />
denen wieder jedes zehn bis fünfzehn Pfund schwer ist. Im Ganzen sind also 30-<br />
45 Pfund Federn und das ist ein gewaltiger Haufen! Demnach heißt es, mehrere<br />
Winter hindurch nur schon gerupfte Gänse zu verkaufen und alle Federn für den<br />
Hausbedarf selber zu schleißen. Das können die weiblichen Wesen des eigenen<br />
Heims nicht allein bewältigen (männliche Wesen geben sich zu so was nicht her!)<br />
und so muss man andere aus der Nachbarschaft dazu einladen. Die Töchter anderer<br />
Bauern kommen schon deshalb, weil sie auf Gegenseitigkeit rechnen, die Inleute<br />
usw. aber von da und dort wegen der „Interholtung“ und des zu erwartenden<br />
Endschmauses. – Der große Eichentisch, von den zwei Wandbänken und mehreren<br />
Stühlen umrahmt, wird sauber abgerieben und nach der Stall- und Haus-„Verrichtung“<br />
erscheinen auch schon die Hilfskräfte. – „Grüß Gott! Schöi, doß kimmts.“<br />
– „Grüß Gott a, hot jo leicht sein kinnt.“ – Setzts Eng indr!“ (nieder), erschallt es<br />
vorderhand. Frau Angerl bringt dann nach ein paar einleitenden Worten ein oder<br />
mehrere Säckchen oder eine „Reuter“ (ein Riesensieb) ungeschlissener Federn<br />
und „a jeds“ nimmt sich davon eine Portion. Und schon geht’s los. Ritz – ratz,<br />
zupfen die behenden Finger die Federfähnchen links und rechts vom Stiel und<br />
das Schöpfchen oben wird ebenso flink mit abgerissen. Die Stiele werden auf den<br />
Boden geworfen. – Die „Menscherla“ (junge Mädchen) blicken im Kreise herum<br />
– wer wird die peinliche Stille brechen? Natürlich die Kathl vom Joglhof. Sie<br />
räuspert sich und beginnt: A schöne Zeit hobmr itze“ (jetzt). – „Jo, wahrli prächti<br />
(g); Schnee is gnua und a We(g) is a scho.“ – „No, do kinn´ns mit dr Taf (Taufe)<br />
morgn leicht in d´ Stodt.“ – „Leicht.“ – Ejz hot dr Joglbaur schon zwoa Kindr und<br />
zwoa Menschr“ (Zwei Buben und zwei Mädchen). – „Könnt scho(n) afhörn der<br />
Jogl – d Wirtschoft trogt net mehri, doß no a Schüppl nochikemm´n könnt.“ – „Is<br />
a sou.“ – „Wej wird de(nn) s Menscherl taft?“ – „Wej wird’s denn taft? Morgn is<br />
Maria Empfängnis, alsdann wird’s halt Marai taft.“ – „Mhm.“ (Das sagt nicht<br />
alles die Kathl, sondern bald die, bald jene, so auch in den folgenden Dialogen,<br />
Triologen und Massengesprächen.) Da fällt der Krenzens etwas ein und sich vorbeugend,<br />
bemerkt sie: „Kinder wer´n olleweil mehri, rein von selbr, und wegen<br />
dem muß ma(n) sporn. Und wegn dem hon i heut selbr zu meini Menschr gsogt:<br />
Menschr, sports ner recht, hon i gsogt, weil ihr kriegts mit der Zeit a an Mann, -<br />
sparts ner!“ (Allgemeines Gelächter und die Roblamalia ruft aus: „Na, die Krezens,<br />
die is holt allweil kürzweili, die woas allweil wos, doß ma locha muaß.“ Doch die<br />
wehrt sich: „No, koa (kann), ma wos davor? Do hobts z.B. d Prinzessin, wos den<br />
Moses in dem Nil gfundn hot. Der ihr Bodr, der Farra-o, wird a gschaut hobn, wej<br />
seini Tochtr, d´ Prinzessin, mit dem noss´n Buabn doherkemma is.“. – „Wer weiß´s,<br />
hotrs ihr glaubt, doß´s net ihr Kind is.“ – „Obr, sogts mr amol, wej dös kimmt, in<br />
Affrika, sandt jo do(ch) olli Leut schworz, weils Negr sand durt, und ei dr Biblischn<br />
Gschicht is der Moses weiß.“- „Geh, du Mankei, Affrika is jo schreckla groß und<br />
d Leut obnt af dr Londkortn sant meistnteils braun und ner ünt af dr Londkortn<br />
sands schworz.“ – „No, jo, kinnt a sa(n).“ – „Obr der Farra-o hot an dem Moses<br />
a ka großi Freud erlebt, weil der ehm in dös Roti Meer einifilutiert hot, in dem er<br />
samt seini Million Soldotn hot drsaufn müssn.“ – „Hu, dös war mir wos! I gang<br />
net afs Wossr, net ums Schloß Frauenberg; weil, wos hot ma davo, wenn ma a<br />
schöins Schloß hot und dabei tot is?“ – „Wohr is´s, a sou is´s!“ – Nun beginnt die<br />
kloa Franzi vom Riegelhof ein anderes Thema. „Unsr Knet (Knecht), der Petrn<br />
Wenzerl, hot in dr Zeitung glesn, doß s´af den Kini Zogul von Halbanien gschoss´n<br />
hobn – hobn ´n obr net troff’n, grod ner an Generol von ehm. Begreif net, wegn<br />
wos d Leut alleweil af anand schuißn, und raubmordn tans a alleweil und ei Amerika<br />
mochn d Polizei a no Holbport mit die Mördr. Do bin i holt do no viel lejbr<br />
im Böhmerwold do dahoamt, als in die heißn Ländr, wo den Leutn s Bluat ollweil<br />
suidn tut und Löwn und Tigr und Schlongn umanandrennen und s Vieh und Mensch<br />
affressn.“ – „Im Böhmerwold is ´s richti no am schönern gor, tuif im<br />
Böhmerwold.“. Das Wort zündet und es ertönt das Lied: „Tief im Böhmerwald,<br />
wo meine Wiege stand.“ Dann folgen noch andere Lieder, so: „Mei Vodr segets<br />
gern, i sollt a Pforrer wern“, „Verlossn, verlossn bin i, wie a Stoan af dr Stroßn,<br />
verlossn bin i.“ u.a.m. Aber nicht immerzu, denn davo wird am bold s Mäul völli<br />
trucka. Wer mit seinem Häufchen Federn fertig ist, nimmt sich eine neue Portion,<br />
so dass Frau Agerl bald mit einem neuen Sack voll ungeschlissener Federn kommen<br />
muss. „Obs denn überoll af derer Welt heut af d´Nocht Fedrn schleißn tan?“<br />
wirft die Ratzltoni vom Meisetschlagerborromäus ein, um das Gespräch wieder<br />
in Fluß zu bringen. – „Mankei du“, sagt darauf die Baberl von Kesslspreng, „wißts<br />
denn net, doß während dem bei uns d´Leut´ schlofn gehen, die Leut af dr ondrn<br />
Seitn vom Globius beim Fruhstuck sitzn?“ – „Jo richti(g), is a sou.“ – Die Katherl<br />
vom Joglhof, die „s Capo“ ist, sucht schon lange im Geiste nach einem Übergangsthema<br />
zum so beliebten Hauptthema oder eigentlich den beiden interessantesten<br />
Themen, und sagt deshalb: „In dem Amerika gibt’s alleweil Mord und<br />
Brand, und bei uns a grod gnu(a) Raubrstückln; obr so schöni Raubrstück, wej<br />
die vom Boirischn (Hi(a)sl net leicht. Der hot z.B. amol an recht reichn Kaufmo
36<br />
37<br />
Ein überraschendes Bild bot allen Besuchern die am 5. Mai 1930 vom Viehzuchtund<br />
Milchkontrollverein in Wallern veranstaltete Gebietsviehschau und Stierauktion<br />
für reingezüchtete Tiere der Simmentaler- Berner Rasse. Zur Schau waren<br />
69 Jung- und Decktiere, 85 Kalbinnen und 60 Kühe gebracht. Allgemeine<br />
Bewunderung und lobende Anerkennung fand die allseits bekannte Wallerer<br />
Zuchtstierhaltung. Der Verkauf war ein verhältnismäßig guter, außer einer Anzahl<br />
Kalbinnen und Kühe wurden auch 28 Stiere zum Preise von 8-12 K für das<br />
Kilo Lebendgewicht verkauft. Nachdem aber 60 Stiere zum Verkauf aufgetrieben<br />
waren, blieben der Rest, davon auch erstklassige Tiere mit sehr guter Abstammung,<br />
unverkauft. Das Prämiierungsergebnis ist wiederum der beste Beweis für<br />
die erstklassigen Tiere des Zuchtgebietes Wallern, denn insgesamt wurden an<br />
214 aufgetriebene Tiere 102 Preise verliehen, und zwar 43 Preise für Stiere, 25<br />
für Kalbinnen und 34 für Kühe. Nachmittags wurden die preisgekrönten Tiere<br />
unter den Klängen der Musikkapelle des Männergesangsvereines Wallern am<br />
Ringplatze vorgeführt. Die Spitze dieses festlichen Zuges bildete ein geschmückter<br />
Wagen, gezogen von zwei Stieren der Zuchttierhaltung.<br />
(Aus: Waldheimat 1930/7)<br />
Der im November 1870 hier hausende orkanartige Sturm hat in einer Nacht<br />
tausende der schönsten Stämme aller Altersklassen in einem wahrhaft fürchterlichen<br />
Durcheinander hinterlassen. Die Aufarbeitung war mit teilweiser Lebensgefahr<br />
durch herbeigezogene fremde Holzarbeiter aus dem Flachlande und<br />
Deutsch-Tirol gegen hohe Entlohnung und Reisevergütung bewerkstelligt worden.<br />
Zur schnellen Verarbeitung dieser riesigen Holzmassen reichten diese Kräfte<br />
nicht hin. Im Jahre 1871 wurden 3000 Brettklötzer, 233 Klafter hartes und<br />
2600 Klafter weiches Scheitholz nebst einer Anzahl anderwertiger Nutzholzausschnitte<br />
für die Fabrik in Mader und den Ortsverbrauch erzeugt. Im Ganzen betrug<br />
das Flächenausmaß der Windwürfe etwa 207 Joch nebst einer Anzahl größerer<br />
und kleinerer gruppenweise verteilter Fälle und Brüche.<br />
Im Jahre 1872 arbeiteten 100 fremde Partien an der Bewältigung der Windbruchverwüstung<br />
und wurden 3100 Brettklötzer, 132 Klafter hartes, 2550 Klafter weiches<br />
Scheitholz gemacht. Ganze Partien lagen unaufgearbeitet da, der Borkenkäfer<br />
zeigte sich hie und da, aber nicht in beträchtlicher Menge. An dessen Vertilgung<br />
wurde wohl gearbeitet, aber es war ihm stellenweise nicht beizukommen,da<br />
man in den Windriss unmöglich hineingelangen konnte und die außergewöhnlich<br />
Die Zuchtviehausstellung in Wallern<br />
Windbruch und Borkenkäfer 1870 im Bezirk<br />
Winterberg<br />
umbracht; ´s Geld obr, wos r bei dem gfundn hot, hotr den armen Leutn gebn.<br />
Drschossn hotr ehm, und hintno a no d Gurgl dur(ch)gsaglt, doß ´s Bluat gspritzt<br />
is bis hintrn Ofn. Jo dös is a Mandl gwen.“ – „O, so wos, brr, do graust am.” –<br />
“Schon, schon.” – “Jo obr hintno is ehm, dem Hiasl, der Geist von dem Kaifma,<br />
wos ejz als a Gspenst g´waietzt hot (spukte), erschienen und hot ehm, dem Hiasl,<br />
versteht si(ch), varflucht und hot ehm weißgsogt: „Ghängt wirst am ollrhöchstn<br />
Golgn und d´Kroh werdn di fressn”, und a sou is ´s a gwordn.“ – „Geht’s, hörts<br />
af, Kathl, mit dem! Dös muß an jo im Traum fürkema, doß ma vor lautr Grausn<br />
schwitzet wird“ – “Hu, do fürcht i mi schon vorm Hoamgehn!“ – „ No, no, do<br />
muß ma jo net gei(ch), so zidrn; weil, we(nn) am so a Geist in dr Nocht firkimt,<br />
braucht man er sogn „Olli gutn Geistr lobn Gott den Herrn“ und er muß si af dös<br />
hin varzuign. - Wohr is ´s und i tu dös a, wenn mir der Geist von dem Hiasl odr<br />
dem Kaufmo erscheinen sollt´.“ – Es gibt noch mancherlei andere interessante<br />
Gespräche dieser und anderer Art und nach einigen solchen Abenden geht der<br />
Federnvorrat zu Ende und eine „Überstunde“ würde genügen, um alles fertig zu<br />
schleißen. Aber das gibt’s nicht; man muss das letzte Patzerl strecken, damit’s<br />
noch für morgen etwas zu tun gibt; denn da gibt es ein Abschieds- und Dankmahl,<br />
Kaffee und Striezel oder Wuchteln, vielleicht auch noch Schnaps und<br />
„No(ch) was.“ Und dann kann man auch tanzen, wenn der Knecht auf der Mundharmonika<br />
Landler aufspielt. Im Notfall tanzen halt Mädeln mit Mädeln und auch<br />
ältere Frauen miteinander; denn tanzen mögen auch noch die 60-jährigen, selbst<br />
die 80-jährige Kordula von Siebenhäuser. Dazu ist man nie zu alt. –<br />
Die „Rockareis“, d.h. die in Flachsbaugegenden gebräuchlichen Spinnrocken-<br />
Versammlungen (jeden Abend in einem anderen Hofe) sind oft noch weit schöner,<br />
weil sich dabei auch viele Burschen einfinden. (Aus: Waldheimat 1932/3)<br />
Johann Thoma<br />
Wildfütterung am Kubani. Foto: Josef Seidel, Krummau (Sammlung Reinhold<br />
Fink)
38<br />
39<br />
starken Stämme viele Hindernisse boten. Der Lohn für die Erzeugung einer Klafter<br />
30zölligen weichen und harten Scheitholzes für Fremde war mit einem Gulden,<br />
für einen 18schuhigen Klotz 20 Kreuzer bemessen; für einheimische Arbeiter<br />
mit 72 Kreuzer für die Klafter weiches, 15 Kreuzer für einen Brettklotz. Außerdem<br />
wurden Lebensmittel, bestehend in Erdäpfeln, Mehl und Erbsen zu<br />
Erstehungspreisen an die Arbeiter verteilt und von dem Lohne abgerechnet, und<br />
auch Werkzeuge leihweise ausgefolgt, um nur mehr Fremde zu erhalten.<br />
Im Jahre 1873 wurde der erste Borkenkäferfraß in größerer Ausdehnung um die<br />
Windbruchsflächen wahrgenommen. Der Käfer schwärmte in diesem Sommer<br />
dreimal und wurde in allen Entwicklungsstadien übers ganze Sommerjahr angetroffen.<br />
Infolgedessen wurde die Windbruchsarbeit eingestellt und alle verfügbaren Arbeiter,<br />
Frauen, selbst Kinder gegen eine Tagesentlohnung von 60-70 Kreuzer für<br />
Männer, 40, 35 und 30 Kreuzer für Weiber und 20 Kreuzer für Kinder zum Fällen,<br />
Entrinden und Brennen der Rindenstücke aufgeboten. Fremde Arbeiter fanden<br />
gegen Akkordfällungen Aufnahme. Die Menschenkräfte waren nicht ausreichend<br />
und gegen den Spätherbst, obwohl schon eine Anzahl von Stämmen gefällt<br />
und entrindet dalag, stand noch eine unabsehbare Menge vom Käfer angegriffener<br />
Stämme da, deren Fällung aus Mangel an Arbeitskraft unterbleiben musste.<br />
Erzeugt wurden aus von Borkenkäfern angestochenen Stämmen 5000 Brettklötzer,<br />
2700 Klafter weiches Scheitholz und an 20.000 Stämme und Stämmchen von<br />
allen Altersklassen wurden gefällt und entrindet. Die Auslagen für die Fällung<br />
und Entrindung der Käferstämme betrug 3905 Gulden 50 Kreuzer (an Fremde<br />
951 Gulden 82 Kreuzer). In wahrhaft erschreckender Weise zeigte sich 1874 dieses<br />
Wälder verderbende Insekt allerorts, selbst wo nicht ein geworfener Baumstamm<br />
war. Infolge dessen wurden vom Forstamt 100 Mann Südtiroler beordert,<br />
außer diesen arbeiteten noch 100 Sägen mit nur einheimischen Arbeitern vom<br />
Mai bis fast Ende September, und außer diesen noch täglich 130 Männer, Frauen<br />
und Kinder, um dem Schädling beizukommen.<br />
Fangschläge in der Breite von 7-11 Klafter wurden um die angestochenen Waldteile<br />
herum angelegt, um dem Fraß zu lokalisieren und dem Insekt besser beikommen<br />
zu können. Die Entrindung geschah in diesen Fangschlägen und überall<br />
erst dann, wenn sich der Wurm zeigte, worauf unter jeden zu entrindenden Stamm<br />
ein Leintuch ausgebreitet, die Rindenstücke damit zum Feuer getragen und verbrannt<br />
wurden. Einen wahrhaft traurigen Anblick bot der Wald in dieser Zeit,<br />
wohin man nur blickte, überall nur Feuer und Rauch, teils dürre, rote, wohl auch<br />
grüne, aber in traurigster Gestalt dastehende Bäume, die einen förmlich um Hilfe<br />
anzurufen schienen.<br />
Nach angestrengter Tätigkeit gelang es über den Sommer, alle bis auf den letzten<br />
angestochenen Stamm zu fällen und zu entrinden. Aus reinem Käferholze wurden<br />
hergestellt 5700 Klafter Scheitholz, 4000 Brettklötzer und 3090 Bauholzstämme.<br />
Da aber die Käfer in noch nie da gewesenen Massen auftraten, wurde die Holzerzeugung<br />
gänzlich eingestellt und sämtliche verfügbare Mannschaft zum Fällen<br />
und Entrinden beordert. In den Jahren 1873 und 1874 wurden 183 Joch nebst<br />
unzähligen kleinen Baumgruppen angegriffen. Außer obigen wurden in diesem<br />
(Aus der Umgebung von Kaplitz.) Der Mensch könnte das Ross nicht bändigen,<br />
wenn dieses wüsste, wie stark es ist. Damit der Mensch das Ross zähmen könne,<br />
hat ihm einst der Teufel die Flechsen durchgetrennt und als Andenken bleiben<br />
dem Rosse die Teufelsflechsen (Galen) an der Innenseite der Oberschenkel. Zum<br />
Lenker spricht das Ross: „Bergauf treib mich nicht, talab jag´ mich nicht und auf<br />
der Ebene brauchst mich nicht schonen.“ Um einen Hund an sich zu gewöhnen,<br />
halte man einen Brotbissen in der linken Achselhöhle, bis er warm ist und gebe<br />
ihn dann dem Hunde zu fressen. Der Hund wird den neuen Herrn nicht mehr<br />
verlassen. Damit Diebe und andres schlechtes Gesindel den Haushund nicht „bannen“<br />
können, soll der Hund nach einem rinnenden Wasser – Moldau, Donau, und<br />
ähnlich – benannt sein. Kein Zauber wird den so benannten Hund, wenn Diebe<br />
ins Haus dringen, zum Schweigen bringen. Auch im Sprichwort spielt der Hund<br />
eine Rolle: „D´ Leut muß m´r reden und d´Hund koal´n (bellen) laß´n.“ „An<br />
koalad´n Hund kai (wirf) a Stückl Brot vür.“ – „Wal d´r olti Hund nimma beiß´n<br />
kau, koalt´r.“ „An oldn Hund kaun ma s Koaln nima aunast lenna.“<br />
(Aus: Waldheimat 1933/3)<br />
Ross und Hund im Leben des Landmannes<br />
Augustin Galfe<br />
Jahre noch gefällt und entrindet im Akkord zu 30 Kreuzer für den Stamm 6106<br />
Stück, zu 50 Kreuzer für den Stamm 1970 Stück und gegen Taglohn 4329 Stück;<br />
der Gesamtaufwand betrug 5922 Gulden 33 Kreuzer.<br />
Der Borkenkäfer war 1875 in bedeutender Abnahme, sodass von ihm angegangenen<br />
Flächen ohne Zuhilfenahme Fremder abgeholzt und entrindet werden konnten.<br />
Seine Verheerungen wurden nur in den 1874 betroffenen Gebieten in fortgesetzter<br />
Reihenfolge sichtbar. Im Akkordlohn wurden 1882 Stämme und gegen<br />
Taglohn 2797 Stämme gefällt. Die Kosten betrugen für alle Arbeiten 1824 Gulden<br />
72 Kreuzer.<br />
Im November 1874 hat abermals ein Sturm in den teils vom Käfer, teils vom<br />
Windbruch entstandenen Flächen die wenigen Ausständer, bestehend in Tannen,<br />
Fichten und Buchen geworfen, deren Aufräumung 1875 auch in Angriff genommen<br />
wurde.<br />
Mit leichter Mühe wurde 1876 die Vertilgung vorgenommen, da der Borkenkäfer<br />
mehr gruppenweise auftrat. Etwa 800 Stämme wurden umgehauen hiefür 207<br />
Gulden Verarbeitungskosten entrichtet. In den Jahrgängen 1877 und 1878 wurde<br />
nur mehr aus Vorsicht bei der Holzscheiter-Erzeugung eine Abrindung vorgenommen.<br />
Am 6. und 7. Dezember 1900 herrschte ein heftiger Nordweststurm, der nach<br />
Augenschätzung über 121 Festmeter Hartholz und 1022 Festmeter weiche Holzmasse<br />
brachte. (Aus: Waldheimat 1927/11)
40<br />
41<br />
In früheren Zeiten, als das Vieh und die Pferde noch auf größeren Hutweiden und<br />
in den Waldungen gehütet wurden, war in jedem Dorfe ein Hirt. Der Hirt des<br />
Dorfes Warzenried im nahen Bayern, hieß Stelzl. Der hütete die Pferde aus Warzenried<br />
über Jägershof bis an die böhmische Grenze. Als er wieder einmal auf der<br />
Die Sage vom Stelzl<br />
Peter Maier<br />
Nach einer mittelmäßigen Ernte des Jahres 1770 zeigte sich schon mit dem beginnenden<br />
Frühjahr 1771 ein bedenklicher Mangel an Feldfrüchten, der noch<br />
durch die vollständige Missernte in diesem Jahre, bewirkt durch fortwährenden<br />
Regen, zu einer argen Hungersnot ausartete, die viele Menschen hinwegraffte.<br />
Aus jener Zeit stammt das folgende, vom Obersten Münz- und Bergmeisteramte<br />
in Prag an die Stadt Bergreichenstein gerichtete Schreiben, das erkennen lässt,<br />
dass im Prachiner Kreis (Amtsstadt Pisek) schon im April 1771 großer Nahrungsmangel<br />
herrschte: „Ehrenveste und Wohlweise! Gute Freunde! Es ist von einen<br />
Hochlöbl. Landes Gubernio an das Prachiner Königl. Creyß-Amt bereits die Verordnung<br />
ergangen, dass weilen die dortigen Creyß über die einheimische Nothdurft<br />
nun schon kein Getraid-Vorrath mehr vorhanden, daß selbe mit denen Benachbarten<br />
Königlichen Creyß Aemtern sich einvernehmen sollen, damit Euch mit<br />
dem Benöthigten Brod, und Saamen-Getraid aus dem Bechiner, oder Czoschlauer<br />
(=Czaslauer) Creyß die Aushilf geschehen möge. Dahero Ihr Euch nur bey gesagtem<br />
Königl. Creyß Amt zu melden, und daselbst die weitere Anweißung zu<br />
erwarten haben werdet. Geben von dem Kays. Königl. Obristen Münz, und Berg<br />
Meister Amt. Prag den 27. April 1771. Franz J. Graf Pachta. Johann Josef Urtica.“<br />
(Aus: Waldheimat 1932/9)<br />
Lebendige Freude strahlt in den Augen der Burschen, der Übermut juckt und die<br />
Schulbank ist hart, denn der ersehnte Martinitag ist wiederum da. Lachend und<br />
schreiend durchstöbern die Knaben die „Reihan“, um alte Besen, Schaufeln, Streusensen<br />
oder anderes Eisenzeug zu sammeln für ihr wichtiges Treiben am Abende<br />
dieses Tages. Bei Einbruch der Dämmerung versammelt sich nun die Knabenschar<br />
am Dorfeingang. Jeder ist versehen mit dem eroberten alten Geschirr in der<br />
einen Hand und mit einem Prügel in der anderen. Endlich ist es dunkel genug.<br />
Jetzt gehen oder laufen die Burschen, auf die Blechgeschirre und Sensen schlagend<br />
und lärmend, durch die Dorfstraße, bis an das Dorfende, wo mehrere Minuten<br />
diese Lärmmusik stark anhält. Hierauf wandert die kleine Schar ebenfalls<br />
schlagend und lärmend rund um das Dorf, wobei sie von etwas älteren Knaben<br />
gejagt werden. Nach einer halben Stunde ist die Freude der Burschen beendet<br />
und ihre Lärminstrumente fliegen wieder in die „Reihan“ (Raum zwischen zwei<br />
Häusern zum Abfließen der Dachtropfen). Dieser Brauch dürfte in der frühesten<br />
Hirtenzeit wurzeln, in der noch Wölfe die weidende Herde überfielen. Im unteren<br />
Böhmerwalde ist das Wolfenablassen in der Andreasnacht, am 29. November,<br />
indem die Burschen am Dorfplatz mit den Geißeln heftig tuschen und damit die<br />
Wölfe vertreiben. Über das Wolffangen teilte der Bauer Schmid Ferdl, Klasser,<br />
folgendes mit: Man fing öfters Wölfe in eigenen tiefen Wolfsgruben, über die ein<br />
Prügel lag, auf welchem ein Brett mit einem Köder befestigt war. Nebenbei versteckte<br />
ein Gesträuch die vordere Grubenseite. Wenn der Wolf zum Köder kam,<br />
schnappte das Brett um, der Wolf fiel in die Grube und das Brett schnellte wieder<br />
in die frühere Fallstellung zurück. Die gefangenen Wölfe wurden dann von den<br />
Bauern erschossen. Der alte Hainzinger verschüttete 1850 herum eine Wolfsgrube<br />
in Multerberg (Schönberg). Dieses Fangen der Wölfe in Gruben war auch im<br />
Böhmerwalde üblich. Das Dorf Wolfsgrub bei Wallern hat doch davon den Namen.<br />
Am 11. November, Martintag, wurde im Mühlviertel, im Böhmerwald zu<br />
„Andree“, das Viehhüten eingestellt und niemand sollte mehr viehüten, denn der<br />
Wolf ist abgelassen. (Aus: Waldheimat 1929/11)<br />
Die Hungersnot 1771/72 in Böhmen<br />
Rudolf Hruschka<br />
´S Wolfablass´n am Martinitag<br />
Franz Wötz<br />
Weide war, bemerkte er, als er die Herde zum Nach-Hause-Treiben ordnen wollte,<br />
dass statt der ihm anvertrauten 100 Pferde nur 99 da waren. Das hundertste,<br />
welches ihm beim Zählen abging, ritt er selbst. Ganz verzweifelt ob des Verlustes,<br />
machte er sich gleich auf die Suche und streifte die ganze Gegend ab, doch<br />
vergebens. Das Pferd konnte der gute Hirt nicht finden. Aus Gram darüber wurde<br />
er wahnsinnig und erhängte sich im Walde.<br />
Seit diesem Tage trieb der Stelzl als Geist sein Unwesen in jener Gegend, in der<br />
er vordem seine Pferde geweidet hatte.<br />
So erzählen die Leute, dass schon mancher, der sich über der Grenze (in Bayern)<br />
im Wirtshaus verspätet hatte, auf dem Rückweg den Stelzl auf dem Rücken oft<br />
bis zur Haustür, oder wenigstens bis an die böhmische Grenze tragen musste.<br />
Dort verschwand der Geist mit Hohngelächter. Um diesen Spuk zu vertreiben,<br />
wurde der Stelzl in der Franziskanerkirche zu Neukirchen-Heiligenblut an der<br />
böhmischen Grenze auf 200 Jahre verwunschen und ihm so das Handwerk gelegt.<br />
Doch sind die 200 Jahre bald um und dann wird der Stelzl wieder sein Unwesen<br />
treiben. (Aus: Waldheimat 1932/9)
42<br />
43<br />
Sechs Jahrzehnte haben einen dichten Schleier des Vergessens über das Heimatland<br />
gebreitet. Zwar ist über das Schicksal der Menschen, welche jene Zeit überlebt<br />
haben, als sie, wie der Waldprophet es ausdrückte, „einen eisernen Kopf<br />
haben mussten“, schon viel geschrieben und erzählt worden, aber kaum wurde<br />
des Schicksals der Haustiere gedacht, die ebenso wie ihre menschlichen Betreuer<br />
leiden und dulden mussten. Ich möchte daher etwas über die nützlichen Wegbegleiter<br />
unserer Vorfahren ins Blickfeld rücken.<br />
Dazu einige statistische Angaben: Im Jahre 1936 entfiel von der Gesamtfläche<br />
der CSR 59% auf landwirtschaftliche Nutzfläche. Im Jahre 1940 - also während<br />
der „Reichszeit“- entfielen von 1,280 720 ha Nutzfläche im Sudetenland 57,7%<br />
auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche. Es bestanden größtenteils klein- (60,3%<br />
) und mittelbäuerliche Betriebe (30,9%); großbäuerliche Betriebe und Großgüter<br />
waren etwa 8,8%. Von dieser Fläche betrug der Anteil des Grünlandes (Wiesen<br />
und Weiden) etwa 526 362 ha = 41% der landwirtschaftlichen Fläche. Die Bewirtschaftung<br />
dieser Wiesen und Weiden war sehr intensiv, sodass man bei der<br />
Viehzählung im Jahre 1939 – 1,226.500 Stück Rindvieh zählte; davon wiederum<br />
614.000 Kühe von denen im Jahr durchschnittlich 1 106,012.000 Liter Milch<br />
kamen, aus welcher wiederum 25 840 Tonnen Butter und andere Milcherzeugnisse<br />
produziert wurden. Auch Ochsen gab es viele, denn sie mussten außer der landwirtschaftlichen<br />
Arbeit auch die Holzabfuhr im Wald leisten.<br />
An Pferden wurden zum Ende des Krieges im Sudetengebiet ungefähr 130.000<br />
Tiere gezählt. Die statistischen Zahlen stammen aus dem Buch „Bauerntum und<br />
Landbau der Sudetendeutschen“ von Karl Hübl, 1963.<br />
Diese trockenen Zahlen sagen jedoch nichts aus über die durch Generationen<br />
gewachsene Wechselbeziehung zwischen Mensch und Tier, welche durchaus lebensnotwendige<br />
und partnerschaftliche Züge trug. Ich zähle bewusst Schweine,<br />
Schafe, Ziegen und Geflügel in dieser Statistik nicht auf, auch wenn sie natürlich<br />
zu jedem Bauernhof gehörten, aber Ansehen und Einkommen des Betriebes wurden<br />
vom Bestand an Rindvieh und vom Pferdebesitz bestimmt. Die Pflege dieser<br />
Tiere war für den bäuerlichen Haushalt die Grundlage des Wohlbefindens der<br />
Menschen. Mensch und Tier bildeten eine Symbiose der Lebensnotwendigkeit<br />
und wurden auch so bewertet. Jedes Tier im Stall hatte seinen Namen, seine Aufgabe<br />
aber auch seine Eigenheit, die immer berücksichtigt wurde. Das Verhältnis<br />
zu den Tieren nahm oft geradezu persönliche Bezüge an. Ihre sorgfältige Pflege<br />
war auch dem entsprechende „Futternot der Tiere ist ärger als Brotnot der Menschen“,<br />
hieß es. Wer roh zu seinen Tieren war, verlor im Dorf Ansehen und Geltung.<br />
Auch wenn nur eine Kuh im Stall stand, mühte sich die Hausfrau, jeden<br />
Rain abzusicheln, oder gar Futter mit dem Graskorb aus dem Wald zu holen. Es<br />
erübrigt sich zu sagen, dass ein gepflegter Viehbestand auch die nötige Förderung<br />
durch Zuchtviehvereine und genossenschaftliche Organisationen voraussetzte.<br />
In Krieg und Frieden waren die Menschen untrennbar mit der Pflege ihrer<br />
Hausgenossen im Stall verbunden. Die Haustiere halfen immer über Hunger und<br />
menschliche Entbehrung hinweg. So ging das durch Generationen, bis das unheilvolle<br />
Kriegsende nicht nur die Menschen, sondern auch die Haustiere traf.<br />
Schon im Sommer 1945 begann die Besetzung der Höfe. Menschen kamen, die<br />
von der Betreuung der Tiere oft keine Ahnung hatten, denen aber auch der Wille<br />
zur Bauernarbeit fehlte. Wenn man einen Teil der rechtmäßigen Besitzer wenigstens<br />
noch als Dienstboten auf dem Hof duldete, wurden die Tiere noch betreut - auch<br />
wenn manches Rind oder Schwein heimlich vom neuen Herrn verkauft wurde,<br />
um seine Kasse aufzubessern.<br />
Als jedoch im Jahre 1946 die allgemeine Aussiedlung begann, fing auch das tragische<br />
Verschwinden der Haustiere an. Bei jedem Menschentransport steckten<br />
die Leute den Tieren die Raufen voll Futter an, bevor sie Haus und Hof verlassen<br />
mussten, damit das Vieh wenigstens für kurze Zeit vor dem Hunger bewahrt wäre.<br />
In unserem Dorf war der neue Besitzer aller Haustiere eine Weidegenossenschaft<br />
aus Chlumany bei Prachatitz. Die Hüter sollten das Vieh wenigstens weiden; aber<br />
Haustiere als Partner der Bauernfamilie<br />
Rosa Tahedl<br />
Ochsen zogen den großen<br />
Wagen bei der Heuernte in<br />
Wallern. Foto: Josef Seidel,<br />
Krummau (Sammlung<br />
Reinhold Fink)
44<br />
45<br />
sie hatten meistens als Goldgräber in den verlassenen Häusern zu tun und kümmerten<br />
sich wenig um das Vieh. Solange noch Nachbarn da waren, molken und<br />
fütterten sie in mehreren Ställen. Die Kommissare mussten bald neben den Menschen<br />
auch Viehtransporte zusammenstellen. Man trieb die Tiere, welche das nicht<br />
gewohnt waren, mit roher Gewalt ins Landesinnere. Dabei riss manches Tier aus<br />
und trieb sich monatelang in den Wäldern herum. Man hätte wohl gerne mehr<br />
Viehtransporte mit dem Zug fortgeschickt, aber man brauchte die Viehwaggons<br />
für die Vertreibung der Menschen.<br />
So blieb immer noch eine größere Zahl der Rinder in den von Menschen verlassenen<br />
Grenzdörfern zurück. Solange der Futtervorrat in den Scheunen reichte,<br />
konnten herbeigeholte Jugendbrigaden die Tiere wenigstens halbwegs versorgen,<br />
aber die Milchkannen standen bald leer an der Dorfstraße und in der Molkerei<br />
lief der Betrieb nur stundenweise. Dazu kam ein trockener Sommer im 47er<br />
Jahr. Die Heuernte mit diesen Hilfskräften geschah nur spärlich, die Grummeternte<br />
fiel ganz aus, und der Hunger in den Ställen begann. Es ist unvorstellbar,<br />
wie die gequälte Kreatur litt. In den leeren Scheunen klapperten nur die Tore im<br />
Wind, in den Ställen brüllten die Tiere. Längst hatte man sogar Strohsäcke entleert<br />
und alte Strohdächer abgedeckt. Der Schinder aus Wallern war mit seinem<br />
Hundegespann fast täglich im Dorf. Dazu kamen dann die Umsturzwirren im<br />
Frühling 1948, wo sich neue Herren einnisteten.<br />
Im 48er Jahr mit einer reichen Pilzernte im Wald war ein vollkommen verregneter<br />
Sommer. „Viel Schwammer - viel Jammer“ sagte man zu Recht. Im Grenzgebiet<br />
richtete man Staatsgüter ein mit unentwegt fluktuierenden Beschäftigten aller<br />
möglichen Nationen. Die Betreuer wechselten, die Tiere aber mussten bleiben<br />
und litten weiter in den provisorisch errichteten Gemeinschaftsställen. Jahrzehntelang<br />
ging diese Misswirtschaft weiter. Das Gras verdarb auf den Wiesen und<br />
die Scheunen waren im Herbst schon halb leer. Der Milchertrag ging rapide zurück;<br />
die große Wallerer Molkerei wurde geschlossen. Milch und Butter wurden<br />
in der Staatswirtschaft mit Lebensmittelkarten zur Mangelware. Der Schwarzmarkt<br />
blühte. Die Tiere aber litten weiter im Auf und Ab dieser Misswirtschaft<br />
und konnten sich nicht wehren. Vorbei war die Zeit, da die Kühe noch Namen<br />
trugen und Ochsen und Pferde dem Zuruf des Bauern folgten. Ich erinnere mich<br />
immer an den „Maxl“, einen großen, behäbigen Ochsen, welcher der Wastl Frieda<br />
gehörte und ihr in der Landwirtschaft half. Als die Frieda zum Ausweisungstransport<br />
musste, sind auch viele Tiere weggetrieben worden. Den „Maxl“ aber<br />
hielt der Kommissar zurück, denn er brauchte ein Zugtier, um Beutegut zusammen<br />
zu holen. Sonst ließ er das Tier frei grasen. Natürlich suchte sich Maxl nur<br />
gute Weideflächen und war oft auf den Wiesen beim Schulznhaus zu sehen. Dort<br />
streifte er als Selbstversorger durch die Sommerwiese.<br />
Wenn da jemand von der Zughaltestelle kommend das Tier anrief: „Maxl kimm!“<br />
Dann stellte es den Schwanz auf, sobald es die vertrauten Laute vernahm und<br />
trottete gemächlich dem Rufer zu. Es ließ sich dann am Kopf graulen und leckte<br />
mit seiner rauhen Zunge über die Hand des Menschen, der ihm vertraut schien,<br />
Die Bienenzucht, bzw. die Imkerei ist erst seit dem 16. u. 17. Jhd. in unseren<br />
Landen weitgehend bekannt und mit Kaiser Leopold 1. im Jahr 1674 dort mit<br />
dem ältesten Gesetz, die Bienenzucht betreffend, verankert. Sein Nachfolger,<br />
Kaiser Karl VI, förderte gezielt diese und unter Kaiserin Maria Theresia gab es<br />
schon umfangreiche Verordnungen für die Bienenzucht. In unserem Böhmerwald,<br />
wie auch im angrenzenden Herzogtum „Ob der Enns“ waren diese Bestimmungen<br />
somit auch rechtsgültig. Für den Böhmerwald konnte ich keine gewerbliche<br />
Nutzung in Erfahrung bringen, somit wurde dort die Bienenzucht und deren Nutzung<br />
fast ausschließlich als Nebenerwerb, wenn nicht aus Liebhaberei betrieben,<br />
sie war wohl vor allem den Männern vorbehalten. Im angrenzenden Mühlviertel<br />
und auch in den übrigen Vierteln Oberösterreichs wurde der Imker scherzhaft als<br />
„Beiveglvoda“ als Vater der Bienenvögel bezeichnet. Die Biene wurde als einziges<br />
der vieltausend Insekten zum Haustier. Deren Erzeugnisse, vor allem der<br />
Honig, waren für den häusliche Gebrauch und Verbrauch bestimmt, der Rest als<br />
Geschenk für Verwandte und Freunde, letztlich wurde das Wachs den Klöstern<br />
oder den Lebzeltern und Wachsziehern zum Verkauf angeboten, die es zur Herstellung<br />
von Kerzen und Wachsprodukten verarbeiteten. Der Ertrag, bzw. die<br />
Schöpfung hing natürlich vom Wetter und vom Wind ab. Im Christentum wurde<br />
die Biene wegen ihrer „überaus keuschen Fortpflanzung zum Tierlein der jungfräulichen<br />
Mutter Gottes“. Und im volksreligiösen Bereich bleibt an Bienen und<br />
Bienenzucht im Böhmerwald<br />
Franz Bayer<br />
bis er wieder einen neuen Weideplatz suchte. Nur ein Tier! Aber es erkannte mit<br />
seinem Instinkt Menschen, die es gut mit ihm meinten. So wie er mögen sich die<br />
vielen gut gepflegten Tiere verhalten haben als ihre Hausleute oft unter Tränen<br />
Abschied von ihren Helfern im Bauernhaus nehmen mussten. Mancher sicher<br />
nicht sentimentale Bauer hat den Abschied von seinen Pferden wie den Verlust<br />
guter Freunde empfunden. Oft ging die alte Bäuerin vor der Vertreibung noch mit<br />
dem „Sprengkessel“ (Weihwasserbehälter) in den Stall, um die Tiere dem Schutz<br />
einer höheren Macht zu empfehlen, als ahne sie welche Not auf die unschuldige<br />
Kreatur wartete.<br />
Heute gehört die Flur meines Heimatortes zu einem Landschaftsschutzgebiet und<br />
wird nicht mehr bearbeitet. Daher sind auch keine Nutztiere mehr im Dorf, und es<br />
gilt wahrlich das Wort des Waldpropheten: „Wer noch eine Kuh weiden sieht, der<br />
soll ihr ein silbernes Glöckel umhängen“. Ich wollte mit diesen Zeilen an die<br />
vielen treuen Helfer der Menschen erinnern, die wie sie unverschuldet in Not und<br />
Tod getrieben wurden.
46<br />
47<br />
„Nero“ hat er geheißen, ein stolzer und schöner Name für einen Mischling, war<br />
mittelgroß und von hellbrauner Farbe. Kaum einen Euro würde heute jemand für<br />
einen solchen Hund ausgeben, aber wenn man ihn genauer betrachtete und seine<br />
Augen sah, dann merkte man, das ist kein „dummer Hund“. Viel hatte er schon<br />
gesehen und erlebt auf seiner Wanderschaft mit seinen Herrn, gute und schlechte<br />
Menschen kennen gelernt, er wusste sie gut zu unterscheiden. Es gab nur einen<br />
Menschen für ihn, den er über alles liebte, den Scherenschleifer. Mit ihm zog er<br />
von Ort zu Ort und von Haus zu Haus. “Der Scherenschleifer ist da!”, so rief sein<br />
Herrchen schon vor der Haustür. Er war bekannt für seine gute Arbeit. Meistens<br />
waren es die Hausfrauen, die ihm ihre Scheren anvertrauten, die frisch geschliffen<br />
am Abend wieder ausgehändigt wurden. Darauf ging es zur nächsten Ortschaft.<br />
Seine Schleifmaschine war primitiv und musste mit dem Fuß in Schwung<br />
Der Hund des Scherenschleifers<br />
Karl Spannbauer<br />
Bienenstock immer noch etwas von der Jahrtausende alten Verehrung erhalten.<br />
So „isst“ die Biene und frisst nicht wie die anderen Tiere und wenn diese im<br />
bäuerliche Wortschatz „verrecken“, so sagt man von der Biene, sie „stirbt“. Auch<br />
im christlichen Jahresablauf wurde den Bienen ein Schutzpatron zuerkannt. Es<br />
ist der Hl. Ambrosius, der als Schutzpatron der Bienenzüchter gilt. Sein Attribut<br />
ist der Bienenkorb, auch der Hl. Bernard von Clairvaux, der zweite Gründer des<br />
Zisterzienserordens, hat unter anderen ebenfalls den Bienenkorb unter seinen<br />
Attributen. Die Imkerei stand in den vergangenen Jahrhunderten hoch in Ehren,<br />
nachdem auch die Klöster und die Kirche ihre Verbreitung betrieben und<br />
begünstigten.Bezeichnend für ihre Wichtigkeit in vergangenen Zeiten war, dass<br />
ein Bienenvolk genau so viel wert war wie eine Kuh. In unseren Häusern im<br />
Böhmerwald befand sich das „Beihäusl“, der Bienenstand, direkt beim Haus.<br />
Viele Ereignisse haben die Bienenzucht in den vergangenen Jahrhunderten beeinträchtigt,<br />
den Ertrag beeinflusst, konnten aber deren Weiterentwicklung nicht<br />
aufhalten. Aber in der Jetztzeit hat ein Schädling, aus dem Südosten unseres Kontinent<br />
kommend, entscheidend die Imkerei bedroht. Dieser Schädling ist erst seit<br />
1980 in unseren Landen aufgetreten. Es ist die Verroamilbe, welche in der Lage<br />
ist, ganze Bienenvölker zu vernichten.Trotz wissenschaftlicher Erfolge ist die<br />
Gefahr noch nicht ganz gebannt, wie das Frühjahr 2006 zeigte.<br />
In unseren früheren Wohngebieten, dem Böhmerwald, sind vielfach die Nutzbienen<br />
wieder zu Wildbienen geworden. Die „Beihüttn“ mit ihren Türen, Fenstern<br />
und Fluglöchern sind verschwunden, wenn sich nicht doch auch ein Bienenfreund<br />
unter den Besetzern befand.<br />
gebracht werden. Der Verdienst war gering, aber es reichte auch über’n Winter,<br />
denn da gab es keine Arbeit. Nero war sein einziger Freund, mit ihm teilte er sein<br />
letztes hartes Stück Brot. Er hatte nur noch eine alte Schwester, die ein wenig für<br />
ihn sorgte, den Hund aber mochte sie nicht, sie mochte überhaupt keine Tiere.<br />
Nero und sein Freund zogen gemeinsam den kleinen Wagen durch die Gegend<br />
und fanden immer wieder gute Menschen, die ihnen eine warme Suppe oder ein<br />
Stück Brot anboten.<br />
So lebten beide glücklich und zufrieden etliche Jahre lang, bis der Scherenschleifer<br />
krank wurde und nicht mehr gehen konnte. Seine größte Sorge war der Hund.<br />
„Was mach ich nur mit meinem Hund?“, war seine bange Frage. Seine Schwester<br />
wollte ihn auf keinen Fall nehmen. Auf seiner letzten Fahrt kam er auch nach<br />
Pumperle, er kam auch zu uns. Er erzählte meinen Großeltern von seiner großen<br />
Sorge um den Hund. Die Großeltern hatten Mitleid mit dem Scherenschleifer, der<br />
für sie schon ein alter Bekannter war und sie hatten Mitleid mit dem Hund. So<br />
kam der Nero zu uns ins Xanderhaus und wurde Hofhund. Er soll lange nach<br />
seinen alten Freund geweint haben, aber die gute Pflege und die Liebe hat ihn<br />
doch nach einiger Zeit den Schmerz der Trennung überwinden helfen. Allmählich<br />
fand er Zutrauen zu seinen neuen Menschen, besonders zum Großvater, denn<br />
dieser nahm ihn überall mit, auf’s Feld, auf die Wiese und in den Wald, er sprach<br />
mit ihm wie mit einen Menschen.<br />
Mit der Katze entstand fast eine Freundschaft, nur seiner Futterschüssel musste<br />
sie fern bleiben. Die schöne Hundehütte benutzte er nur bei schlechten Wetter,<br />
aber seine Augen waren überall und ohne sein Wissen kam niemand ins Haus.<br />
Eines Morgens, als der Großvater aufstand und seine Hausschuhe suchte, brachte<br />
Nero ihm zuerst den einen und dann den zweiten. Von diesen Tag an standen<br />
jeden Tag die Hausschuhe vor seinen Bett.<br />
Später einmal hat der Großvater seinen Tabaksbeutel irgendwo verlegt und konnte<br />
ihn nicht finden. Nero half ihm suchen und nach kurzer Zeit brachte er den<br />
gesuchten Tabaksbeutel.Alle freuten sich über den gescheiten Hund und so entstanden<br />
richtige Suchspiele an denen alle hatten die größte Freude hatten. Später<br />
schickte ihn Großvater auch in die Tabaktrafik zum Tabakholen.<br />
Ab und zu kamen die Zigeunerwagen und blieben über Nacht im Dorf. Die Zigeuner<br />
stahlen manchmal wie die Raben. So kam es einmal, dass zwei Zigeunerinnen<br />
zu uns kamen, die eine ging zur Haustür und bettelte um ein Stücklein Brot<br />
für ihre sieben Kinder, während die andere unbemerkt, wie sie glaubte, in den<br />
Hühnerstall schlich. Aber Nero hatte es gesehen, er ließ die Zigeunerin nicht<br />
mehr aus dem Hühnerstall, bis jemand aus dem Haus kam. Ähnlich wie der<br />
Zigeunerin erging es einmal einem Fuchs, der sich nachts ein Hühnchen holen<br />
wollte. Er kam zwar hinein, aber nicht mehr heraus, Nero hatte ihm den Weg<br />
versperrt.<br />
Eines schönen Tages mähte Großvater die Waldwiese, nach einer Zeit merkte er,<br />
dass die Sense keine Schneid mehr hatte und auch das Wetzen nicht mehr half.<br />
Das Dengelzeug hatte er ja mitgenommen, aber die Brille daheim vergessen. Er
48<br />
49<br />
Gegen Ende April konnte man bereits den Ruf des Kuckucks hören. Er kam als<br />
Sommergast zu uns in den Böhmerwald, denn er blieb ja nur bis zum August bei<br />
uns. Dann zog er wieder in den Süden. Die Waldbesitzer hatten diesen scheuen<br />
Vogel recht gern, denn er vertilgte verschiedene Raupen und Insekten, die andere<br />
Vögel verachteten. Mit Vorliebe fraß er behaarte Raupen, so die des Fichtenspinners,<br />
des Kiefernspinners und der Kieferneule. So nützlich er sich von dieser<br />
Seite zeigte, so unerfreulich ist seine Brutmethode. Vielen jungen Singvögeln<br />
kostet sie nämlich das Leben.<br />
Das Kuckucksweibchen legt seine Eier in die Nester anderer Vögel und zwar<br />
überwiegend in die Nester von Singvögeln. Eine besondere Vorliebe hat sie für<br />
die Nester des Rotkehlchens, des Rotschwänzchens und der Bachstelze. Weil der<br />
Kuckuck schneller wächst wie seine Nestbrüder, so drängt er sie alsbald aus dem<br />
Nest, wo sie dann eingehen. Alt und Jung horchten im Frühjahr auf den ersten<br />
Kuckucksruf. Wenn man dabei seinen Geldbeutel schüttelte, ginge einem das<br />
ganze Jahr das Geld nicht aus. Ebenso wurden die ersten Kuckucksrufe gezählt,<br />
da es allgemein hieß, so oft der Ruf erschallt, so viele Jahre würde man noch<br />
leben. (Überarbeitet von Ingomar Heidler)<br />
Der Kuckuck<br />
Adolf Heidler<br />
schickte Nero, um die Brille zu holen. Auch diese recht schwierige Aufgabe meisterte<br />
der Hund mit Bravur.<br />
Eine besondere Spezialität Neros war (niemand hatte es ihm beigebracht), am<br />
Abend nach den Hühnern zu schauen und zu überprüfen, ob auch alle auf ihrer<br />
Stange im Hühnerstall saßen. Er musste jedes der Hühner genau gekannt haben<br />
und kam es vor, dass eines von ihnen fehlte, dann fing er an zu suchen, bis er es<br />
irgendwo auf einem Baum, im Fliederstrauch oder auch sonst wo fand. Er gab<br />
keine Ruhe, bis alle Tiere im Hühnerstall waren. Manch andere ähnliche Geschichten<br />
wären noch zu berichten, aber die erzählten reichen wohl, um zu zeigen,<br />
dass man nicht nach dem Äußeren urteilen kann, dieser unscheinbare<br />
Mischlingshund wurde für alle im Haus zum treuen Freund und war „unbezahlbar“.<br />
Er starb nicht an Alterschwäche oder an einer Krankheit, sondern an der<br />
neuen Technik. Es war gerade die Zeit, als man auch bei uns im Böhmerwald die<br />
ersten Autos auf der Straße sah. Für den Nero war das etwas Unbekanntes und<br />
Böses, vor dem er seine Leute schützen wollte. Er wurde von einen solchen Ungetüm<br />
erfasst und getötet. Großmutter erzählte mir, wie sehr sie ihren Nero vermisst<br />
und betrauerten, er fehlte einfach überall. Einen Hund gab es bei uns seit<br />
dem mehr.<br />
Im Sommer 1941 durfte ich in Hintring die Jagd ausüben. Der Jagdpächter hatte<br />
mir einen Rehbock zum Abschuss freigegeben, der nach seinen Angaben ein zurückgesetzter<br />
Sechser war, aber nur eine Stange wie ein Spießer aufhatte. Der<br />
Pächter zeigte mir weit unten in den Moldauauen den Wechsel des Bockes. Bei<br />
den ersten Ansitzen kamen außer einer Rehgeiß mit zwei Kitzen kein Bock. Wieder<br />
saß ich auf der Kanzel. Zwei Stunden vergingen, nichts rührte sich. Die Sonne<br />
war längst untergegangen, ich wollte gerade vom Hochsitz steigen, als sich ca.<br />
zweihundert Gänge vor mir ein roter Fleck auftat. Teilweise war er von herabhängendem<br />
Gezweig verdeckt. Lange rührte sich nichts, aber schließlich bewegte<br />
sich der Fleck und heraus trat ein Bock. War es der, den ich suchte? Sein Haupt<br />
bleibt immer noch verdeckt von den Zweigen, so dass ich ihn nicht ausmachen<br />
konnte. Irgendwo wurden Stimmen laut. Der Bock reagierte entsprechend und<br />
verschwand. Ein paar Tage später bekam ich den Bock wieder zu Gesicht. Spitz<br />
zog er meinem Ansitz entgegen. Es war der ersehnte. Tatsächlich hatte er nur eine<br />
Stange, spitz und lang. Er verhoffte nur kurz und verschwand dann wieder im<br />
Gebüsch. Die Zeit verging. Plötzlich links von mir ein leises Knicken. Da stand<br />
auf zwanzig Schritte ein Bock. Aber nicht mein Bock. Ein Bock mit zwei Stangen.<br />
Auch er zog schnell wieder ins Gebüsch zurück.Dieses Spiel, erst mein Bock<br />
außerhalb der Schussweite, dann der andere mit den zwei Stangen, wiederholte<br />
sich zwei dreimal hintereinander. Vier Wochen wartete ich nun schon auf den<br />
Abschuss des Einstangenbockes.Wieder saß ich an. Wieder dasselbe. Zuerst der<br />
Bock mit einer Stange, jedoch weit außerhalb der Schussweite, dann eine Stunde<br />
später der mit den zwei Stangen. Auch er war ein Abschussbock, aber er war mir<br />
ja nicht freigegeben. Dieser Bock stand und stand als wartete er auf seinen Tod.<br />
Da fasste ich den Entschluss, zog die Büchse an die Wange und drückte den<br />
Abzug. Grob verdarb der Knall die Waldabendstille. Der Bock brach im Feuer<br />
zusammen. Erst jetzt wurde mir bewusst, was denn der Jagdpächter dazu sagen<br />
würde, da ich ja den verkehrten Bock geschossen hatte. Langsam näherte ich<br />
mich dem verendeten Bock, Da lag er vor mir in seiner roten Pracht, das Gras<br />
gefärbt von seinem Lungenschweiß. Dann mein Blick auf das Gehörn, nur eine<br />
Stange. Als ich aber noch näher trat, zeigte er auf einmal doch zwei Stangen, wie<br />
konnte das sein? Tatsächlich war es so, dass beide Stangen so hintereinander<br />
gestellt waren, dass man spitz nur eine, von der Seite aber zwei Stangen zu sehen<br />
bekam. Vier Wochen lauerte ich auf den einen und ließ ihn immer für den anderen<br />
weiterziehen. Das leise Rauschen der Moldau, die gegen Salnau hinzog, begleitete<br />
mich auf meinem Heimweg. Blauschwarz zeichneten sich ringsherum<br />
die weiten Wälder vom Horizont ab und die ersten Sterne leuchteten bereits am<br />
Himmel. Spürbar lag Ruhe und Frieden über der Natur. (Überarbeitet von Ingomar<br />
Heidler)<br />
Ein kurioses Jagderlebnis<br />
Adolf Heidler
50<br />
51<br />
Brennet, der höchstgelegene Ortsteil von Eisenstrass, wird umschlossen von den<br />
Wäldern, die sich um den Brennetberg gelagert hatten. Trotzdem undurchdringlicher<br />
Urwald dieses Gebiet noch bedeckte, wurde es bereits früh von Handelsleuten<br />
und Kriegsvölkern durchzogen. Dazu wurden schon vor der Jahrtausendwende<br />
Steige durch den Urwald geschlagen. Schaurig klang das Geheul der Wölfe<br />
durch den Wald und das Röhren der Hirsche widerhallte bis hinunter in die Schluch-<br />
Es ist nicht verwunderlich, dass in einem Gebiet wie dem Böhmerwald, der heute<br />
noch viele Geheimnisse in seinen dunklen Wäldern, Mooren und Sümpfen birgt,<br />
seine dort lebenden Menschen dem Aberglauben zum Opfer fielen. Die Abgeschiedenheit<br />
der einzelnen Bauernhöfe von ihren Nachbarn, irgendwo mitten im<br />
Wald, gibt schon Gelegenheit genug, alle Geschehnisse ohne Zutun eines Dritten<br />
selbst zu erforschen und letzten Endes das Rätsel zu lösen. Was bleibt da sonst<br />
übrig, als alles Vorhergehende sich durch den Kopf gehen zu lassen und da haben<br />
Urwald am Brennetberg<br />
Die Tierwelt im Aberglauben des Böhmerwaldes<br />
Adolf Heidler<br />
Adolf Heidler<br />
Zeitig in der Früh war der Schafhirt Hiasl auf dem Dorfanger und blies dreimal in<br />
sein Kuhhörndl. Kaum war der letzte Ton verklungen, kamen die Schafe aus allen<br />
Häusern und jedes wollte am nächsten zu ihm. Die Schafe mochten ihn, so<br />
wie er sie auch liebte. Überhaupt: Das, was der Hiasl seine Heimat nannte, das<br />
belauschte er mit offenen Augen und hellen Ohren. Ein jedes Weglein, jeden<br />
Baum, jeder Stein ist ihm ein Heiligtum gewesen. Er redete mit den Vögeln und<br />
den Tieren im Wald und mit seinen Schafen und vor allem mit seinem Hund, dem<br />
Spitz. Mit dem konnte er reden wie mit einem Menschen. Grad angeschaut hat<br />
ihn dabei der Spitz, die Ohren aufgestellt, damit er nichts überhört hat. An einem<br />
Sonntag weidete der Hiasl seine Schafe ganz in der Nähe des Dorfes. „Ich gehe´<br />
heut in die Kirche“, sagte er zu den Schafen. „Bleibt mir schön beisammen und<br />
lauft mir nicht davon, ich bin bald wieder da.“ Schnell ging er auf die Kirche zu.<br />
Als er sich umschaute, sah er den Spitz ganz traurig dreinschauen, weil er bei den<br />
Schafen bleiben sollte. Da hat er dem Hiasl leid getan, und er hat ihn gerufen:<br />
„Geh´Spitz, darfst auch mitgehen in die Kirchen, aber schön braf musst sein.“<br />
Wie das der Hund hört, saust er dem Hiasl nach. In der Kirche ist der Hiasl ganz<br />
hinten beim Weihbrunnkessel stehen geblieben, und der Spitz hat sich brav zu<br />
seinen Füßen hingesetzt. Der Pfarrer hat gerade vom guten Hirten gepredigt. Dem<br />
Hiasl ist dabei ganz warm ums Herz geworden. Aber dann hat der Pfarrer zweimal<br />
hintereinander gerufen: „Ein guter Hirt verlässt seine Herde nicht!“ Dabei hat er<br />
hingeschaut auf den Weihbrunnkessel zu. Da ist es dem Hiasl heiß aufgestiegen.<br />
Er hat sich zu seinem Spitz hinuntergebückt und ihm leise ins Ohr gesagt: „Geh,<br />
Spitzl, komm, da gehen wir wieder, der Pfarrer fängt zum Sticheln an!“ und er ist<br />
mit seinem Spitz fortgeschlichen zu seinen Schafen. (Überarbeitet von Ingomar<br />
Heidler)<br />
Der gute Hirt<br />
ten des Grünbaches. Der Braunbär, der Luchs und die Wildkatze sonnten sich an<br />
den Südhängen des Brennetberges. Habichte und Falken schwangen in den Lüften<br />
über dem unermesslichen Waldmeer und ihre scharfen Lichter spähten nach<br />
Beute. Der Auerhahn balzte im Gehölz und es prasselte und krachte hinter ihm,<br />
wenn er sich zum Fluge erhob. Aus dem Dunkel des Waldes ließ der Uhu sein<br />
klägliches „Buhu“ erschallen. Dazwischen hinein pfauchten die Waldkäuze und<br />
andere Eulen glitten wie Geister durch die Lüfte.So mag es gewesen sein, als sich<br />
die ersten Ansiedler am Brennet festsetzten. Mitten in diese Urwaldlandschaft<br />
hinein bauten sie ihre Blockhäuser und setzten so den Grundstein für eine Heimat,<br />
die ihnen über alles heilig war. Soweit das Auge reichte, bot sich ihnen ein<br />
herrlicher Ausblick hinein ins Böhmische und hinüber zu den Grenzen des Bayernlandes.<br />
Die Jahreszeiten vergingen und in den langen Winternächten, wenn der<br />
Sturmwind den Schnee vor sich hertrieb, dass man kaum die Augen offen halten<br />
konnten, und sich meterhohe Wächten um die Häuser türmten, Wege und Stege<br />
versperrten, dann war die Zeit gekommen, wo man sich beim prasselnden Feuer<br />
in der Stube Erlauschtes und Erlebtes aus vergangenen Tagen erzählte. Dass dabei<br />
besonders der Wald mit seinen Tieren eine große Rolle spielte, war klar. Die weiten<br />
und unwegsamen Steige hinunter ins Tal führten durch den Wald und nicht<br />
selten drohte den Wanderern von den wilden Tieren Gefahr. So ein Gang durch<br />
die finsteren Urwald erheischte Furchtlosigkeit, Mut und Entschlossenheit, Hellseligkeit<br />
und Hellhörigkeit, um jedwede Gefahr vorzeitig zu erkennen und rechtzeitig<br />
abzuwenden. Nicht weniger gefahrvoll war die Jagd auf Bären, die vorzügliches<br />
Fleisch lieferten. Kämpfe zwischen Hirten und Wölfen mussten ausgefochten<br />
werden, wenn diese in die Herden einfielen. Mancher trug tiefe Narben<br />
im Gesicht und an den Händen. Ein freudiges Jubeln durchzog dann alle Gehöfte,<br />
wenn so ein Räuber wieder einmal erlegt war. Gaben diese Begebenheiten nicht<br />
Stoff genug zu Erzählungen und Geschichten? Viele dieser Geschichten verfielen<br />
durch die Jahrhunderte der Vergessenheit anheim und nur wenige sind der<br />
Nachwelt erhalten geblieben. (Überarbeitet von Ingomar Heidler)<br />
Adolf Heidler
52<br />
53<br />
wir es schon. – Gestern Abend hat eine Nachteule ganz in der Nähe des Hauses<br />
ihr Heulen und Wimmern hören lassen und in der gleichen Nacht ist die Großmutter<br />
gestorben. „Nachteule und der Tod im Hause“ gaben den festen überzeugten<br />
Anhaltspunkt zu dem Geschehen. Der Glaube an Hexen, Druden, Geister und<br />
andere Spukgestalten gab noch seinen Senf dazu und kein Mensch hätte sich vor<br />
Jahren den überzeugenden Überlieferungen der Alten widersetzt. So pflanzte sich<br />
der Aberglaube von einer Generation auf die andere fort. So haben es ihm seine<br />
Vorfahren erzählt und so erzählt er es seinen Kindern weiter.<br />
So gibt es viele Tiere, an denen der Aberglaube haftet. Von einigen, die mir noch<br />
in Erinnerung sind, will ich erzählen.<br />
Der Volksmund sagt über die Nachteule, die ich schon erwähnt habe, dass ein<br />
Mann, der von seinem bösen Weibe gar arg traktiert wurde diese mit folgenden<br />
Worten wegschickte: „Du verfluchte Nachteule, schau, dass du in den Wald hinauskommst,<br />
damit ich dich nicht mehr sehen muss!“ Im gleichen Augenblick war<br />
das Weib in eine Nachteule verwandelt und flog beim Fenster hinaus. Seitdem<br />
heult sie des Nachts draußen im Wald. Oft konnte man über böse, geschwätzige<br />
oder hässliche Weiber hören: „Dös is a Nachtal!“.<br />
Wer beim ersten Kuckucksruf im Frühjahr seine Geldbörse richtig schüttelt, dem<br />
geht das ganze Jahr über das Geld nicht aus. Gar arge Gedanken plagten da so<br />
manchen, wenn er kein Geld bei sich hatte, wenn der Kuckuck rief. Mit leiser<br />
Erregung werden die Rufe des Kuckucks gezählt, denn, so oft er sein „Kuckuck“<br />
erschallen lässt, so viele Jahre verbleiben einem noch zu leben.<br />
Der Ziegenmelker, auch Moosziege genannt, soll nach dem Volksglauben die<br />
Kühe und auch die Ziegen ihrer Milch berauben. Lässt er seinen Ruf in der Nähe<br />
eines Hauses ertönen, bedeutet es ein bevorstehendes Unglück. Als Wettervogel<br />
wird von ihm gesagt: „Schreit die Moosziege lang in den Abend hinein, wird<br />
oder bleibt Schönwetter auf lange Sicht.“ Die Ringelnatter, auch Hausschlange<br />
genannt, wird gerne im Misthaufen beim Hause geduldet. So heißt es: „Wo eine<br />
Hausschlange sich hält, ist´s um den Hausfrieden gut bestellt.“ Wenn der Fuchs<br />
auf Raub ausgeht, macht er einen großen Bogen um das Haus. Turteltauben wurden<br />
in früheren Jahren viel gehalten, weil sie Haus und Hof vor Blitzschlag schützten.<br />
Geschlachtet durften sie überhaupt nicht werden, da sonst ein Unglück ins<br />
Haus kam. Der Aberglaube, dass Turteltauben den Rotlauf an sich ziehen, war<br />
weit verbreitet. Der Wachtelruf wurde mit der Fruchtbarkeit der Getreidesaaten<br />
in Verbindung gebracht. So konnte man von den Alten noch hören: „So oft die<br />
erste Wachtel schlägt, so viel Kreuzer kostet das Viertel Korn. Je früher sie sich<br />
im Frühjahr hören lässt, umso ertragreicher die Frucht.“ In manchen Gegenden<br />
des Böhmerwaldes, aber auch weiter drinnen im Tschechischen war bei den Ledigen<br />
der Ruf der Wachtel sehr bedeutsam. Denn, so oft sie im Frühjahr ihr erstes<br />
„switt, swilliwitt“ erschallen ließ, so viele Jahre blieben sie noch unverheiratet.<br />
Der Andreastag (30. November) war, wie mir der alte Kreßen Wenz aus Eisenstrass<br />
erzählte, für die heiratslustigen Mädchen ein ganz besonderer Tag. Noch bis<br />
in die Mitte des vorigen Jahrhunderts hielt sich dieser Brauch und Aberglaube.<br />
Dem ältesten Hahn im Dorfe wurden die Augen verbunden. Dann wurde er in die<br />
Mitte des Kreises gestellt, den die Mädchen bildeten. Das Mädchen, auf welches<br />
nun der Hahn losging, wurde im nächsten Jahr glückliche Braut. Auch die Bienen<br />
waren dem Aberglauben verfallen. So hieß es: „Wo Unfriede im Haus, dort ziehen<br />
die Bienen aus.“ Als ich noch Hüterbub war, fragte mich eines Tages der alte<br />
Kreßen Wenz, ob ich wüsste, warum die Bienen den dreiblättrigen Klee meiden.<br />
Da ich die Frage verneinte, erzählte er mir: „Wie der liebe Gott die Welt erschaffen<br />
hat, setzte er den siebten Tag als Ruhetag ein. Das fleißige Volk der Bienen<br />
aber kannte keinen Sonntag. Da versammelte er alle Bienen um sich und sprach<br />
zu ihnen: „Weil ihr den Sonntag nicht haltet, verbiete ich euch den dreiblättrigen<br />
Klee zu befliegen!“ Die Bienen meiden seit dem diese Blüten und arbeiten sonnund<br />
wochentags. Fledermäuse waren zumal bei Kindern gefürchtete Tiere. Wurde<br />
ihnen schon von klein auf erzählt, dass sie Kindern in die Haare fliegen und<br />
dann nicht mehr wegzubringen sind. Der Volksmund aber sagt: „Wo Fledermäuse<br />
im Haus, geht das Glück nicht aus.“<br />
Schnecken sind Tiere, die eine besondere heil- und schönheitswirkende Kraft<br />
besitzen. Lässt man eine Schnecke über Warzen kriechen und steckt sie dann auf<br />
einen dürren Ast, so vergehen die Warzen, sobald die Schnecke verfault ist. Som-<br />
Im früheren Böhmerwaldmuseum<br />
Oberplan schmückte<br />
ein ausgestopfter Bär die<br />
Tierstube. Foto: Josef Seidel,<br />
Krummau (Sammlung Reinhold<br />
Fink)
54<br />
55<br />
Von frühester Jugend mit dem Wald und so auch mit seinen Bewohnern vertraut,<br />
gab es eine Tierart, die in unserer Gegend sehr präsent war, mit der ich nie vertraut<br />
wurde, ja, die immer und überall mein Entsetzen hervorrief: Schlangen!<br />
Es gab Kreuzottern, Kupfernattern, Ringelnattern und die Blindschleiche. Aber<br />
selbst diese kleine harmlose Echse ließ mich als Kind schnellstens aus ihrer Nähe<br />
flüchten. Beim Beeren pflücken mied ich möglichst jeden Stein, denn Kreuzottern<br />
sonnten sich da gerne. Ich ließ die Hand meines Vaters nie los, wenn wir an<br />
einer aufgeschichteten Steinmauer vorbei gingen, von der bekannt war, dass hier<br />
die Kupfernatter lebte.Ein Erlebnis ist mir auch heute noch sehr gegenwärtig. Ich<br />
Als Raubtier ward er ja geboren,<br />
nur lässt man ihn nicht ungeschoren,<br />
dann das tun, wo zu’s ihn drängt -<br />
der Mensch ist manchmal schon beschränkt.<br />
Dann ist sein Blick leicht irritiert,<br />
was mich zu dem Gedanken führt,<br />
dass er sich fühlt total verkannt,<br />
suspekt ist ihm dann mein Verstand.<br />
Waldbewohner<br />
Anne Klarner<br />
Und manchmal haben wir auch Krieg!<br />
Vorbei ist’s dann mit aller Lieb.<br />
Kommt er mit einem Vogel an,<br />
schrei ich voller Empörung dann:<br />
„Lässt du ihn augenblicklich aus!<br />
Das ist ja schließlich keine Maus!“<br />
mersprossen werden vertrieben, wenn man sich mit einer Schnecke einreibt. Wenn<br />
der Schleim trocken ist und abgezogen wird, sind die Sommersprossen verschwunden.<br />
Auch der Froschlaich nimmt die Sommersprossen fort, wenn man sich mit<br />
ihm einreibt. Auf Kopfkissen mit Hühnerfedern kann man weder schlafen noch<br />
sterben; da ist die Unruhe drinnen, sagt der Volksmund. Daher wurden auch bei<br />
Sterbenden die Kopfkissen gewechselt, damit sie leichter hinüberschliefen.<br />
Einmal beobachtete ich, wie ein Bauer mit seinem Knecht ein Rind rücklings in<br />
den Stall schob. Auf meine Frage, warum er dies tue, sagte er: „Das tut man nur,<br />
wenn man ein Stück aus fremden Händen kauft und das erste Mal in den Stall<br />
führt, damit es nicht verhext werden kann.“ Spinne am Morgen bringt Kummer<br />
und Sorgen. Spinne zu Mittag bringt Glück am dritten Tag. Spinne am Abend,<br />
bringt Glück und Gaben. Eine Spinne töten, bringt Unglück. Läuft eine Spinne<br />
über den Weg, so ist es besser, man kehrt um oder geht einen anderen Weg. Läuft<br />
eine Katze über den Weg, so bedeutet dies nichts Schlechtes, wenn sie von links<br />
kommt. Denn es heißt: „Läuft die Katz von links nach rechts, bedeutet es noch<br />
lang nichts Schlecht´s.“ Kommt sie aber von rechts, bedeutet das nichts Gutes.<br />
So beinhaltet der Aberglaube alles, was im Leben des Menschen von Bedeutung<br />
ist, Glück, Unglück, Gutes und Böses. Und der Zufall bekräftigt aber immer wieder<br />
aufs neue den Glauben und niemand zweifelt daran. Heute in unserer schnelllebigen<br />
Zeit geraten solche Vorkommnisse schnell in Vergessenheit oder werden als<br />
lächerlich abgetan. Wenn mir aber jemand sagt, dass der Aberglaube nur bei den<br />
Hinterwäldlern zu Hause ist, so möchte ich ihm folgende Begebenheit erzählen.<br />
Ich besuchte einmal eine vornehme und hochintelligente Familie. Gerade hatte<br />
ich die Frau begrüßt, als sie mir sagte: „Ich habe ja gewusst, dass wir heute Besuch<br />
bekommen, unsere Muschi, die Katze, hat sich in aller Frühe schon geputzt.“<br />
Meinen Sie nicht, dass dies auch schon ein Stück Aberglaube ist? (Überarbeitet<br />
von Ingomar Heidler)<br />
Er tut nur das, was er grad will,<br />
mit leisen Tönen, stur und still.<br />
Wenn ich auch schmeichle, locke<br />
„Felixlein -<br />
komm doch ein bisschen zu mir rein!“<br />
Dreht er sich um, gelangweilt fast<br />
und tigert weg, ganz ohne Hast.<br />
Ich wünschte auch, ich könnt’ gelassen<br />
voll Anmut ruh’n, mit Nonchalance,<br />
doch wenn ich mich auch sehr bemühe,<br />
gelingt es mir halt nicht so ganz.<br />
Er schaut mich an mit grünen Augen -<br />
ich wüsste gern, was er jetzt denkt,<br />
es ist nur so, dass, wenn ich renne,<br />
mich seine Ruhe fast beschämt.<br />
Kater Felix<br />
Anna Klarner<br />
turnte am offenen Stubenfenster (ebenerdig) herum, fiel dabei aus dem Fenster<br />
und landete im Garten neben einer Schlange, die sich da an der Hausmauer sonnte.<br />
Meine Mutter rannte über meine wilden Schreie erschrocken herbei. Eines<br />
Abends waren wir in der Dämmerung noch beim Baden an einem nahen See. Als<br />
wir am Ufer herumplanschten, sah ich plötzlich auf der Wasseroberflüche einen<br />
Schlangenkopf, der sich uns näherte.... erstaunlich, dass ich auch trotzdem<br />
weiterhin bereit war, in diesem See zu baden. Aber buchstäblich war es für mich<br />
„die Schlange im Paradies“.
56<br />
57<br />
Ich lausch’ begeistert, bin entzückt<br />
und denk’, es ist verrückt:<br />
Mensch - Vogel<br />
Größe - Stimme<br />
Relation,<br />
wie käm’ der Mensch<br />
da schlecht davon!<br />
Was diese kleine Brust so bringt.<br />
Das schmettert, jubelt, trillert, klingt.<br />
Ein Winzling sitzt ganz hoch im Fliederbaum,<br />
er singt sehr laut - man sieht ihn kaum!<br />
Abendständchen<br />
Anne Klarner<br />
Anne Klarner: Klematis,<br />
Seerosen und Mohn
58<br />
59<br />
Bei uns in Langendorf gab es zwei Fischteiche, die beide vom „Krebsn-Bachl“<br />
gespeist wurden, der von den sauren Wiesen unterhalb vom „Socherberg“ kam.<br />
Am unteren Teich, dem Dorfweiher, der um einiges größer war und dem Schlossbesitzer<br />
Fürst Schwarzenberg gehörte, wurden Karpfen gezüchtet. Jedes Jahr vor<br />
Weihnachten wurde das Wasser abgelassen und die Fische abgefangen. Trotz<br />
sorgfältigem Fang ging manch einer doch durch die Netze, aber unterhalb des<br />
Teiches warteten schon Leute, die sich auf einen entwichenen Fisch freuten, denn<br />
es gab dann wieder etwas Abwechslung auf dem Teller. Am oberen Teich, in der<br />
Nähe des jüdischen Friedhofs, wurden die jungen Fischlein herangezogen. Zur<br />
Freude von uns Kindern, denn wir probierten dort unsere ersten Angelkünste aus.<br />
Wenn man Glück hatte, konnte man - manchmal aber erst nach mehreren Stunden<br />
- einige kleine Fischlein einfangen. Die brachten wir dann schnellstens zum Lederer-Maxl,<br />
der sie an seine Hühner verfutterte. Er gab uns dafür ein kleines<br />
Stückchen Johannisbrot oder Bärendreck. Wir hatten dabei die größte Freude<br />
und es war jedem geholfen.<br />
Eines Tages gab es einen großen Menschenauflauf vor dem Haus vom Lang Karl<br />
beim Weiher unten. Die Männer waren mit Mistgabeln, Schaufeln oder Besen<br />
bewaffnet und umzingelten das ganze Haus. Das hatte sich natürlich schnell herumgesprochen<br />
und wir Kinder waren auch sofort zur Stelle und wollten wissen,<br />
was das zu bedeuten hat. Es wurde uns gesagt, dass sich auf dem Heustadl ein<br />
Marder verkrochen hatte, der bei der Nacht die Hühner getötet hatte. Es dauerte<br />
mehrere Stunden, bis das Tier eingefangen werden konnte. Das war natürlich für<br />
uns Kinder wieder einmal ein besonderes Erlebnis, denn bei uns in Langendorf<br />
war immer etwas los.<br />
Wie man weiß, hatten die Bauern früher Pferde zur Feldarbeit, die etwas kleineren<br />
Höfe hatten Kühe, die auch als Zugtiere verwendet wurden. Und die noch<br />
kleineren Häusler hielten sich Ziegen, damit sie Milch für den täglichen Gebrauch<br />
hatten. Im Herbst, wenn das Getreide abgeerntet war, wurden die Ziegen und<br />
auch die Kühe auf die Stoppelfelder zur Weide getrieben. Wir Kinder mussten<br />
dann die Tiere hüten und hatten sehr viel Spaß, denn man traf sich dabei auch<br />
zum Kartoffel- und Holzäpfel braten. Es ging immer sehr lustig zu, denn es kamen<br />
sehr viele Kinder zusammen.<br />
Im „Bali-Bichel“ hatten mehrere Familien vom „Richter-Hof“ einen kleinen Teil<br />
Felder und Wiesen gepachtet, es war auch ein kleines Stück Wald und Hecken<br />
dabei. Dort hatte sich eine Rebhuhnfamilie eingenistet, die jedes Jahr an dieser<br />
Stelle ihre Jungen aufzog. Ich habe in späteren Jahren noch oft an diese<br />
„Rebhendln“ gedacht. Als wir nach über 50 Jahren wieder in den Böhmerwald<br />
fuhren und einen Spaziergang zur Kirche und auf den Friedhof machten, gingen<br />
wir am Haus vom „Binterich“ vorbei. Ich erzählte von dem Ziegenböcken, die<br />
der „Binterich“ und auch der „Mirkerer-Bauer“ besaßen und auch vom Ziegen<br />
hüten. Dabei zeigte ich auch den Platz, wo ich früher immer die Ziegen hüten<br />
musste und plötzlich kam uns zu unserer großen Überraschung eine Rebhuhn-<br />
Familie entgegen. Es war fast unglaublich nach so langer Zeit. Diese kleinen<br />
Rebhendln haben also ihren Platz nicht verlassen und wohnen nun schon seit<br />
Jahrzehnten immer noch in den Hecken im „Bali-Bichel“.<br />
Auf dem Weg von Langendorf nach Neustadln musste man über die Rechelbrücke<br />
und nach der Rechelbrücke ging der Weg durch den „Schwarzwald“ nach Nuserau.<br />
Ging man weiter in Richtung Neustadln, kurz vor dem „Reimhaisel“ am Waldende<br />
ging ein Fußweg nach Körnsalz. Auf der Anhöhe stand ein Kreuz, man<br />
nannte es „Samerkreuz“ am Säumerweg. Man sagte uns Kinder, dass es dort<br />
„weihrizt“ (geistern). Man konnte dieses Schauspiel im Sommer bei Nacht, wenn<br />
man unten auf der Straße vorbeiging, beobachten. Es war weithin zu sehen, es<br />
sah aus wie ein großer Feuerball, der sich bewegte. Man dachte, es brennt dort<br />
oben. Eines Tages machten sich einige mutige Buben auf dem Weg zum Samerkreuz,<br />
um nachzusehen, was dort oben für ein Geist spukte und siehe da, sie<br />
konnten das Rätsel lösen. Es war ein sehr großer, verfaulter Baumstumpen. Dort<br />
hatten sich tausende kleiner Leuchtkäfer - Glühwürmchen - eingenistet. Sie flimmerten<br />
bei Dunkelheit um den Baumstamm und gaben dazu ihr Konzert. Wären<br />
diese wagemutigen Burschen nicht gewesen, wüsste man bis heute noch nicht,<br />
wer da oben „weihrizt“.<br />
Nach meinem Schulabschluss - mit 14 Jahren - musste ich ein Pflichtjahr in der<br />
Landwirtschaft machen. Da der „Odum-Otto“ - der Mann von meiner Cousine -<br />
einen Hof in Nuserau hatte, entschloss ich mich damals, dieses Pflichtjahr bei<br />
ihm zu machen. Ich war das erste Mal in meinem Leben von zu Hause weg. Am<br />
Anfang fiel es mir sehr schwer und ich hatte ein bisschen Heimweh, aber mit der<br />
Zeit gewöhnte ich mich daran, bei anderen Leuten zu sein. Ich konnte ja am<br />
Sonntagnachmittag immer nach Hause zu meinen Eltern nach Langendorf gehen.<br />
Es gefiel mir dann sehr gut, denn es machte mir großen Spaß mit Tieren umzugehen.<br />
Auf dem Hof gab es zwei Ochsen, die als Zugtiere verwendet wurden und<br />
die wirtschaftlicher waren als Pferde, sagte der Otto, denn Pferde mussten zwei<br />
Stunden vor der Arbeit gefüttert werden. Bei den Ochsen war das anders, die<br />
wurden zusammen mit den Kühen und Kälbern gefüttert und wurden jedes Jahr<br />
kräftiger und schwerer an Gewicht. Im Herbst, wenn die Feldarbeiten abgeschlossen<br />
waren und die Ochsen gut genährt und kräftig waren und genügend Fleisch<br />
angesetzt hatten, wurden sie verkauft, damit wieder Geld ins Haus kam, um im<br />
Winter für’s Frühjahr wieder ein neues Gespann zu kaufen, denn ohne Fuhrwerk<br />
kann man keine Landwirtschaft bearbeiten.<br />
Ich fragte den „Odum-Otto“: „Wann werden wir wieder neue Ochsen kaufen“.<br />
Ich fragte jeden Tag bis er an einem Abend sagte: „Gehe heute bald ins Bett, wir<br />
müssen morgen früh aufstehen um neue Ochsen zu holen“. Nach dem Frühstück<br />
ging es los. Mit warmer Kleidung, guten Schuhen und mit einigen Kälberstricken<br />
ausgerüstet ging der Abmarsch los. Es war schon Winter und es gab auch viel<br />
Jugenderlebnis<br />
Willi Jung
60<br />
61<br />
Schnee. Unser Weg führte uns von Nuserau über Annatal nach Unterreichenstein<br />
bis nach Ziegenruck. Von diesem Ort stammte Otto’s Mutter. In Ziegenruck angekommen<br />
wurden wir von Verwandten herzlich begrüßt und mit einer warmen<br />
Mahlzeit versorgt. Dann wurden uns die neuen Ochsen vorgestellt. Ich war sehr<br />
enttäuscht beim Anblick dieser Kälber und sagte zum Otto: „Die sind aber sehr<br />
klein!“ Er sagte mir, dass sie bis zum Frühjahr schon wieder wachsen werden.<br />
Dann machten wir uns, jeder mit einem Kalb auf den Weg nach Nuserau. Mann<br />
kann sich vorstellen, dass dieser Marsch mit den neuen Stierkälbern nicht leicht<br />
war bei dem vielen Schnee und den vielen Kilometern. Aber wir hatten es doch<br />
geschafft und mit einigen Zwangspausen sind wir am Abend in Nuserau angekommen<br />
mit unserer neuen Errungenschaft. Der Otto war bei der Auswahl seiner<br />
Tiere sehr anspruchsvoll, die mussten ja wieder einige Jahre ihren Dienst auf dem<br />
Hof tun. Er achtete darauf, dass sie in Farbe und Größe sowie in der Verträglichkeit<br />
zusammen passten. Zur linken Seite kam der „Gelbgefleckte“ mit Namen<br />
„Less“, zur rechten Seite kam der „Rotgefleckte“ mit Namen „Scheck“ und so<br />
standen sie auch im Stall nebeneinander und auch später vor dem Wagen. Dieses<br />
Erlebnis, das mir ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird, hat sich im Winter<br />
40/41 zugetragen. und. Die beiden Tiere waren sehr gesund und wurden gute<br />
Zugtiere. Der Otto wurde 1942 zur Deutschen Wehrmacht eingezogen. Seine Frau<br />
- meine Kusine - musste dann den Hof alleine bewirtschaften mit Hilfe von Verwandten<br />
und Nachbarn. Ich musste dem Otto immer kleine Berichte schreiben<br />
Die beiden Ochsen aus Nuserau vom „Odum-Hof“. Im Hintergrund ist Langendorf<br />
mit der Schellfabrik und der „Woasloka“ zu sehen. Dieses Bild habe ich<br />
damals mit meinem kleinen Fotoapparat aufgenommen.(Aufn. W. Jung)<br />
Großmutters Zeiten<br />
Meine Großmutter berichtete, dass sie nur selten Eier verkauft habe, denn sie<br />
brauchte sie selber zum Kochen, für Suppennudeln und zum Backen für die große<br />
Familie. Auch hatte meine Großmutter damals nur 10 bis 12 Hühner. Sie setzte<br />
zwar jedes Frühjahr eine Gluckhenne (Bruthenne) an, die jeweils etwa zehn Küken<br />
ausbrütete und zog diese groß. Im Sommer, wenn sie absehen konnte, wie<br />
viele Junghennen nachwachsen, schlachtete sie ebenso viele alte. Das gab jedes<br />
Mal eine gute Hühnersuppe und Fleisch für zwei bis drei Mahlzeiten. Für die<br />
kleine Hühnerschar waren in der hinteren Abteilung des geräumigen Schweinestalles<br />
Sitzstangen angebracht worden, die wir Hohbaam (Hochbaum) nannten.<br />
Großmutter erzählte, dass an den hellen Sommertagen die Hühner schon sehnsüchtig<br />
darauf warteten, dass sie mit dem Schweinefutter kam und die Tür aufsperrte.<br />
Dann stürmten sie ins Freie. Im Winter, wenn es draußen kalt und der Tag<br />
kurz war, flogen sie zum Fressen herab, blieben dann aber im warmen Schweinestall.<br />
Da er tagsüber versperrt blieb, suchten sich die Hühner im Schuppen daneben<br />
ihre Nester. Die meisten Plätze kannte Mutter, aber manchmal legten die Hennen<br />
die Eier auch an anderen Stellen ab. Es dauerte manchmal einige Tage, bis diese<br />
Nester gefunden wurden. Ja, sie hatte es eben nicht ganz leicht mit ihrem Federvieh!<br />
Eine neue Bäuerin und ein neuer Schwung<br />
Als nach der Hochzeit meine Mutter als neue Bäuerin auf dem Hof kam, quartierte<br />
sie die Hühner in den angrenzenden Keller um, in dem bis dahin die Futterrüben<br />
gelagert worden waren. Sie wollte mehr Schweine halten und um zusätzliche<br />
Hühnerhaltung auf dem Veilhof in Oppelitz<br />
Maria Frank<br />
über seinen Hof und die Tiere, auch wenn ein neues Kalb geboren wurde oder<br />
junge Schäflein zur Weit kamen. Die Ochsen wurden groß und wurden mit der<br />
Zeit prächtige Kerle, man hatte sehr viel Freude mit ihnen. Als der Krieg 1945 zu<br />
Ende war, kam auch der Otto wieder nach Hause und konnte seine Frau und seine<br />
kleine Tochter Herta in den Arm nehmen.<br />
Seine Ochsen standen immer noch im Stall und seine Freude war groß, das kann<br />
man sich vorstellen. Aber die Freude dauerte nicht lange. Es kamen die Tschechen,<br />
sein Besitz wurde enteignet und die Familie musste den Hof verlassen. Sie<br />
ging nach Langendorf zu meiner Tante, der Schwester meiner Mutter. Kurze Zeit<br />
später wurde meine Kusine, geschwächt von der schweren Arbeit alleine auf dem<br />
Hof, sehr krank und starb noch in Langendorf. Die Aussiedlung blieb ihr erspart.<br />
Der Otto kam alleine mit seiner kleinen Tochter nach Deutschland.
62<br />
63<br />
Einnahmen zu erzielen an einen Fleischer verkaufen, sobald sie groß und fett<br />
genug waren. Mein Vater brachte in dem Keller einige Sitzstangen an, denn man<br />
weiß ja, dass die Hühner gerne oben, erhöht, sitzen. Meine Mutter wollte aber<br />
auch die Anzahl der Hühner vergrößern, um für verkaufte Eier mehr einzunehmen.<br />
Deshalb setzte sie im Frühjahr zunächst zwei, später auch drei Gluckhennen<br />
an. Unter den heranwachsenden Tieren waren naturgemäß auch Hähne, die<br />
wir aber erst erkannten, wenn ihnen die roten Kämme wuchsen. Wenn sie eine<br />
bestimmte Größe und ein bestimmtes Gewicht erreicht hatten, wurden diese “besseren<br />
Leuten” in der Stadt angeboten. Die Hähnchen waren zu schlachten, bevor<br />
sie abgeholt wurden. Das geschah in der Regel dadurch, dass man ihnen mit<br />
einem Beil auf einem Hackstock den Kopf abschlug. Dann mussten wir sie noch<br />
eine Weile halten und dabei Beine und Flügelspitzen mit der Hand fest umklammern,<br />
sonst hätten sie noch einige Male geflattert und dabei alles voll Blut gespritzt.<br />
Wir schlachteten aber auch ausgewachsene Hühner. Sie wurden nur sehr<br />
selten als Suppenhuhn verkauft, die meisten rupfte meine Mutter selbst. Damit<br />
sich die Federn leichter ausreißen ließen und die Haut dabei heil blieb, wurden<br />
die Tiere vor dem Rupfen mit kochendem Wasser übergossen. Dann schnitt sie<br />
die Vögel mit dem Messer neben dem Brustbein auf. Sie entnahm vorsichtig das<br />
Herz, die Leber und den Magen und wusch diese Innereien sorgfältig, denn sie<br />
waren zum Verzehr bestimmt, die Gedärme warf sie weg. Entsprach ein Eingeweide<br />
nicht ihren Vorstellungen, so warf sie es ebenfalls weg. So eine Henne mit<br />
Gemüse gekocht, ergab eine wohlschmeckende Hühnersuppe. Das Fleisch aber<br />
war in der Regel noch zäh. Deshalb drehten wir es durch die Fleischmaschine,<br />
vermischten es mit einem oder zwei Eiern und Semmelbröseln und machten daraus<br />
einen Geflügelhackbraten.<br />
Die Fuchsplage<br />
So eine Henne schmeckte aber nicht nur uns Menschen, sondern auch dem Fuchs.<br />
Da unser Hof gegen Westen nicht abgeschlossen war, gingen die Hühner auf die<br />
Hutweide hinter der Scheune und dann weiter bis zum Waldrand hinauf. Sie fanden<br />
auf der Hutweide allerhand Insekten, die ihnen besonders schmeckten, im<br />
Wald waren es die Ameisenpuppen. Bei dieser zusätzlichen Nahrung ging es unseren<br />
Hühnern recht gut, sie waren gesund und legten viele Eier. Sie machten es<br />
aber auch dem Fuchs leicht, sie zu fangen. Er rupfte sie und ließ die Federn liegen.<br />
Auch wenn wir es nie beobachteten, wie er ein Huhn fing, so konnten wir an<br />
den ausgerissenen Federn erkennen, dass ihm wieder eines zum Opfer gefallen<br />
war. Das ärgerte meine Eltern, denn sie wollten nicht die Hühner großziehen und<br />
füttern, damit der Fuchs leicht zu einem guten Fressen kam. Um das zu ändern,<br />
sagte mein Vater zum Jagdpächter, er solle den Hühnerdieb erschießen. Der aber<br />
antwortete ihm, das ginge jetzt nicht, da die Füchse gerade Schonzeit haben, denn<br />
die Füchsin müsse die Jungen versorgen. Da wir aber wieder ausgerissene Hühnerfedern<br />
fanden, beschloss mein Vater, sich selbst zu helfen. Jeden Morgen, wenn<br />
der Hühnerstall geöffnet wurde, ging er mit seinem Jagdgewehr hinaus auf die<br />
Hutweide hinter der Scheune und gab drei Schüsse ab. Diese Methode schien<br />
zunächst recht erfolgreich zu sein, denn etliche Tage holte der Fuchs keine Henne.<br />
Aber dann jammerte mein Vater, dass sein Vorrat an Patronen zu Ende gehe<br />
und er keine neuen kaufen könne. Als der Fuchs doch wieder eine Henne stahl,<br />
ging meine Mutter zu einer anderen Vorsorge über. Unsere Nachbarn hatten uns<br />
nämlich geraten, ein Feuer anzuzünden und darin etwas zu verbrennen, was einen<br />
üblen Geruch hat, denn die Füchse haben eine sehr feine Nase und würden<br />
dann woanders hinziehen und unsere Hühner hätten Ruhe. Da wir Kinder damals<br />
schon leichtere Arbeiten verrichten konnten, erhielten wir den Auftrag, Reisig<br />
aus dem Wald zu holen und hinter der Scheune aufzustapeln. Meine Mutter ging<br />
nun jeden Tag, nachdem sie den Hühnerstall geöffnet hatte, mit zusammengeknülltem<br />
Papier, Zündhölzern und einem Span voll Wagenschmiere hinaus auf<br />
die Hutweide und zündete in sicherer Entfernung von der Scheune mit einer Handvoll<br />
von diesem Reisig ein Feuer an. Ob es wirklich übel gerochen hat, weiß ich<br />
nicht, denn ich war nie dabei. Aber die Wirkung war gleich Null, der Fuchs fing<br />
wieder eine Henne nach der anderen. Nach der Schonzeit kam auch der Jagdpächter<br />
mit einem Schützen. Sie gingen auf die Fuchsjagd. Auf dem Nachhauseweg<br />
erzählten sie uns, sie hätten dem Hühnerdieb eine Ladung Schrott auf das<br />
rote Fell gebrannt. Er hätte sich dann in den Bau verkrochen. Ganz bestimmt<br />
werde er daran zugrunde gehen. Es war Herbst geworden und der Fuchs stibitzte<br />
in diesem Jahr keine Henne mehr. Aber im nächsten Jahr ging das Stehlen weiter.<br />
Der Weg wurde verbaut<br />
Im Jahre 1940 bauten meine Eltern eine neue Scheune, weil die alte zu klein und<br />
unbequem war. Dabei entstand auch ein neuer Holzschuppen, der mit einem Schubtor<br />
gegen Westen zu verschlossen werden konnte. Nun war für die Hühner der<br />
Weg auf die Hutweide und hinauf zum Wald versperrt. Die Hühner hatten als<br />
Auslauf nur den Hof und den Obstgarten. Aber meine Mutter fand, dass sie zu<br />
wenig Platz haben und bat meinen Vater, dass er den Zaun zwischen dem Obstgarten<br />
und der angrenzenden Brache wegreißen soll. Er zäunte auch dieses Grundstück<br />
ein. Nun hatten die Hühner wieder genug Auslauf. Aber im darauf folgenden<br />
Sommer jammerte mein Vater, dass die große Hühnerschar das lange Gras<br />
derart nieder gezogen hat, dass es die Mähmaschine kaum erfassen konnte. Weil<br />
sie es auch verschmutzt hätten, würden es die Rinder nicht gern fressen. Und<br />
wieder berieten sich die beiden Veilbauernleute, um auch für dieses Problem eine<br />
Lösung zu finden. Und sie fanden sie auch. Vater sollte das Gras schon mähen,<br />
wenn es fingerlang war und nicht warten, bis es geblüht hat. Er soll es nachher<br />
mit etwas Stroh oder dem Heu von einer Brache zu Häcksel schneiden. Die<br />
Beimengung sollte dann den schlechten Geschmack übertönen, den der Hühnerdreck<br />
verursacht.<br />
Mehr Eier für das Weihnachtsgeschäft<br />
Als meine Mutter als neue Bäuerin auf unseren Hof gekommen war, nahm sie<br />
sich vor, erfolgreich zu wirtschaften, dass es aufwärts gehe mit dem Hof. Ein<br />
Schritt dazu war, wie beschrieben, den Hühnerbestand zu vergrößern, denn sie<br />
hatte gemerkt, dass die Eier um Weihnachten zu einem höheren Preis weggingen
64<br />
65<br />
und die Nachfrage stieg. Aber sie hatte sich verrechnet! Sie konnte im Advent<br />
jeden Tag nur ein oder zwei Eier von den Nestern holen und die brauchte sie<br />
selbst zum Kochen und Backen. Dann fing sie eine Henne und erschrak: Denn sie<br />
war wesentlich leichter als die Tiere, die sie im Sommer schlachtete. Sie fühlte,<br />
dass das Brustbein wie eine Messerschneide im Federkleid zu spüren war. Die<br />
Hühner sind unterernährt, sie haben Hunger und ihrem Körper fehlt die Kraft<br />
zum Eierlegen! Nun ja, folgerte sie, im Winter fliegen sie schon um vier Uhr auf<br />
ihre Sitzstangen und können am nächsten Tag, wenn es hell genug ist, erst um<br />
acht oder neun Uhr fressen. Man muss ihren Tag verlängern. Das geht mit elektrischem<br />
Licht. Als sie ihren Plan mehrere Male zu Ende gedacht hatte, trug sie ihn<br />
ihrem Mann vor. Dann sprach sie mit dem Monteur Schneider darüber, um die<br />
technischen Möglichkeiten zu erfahren. Der baute dann im Hühnerstall eine Lampe<br />
ein und den Schalter dazu im Hausgang, damit man die Beleuchtung am Abend<br />
länger brennen lassen und am Morgen früher einschalten konnte. Die Leute im<br />
Dorf machten sich darüber lustig, dass es den Hühnern auf dem Veilhof besser<br />
ginge, als den Bewohnern der Nachbarorte ohne elektrischen Strom. Aber die<br />
Hühner dankten diese Neuerung mit mehr Eiern, so dass meine Mutter wieder<br />
einmal recht hatte.<br />
Eintagsküken<br />
Mit dem Anschluss des Böhmerwaldes an Deutschland im Herbst 1938 änderte<br />
sich manches. Zu uns auf den Hof kam Fräulein Pasta, eine junge Landwirtschaftslehrerin.<br />
Sie wollte meine Mutter überreden, die Funktion einer Ortsbauernführerin<br />
zu übernehmen. Aber meine Mutter weigerte sich und argumentierte, dass sie<br />
von unserem Nachbarn, dem Ortsbauernführer, wisse, dass er oft zu einer Sitzung<br />
oder Schulung weg müsse und dann seinen Vater bat, das Kommando auf<br />
dem Hof zu übernehmen. Ihr stand aber so eine willige Person nicht zur Verfügung.<br />
Sie mache die Arbeit, aber das Amt kann sie nicht übernehmen. Fräulein<br />
Pasta kam dann noch öfter zu uns und brachte immer bebilderte Broschüren mit,<br />
die uns in gereimter Sprache weiterbilden und belehren sollten. Ich las sie mit<br />
Vergnügen. Einmal erzählte ihr meine Mutter, dass ihr Sohn eine Gluckhenne auf<br />
13 Eiern angesetzt hätte, dass alle Eier befruchtet waren, so dass sie 13 Küken<br />
bekam. Sie brachte fast alle durch, denn der Hack (Habicht) trug nur eines weg.<br />
Aber es waren dann nur zwei Junghennen und 10 Hähne. Darauf schlug Frau<br />
Pasta vor, sie solle es doch einmal mit Eintagsküken versuchen. Sie würden mit<br />
einer Maschine ausgebrütet, aber bevor man die Eier hineinlegt, werden sie durchleuchtet.<br />
Eier, die anzeigen, dass sie männliche Küken liefern, werden vorher<br />
aussortiert, man nehme nur solche, aus denen weibliche Küken schlüpfen. Meine<br />
Mutter besprach das mit den Nachbarinnen und drei davon beschlossen, es mit<br />
den Eintagsküken zu versuchen. Fräulein Pasta gab dann die Bestellung auf. Wir<br />
mussten uns aber für eine Rasse entscheiden. Mir gefielen die Weißen Leghorn<br />
am besten, aber die anderen entschieden sich für Rebhuhn - farbige Italiener. Wir<br />
bekamen eines Tages die Nachricht, dass die Küken mit dem Lastauto angeliefert<br />
würden, und wir sollen sie im Wirtshäusel in Schröbersdorf abholen. Die Bäue-<br />
rinnen waren nicht glücklich, denn sie hatten ja keine Bruthenne, die die kleinen<br />
gelben Wollknäuel mit ihrem Federkleid wärmen konnte. Frau Pasta brachte dann<br />
eine Lampe mit rotem Licht. Sie war imstande, die Küken zu wärmen. Mann sah<br />
es daran, dass sie sich unter dem Licht entspannt nebeneinander hinlegten, aber<br />
wenn es nicht brannte, dann bildeten sie ein Knäuel und die äußeren drängten<br />
nach innen. Unter den heranwachsenden Hühnern waren dann aber doch zwei<br />
Hähne. Ich vermutete, dass beim Durchleuchten ein Fehler gemacht worden war,<br />
oder dass der Brüter einfach zwei männliche Eier unter die weiblichen gemischt<br />
hatte, weil er wusste, dass weibliche Hühner ohne Hähne keine befruchteten Eier<br />
legen konnten.<br />
Der neue Hühnerstall<br />
Fräulein Pasta sah, dass sie in meiner Mutter eine fortschrittliche Bäuerin gefunden<br />
hatte, die den Neuerungen aufgeschlossen gegenüberstand. Eines Tages überredete<br />
sie sie, einen neuen, mustergültigen Hühnerstall zu bauen, Schnell war ein<br />
geeigneter Platz im Obstgarten an der Südwand der Scheune gefunden. Nach den<br />
Empfehlungen eines Fachmannes war schnell ein Plan entwickelt: Der große Raum<br />
sollte für die erwachsenen Hühner sein, der kleinere daneben war für die Küken<br />
und heranwachsenden Tiere vorgesehen, zwei große Fenster nach Süden sollten<br />
genug Licht hereinlassen, auf der Westseite wurden zwei Reihen Nester geplant<br />
und die Böcke für das Kotbrett sollten etwa 1 m hoch sein. Mein Vater besorgte<br />
das Material. Da aber Krieg war, gab es keine deutschen Handwerker, sie waren<br />
alle bei den Soldaten. Da verpflichtete das Arbeitsamt in Bergreichenstein einen<br />
tschechischen Zimmermann aus Ostuzno. Er hieß Pepik. Da der Weg von Ostruzno<br />
bis Oppelitz ziemlich weit war, richtete meine Mutter für ihn ein Bett her, er<br />
schlief bei uns. Er wurde aber auch bei uns verpflegt. Am Samstag, wenn er nach<br />
Hause ging, gab ihm die Mutter noch etwas Essbares (Eier, Butter oder Geselchtes)<br />
mit. Dafür arbeitete er auch gut. Als der Hühnerstall fertig war, zimmerte<br />
mein Vater aus gehobelten Brettern nach einem vorgefertigten Plan einen Futterautomaten.<br />
Er sah aus wie eine Truhe, oben mit einem Deckel und fasste einen<br />
ganzen Sack Getreide. In der Geschwindigkeit, in der die Hühner aus dem Trog<br />
am unteren Ende die Körner aufpickten, rutschten neue nach. So hatten die Tiere<br />
immer etwas zu fressen, wenn sie hungrig waren, konnten aber nicht in den Vorrat<br />
steigen und ihn verschmutzen. Meine Mutter fütterte die Hühner so, wie sie es<br />
schon lange gewohnt war, nämlich mit zerstoßenen, gekochten Kartoffeln und<br />
etwas Getreideschrott. Im Winter rieb sie einige Möhren darunter. Sie lieferten<br />
für die Tiere die nötigen Vitamine und machten dem Eidotter eine schöne, kräftiggelbe<br />
Farbe. Neben der Eingangstür war eine gusseiserne Knochenquetsche an<br />
die Holzwand geschraubt. Wenn man einen Knochen darauf legte und den Hebel<br />
herunterdrückte, wurde er zerquetscht. Die Teile fielen auf den Boden und wurden<br />
von den Hühnern eifrig gefressen. Ich hatte schon früher in so einer lehrreichen<br />
Broschüre gelesen, dass man die Knochen nicht wegwerfen, sondern zerklopfen<br />
soll. Sie liefern dem Geflügel Eiweiß und Fett und dazu Kalk für die<br />
Eierschalen. Damals zerklopfte ich nur die kleinen Geflügelknochen auf einem
66<br />
67<br />
Hackstock mit einem Hammer. Die Hühner waren so gierig auf diese Leckerbissen,<br />
dass sie auf den Hackstock flogen, um das meiste zu kriegen. Dabei traf ich<br />
auch einige Male ihr Schnäbel. Ich erschrak jedes mal, aber nie ist deswegen eine<br />
Henne eingegangen. Als der neue Hühnerstall fertig war, bat mein Vater den<br />
Fleischhacker Faßmann aus Bergreichenstein, der bei uns schon öfter ein Schwein<br />
oder ein Rind zum Schlachten gekauft hatte, ob er uns wöchentlich ein paar Knochen<br />
geben kann. Der Fleischer sagte zu und so holte ich jeden Mittwoch nach<br />
der Schule die versprochenen Knochen. Wenn ich dann im Hühnerstall stand,<br />
diese Knochen zerquetschte und sah, wie gerne unsere Hühner die Stückchen<br />
aufpickten, die zu Boden fielen, freute ich mich, dass ich den fleißigen Tieren<br />
diese Wohltat verschaffen konnte. Im Krieg wurde uns jedes Jahr vorgeschrieben,<br />
wie viele Eier wir abzuliefern haben. Es waren viele, aber unsere Hühner<br />
legten gut. Das Milchgeschäft in Bergreichenstein wurde als Sammelstelle bestimmt.<br />
Um es uns bequem zu machen, brachte meine Vater eine Eierkiste mit<br />
zwei Stapeln Lagen nach Hause. Es passten also 500 Stück hinein. Weil wir aber<br />
unser Liefersoll immer gut erfüllten, erlaubte man uns, dass wir die anderen Eier<br />
an Privatleute verkaufen, ohne bestraft zu werden.<br />
Das Ende<br />
Anfang Mai 1945 besetzten die Amerikaner Oppelitz. Sie kamen auch zu uns auf<br />
unseren Hof. Zuerst zerschlugen sie Vaters Jagdgewehr und warfen die Teile auf<br />
den Misthaufen. Dann ordnete ein Offizier an, dass wir das Wohnhaus verlassen<br />
und bei Nachbarn nächtigen sollen. Da wir damals einen tschechischen Bauern<br />
aufgenommen hatten, der von den deutschen Soldaten verpflichtet worden war,<br />
mit seinem Wagen und seinen zwei Pferden eine Fuhre nach Winterberg zu bringen<br />
und dessen Pferde in unserem Stall standen, wollte mein Vater das Haus nicht<br />
verlassen. Mit meinem spärlichen Schul-Englisch und einem Wörterbuch machte<br />
ich dem Offizier die Lage klar. Er erlaubte, dass mein Vater im Haus blieb. Am<br />
nächsten Tag gingen wir auf unseren Hof zurück. Wir durften aber das Haus erst<br />
betreten, nachdem dort eingesperrte deutsche Gefangene abgeführt worden waren.<br />
Bei ihnen waren auch zwei Hitlerjungen und eine Nachrichtenhelferin. Diese<br />
drei wurden von den Amerikanern energisch weggeschickt, obwohl sie sich<br />
nicht von den anderen trennen wollten. Dann gingen wir ins Haus und sahen, was<br />
die Amerikaner hinterlassen hatten. Sie waren wohl mit den nicht ganz sauberen<br />
Schuhen oder Stiefeln ins Bett gegangen, das schlossen wir aus der verschmutzten<br />
Bettwäsche. Sofort wechselten wir sie, wenn auch zum Waschen zunächst<br />
keine Zeit war. In der Küche fanden wir verbrannte Tiegel und Pfannen mit<br />
ebenfalls verbrannten Eierresten. Die Amerikaner müssen wohl Feuer gemacht<br />
und mit Kienholz geheizt haben, weil sie eine so große Hitze zusammengebracht<br />
hatten, dass selbst die weißen Kacheln des Kachelofens dunkel verfärbt waren.<br />
Dann schauten wir in der Kammer nach, wo vor der Einquartierung der Feinde<br />
eine volle Eierkiste stand. Sie war leer! Die Amerikaner hatten also alle Eier<br />
verspeist, auch die, die daneben in einer blechernen Waschschüssel waren. Ich<br />
überlegte, wie viel Eier wohl so ein amerikanischer Soldat verträgt. Als wir auf<br />
dem Dachboden und auf dem Houhboden (Hochboden) nachschauten, wo wir<br />
das gedroschene Getreide zum Trocknen lagerten und wo in der Nacht zuvor die<br />
deutschen Gefangenen eingesperrt waren, fanden wir einen leeren Topf und<br />
daneben viele Eierschalen. Wir schlossen daraus, dass die Amerikaner ihre deutschen<br />
Gefangenen mit einem Topf voll roher Eier verpflegt hatten. Dann stießen<br />
wir auch auf einen leeren Milchtopf. Aha, dachte ich, die deutschen Gefangenen<br />
hatten also auch Milch bekommen. Ich kann mir aber bis heute nicht vorstellen,<br />
wie sie in der Dunkelheit die Milch und die Eier verzehren konnten. Später fanden<br />
wir vor dem Fenster im Gartenbeet mit den jungen Möhren etliche Streifen,<br />
die früher einmal die militärischen Grade angezeigt hatten. Die Gefangenen haben<br />
sie bei völliger Dunkelheit von ihren Uniformen abgetrennt und aus dem<br />
Fenster geworfen. Wenige Tage nachdem die Amerikaner unser Dorf wieder verlassen<br />
hatten, kam Pepik aus Ostruzno mit seinem Schwager auf unseren Hof. Er<br />
tat so, als kenne er meinen Vater nicht. Dann ging er mit seinem Schwager in den<br />
Hühnerstall und sagte: „Das sind meine Hühner.“ Im Schweinestall sagte er: „Das<br />
sind meine Schweine“, und im Kuhstall: „Das sind meine Kühe“, „Das sind meine<br />
Pferde“. Mein Vater hörte das und fand es empörend. Er ging in die Stube und<br />
bat: „Resl, halte mich, sonst hau ich den Kerl zusammen!“ Für uns gab es jetzt<br />
kein Ablieferungssoll mehr für Eier, aber unsere Hühner legten fleißig weiter.<br />
Wir beschlossen also, jedem, der von uns Eier kaufen will, der bekommt, was er<br />
verlangt. Auch wurde beschlossen, dass meine Mutter jetzt mehr aus Eiern kochen<br />
soll. Es gab auch genügend Esser, denn die Leute kamen zu uns, weil wir<br />
ihnen bescheinigen sollten, dass sie bei uns in der Erntearbeit stehen. Sie hatten<br />
nämlich Angst, dass sie ohne eine solche Bescheinigung ins Innere Böhmens<br />
geschickt würden. Einige Tage später sahen wir, wie ein Lastauto voll Tschechen,<br />
es waren meist Polizisten und Soldaten, nach Bergreichenstein fuhr. Dann wurden<br />
an die Hoftore Zettel geklebt, auf denen stand: „Statni Majetek.“ Es dauerte<br />
wiederum einige Tage, dann kam ein Tscheche auf unseren Hof und sagte auf<br />
tschechisch: „Der Hof gehört jetzt dem Staat und ich bin der neue Verwalter. Ihr<br />
dürft ohne meine Erlaubnis nichts mehr verkaufen oder verändern.“ Wir fühlten<br />
uns dadurch weder eingeengt noch hatten wir Angst vor ihm, denn er verstand ja<br />
nichts von der Landwirtschaft und machte sich auch nicht kundig. Er kam jeden<br />
zweiten oder dritten Tag unangemeldet, um nachzuschauen, ob alles seine Ordnung<br />
hat. Manchmal nahm er Milch, Butter oder Eier mit, ohne zu bezahlen.<br />
Nicht der Zimmermann Pepik aus Ostruzno bekam den Hof, sondern ein ehemaliger<br />
Kutscher der Solofabrik in Schüttenhofen. Als ich 1988 das erstemal nach<br />
der Vertreibung unseren Hof besuchte, ging ich auch in den Hühnerstall. Die<br />
Tschechen haben ihn wohl nie ausgemistet, denn der Hühnerdreck auf dem Kotbrett<br />
reichte bis zu den Sitzstangen hinauf. Zwei der großen Fenster waren eingeschlagen<br />
und die Löcher notdürftig mit Pappe geflickt. Die Nester fehlten ganz.<br />
Im Raum standen mehrere Wagen- und Ackergestelle. Nach 1990 erwarb das<br />
Ehepaar Prochazka aus Prag den Hof. Da sie fleißig und wohlhabend waren,<br />
bauten sie vieles um. Aus dem alten Hühnerstall wurde eine Bar, der Kuhstall
68<br />
69<br />
In Oppelitz hielt jeder Bauer zwei oder drei Gänse, die Inleute hatten meist nur<br />
eine. Diese Tiere wurden nicht wegen des Geldes gehalten, das man durch sie<br />
erwirtschaften konnte, sondern wegen der Federn, denn jeder schätzte ein gut<br />
gefülltes, warmes Federbett. Die Winter im Böhmerwald konnten ja bitterkalt<br />
werden. Außerhalb der Brutzeit waren die Gänse pflegeleicht, auch wenn man<br />
dieses Wort damals noch nicht benutzte. Am Morgen wurden sie ausgelassen, d.<br />
h. man öffnete das Türchen ihres Stalles und sie watschelten ins Freie. Dann<br />
gingen sie auf den Dorfplatz hinaus und gesellten sich zu den anderen. Der Anger<br />
bot ihnen auch zu fressen. Sie weideten das Gras und die Angerkamille und hielten<br />
sie kurz. Ihr Kot düngte diese Pflanzen, so dass sie immer wieder nachwuchsen.<br />
Sie tranken aus dem Abfluss des Dorfgrandes oder aus dem Rinnsal, das<br />
vom Hirterbrunn über den Anger hinunterfloss. Am Abend kamen sie wieder<br />
nach Hause, suchten den Trog auf, in dem die Hühner gefüttert wurden, und taten<br />
sich an den Resten gütlich. Dann begaben sie sich in ihre Ställe. Wenn sie aber<br />
gerupft werden sollten, wurden sie am Morgen nicht ins Freie gelassen. Dass die<br />
Federn reif zum Rupfen waren, erkannten die Frauen daran, dass die Gänse unter<br />
Tags schon einige Federn verloren. Gab es dieses Anzeichen nicht, riss die Bäuerin<br />
dem Federvieh einige Brustfedern aus. Wenn das mit wenig Kraft möglich<br />
war und kein bisschen Blut mehr an den Kielen hing, waren sie reif zum Rupfen,<br />
ansonsten wartete sie noch einige Tage. Zum Gänserupfen zogen die Frauen eine<br />
alte, aber noch stabile Schürze an, setzten sich auf einen Melkschemel und legten<br />
die Gans so auf den Schoß, dass der Bauch des Tieres nach oben zeigte. Dann<br />
klemmten sie den Kopf der Gans zwischen ihren Knien ein. Das Rupfen muss für<br />
die Gans eine schlimme Tortur gewesen sein, denn sie gaben bei jeder Feder, die<br />
ausgerissen wurde, einen Schrei von sich. Nicht selten kam es dabei auch zur<br />
Entleerung des Darmes.<br />
Am Ende des Winters, Ende Februar etwa, fingen die Gänse an, Eier zu legen.<br />
Meine Mutter richtete dafür rechtzeitig ein Nest her. In einen niedrigen Korb<br />
legte sie einen alten Jutesack, damit die Kälte abgehalten wurde, darauf Stroh<br />
und etwas Heu. Dieses Nest stellte sie an das Ende des Ganges im Schweinestall,<br />
dorthin, wo die Gänse gewöhnlich die Nacht verbrachten. Das Schnopferl - so<br />
nannten wir unsere Gans wegen des Federschopfes auf ihren Kopf - legte dort<br />
auch brav ihre Eier ab, jeden zweiten Tag eines. Nachbarinnen erzählten, dass<br />
sich ihre Gänse selbst ein Nest in der Streuschupfe oder an einem abgelegenen<br />
Platz bauten. Wir nahmen die ersten sechs oder sieben Ganseiner aus dem Nest,<br />
um sie vor Beschädigung zu bewahren. Die folgenden blieben im Nest liegen.<br />
Sie regten die alte Gans zum Brüten an. Man hatte nämlich die Erfahrung gemacht,<br />
dass sich der Drang, auf die Eier zu setzen, nicht einstellte, wenn man das<br />
Nest jeden Tag leer räumte. Wir stellten in einem Gefäß Wasser und im anderen<br />
etwas Hafer und einen Sterz aus geriebenen Kartoffeln und Gerstenschrot vor die<br />
brütende Gans. Die Gänse brüteten vier Wochen. Gegen Ende dieser Zeit nahm<br />
meine Mutter ein Ei aus dem Nest und horchte daran, ob schon ein leises Piepsen<br />
des ungeborenen Gänsleins zu hören wäre. Wenn ein Ei „aufgebissen“ war, das<br />
Kücken also bereits ein Loch in die harte Eischale gebohrt hatte, war das ein<br />
Grund zur Freude, aber auch Anlass nun öfter nach dem Nest zu schauen. Die<br />
jungen, noch feuchten Gänslein legten wir in eine Schuhschachtel, deckten sie<br />
mit einem weichen Lappen zu und stellten sie in den Ofenwinkel, damit sie es<br />
schön warm hatten. Wenn alle Gänslein geschlüpft waren, stellte meine Mutter<br />
eine Kiste neben den Kachelofen, und setzte ein Kücken nach dem anderen hinein.<br />
Die Gans aber wurde ins Freie entlassen. Anfangs deckte man die Gänslein<br />
Gänsehaltung in Oppelitz<br />
Maria Frank<br />
erhielt einen Kamin, der neue Hühnerstall wurde ganz weggerissen. In seine betonierte<br />
Bodenplatte wurde ein Bassin eingelassen. Damit war alles beseitigt, was<br />
je darauf hinwies, dass hier einmal ein deutscher Bauer mit großem Erfolg Hühner<br />
gehalten hatte.<br />
Gänse vor einer Kapelle im<br />
Böhmerwald. Foto: Wurbs.<br />
(Sammlung Reinhold Fink)
70<br />
71<br />
Unser Nachbar Sager brauchte keinen Hund, ein schlimmer Ganserer bewachte<br />
Haus und Hof. Auf dem Weg zu Sagers Stube musste man erst einen Kampf mit<br />
dem Ganter ausfechten. So musste ich meine Schwester Erna stets begleiten, wenn<br />
sie nur zum Sägewerk ging; sie war ja auch noch klein und hatte große Angst vor<br />
den Gänsen. Ich selbst bin dem Ganserer bald auf die Schliche gekommen. Weglaufen<br />
durfte man auf keinen Fall, da hatte er uns gleich am Kleid gepackt; nein,<br />
frech auf ihn zugehen, da hatte er mehr Respekt und kam er mir doch zu nahe,<br />
packte ich ihn am langen Hals, denn dann konnte er ja nicht mehr beißen, und<br />
warf ihn mit meiner ganzen Kraft von mir weg. Aber so schnell gab er meist nicht<br />
auf. Zischend und zornig ging der Ganserer wieder auf mich los, und erst nach<br />
Die Gänse<br />
Anna Quitterer<br />
einem dritten erfolglosen Angriff wandte er sich heftig schnatternd seiner Gänseschar<br />
zu und zog mit ihr ab. Ich denke, unsere Gänse waren braver. Vielleicht<br />
weil wir sie aufgezogen haben, sie gefüttert und für sie sorgten. Auf die zum<br />
Bleichen ausgelegte Wäsche hatten es aber unsere wie Sagers Gänse abgesehen.<br />
Die Mutter hatte ihre Bleiche auf dem Rasen neben dem Bach. Eine Holzschaufel<br />
lag immer daneben und wer am Bach vorbeikam, schüttete damit Wasser auf die<br />
Wäsche. Unsere Gänse behüteten bei der Nacht unser Haus. Ging man auch noch<br />
so leise zur Stalltür hinein, die Gänse meldeten es schnatternd. Sie machten ein so<br />
großes Geschrei, dass man sich die Ohren zuhalten musste. Leid taten mir die<br />
Gänse, wenn sie gerupft wurden. Oft habe ich den Kopf der Gans halten müssen.<br />
Die Mutter passte aber beim Rupfen recht auf, damit es der Gans nicht zu weh tat.<br />
Auf Gänse legte unsere Mutter großen Wert; sorgte sie doch, dass wir gute Federbetten<br />
hatten und vielleicht dachte sie schon an unsere Aussteuer.<br />
Es war im Winter. In der Gänseschar fehlte eine junge Gans. Auch zu dieser<br />
Jahreszeit konnten sich die Gänse im Freien aufhalten. Sie hatten ja ihr warmes<br />
Federkleid und brauchten nicht zu frieren. Am Abend sagte die Mutter zu uns:<br />
„Es sind nicht alle Gänse da!“ und sie bat uns, ihr suchen zu helfen. So suchten<br />
wir rund ums Haus, schauten in Scheune und Schuppen, gingen um die Bretterstöße<br />
herum, lockten dabei mit dem Ruf „Hussi, Hussi!“ Alles war vergebens,<br />
mit einem angewärmten Lappen noch zu. Gefüttert wurden sie mit einem gehackten<br />
gekochten Hühnerei. Aber schon bald mischten wir etwas Hirse (mundartl.<br />
gelber Hendlbrei) und geschnittene Brennesseln darunter. Nun hatten wir Kinder<br />
die Pflicht, im ganzen Dorf nach jungen Brennesseln zu suchen. Dabei kam es<br />
zum Streit, wenn auch in anderen Häusern junge Gänse geboren worden sind.<br />
Die jungen Gänse wuchsen schnell und die Bauersfrauen stellten die Kiste in die<br />
warme Frühlingssonne. Um diese Zeit kamen Tschechen in unser Dorf, kauften<br />
die Gänslein und trugen sie in einem extra dafür hergerichteten Korb fort, angeblich<br />
weil die tschechischen Bauern darauf warteten. Die Gans, die wir gleich<br />
nach dem ersten Brutgeschäft ins Freie gesetzt hatten, begann wieder Eier zu<br />
legen, Diese zweite Brut wurde meist nicht mehr verkauft, sondern selbst aufgezogen.<br />
Die Umstände waren nun günstiger: Es gab genug Brennesseln, die Tage<br />
waren schon länger und die Sonne spendete ausreichend Wärme. Für die zweite<br />
Brut wurde dann im Garten ein Stück Rasen eingezäunt. Statt des gehackten Eis<br />
wurde nun ein Gemisch aus geriebenen, gekochten Kartoffeln, etwas Schrot und<br />
viel Brennesseln verfüttert. Auch wurde die Kiste am Abend nicht mehr in die<br />
Küche getragen und neben den Kachelofen gestellt, sondern in den Hausgang<br />
oder in den Stall. Wenn das Stück eingezäunter Rasen für die Gänseschar zu eng<br />
geworden war, mussten sie irgendwo, wo es schönen Rasen gab, gehütet werden.<br />
Das war meist Kinderarbeit. Im August, nach der Getreideernte, wurden die Gänse<br />
auf die abgeernteten Felder getrieben. Dort fanden sie nicht nur Gras und Kräuter,<br />
sondern auch liegen gebliebenes Getreide. Da nun auch die Federn gewachsen<br />
waren, versuchten sie sich bisweilen in die Luft zu erheben und zu fliegen,<br />
was dem Gänsehüter Sorgen bereitete. Nach dem ersten Rupfen wurden sie verkauft.<br />
Sie fanden als Martinigans und Weihnachtsgans den gewünschten Absatz.<br />
Bei den Züchtern kam nur selten eine Gans auf den Tisch.<br />
Die alte Anzeige<br />
weist auf den früheren<br />
Handel mit<br />
Gänsefedern. Zentrum<br />
des Handels<br />
war die Gegend um<br />
Neuern. Bereits seit<br />
1746 war hier der<br />
Gänsefedernhandel<br />
belegt. (Sammlung<br />
Reinhold Fink)
72<br />
73<br />
Unser Nachbar erzählte in einem Frühjahr, dass der Besitzer der Glasfabrik Klostermühle<br />
10 Enteneier aus Österreich mitgebracht habe, die er nun von einer Henne<br />
ausbrüten lassen möchte. Er hat neben seiner Villa einen großen Garten und gleich<br />
daneben die Wottawa, also einen geeigneten Platz für eine Entenschar. Aber jetzt<br />
sucht er eine Henne, die diese Eier ausbrütet. Er bat mich, dass ich ihm bei dieser<br />
Suche behilflich sei.<br />
Wir hatten so eine Bruthenne, die wir auch Gluckhenne nannten. Wenn eine Henne<br />
brutwillig wird, hört sie auf Eier zu legen, sitzt den ganzen Tag im Nest, so<br />
dass die anderen dieses Nest nicht benutzen können, und gibt in einem bestimmten<br />
Rhythmus gluckende Laute von sich. Wir sagten also diesem Nachbarn zu,<br />
dass er am nächsten Tag diese Bruthenne abholen kann. Vier Wochen vergingen.<br />
Dann berichtete unser Nachbar, dass die Bruthenne ihr Aufgabe erfüllt hat, dass<br />
aber von den zehn Eiern neun unbefruchtet, also galt waren, wie wir das nannten.<br />
Der Fabrikant will aber das alleinige Entlein nicht aufziehen, weil ihm das zu viel<br />
Arbeit macht. Unser Nachbar fragte an, ob wir das kleine Tier nehmen. Mein<br />
Bruder sagte sofort zu, meine Mutter dagegen hatte Bedenken, denn sie wusste<br />
ja, dass bei den Kindern eine solche Begeisterung schnell verfliegen kann. Am<br />
nächsten Abend brachte uns unser Nachbar das Entlein. Mein Bruder nahm es in<br />
die Hand, liebkoste es und suchte dann eine leere Schuhschachtel als erste Behausung<br />
für das Tierchen. Er richtete dann das Futter her. Er zerkleinerte ein<br />
halbes, hartgekochtes Ei, vermischte es mit etwas gelbem Brei (eigentlich Hirse)<br />
Das Entlein Quack-quack<br />
Maria Frank<br />
wir fanden die Gans nicht. In der Stube wärmten wir uns auf, denn draußen war<br />
es eisig kalt und bald dachten wir nicht mehr an die Gans. Nicht so unsere Mutter!<br />
„Das junge Ganserl, wo wird’s denn sein? Jetzt muss es elend zugrunde gehen,<br />
wenn wir es nicht finden.“ Die Mutter nimmt die Laterne und geht noch mal<br />
suchen. Sie geht über die Brücke und auf der Hauswiese leuchtet sie alle Stellen<br />
ab, die sich im Schneelicht von der Umgebung abhoben. Und schau, sie findet<br />
die Gans. In einem nicht ganz zugeschneiten Graben war sie eingeklemmt. Sie<br />
konnte weder vor noch zurück und sie war schon ganz schwach. Voller Freude<br />
zeigte uns die Mutter die Gans, die sie doch noch gefunden hatte. Was war geschehen?<br />
Am nächsten Tag erzählten uns die Nachbarn, dass sie an jenem Nachmittag<br />
gesehen hätten, wie unsere Gänse vom Hausort in die Hauswiese hinunter<br />
geflogen seien, was Gänse ja nur ganz selten tun. Dabei ist wohl unsere Gans so<br />
unglücklich zwischen dem Schnee und dem Eis des Grabens gelandet und konnte<br />
sich nicht mehr befreien. (aus „Ein Haus im Böhmerwald“, Erinnerungen an eine<br />
Kindheit in Elendbachl, 1995)<br />
und holte dann eine junge Brennessel von draußen. Diese schnitt er ebenfalls<br />
klein und mischte sie unter das schon vorbereitete Futter. Das Entlein, das schon<br />
richtig Hunger hatte, fraß gierig. Dann hielt er ihm in einer niedrigen Schale<br />
etwas frisches Wasser hin. Es tauchte zweimal seinen Schnabel ein. Dann war es<br />
satt. Mein Bruder setzte es in die Schuhschachtel, deckt einen leichten Lappen<br />
darüber und stellte die Schachtel in das schmale Regal im Ofenwinkel.<br />
Mein Bruder fütterte das Entlein viermal am Tag, das erste Mal, bevor er in die<br />
Schule ging, dann wieder, wenn er aus der Schule nach Hause kam und am Nachmittag<br />
zur Jausenzeit und vor dem Schlafengehen. Der kleine Vogel gedieh sichtlich,<br />
er wurde größer und auch schwerer. Eines Tages fiel er mit der Schuhschachtel<br />
auf den Boden. Meine Mutter versuchte nicht, ihn wieder in die Schachtel zurückzugeben,<br />
sondern deckte die Schachtel darüber, damit er nicht weglaufen<br />
konnte oder zu sehr auskühlte. So fand es mein Bruder vor, als er nach der Schule<br />
neugierig nach Hause eilte. Aber am nächsten Tag saß das Entlein wieder auf dem<br />
Boden. Mein Bruder forschte nach dem Grund, denn dieses Verhalten verstand er<br />
zunächst nicht. Nach einigem Nachdenken glaubte er, den Grund gefunden zu<br />
haben: Das Entlein brauchte jetzt mehr Bewegung, deshalb ging es in der Schachtel<br />
an das Ende, das ein bisschen über das Regal herausragte, bekam das Übergewicht<br />
und fiel zu Boden. Er beschloss, ihm mehr Bewegungsfreiheit zu verschaffen<br />
und setzte es nicht mehr in die Schuhschachtel, sondern in eine Kiste draußen<br />
im Vorhaus. Etwa um dieselbe Zeit kam er auf die Idee, dass die junge Ente jetzt<br />
eigentlich eine kräftigere Nahrung brauche, etwa eine Schnecke oder einen Regenwurm,<br />
wie er es bei anderen Enten gesehen hatte. Aber woher nehmen? Wenn<br />
man ein Gartenbeet umsticht, kommen Regenwürmer zum Vorschein, aber man<br />
kann doch nicht wegen eines Entleins jeden Tag ein Gartenbeet umgraben! Dann<br />
fiel ihm ein, dass er auch unter einem Stein schon einen Regenwurm gesehen hat.<br />
Auf dem Heimweg von der Schule erzählte er den anderen Dorfbuben, dass er<br />
am Nachmittag zum Regenwürmerfangen gehen will. Zwei baten ihn, mitgehen<br />
zu dürfen, denn sie witterten ein spannendes Abenteuer. Am halben Nachmittag<br />
kamen die zwei Nachbarsbuben auf unseren Hof und forderten, doch zum<br />
Regenwürmerfangen zu gehen. Zuerst berieten sie sich, dann gingen sie auf den<br />
Anger in der Dorfmitte. Dort drehten sie viele Steine um, fanden aber keinen<br />
Wurm. Sie machten meinem Bruder Vorwürfe, dass er sie „angehiaselt“ (falsch<br />
informiert) hätte. Entmutigt wollten sie schon aufgeben und heimgehen, als sie<br />
neben dem Wassergrand noch einen großen Stein liegen sahen. Mit einiger Mühe<br />
drehten sie ihn um - darunter lag tatsächlich ein Regenwurm! Mein Bruder nahm<br />
ihn in seine hohle Hand. Auf dem Weg zurück zu unserm Hof malten sie sich mit<br />
begeisternden Worten aus, mit welcher Freude das Entlein ihn verschlingen würde.<br />
Aber weit gefehlt. Das Entlein zeigte kein Interesse an dieser ungewohnten<br />
Speise. Nun überlegten die Buben, dass eine Ente vielleicht nur dann einen Regenwurm<br />
verspeist, wenn sie ihn selbst gefangen hat. Diese Überlegung leuchtete<br />
ein. Sie wollten sie gleich am nächsten Tag überprüfen. Am nächsten Tag trafen<br />
sich die beiden Nachbarsbuben wieder bei meinem Bruder. Er nahm das Ent-
74<br />
75<br />
wie anderswo auch - dass die Töchter, wenn sie heirateten eine Aussteuer bekamen.<br />
Da bei uns das Geld rar war, begann man schon Jahre vorher, was möglich<br />
war, selber zu schaffen, so z.B. das Leinen und die Federbetten. So dachte auch<br />
meine Mutter. Als ich noch in die Volksschule ging, hielt sie Gänse zur Gewinnung<br />
der nötigen Federn. Hinter unserem Haus floss die junge Flanitz vorbei, sie<br />
entsprang am Nordhang des Lissiberges und war bei uns schon ein munteres<br />
Bächlein, aus dem mein Bruder manche Forelle herausholte. Mein Vater erweiterte<br />
das Bett zu einem kleinen Weiher, der „Schwöll“, um den Gänsen einen<br />
Tummelplatz im Wasser zu bieten. Die Gans brütete einmal im Frühjahr fünf<br />
Bei uns im Böhmerwald war es Sitte -<br />
Anna Kangler<br />
lein aus der Kiste und trug es mit beiden Händen auf den Anger. Schnurstracks<br />
gingen sie zum Grand und hoben denselben Stein hoch, unter dem sie am Tag<br />
vorher einen Regenwurm gefunden hatten. Mein Bruder bückte sich mit dem<br />
Entlein, so dass es mit dem Schnabel den Regenwurm packen konnte. Es dauerte<br />
dann aber doch noch einige Augenblicke, bis die junge Ente begriff, dass es etwas<br />
zum Fressen gab. Dann würgte es den Regenwurm hinunter. Die drei Buben<br />
sahen das mit heller Begeisterung. Dann suchten sie noch einen weiteren Stein,<br />
unter dem sich vielleicht ein Regenwurm hätte befinden können, aber sie fanden<br />
keinen. Nachdem sie das Entlein wieder nach Hause gebracht und in seine Kiste<br />
gesetzt hatten, freuten sich die Dorfbuben noch über ihre gute Tat und beschlossen,<br />
am nächsten Tag auf einem Wegrand nach einem geeigneten Stein, unter<br />
dem ein Regenwurm sein konnte, zu suchen. In der Folgezeit gingen die drei<br />
nicht jeden Tag, aber oft mit dem Entlein auf Regenwurmjagd. Es gedieh prächtig.<br />
Die Buben fanden dann, dass es einen richtigen Namen haben müsste, und sie<br />
kamen auf Quack-quack. Das Entlein Quack-quack war inzwischen so groß und<br />
kräftig geworden, dass es aus eigenen Kräften aus der Kiste im Vorhaus steigen<br />
konnte. Da es aber nicht stubenrein war, musste meine Mutter oder mein Bruder<br />
öfters den Entendreck wegputzen. Weil aber meine Mutter nicht einsah, dass dieses<br />
Haustier noch weiter im Vorhaus bleiben sollte, gab sie meinem Bruder den<br />
Auftrag, die Kiste in den Hühnerstall zu tragen. Dort fraß das Entlein Quackquack<br />
mit den Hühnern, so dass ein zusätzliches Kraftfutter nicht mehr nötig war.<br />
Während des Tages ging es mit den Hühnern in den Schuppen oder in den Obstgarten.<br />
Eines Tages war es verschwunden. Mein Bruder suchte es überall, aber er<br />
fand es nicht. Es gab auch keine Anzeichen, dass es der Fuchs oder der Habicht<br />
geholt haben könnte. Dass es jemand geschlachtet und gegessen haben könnte,<br />
schloss er aus, denn es war so ein liebes Entlein Quack-quack.<br />
Junge aus. Wir freuten uns und hegten und pflegten die kleinen Gänslein.Eines<br />
Tages fand meine Mutter, dass ich eine neue Schürze für die Schule bräuchte. Ich<br />
durfte mir den Stoff im Geschäft „Hochen“ in Andreasberg selber aussuchen und<br />
wählte einen Druck: hellblau mit weißen Blümchen. Sie schneiderte mir die Schürze<br />
und am Sonntagnachmittag durfte ich sie zum ersten mal umbinden.<br />
Die kleinen Gänslein hatten ihr gelbes Daunenkleid schon verloren, die ersten<br />
Federn sprossen hervor. Sie weideten mit den Gänseeltern friedlich auf der Wiese<br />
vor dem Haus. Ich saß auf der Hausbank und las in einem spannenden Buch, das<br />
ich mir von der Schulbibliothek ausgeliehen hatte. Da kamen meine Eltern mit<br />
meinem kleinen Bruder heraus, die Mutter trug mir auf, auf die Gänslein zu achten.<br />
„Sie dürfen nicht ins Wasser, es ist zu kalt, es hat einige Tage geregnet“, sagte<br />
sie, „sonst kriegen sie den Krampf und werden hin. Auf der Wiese passt der Ganser<br />
schon auf, dass keins der „Stößei“ (Habicht) holt. Wir gehen zum „Nuiher<br />
Oicht“ (Neuer Ort) und schauen, wie weit die Erdäpfel schon sind.“ Dieser Acker<br />
war ursprünglich ein schütteres Wäldchen, ein Weideplatz, meine Mutter hatte es<br />
als Heiratsgut erhalten. Der Vater hatte es mit dem Gruber Jordan, der im fürstlichen<br />
Wald mit ihm beschäftigt war, in jahrelanger, mühevoller Arbeit gerodet,<br />
der Boden war unverbraucht und sehr fruchtbar. So gingen sie und ich las weiter.<br />
Plötzlich sah ich die Gänse nicht mehr. Erst suchte ich ums Haus, dann fiel mir<br />
das Wasser ein. Und richtig! Da schwammen und tauchten sie voll Lebensfreude<br />
und jagten einander durch die Schwöll. Eilig raffte ich die Schürze hoch, um<br />
darin die Ausreißer zu bergen, stieg ins Wasser, es reichte mir bis über die Knie<br />
und war ziemlich frisch. Ich versuchte, die Kleinen zu fangen, was aber recht<br />
mühsam war, weil sie mir immer wieder entschlüpften. Schließlich hatte ich aber<br />
doch alle fünf in meiner Schürze und trug sie vorsichtig zur Hausbank. Hier setzte<br />
ich mich in die Sonne, die Gänslein in der Schürze auf meinem Schoß. Sie<br />
fühlten sich zufrieden, ihr „Wiwiwi“ wurde immer leiser und spärlicher, sie schliefen<br />
ein. Auch mir tat die Wärme wohl, besonders meinen kalten Füßen und der<br />
nasse Rock trocknete. Als nach einer guten Weile die beiden alten Gänse von<br />
ihrem Bad zurück kamen und ihr lautes „Gong, Gong“ zu hören war, strebten die<br />
Jungen zu ihnen auf die Erde. Aber, o Schreck! Wie schaute meine neue Schürze<br />
aus! Etliche grüne Batzen verunzierten sie. Erst versuchte ich, sie durch Schütteln<br />
und reiben zu reinigen, dann holte ich Wasser und Seife, aber die Flecken<br />
blieben. Auch die Mutter brachte sie mit heißer Lauge nicht weg, die Schürze war<br />
verdorben. Die Gänslein aber wurden groß und lieferten nach und nach die Federn<br />
für zwei „Tuchenten“ (Federbetten) und vier Kopfpolster. Wir sparten sie<br />
auf, damit sie neu waren, bis ich sie später einmal in Gebrauch nehmen sollte.<br />
Und so unbenützt blieben sie im Haus zurück, als wir 1945 die Heimat verlassen<br />
mussten.
76<br />
77<br />
In meiner Kindheit war ich sieben Sommer „Hirtmensch“ (Hütmädchen) am Bauernhof<br />
meiner Großmutter. Kühe, Kalben, Ochsen, eine Geiß, aber auch ein Stier<br />
gehörten zu „meiner“ Herde. Eines Tages fragte mich der Onkel Franzl, ob ich<br />
mich traue, den Stier Muran mit auszutreiben. Dieses Vieh, von meinem Onkel<br />
groß gezogen und an die Weide gewöhnt, war nämlich schon ein richtiger grober<br />
Lackl geworden und zeigte manchmal bösartige Anwandlungen. Ich meinte aber<br />
verwundert: „Er tut mir ja nix“.<br />
Einmal herrschte in der Herde eine Unruhe. Der Stier ließ einer Kalbin keine<br />
Ruhe, er trieb auch die anderen Tiere durcheinander, sodass sie nicht weiden<br />
konnten. Mich packte der Zorn, ich schrie ihn an und schlug ihm kräftig mit der<br />
Peitsche über die Nase. Das war ein Fehler. Der Stier senkte den Kopf zur Erde,<br />
begann zu brummen und gefährlich zu blasen und als er mit den Hufen den Rasen<br />
bearbeitete, dass er nur so wegflog, bekam ich Angst und flüchtete auf die hohe<br />
Steinmauer, welche die Weide vom fruchtbarem Ackerland abgrenzte. Ich war<br />
fast oben, da verklemmte sich einer meiner Holzschuhe zwischen den Steinen.<br />
Ich konnte nicht mehr vor noch zurück, es gelang mir auch nicht, aus dem Holzschuh<br />
herauszuschlüpfen. So blieb ich sitzen, der Muran konnte mich zwar nicht<br />
mehr erreichen, er blieb aber vor der Steinmauer und ließ seine Wut an den<br />
„Schwarzbeerhübeln“ rundum aus. Als es Zeit wurde, die Tiere heimzutreiben,<br />
sammelten sie sich vor der „Trieb“ und warteten, dass ich die „Zaunostln“ aufschieben<br />
würde. Auch der Stier stand nun friedlich dabei, ich aber saß gefangen<br />
auf den Steinen. Der Franzl tat einen schrillen Pfiff vom Haus her, um mich an<br />
meine Pflicht zu erinnern, ich schrie aus Leibeskräften um Hilfe, meine Stimme<br />
aber war zu schwach, er hörte mich nicht. Auch der Stier hatte den Pfiff gehört<br />
und begriff, was das Signal bedeutet. Er senkte den mächtigen Kopf und ging das<br />
Hindernis einfach an. Sein kräftiger Nacken hob die beiden Stangen aus dem<br />
Halt, sie polterten zu Boden, die Herde setzte sich heim zu in Bewegung und ich<br />
saß noch immer auf der Steinmauer. Als ich langsam verzagt wurde, kam mein<br />
Onkel und befreite mich aus meiner misslichen Lage. Von da an brauchte ich den<br />
Muran nicht mehr hüten. Einige Wochen später drückte der Stier meinen Onkel<br />
an die steinerne Stalltüreinfassung, als er ihn herausweisen wollte und brach ihm<br />
eine Rippe. Da verkaufte meine Großmutter den Muran dem Metzger.<br />
In meiner Volksschulzeit war ich etliche Jahre in den Sommermonaten „Hirtmensch“<br />
auf dem Bauernhof meiner Großmutter. Rindviecher waren mir vertraute<br />
Wesen. Ich war gerne dort, so besuchte ich die Ahndl auch oft unterm Jahr.<br />
Einmal, bevor die Frühjahrsarbeit auf den Feldern anging, besuchte mein Onkel<br />
Franzl den Viehmarkt in Netolitz. Dieser Ort lag in der Nähe von Prachatitz, aber<br />
schon im tschechischen Gebiet. Er brachte eine große, weiße Kuh heim und stellte<br />
sie uns vor, ehe er sie in den Stall führte. Wir, die Großmutter, die Dirn und<br />
auch ich begutachteten sie. Die Großmutter besah sie von allen Seiten und sagte:<br />
„Jung, gesund und kräftig ist sie wohl, aber wie ist es mit der Milch? Hast dich<br />
erkundigt, wie viel sie am Tag gibt?“ Er ging gar nicht auf die Frage ein sondern<br />
antwortete: „ich brauch sie zum Einspannen, mit der Scheckl zusammen gibt das<br />
ein gutes Gespann. Pflug, Egge, Heu- und Mistwagen sollen sie ziehen.“ Der<br />
Onkel zog zwar immer wieder ein Paar Öchslein groß und richtete sie zur Arbeit<br />
ab, er verkaufte sie aber, wenn sie so weit waren und fuhrwerkte lieber mit den<br />
Kühen.<br />
Die Dirn meinte geringschätzig: „Aber nur weiß ist sie, kein rotes Fleckerl hat<br />
sie, nicht einmal einen farbigen Tupfer. Die passt ja gar nicht zu unseren Viecher.<br />
Wie heißt sie denn?“ Der Franzl wusste es nicht, so erhielt sie den Namen. „Die<br />
Weiße“. „Aber wunderschöne Hörner hat sie“, machte ich aufmerksam. „Schaut<br />
nur, wie aufigspritzt!“ Wie armselig und traurig schauen doch heutzutage die<br />
Rindviecher aus, denen man den Kopfschmuck geraubt hat. Etliche Wochen später<br />
fragte ich den Franzl: „Nu, bist zfriedn mit, der Weißn?“ „Ziehen tuts gut, sie<br />
ist stark“, sagte er, „aber meinst, das Luder tät mir folgen? Ich habs im Guten<br />
versucht und hab sie richtig angeschrien und zuhauen möcht ich nicht, weil boshaft<br />
zeigt sie sich nicht.“ Der Onkel sprach auch bei der Arbeit mit den Tieren.<br />
Mit einfachen, ruhigen Worten lobte oder tadelte er sie, munterte sie auf und<br />
redete ihnen gut zu, wenn sie müde wurden. Einmal aber fluchte er sie laut an, als<br />
der Pflug über einen Stein scharrte, hängen blieb, die Tiere nicht gleich standen<br />
und es ihn aus der Furche warf. Plötzlich hatte ich einen Gedanken: „Franzl“,<br />
sagte ich, „vielleicht versteht die Kuh nur böhmisch?“ Überrascht sah er mich an.<br />
„Kannst recht haben“, meinte er, „da muss ich Geduld haben bis sie boarisch<br />
kann.“ Mit der Zeit gewöhnten sie sich gut aneinander.<br />
Der Stier Muran<br />
Die Weiße (Sprachschwierigkeiten)<br />
Anna Kangler<br />
Anna Kangler
78<br />
79<br />
„Üwageb’n is nimma leb’n!“ Mit diesem bitteren Wort nahmen Generationen<br />
Donauer Bauern, wenn die Zeit dazu da war, geduldig und ohne lautes Jammern<br />
ihr Schicksal an, übergaben den Hof in jüngere Hände und zogen in das<br />
Leitumshäusel. Untätigkeit hatten sie nie gelernt, also werkelten sie, solange es<br />
der müd gearbeitete Körper noch erlaubte, bei der täglichen Arbeit mit, kramten<br />
in Haus und Hof herum oder bewirtschafteten ihre Leitumsgrundstücke und warte-<br />
Die Simmentalerinnen<br />
Ernst Quitterer<br />
wous af Hintrin geht. Und asou hou i eam gsoat: „Do gehst in Wold ahi, afm<br />
Straßl afi und eint am Steig ba da Schleißn ohi, am Wejg links umi, ejhatzt iwa d<br />
Wies driwa und iwa d Bruck dauhi, afm Doifstraßl ohi, oft bist in Hintrin bold<br />
drejnt.“ Hot si der auskejnt?<br />
Do hot mi oamol oana gfroat<br />
Wenzl Schwarz<br />
An einem schulfreien Donnerstag hat meine Mutter zu mir gesagt: „Gehst mit?<br />
Heute gehen wir um ein Waldgras auf den „Daniheal“, da gibt es viel gutes Waldgras<br />
und Kräuter, für die Küche ein Tee.“ Der „Daniheal“ = Daniel? war eine<br />
Waldlichtung am nördlichen Hang des Fürstensitzberges. „Ja. ich gehe gerne mit,<br />
weil Heuheigen tun wir noch nicht und die Nachbarinnen gehen auch mit, da sind<br />
wir nicht allein.“ So gehen wir eine gute Stunde, erreichen die Lichtung und<br />
fangen zu grasen an. Plötzlich schreien die Frauen, die oberhalb von uns gearbeitet<br />
haben: „Passt auf! Da kommen Schlangenreifen den Hang herab!“ Schnell<br />
sind wir ins Dickicht gelaufen und haben uns versteckt. Da sehen wir sie schon,<br />
die Schlangen, lauter Kreuzottern, zu zweit wie Wagenreifen über den Hang herunterrollen.<br />
Sechs bis sieben solche Reifen habe ich gezählt. Da haben die Frauen<br />
gesagt: „Gehen wir leer heim, heute ist es heiß und zu gefährlich zum Grasen.<br />
Das sind lauter Kreuzottern, die paaren sich, das ist ihre Liebeszeit. Das Gras<br />
holen wir ein anderes mal, wenn es nicht so heiß ist.“<br />
ten meist gelassen, bis Gott sie zu sich rief. Kurz nach dern Ersten Weltkrieg hatte<br />
mein Vater unseren Hof übernommen. Mein Großvater war damals noch ein rüstiger<br />
Mann, dem Nichtstun nicht lag. Er bearbeitete noch über ein Jahrzehnt seine<br />
beiden Leitumsfelder selbständig und kümmerte sich sehr um seine Kuh, die mit<br />
den anderen Kühen in unserem Stalle stand. Die Kuh hieß Susi. Diese Susi war<br />
ein eingebildetes Luder, wenn man das von Kühen sagen darf, so richtig verzogen<br />
und verhätschelt. Doch einen Vorzug besaß sie: Sie war noch zum Ziehen<br />
abgerichtet worden und konnte eingespannt werden. Nur eine einzige unserer<br />
Kühe, die Berta, konnte das auch. Die übrigen Rinder waren nur Milcherzeuger<br />
und Fleischlieferanten. Mit der Susi und der Berta bewirtschaftete der Großvater<br />
seine Felder. Beide Kühe waren Simmentalerinnen, das ist eine Rinderrasse aus<br />
einem Gebirgstal in der Schweiz. Es war im Spätsommer, kurz nach meinem<br />
Eintritt in die Donauer Volksschule. An einem sonnigen Nachmittag rief mich<br />
mein Großvater zu sich und sagte, dass er heute das „Weiherackerl“, sein<br />
Leitumsfeld, eggen wolle; ich solle ihm dabei helfen und die Kühe führen. Er<br />
ging in den Stall und nahm mich mit. Nun war der Viehstall nicht meine Liebe,<br />
nein, ganz und gar nicht. Ich besuchte diese Örtlichkeit nur, wenn es unbedingt<br />
sein musste, und darin auch nur mit ausgeprägtem Widerwillen. Die Abneigung,<br />
die ich gegen den Stall und seine Bewohner empfand, beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit;<br />
wir waren einander nicht zugetan. Doch das war nun ohne Bedeutung.<br />
Ich hatte nie gewagt, mich meinem Großvater zu widersetzen, denn er war<br />
ein ernster, strenger Mann. Er schirrte also die Susi und die Berta ein, und zehn<br />
Minuten später eggten wir schon im Weiherackerl, das kaum zwei Steinwürfe<br />
weit von unserem Hofe entfernt lag. Freude machte mir die Eggerei nicht; es war<br />
für mich eine harte Pflicht. Auch für meinen Großvater war die Arbeit hart, wenn<br />
er sich das auch lange nicht anmerken ließ. Wir hatten etwa das halbe Feld geeggt,<br />
da hielt er das Gespann oben an der Straße an, hakte die Zugscheite mit den<br />
Strängen daran von der Egge los und sagte zu mir doch recht müde: „Ich gehe<br />
jetzt heim, du bleibst da und passt gut auf die Kühe auf, bis dein Vater mit den<br />
Pferden kommt und die Arbeit fertig macht!“ Dann ging er. Da stand ich also nun<br />
mit meinen beiden Simmentalerinnen; ein bisschen stolz, dass man mir eine so<br />
verantwortungsvolle Aufgabe übertragen hatte, und ein bisschen ängstlich, nun<br />
ja, diese beiden Simmentalerinnen - wer weiß, wer weiß? Eigentlich hatte ich<br />
nichts gegen das Simmental, eher das Gegenteil, das Wort gefiel mir, denn unbekannte<br />
Wörter, die ich hörte, blieben mir gleich fest im Gedächtnis hängen, und<br />
je toller sie klangen, desto heftiger erregten sie meine Phantasie, und die bildete<br />
mir eine fremde, farbige, gewaltige Landschaft mit hohen Bergen, auf denen die<br />
„Simmentaler“ frei wie die Gemsen ihr Wesen trieben. Aber so unmittelbar wie<br />
im Augenblick wollte ich mit den Simmentalern eigentlich nichts zu tun haben,<br />
denn in der Wirklichkeit da vor mir waren sie mir viel zu groß und zu stark für<br />
meine kleine Kraft und mir auch unheimlich, weil ich fürchtete, was sie in ihren<br />
mächtigen Köpfen dachten und was sie Ungutes mit mir anstellen konnten. Auch<br />
fühlte ich im tiefsten Inneren, dass ich bei den beiden in recht mäßigem Ansehen<br />
Ein gefährlicher Nachmittag<br />
Anna Kangler
80<br />
81<br />
Eine <strong>Böhmerwäldler</strong>in, Anna Fritz, erzählte mir ein Erlebnis von einem abenteuerlichen<br />
Grenzgang nach dem Zweiten Weltkrieg. Fast könnte man zweifeln, dass<br />
sich die Geschichte auch wirklich so zugetragen hat, aber die Erzählerin ist absolut<br />
glaubwürdig.<br />
Frau Fritz, zu jener Zeit verheiratete Mathis, ihre Schwester Frau Müller, beide<br />
geborene Sigmund, und ein ihnen bekannter junger Mann, Hans Lebsche, der<br />
während des Krieges bei der Marine diente, wollten für eine Schwester der beiden<br />
Frauen Wäsche und ein Federbett über die Grenze nach Neureichenau bringen.<br />
Die Sache mit dem Esel - Grenzgang mit<br />
Hindernissen<br />
Erna Dittrich<br />
In Neureichenau, auf der bayerischen Seite am Fuße des Dreisessels gelegen,<br />
hatten viele der Grenzgänger bei einem Bauern einen Abstellplatz für ihre Habe,<br />
so auch die beiden Frauen. Auch ein großes Streulager war dort eingerichtet,<br />
damit die Leute, wenn sie morgens mit ihrem schweren Gepäck ankamen, sich<br />
ausruhen und schlafen konnten. Hier lagen sie oft nebeneinander, ohne dass einer<br />
den anderen kannte. Man konnte ja nur nachts wieder zurück gehen. Wohnte man<br />
nicht in der Nähe der Grenze, so schaffte man den Rückweg in der gleichen Nacht<br />
nicht mehr. Frau Fritz war in Krummau verheiratet, zog nach dem Krieg über<br />
Umwege mit ihrem kleinen Sohn zu ihren Angehörigen nach Kirchschlag. Von<br />
der Kreisstadt ungefähr drei Gehstunden entfernt, gehörte Kirchschlag zum Landkreis<br />
Krummau. In Kirchschlag gab es einen deutschen Briefträger namens<br />
Ludwig. Da der Zustellbezirk sehr groß war und es viel Post gab, stellten die<br />
Tschechen einen Esel zum Austragen der Post zur Verfügung. Den Esel hatte das<br />
deutsche Militär zurück gelassen. Da Frau Fritz den Briefträger gut kannte, wollte<br />
er ihnen den Esel für einen Tag leihen, um leichter das Gepäck über die Grenze<br />
transportieren zu können. Frau Fritz und ihre Schwester versprachen hoch und<br />
heilig, mit dem Esel am nächsten Tag wieder zu Hause zu sein. Hans Lebsche bot<br />
ihnen Hilfe an, da er einen Schleichweg über die Grenze kannte.<br />
Der Esel wurde bei Nacht in das Elternhaus der Frauen gebracht. Damit niemand<br />
etwas zu hören bekam, führte man ihn in die Stube, die Fenster wurden verdunkelt.<br />
Dann wurden dem Esel die schöne Bettwäsche und ein Federbett aufgeladen<br />
stand. Eine Weile ging es ganz gut, da erduldeten sie mich. Doch dann sah sich<br />
die Susi vorsichtig nach mir um, dann sahen sich die beiden an, dann sahen sie<br />
mich an und hatten etwas Hinterhältiges im Blick, und dann marschierten sie<br />
gleichzeitig los. Zuerst vom Feld über die Brücke, dann auf die Straße und darin<br />
ab in Richtung heimatlicher Stall, zielstrebig, stark und unbeirrbar. Und nun folgte<br />
mein dramatischer Auftritt als missglückter Bauer! Zweihundert Meter dauerte<br />
mein verzweifelter Kampf gegen die rohe Gewalt der beiden Simmentalerinnen.<br />
Zweihundert lange, lange Meter hing ich am Leitseil, zog und zerrte daran, spreizte<br />
und stemmte mich, schrie und weinte, war zornig und schämte mich, doch alles<br />
war vergebens, machtlos war ich den entfesselten Kräften ausgeliefert. Endlich<br />
bog dieses Aufsehen erregende Dreiergespann in unseren Hof ein. Die Kühe zogen<br />
mich noch bis in die Mitte des Hofes, blieben dort dann ganz gesittet vor der<br />
Stalltür stehen und schauten mich freundlich mit ihren großen, unschuldigen Tieraugen<br />
an. Doch im tiefsten Augengrund konnte ich, besonders bei der Susi, deutlich<br />
den heimlichen Triumph erkennen: „Gell, dir haben wir’s gezeigt!“ Sie standen<br />
nun ganz still und warteten auf jemanden, den sie als Herren anerkannten.<br />
Das war dann unsere Magd Nani. Sie erkannte gleich, was sich da abgespielt<br />
hatte, lachte ein bisschen, wischte mir mit ihrer Schürze die Tränen ab und sagte<br />
tröstend: „No geih, kimm, setz die afs Bankerl!“ Ich setzte mich auf unsere Hofbank<br />
und versuchte ruhiger zu werden, denn das Weinen stieß mich so, dass ich<br />
kein Wort herausbrachte, zu fürchterlich war mir die Schmach, die ich erlitten<br />
hatte. Die Nani begann mit dem Ausschirren der Kühe und ich wollte mich gerade<br />
unauffällig von der Stätte meiner Niederlage verdrücken, da trat mein Vater<br />
aus dem Haus. Er sah die beiden friedlichen Kühe, er sah seinen Sohn so ganz<br />
ohne Glanz und Gloria, und er erkannte: „Zu einem Bauern taugt der nicht, den<br />
müssen wir studieren lassen!“<br />
Eine grasende Kuh bei der Ortschaft Kuschwarda. Foto: Wolf, Krummau (Sammlung<br />
Reinhold Fink)
82<br />
83<br />
und mit einer Wäscheleine um den Bauch festgebunden. Frau Fritz richtet sich<br />
noch einen Rodel voll Bettwäsche, den sie selbst ziehen wollte. Die Tür wurde<br />
geöffnet, um den Esel ins Freie zu führen, doch - oh Schreck - der Türstock war<br />
nicht groß genug für den aufgepackten Esel! Als man versuchte, den Esel durch<br />
die Tür zu zwängen, bekam es der Ludwig, der bis zum Abmarsch dabei sein<br />
wollte, mit der Angst zu tun, dass dem Esel weh getan werden könnte. Es blieb<br />
nichts anderes übrig, als wieder abzuladen. Danach führte man den Esel in die<br />
Schmiedewerkstatt des Vaters, um ihn neu zu bepacken. Auf dem Weg von der<br />
Schmiede zum Dorf lag zwischen den Bauernhäusern hoher Schnee, so dass ein<br />
Hohlweg geschaufelt war. Hier musste man durch, doch der aufgepackte Esel<br />
war für den schmalen Weg zu breit. Nun hieß es wieder abpacken und den Esel,<br />
nachdem man ihn durch den Schnee geführt hatte, wieder neu beladen - immer in<br />
der Angst, dass eine Patrouille des Weges kam. Endlich ging es ganz ruhig der<br />
Straße entlang durch Kirchschlag, ein langgezogenes Straßendorf. Die kleinen<br />
Hufe des Esels sanken im Schnee so stark ein, dass die Drei vorangehen mussten,<br />
um dem Tier einen Weg zu bahnen. Dabei fiel ihnen Schnee in die Stiefel, so dass<br />
sie jetzt schon nasse Füße bekamen. Anschließend ging es eine weite Strecke<br />
durch den Wald, danach vor Eggetschlag über die Straße, dann querfeldein. Hier<br />
war der Schnee sehr matschig. Nun führte der Weg über die Moldaubrücke, Gegen<br />
sechs Uhr früh erreichten die das erste Haus in Glöckelberg. In einem der<br />
Häuser sahen sie eine Frau beim Brotteigkneten. Das Geräusch eines Fahrzeugs<br />
ließ sie aufschrecken, es gab aber keinen Fluchtweg. Zum Glück erkannten sie,<br />
als sich das Fahrzeug näherte, dass es nur der Milchwagen war. So zogen sie<br />
noch ein Stück weiter und als der Tag anbrach, baten sie einen Bauern, ob sie sich<br />
im Stall ein wenig ausruhen dürften. Doch dieser schickte sie wieder weiter. Auch<br />
bei anderen Häusern hatte die Suche nach einem Quartier keinen Erfolg, so gingen<br />
sie zum ersten Bauern zurück. Dort riss sich der Esel los und lief einfach in<br />
den Stall, wie wenn er der Quartiersuche ein Ende machen wollte. Jetzt durften<br />
sie bleiben und sich in einer Kammer ausruhen. Ihre nassen Stiefel hängten sie<br />
zum Trocknen über den Ofen. Erst am Abend wurden sie wieder wach, als es in<br />
der Kammer schon stockfinster war. Es hatte den ganzen Tag über so stark geschneit,<br />
dass der Schnee bis über das Fenster reichte. Nachdem sie von den Bauersleuten<br />
Milch und Brot zum Essen bekommen hatten, wollten sie ihre getrockneten<br />
Stiefel wieder anziehen. Doch beim Trocknen über dem Ofen war das Leder<br />
so eingelaufen, dass die Stiefel nicht mehr passten. Gerade noch konnten sie<br />
die Stiefel anziehen. Frau Fritz traf es am schlimmsten, sie musste mit den Fersen<br />
auf dem hinteren Rand ihrer Stiefel laufen. Trotz des vielen Schnees machten sie<br />
sich auf den Weg in Richtung des Plöckensteiner Sees vor Hüttenhof. Doch der<br />
Esel brach so stark ein, dass es kein Weiterkommen gab. Sie mussten umkehren<br />
und baten den Bauern wieder um eine Bleibe. Immer wieder versuchten sie aufzubrechen,<br />
aber vergeblich. So vergingen drei Tage. Doch dann mussten sie endgültig<br />
aufgeben und beschlossen, den Rückweg anzutreten. Ihr Gepäck ließen sie<br />
beim Bauern zurück, um es später über die Grenze zu bringen. Schon ein gutes<br />
Stück auf dem Rückweg standen sie auf einmal vor einem Bach, einem Zufluss<br />
der Moldau, der ihnen beim Hinweg nicht aufgefallen war, er musste da noch<br />
zugefroren gewesen sein. In der Zwischenzeit hatte es getaut, und es gab kein<br />
Durchkommen. Hans ritt mit dem Esel durch den Bach, aber der Esel wollte nicht<br />
mehr alleine zurück, um die Frauen zu holen. So musste Hans wieder mit dem<br />
Esel umkehren. Frau Fritz und ihre Schwester gingen zum nächstgelegenen Bauernhaus<br />
und brachten einen Pfosten mit, aber als Hans ihn quer über den Bach<br />
legen wollte, rutschte er aus und fiel ins Wasser. Die Frauen zogen Hans heraus<br />
und brachten ihn, tropfnass und schon blau im Gesicht, auf dem Pfosten liegend<br />
zu dem Bauernhaus. Die alte Bäuerin kochte ihnen Tee, Hans durfte dort bleiben<br />
um sich etwas zu erholen. Während dieser Aufregung ließ man den Esel aus den<br />
Augen, er lief einfach zu den Bauern aus Glöckelberg zurück. Die Leute dort<br />
erschraken, als sie den Esel alleine kommen sahen, der auch noch dazu jämmerlich<br />
schrie. Sie nahmen an, dass die drei Grenzgänger von den Tschechen gefangen<br />
genommen worden waren. Als aber die Frauen wieder nach Glöckelberg<br />
kamen, meinte der Bauer: „Wie könnt ihr zu diesem Bauern gehen, der ist doch<br />
ein Kommunist! Wenn er erfährt, dass ich euch Unterkunft gegeben habe, verrät<br />
er mich an die Tschechen!“<br />
Nun war es gut, dass sie dem Bauern, bei dem Hans untergebracht war, nicht die<br />
Wahrheit gesagt hatten. Frau Müller war mit einem Österreicher verheiratet und<br />
war daher österreichische Staatsbürgerin, sie hatte ein rot-weiß-rotes,<br />
österreichisches Wappen an ihrer Kleidung. Dem Bauern hatten sie erzählt, dass<br />
sie ihrem Mann etwas nach Österreich bringen würde. Am nächsten Tag holten<br />
die Frauen Hans wieder ab, ihre Kleidung wurde auf dem Weg dorthin wieder<br />
nass. Nachdem sie sich kurz erholt hatten, machten sie sich um halb drei Uhr<br />
morgens weiter auf den Heimweg. Gepäck hatten sie nun keines mehr, somit<br />
konnten sie auch am Tag auf öffentlichen Wegen gehen. Doch damit ist die Geschichte<br />
noch nicht aus! Als sie nach Eggetschlag gelangten, kam ihnen ein Tscheche<br />
mit einem Gehilfen entgegen, der auf der Schulter Kleeheu trug. Die beiden<br />
waren zur Wildfütterung unterwegs. Der Tscheche fragte die drei, wo sie denn<br />
mit dem Esel hin wollten. Sie antworteten: „Zur Schmiede.“ Es blieb ihnen somit<br />
nichts anderes übrig, als dann auch in diese Richtung zu gehen. Unterwegs kamen<br />
sie bei der Schule vorbei, viele Kinder liefen auf sie zu, die sich freuten,<br />
einen Esel zu sehen. Hans sagte: „Wer von euch dem Esel Futter bringt, darf ihn<br />
streicheln!“ Einige Kinder liefen heim und kamen mit Händen voll Hafer und<br />
Brot zurück. Dann ging es wieder weiter, immer der Straße entlang. Neben der<br />
Straße türmten sich hohe Schneewände. Auf einmal stand auf einer dieser Wände<br />
ein tschechischer Soldat auf Schiern, der von der Grenzstation Friedberg kam.<br />
Auch er fragte sie, wohin es mit dem Esel denn gehe? Frau Müller, die gut tschechisch<br />
sprach, erklärte ihm, dass sie ihrem Mann etwas nach Österreich gebracht<br />
hätte. Denn von dem Ort, an dem sie sich befanden, hätten sie es näher nach<br />
Osterreich als nach Bayern gehabt. Frau Müller fragte den Tschechen, ob sie<br />
nicht für einen Augenblick sein Bajonett haben könnte, um dem Esel die Hufe
84<br />
85<br />
auszuputzen. Tatsächlich warf er ihnen sein Bajonett zu! Danach konnten sie den<br />
Weg fortsetzen. Der Soldat fuhr neben ihnen her, bis er zu einem Lager bei<br />
Schwarzbach abbog. Was aber spielte sich in der Zwischenzeit beim Briefträger<br />
Ludwig ab? Die Tschechen fragten ihn, wo denn sein Esel sei. Er gab vor, dass<br />
der Esel krank im Stall stehe. So ging es von einem Tag zum anderen. Nach ein<br />
paar Tagen riet man dem Briefträger, er solle den Esel doch zum Tierarzt bringen.<br />
Aber Ludwig erwiderte, dass er ihn selbst gut pflegen könne und ihn schon wieder<br />
gesund bekommen würde. Welche Angst dieser Mann auszustehen hatte, kann<br />
man sich vorstellen, denn es waren schon fünf Tage vergangen. Jeden Abend saß<br />
er im Elternhaus der Frauen, und alle warteten sehnsüchtig und voller Angst auf<br />
deren Rückkehr. Die drei Abenteurer samt Esel waren inzwischen auf einer Seitenstraße<br />
nach Planers unterwegs. Sie kamen an einzeln stehenden Häusern vorbei.<br />
Auf einmal lief ein Mann aus einem Haus auf sie zu und wollte ihnen den Esel<br />
abkaufen. Die drei erklärten ihm, dass sie das Tier nicht verkaufen könnten, da es<br />
ausgeliehen sei. Aber der Mann war so begeistert und als er den Esel streichelte,<br />
legte sich dieser einfach hin und wollte nicht mehr aufstehen. Da brachte der<br />
Mann auch noch Zaumzeug aus dem Haus und legte es dem Esel um. Es dauerte<br />
lange, bis er aufgab und einsah, dass das Tier wirklich unverkäuflich war. Auch<br />
nachdem der Mann endlich wieder in sein Haus gegangen war, hatten sie noch<br />
große Mühe, den störrischen Esel wieder auf die Beine zu bringen. Sie mussten<br />
ihn förmlich aufheben. Ihr Weg führte nun weiter durch den Wald. Da hörten sie<br />
auf einmal das Geläute eines Schlittens, ein Ausweichen war nicht möglich. Auf<br />
dem Schlittengespann saßen neben dem Kutscher zwei Bauern und hinter diesen<br />
standen zwei Kommissare mit aufgepflanzten Bajonetten. Man musste annehmen,<br />
dass die beiden Bauern verhaftet waren und fortgebracht wurden. Die Kommissare<br />
riefen: „Stui, Stui!“ (Stehen bleiben!) Lag es nun am Kutscher oder gingen<br />
die beiden Pferde tatsächlich durch? Sie bäumten sich auf und galoppierten<br />
an den dreien vorbei. Jedenfalls kam das Gespann nicht zum Stehen und die drei<br />
konnten mit ihrem treuen Gefährten den Weg fortsetzen. So gelangten sie in die<br />
Ortschaft Mutzgern, hier kannte man Frau Fritz. Sie klopfte bei einem Bauern an,<br />
bei dem sie früher einmal gearbeitet hatte. Endlich brachte man mit letzter Kraft<br />
und Ausdauer auch das letzte Stück des Weges zu Ende. Die Freude war unbeschreiblich,<br />
als sie zu Hause eintrafen. Die Mutter weinte vor Freude und der<br />
Briefträger war aus seiner Not gerettet, er brauchte bloß den Esel in seinen Stall<br />
zurückzuschmuggeln. (Aus: Erna Dittrich „So is’gwen“, 1995)<br />
Es war am 22. Mai 1946; Mutter, meine Schwester und ich packten unsere Sachen<br />
für die “Aussiedlung” zusammen, wie jene mit schlechtem Gewissen oder<br />
jene aus Dummheit unsere Beraubung und Vertreibung verlogen und beschönigend<br />
nennen.<br />
Da kamen zwei Tschechen, wie Cowboys gekleidet, zu uns und verlangten, dass<br />
wir unsere Rinder (gelegentlich spannten wir sie als Zugtiere beim Ackern, Eggen<br />
usw. ein) zur Sammelstelle beim Altrichter ( Hausname des Bauern) treiben<br />
sollten.<br />
Wir verstanden natürlich nicht tschechisch. Und schon gar nicht was sie wollten.<br />
Nach einigem Hin und Her gingen wir in den Stall. Wir sollten die Rinder losbinden,<br />
meinten die Cowboys. Wir verstanden nichts. So mussten sie die Rinder<br />
vom Futterbarn abhängen, was ihnen schimpfend gelang. Sie führten die Scheckl<br />
(unsere Milchkuh) und das Scheckei (eine schöne trächtige Kalbin), an ihren<br />
Ketten um die Hörner, am Weg durch die Au Richtung Kirchenwinkel. Traurig<br />
sahen wir ihnen vom Zimmerfenster aus nach. An der Weggabel in Richtung<br />
Altrichter blieben die Rinder stehen. Die Treiber schlugen auf die Tiere ein, schrieen,<br />
und traten sie mit Füßen. Die Rinder rührten sich nicht. Wieder und wieder<br />
rissen sie an den Ketten und schlugen die Tiere. Auf einmal schüttelte die Scheckl<br />
den Kopf hin und her, machte einen gewaltigen Sprung vorwärts und der Treiber<br />
lag, mit den Beinen gegen den Himmel zeigend, am Boden. Auch das Scheckei<br />
konnte das. Die losgerissenen Rinder kamen im Galopp zurück. Vor der noch<br />
offenen Stalltüre blieben sie kurz stehen und gingen schnaubend auf ihre Plätze<br />
im Stall.<br />
Auch die Tschechen kamen zurück. Fluchend holten sie die Rinder noch einmal<br />
aus dem Stall und kamen mit ihnen bis zur Abzweigung. Wieder blieben Tiere<br />
stehen - warfen wie vorher bei dem Gerangel - die Cowboys in das Gras und<br />
kamen galoppierend zurück. Die Tschechen folgten ihnen langsam schimpfend.<br />
Und welch ein Wunder! In gebrochenem DEUTSCH erklärten sie, dass sie die<br />
Tiere nicht mehr anlangen würden und wir sollten sie - bitte, bitte - selber zur<br />
Sammelstelle bringen. Ungern taten wir es. Langsam und mit hängenden Köpfen,<br />
gingen die Scheckl und das Scheckei mit unserer weinenden, am ganzen<br />
Leib zitternden Mutter und ihrem zornigen Sohn zur Sammelstelle.<br />
Nachsatz: Seit diesem Ereignis zitterte die Mutter, bis sie starb. Und ich sagte nie<br />
mehr zu jemand: „blöde Kuh“ oder „Rindvieh“.<br />
D’ Scheckl und die Cowboys<br />
Karl Halletz
86<br />
87<br />
Es kommt vor, dass ich einmal nicht schlafen kann, aber gerade dann wenn alles<br />
ruhig ist, wandern meine Gedanken heimwärts in die Böhmerwaldheimat, und<br />
ich erinnere mich an Erlebtes und an Geschichten, die mir der Großvater und<br />
auch die Großmutter erzählt haben, als ich noch ein kleiner Bub war. Eine Geschichte<br />
davon möchte ich heute zu Papier bringen. Ein Stück entfernt von Pumperle<br />
lebte ein Mann, die Leute nannten ihn Hias. Er war Gelegenheits-arbeiter,<br />
der alles machte, nur nichts Gescheites. Er paschte (schmuggelte), wilderte und<br />
am liebsten saß er im Wirtshaus, doch meistens fehlte es an Geld. Daheim, seine<br />
Frau, die Resi, versorgte die kleine Landwirtschaft und die Kinder. Resi war<br />
furcht-bar neugierig. Es war wieder einmal spät geworden beim Wirt, eigentlich<br />
war es schon früh am Morgen, als er heimwärts wanderte. Da sah er vor sich<br />
einen Maulwurf laufen, der schnell wieder unter die Erde zu kommen trachtete.<br />
Ohne sich viel dabei zu denken, schlug er mit seinen Stock den schwarzen Kerl<br />
einfach tot, und warf ihn in einen der vielen Ästehaufen, die am Weg zum Verbrennen<br />
bereit lagen. Als er so weiterschritt, da fiel ihm ein, er könnte sein so<br />
neugieriges Eheweib ein bisschen ärgern. Sie wird sowieso wieder recht schimpfen.<br />
Als er endlich heimkam, stand die Resi schon an der Haustür und schimpfte:<br />
„Host wieder des gonze Geld versoffen und i kann dann zum Bettln gehn!“ Sonst<br />
kam es in solchen Fällen immer zum Streit, aber er sagte gar nichts und machte<br />
einen recht traurigen Eindruck. Das aber machte sie neugierig und sie fragte: „Is<br />
ebbers passiert?“ Er zeigte sich weiter verschlossen und antwortete, ich möchte<br />
dir ja gern was sagen, aber du gehst ja glei im nächsten Moment zur Nachbarin<br />
und erzählst es weiter. Na, g’wiß net, ich versprech’ dir’s und sie ließ ihm keine<br />
Ruhe. Darauf sagte er: “Resi, aber du derfst es koan Menschen sagen, i hob oan<br />
umbracht”. “Um Gotts Willen!”, schreit sie auf, “die wern di doch einsperren!”<br />
“Na, sagt der Hias, koa Mensch hot mi g’sehn, wia i ihn daschlogn hob”. Er zog<br />
eine andere Kleidung an und ging auf die Wiese, um dort Gras für die paar Ziegen<br />
zu mähen, aber er ließ das Haus nicht aus den Augen, denn er wusste, bald wird<br />
sie zur Nachbarin laufen und ihr alles erzählen, natürlich unter dem Siegel strengster<br />
Verschwiegenheit. Als er heimkam, sprach er nicht mehr über dieses Thema,<br />
aber sie schlich umher wie das schlechte Gewissen selbst. Am nächsten Tag zur<br />
Mittagszeit, als der Maulwurfsmörder gerade seine Suppe löffelte, klopfte es an<br />
die Türe. Herein kamen zwei Gendarmen und fragten: „Sind sie der Mathias<br />
Sagerer?” “Ja, der bin i, was wollt ihr von mir?” “Sie müssen mitkommen, es<br />
liegt eine Anzeige vor, dass sie jemanden umgebracht haben, also machen sie uns<br />
keine Schwierigkeiten“. Seine Resi hat also seine G’schicht brühwarm der Nachbarin<br />
erzählt und die Nachbarin gleich wieder der andern Nachbarin, deren Mann<br />
hat davon erfahren und die Gendarmerie verständigt. Zuerst hat der Hias nur<br />
Einer meiner Großonkel ist ein Wilderer gewesen. Er ist ledig geblieben und hat<br />
mit einer alten Tante, der Moam, im Stübl gewohnt, wie man bei uns die<br />
Austraghäusln genannt hat. Er hat ein Ross gehabt und ist als Frächter viel<br />
unterwegs gewesen und weit herumgekommen. Bis nach Krummau und sogar<br />
nach Budweis haben ihn seine Wege geführt, und da hat er, wenn die Gelegenheit<br />
günstig gewesen ist, so manches Stück Wild aus den Fürst-Schwarzenberg’schen<br />
Wäldern geholt und unter seiner Fracht versteckt in die Städte mitgefahren. Hier<br />
hat er schon seine Plätze gehabt und seine Leute gewusst und sich damit manchen<br />
Gulden zusätzlich verdient. Gewusst hat es ein jeder, aber verraten hat ihn<br />
niemand, und die Jager haben ihn nie erwischt, so schlau hat er dieses Geschäft<br />
betrieben. Einmal ist er nur recht knapp davongekommen. Er schießt ums Finsterwerden<br />
einen Rehbock, bricht ihn auf und steckt ihn in einen blau gefärbten Leinensack.<br />
Gerade als er den Sack über die Schulter wirft, ertönt ein kräftiges: „Halt,<br />
du Lump - oder ich schieße!“ Teufl, Teufl, da ist der Hansirgl aber gesprungen!<br />
Hinein in die Stauden, hinunter in den Graben, im Bach entlang, hinauf durch die<br />
unteren Weiden, längs der Steinmauer zum Häusl und beim Stadltürl hinein. Es<br />
ist schon finster, drum haben die Jager nicht mehr schießen und ihn auch nicht so<br />
schnell verfolgen können. Ob sie ihn erkannt haben? Im Gesicht nicht, da hat er<br />
ein schwarzes Tüchl davor gehabt.<br />
Eine Wilderergeschichte<br />
Anna Kangler<br />
Der Mordfall<br />
Karl Spannbauer<br />
gelacht und wollte den Kriminalpolizisten den Spaß mit seiner Frau erklären,<br />
aber die meinten, das alles könne er dann bei Gericht erklären. Es kam zum Verhör<br />
und niemand wollte ihm die Geschichte mit dem Maulwurf und dass es sich<br />
nur um einen Spaß handelte, glauben. Es kam zur Ortsbesichtigung und die Herren<br />
vom Gericht wollten wissen, wo der Ermordete vergraben sei. Die Gendarmen<br />
drehten die Ästehaufen um und um und immer wieder wurde der Hias gefragt,<br />
wo er den Toten versteckt hätte. Dem Hias war nicht mehr gut bei dieser<br />
Sache und das Lachen war ihm schon längst vergangen. Er hätte den Herren<br />
gerne den Maulwurf gezeigt, aber er wusste selbst nicht mehr genau, wo der<br />
gelandet war. Endlich, dann doch nach einiger Zeit fand er die Tierleiche und nun<br />
schließlich musste man ihm die Geschichte vom Maulwurf glauben. Die Herren<br />
des hohen Gerichtes mussten sich sogar entschuldigen, aber leicht ist ihnen das<br />
nicht gefallen. Und als er wieder daheim war bei seiner Resi, da hat’s was gegeben.<br />
Schuld an der ganzen Sache aber war ja er selbst mit seiner blöden Geschichte.<br />
Und immer wenn er einen Maulwurf sah, musste er an die Tage in der<br />
Untersuchungshaft denken.
88<br />
89<br />
“Ja“, sagt der Jagahans im Wirtshaus zu seine Spezln und zündt sei Pfeifm an,<br />
„was glaubts, was ma gestern passiert is? I tat s selber nit glaubn, wenn i nit<br />
selber dabei gwen war. Aber es is so wahr, wias wahr is? dass i da sitz. Geh i schö<br />
langsam durchs Holz an See zua, springt vor mir a Rehbock auf und will si ins<br />
Moos eini flüchtn. Da gibts bei mir koa Bsinna. S Gwehr owa, afa reiß is zan<br />
Gsicht und scho krachts. Den Bock reißts zam wia an laarn Sack. Koan Rührer<br />
tuat er mehr. I geh hin und woatn aus und steckn in Rucksack eini. Aber - was is<br />
denn jetzt des! I moan, i siag nit recht. Liegt da a mords Trumm Has, grad da, wo<br />
der Bock niederbrocha is. Ganz warm is er no. I beitl min Kopf, kann mas nit<br />
denka, wia des zuaganga is.—<br />
Den Has muaß der Bock beim Umfalln direkt derdruckt ham.“<br />
Jagdglück<br />
Anna Kangler<br />
Houmt ma uis durstöubert int und oubn.<br />
Houmt d Moam ausgfroat. Dej muaß ma loubn.<br />
Ins Budafaßl houms nit gschaut.<br />
Da is a Rehbouck dringlejng saumt der Haut.<br />
D lejst Woucha hant die Jaga kejma.<br />
Sie wulltn ma mein Rehbouck nejma.<br />
Wulltn bringa mi vors hohe Gericht.<br />
Owa gfuntn houms dos Böckei nicht.<br />
Jetzt aber schnell! Das Gewehr hinter den Holzstoß geschmissen, ein paar Scheitln<br />
darauf, dann hetzt er in die Stube. „Moam!“ schreit er nur, die ist schon im Bilde.<br />
Sie sieht das Butterfaßl stehen, hebt den Deckl ab, reißt den Rührsteckn heraus,<br />
und der Onkel beutelt den Bock hinein. Die „Flauger“ lehnen ja draußen vorm<br />
Haus zum Trocknen. Dann sticht sie den Steckn durchs Faßl, drückt den Deckel<br />
drauf und setzt sich dazu. Der Hansirgl packt den blutigen Sack und taucht ihn<br />
vor dem Haus in dem Wassergrund unter. Mit seinen Holzschuhen, die nass vom<br />
Bachwasser sind, rennt er über den Misthaufen und stellt sie in den Stall. Dann<br />
legt er sich ruhig auf die Ofenbank und schaut der Moam zu, wie sie ausrührt...<br />
Gleich drauf sind die Jager da. Die Moam, schwerhörig schon, versteht rein gar<br />
nicht, was die Jager wollen, bleibt beim Butterfaßl sitzen und rührt ruhig weiter.<br />
Und der Hansirgl, grad aus einem tiefen Schlaf aufgescheucht, ist noch so „tramhapert“,<br />
dass er gar nicht erfasst, was los ist... Einige Zeit später aber hat er die<br />
Leute im Wirtshaus mit folgendem Lied, zum Lachen gebracht:<br />
Der Prozess<br />
Auf dem Rain zwischen den Feldern des Wenzalbauern und seines Nachbarn<br />
wuchs eine Eiche. Als der Wenzalbauer wieder einmal in Geldnot und der Preis<br />
für Eichenholz hoch war, fällte er sie und verkaufte das Holz ohne ein Wort mit<br />
seinem Nachbarn zu reden. Als dieser sah, was geschehen war, ging er zum<br />
Wenzalbauern und verlangte die Hälfte vom Verkaufspreis. Der wollte aber nichts<br />
von dem guten Geld hergeben. So kam es zu einem heftigen Streit zwischen den<br />
beiden Nachbarn. Schließlich verklagte er den Wenzalbauern beim Gericht. Als<br />
die Zeit der Verhandlung heranrückte und der Termin feststand, hätte auch der<br />
Wenzalbauer einen Anwalt oder einen Advokaten, wie wir sagten, beauftragen<br />
sollen, damit er ihn bei Gericht verteidige. Doch dazu fehlte ihm das Geld. Auch<br />
hielt er sich für sehr schlau und redegewandt, sodass er glaubte, sich bei Gericht<br />
selbst verteidigen zu können. Bald merkte er, dass ihm die Kenntnis der einschlägigen<br />
Gesetze fehlte. Er suchte deshalb den Hoidn Franzal, einen Verwandten<br />
auf, der sein Geld als Gemeindeschreiber verdiente. Dieser Verwandte las dem<br />
Wenzalbauern die Gesetze vor. Dann berieten die beiden Männer gemeinsam,<br />
was wohl für den Prozess zutreffen könnte. Dem Wenzalbauern bereitete das<br />
Lesen einige Schwierigkeiten, deshalb ließ er sich vom Hoidn Franzal die Gesetze<br />
vorlesen und er lernte sie auswendig. Dieses Einüben dauerte zwar mehrere<br />
Tage, aber es kostete keinen Heller und das gab ihm Kraft zum Durchhalten. Bei<br />
Gericht erkannte der Richter sehr bald, dass er keinen studierten Juristen, sondern<br />
einen Stümper vor sich hatte und verurteilte den Wenzalbauer zur Herausgabe<br />
des halben Verkaufspreises. Der verkaufte dann ein Stück Vieh, um das Geld<br />
zahlen zu können..<br />
Im Wahlkampf<br />
Vor der Wahl entbrannte ein heftiger Kampf zwischen den Roten (Sozialdemokraten)<br />
und den Grünen (Bund der Landwirte). Auf der Straße, vor allem aber in<br />
den Wirtshäusern, redeten sich die Anhänger dieser Parteien bei jeder Gelegenheit<br />
die Köpfe heiß. Der Wenzalbauer geriet in diesen Wahlkampf, denn er suchte<br />
oft ein Wirtshaus auf, weil ihn dürstete. Die politischen Reden, die er dort hörte,<br />
verdrossen ihn und er überlegte, wie er den Streithähnen eins auswischen könnte.<br />
Schließlich kam ihm ein Einfall. Er fand ihn gut und setzte ihn auch gleich um: Er<br />
strich eine Sau auf einer Seite rot, auf der anderen aber grün an. Dann band er<br />
dem Tier einen Strick um das linke Bein und trieb die Sau durch die Dörfer bis<br />
nach Langendorf. Die Leute auf der Straße blieben stehen, schauten sich dieses<br />
Sautreiben an, das sie noch nie gesehen hatten, und lachten herzlich darüber. Ob<br />
dadurch der Diskurs über die Ansichten der Parteien in den Wirtshäusern weniger<br />
hitzig geführt wurde, ist nicht bekannt.<br />
Stückln vom Wenzalbauer<br />
Maria Frank
90<br />
91<br />
Man schrieb das Jahr 1926. Ich besuchte den 1. Jahrgang der zweiklassigen Volksschule<br />
in Blumenau. Die 1. Klasse umfasste die Jahrgänge eins mit drei und war<br />
im Erdgeschoss untergebracht, die 2. Klasse im 1. Stock darüber mit den Jahrgängen<br />
vier bis acht. Es war im Spätherbst. In der Klasse herrschte äußerste Ruhe,<br />
hatte doch unser Lehrer sein Werkzeug, den „Haselnussern“ stets neben sich auf<br />
dem Pult liegen. Er schrieb fleißig, behielt uns aber im Auge, wir hatten Stillbeschäftigung.<br />
Plötzlich hob ein Bub, der in der letzten Bank beim Fenster saß, den Kopf und<br />
lauschte. Tatsächlich, wir hörten es jetzt auch, ein uns unbekanntes Geräusch<br />
schreckte uns auf. Wir konnten uns nicht denken, woher dieses Gebrumm kam<br />
und was es bedeuten sollte. Da schrie der Bub am Fenster: „A Auto! Es bleibt<br />
Miesa, Radbusa, Angel und Uslawa heißen die vier Quellflüsse der Beraun. Die<br />
Radbusa entspringt bei Schnaggenmühl im Böhmerwald. So lernten wir es einst<br />
daheim in der Volksschule zu Mogolzen. Mundartlich nannten wir die Radbusa<br />
„d’ Rabusa“. Als Nichtanwohner derselben lernte ich sie erst im Sommer 1939<br />
persönlich kennen, nahe Semeschitz beim Schwimmen. Mit zwei Erfahrungen:<br />
Ihre Wassertemperatur war eine bedeutend „frischere“ als die unserer Dorfweiher<br />
Erinnern an die Radbusa<br />
Josef Bernklau<br />
A Auto!<br />
Anna Kangler<br />
Rache!<br />
Wenn der Wenzalbauer an einem Wirtshaus vorbeiging, verspürte er jedes mal<br />
einen großen Durst. Dann meinte er, dass ihm das Wirtshaus zurief. „Komm herein,<br />
kauf dir ein Glaserl und lösch damit deinen Durst!“ Nicht jedes Mal, aber<br />
öfter gab er dieser Versuchung nach. Am liebsten kehrte er beim Hable, dem Wirt<br />
in Pritschen, ein. Wenn er kein Geld dabei hatte, ließ er die Zeche anschreiben,<br />
aber immer wieder bezahlte er seine Schulden bald. Einmal aber wuchsen seine<br />
Zechschulden in eine beachtliche Höhe, so dass der Wirt, der ja auch seine Bierlieferung<br />
bezahlen musste, den säumigen Gast mahnte. Aber erfolglos. Der<br />
Wenzalbauer bezahlte nicht, sondern tischte nur unglaubliche Entschuldigungen<br />
auf. Da griff der Wirt zur Selbsthilfe. Als der säumige Zecher wieder bei ihm<br />
einkehrte, weigerte sich ihm ein Bier auszuschenken. Der Wenzalbauer musste<br />
seinen Durst nach Hause tragen. Aber das ärgerte ihn sehr und er sann auf Rache.<br />
Von seinem Feld aus beobachtete er, wie der Wirt auf seinem Krautfeld Pflanzen<br />
setzte. Da fiel ihm etwas Passendes ein. In der folgenden Vollmondnacht schlich<br />
er sich auf das Krautfeld des Wirtes, zog behutsam Pflänzlein um Pflänzlein aus<br />
der Erde, zwickte mit einer Schere den dünnen Stiel vorsichtig ein und setzte es<br />
wieder ein. Am nächsten Tag beobachtete er, wie der Wirt nach seinen Pflanzen<br />
schaute. Da sie wie welk auf der Erde lagen, goss er sie sorgfältig. Die Schadenfreude<br />
des Wenzalbauern wuchs. Um aber das Maß voll zu machen, kehrte er<br />
wieder beim Pritschner Wirt ein und brachte die Rede auf die Krautpflanzen.<br />
Dann sagte er verschmitzt und ein wenig beiläufig: „Die hatten denselben Durst<br />
wie ich, als du mir das Bier verweigert hast. Hättest du mir das Bier nicht verweigert,<br />
wären deine Pflanzen nicht verdurstet.“<br />
steh!“ Vergessen waren Stillarbeit und „Zeigestab“, wir sprangen auf und liefen<br />
zu den Fenstern, hatten die meisten von uns ja noch kein Auto gesehen. Unser<br />
Pfarrer, der am Dienstag und Freitag Nachmittag zu je zwei Religionsstunden<br />
von Andreasberg in unsere Schule kam, fuhr mit Kutsche oder Schlitten, zwei<br />
flinke Pferde als Gespann. Unser Doktor, der selten zwar, aber doch ab und zu<br />
gebraucht wurde, kam aus Ogfolderhaid ebenso mit Ross und Wagen. Wir hatten<br />
einen Lohnführmann, den „Weber Blosl“, der bei Bedarf nach Krummau fuhr<br />
und Waren für die Geschäfte holte. Der Tischmüllner lieferte das Mehl mit zwei<br />
kräftigen Zugpferden an. Also war ein Auto für uns ein sehenswertes, interessantes<br />
Fahrzeug. Unser Lehrer warf auch einen Blick zum Fenster hinaus und wurde<br />
sichtlich nervös. „Der Herr Schulinspektor!“ rief er, „setzt euch alle schnell auf<br />
euere Plätze!“ Dabei klopfte er mit dem Stock kräftig auf das Pult. Aber wir<br />
überhörten diesmal den Befehl, aufgeregt liefen wir von einem Fenster zum anderen,<br />
schubsten uns und drängelten, um besser sehen zu können. Dabei gab es<br />
natürlich Geschrei und Gelächter. In dem Tumult überhörten wir auch den Eintritt<br />
des hohen Herrn in unsere Schulstube und waren überrascht, als uns plötzlich<br />
eine tiefe, fremde Stimme zur Ordnung rief. Dieser Schulrat, wie sein Amt<br />
heute bezeichnet wird, hatte ein Herz für Kinder. Er fragte: „Wer von euch hat<br />
noch kein Auto gesehen?“ Da schossen die Hände nur so empor. „Gut“, sprach<br />
er, „dann wollen wir das Auto genau ansehen. Stellt euch in Reihe auf und folgt<br />
mir hinaus!“<br />
So standen wir um das Vehikel und er erklärte uns die Funktionen. Das interessierte<br />
hauptsächlich die Buben, sie drängten sich vor. Ich, kleines Mädchen, stand<br />
im Hintergrund und sah eigentlich nur einen viereckigen schwarzen Kasten, so<br />
beobachtete ich lieber die Krähen, die dem nahen „Peterfoldini Hölzl“ zuflogen<br />
und mit lautem Gekrächze auf einen kahlen Baum aufsaßen.<br />
An den Unterricht nachher habe ich keine Erinnerung, wir durften aber anschließend<br />
das Auto zeichnen, weil der Herr Schulinspektor mit unserem Lehrer etwas<br />
zu bereden hatte.
92<br />
93<br />
in Nemlowitz, Magolzen oder im Wassertrompetener „Teinzer“ Weiher. Und<br />
besonders welchen Unterschied Schwimmen mit der Strömung oder gegen sie<br />
beinhaltete! Unter Schulleiter Dr. Heinrich Voith erschwamm auch ich mir dann<br />
in der Radbusa in Bischofteinitz den Freischwimmerschein.<br />
Eine „intensivere“, wenn auch nur theoretische „Bekanntschaft/ Beschäftigung“<br />
mit der Radbusa kam am Anfang der Sechziger Jahre an der Fulda auf mich zu. In<br />
der Egerländer Trachtengruppe Melsungen übte Gruppenleiter Lehrer Johann<br />
Willinger „Das Lied von der Eger“ von Robert Lindenbaum mit uns ein. Dasselbe<br />
war zum Ausklang des Egerlandtages am 18. Juli 1955 an der Egerquelle uraufgeführt<br />
worden. Die Inspiration war da. Obwohl unsere Radbusa mit der 256<br />
km langen, bei Leitmeritz in die Elbe mündenden Eger keinen Vergleich aufzuweisen<br />
hat, schrieb ich „Das Lied der Radbusa“. Der „Liebscher von 1913“, der<br />
Seite 15 unter „Gewässer Flüsse und Bäche“ mit einem Sternchen auf das Werk<br />
„Die Radbusa und ihre Nebenläufe“ von Ottokar Schubert hinweist, wurde herangezogen:<br />
27 Mühlen und Schleifen setzte die Radbusa demnach in Bewegung,<br />
27 Zuflüsse scheinen auf. Im Bezirk Bischofteinitz ist sie 50 km lang, ihr größter<br />
Nebenfluss ist die Piwonka mit 22,5 km. Landkarten, Ortsbeschreibungen der<br />
Anliegerorte galt es auszuwerten. Weil in dieser Zeit gerade mit Hochdruck am<br />
Bischofteinitzer Heimatkreisbuch gearbeitet wurde, flossen mir wertvolle Bauelemente<br />
zu...<br />
Die Radbusa im Gemeinschaftswerk<br />
1967 erschien das Gemeinschaftswerk „Unser Heimatkreis Bischofteinitz“ (Leitung<br />
des Arbeitsausschusses und Gesamtgestaltung des Buches Franz Liebl). Hierin<br />
hat Ludwig Schötterl, Schriftleiter und Herausgeber der Bischofteinitzer Zeitung<br />
bis 1945, die Radbusa - Beschreibung auf den Seiten 18-29 vorgenommen. Gleich<br />
danach wurde auf den Seiten 30-33 mein „Lied der Radbusa“ in der Zweitfassung<br />
eingeblendet.<br />
Professor Ernst Schwarz nennt Radbud<br />
In seinem Werk „Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle“, 1960<br />
im Verlag Robert Lerche, München, erschienen, heißt es Seite 98: „Flussnamen,<br />
die das Wasser als Besitzer einer Person benennen, sind zwar nicht besonders<br />
häufig, kommen aber schon in alter Zeit vor... In die Steine fließt der Bach<br />
Dobrohost’, 1255 sub Dobrohoste fluvio (RB II 34), z. PN Dobrohost. In diese<br />
Gruppe gehört auch die Radbusa, tsch. Radbuza, Quellfluss der Beraun, 1386<br />
flumen Razbuza (Sedlacek, Snuska, S. 101), z. PN Radbud 410). M. Vasmer, Zs.<br />
f. slav. Phil. 2 (1925), S. -527.“<br />
Pilsner Archivar fand 1260 Radbud<br />
Demnach war dieser Radbud ein Grundherr im Jahre 1260 „dem der Wald im<br />
Quellgebiet eines Bächleins beim Dorf Waier gehörte.“ Der Name des Archivars<br />
„dieser Quelle“ kann hier nicht genannt werden, weil er im Artikel „Die - Radbusa<br />
- ein Fluss in Westböhmen“ nicht steht. (Bischofteinitzer Oberschul-Rundbrief,<br />
Folge 212, August 2005).<br />
Die Radbusa bei Zdenek Jiskra<br />
Ob auf Zdenek Jiskra (Prag) getippt werden kann? Der hat 1997 „Die Miesa“ (I.<br />
Teil, 238 S.) beschrieben und die Radbusalänge mit 111,5 km angegeben, während<br />
die auf den Pilsner Archivar verweisende Quelle 115 km angibt. Z. Jiskra<br />
führt auf den Seiten 256/257 eine Vielzahl von Radbud- und Radbusanamen auf...<br />
„Vor der Deutung des HN bleibt es nur zu sagen, dass die Belege eine Unsicherheit<br />
beweisen, was darauf zeigt, dass der Name für die Tschechen sowie für die<br />
Deutschen undurchsichtlich und sicher auch unverständlich war... Trotzdem kann<br />
man da einen Einspruch erheben: weil ein c. PN Radbud nicht existiert hat, bleibt<br />
das noch die Möglichkeit, mit dem germ. PN Radbod als dem Namensgeber hier<br />
zu rechnen und zwar, dass es noch während der Zeit des germ. Altvolks zu der<br />
Bildung des HN aus dem germ. oder ahd. gekommen ist: *Radbod/s-ahwa,<br />
Radbods-a - Radbusa = d. „Fluss des Radbod“. Als ein undurchsichtlicher Wassername<br />
wurde das HN vom tschechischen. Neuvolk übernommen und aus den Belegen<br />
kann man auf die Bestrebungen zeigen, diesen Namen mit Brzvoda usw. zu<br />
ersetzen. Die deutsche Kolonisation entlang des Flusses verstand zwar den Namen<br />
auch nicht, jedoch hat sie endlich die Konservierung der Endung -a durchgesetzt.<br />
Der andere tschechische. Name des Flusses war Brzvoda, was dem deutschen<br />
Baldwasser entspricht.“<br />
(Abkürzungen: HN = Hydronom, PN = Personenname, c. = tschechisch, d. =<br />
deutsch, germ. = germanisch ahd. = althochdeutsch.<br />
Inwieweit ein 2. Teil der Miesa-Beschreibung sowie einer Radbusa-Beschreibung<br />
von Zdenek Jiskra erfolgt ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Ob er noch Na<br />
kopecku 7, CZ- 1800 Praha 8, wohnt, ebenfalls. Eventuell sind im Internet zweckdienliche<br />
Auskünfte herunter zu laden.)<br />
Überschwemmungen<br />
Starke Wolkenbrüche verursachten 1838, 1890 und 1901 (sicher auch schon davor<br />
und auch noch danach) im Radbusalauf und Zulauf große Überschwemmungen<br />
und große Verluste. Beispielsweise führte der Potok-Bach 1901 drei Meter hohe<br />
Wassermassen zu Tal, welche vor allem die große Vorstadt zu Bischofteinitz heimsuchten.
94<br />
95<br />
Josef Fruth: „Katzenwäsche“, (Pinselzeichnung, Tusche).<br />
„Eichkätzchen“ (Kohle).<br />
„Reiher im Anflug“ (Kohle).<br />
„Hundestudie“ (Bleistiftzeichnung).
96<br />
97<br />
Josef Fruth: „Rosshandel“ (Pinselzeichnung, Tusche) Josef Fruth: „Pflüger“ (Pinselzeichnung, Tusche)
98<br />
99<br />
Josef Fruth: „Säumer“ (Pinselzeichnung, Tusche)<br />
„Auf der Weide“ (Ziegenstudie, Kohlezeichnung)<br />
„Bei den Tieren“ (Studie im Stall, Bleistiftzeichnung)
100<br />
101<br />
Josef Fruth: „Im Hühnerstall“ (Kohlezeichnung) Josef Fruth: Das tapfere Schneiderlein“ (Hinterglasbild)
102<br />
103<br />
Josef Fruth Josef Fruth: „Sankt Franziskus“ (Hinterglasbild)<br />
Trugst das Opfer<br />
in Christi Wundmahlen,<br />
trugst die Liebe<br />
im glühenden Herzen,<br />
der Sonne verschwistert,<br />
Gott entgegen<br />
Bruder Franziskus<br />
Bruder der Wildnis<br />
mit Vogel und Baum,<br />
mit Gras und Blume,<br />
mit Wasser und Wolke,<br />
verloren sich selbst<br />
im Schatten der Höhle.<br />
Gabst im Geschöpf<br />
dem Schöpfer die Ehre,<br />
Bruder den Menschen,<br />
Bruder dem Tier.<br />
Feind dem Blendwerk<br />
im gleißenden Gold,<br />
im Trug der Sinne,<br />
Künder der Armut.<br />
Sankt Franziskus
104<br />
105<br />
Dann war es soweit. Der kärgliche Rest einer einst stattlichen Gemeinde erhielt<br />
den Bescheid, sich mit dem bisschen Nötigsten, das mitzunehmen gestattet war,<br />
bereit zu halten. Noch einmal überprüften die Ratlosen jedes Stück und stellten<br />
immer wieder Liebgewordenes zu Gunsten des Lebenswichtigen zurück. Was an<br />
Wertvollem nicht schon längst zwangsweise abgeliefert oder widerrechtlich abgenommen<br />
war, vergruben sie, wie es in unguten Zeiten schon immer geschehen<br />
war, an einer leicht merkbaren Stelle, in der Hoffnung, zu besserer Stunde den<br />
Schatz wieder heben zu können.<br />
Ein letztes Mal riefen die Glocken - es läuteten alle drei wie an einem Festtage<br />
zum Gottesdienst, und keiner des kläglichen Restes blieb fern. Sie nahten sich im<br />
Sonntagsstaat, Mütter führten die Kleinen an der Hand, und eine, die vor Wochen<br />
erst geboren hatte, trug das schneeweiß gebüschelte Knäblein herbei. Niemand<br />
mehr war des Spielens kundig, also dass die Orgel an diesem Tage feierlichen<br />
Leides stumm bleiben musste. ( ... )<br />
Die Gräber auf dem Kirchhofe waren geschmückt wie zu den Seelentagen. Der<br />
Pfarrer nahm die vorrätigen Hostien an sich, als Messbrot von daheim; streichelte<br />
die gläserne Glocke, die einst im Dachreiter einer hölzernen Kapelle geklungen<br />
hatte und nun zur Erinnerung an die frühe Glasmacherzeit in der Sakristei aufbewahrt<br />
war. Noch einmal durchstreiften seine Blicke den Kirchenraum; bald auch<br />
würde dieses Gotteshaus verfallen wie vor Jahrzehnten die Glashütten, die<br />
rundumher einst geraucht hatten. Vorsorglich schloss er mit eigener Hand alles<br />
ab: Tabernakel und Schränke, Törlein und Tor. Die Schlüssel übergab er zwei<br />
Männern in Uniform, die das heilige Opfer und die letzten Handlungen des Priesters<br />
argwöhnisch belauert hatten. Bald darauf trafen zwei Lastwagen ein, um den<br />
Rest der Einwohner in das Vertreibungslager an der Grenze zu schaffen. Über<br />
den Dächern verkräuselte zum letzten Male der Herdrauch.<br />
Aus: Sepp Skalitzky „Domenkrone der Heimat“, Buxheim im Allgäu, 1961<br />
Nun lächelt Heimat, und Erinnerungen<br />
umkreisen mich als scheue Wahngestalten.<br />
Ein Hase kommt durchs Niemandsland gesprungen,<br />
Ich kann nur schmerzlich-hart die Hände falten.<br />
Ein schussbewehrter Turm und Stachelzäune<br />
bewachen einen nackten Todesstreifen.<br />
Schau! Dort drüben ragt noch unsre alte Scheune;<br />
ob dort noch immer Kaiserbirnen reifen?<br />
Schon wipfelt Wald, wo einstens Korn gewachsen<br />
und Einödhöfe geistern als Ruinen.<br />
0, knarrten wenigstens noch Wagenachsen<br />
auf Wegen, die nun Gras und Disteln dienen.<br />
Ist das noch Heimat, wo die Glocken sterben,<br />
vertraute Gräber trauern unter Nesseln,<br />
wo liebe Dörfer unbeweint verderben<br />
und viele Tode letztes Leben fesseln?<br />
Abschied für immer<br />
Über die Grenze<br />
Sepp Skalitzky<br />
SeppSkalitzky
106<br />
107<br />
Von den politischen Wirren in den Jahren 1937 und 1938 bekamen wir Kinder -<br />
ich war damals 12 Jahre alt - nicht sehr viel mit, doch überall wurde gemunkelt<br />
und getuschelt „es gibt Krieg“, Krieg zwischen den Tschechen und dem Deutschen<br />
Reich. Doch durch das Münchner Abkommen wurde dieser erst einmal<br />
abgewendet. Dennoch erfolgte im Frühjahr 1938 der Einmarsch der deutschen<br />
Truppen in das Sudetenland, doch „Gott sei Dank“ ohne Blutvergießen. Im Herbst<br />
1938 wurde dann plötzlich in Langendorf auf den Schlosswiesen ein Arbeitsdienstlager<br />
für den weiblichen Reichsarbeitsdienst erstellt. Alle Mädchen (“Arbeitsmaiden”)<br />
wurden bei den Bauern, in der Industrie sowie in der Krankenpflege in<br />
Langendorf und der ganzen Umgebung zur Arbeit eingesetzt, natürlich unter<br />
strengster Bewachung. Ausgang gab es nur an den Sonntagen und dann nur in<br />
Begleitung. Aber die jungen Burschen versuchten trotzdem mit den Mädchen ins<br />
Gespräch zu kommen um sich bekannt zu machen. Manch einer musste aber<br />
feststellen, dass dies nicht so einfach war, denn die Lagerführerin hatte eine abschreckende<br />
Waffe. Sie hatte ein Luftgewehr, mit dem sie auf die Lager-Eindringlinge<br />
mit Sauborsten schoss. Die Borsten konnten nur mit großen Schmerzen<br />
entfernt werden. Dieses Arbeitsdienstlager wird so manchem noch in „guter“<br />
Erinnerung bleiben. Es wurde vor dem Einmarsch der amerikanischen Truppen<br />
bei Kriegsende im Frühjahr 1945 aufgelöst.<br />
In dieser Zeit wurde die Verwaltung im Rathaus unseres Ortes von tschechischen<br />
Kommissaren besetzt. Es wurde bekannt gegeben, dass alle Deutschen vertrieben<br />
werden sollten. Familien aus der Slowakei, Rumänien und div. anderen Ländern<br />
kamen zu uns. Jede dieser Familien konnte sich ein Haus oder einen Hof oder<br />
eine Gastwirtschaft aussuchen und in ihren Besitz nehmen. Die bisherigen deutschen<br />
Bewohner mussten dann bis zur Vertreibung in einem kleinen Stüberl oder<br />
im Ausgedinghaus oder zum Teil auch in ihren eigenen Ställen wohnen. Das ehemalige<br />
Arbeitsdienstlager auf den Schlosswiesen wurde nun als Auffanglager für<br />
die auszusiedelnden Deutschen genutzt.<br />
Man holte nach und nach verschiedene Familien aus Langendorf und aus den<br />
Ortschaften der ganzen Umgebung in dieses Lager, um sie nach Deutschland zu<br />
transferieren. Manche Familien wurden mit den eigenen Fuhrwerken von den<br />
neuen Besitzern ihrer Höfe ins Lager gefahren. Man kann sich vorstellen, wie<br />
vielen Menschen das Herz blutete, wenn man mit den eigenen Fuhrwerken ins<br />
Lager zum Abtransport ins Ungewisse gebracht wurde und alles zurück lassen<br />
musste. Der erste Transport war Ostern 1946. Man brachte die Leute von Langendorf<br />
zum Bahnhof nach Schüttenhofen, wo sie in Viehwaggons verladen und<br />
über die deutsche Grenze abgeschoben wurden. Bis zu 30 Personen mussten sich<br />
diesen Waggon teilen.Von nun an wurde das Lager nicht mehr leer, es war ein<br />
Kommen und ein Gehen. Jede Woche wurden mehrere Transporte zusammengestellt<br />
und weiterbefördert. Die meisten Transporte wurden auf Umwegen nach<br />
Furth im Wald geschickt. Pro Person durften nur 50 kg Gepäck mitgenommen<br />
werden. Natürlich wurden nur die wichtigsten Gegenstände mitgenommen. Die<br />
Pakete, Koffer oder auch schnell zusammengenähte Säcke für Federbetten wurden<br />
im Lagerhaus bei der Fa. Schell bis zum Transport aufbewahrt. Bei der Ankunft<br />
in Deutschland musste aber mancher mit großer Enttäuschung feststellen,<br />
dass von seinen 50 kg Habseligkeiten nicht mehr viel übrig war, die wertvollsten<br />
Sachen waren gestohlen oder einfach verschwunden. Eine bekannte Frau aus<br />
Langendorf hatte bei der Ankunft im „Deutschen Reich“ nicht einmal mehr ein<br />
„Kaffeeheferl“, man hatte ihr fast alles gestohlen.<br />
Vom Lager Furth im Wald wurden die Transporte dann in verschiedene Bundesländer<br />
weitergeleitet. Einige kamen nach Hessen, andere nach Bayern und wieder<br />
andere nach Württemberg in Auffanglager. Unser Transport kam mit ca. 20 Familien<br />
nach Ulm in die Kienlesbergkaserne, dies war ein Vertriebenen- und<br />
Heimkehrerlager. Hier ging es sehr turbulent zu, jeden Tag kamen Heimkehrer<br />
aus russischer Kriegsgefangenschaft. Viele zerrissene Familien haben sich hier<br />
wieder gefunden, so auch eine bekannte Frau, die ihren Ehemann in Ulm als<br />
Heimkehrer wieder in die Arme schließen konnte. Die Heimatvertriebenen waren<br />
in Holzbaracken untergebracht. Sieben Familien teilten sich eine Baracke.<br />
Nach ca. zwei Monaten wurden die einzelnen Familien dann in verschiedene<br />
Ortschaften verteilt. Die Stadt Ulm war nach Kriegsende zu 90% zerstört, fast<br />
Die Jungen Burschen im Vordergrund, die Arbeitsdienstmädchen nahen auf der<br />
Brücke. (Bildgabe Willi Jung)<br />
Meine Erinnerung an die Vertreibung<br />
Willi Jung
108<br />
109<br />
alles in Schutt und Asche. Man kann sich vorstellen, das wir Vertriebenen nicht<br />
immer willkommen waren und nicht überall mit offenen Armen aufgenommen<br />
wurden, was auch verständlich war. Denn im ganzen Deutschen Reich war ja<br />
alles zerstört und die Not war sehr groß. Aber mit der Zeit wurde es langsam<br />
besser. Ich hatte sehr viel Glück im Unglück und habe bald, zusammen mit meinem<br />
Freund in Ulm bei einem Dachdeckerinnungsmeister Arbeit gefunden. Es<br />
gab ja wieder viel aufzubauen nach diesem unsinnigen Krieg. Meine Familie und<br />
ich kamen nach Oberkirchberg zu einem Bauern in ein Ausgedinghaus, in dem<br />
vier ledige Schwestern wohnten. Der Empfang war nicht gerade freundlich. Uns<br />
wurden zwei kleine Zimmer zugeteilt, ohne Wasser und Kochgelegenheit. Nach<br />
zwei Wochen konnte ich mir dann aber vom ersten Lohn einen gebrauchten Herd<br />
kaufen und somit hatten wir endlich wieder die Möglichkeit, uns etwas Warmes<br />
zu kochen. Der Bauer hatte ein großes Herz und Mitleid mit uns. Er brachte uns<br />
gleich einen kleinen Sack mit einigen Kilo Weizen und sagte: „Gehen sie zur<br />
benachbarten Mühle und tauschen sie den Weizen in Mehl um, damit ihr für den<br />
Anfang etwas zu essen habt“. Ich entgegnete ihm damals: „Ich kann das ja nicht<br />
bezahlen“. Er gab zur Antwort: „Sie können es ja gelegentlich wieder gut machen.“<br />
Was ich später auch getan habe. Mein Freund und ich haben ihm damals<br />
dann das Dach vom Viehstall instand gesetzt. Ich hatte auch weiterhin ein sehr<br />
gutes Verhältnis mit den Bauersleuten. Ob es beim Heumachen war, im Holz oder<br />
auf dem Hof, ich war immer bereit ihm zu helfen, wenn Not am Mann war. Meine<br />
Eltern und meine beiden Schwestern hatten weniger Glück. Sie kamen ein paar<br />
Tage später nach Furth im Wald und wurden dann zwei Jahre durch verschiedene<br />
Lager geschleust bis sie endlich auch nach Ulm kamen, wo wir uns wieder gefunden<br />
haben.<br />
Die meisten haben es mit viel Fleiß und Arbeit wieder zu etwas gebracht, haben<br />
sich ein Haus gebaut, einige haben sich auch wieder ein eigenes Geschäft aufgebaut.<br />
Die Kinder, die hier geboren sind, sind hier zu Hause und hier ist auch ihre<br />
Heimat. Aber es gibt auch wieder viele Kinder und Enkelkinder, die Interesse an<br />
der Heimat ihrer Großeltern haben, mit ihnen dort hin fahren, um zu sehen, wo<br />
ihre Vorfahren herkommen. So wird unsere alte Heimat hoffentlich nicht in Vergessenheit<br />
geraten. Man kann ja nun ohne Schwierigkeiten die deutsch-tschechische<br />
Grenze passieren. Vom damaligen Arbeitsdienstlager in Langendorf ist nicht<br />
mehr viel übrig geblieben. Es steht noch eine Baracke dort, alles andere ist verschwunden.<br />
Am 2. Mai 1945 überschritten Soldaten der US Infanterie-Kampfgruppe der 3.<br />
Armee die Grenze zur CSR. Sie waren von Aigen über Haag die Kanalstraße<br />
nach Sonnenwald und Glöckelberg gekommen und ein Teil ist den Kanal entlang<br />
nach Neuofen weiter gezogen. Der zweite Teil fuhr über Hinterstift nach Vorderstift<br />
bis an die Moldaubrücke. Das ganze Gebiet zwischen Hochficht und Moldau<br />
wurde besetzt. Auf der anderen Seite der Moldau stand noch eine kleine Schar<br />
deutscher Offiziere mit ihren Soldaten im Parkfrieder-Berg verschanzt und wollte<br />
die Stellung halten. Oberplan sollte verteidigt werden. Die Moldaubrücke in<br />
Vorderstift war schon zur Sprengung vorbereitet. Weil die Männer des „Deutschen<br />
Volkssturms“ gefällte Bäume als Panzersperren zwischen Lichtenberg –<br />
Schöneben - Glöckelberg errichtet hatten, konnten erst zwei Tage später US-Panzer<br />
die Höhen über den Hochficht überqueren und nach Oberplan vordringen. Es<br />
war das 778. US-Panzer-Bataillon der 26. Infanterie-Division der US-Army. Der<br />
Bürgermeister von Oberplan (Ladek) schickte eine Parlamentärsgruppe mit einer<br />
Dolmetscherin (wohnhaft in der landwirtschaftl. Fachschule) mit weißer Fahne<br />
entgegen und bat um kampflose Übergabe. Die Oberplaner Bevölkerung wartete<br />
voll Angst in ihren Häusern ab. Rundfunknachrichten gab es nicht mehr, da die<br />
Apparate abgegeben werden mussten. Das Postamt musste besetzt gehalten werden<br />
um telegrafische Anweisungen aus Krummau entgegennehmen zu können.<br />
Die Schulen waren geschlossen. In Oberplan befanden sich Flüchtlinge aus dem<br />
Banat, aus Wien und aus Neuss a. Rhein. Die Amerikaner kamen in ihren Jeeps,<br />
die Bahnhofstraße herauf gefahren, drangen in jedes Haus ein und verlangten die<br />
Herausgabe aller Waffen oder versteckter Soldaten. Viele Häuser mussten geräumt<br />
werden und so manche Familie wurde evakuiert um dem Quartier für die<br />
Amis Platz zu machen. Ein kleines Flugzeug versorgte die Besatzer über den<br />
Hochficht mit Munition und Verpflegung. Es herrschte schlechtes Wetter am 5.<br />
Mai, als das Kriegsende und die Kapitulation bekannt gemacht wurde. Die Amerikaner<br />
verhielten sich sehr korrekt. Aus ihrer Küche, die sich in der Puit befand,<br />
bekam so mancher Deutsche etwas zu Essen oder konnte gegen Waschen und<br />
Bügeln von Uniformen Seife oder Zigaretten eintauschen. Den Kindern schenkten<br />
die Soldaten Schokolade. Mein Vater hat einen Teil seiner Briefmarkensammlung<br />
gegen Kaffee eingetauscht, den wir wieder für Brennholz hergeben<br />
mussten. Die Versorgung war ja zusammengebrochen. Alle abgegebenen Waffen<br />
wurden am Prix-Anton-Haus-Eck zerschlagen. Viele machten sich Sorgen um<br />
die Väter und Söhne von denen man schon länger kein Lebenszeichen erhalten<br />
hatte und die vielleicht in Gefangenschaft geraten waren. Würden sie bald<br />
Das Ende des Krieges, die Besatzung und die<br />
Vertreibung in Oberplan<br />
Maria Konstanzer
110<br />
111<br />
heimkommen? Unterhalb des neuen Forsthauses war ein Gefangenenlager für<br />
deutsche Soldaten eingerichtet worden, wo wir ihnen Brot brachten. Die im Kriege<br />
hier beschäftigten Fremdarbeiter durften durch die UNRA nach Hause. Im<br />
Schutz und in der Geborgenheit der amerikanischen Besatzung erfuhren wir nichts<br />
von den nun einsetzenden Gräueltaten des tschechischen Mobs an den<br />
Sudetendeutschen in Nordböhmen. Am 5. August räumten die US-Truppen das<br />
nun wiedererstandene Territorium der CSR und nur noch eine Verwaltungseinheit<br />
verblieb bis 1. September. Dann wurde die Zivilverwaltung an einen tschechischen<br />
Kommissar Übergeben. Ein Trupp russischen Soldaten zog von Honetschlag<br />
kommend mit Pferden durch den Ort Oberplan und blieben drei Tage in<br />
den von den Amerikanern verlassenen Quartieren (z. B. b. Soafensieder Nr. 57).<br />
Den Laden von Uhrmacher Tanzer durchsuchten sie nach Taschenuhren, auch<br />
musste er viele für sie reparieren. Im Rathaus herrschte das Gemeindekommissariat<br />
und hieß nun Narodni Vybor. Viele ehemalige Sozialdemokraten, die unter Hitler<br />
zu leiden hatten, denunzierten die Nazis. Es gab wenig Toleranz. In Oberplan<br />
wurde ein Arbeitsamt eingerichtet, wo alle arbeitsfähigen jungen Leute registriert<br />
(..je zamestnani) und zu den tschechischen Bauern oder Fabriken in Arbeit<br />
geschickt wurden. Fleisch gab es nicht zu kaufen. Nur für Knochen mussten wir<br />
uns anstellen. Wir mussten weiße Armbinden tragen und durften uns nur im<br />
Umkreis von 20 km frei bewegen. Das schloss jede Bahnfahrt aus. Es gab nur<br />
einen Arzt für Oberplan und Umgebung. (Dr. Friedrich) Während jedes Verbrechen,<br />
das Deutsche begingen, von der Feindpresse in der ganzen Welt bekannt<br />
gemacht wurde, nahm die Weltöffentlichkeit nicht zur Kenntnis, was jetzt geschah.<br />
Durch lügenhafte Vorspiegelungen gelang es Benesch die Zustimmung<br />
von Stalin, Roosevelt und Churchill zu seinem schon lange geplanten Vorhaben<br />
der Austreibung der Sudetendeutschen zu erhalten. Die Vertreibung der Menschen<br />
aus der Gemeinde Operplan erfolgte im Laufe des Jahres 1946 in mehreren<br />
Etappen. Zunächst mussten alle Wertgegenstände wie Silber, Schmuck, Musikinstrumente<br />
und Photoapparate abgegeben werden. Dann erfolgte die Aufforderung<br />
zur Abgabe von Nähmaschinen und andere ausgewählte Gegenstände.<br />
Hausdurchsuchungen lagen an der Tagesordnung. Sie scheuten nicht vor Krankenzimmern<br />
zurück und holten Möbel ab. (Meine Mutter starb am 2.4.46). Jeder<br />
musste ein Vermögensverzeichnis erstellen und die Geldverhältnisse offen legen.<br />
Es erfolgte ein schriftlicher Aufruf sich mit 50 kg Gepäck an einer bestimmten<br />
Sammelstelle einzufinden mit Angabe von Datum und Zeit. Die Vollzugsorgane<br />
der Tschechen kontrollierten die Ausweise, wogen ab, stöberten nach verborgenen<br />
Dingen und ließen ganze Gepäckstücke zur Seite stellen. Transportmittel ins<br />
Lager nach Krummau waren offene LKW. Das Wetter spielte keine Rolle. Der<br />
erste Transport war am 11.4.1946. Der Abschied von daheim war sehr schmerzlich<br />
und das Vorbeifahren am Friedhof oder an den Feldern und Wiesen kann in<br />
seiner Tragik nicht wiedergegeben werden. Keiner kannte das endgültige Ziel,<br />
niemand wusste, ob man sich wieder sehen würde. Wir blieben elf Tage in einem<br />
Barackenlager in Krummau, bis wir über Pilsen, Furth im Wald, Aichach (Ent-<br />
Schon im Juli 1945 mussten wir unsere Wohnung im Sparkassengebäude mit nur<br />
wenigen Habseligkeiten verlassen. Man nahm uns beim Hannesschläger im „Minigraben“<br />
auf. Um nicht wie viele andere Mädchen meines Alters zu tschechischen<br />
Bauern als Dienstmagd verschleppt zu werden, verdingte ich mich beim Metzger<br />
Prix (Lederer Ernstl) als Kindsmagd. Als die Familie ihren Besitz im Herbst verlassen<br />
musste, war ich bei einem jungen tschechischen Ehepaar, das den Konsum<br />
übernommen hatte, als Hausgehilfin tätig, alles nur gegen Essen. Am 12. April<br />
1946 mussten wir uns um 8 Uhr früh mit unseren paar Habseligkeiten am unteren<br />
Marktplatz einfinden. Im „Gasthaus Gassl“ war die Kontrollstelle, zu der wir,<br />
Fahrt ins Ungewisse<br />
Elfriede Holub<br />
lausung) nach Deutschland kamen, wo wir in die verschiedenen Reg. Bezirke<br />
aufgeteilt wurden. Wir waren 59 Personen nach Garmisch -Partenkirchen gekommen<br />
und nach Berufen in zwei Teile aufgeteilt. Ein Teil kam nach Farchant,<br />
einer nach Gapa. Endlich wurden wir in Privatquartiere eingewiesen unter Protest<br />
der einheimischen Bevölkerung. Wir waren völlig mittellos und ohne Hausrat.<br />
Unser Leiden war noch keinesfalls beendet. Man begegnete uns mit Misstrauen,<br />
wir waren überall unerwünscht und erst nach der allgemeinen Entnazifizierung<br />
und der im Juni 48 erfolgten Währungsreform und Aufhebung der Zwangswirtschaft<br />
konnten wir in unsere erlernten Berufe eingegliedert werden. Es stellte<br />
sich bald heraus, dass wir Heimatvertriebenen keine Last, sondern eine große<br />
Hilfe beim Wiederaufbau Deutschlands darstellten und ein großes wirtschaftliches<br />
Potential bedeuteten. Bald begannen wir unsere Verwandten zu suchen und<br />
schlossen uns mit den wieder gefundenen Landsleuten zu Vertriebenenverbänden<br />
wie Sudetendeutsche Landsmannschaft, <strong>Böhmerwaldbund</strong>, Ackermanngemeinde<br />
usw. zusammen und gründeten Heimatgemeinden. Alljährlich treffen wir uns zum<br />
Jakobitreffen auf dem Dreisesselberg. Die Gemeinde Ulrichsberg in Oberösterreich<br />
übernahm die Patenschaft für uns Oberplaner und wir dürfen dort eine Heimatstube<br />
zum Gedenken unseres Heimatdichters Adalbert Stifter unterhalten, die von<br />
einem Ausschuss unter Vorsitz von Frau Dolzer gegründet wurde. Auf dem Nockherberg<br />
treffen wir uns zum fröhlichen Beisammensein, im jährlichen Wechsel<br />
mit Ulrichsberg, wo es viel Gelegenheit zum Austausch von Erinnerungen gibt.<br />
Herr Rupert Essl verfasste für uns eine Chronik von Oberplan mit allen historischen<br />
Daten. Seit der Öffnung der Grenzen können wir wieder regelmäßig zur<br />
heilige Messe in der Wallfahrtskirche zum Gutwasserberg in Oberplan zusammenkommen<br />
und auch den Friedhof besuchen. Wir wünschen unserem Oberplan<br />
eine friedliche Zukunft in Europa.<br />
Aus meiner Sicht geschrieben, M. Konstanzer, geb. Mauritz, Oberplan Nr. 59
112<br />
113<br />
eine Familie nach der anderen, mit unserem Gepäck hereingeholt wurden; es war<br />
Personenkontrolle und das Gepäck wurde durchwühlt. Anschließend mussten wir<br />
wieder am Marktplatz warten. Welche Gedanken gingen uns da durch den Kopf.<br />
Es war nur ein Glück, dass es trocken war! Gegen Mittag kamen dann Lastautos,<br />
auf die wir unsere Habe laden mussten und wir stiegen dazu auch auf. Es waren<br />
ca. 10 bis 12 Personen mit Gepäck auf einem Lastauto. Dann fuhren wir auf dem<br />
offenen Laster über Honetschlag Richtung Krummau. Als wir durch die „Puid“<br />
(nördlicher Ortsteil von Oberplan) kamen, schauten wir mit Wehmut zurück, bis<br />
wir unser geliebtes Oberplan nicht mehr sahen. Es war ja ein Abschied für immer!<br />
In Krummau, im Lager in der Nähe des Bahnhofs angekommen, wies man uns in<br />
eine große Baracke ein, die vorher ein Pferdestall des Militärs war. An die Tage<br />
im Lager kann ich mich nicht viel erinnern, mir ist nur der „Donnerbalken“ (große<br />
offene Baracke zur Verrichtung der Notdurft) im Gedächtnis geblieben. Am<br />
18. April 1946 wurden wir dann in Güterwaggons verladen, und die Fahrt ins<br />
Ungewisse begann. Wir fuhren die Nacht durch, über Pilsen an die Grenze nach<br />
Furth im Walde und weiter nach Allach bei München, wo wir morgens ankamen.<br />
Hier mussten wir den Zug verlassen und wurden von den Amis registriert und<br />
„entlaust“. Gegen Abend wurden wir wieder in die Viehwaggons gesteckt und<br />
die Fahrt ging weiter. Es war eine Höllenfahrt, denn es waren lauter alte Waggons,<br />
da wurden wir tüchtig durcheinander geschüttelt. Wir hatten Endstation<br />
Garmisch. Kurz nach Mitternacht kamen wir am 20. April 1946 am Güterbahnhof<br />
in Garmisch an.<br />
Gegen 7 Uhr morgens kamen ein paar Herren vom Flüchtlingsamt und vom Arbeitsamt.<br />
Wir mussten die Waggons räumen. In der Bahnhofswirtschaft bekamen<br />
wir etwas zu essen. Dann wurden die Leute „verteilt“ in die nähere und weitere<br />
Umgebung. Wir blieben in Garmisch und wir wurden gleich vom Arbeitsamt in<br />
Arbeitsstellen eingewiesen. Dann begann das Warten! Die Leute, die nicht in<br />
Garmisch untergebracht wurden, sind im Laufe des Vormittags an Ort und Stelle<br />
gebracht worden. Die Herren vom Amt hatten ihre Arbeit getan und gingen fort.<br />
Wir standen nun da am Güterbahnhof und warteten auf die Zuweisung einer Bleibe,<br />
doch es tat sich nichts. Es ging schon auf 16 Uhr zu, da ging unser Vater<br />
hinauf ins Bahnhofsgebäude und bat den Beamten, die Polizei anzurufen und<br />
denen Bescheid zu sagen, dass wir seit dem frühen Morgen am Güterbahnhof<br />
stehen und auf die Einweisung in ein Quartier warten. Die Polizei setzte sich mit<br />
dem Flüchtlingsamt in Verbindung. Die Herren hatten uns ganz vergessen. Es<br />
kam dann einer und wies einige in den „Gasthof Lamm“ ein, und wir waren dann<br />
noch 15 Personen, die man notgedrungen in einen großen Saal im Skistadion<br />
einwies. Inzwischen war es 17 Uhr geworden. Nach einiger Zeit kam auch ein<br />
Mann mit einem kleinen Laster. Das erste, das er sagte war: „Ja, das kann ich aber<br />
nicht mehr schaffen, denn es beginnt ja bald die Auferstehung!“. Wir fragten nur:<br />
„Wollen Sie uns über die Osterfeiertage hier stehen lassen?“. Er brachte dann<br />
zuerst die Leute ins Lamm und kam dann noch mit einem zweiten Wagen. So<br />
kamen wir doch noch zu einem Dach über dem Kopf. In dem Saal standen nur<br />
amerikanische Feldbetten. Wir waren aber froh, dass wir die Beine ausstrecken<br />
konnten. Die Wirtsleute waren von uns „sehr begeistert“. Dafür bekamen wir<br />
auch am Ostersonntagmittag als Suppe das Kochwasser der Reiberknödel. So<br />
haben wir die Feiertage eben dort verbracht.<br />
Rosl und ich mussten am Dienstag unsere Arbeitsstelle antreten. Ich als Kindergärtnerin<br />
kam erst in einen Kindergarten, dann als Kindermädchen zu einem Arzt,<br />
dann in ein Kinderheim und zuletzt war ich wieder „Kinderfräulein“. 1950 heiratete<br />
ich den Winterberger Buchbinder Hans Holub und wir eröffneten in Lüdenscheid<br />
eine Kunsthandlung und Buchbinderei. Rosl kam in einem bekannten<br />
Modesalon (hier war auch für die Olympiade 1936 gearbeitet worden) als Schneiderin<br />
unter. Sie ging 1954 mit meinen Eltern nach Bad Reichenhall, wo sich eine<br />
ganze Kolonie Oberplaner Pensionisten zusammengefunden hatte. Dort heiratete<br />
sie den Bauleiter Hans Oberholzner. Die Eltern mussten gleich nach den Feiertagen<br />
zum Wohnungsamt, damit sie ein Zimmer zugewiesen bekamen. Sie hatten<br />
es dort auch ganz gut getroffen. Unsere böhmerwäldlierlisch-baierische Mundart<br />
hat uns die Herzen der Oberbayern relativ schnell geöffnet.<br />
Ein Ochsengespann in<br />
der Lichtenauer Straße<br />
im alten Wallern. Foto:<br />
Josef Seidel, Krummau<br />
(Sammlung Reinhold<br />
Fink)
114<br />
115<br />
Herma Faschingbauer<br />
Wenn ich daran denke! Ach wie schön war es daheim! Als Kind hatte ich ein<br />
Pony. Ich sollte es aber auch selbst versorgen. In der Schule hat sich dann keiner<br />
neben mich gesetzt, weil ich immer nach Stall gestunken habe. Dann hat es mein<br />
Vater verkauft und ich war lange böse auf ihn. Als ich erwachsen war, hatten wir<br />
zwei Pferde, den Max und den Moritz. Mit denen bin ich gerne gefahren. Wir<br />
hatten auch viele Wagen für Spazierfahrten: eine elegante Kutsche und ein<br />
„Steirerwagerl“ und im Sommer machten wir immer eine Landpartie auf einem<br />
geschmückten Leiterwagen. Im Winter machten wir öfters eine Schlittenpartie.<br />
Einmal nahmen wir eine Kurve zu scharf- plötzlich lagen wir alle im Schnee.<br />
Mein Vater weckte mich immer in der Früh um halb fünf Uhr. Dann stand ich auf<br />
und fütterte die zehn Kühe und molk sie. Dann kamen die Ochsen an die Reihe.<br />
Wir hatten immer einen Knecht und eine Magd. Im Krieg waren das polnische<br />
oder ukrainische Gefangene. Wir hatten fast in jeder Oberplaner Flur Wiesen und<br />
Felder, insgesamt etwa 25 ha. Wir hatten auch Wälder, einen Torfstich und eine<br />
Sandgrube. Die Sandgrube war eine richtige Goldgrube. Ich habe meine Arbeit<br />
als Bäuerin geliebt! 300 Jahre waren meine Vorfahren in Oberplan Bauern und<br />
Bürger, haben das Gemeindeleben mitgeprägt. Meine Großväter waren Färber,<br />
Tierärzte, Metzger aber eben immer auch Bauern. Mein Vater war in vielen Vereinen<br />
tätig. Wir durften zu Fronleichnam einen Altar aufstellen und meine Eltern<br />
bemühten sich immer sehr, den allerschönsten zu haben.<br />
Und dann war auf einmal alles anders! Es war am 23. Oktober 1945. Es wohnten<br />
noch drei Familien und zwei allein stehende Frauen in unserem Haus. An diesem<br />
23. Oktober kamen plötzlich drei Männer in unsere Wohnstube. Zwei hatten eine<br />
Uniform an und fuchtelten mit Gewehren herum. Einer war ein slowakischer<br />
Zigeuner. Er schrie meinen 71-jährigen Vater an: „Ich jetzt hier Herr! Du Dreck!<br />
In eine halbe Stunde musst Du weg!“ Das war um halb zwei Uhr.<br />
Meine Freundin Herma Faschingbauer, genannt „Färber Herma“ war mir immer<br />
wie eine große Schwester. Sie war in der ersten Klasse, die mein Vater in Oberplan<br />
führte und sehr begabt, Besonders gut konnte sie zeichnen und malen. Mein<br />
Vater und auch andere Lehrer meinten immer, sie müsse eigentlich studieren,<br />
doch dann kam 1938 der „Anschluss ans Reich“ und das „Erbhofgesetz“ und so<br />
war sie als einzige Tochter dazu bestimmt, den Bauernhof zu übernehmen. Sie<br />
besuchte also nach der Bürgerschule und einem freiwilligen 9. Schuljahr als erstes<br />
Mädchen die landwirtschaftliche Fachschule in Oberplan, wo sie als Beste<br />
ihres Jahrgangs abschloss. Ich lasse sie nun selbst erzählen:<br />
Verschleppt ins „Tschechische“ und – „abgeschoben“<br />
(Odsun)<br />
„So“, sagte mein Vater ganz gebrochen. „Da müssen mir halt gehen“. Wir hatten<br />
ja schon vorgepackt, denn wir waren ja nicht die ersten, die auf diese Weise gehen<br />
mussten. Eine Woche vorher hatte es Frau Woldrich mit ihren Kindern getroffen,<br />
die auch in unserem Haus Unterschlupf gefunden hatte und viele andere<br />
Beamtenfrauen, deren Männer nicht da waren. Während wir zusammenpackten,<br />
kamen Soldaten, zwangen mich, mitzugehen. Ich fragte: „Ja, wohin denn? Sie<br />
sehen doch meinen alten Vater, meine gehbehinderte Mutter und den Jungen hier.<br />
Die sind doch alleine nicht fähig, zu packen.“ (Wir hatten seit 1942 Werner, einen<br />
Berliner Jungen bei uns, der nach Ablauf der Erholung nicht zurückkehren konnte,<br />
weil seine Mutter mit weiteren sieben Kindern in Berlin ausgebombt worden<br />
ist. Er war 12 Jahre alt. Ich hatte Werner gleich, als die Tschechen kamen, den<br />
Auftrag gegeben, mit dem Rad zu Familie Kary nach Glöckelberg zu fahren und<br />
Thomas Kary, der das Milchauto fuhr und mit dem ich so gut wie verlobt war, zu<br />
bitten, er möge kommen und uns holen. Wäre ich doch nur selber gefahren!<br />
Meine Einwände halfen nichts, die Männer zwangen mich, mitzugehen. Ich durfte<br />
außer einem kleinen Köfferchen gerade noch mein Federbett mitnehmen, dann<br />
wurde ich zu einem Lastauto geschleppt und musste hinaufsteigen. Da kam ein<br />
anderer Tscheche, riss mir mein Federbett aus den Armen und schrie: „Du deutsches<br />
Schwein, du brauchst kein Bett!“ Dabei zog er eine Reitpeitsche aus dem<br />
Stiefel und schwang sie drohend. Auf dem Auto waren schon eine Menge Oberplaner<br />
junge Leute. Das Auto fuhr los - ich hatte mich von meinen Eltern gar<br />
nicht verabschieden können. Erst nach einer Woche erhielt ich einen Brief, dass<br />
sie in Glöckelberg wären, ein Zimmer mit einem Kachelofen und eine kleine<br />
Kammer hätten und die Betten, das Sofa und die Nähmaschine dank der<br />
Tschechischkenntnisse von Thomas mitgebracht hätten. Etwa halb vier Uhr fuhren<br />
wir ab. Es ging ins Landesinnere, etwa eine Stunde Fahrzeit. In dem kleinen<br />
Dörfchen Mric bei Krems wurden wir abgeladen. Da standen wir und kamen uns<br />
vor, wie auf einem Viehmarkt. Die tschechischen Bauern kamen und suchten sich<br />
die Leute aus, die sie meinten, brauchen zu können. Mich wählte ein etwa vierzigjähriger<br />
Bauer aus. Wir kamen bei seinem Haus an, einem typischen tschechischen<br />
eingeschossigen Bauernhaus. Der Tscheche hatte eine tschechische Dienstmagd,<br />
die Ruscho, und einen gefangenen Soldaten aus Wien, den Lorenz. Dieser<br />
war ganz ausgehungert und hatte auch keine Kraft. Als ich ankam rief die Ruscho:<br />
„Jezismario! Nemame Postele!“ (Jesusmaria! Wir haben kein Bett, wir haben<br />
keine Zudecke!). Soviel tschechisch verstand ich und dachte: „Na, sauber! Was<br />
wird da werden! Wo werde ich da schlafen?“ Da fragte ich den Bauern (der deutsch<br />
konnte, aber die Sprache grundsätzlich nicht verwendete): „Und wo werde ich<br />
dann schlafen?“ Es sagte: „Na, draußen im Stall!“ Ich hatte eine Angst, weil ja<br />
überall auch Russen waren. Da fragte ich den Lorenz: „Wo schläfst Du?“ Er<br />
zeigte auf einen Schuppen. Im Stall standen zwei Pferde, vier Kühe und etwas<br />
Kleinvieh. In der Ecke war ein holzverschaltes Abteil, darinnen war Stroh.<br />
Dahinein legte ich mich samt den Kleidern und weinte die ganze Nacht.- Über<br />
eine Woche schlief ich also dort im Stall. Mittlerweile hatte ich gemerkt, dass der<br />
Edeltraud Woldrich
116<br />
117<br />
Bauer deutsch konnte. Weil er mich gleich geduzt hatte, hielt ich es auch so. Ich<br />
sagte nach einer Woche zu ihm: „Ich merke, du kannst deutsch. Von nun an reden<br />
wir deutsch miteinander. Und jetzt sag ich dir etwas: Jetzt fährst du fort und<br />
stiehlst mir irgendwo ein Bett!“ Er protestierte: „Ich nix stehlen! Konfiszieren!“<br />
Ich sagte wütend: „Das ist alles eins! Das ist auch „kralowaten“ (=stehlen). Da<br />
schaute er erst ein wenig dumm, dann fuhr er mit seinem Fuhrwerk fort und<br />
brachte tatsächlich ein Bett daher. Ich hatte schon lange gemerkt, dass er von<br />
seinen Ausflügen immer mit neuen Sachen zurückkehrte: mit einem gummibereiften<br />
Leiterwagen z.B. an dem noch das Schild des deutschen Bauern hing,<br />
dem er einmal gehört hatte, oder mit einem schönen Pferd. Nun hatte ich also ein<br />
Bettgestell, einen Strohsack habe ich mir selbst gestopft. Jetzt hatte ich aber noch<br />
immer keine Zudecke. Mittlerweile erfuhr ich durch die Ruscho, dass Verwandte<br />
von uns („Schlosserfranzl“) in Chlum auf einem Meierhof arbeiteten. Am Sonntag<br />
darauf ging ich mit Ruscho nach Chlum. Ich musste eine weiße Binde tragen<br />
mit NP (Nemce-Prace = deutscher Arbeiter), aber die tschechischen Kinder riefen<br />
uns immer Nemce Praze (= deutsches Schwein) nach. In Begleitung von<br />
Ruscho hatte ich ein bisschen Schutz. Ich besuchte also meine Verwandten und<br />
die schenkten mit tatsächlich ein bezogenes Federbett und ein Kopfkissen. „Ein<br />
Leintuch brauche ich auch, ich habe gar nichts“, sagte ich. Da bekam ich auch<br />
noch ein Leintuch geschenkt. Aber wohin jetzt mit dem Bett? Neben der Küche<br />
war eine dunkle Kammer, dahinein konnte ich mein Bett stellen, da gab es Kakerlaken<br />
und solch Ungeziefer, die mir sogar manchmal über das Gesicht liefen. Ein<br />
ganz kleines Fenster, fast blind vor Schmutz ging auf den Backofen hinaus. Aber<br />
daneben in der Kammer schlief die Ruscho, und die hatte auch nicht viel mehr als<br />
ich. Ich schlug einige Nägel in die Wand und hängte die paar Kleidungsstücke,<br />
die ich noch hatte, daran. Das war mein Hab und Gut. Ich konnte mir weder die<br />
Wäsche waschen, weil es auch kein Wasser gab. Draußen im Hof war eine<br />
Wasserstelle, da konnten Lorenz und ich uns das Gesicht waschen. Das war unsere<br />
Morgentoilette. Aus - Feierabend! Um die Wäsche zu waschen, machte ich mir<br />
am Ofen Wasser warm, spannte einen Strick und hing sie darüber. Ich sagte zu<br />
Lorenz: „Pass auf, wenn du die Schweine raus lässt, dass sie mir nicht an die<br />
Wäsche gehen. Ich habe nur einmal zum Wechseln!“ Lorenz hatte immer noch<br />
seine Wehrmachtsuniform an. Ich sah nie, dass er etwas gewaschen hat, aber er<br />
hat auch von weitem „geduftet“.<br />
Der Bauer war nicht grob zu mir. Er hat mich auch nie „deutsches Schwein“<br />
genannt, wie es viele andere taten. Aber mit dem Essen, da hat er uns einiges<br />
zugemutet, dem Lorenz und mir. Seine Schwester, die „Pany Gottliebova“ (eigentlich<br />
hatte sein Schwager, Herr Gottlieb, ja durchaus keinen tschechischen<br />
Namen) kam alle vierzehn Tage und buk Brot und machte etwa dreißig Kartoffelknödel.<br />
So aßen Lorenz und ich täglich Kartoffelknödel und eingemachte Heidelbeeren.<br />
Die Knödel holten wir aus dem großen Topf und machten sie warm.<br />
Manchmal hatten sie schon Schimmel angesetzt, da wusch ich sie erst ab, bevor<br />
ich sie wärmte. Der Bauer und Ruscho aßen vor uns, sie aßen Fleisch und Kraut.<br />
Am Sonntag bekamen auch Lorenz und ich ein kleines Stück Fleisch und Kraut<br />
zu unseren Knödeln. Am Sonntag bekamen wir zusätzlich auch noch zwei Semmeln.<br />
Das Brot sperrte der Bauer die Woche über in einen Schrank. Auch die<br />
Ruscho bekam nicht mehr Brot als die eine Scheibe, die er jeden Morgen für uns<br />
abschnitt. Lorenz war so schwach, dass er es kaum schaffte, einen Korb Futter für<br />
die Pferde herunterzuholen. Ich musste ihn immer helfen. Der Bauer hatte auch<br />
einen Hund, der als gefährlich bekannt war. Aber ich redete mit ihm und konnte<br />
ihn sogar streicheln, er tat mir nichts. Da hatte ich immer den Hund an meiner<br />
Seite, weil ich mich vor den Russen, die sich überall herumtrieben, fürchtete.<br />
Rigo hieß der Hund und er war ein ganz schöner Kerl. Einmal brachte der Bauer<br />
von einem seiner „Konfiszierzügen“ Anzüge mit, die ihm viel zu groß waren. Er<br />
fragte mich, ob ich sie für ihn ändern könne. Ich sagte: „Ja schon, aber ich brauche<br />
eine Nähmaschine.“ „Hab ich nicht“, sagte er. Und ich entgegnete: „Weißt du<br />
was, da fährst du fort und klaust eine“. Natürlich protestierte er gegen dieses<br />
Ansinnen. „Nicht stehlen - konfiszieren!“ Und ich: „Jesto jedno!“ (Alles eins!)<br />
Eines Tages fragte er mich, woher ich genau wäre. Am Abend kam er und sagte:<br />
„Weißt du, wo ich heute war?“ „Interessiert mich nicht!“ entgegnete ich. Er aber<br />
fuhr fort: „Ich war in Horni Plana“. „So, in Oberplan warst du?“ fragte ich zurück.<br />
„Ja in Horni Plana. Ich schauen deine Haus. Schöne große Haus. Weißt du<br />
was? Wenn du mich heiraten, können wir nach Oberplan.“ Ich entgegnete: „Und<br />
wenn du mit dem Arsch in Gold sitzen würdest, würde ich dich nicht nehmen!“<br />
Ich war wütend. „Ich dir nichts nehmen!“ sagte er. Und ich: „Du nicht, aber deine<br />
Leute! Ihr habt mir alles genommen. Meine Ehre lass ich mir nicht auch noch<br />
nehmen!“ Er war wohl über vierzig Jahre alt, ich zweiundzwanzig. Aber er behandelte<br />
mich weiterhin relativ gut, sprach aber nie mehr vom Heiraten. Weihnachten<br />
durfte ich heimfahren. Ich hatte immer noch den Schein, dass ich mir ein<br />
Federbett holen dürfe. So fuhr ich Weihnachten mit meiner Cousine zu meinen<br />
Eltern. Wir hatten eine Genehmigung, mit dem Zug zu fahren. Aber in Gojau<br />
schmissen uns die Bahnbeamten aus dem Zug wegen unserer weißen Armbinden,<br />
trotz Genehmigung. Zum Glück trafen wir im Bahnhof einen älteren Herren, auch<br />
einen tschechischen Bahnbeamten, der sorgte dafür, dass wir mit dem nächsten<br />
Güterzug weiterfahren konnten. Sonst hätten wir die fast 20 km nach Glöckelberg<br />
laufen müssen. Es war ein offener Güterzug. Wir froren fürchterlich. Als wir am<br />
Oberplaner Bahnhof in Vorderstift ankamen, etwa um 9 Uhr abends, mussten wir<br />
noch die 6 km zu Fuß nach Glöckelberg laufen. Dabei war es den Deutschen<br />
verboten, bei Dunkelheit auf der Straße zu sein. Meine Cousine schlief eine Nacht<br />
bei meinen Eltern, am nächsten Morgen führte sie jemand „schwarz“ über die<br />
Grenze nach Österreich.<br />
Ich fuhr nach Weihnachten wieder zurück nach Mric. Aber die „Kary-Mutter“<br />
musste für die vielen tschechischen Zoll- und Grenzbeamten kochen, (Familie<br />
Kary hatte ein schönes großes Gasthaus, das bis jetzt noch in ihrem Besitz war.<br />
Die Tschechen schätzten wohl ihre gute Küche) und sie versuchte, sie zu überzeugen,<br />
dass mich meine alten Eltern dringend in Glöckelberg brauchten. Da
118<br />
119<br />
forderte mich eine Budweiser Buchhändlerin, die sich in Glöckelberg einen Bauernhof<br />
mit Vieh „unter den Nagel gerissen hatte“ als Magd an, weil sie vom Vieh<br />
nichts verstand. So kam ich zu meinen Eltern nach Glöckelberg. Einmal kam ich<br />
beim Futterholen mit einem Glöckelberger Bauern in Konflikt, weil mich Frau<br />
Skrabal auf seine Wiese zum Mähen geschickt hatte. Sie meinte wohl, alles um<br />
das Haus wäre ihr Eigentum. Aber dann verkaufte sie die Kühe und ich stand<br />
ohne Arbeit da. Da sagte Frau Kary zu mir. „Weißt du was, du hilfst mir im Gasthaus.<br />
Du kannst ein bisschen Tschechisch. Ich werde das schon deichseln.“ So<br />
arbeitete ich nun bei Karys, zwar wieder ohne Entlohnung wie in Mric, aber das<br />
Essen war besser, und ich konnte auch manchmal etwas für meine Eltern mit<br />
heim nehmen. Vater meinte: „Nun brauchen wir wenigstens keine Spatzensuppe<br />
mehr essen.“ Es war nämlich wirklich so, dass eine sehr resolute Lehrersfrau, die<br />
dem tschechischen Briefträger seine geschossenen Spatzen abschwatzte, diese<br />
rupfte und ausnahm und Mutter kochte für die ganze Hausgemeinschaft eine<br />
„Spatzensuppe“. So verging der Sommer in Glöckelberg. An schönen Tagen saß<br />
Vater auf der Bank vor dem Haus, schaute hinüber nach Oberplan und die Tränen<br />
rannen über sein Gesicht. Nie mehr war er hinübergewandert in seinen Heimatort.<br />
Wenn der Hund einmal ausgerissen war, holte Werner ihn wieder zurück.<br />
Aber eines Tages fand er ihn nicht mehr. Am 30. September 1945 kamen wir in<br />
das Lager nach Krummau. Es wimmelte nur so von Wanzen und Flöhen. Wir<br />
waren eine Menge Leute aus Oberplan, eigentlich der letzte Rest. Am 2. Oktober<br />
wurden wir in Krummau bereits verladen. Da wurden wir noch einmal durchsucht,<br />
man nahm uns noch einmal eine Menge weg, erstaunlicherweise nicht unseren<br />
kleinen Eisenofen, dem wir die Beine abgeschraubt hatten und ihn so zerlegt<br />
wie einen Schatz hüteten. Aber Vater „verlor“ da noch die Hose von seinem<br />
besten Anzug. Die hat halt ein Tscheche gebraucht, was soll man da machen?<br />
Den Ofen, hatten wir für unsere Linzer Flüchtlinge angeschafft gehabt. In<br />
Glöckelberg schon kochte meine Mutter darauf, später in unserer ersten Bleibe in<br />
Deutschland und als wir heirateten, leistete er uns wieder gute Dienste. Wir kamen<br />
sehr bald nach Furth im Walde. Dort war man nicht auf uns vorbereitet. Wir<br />
standen einen ganzen Tag im Bahnhof und bekamen nichts zu essen. Es waren<br />
auch kleine Kinder im Wagen. Ich stieg aus, und versuchte Milch für diese zu<br />
bekommen. Die Erwachsenen mussten sich aus ihren Lebensmittelvorräten verpflegen.<br />
Wir wurden nach einem Tag zum Einsteigen aufgefordert und weiter<br />
ging die Reise. Wir kamen nach Schwabach in ein Barackenlager „auf dem Vogelherd“.<br />
Alle, die im Waggon waren, waren auch wieder in einer Baracke<br />
beisammen. Es gab dort Stockbetten. Die Eltern lagen unten und Werner und ich<br />
oben. Wir wurden zuerst einmal gründlich „entlaust“. Vielleicht war es nach dem<br />
Krummauer Lager auch nötig. Unser Transport wurde getrennt. Die Hälfte kam<br />
nach Weißenburg auf die Wülzburg. Da war es besser mit der Verpflegung, wie<br />
man später hörte. Wir waren sechs Wochen im Lager in Schwabach. Früh gab es<br />
schwarzen Kaffee und mittags eine Gemüsesuppe mit Graupen und etwas Fleisch<br />
und ein Stück Brot, abends war die Suppe dünner. Später kam heraus, dass der<br />
Lagerverwalter das Fleisch und andere Lebensmittel verschoben hatte. Er hatte<br />
sich ein sehr schönes Haus von dem unterschlagenen Lebensmitteln gebaut. Er<br />
wurde auch dafür eingesperrt. Wir jungen Leute gingen oft spazieren. In Schwabach<br />
wurde viel Tabak angebaut. Da stibitzte ich manchmal einige Blätter für<br />
meinen Vater. Ich hatte mir von den Tschechen das „Konfiszieren“ schon abgeguckt<br />
gehabt. Vater schnitt sie fein und verwahrte sie in einer Blechbüchse in der<br />
Nähe des Ofens. Der Tabak begann zu gären. Plötzlich gab es einen Schlag! Die<br />
Blechbüchse „explodierte“. Und der Tabak flog in er Stube herum. Vater weinte<br />
beinahe.<br />
Von Schwabach kamen wir nach Adelsdorf bei Höchstadt/Aisch in ein Lager. Da<br />
gab es riesengroße Ratten, die sich gar nicht vor uns fürchteten, Mäuse und natürlich<br />
Wanzen. Die waren uns mittlerweile schon ganz vertraut. Von hier aus wurden<br />
wir auf die Dörfer verteilt.. Unser ganzer Waggon kam wieder gemeinsam<br />
nach Friemersdorf in einen großen Tanzsaal. In einer Scheune konnten wir die<br />
Kisten und Koffer abstellen. Da mussten wir selber kochen. Wir bekamen Kartoffeln<br />
und Kraut und ein bisschen Fett. In einem großen Kessel, in dem erst die<br />
Wäsche gewaschen worden war, kochten wir dann unsere Suppe für die etwa<br />
dreißig Leute. Bald wurden wir weiter verteilt. Wir bekamen in einem fürchterlich<br />
abgelegenem Dorf, in Unterwinterbach zu viert ein neun quadratmetergroßes<br />
Zimmer mit schrägen Wänden. Wir hatten ein Bett, unseren Ofen - sonst nichts.<br />
Das Ofenrohr mussten wir durch das Fenster stecken. Das Holz, das wir hatten,<br />
war ganz nass. Entweder stank das Holz in unserem Zimmer, oder es stank vom<br />
Rauch. Mein Vater meinte einmal ganz niedergeschlagen: „Man kann es den Leuten<br />
gar nicht übel nehmen, dass sie uns Zigeuner nennen. Es stinkt bei uns ja wirklich<br />
schon so, wie in einem Zigeunerlager. Ein einziges Bett hatten wir. Darinnen<br />
schliefen meine Mutter und ich. Vater schlief auf einem Strohsack am Fußboden<br />
und Werner schlief auf einem Strohsack auf einer Truhe. Mutter mit ihrem kranken<br />
Fuß musste nun alles laufen. Aber es ging erstaunlicherweise gut, sogar über<br />
die Treppen. Wir mussten nach Uehlfeld einkaufen gehen, das war fast eine Stunde<br />
durch den Wald zu laufen, Vater ging immer mit Werner zum Einkaufen. Im<br />
Januar 1947 rutschte er auf einer vereisten Wurzel aus und fiel hin. Als er heimkam,<br />
zeigte er mir einen blauen Flecken. Dann legte er sich hin, Am nächsten Tag<br />
konnte er nicht mehr von seinem Strohsack am Fußboden aufstehen. Als ich ihn<br />
fragte, warum er nicht aufstehe, sagte er: „Ich weiß nicht, mir ist heute gar nicht<br />
gut.“ Der Müller aus Hüttenhof bei Glöckelberg wohnte im gleichen Ort. Der<br />
kam jeden Tag ein bisschen zu uns. Das war für Vater gut. Er stand dann doch<br />
immer ein bisschen auf und setzte sich auf die Truhe. Vielleicht war es ein kleiner<br />
Schlaganfall. Aber vielleicht hat ihn auch das „Herzeleid“ krank gemacht. Er<br />
sagte öfters einmal: „Daheim waren wir wer, und da werden wir Zigeuner geschimpft.“<br />
Vater hatte nämlich immer versucht, etwas zum Essen zu erbetteln.<br />
Solange noch etwas da war, was wir vertauschen konnten, bekam er auch etwas.<br />
Als wir nichts mehr hatten, musste er sich von einer Bäuerin sagen lassen: „Euch<br />
Zigeuner geb ich nichts. Hättet ihr etwas gearbeitet, hätten sie euch nicht hinaus-
120<br />
121<br />
geschmissen. Lieber geb ich meine Erdäpfel den Säuen, als euch Zigeunergesindel.“<br />
Vater weinte bitterlich, als er uns das daheim erzählte. Ich sagte zu<br />
ihm: „Du gehst mir nirgends mehr hin!“ Von da an ging es gesundheitlich immer<br />
weiter bergab mit meinem Vater. Er bekam Wasser in den Beinen und Hungerödeme.<br />
Ich holte den Herrn Pfarrer, dass er ihm die letzte Ölung gäbe. Als er ging,<br />
sagte Vater: „Der Pfarrer hat mir die Füße mit etwas eingeschmiert, die tun gar<br />
nicht mehr weh.“ Das war zwei oder drei Tage vor seinem Tod. Dann kam noch<br />
einmal der „Hüttenhofmüller“. Dem erzählte er: „Heute Nacht war meine Mutter<br />
bei mir. Die hat gesagt, sie hat mir schon ein Plätzchen gerichtet. Morgen um vier<br />
Uhr holt sie mich.“ Da sagte der Müller: „Geh, Färber! Das hast du geträumt.“<br />
Am anderen Tag um vier Uhr ist er gestorben. Der Müller war auch wieder da und<br />
hatte ihm noch eine Zigarette gedreht. Die Zigarette glühte noch, als Vater starb,<br />
am 10. März 1947. Er war 72 Jahre alt.<br />
Meine Mutter war im Bett gelegen. Sie hatte einen Bruch. Der hatte sich eingeklemmt.<br />
Aber obwohl die Ärztin immer zu Vater gekommen war, sagte sie ihr<br />
nichts. Sie konnte nicht auf die Beerdigung gehen. Nach Vaters Tod wurde sie ins<br />
Krankenhaus eingeliefert und bekam einen künstlichen Ausgang. Ich glaube, sie<br />
sagte nichts, weil sie nach Vaters Tod auch sterben wollte. Sie war noch nicht<br />
einmal 60 Jahre alt und starb am 15. April 1947, fünf Wochen nach meinem<br />
Vater.<br />
Nun stand ich mit Werner ganz allein da. Es war schon schlimm. Ohne Arbeit,<br />
ohne Eltern und von Werners Mutter immer noch keine Nachricht. Gott sei Dank<br />
konnte ich nähen. So ging ich von Haus zu Haus und nähte für die Leute, wieder<br />
ohne Bezahlung, nur für das Essen für mich und Werner. Später strickte ich in<br />
Heimarbeit Pullover, für 4 Mark für einen Kinderpullover. Im Herbst 1947 fand<br />
ich für Werner eine Lehrstelle in einer Bäckerei. Mittlerweile lief über das Rote<br />
Kreuz die Suche nach seiner Mutter. Und kurz vor Antritt der Lehrstelle meldete<br />
sich seine Mutter und holte ihn nach Berlin. Er fand eine Lehrstelle bei den Berliner<br />
Gaswerken, wo er bis zu seiner Pensionierung arbeitete. Ich zog im Januar<br />
1948 zu meiner Tante nach Spalt, die dort immer noch als Pfarrhaushälterin beim<br />
ehemaligen Pfarrer von Tweras, Dr. Houschka, angestellt war. Ich fand eine Arbeit<br />
in einer Metzgerei. In Spalt lernte ich meinen Mann kennen. Er war erst aus<br />
russischer Gefangenschaft gekommen und stammt aus Saaz. Heute können wir<br />
uns über unseren Sohn Toni freuen, der Hauptschullehrer in Nürnberg ist und<br />
über seine Familie. Von unserem „Lastenausgleich“ konnten wir uns in Nürnberg<br />
200 qm Grund für ein Reihenhaus kaufen. Auch Toni hat ein Haus in Nürnberg.<br />
Wir haben alle schwer gearbeitet. Heute nennt uns keiner mehr Zigeuner, höchstens<br />
einmal ein <strong>Böhmerwäldler</strong> in liebevollem Spott, da ja die Oberplaner daheim den<br />
Spitznamen „Zigeuner“ hatten.<br />
Die Amerikaner kamen in den letzten Tagen des 2. Weltkrieges von Glöckelberg<br />
her auf Oberplan zu - also von Westen. Die kleinen Widerstandsnester wurden<br />
kurz mit Artillerie bekämpft - Pernek wurde wieder einmal schwer beschädigt.<br />
Der Volkssturm und ein paar Versprengte waren kein ernstzunehmender Gegner.<br />
In Oberplan war ein Kriegsgefangenen - Sammellager beim Weißgärber im Mini-<br />
Graben aufgerichtet. Kamen doch einige Tausend vom Osten (Protektorat) dazu,<br />
die noch schnell nach Haus wollten. Vierzig Jahre danach, erzählte mir ein Sportartikel-Vertreter,<br />
während er mir die Kollektion vorführte, dass er auch dabei<br />
gewesen sei und, nachdem bereits über Budweis - Krummau die Flucht gelungen<br />
war, in Oberplan im Böhmerwald in die Gefangenschaft geriet.<br />
Unser Haus im Ansbacher Viertel wurde von den Amerikanern beschlagnahmt<br />
und als Feldlazarett verwendet. Die Tiere mussten in den Nachbarställen untergebracht<br />
werden. Meine Mutter und meine Schwester Mitzi wurden den Nachbarn<br />
zugeteilt. Vater war bei der WL (Wehrmacht Luft) eingezogen und war beim Bodenpersonal<br />
zur Flugplatz - Geräte - Betreuung eingesetzt - Unteroffizier. Mein<br />
Bruder Wolfgang, Jahrgang 1928, wurde im Jahre 1944 zur Flak (Fliegerabwehr)<br />
im Industrie-Gebiet Köln - Düsseldorf als 16 Jähriger eingezogen. Da ist für mich<br />
ein weiteres Kapitel anzuschlagen. Konnte er doch erst im Jahre 47 nach seinen<br />
Angehörigen im Bayerischen Wald und im Mühlviertel, das von den Russen besetzt<br />
war, suchen. Das schreibt sich heute sehr leicht - die neuen Grenzen waren<br />
stark von (Zöllnern) Militär besetzt und ohne Bewilligung durfte keine Linie überschritten<br />
werden. So einen Wisch zu erlangen war ja von vornherein vergebliche<br />
Müh! Wovon sollte man sich ernähren - wenn es etwas gegeben hat - selbst Erdäpfel,<br />
eine Hand voll - wurde zu Wucherpreisen und gnadenhalber abgegeben.<br />
Während meiner Wanderung von Ost nach Südwest wurde mir bald klar, dass<br />
man eher in einer armen Hütte einen Bissen Brot erbetteln konnte, als einen Erdapfel<br />
bei einem großen Bauern - dort nämlich musste ich einen Tag für’s Essen -<br />
eine dünne Mehlsuppe - arbeiten.<br />
Im Gefangenen-Lager ist es nicht einmal passiert, dass einer den Ehering für ein<br />
Stück Brot tauschte. Wer kann mir sagen was Hunger war??? Im August zogen<br />
sich die Ami ‘s zurück und die Mutter mit der Mitzi begannen das ganze Haus<br />
von oben bis unten zu säubern. Die Reisbürsten traten den Weg ihrer Bestimmung<br />
an, mit Fleiß und Zähigkeit gelang auch das Werk. Als die Stiegen und<br />
Gänge wieder strahlten, suchte meine Mutter etwas auf dem Dachboden - dabei<br />
entdeckte sie hinter einer offenen Mansardenzimmertür einen Fremden / Einbrecher<br />
im Türkensitz vor einer weit geöffneten Kredenz - neben sich einen großen<br />
Ring mit Dietrichen (Ierer) und schon einige Blei-Kristall-Gegenstände. Unsere<br />
Kästen waren durchwegs vollgestopft mit Leinen-Ballen, Tuchenden und Haus-<br />
Die Vertreibung<br />
Franz Norbert Praxl
122<br />
123<br />
wäsche. Für uns drei Kinder war die Aussteuer längst komplett. Durch das Geschrei<br />
und Ruf nach Hilfe „Einbrechen sind im Haus!“ wurde dieser Fallott verscheucht!<br />
Aber am frühen Nachmittag kam der eben geflohene, plötzlich als neuer<br />
Hausbesitzer, mit einigen Gendarmen mit aufgesteckten Bajonetten und stellte<br />
das unfassbare Ultimatum, innerhalb von zwei Stunden ist das Haus mit dem<br />
gesamten Inventar - alle Schlüssel an den Schlössern - das Vieh versorgt in den<br />
Stallungen - zu übergeben.<br />
Mit einem Handgepäck - nicht schwerer als 50 kg - beginnt der Abmarsch “heim<br />
in’s Reich”. Radios, Waffen, Milch-Zentrifugen, Schrotmaschinen, Butterfaßl<br />
mussten viel früher abgeliefert werden oder wurden versiegelt. Bei einem der<br />
ersten Treffen in Bayern sprach man noch über das Gebrüll der Kühe, eine davon,<br />
die ein zwei Tage vorher gekalbt hatte, wurde vom neuen Besitzer nicht gemolken<br />
und ist daher an der Kette hängend krepiert. Heute ist der vierte Inhaber auf<br />
unserem Haus - die sind nur zum Raub heraufgezogen und immer weniger war zu<br />
holen. Es war dies ein Sohn einer Obstfrau, die in früheren Jahren bei uns einquartiert<br />
war - die haben das Obst mit dem Buckelkorb in die Dörfer getragen<br />
und verkauft. Jedenfalls ist dieser Vorgang hier reibungsloser und nicht ohne Tränen<br />
hingenommen worden, während bei meiner Tante in Krummau mit brutalster<br />
Brachialgewalt eingeschritten wurde. Sie war in der erst 1934 erbauten Villa allein<br />
zu Haus und wollte auch innerhalb einer Stunde noch dies und das mitnehmen,<br />
so zum Beispiel in letzter Minute den Pelzmantel, der irgendwo in einem<br />
Kasten eingemottet war - der Mantel und was sie sonst noch am Arm hatte wurde<br />
ihr weggerissen und dafür der Rosenkranz vor die Füße geschmissen. Es half ihr<br />
nicht, wenn sie sich auch noch so fest mit den Händen und Füßen am Türstock<br />
festkrallte! - hier brachen Kolbenhiebe den letzten Widerstand. Selbst im Lager<br />
fanden unangesagte Leibes-Visitationen zu jeder Tages oder Nachtzeit statt und<br />
was noch irgendwie nach Brauchbarem aussah wurde von den herumstehenden<br />
Siegern - dazu zählen sie sich - mit dem bekannten Beemischen Zirkel zabralisiert.<br />
Wenn Du das nicht weißt, was zabrali heißt, brauchst nur nach Wien gehn, da<br />
kennt jeder dieses Wort - nicht zuletzt von den Russen aktualisiert. Meine Schwester<br />
war schon im Keller vom Notar Nitsche eingesperrt und wartete auf den Abtransport<br />
- da kam ihr heutiger Mann Albert von Wels zurück - einer seiner Kameraden<br />
vom Nachkommando verständigte ihn von der Verhaftung - mit der Pistole<br />
im Anschlag holte er sie heraus und in einen Teppich eingerollt passierten sie<br />
die schon stark bewachte Grenze, da er nicht stehen geblieben ist, wurde ihnen<br />
noch nachgeschossen. So ist mein Schwager zum Lebensretter meiner Schwester<br />
geworden - denn unsere beiden Onkel Fritz und Rudolf (Plank (Irihansl) aus<br />
Deutschhaidl) wurden im Lager Joachimthal / Erzgebirge bzw. im Budweiser<br />
Lager zu Tode gemartert, in diesem Keller hatten sie sich nur durch Blicke verständigen<br />
können.<br />
Am 3. Mai 1945 wurde die Moldaubrücke zwischen Vorderstift und Oberplan<br />
gesprengt. Von Glöckelberg her kamen am 5. Mai die amerikanischen Truppen.<br />
In Vorderstift war Halt für Trucks und Fahrzeuge. Es kamen auch einige Soldaten<br />
zu Fuß und bewegten sich gegen Oberplan. Kämpfe gab es nicht. In Vorderhammer<br />
kamen sie in die Häuser und fragten nach einem Pferdewagen, der Rucksäcke<br />
und Zelte von der Brücke in den Markt bringen könnte. Ich habe unser Pferd<br />
eingespannt und bin bis spät in die Nacht (es war schon dunkel) zwischen Brücke<br />
und Markt hin und her gefahren. Von den Soldaten bekam ich Kaugummi, Kekse<br />
und Schokolade geschenkt, alles Dinge, die ich nicht kannte.<br />
Am nächsten Tag haben Bulldozer die Überfahrt zur Brücke instand gesetzt, sodass<br />
auch Fahrzeuge über die Moldau fahren konnten. An dem Tag kamen auch<br />
schon Fahrzeuge und Panzer aus Richtung Pernek gegen Oberplan gefahren. Am<br />
Tag nach der Kapitulation (8. Mai 1945) kamen die Amis zu uns in die Mühle.<br />
Meine Schwester Emma konnte Englisch, und wir erfuhren, dass der Krieg zu<br />
Ende sei und wir Deutsche müssten alle weg von hier, was wir aber nicht glauben<br />
konnten. Aber am 4. September war es wirklich so weit. Es kamen Polizisten mit<br />
Vaclav Stepanek aus Plaven 17 und Vater musste die Mühle an Stepanek überge-<br />
Kriegsende und Vertreibung<br />
Rudolf Jungbauer<br />
Am Teich vor dem Waldhaus unterhalb des Großen Falkenstein tummelt sich die<br />
Gänseschar. Foto: Josef Seidel, Krummau (Sammlung Reinhold Fink)
124<br />
125<br />
ben. Wir durften die Mühle nicht mehr betreten. Eine Woche später kamen<br />
Stepaneks Frau und Sohn und wir mussten im Wohnhaus im 1. Stock zwei Zimmer<br />
frei machen. Sie brachten nichts mit als ihre Kleider. Mutter musste die Frau<br />
in unserer Küche kochen lassen und sie benützte auch unser Geschirr und unsere<br />
Vorräte.<br />
In der letzten Septemberwoche kam Fritz aus der Gefangenschaft nach Hause.<br />
Wir hatten von ihm seit Januar nichts mehr gehört. Er kam an der Moldau entlang<br />
und Mutter sagte: „Dort kommt ein junger Mann.“ Aber erst, als er am Haus<br />
angekommen war, konnten wir ihn erkennen. Fritz hat sehr schlecht ausgesehen<br />
von den Strapazen der letzten Monate. Er kam aber bald wieder zu Kräften und<br />
half Vater auf der Säge. Emma und ich arbeiteten in der Landwirtschaft und brachten<br />
die Ernte ein. Es wurde viel von Ausweisung erzählt. Deshalb machte Mutter<br />
vorsorglich für jeden einen Rucksack aus Leinen, füllte ihn mit Geschirr und<br />
Kleidern und wir versteckten die Rucksäcke auf dem Heuboden.<br />
Am 23. Oktober 1945 (Adalbert Stifters 140. Geburtstag) kam der tschechische<br />
Postmeister mit Polizisten aus Oberplan und erklärte meinem Vater, dass ab heute<br />
alles enteignet ist und wir mit 30 kg Gepäck in ein Lager müssen. Wir mussten<br />
Vorderhammer innerhalb einer Stunde verlassen. Wir hatten unsere fünf Rucksäcke,<br />
einen Korb mit Wäsche und einige Taschen mit Lebensmitteln und Geschirr,<br />
keine Betten, nur für jeden eine Decke. Schwarzbäck Franz, der bei meinem Vater<br />
angestellt war, hat uns mit unserem Pferd und Wagen nach Oberplan gefahren.<br />
Wir sollten zu Bauern in die Tschechei kommen. Doch dann kam die Rettung:<br />
Meine Cousine Anni aus Honetschlag. Sie sagte, dass ihr Vater (Laden-Hable)<br />
uns aufnimmt. Nach langem Verhandeln mit dem Postmeister und dem Kommissar<br />
durfte uns Schwarzbäck Franzl nach Honetschlag fahren. Er brachte uns später<br />
auch noch die Sachen, die wir am Heuboden versteckt hatten.<br />
In Honetschlag war ein „menschlicher“ Kommissar, Herr Matschke. Als er sah,<br />
dass wir nicht einmal Betten hatten (der Winter war nahe), fuhr er am nächsten<br />
Tag mit meiner Mutter nach Oberplan, und nach Absprache mit dem dortigen<br />
Kommissar konnte meine Mutter noch Betten aus der Mühle holen. Vater und<br />
Mutter hatten bei meinem Onkel eine Küche und ein Zimmer bekommen, wo sie<br />
bis zur endgültigen Vertreibung wohnten. Emma kam nach Langenbruck zum<br />
„Habli“, Fritz zum „Matuschka“ in Honetschlag und ich zum „Boscher“ nach<br />
Böhm. Haidl zum Arbeiten. Emma konnte im Januar 1946 nach Deutschland<br />
ausreisen. „Boscher“ aus Böhm. Haidl brachte sie mit dem Pferdefahrwerk bis<br />
vor Haidmühle an die Grenze. Sie ging nach Passau und wurde bei den „Englischen<br />
Fräulein“ aufgenommen, um Lehrerin zu studieren. Fritz wurde Anfang<br />
März ohne Angabe eines Grundes verhaftet und kam ins Arbeitslager nach Krummau,<br />
wo er in der Pötschmühle (Papierfabrik) arbeiten musste. Am 12. April 1946<br />
mussten wir uns in Honetschlag zur “Aussiedlung” fertig machen. Wir durften<br />
etwa 50 kg für jeden mitnehmen. Vater, Mutter und ich waren drei Tage im Lager<br />
in Krummau. Am Tag, als der Transport nach Deutschland abfuhr, kam auch Fritz<br />
aus dem Arbeitslager zu uns und konnte mit uns ausreisen. Die Fahrt ging über<br />
Wir hatten daheim 18 ha Wiesen und Äcker und 7 ha Wald. Mein Vater war<br />
Bürgermeister. Er wurde im Sommer 1945 aus diesem Grunde verhaftet. Nach 14<br />
Tagen wurde er wieder frei gelassen. Weitere 14 Tage war er daheim zur Arbeit.<br />
Dann hat man ihn wieder geholt. Er war zuerst in Krummau in Weichseln in den<br />
Steinbrüchern. Da konnten wir ihm ab und zu etwas zum Essen bringen. Das<br />
waren zu Fuß etwa 20 km. Die Gefangenen waren dort ja so arm. In den Baracken,<br />
wo später auch die Aussiedler hingebracht worden waren, haben sie gewohnt<br />
und wurden von ganz grausamen SMB-Soldaten bewacht. Die waren äußerst<br />
brutal. Wir sind auf Feldwegen in das Lager geschlichen, haben uns von<br />
Strauch zu Strauch vorgetastet. Wir hätten uns ja eigentlich gar nicht so weit von<br />
Mugrau entfernen dürfen (etwa 7 km). Wenn uns jemand erwischt hätte, hätte<br />
man leicht erschossen werden können. In unserem Dorf wurden schon jede Woche<br />
Leute ausgesiedelt. Wir waren die Letzten im Oktober 1946. Weihnachten<br />
1945 waren wir noch daheim. Bei uns war der Dorf-Kommissare einquartiert.<br />
Wir mussten ihn verpflegen, aber wir haben selbst nichts gehabt. Er wollte jeden<br />
Tag etwas anderes Gutes und die Mutter hat nicht gewusst, woher sie es nehmen<br />
sollte. Wir hatten zwar noch das Vieh, wir durften aber nichts schlachten und<br />
auch keine Milch nehmen. Als die Mutter einmal sagte, er müsste etwas zu essen<br />
herbeischaffen, weil sie nichts habe, war er ganz erstaunt: „Ja, das weiß ich ja<br />
nicht, dass Sie nichts haben.“ Er war ein junger Mann anfangs Zwanzig und gänzlich<br />
überfordert. Seine Mutter war Tschechin, sein Vater <strong>Deutscher</strong>. Er wusste<br />
Nach einer Tonbandaufnahme<br />
Hilde Friepes und Hilde Erhart<br />
Pilsen - Furth im Wald nach Deutschland. Wir waren 30 Personen in einem Viehwaggon<br />
mit nur einem Eimer als Klo. In Furth i.W. wurden wir aus den tschechischen<br />
Waggons in deutsche umgeladen. Dann gab es etwas zu essen von den<br />
Amerikanern. Die Fahrt ging weiter über München nach Mittenwald, wo wir am<br />
Karsamstag 1946 ankamen. Wir wurden in die Marienherberge eingewiesen, die<br />
früher eine Jugendherberge war. Einige Tage später wurden wir in eine Pension<br />
eingewiesen. Wir hatten zwei Zimmer und eine Küche, die wir mit einer Familie<br />
aus Schlesien teilten. Vater fand Arbeit in einer Gärtnerei und ich ging nach Niederbayern<br />
zu einem Bauern. Fritz war auch bei einem Gärtner und ist dann im September<br />
nach Landau a.I. gekommen. Dort hatte er eine Stelle in seinem Beruf als<br />
Müller gefunden. Ich kam im November 1946 wieder nach Mittenwald zurück.<br />
1954 zogen meine Eltern nach Rosenheim in das Haus meines Schwagers<br />
Pichelmeier. Fritz ging 1950 nach Frankfurt/M, wo er bis zu seiner Pensionierung<br />
als Müllermeister tätig war. Ich bin 1963 von Mittenwald nach München<br />
gezogen und betrieb hier bis… ein Taxigeschäft.
126<br />
127<br />
nicht, was er daheim tun sollte, da ist er ins Sudetenland als Kommissar gegangen.<br />
Dann hat er einmal ein Stück Fleisch gebracht. Später hatten wir noch einen<br />
anderen Kommissar, den mussten wir auch verköstigen und versorgen. Der hatte<br />
auch deutsche Vorfahren, aber er gab sich als ganz verbissener Tscheche. Der<br />
hätte keine Lebensmittel gebracht zum Kochen. Und wir hatten kein Mehl, keine<br />
Eier, kein Fett - nichts. Da haben wir ihm Erdäpfel hingestellt. Mein Cousin sagte<br />
einmal zu ihm: „Ja, wie glauben Sie denn, dass ihnen die Leute was kochen können,<br />
wenn sie nichts haben?“ Da hat er irgendwo ein Kalb schlachten lassen von<br />
einem Hof, wo die Leute schon weg waren. Das Vieh lief herrenlos auf den Weiden<br />
herum und hat vor Schmerzen gebrüllt, weil es nicht gemolken wurde. Und<br />
die Katzen streunten in der Gegend herum und jammerten. Nach und nach kamen<br />
auf alle Höfe „Kommissare“. Dann hat man alle Tiere zusammen getrieben und<br />
hat sie in das „Taschekhaus“ (Gut des letzten deutschen Bürgermeisters von<br />
Budweis) gebracht.<br />
An einem Montag, den 3. Oktober mussten wir uns bei der Sammelstelle einfinden.<br />
Die Mutter ging am Morgen in den Stall und hat sich von jeder Kuh einzeln<br />
verabschiedet, mit ihr geredet und sie gestreichelt. Jede Kuh hatte ja ihren Namen<br />
und man kannte ihre Eigenschaften und Eigenheiten. Und die Pferde haben auch<br />
gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung war. Ich mag gar nicht daran denken. Und<br />
am schlimmsten war es, als uns unser Hund nachbellte. Wie er jaulte und jammerte,<br />
da ist uns fast das Herz gebrochen. Und wir mussten das alles zurücklassen!<br />
Wir hatten zwei Kisten und die Betten hatten wir in Leinwandsäcken eingenäht.<br />
Dann kam der Lastwagen. Man hat noch einmal alles durchgesucht, aber<br />
man hat uns nichts mehr genommen. Wir hatten ja nur mehr Kleidung und etwas<br />
zum Zudecken eingepackt. Dann ging es nach Krummau in die Baracken. Es war<br />
schon gar kein Platz mehr drinnen und wir mussten die Kisten immer noch in die<br />
Räume hineinschlichten. Die Leute haben auf den Kisten geschlafen. Und die<br />
einen waren krank und die anderen haben gebrochen und die alten Leute wollten<br />
schlafen. In Mänteln schliefen wir auf den Kisten, denn es war ja schon kalt im<br />
Oktober. Dann hat es endlich geheißen: Morgen geht der Transport. Am Morgen<br />
hieß es dann: Es geht kein Transport. Ihr müsst alle hinunter ins Krankenlager<br />
(das war unten beim Bahnhof) Da war es ein bisschen besser. Natürlich wussten<br />
wir nicht, dass wir nun da bleiben mussten. Man sagte uns, wir müssten 14 Tage<br />
in dem Lager bleiben, weil die Männer und Väter noch nicht entlassen sind. „Wenn<br />
die entlassen sind, werdet ihr ausgesiedelt.“ Ja, von wegen. Da hatten wir einen<br />
Raum für unsere Familie. Wir bekamen täglich eine Suppe. Täglich wurden wir<br />
aus den Baracken hinausgetrieben (die Mutter nicht, und mein kleiner Bruder<br />
auch nicht), mein Bruder Franz (Jahrgang 1930) und mich (Jahrgang 1929), auf<br />
den Lastwagen geladen und dann wurden wir nach Welleschin gebracht zu Erntearbeiten.<br />
Wir waren bei einem großen Bauern. Die Familie war furchtbar gehässig.<br />
Wir mussten erst Kartoffeln graben und auch die Rüben. Zu essen bekamen<br />
wir schon, aber wir mussten hinten in der Scheune essen. Die älteren Buben mussten<br />
im Steinbruch arbeiten, in der Nähe von Welleschin. Am Abend brachte uns<br />
der Lastwagen wieder nach Krummau ins Lager. Da war auch der Bauer Rudo<br />
dabei (unser HJ-Lagerführer, als wir auf dem Schöninger im April 1945 Schanzen<br />
graben mussten). Ihm sah man die Angst an. Das ging so 14 Tage, und vom<br />
Abreisen war gar nicht mehr die Rede. Mittlerweile hörten wir, dass die tschechischen<br />
Bauern rebelliert hatten, dass sie keine Erntearbeiter mehr hatten, weil ihre<br />
ehemaligen Knechte alle in die deutschen Gebiete auf Höfe gegangen sind. Eines<br />
Tages, es war ein Freitag kam ein Fuhrwerk angefahren. Drei Burschen gingen<br />
durch die Baracken. Bei uns sagten sie: „Packt Euch zusammen, ihr müsst mit<br />
uns fahren, nach Sahortov“. Wir wussten gar nicht, wo das ist. Der eine von den<br />
jungen Männern konnte etwas deutsch. Er hatte nämlich während des Krieges in<br />
Köln in einer Munitionsfabrik gearbeitet. Er sagte uns, dass Sahortov in der Nähe<br />
von Gojau sei. Da waren wir dann etwas beruhigt, weil wir nicht ins tschechische<br />
Gebiet mußten. Dann ging es mit dem Fuhrwerk hinauf nach Sahortov, das deutsche<br />
Ahorn. Da waren drei große Bauernhöfe. In einem war mein Bruder, im<br />
zweiten ich, im dritten meine Mutter mit meinem kleiner zehnjährigen Bruder.<br />
Sie musste arbeiten, damit er was zu essen kriegte. Auf unserem Hof war nur der<br />
Bauer und ich, später kam noch ein tschechisches Mädchen und eine alte<br />
Babitschka. Da war noch die Ernte draußen, z. T. sogar noch Getreide, auch Heu.<br />
Man hatte ja den ganzen Sommer nichts getan. Die Babitschka mit 80 Jahren hat<br />
gekocht. Jeden Tag gab es einen Mampf. Am Sonntag gab es ein Paprikahuhn in<br />
einem Riesentopf. Der Bauer hat das Fleisch gekriegt und die Rusenka auch, ich<br />
habe Knödel und Soße gekriegt. Das gab es nun die ganze Woche. Am dritten Tag<br />
begannen die Schimmelfederchen zu wachsen. Uns hat es fürchterlich geekelt,<br />
auch die Rusenka. Wir haben dann nur noch den Knödel gegessen, den konnte<br />
die Babuschka sehr gut. Seitdem mag ich kein Paprikahuhn mehr. Das gab es<br />
jeden Sonntag, solange der Vorrat an Hühnern reichte. Dann waren die deutschen<br />
Hühner „vernichtet“. Die Scherhaufers von Gojau waren entfernte Verwandte<br />
von uns. Sie galten als Antifaschisten und durften ihr Lebensmittelgeschäft noch<br />
führen. Sie haben uns öfters einmal ein kleines Brot zugesteckt. Da habe wir<br />
dann dem Vater gebracht, der immer noch im Lager in Krummau war und in der<br />
Pötschmühle arbeitete.<br />
Sonntag hatten wir immer frei, denn die Bauern waren sehr fromm, aber haben<br />
uns nie von ihrem Überfluss auch nur ein Bröckerl gegeben, nicht einmal meinem<br />
kleinen Bruder. Unsere Wohnung war ein ausgebauter Schafstall. Ende des<br />
Krieges war der für Flüchtlinge aus Schlesien mit einem Holzfußboden und Fenstern<br />
versehen. Heizen konnte man nicht. Die Mutter und mein kleiner Bruder<br />
haben im Bett geschlafen, ich auf zwei verschieden hoben Kisten, also auf zwei<br />
Ebenen. Mein großer Bruder schlief auf einer großen Kiste, auf einer Ebene. So<br />
hausten wir über den Winter, fütterten das Vieh und suchten in fremden Häusern<br />
nach Heu und Stroh. Das war in dem kalten Winter 1946/47. Wir bibberten die<br />
ganze Nacht. Gehungert haben wir hier nicht, weil wir uns dann einfach von den<br />
Saukartoffeln genommen haben, bis wir satt waren. Im Januar hatte unsere Mutter<br />
einen fürchterlichen Unfall. Vor dem Stall stand ein große Kartoffeldämpfer
128<br />
129<br />
und die Mutter und der Bruder mussten immer die Kartoffeln dämpfen. Als die<br />
Mutter einmal in den Dämpfer schauen wollte, hat es den Deckel hochgerissen<br />
und ein Schwall kochenden Wassers ist auf die Mutter geschossen. Gesicht, Brust,<br />
Arme und Hände waren fürchterlich verbrüht. Meinen kleinen Bruder konnte die<br />
Mutter noch rechtzeitig wegstoßen. Sie schrie fürchterlich auf vor Schmerz. Der<br />
Bauer machte schnell einen Schlitten bereit und eingehüllt mit Federbetten brachte<br />
er meine Mutter mit dem Pferdeschlitten zu einem Arzt nach Krummau. Trotz<br />
vollem Wartezimmer kümmerte sich der Arzt gleich um meinen Mutter. Er wollte<br />
sie sofort ins Krankenhaus überweisen, aber meine Mutter wehrte sich mit Händen<br />
und Füßen dagegen. „Ich lasse meine Kinder nicht allein. Ich gehe auf keinen<br />
Fall ins Krankenhaus.“ Dann hat uns der Arzt eine Art Pechsalbe gegeben (die<br />
sah aus wie Teer) und Kamille. Die Mutter hatte unglaubliche Schmerzen. Sie<br />
musste liegen. Dann begann alles zu sulzen, dann zu faulen. Wahrscheinlich wäre<br />
die Mutter gestorben, wenn sie nicht einen so unglaublich starken Lebenswillen<br />
gehabt hätte. Das war richtig fauliges Fleisch. Das habe ich ihr dann nach etwa<br />
drei Wochen mit einer Pinzette millimeterweiese weggezogen. Dann ist eine neue<br />
Haut gewachsen, aber voller Narben. Drei Monate ist sie gelegen. Dann haben<br />
sich in den Ellbogen richtige „Schwimmhäute“ gebildet. Sie konnte den linken<br />
Arm nicht mehr ausstrecken. Das war noch den ganzen Sommer so. Aber sie<br />
versuchte trotzdem zu arbeiten. Im Krummauer Krankenhaus war eine Ärztin,<br />
die war mit dem Bruder des ehemaligen Höritzer Bäckers verheiratet. Meine Mutter<br />
kannte sie von früher, sie hatte ihr im Krieg manchmal etwas Butter gegeben.<br />
Einmal traf sie meine Mutter in Krummau und war ganz entsetzt über ihre Narben.<br />
Sie war mittlerweile Chefärztin im Krankenhaus geworden und sie kümmerte<br />
sich nun um die Mutter. Sie hat die Mutter operiert, die groben Narben weggeschnitten.<br />
Dann konnte die Mutter wieder arbeiten. Die Narben im Gesicht sind<br />
nie ganz verschwunden.<br />
Nach der nächsten Ernte, am 3. November 1947 sagte der Bauer zu uns: „Ihr<br />
könnt hingehen, wohin ihr wollt, ich, kann euch nicht noch einmal einen Winter<br />
durchfüttern.“ Ja, was tun wir nun? Wohin sollen wir gehen? Wir hatten für unsere<br />
Arbeit nie Geld bekommen. Da ging mein Bruder in die Bastweberei (?) nach<br />
Schöbersdorf, weil er wusste, dass dort noch viele Deutsche arbeiten, die vom<br />
Lager in Krummau aus dorthin fuhren. Sie hatten es viel besser gehabt, als wir,<br />
denn sie bekamen ihr Deputat und konnten selber kochen, und wenn kein Fleisch<br />
da war, schlachtete man halt ein Rind, das herrenlos herumlief. Viele Kühe starben<br />
in der großen Kälte auf der Weide. Sie kalbten auch draußen, und die Kälber<br />
starben fast alle kurz nach der Geburt und oft die Mutterkühe auch. Der Verwalter<br />
der Fabrik nahm uns auf, aber er sagte uns, dass er dies ohne Genehmigung mache.<br />
Es könne uns jederzeit jedermann wegholen. Wir waren aber trotzdem froh.<br />
Wir kamen dann nach Wolfstein, das war ein Weiher mit zwei großen Bauernhöfen<br />
oberhalb Höritz. Wir bezogen ein leer stehendes Bauernhaus, in einem kleinen<br />
Häuschen daneben wohnte ein Bulgare mit seiner Familie. Wir mussten eine<br />
Herde mit 36 Rindern, lauter Jungvieh, hüten. Das war nun der nächste Winter,<br />
1947/48. 1948 sollten wir weg. Der Verwalter konnte uns nicht helfen, weil er<br />
uns ohne Genehmigung aufgenommen hatte. Das hatte er uns ja von Anfang an<br />
gesagt. Heulendes Elend. Es kam ein Bauer aus dem tschechischen Gebiet. Dann<br />
ging es nach Kalsching, dann nach Chlumischek, Kremsier (Dort waren eine<br />
Menge aus unserer Gegend: Webinger, Herm. Faschingbauer, Kalischkos aus<br />
Schwarzbach). Wir fuhren durch Berlau, dann nach Krems. Chlumicek war ein<br />
kleines Dorf mit einem Gut. In einem großen Bauernhof kamen wir in das<br />
Austraghäusl. Es war eine recht schöne Wohnung: Ein Kücherl, ein Zimmerl und<br />
noch eine Kammer, sauber und schön. Sie war ja für die alten Bauern hergerichtet<br />
worden. Essen durften wir nicht beim Bauern. Sie waren auch rechte Deutschenhasser.<br />
Aber sie gaben uns Lebensmittel und es wurde uns schon etwas bezahlt.<br />
Es hatte sich politisch etwas geändert: 1948 kam Gottwald mit seiner kommunistischen<br />
Partei an die Macht. Die Bauern hatten nun Angst, dass es ihnen geht wie<br />
den Bauern in Russland. Sie fürchteten die Kolchosenwirtschaft und die Enteignung.<br />
Wir aber haben uns gefreut, denn von diesem Tag an, als die Kommunisten<br />
die Macht übernommen hatten, haben wir Fleischmarken bekommen. Für uns<br />
brachten die Kommunisten eine Erleichterung unserer Lage. Mein Bruder kannte<br />
jemanden von der kommunistischen Parteizentrale. Der erzählte uns die Veränderung<br />
der politischen Lage. Nun wussten wir auch, warum wir nun auch Geld<br />
bekamen. Zwar war es noch immer ein Hungerlohn, aber immerhin etwas. Es<br />
reichte gerade für Salz und Zwirn und ähnliche Kleinigkeiten. Meine Mutter arbeitete<br />
aber immer noch nur für das Essen für sich und den kleinen Bruder. Aber<br />
sie bekam ab und zu Milch und Lebensmittel. Wir arbeiteten den ganzen Sommer<br />
ab 4 Uhr früh auf den Feldern.<br />
Im Gutshof lebte eine deutsche Familie (Marx) aus Fleißheim. Die hatten zwei<br />
ganz liebe Mädchen, acht und drei Jahre alt. Der Gutsbesitzer hatte diese Familie<br />
besser behandelt. Er gab ihnen ein ordentliches Deputat und auch Geld. Da hat<br />
uns die Frau Marx immer etwas zukommen lassen, weil sie sah, wie schlecht es<br />
uns ging. Plötzlich im Oktober kam die Frau Marx ganz aufgeregt angerannt:<br />
„Habt ihr auch den Bescheid bekommen, dass wir morgen abgeholt werden? Es<br />
geht nach Krummau zu einem Transport.“ Wir hatten nichts bekommen. Wir liefen<br />
nach Horkovic, das in der Nähe war, da war die Schwester vom Kalischko<br />
Herbert. „Rosa, hast du einen Abreisebescheid bekommen?“ fragte ich. Sie sagte:<br />
„Nein, aber es ist mir gleich. Ich hau heute Nacht sowieso ab.“ Ja, warum sollen<br />
wir nicht fort? Mein Bruder sagte: „Ich gehe morgen nicht zur Arbeit. Ich fahre<br />
nach Krummau und spreche mit dem Kommunisten, den ich kenne.“ Er traf in am<br />
Landratsamt an. Er sagte ihm, dass alle den Ausweisungsbefehl bekommen hätten<br />
außer uns, aber dass wir nicht alleine da bleiben möchten, und mit den anderen<br />
ausreisen möchten. Der Kommisar hängte sich gleich ans Telefon, um zu<br />
fragen, was da los wäre. Es stellte sich heraus, dass der Schwiegersohn unseres<br />
Bauern (Er war bei der SMB in Kalsching) die Abreise unserer Familie verhindern<br />
wollte, damit der Schwiegervater seine billigen Arbeitskräfte erhalten könnte.<br />
Der Kommunist gab meinem Bruder gleich ein Schreiben mit, dass wir auch
130<br />
131<br />
„abreisen“ dürften. Kurz danach kam der SMB-Mann mit einem Motorrad angesaust<br />
und schimpfte wütend auf meinen Bruder, dass er von der Arbeit fern<br />
geblieben und nach Krummau gefahren wäre. Die Kommunisten hatten uns also<br />
geholfen, dass wir auch gehen durften. Wir hörten gar nicht mehr auf die<br />
Schimpferei, packten unsere Kisten und stellten uns auch an die Sammelstelle.<br />
Unser Bruder Adolf hatte von dem Bauern, wo die Mutter gearbeitet hatte, ein<br />
kleines Lämmlein geschenkt bekommen. Da musste in unserer Not mein großer<br />
Bruder das Lämmlein schlachten. Es war fürchterlich! Die Mutter hat es in einem<br />
großen Topf gekocht und wir haben den ganzen Topf voll mitgenommen. Wir<br />
hatten zwar etwas zu essen, aber die Soße ist übergeschwappt und viel Kleidungsstücke<br />
waren voll Soße. Die Kisten wurden in Gepäckwägen verladen, wir<br />
durften in Personenwägen einsteigen. Und dann ging es los, als es dunkel wurde.<br />
Wohin? Wohin? Es ging nach Budweis, sollte es wirklich nach Russland gehen,<br />
wie einige befürchteten? Es waren zwei furchtbare Tage. Einige meinten nach<br />
Sachsen. Gott sei Dank! Nach Sachsen! Dann ging es weiter: Tabor - Dann standen<br />
wir einen ganzen Tag am Gleis. Ohne Essen! Wir hatten unser Lämmchen -<br />
ein trauriges Mal. Wir durften die Waggons nicht verlassen. Am Abend fuhr der<br />
Zug weiter. Komotau! Doch nach Sachsen? Dann kam Kupferberg. Kein Mensch<br />
kannte Kupferberg. Dann kam Schmiedeberg. Kein Mensch kannte Schmiedeberg.<br />
Also doch über die hohen Berge nach Sachsen? Gegen Morgen: Weipert.<br />
Direkt am Grenzbach. Aber nicht weiter. Nicht nach Sachsen. Wir wurden ausgeladen.<br />
Man brauchte unsere jungen Männer in das Uranbergwerken in<br />
Joachimsthal. Wir kamen in eine Schule in Weipert, dort waren wir drei Tage.<br />
Dann kamen die Kommissare, einer aus Wien, der perfekt deutsch sprach. In der<br />
Schule waren Matratzen. Wir lagen zum ersten mal auf Matratzen. Ja, ganz vornehm.<br />
Es war ein wunderschöner Oktobertag im Erzgebirge. Die Kommissare<br />
haben uns in Weipert - Neugeschrei in Häuser und Wohnungen von vertriebenen<br />
Deutschen eingewiesen. Es waren allerdings noch sehr viele Fachleute hier. Es<br />
war ja in Weipert fast in jedem Haus eine kleine Fabrik oder ein Handwerksbetrieb<br />
oder Heimarbeit, meistens Textilsachen. Dem Wiener scheine ich gefallen<br />
zu haben und er sagte zu mir: „Mäderl, ihr kriegt ein Haus für euch alleine.“ So<br />
sind wir halt in diese Straße gegangen und haben ein nettes Einfamilienhaus bezogen<br />
mit Küche und zwei Zimmern, Wasser am Flur. Eine fürstliche Wohnung,<br />
aber leer. Mein Bruder war gut im Organisieren. Er entdeckte, dass zwei Häuser<br />
weiter unten in der Schule ein Lazarett eingerichtet gewesen war. Da sind wir<br />
schnell hingelaufen und haben uns Betten, Stühle und einen Tisch geholt - und<br />
einen Schrank. Wer am schnellsten da war, hat die besten Sachen gekriegt. Die<br />
anderen haben das später auch gemerkt, aber wir waren diesmal ausnahmsweise<br />
die ersten. In der Küche war ein Ofen, sonst nichts. Im 1. Stock wohnte der ehemalige<br />
Hausherr. Er hat uns eine alte Kredenz für die Küche gegeben. Dann haben<br />
wir uns aus einem hölzernem Bett und Matratzen eine Couch gemacht, darauf<br />
hat dann mein großer Bruder geschlafen. Und ich habe allein ein Zimmer<br />
gehabt!. Vorhänge hatten wir noch von Passionsspielvorhängen aus dem<br />
Flüchtlingsgepäck. Wir hatten als einzige in der ganzen Straße Vorhänge und<br />
haben uns ganz reich gefühlt. Unser Vater war inzwischen in verschiedenen Gefängnissen.<br />
Das schlimmste war in Bori. Aber damals war er wieder in der<br />
Pötschmühle. Manchmal wussten wir, wo er ist, da konnten wir ihm schreiben.<br />
Dann haben wir wieder einmal ein halbes Jahr nicht gewusst, wo er ist. Die Burschen<br />
mussten alle in den Schacht gehen, auch mein Bruder Franz. Adolf musste<br />
in die Schule gehen, die Mutter in den Wald zum Heger, Bäumchen setzen und<br />
ich war in einer Fabrik eingesetzt. Wir haben Vorhänge gemacht und Posamenten.<br />
Wir haben aber 50% Ausschuss erzeugt, weil kein Fachmann da war. Die<br />
waren alle ausgewiesen. Ich war nicht an der Maschine, weil ich lesen, schreiben<br />
und rechnen konnte. Ich konnte schon ein bisschen tschechisch, aber den südböhmischen<br />
Bauerndialekt. Also kam ich in die.... Wir haben das Rohmaterial in<br />
die Färberei geben und wiegen und die Färberei-Verluste aufschreiben. Aber es<br />
hat nie geklappt. Und wir mussten das überprüfen, aber wir waren ja keine Fachleute.<br />
Wir waren ein ganzes Jahre da, und wenn wir nicht die Sorgen um den<br />
Vater gehabt hätten, wäre das eine schöne fröhliche Zeit gewesen. Wir jungen<br />
Leute gingen zur kommunistischen Partei, da war es lustig. Da wurden Reden<br />
gehalten und gesungen - es war einfach schön. Da durften die Tschechen nicht<br />
dabei sei - es war ein Herr Ernst aus Aue in Sachsen, ein komm. Funktionär. Er<br />
kam immer mit Ledermantel auf einem Motorrad daher. Dann brachte er uns<br />
einen Lastwagen voller Bücher aus Schmiedeberg. Die waren in einer Halle deponiert.<br />
Ich durfte nun die Bücher in Regale ordnen. Das hat mir großen Spaß<br />
gemacht, obwohl ich das am Abend nach der Arbeit machen musste, denn während<br />
des Tages war ich ja in der Fabrik. Wir haben die Bücher einigermaßen<br />
geordnet und ich hatte die Ausleihlisten zu führen. Manche haben die Bücher<br />
auch gar nicht mehr zurückgebracht. Aber was soll’s? Es war also unter uns jungen<br />
Leute recht fröhlich. Das Elend der Mütter haben wir damals gar nicht recht<br />
gesehen. Sonntags gingen wir alle miteinander in die Kirche. Wir hatten allerdings<br />
nur einen tschechischen Pfarrer. Zum ersten mal bekam ich den Kommunismus<br />
negativ zu spüren, als plötzlich eine Tschechin zu uns kam. Ein nettes junges<br />
Mädchen. Doch sie hat immer geweint. Als ich sie fragte, warum sie immer weine<br />
und warum sie hier im deutschen Gebiet sei, sagte sie ganz verschüchtert: „Ich<br />
bin Religionslehrerin. Nun hat man mich beim Staat hinausgeschmissen und ich<br />
muss nun in der Fabrik arbeiten. Ich muss noch froh sein, dass ich im Büro arbeiten<br />
darf.“ Da dachte ich bei mir: „Ja, die eigenen Leute werden nun hier auch so<br />
behandelt?“ Sie hat bei einem ganz alten deutschen Weiberl gewohnt in einem<br />
Dachzimmerl. Ich habe sie einmal dort besucht, weil wir uns wirklich gut verstanden<br />
haben. Sie hat auch gesehen, wie wir dran sind - aber ihr ging es nicht<br />
besser. Unser Chef war ein Prager Jude, der auch zwangsweise ins deutsche Gebiet<br />
musste. Er war der Chef von unserer Fabrik, obwohl er auch gar nichts davon<br />
verstand. Mein Bruder Franz war die ganze Zeit im Schacht. Weil er sich gut mit<br />
allen Motoren auskannte, musste er wenigstens nicht mehr einfahren. Er konnte<br />
beim Kompressor bleiben. Später wurde allerdings der Schacht in Neugeschrei
132<br />
133<br />
geschlossen, weil die Grube erschöpft war. Nun mussten die Bergleute nach Bleyl<br />
gehen. Entweder wurden sie von Lastautos abgeholt, oder sie gingen zu Fuß eine<br />
dreiviertel Stunde durch den Wald. Zur Haltestelle des Lastautos war es auch fast<br />
eine Viertelstunde. Deshalb ging mein Bruder sehr oft zu Fuß. Er war auch in<br />
Bleyl am Kompressor. Am 29. November 1950 ging er auch um 9 Uhr weg, weil<br />
um 10 Uhr Schichtbeginn war. Er hatte ein Buch mit, „Das Erbe von Björndal“.<br />
Darin las er immer, wenn der Motor richtig lief. Seinen Brotzeitsack hatte er auch<br />
umgehängt. Am nächsten Tag in der Früh kamen die Burschen von der Schicht<br />
zurück und kamen zu uns gelaufen: „Wo ist der Franzl? Wo ist der Franzl?“. Ich<br />
sagte: „Er ist doch um 9 Uhr weggegangen. Der muss doch bei euch gewesen<br />
sein!“ „Nein, er war nicht da. Der Steiger lässt ihm sagen, er soll sich sofort<br />
melden, falls er krank ist.“<br />
Wir waren ganz erschrocken und aufgeregt. Wir rannten alle los, um meinen Bruder<br />
zu suchen. Aber wo? Zuerst liefen wir in den Schacht zu den Russen. Am<br />
Schacht waren nur russische Ingenieure und die waren sehr korrekt und freundlich.<br />
Sie haben auch immer darauf geachtet, dass die deutschen Bergleute genügend<br />
zu essen hatten, damit sie genügend Kraft hatten. Als die Russen hörten,<br />
dass mein Bruder nicht angekommen war, hängten sie sich gleich ans Telefon um<br />
nachzufragen. Sie hörten, dass irgendwo ein „Unfall“ gewesen wäre. Nun rief er<br />
gleich die SMB- Station in Bleyl. Wir waren ja unmittelbar an der sächsischen<br />
Grenze, und die war schwer bewacht. Der Russe sagte: „Da ist ein Unfall passiert.<br />
Sie müssen zur SMB nach Bleyl“. Er wusste zwar, was passiert war, wollte<br />
es uns aber nicht sagen. Da hetzten wir dorthin: Meine Mutter, mein kleiner Bruder<br />
und ich. Auch ein junges Mädchen aus Weipert lief mit. Es waren schon<br />
Schneewehen auf der Straße und wir hetzten die Dreiviertelstunde nach Bleyl.<br />
Endlich waren wir bei der SMB- Station:. „Wo ist mein Sohn!“, schrie ihnen<br />
meine Mutter schon auf der Straße zu. Man machte uns die Türe nicht auf. Dann<br />
öffnete sich oben ein Fenster. Der Beamte schrie: „Was wollen Sie?“ „Wo ist<br />
mein Sohn!“ rief ihm meine Mutter entgegen. „Gehen sie in Totenkammer!“,<br />
schleuderte ihr der Beamte entgegen. Meine Mutter schrie verzweifelt auf und<br />
wir weinten mit. Da brüllte der Beamte: „Sind Sie sofort ruhig, sonst lasse ich Sie<br />
nach Sibirien bringen!“ Wir schleppten uns dann ins Totenkammerl und da lag<br />
unser Franzl blutüberströmt (Tränenausbruch). 200 Meter vorm Schacht hatten<br />
ihn zwei junge Burschen von der SMB angeschossen und ließen ihn liegen. Dann<br />
gingen sie zur Station und meldeten dort, dass sie einen Grenzgänger angeschossen<br />
hätten. Dann kamen die anderen, brachten ihn zur Station und ließen ihn dort<br />
ohne Hilfe liegen, bis er verblutete. Es war ein Bauchdurchschuss. Die Kugel<br />
durchschlug das Buch und den Brotsack und trat im Rücken wieder heraus. Die<br />
beiden SMB-ler sind am nächsten Tag ins Landesinnere versetzt worden, weil die<br />
Tschechen Angst hatten, dass die Russen die Straftat verfolgen würden. Die russischen<br />
Ingenieure waren sehr aufgebracht über der Vorfall. Die Bergleute hatten<br />
nämlich mit Streik gedroht. Und auch der kommunistische Kommissar aus Aue<br />
war außer sich. Wir durften unseren Bruder lange nicht beerdigen. Er war zehn<br />
Tage im Leichenhaus gelegen und die SMB ist Wache gestanden. Bei der Beerdigung<br />
waren alle Deutschen, die noch in der Gegend waren, anwesend. Die Burschen<br />
sind nicht in den Schacht gefahren, sondern sie gingen auch zur Beerdigung.<br />
Und um den ganzen Friedhof war Militär, weil die Tschechen einen Aufstand<br />
fürchteten. Aber was hätten wir machen können?. Unser Franzl war tot.<br />
Vater wusste davon nichts - er war wieder einmal in der Pötschmühle. Unsere<br />
Mutter war seelisch krank. Es war Winter, und sie musste nicht in den Forst gehen,<br />
aber wenn wir heimgekommen sind, war die Mutter nicht da, die Stube kalt.<br />
Immer fanden wir sie ganz irr auf Franzls Grab hocken. Als wir Vater endlich<br />
verständigen konnten, war auch er nahe dem Wahnsinn. Er gab sich die Schuld<br />
am Tod von Franzl, weil er 1945 nicht dem Rat eines Verwandten gefolgt war und<br />
nach Österreich geflohen war, wo er einen Bauernhof hätte pachten können. Aber<br />
Vater sagte damals: „Ich kann doch nicht unseren jahrhunderte alten Besitz stehen<br />
lassen!“ Und nun machte sich Vater die Vorwürfe: Wäre ich damals gegangen,<br />
würde unser Franzl noch leben! Nach Franzls Tod versuchten wir immer<br />
wieder aufs neue, nach Deutschland zu kommen. Es war mittlerweile Ende 1949.<br />
Mittlerweile war ich zweimal in Prag - allein. Einmal war es für meine Mutter<br />
ganz fürchterlich. Ich musste um 4 Uhr in der Früh in Weipert wegfahren, dann<br />
war ich um 10 Uhr oder halb elf Uhr in Prag. Dann musste ich das Ministerium<br />
suchen. Ich versuchte mich mit meinem bisschen schlechten Mundart-Tschechisch<br />
durchzuschlagen. Als ich in das Zimmer von Herrn Vlcek im Ministerium kam,<br />
warteten schon zwei Frauen hier: eine reichsdeutsche hübsche blonde Frau und<br />
eine Tschechin. Die Reichsdeutsche wollte heim, sie war aus der Kölner Gegend.<br />
Die Tschechin war ihre Dolmetscherin. Da sagte man uns, dass Herr Vlcek heute<br />
nicht da sei, wir müssten am nächsten Tag wieder kommen. Meine Mutter erwartete<br />
mich mit dem letzten Zug um Mitternacht zurück. Wir beschlossen aber alle<br />
drei in Prag zu bleiben und suchten gemeinsam ein Hotel. Am Wenzelsplatz fanden<br />
wir ein Dreibettzimmer. Es war ein vornehmes Hotel - lauter roter Plüsch und<br />
Goldverkleidung. Heute ist es eines der besten Hotels von Prag. Am Nachmittag<br />
schauten wir uns zu Dritt etwas in Prag um. Aber wir hatten Angst, denn es war<br />
für Deutsche noch immer gefährlich in der Stadt, wenn man auch nicht in Lebensgefahr<br />
war, weil die kommunistische Partei etwas für Ordnung sorgte. Es<br />
war Ende 1949. In irgendeinem einfachen Gasthaus drückten wir uns ganz schüchtern<br />
in einem Winkelchen zusammen und aßen etwas zu Abend und dann flüchteten<br />
wir gleich auf unser Zimmer. Ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen.<br />
Meinen Geldbeutel hatte ich unter dem Kopfkissen. Am Morgen gingen wir wieder<br />
ins Ministerium, wo uns Herr Vlcek vage vertröstete. Aber ausgerichtet haben<br />
wir alle drei nichts. „Ist recht, dass Sie da waren. Wir geben Ihnen Bescheid“.<br />
Das war alles. So bin ich eben wieder heimgefahren. Am nächsten Tag um Mitternacht<br />
kam ich heim. Meine arme Mutter war am Bahnhof, ganz außer sich vor<br />
Aufregung. Ich hatte sie ja nicht verständigen können, es gab in ganz Neugeschrei<br />
kein Telefon, das Deutsche benutzen durften. Eines Tages, bekam ich eine Vorladung<br />
auf das SMB-Kommissariat in Karlsbad. Da fuhr ich hin. Ich stand vor dem
134<br />
135<br />
Riesentor. Das ging auf, ich ging hinein. Hinter mir schloss sich das Tor. Ich<br />
geriet fast in Panik. Plötzlich eine Stimme: „Was wollen Sie hier?“ Ich sagte: „Ich<br />
habe eine Vorladung bekommen. Ich muß zu Herrn NN“. Wieder die Stimme:<br />
„Gehen Sie in den 1. Stock“. Dann ging wieder eine Türe auf und wieder hinter<br />
mir zu. Die Beamten hatten wohl genau so Angst wie ich. Ich kam in einen Raum,<br />
da waren zwei Polizeibeamte. Sie wussten schon, dass ich wegen unserer Ausreise<br />
da war. Sie wussten auch die ganze Sache von Franzls Tod. „Was wollen Sie in<br />
Deutschland?“ fuhren sie mich an. „Da ist doch Arbeitslosigkeit und hier ist Arbeit<br />
genug. In Deutschland müssen Sie verhungern!“ Ich erklärte, dass wir alle<br />
Verwandten in Deutschland hätten und meine Mutter nach einem Unfall schwer<br />
krank wäre. Und mein Bruder müsste in die Schule gehen. Und ich wäre auch<br />
keine gute Arbeitskraft. Die Beamten schickten mich wieder unverrichteter Dinge<br />
fort. Es war Winter, Silvester. Der Bus, mit dem ich heimfuhr, ging nur bis<br />
Joachimsthal. Da musste ich von Joachimsthal über das Erzgebirge nach Neugeschrei<br />
gehen. Ich hatte auch keine Winterschuhe, sondern nur Galoschen. In<br />
die hohlen Absätze hatte ich Zeitungspapier gestopft, das die Sohle flach war.<br />
Dann hatte ich dicke Socken an, auch eine Skihose. Aber es waren 20 km über<br />
den Berg zu gehen bis Neugeschrei. Um 2 Uhr bin ich mutterseelenallein losgestapft.<br />
Keine Menschenseele war zu sehen. Es stürmte und schneite. Ich ging<br />
in den Spuren der Lastwagen hinauf Richtung Keilberg. Als ich in Wiesenthal<br />
war, spürte ich eine große Hitze in den Füßen. Ich konnte kaum mehr auftreten. 2<br />
km vor Neugeschrei musste ich alle paar Schritte stehen bleiben, so brannten die<br />
Füße. Als ich bei den ersten Häusern in Neugeschrei war, war es schon stockfinster.<br />
Ich schleppte mich den Berg hinauf zu unserem Häuschen, fiel beinahe zur<br />
Türe hinein. Als ich meine Galoschen und die Socken auszog, merkte ich, dass<br />
die Haut von meinen Fußsohlen richtig weg hing. Die beiden Sohlen waren eine<br />
einzige Blase. Zwei bis drei Tage konnte ich überhaupt nicht auftreten. Der Arzt<br />
gab mir eine Salbe, nach einer Woche war es erst vorbei. Im Februar 1950 bekamen<br />
wir endlich die Erlaubnis zur Ausreise. Aber wir mussten einen Sachverständigen<br />
aus Karlsbad kommen lassen, der musste alles, was wir mitnehmen,<br />
nach unserer Auflistung nachprüfen und für jedes Taschentuch und den kleinsten<br />
Gegenstand mussten wir „Ausfuhrsteuer“ bezahlen. Ich musste vorher noch nach<br />
Karlsbad-Fischern fahren, wo der Sachverständige wohnte und einen Termin mit<br />
ihm ausmachen. Wir mussten ihm auch noch das Taxi von und nach Fischern<br />
bezahlen. Das hat 3000 Kronen gekostet. Wir haben also alles, was wir hatten,<br />
bezahlen müssen, dass wir es mitnehmen durften. Am Mittwoch vor Gründonnerstag<br />
1950 sind wir in den Zug gestiegen. Dann sind wir bis Eger gefahren,<br />
aber ohne unsere Kisten. Wir hatten immer noch Angst, dass diese auch noch<br />
verloren wären. Dann stiegen wir in den Schnellzug Prag-Nürnberg und fuhren<br />
bis Nürnberg. Als wir über die Grenze fuhren, waren da schon apere Stellen, und<br />
ein „deutsches Bacherl“! (Tränen) Und die Gegend war so schön!! Aber wir weinten<br />
alle, weil der Franzl nicht da war und wir von unserem Vater wieder einmal<br />
nichts wussten. Dann kamen wir nach Nürnberg. Von Nürnberg stiegen wir in<br />
einen Zug nach Regensburg. In Regensburg saßen wir über Nacht am Bahnhof,<br />
Adolf, Mutter und ich. Wir mussten aber nach Untergriesbach bei Passau, denn<br />
dahin hatte uns der „Berndl-Onkel“ den Zuzug besorgt. Er hatte aber keine Unterkunft<br />
für uns, denn er arbeitete ja bei einem Bauern als Knecht. Dann fuhren<br />
wir nach Passau. Von dort ging ein Triebwagen nach Obernzell - nur bis Obernzell.<br />
In Obernzell saßen wir wie ein Häuflein Elend am Bahnhof. Wir fielen auf.<br />
Andere Reisende fragten uns, woher wir kämen. (Tränen). Wahrscheinlich erzählten<br />
diese es im Ort. Denn plötzlich kam eine junge Frau daher gerannt und<br />
fragte uns : „Ja, wer seid’s denn ihr?“ Als wir es ihr sagten, rief sie laut: „Ja, um<br />
Gottes Willen! Und wir sind die Mathuni, von der Nähe von Gojau. Wir sind da<br />
in Obernzell. Ich hab euch einen Apfelstrudel mitgebracht, dass ihr was zu essen<br />
habts. Und wo wollt’s denn hin?“ „Wir müssen nach Untergriesbach zum<br />
Wimberger, dort können wir vorerst bleiben.“ „Ja, da müsst ihr auf den nächsten<br />
Triebwagen warten, der fährt nach Untergriesbach und dann müsst ihr nach<br />
Oberötschdorf laufen. Die Tante hatte uns nicht erwartet. Sie schlug die Hände<br />
über dem Kopf zusammen. Aber sie nahmen uns gut auf. Es war Gründonnerstag<br />
Nachmittag. Sie hatten ein Zimmer und ein Kammerl und sie waren vier Leute.<br />
Der Onkel war allerdings schon in München beschäftigt. Die Tante arbeitete bei<br />
der Bäuerin, eine Tochter war bei einem Zahnarzt im Haushalt und die Kleine<br />
ging in die Schule. Die Bäuerin hat uns gleich eine Suppe gegeben. Die Tante<br />
sagte: „Ihr müsst nun da bleiben, denn das Zimmer in Unteröd könnt ihr noch<br />
nicht beziehen.“ Nach Unteröd ging man etwa eine Stunde. Aber man ließ uns<br />
erst nicht ein. Später vertrug sich die Mutter gut mit der Bäuerin. 14 Tage mussten<br />
wir nun bei der Tante bleiben. Tagsüber halfen wir bei der Bäuerin mit und<br />
bekamen dort auch zu essen. Das war unser Arbeitslohn. Es war schon besser, wir<br />
hatten zu Ostern sogar schon einen Striezel. Ich habe nun zuerst Stempelgeld<br />
bekommen und die Mutter 40 DM Sozialhilfe. Dann habe ich beim Arbeitsamt<br />
erwirkt, dass ich im Kloster kochen und handarbeiten lernen konnte. Dann wäre<br />
ich wenigstens „aus der Kost“ gewesen. Das Arbeitsamt hat mir das erlaubt. Meine<br />
Tante in Ebersberg schrieb eines Tages, dass im Ort Handschuhmacher aus Weipert<br />
wären, die eine neue Fabrik gründen wollten. Er hatte sich dazu schon eine Scheune<br />
angemietet und hatte schon eine Menge Arbeiter aus Weipert gefunden. Ich fuhr<br />
zu meiner Tante und sie meinte, wir sollten es einmal versuchen, ob sie mich auch<br />
nehmen würden. Als er hörte, dass ich aus Weipert kam, nahm er mich. „Ich<br />
brauch zwar jetzt niemanden mehr, aber wenn du aus Weipert kommst, muss ich<br />
dich ja wohl nehmen. Ich durfte nun bei meinem Cousin wohnen und auf einem<br />
alten Diwan in der Küche ein dreiviertel Jahr schlafen. In der ersten Zeit musste<br />
ich die Handschuhe bügeln und einsortieren. Ich hatte mich schnell eingearbeitet,<br />
aber da schrieb meine Mutter dauernd, dass ich wieder nach Untergriesbach kommen<br />
sollte, ich könnte bei der Kistenfabrik Graf und Clement anfangen. Sie brauchten<br />
eine Bürokraft. Herr Dr. Graf brachte mir alle Büroarbeit von A bis Z bei.<br />
Alles habe ich da gelernt. Da war ich drei Jahre. Dann ging die Fabrik wieder ein,<br />
weil sie wohl auch versprochene Kredite nicht bekommen hatten. Aber Herr Dr.
136<br />
137<br />
Graf hatte gute Beziehungen zum Landrat. Nach dessen Abwahl wurde er Chef<br />
bei der Firma Kusser, Steinmetz und Holzbetriebe in Hauzenberg. Da wurde ich<br />
in dieser Firma übernommen. Der Chef fragte mich: „Frl. Erhart, sind sie mit 280<br />
Mark zufrieden?“ Ich dachte, mich trifft der Schlag! Vorher hatte ich 120 DM<br />
bekommen sollen, aber bekommen habe ich letztendlich nur 20 DM. Das war<br />
1954. Als ich von Dr. Graf weggegangen war, war er mir 900 DM schuldig, die er<br />
mir später in München abgestottert hat. Mittlerweile war ich mit einem Dr. Gluth<br />
in Verbindung gekommen, der eine Sekretärin suchte. Er hatte mir auch ein Zimmer<br />
in der Fabrik versprochen, was dann aber nicht klappte. Mittlerweile traf ich<br />
am Dreisessel die Katzlinger Elli, die gerade geheiratet hatte. Sie erzählte mir,<br />
dass sie seit acht Wochen verheiratet wäre und in München in der Kurfürstenstraße<br />
wohne. „Komm uns doch einmal besuchen, du kannst auch eine Weile bei<br />
mir bleiben.“ So schlief ich also bei Blauts auf der Couch. Dann ging Elli mit mir<br />
auf Wohnungssuche. Wir hatten eine Anzeige gelesen: „Polizeibeamter bietet<br />
Zimmer an.“ Wir gingen also hin. er war sehr freundlich und sehr höflich. Als wir<br />
uns das Zimmer ansahen, stellte ich fest, dass ich durch sein Schlafzimmer gehen<br />
musste - und das Zimmer hatte nicht einmal eine Tür. Sonst wäre es ein nettes<br />
Zimmer gewesen. Aber Elli sagte kategorisch: „Da bleibst du nicht!“ Der Polizist<br />
war recht enttäuscht, als wir wieder gingen. Er hätte vielleicht jemanden gebraucht,<br />
der ihm gekocht und ihn auch ansonsten gut versorgt hätte. Schließlich fanden<br />
wir wieder eine Anzeige. Das Zimmer war in der Nähe meiner Arbeitsstelle in<br />
einem zerbombten Haus. Aber in ganz München sah man ja nur Schutthaufen.<br />
Das angebotene Zimmer war im Souterin und ich sah nur auf Schutt. Mein Bettzeug<br />
musste ich von daheim mitnehmen. Da war ich ein Jahr. - Dann hat sich<br />
mein Chef mit dem Arbeitgeber zerstritten und wurde entlassen. Da ging ich auch.<br />
Ich gab eine Anzeige auf und suchte eine neue Stelle. Man suchte damals schon<br />
Leute. So kam ich zum Verlag Rehm und war dort sieben Jahre lang Chefsekretärin.<br />
In München traf ich mit meinem späteren Mann Herbert Friepes aus Höritz zusammen,<br />
den ich schon daheim kannte. Er studierte in München. Seine Eltern<br />
wohnten auch in Untergriesbach und wir fuhren alle vier Wochen heim in den<br />
Bayerischen Wald. Herbert hatte damals schon eine Arbeit. Die Familie Friepes<br />
hatte sehr bald wieder einen Laden bei Untergriesbach und als wir so arm aus der<br />
Tschechei kamen, hat sie uns sehr geholfen. Ich wohnte mittlerweile schon in<br />
einem Hochhaus in Bogenhausen, in einem Gewerkschaftshaus. Die Gewerkschaft<br />
bekam damals Kredite, wenn sie für Vertriebene Wohnraum schuf. Unser<br />
Vater kam erst 1957 zu uns. Weil man keinen Grund wusste, ihn zu verurteilen,<br />
verurteilte man ihn dafür, dass er 1938 nicht zur tschechischen Wehrmacht eingerückt<br />
war. Dafür bekam er 15 Jahre, wovon er 10 Jahre absaß. Er war in zehn<br />
verschiedenen Lagern. In Bory war es am schlimmsten. Am besten war es noch in<br />
der Slowakei. Als Adenauer in Russland das Abkommen wegen der Gefangenen<br />
getroffen hatte, sind die Gefangenen in der Tschechei auch als Spätheimkehrer<br />
frei gekommen. Da war ich schon in München. Wenn Adenauer nicht gewesen<br />
wäre, wäre er nie mehr heimgekommen. Noch fünf Jahre hätte er nicht durch<br />
Das Kriegsende erlebte ich in Hinterstift bei Oberplan. Ein amerikanischer Stoßtrupp<br />
erschien und durchsuchte das ganze Dorf nach deutschen Soldaten und<br />
Waffen, weil sie aber beides nicht fanden, zogen sie wieder ab. Am späten Nachmittag<br />
kamen deutsche Soldaten und sagten, das Konsum-Vorratslager muss geräumt<br />
werden und die Waren und Lebensmittel müssen bis zu der am Vortag<br />
gesprengten Moldaubrücke in Vorderstift gebracht werden, wo sie dann auf der<br />
anderen Seite der Moldau nach Oberplan hinauf transportiert würden. Ich spannte<br />
die Pferde vor den Wagen und bin zwei oder dreimal gefahren, da hieß es<br />
plötzlich, die Amerikaner kommen wieder. Es waren aber nur Parlamentäre mit<br />
einer weißen Fahne und die vereinbarten mit deutschen Offizieren, am nächsten<br />
Tag wieder zu kommen, um über die kampflose Übergabe von Oberplan zu verhan-<br />
Er1ebnisse, Vertreibung, Abschied<br />
Franz Tonka<br />
gestanden bei diesem Essen und der Behandlung. Als er zu uns kam, war er nur<br />
ein Haufen Knochen mit Haut darüber. Als wir ihn in Passau abholten, haben wir<br />
ihn nicht erkannt: Schneeweiß, grau im Gesicht. Der Gemeindesekretär hat ihn<br />
mit einem Auto geholt. Vater hat sich nicht aus dem Haus getraut. Er hat auch<br />
nichts gesprochen. Erst nach zwei Jahren hat er in Ebersberg zu erzählen angefangen.<br />
Er hatte Mitgefangene getroffen, z.B. Herrn Lehrer Hans Sattler, einen<br />
Arzt, einen General. Da hörten wir unseren Vater zum ersten mal über diese Zeit<br />
reden. Vater hatte erfahren, dass ein Mitgefangener von ihnen an einem Ministerium<br />
in München beschäftigt war. Dann fuhr Vater mit dem Zug nach München<br />
und besuchte diesen Mitgefangenen. Ich war bei dem Treffen dabei. Sie fielen<br />
sich in die Arme und weinten. Es war erschütternd. Der Mitgefangene sagte:<br />
„Gott sei Dank, dass Du endlich da bist!“ Vater sagte: „Ja, da bin ich schon, aber<br />
ich habe gar nichts mehr. Ich bin ein Bauer und habe keine Felder und nichts.“ Da<br />
sagte der andere: „Da werden wir eben etwas suchen“. Vater bekam dann einen<br />
Kredit für eine Nebenerwerbssiedlung und bekam auch gleich seinen Lastenausgleich<br />
und ein „Heimkehrergeld“. Davon konnte er das kleine Häusl in Ebersberg<br />
kaufen. Den Kredit musste er zurückzahlen. Aber Vater hat sein Häusl nur vier<br />
Jahre genießen können. Mein Bruder musste in Ebersberg noch die Schule fertig<br />
machen. Seine versprochene Lehrstelle als Automechaniker bekam er nicht, die<br />
bekam ein Bauernbub. Er lernte dann Tischler, nach der Gesellenprüfung ging er<br />
nach Stuttgart in einen Betrieb. Dort war er sehr beliebt, dann ging er zurück nach<br />
Ebersberg und wurde in der Gemeinde als Klärwart angestellt. Vater freute sich,<br />
dass er seinen Sohn wieder bei sich hatte, aber bald darauf starb er an den Folgen<br />
seiner Gefängnisstrapazen. (Niederschrift nach einer Tonbandaufnahme im Jahre<br />
2003)
138<br />
139<br />
deln. Am darauf folgenden Tag, kamen sie dreimal, um 9 Uhr früh, um 1 Uhr<br />
mittags und um 5 Uhr abends, aber jedes mal umsonst, sie konnten sich nicht<br />
einig werden. Aber am Sonntag um die Mittagszeit war es dann so weit. Amerikanische<br />
Panzer und mit Infanterie besetzte Fahrzeuge rollten von Glöckelberg herkommend<br />
auf Vorderstift zu und gingen dort in Stellung, wo sie dann eine deutsche<br />
Fahrzeugkolonne, welche in Richtung Stuben - Schwarzbach unterwegs war,<br />
unter schweren Beschuss nahmen. Angeblich soll sich dann der Ortskommandant<br />
von Oberplan, ein junger und draufgängerischer SS Offizier, welcher die Verteidigung<br />
und den Beschuss des Ortes befohlen haben soll, mit dem PKW der Forstdirektion<br />
abgesetzt haben. - Und dann geschah etwas Besonderes, ich habe es<br />
selbst gesehen. Ein deutscher Zivilist fuhr mit seinem Fahrrad von Oberplan in<br />
Richtung Vorderstift, in einer Hand schwang er ein großes, weißes Tuch und rief<br />
mit lauter Stimme: „Nicht schießen, nicht schießen. Oberplan wird nicht verteidigt<br />
und kampflos übergeben!“ Dieser Mann stammte aus Hinterstift. sein Name<br />
war Franz Lang. Als dann in den Abendstunden die Amerikaner in Oberplan einrückten,<br />
kamen viele Oberplaner, welche auf Befehl der deutschen Besatzung<br />
ihre Behausung verlassen hatten, Oberplan sollte ja verteidigt und beschossen<br />
werden, vom Schwemmberg herunter, von der Schieder und auch vom Gutwasserberg<br />
her in ihre Häuser und Wohnungen zurück. Es waren aber auch einige die<br />
waren im Ort bei ihren Häusern und bei ihrem Vieh geblieben. Da ich einmal<br />
Landwirt werden wollte, war ich in Hinterstift auf einem größerem Hof bei einem<br />
deutschen Bauern im Dienst. Einige Wochen vor der Enteignung kam der tschechische<br />
Kommissar ins Dorf, schaute sich jedes Haus und jeden Hof ganz genau<br />
an und unterhielt sich und redete mit den Leuten recht scheinheilig, ja, teilweise<br />
wurde er sogar bewirtet. Jedoch seine gespielte und süße Freundlichkeit war in<br />
Wirklichkeit ganz gemeine und hinterhältige Falschheit. Die Leute hatten natürlich<br />
mit der Zeit so manche Habe irgend wo versteckt oder sogar außer Haus und<br />
über die Grenze gebracht. Als es dann zur Enteignung kam und verschiedene<br />
schöne und wertvolle Sachen, welche sich der Kommisar bei seinem „Hausbesuch“<br />
genauestens gemerkt und notiert hatte, verschwunden waren, hieb und schlug<br />
er mit einer Hundedressurpeitsche auf die Leute so lange ein, bis sie sagten, wo<br />
sie sind oder versteckt waren. Sie mussten dann sofort und schnellstens herbei<br />
geschafft werden und für solches Hab und Gut, welches bereits über der Grenze<br />
in Sicherheit war, gab es dann doppelte und dreifache Schläge. - Ich weiß es noch<br />
ganz genau, wir saßen gerade beim Mittagessen, da kam eine wilde Horde Tschechen<br />
auf das Dorf zu. Die Tür sprang auf und herein stürmte der Kommissar mit<br />
einem Tschechen, der genau so blöd drein schaute wie er in Wirklichkeit war, und<br />
schrie: „Das ist ab heute der neue Verwalter, der in Zukunft diese Hof bewirtschaften<br />
wird. Sie dürfen nur die allernötigsten Sachen mitnehmen und kommen<br />
in ein Sammellager.“ - Der Bauer wurde kreidebleich im Gesicht und die Bäuerin<br />
sagte mit klagender Stimme, sie hätte eine Schwester in Vorderglöckelberg, welche<br />
bestimmt gern die ganze Familie aufnimmt. Dazu aber brauchte man eine<br />
Aufenthaltsgenehmigung vom Kommissar in Glöckelberg. Ich rannte so schnell<br />
es ging querfeldein nach Glöckelberg und besorgte eine solche. Als ich zurück<br />
kam, war die Enteignungswut immer noch nicht ganz vorüber. Der Bauer hatte<br />
Striemen im Gesicht und blutete am Kopf und an den Händen und die Bäuerin<br />
und die Kinder weinten bitterlich. Ich spannte die Pferde an den Wagen, welcher<br />
schon mit den letzten Habseligkeiten beladen war und brachte die ganze Bauernfamilie<br />
nach Vorderglöckelberg. Der Kommissar aber rief mir noch nach, ich<br />
müsse sofort wieder zurück kommen und weiterhin am Hof arbeiten, denn andere<br />
Dienstboten waren keine mehr da, die waren alle schon weg. - Ich tat, das heißt<br />
ich musste tun, wie mir befohlen und war Knecht bei einem Tschechen, der zwar<br />
ein “mords” Kommunist, aber kein Bauer, sondern wie ich später erfahren habe,<br />
nur ein Hilfsarbeiter in einer Fabrik war und deshalb von der Landwirtschaft fast<br />
gar nichts verstand. Seine Frau, eine Deutschenhasserin ersten Ranges, von der<br />
ich des öfteren hören musste: „Tü britsch nemezcki Prassata“, hau ab, du deutsche<br />
Sau. Zum Zeichen dass wir Deutsche waren und dass sie uns verachten,<br />
demütigen und oft sogar beschimpfen und anspucken konnten, mussten wir eine<br />
breite, weiße Armbinde tragen, auf welcher ein großes, schwarzes N aufgedruckt<br />
war, manchmal mussten es sogar zwei N sein - es bedeutete Nemezki oder Nemezki<br />
Nazi. Ich hatte einige Sachen zusammen gepackt, um mit Bekannten über die<br />
Grenze nach Österreich oder Bayern zu gehen. Ein Freund von mir wollte sie in<br />
In der alten Säumerstraße von Wallern fuhr dieses Ochsengespann. Foto: Josef<br />
Seidel, Krummau (Sammlung Reinhold Fink)
140<br />
141<br />
ein abseits gelegenes Versteck bringen, leider, die Tschechen haben es gemerkt<br />
und er konnte gerade noch entkommen, aber meine Sachen haben sie geschnappt.<br />
Wenn sie gewusst hätten, von wem sie sind, hätte ich bestimmt nichts Gutes zu<br />
erwarten gehabt. Als immer mehr Deutsche zu tschechischen Bauern verschleppt<br />
wurden, ging meine Schwester schwarz über die Grenze, und ich wurde, als im<br />
Juni 1946 wieder ein Aussiedlungstransport zusammen gestellt war, mit meinen<br />
Eltern aus unserer Heimat vertrieben. - Wir mussten uns am Marktplatz in Oberplan<br />
sammeln, unsere letzte Habe wurde noch einmal gründlich durchsucht und<br />
kontrolliert und so manches, an daheim erinnerndes Stück, musste schweren Herzens<br />
noch zurück gelassen werden. Mit einem großen Lastauto fuhren wir, zum<br />
letzten mal vorbei an unserer Kirche ins Sammellager nach Krummau und mein<br />
Vater durfte großzügiger Weise, aber nur weil er Berufsmusiker war, als einziges<br />
Musikinstrument sein Akkordeon mitnehmen. Mit Tränen in den Augen nahmen<br />
wir Abschied von der Heimat, von Grund und Boden, vom Elternhaus, aber auch<br />
von unserem alten Onkel und der Tante, die zurück blieben und denen sie auch,<br />
trotzdem sie Österreichische Staatsbürger waren, Haus und landwirtschaftlichen<br />
Grundbesitz enteignet hatten und die sie erst im November 1948 nach Linz a.d.<br />
Donau ausreisen haben lassen. – Pfingsten 1946 verbrachten wir im Krummauer<br />
Lager und am 13. Juni wurden wir dann einwagoniert. 30 Personen mit samt<br />
ihrem letzten Hab und Gut in einem Güterzugwagon, bzw. Vietransportwagen. -<br />
Am späten Nachmittag setzte sich der Zug dann in Bewegung und wir fuhren die<br />
ganze Nacht durch. Es regnete ununterbrochen. Das Wasser drang durch die schadhaften<br />
Dächer der Wagen. Das aufgestapelte Gepäck kam ins Schwanken und<br />
verrutschte, alte und ältere Leute jammerten und stöhnten, andere wieder schimpften<br />
oder beteten leise vor sich hin und die Kinder weinten. Ich glaube, der Heizer<br />
und der Lockführer waren der Teufel in einer Person, gefahren sind sie ganz<br />
bestimmt so, es war eine richtige Höllenfahrt. Am nächsten Morgen, es war schon<br />
helllichter Tag, hielt endlich der Zug. Wir waren in Pilsen. Die Wagontüren wurden<br />
aufgerissen, wir bekamen endlich wieder frische Luft, durften sogar ein wenig<br />
aussteigen, um etwas Brot, Kaffee und warme Suppe zu fassen. - Da stand ein<br />
kleiner, dicker und fetter tschechischer Eisenbahner, schaute uns von der Seite<br />
her an, grinste dreckig und sagte höhnisch: „No segt’s, dos hobt’s jetzo von engerne<br />
Heil Hitler schrein.“ Wenn wir nicht so froh um den Kaffee und das bisschen<br />
warme Suppe gewesen wären, sollte man sie ihm lieber mitten ins Gesicht geschüttet<br />
haben, diesen kleinen, miesen, dreckigen, Ratte. Aber leider, wir waren<br />
ihnen ja ausgeliefert. – Die Fahrt ging weiter und nach einem nicht gerade kurzen<br />
Aufenthalt an der tschechisch-bayrischen Grenze, steuerten wir den Grenzbahnhof<br />
Furth im Wald an. Bevor die tschechische Zugbegleitung zurück fuhr, erhielt<br />
jeder von uns noch einen Kommisswecken Brot von diesen scheinheiligen Schurken,<br />
die Henkersmalzeit sozusagen. Von der warmen Verpflegung, welche wir<br />
vom Roten Kreuz erhielten, etwas erholt, wurden wir dann schnell ein wenig<br />
untersucht und „entlaust“, weil die Amerikaner Angst hatten, wir könnten ihnen<br />
etwas mit bringen. - Nach all dem, rollten wir über Regensburg nach Plattling,<br />
Erlebnis eines <strong>Böhmerwäldler</strong>s in den Jahren 1945 - 46<br />
Am 22.7.1945 nachmittags erschienen in meinem Hause in Ogfolderhaid, Kr.<br />
Krummau, ein tschechischer Gendarm, drei Beamte der SNB (Staatspolizei) und<br />
ein Zivilist und fragten nach mir. Meine Frau antwortete ihnen, dass ich erst abends<br />
heimkomme. Darauf erklärten sie, sie müssten eine Hausdurchsuchung vornehmen,<br />
weil ich Waffen versteckt habe. Obwohl die Frau beteuerte, dass ich nie<br />
Waffen besessen hätte, wurde das ganze Haus durchstöbert und aus den Schränken<br />
und Truhen alles rücksichtslos auf den Fußboden geworfen. Selbstverständlich<br />
fanden die Tschechen nichts. Nun ließen sie sich in meiner Wohnung häuslich<br />
nieder und warteten auf meine Heimkehr. Bevor ich nach Hause kam, wurde<br />
ich von Freunden schon gewarnt. Da ich meinen Angehörigen Unannehmlichkeiten<br />
ersparen wollte, entschloss ich mich trotzdem, heimzugehen. Der Empfang<br />
durch die Tschechen war nicht liebevoll. Ich wurde sofort für verhaftet erklärt<br />
und musste einen LKW besteigen, auf dem schon ein SS-Mann aus dem<br />
Banat und zwei schwer bewaffnete SNB Leute saßen. Die Fahrt ging nach Oberplan.<br />
Dort wurde ich von einem uniformierten Tschechen mit der Hundspeitsche geschlagen.<br />
Hierauf erschien ein Gendarm, der eine Verhandlungsschrift über meine<br />
politische Tätigkeit aufnahm. Besonderes Gewicht legte er auf die Frage, ob<br />
ich beim Freikorps war und jemanden angezeigt hätte. Dieser Mann hat mich<br />
anständig behandelt. Nun wurden der SS-Mann und ich in eine vollständig leere<br />
Gefängniszelle gesperrt. Die Nacht mussten wir auf dem bloßen Fußboden verbringen.<br />
Am nächsten Tag wurde ich in einem Personenkraftwagen nach Krummau<br />
geliefert. Hier traf ich viele Bekannte, u.a. den Gastwirt Osen aus Salnau<br />
Aug’ um Auge, Zahn um Zahn<br />
N.N.<br />
wo der Zug dann in drei Teile geteilt wurde. Ein Teil kam nach Eggenfelden,<br />
einer nach Griesbach im Rottal und wir nach Landau a.d.Isar in Niederbayern.<br />
Wohin jetzt mit uns, wieder in ein Lager, in einem großen Tanzsaal eines Gasthauses.<br />
Nach dortigem und fast zweiwöchigem Aufenthalt und nach gründlicher,<br />
körperlicher ärztlicher Untersuchung wurde uns in einer Gastwirtschaft ein kleines<br />
Zimmer angewiesen, für welches meine Mutter, nur für ihre Verpflegung und<br />
dass wir dort wohnen durften, den ganzen Tag fleißig in Küche und Haus arbeiten<br />
und rackern musste. Etwa ein halbes Jahr später übersiedelten wir und bekamen<br />
ein anderes Zimmer. Als meine Mutter in den Isarauen einmal trockenes<br />
Brennholz sammeln wollte, nahm man ihr ein kleines Handbeil, welches wir von<br />
zu Hause mitgebracht hatten, weg und wir mussten es bei der Polizei wieder
142<br />
143<br />
(„Schestauer“) und zwei seiner Söhne. Am 25.7.1945 wurden 16 Mann von uns<br />
aufgerufen, darunter der schwarzenbergische Forstmeister Johann Starek von<br />
Oberplan. Unter schärfster Bewachung wurden wir auf Lastkraftwagen in das<br />
Kreisgerichtsgefängnis in Budweis gefahren. Was wir bisher erlebt hatten, war<br />
ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was nun folgte. Als wir durch das Tor des<br />
Gefängnisses getrieben wurden, wurde uns schon die Kopfbedeckung heruntergeschlagen.<br />
Ein Hagel von Schimpfworten, wie deutsche Schweine, deutsche<br />
Hunde, Hitlerbanditen, ging auf uns nieder. Dann mussten wir uns im Gang mit<br />
dem Gesicht zur Wand aufstellen. Lange brauchten wir der kommenden Dinge<br />
nicht zu warten. Bald erschienen drei Mann, z. T. in Uniformen von Gefängnisaufsehern,<br />
mit Gummiknüppeln und Stecken und fingen an, auf den ersten der<br />
Leidensgenossen an der Tür einzuschlagen, bis er bewusstlos und blutend am<br />
Boden lag. Dann wurde er mit den Stiefelabsätzen bearbeitet. Wir anderen mussten<br />
zusehen, bis die Reihe an uns kam. Ich war der 12. Der erste Schlag traf mich<br />
ins Gesicht, dass alle Zähne im linken Oberkiefer lose im Munde lagen und im<br />
Unterkiefer keiner mehr gerade stand. Beim zweiten Schlag über den Kopf ging<br />
ich zu Boden, raffte mich aber wieder auf und spuckte das Blut samt den ausgeschlagenen<br />
Zähnen aus. Nun wurde auf mich losgedroschen, bis ich nichts mehr<br />
hörte und sah. Als auch der 16. seine Prügel hatte, wurden wir einzeln in die<br />
Kanzlei geholt. Dort wurde ein Fragebogen ausgefüllt. Nachdem uns alle Wertgegenstände<br />
abgenommen worden waren, wurden wir in die Zellen verteilt. Vor<br />
der Zellentür erwartete uns ein Aufseher, vor dem wir uns nackt ausziehen mussten.<br />
Er untersuchte jedes Kleidungsstück sorgfältig, ob nicht Waffen darin versteckt<br />
seien. Das kam mir geradezu lächerlich vor. Der Wächter befahl mir in<br />
tschechischer Sprache, den Mund aufzumachen. Als ich diesem Befehl nicht sofort<br />
nachkam, weil ich ganz verschwollen war und den Mund voll Blut hatte, versetzte<br />
er mir eine schallende Ohrfeige und gleich darauf eine zweite. Dieser Mann<br />
war ein ganz junger Mensch - er hieß Horak.<br />
Die Zellen, in denen wir saßen, waren in ruhigen Zeiten für vier-sechs Häftlinge<br />
bestimmt gewesen. Nun waren 22-24 Mann darinnen. Dass wir uns zum Schlafen<br />
nicht niederlegen konnten, wird jeder begreifen. Als wir uns etwas beruhigt hatten,<br />
schauten wir uns näher an. Unsere Köpfe waren so verschwollen, dass die<br />
Hüte nicht mehr passten. Wir kannten einer den anderen fast nicht, weil die Gesichter,<br />
Augen und Ohren aufgetrieben waren. Einigen von uns waren Brüche<br />
getreten worden. Dem Schwarzenbergischen Heger Wenzel Aschenbrenner hatten<br />
die Tschechen drei Rippen gebrochen. Er erhielt wochenlang keine ärztliche<br />
Hilfe. Unsere Rücken, Arme und Beine schillerten bald in allen Farben. Aus meinem<br />
linken Ohr floss wochenlang Eiter und Blut.<br />
Am 26.7. wurde ich, obwohl ich noch ganz benommen und verschwollen war,<br />
mit neun Kameraden zur Arbeit in das Aktienbräuhaus kommandiert. Keiner hatte<br />
vorher etwas zu essen bekommen. Wir mussten Kohlen ausladen, Bierfässer<br />
und Flaschen transportieren und Erdarbeiten ausführen. Auch die tschechischen<br />
Arbeiter zeigten kein Mitleid; sie forderten im Gegenteil den Aufseher auf, uns<br />
mehr zur Arbeit anzutreiben. Auf dem Wege zur und von der Arbeit wurden wir<br />
von Schuljungen beschimpft und mit Steinen beworfen, ja, es kam vor, dass erwachsene<br />
Tschechen mitten in unsere Reihen hinein sprangen und einen von uns<br />
ohrfeigten. Wenn wir von der Arbeit heimkamen, wurde wir wieder gründlich<br />
untersucht. Wir durften nur einen Löffel und ein Taschentuch bei uns haben, alles<br />
andere wurde uns abgenommen. Wehe, wenn bei einem ein Zigarettenstummel<br />
gefunden wurde! Beim Eintritt in die Zelle wollte keiner der Letzte sein, weil<br />
dieser gewöhnlich einen Fußtritt in das Hinterteil oder den schweren Schlüsselbund<br />
auf den Kopf geschlagen bekam. Die Verpflegung war vollkommen unzureichend,<br />
Fleisch, Fett, Zucker und Salz gab es für uns nicht. Auch das Deutsch-<br />
Sprechen war streng verboten; dabei verstand der größte Teil der Deutschen nicht<br />
Tschechisch. An manchen Tagen gab es mehr Schläge und Demütigungen als<br />
Essen. Wer das Glück hatte, auswärts arbeiten zu dürfen, der hatte es oft besser,<br />
weil unter den Burschen (es waren meist Burschen. im Alter von 16 Jahren oder<br />
etwas darüber) auch einige vernünftige Menschen waren, die an der Misshandlung<br />
unschuldiger Menschen keine Freude hatten. Aber diejenigen unter uns, die<br />
am Aufbau des durch Bomben beschädigten Kreisgerichtsgebäudes arbeiten<br />
mussten, hatten unter der Rücksichtslosigkeit einzelner Tschechen schwer zu leiden.<br />
Die Antreiberei, die Schläge und Beschimpfungen nahmen den ganzen Tag<br />
kein Ende. Zu diesen Bedauernswerten gehörte auch der Hauptlehrer von Neuofen<br />
bei Oberplan, Johann Moser. Dieser kann bezeugen, dass einmal zwei einarmige<br />
Kriegsversehrte gezwungen wurden, gemeinsam, jeder mit dem gesunden<br />
Arm, eine Scheibtruhe mit Ziegelsteinen zu fahren. Dabei wurden sie zum Laufschritt<br />
angehalten. Der Hauptwüterich und unversöhnlichste Deutschenhasser war<br />
der Oberaufseher Dejchmann. Ihm zur Seite standen einige ebenbürtige Helfershelfer,<br />
deren Namen ich vergessen habe. (Siehe den Aufsatz „Das tschechische<br />
Volksgericht in Budweis“, Oktober 1949!)<br />
Wenn ich mich recht erinnere, hat das tschechische Volksgericht im September<br />
1945 seine hassvolle Tätigkeit aufgenommen. Die geringste Strafe, die dieser<br />
“Gerichtshof” verhängte, waren fünf Jahre. Meist wurden aber 10, 15 und 20<br />
Jahre zudiktiert, recht oft auch lebenslänglich. Dutzende wurden zum Tode verurteilt,<br />
ohne dass wir verstanden, warum. Der erste, der öffentlich hingerichtet<br />
wurde, war ein Tscheche, der sich in der Hitlerzeit als <strong>Deutscher</strong> bekannt und als<br />
Kollaborant sein Leben verwirkt hatte. Er hieß Cerny und lag in meiner Zelle.<br />
Ihm folgten noch viele deutsche Männer, aber auch Frauen und Tschechen. Auch<br />
der Landsmann Kramlinger aus Schwarzbach musste diesen Weg gehen.
144<br />
145<br />
Ma Herrgoutt, sou schwar<br />
Host Da Händ af uns gloat.<br />
Ob schuld oder nit,<br />
koas wird darnoch gfroat. –<br />
Wia ra Trud druckt mi s´Herzweh<br />
Und i derf dou nit schrein.<br />
Sej hant af der paß!<br />
Na, i loß ma nix schein.<br />
Wos nutzert a s´Jammern<br />
Und s´gounz Afbegehrn.<br />
Mir houm hult verspült<br />
Und sej hant hiaz d´Herrn.<br />
Und der Himmel schaut zua!<br />
Worterklärung:<br />
bleamlat = blumig<br />
hobt = hält<br />
Sprengkessl =<br />
Weihwassergefäß<br />
Paner= Puppe<br />
güsnt = jault<br />
Mölher = melken<br />
Lehitzer = Atem<br />
sperri = sperrig<br />
Der Tierpfleger vom Schloß Krummau<br />
füttert den Bären im Bärenzwinger.<br />
Foto: Wolf, Krummau<br />
(Sammlung Reinhold Fink)<br />
Hintaf sitzt nou d’ Ahnl,<br />
hobt si ba der Wied,<br />
i der ounern Händ<br />
hots in Sprengkessl mit.<br />
Die Kloa druckt ihrer Paner,<br />
na, dej gats nit her!<br />
D´ Buam wuint um an Waldl<br />
Und der güsnt nou mehr.<br />
D´Scheckl in Stoll daußt<br />
Plärrt gounz verseßn,<br />
s´Fuattern und s´Mölher,<br />
ulls is heit vergessn.<br />
Und der Himmel schaut zua!<br />
A seltsamer Kommerwogn,<br />
vull Kistn und Pack,<br />
a Pinkl in Saattuach,<br />
vo Lei(n)wand a Sack<br />
Nou a bleamlate Truher,<br />
dos is uns verbliebn.<br />
A sou a schöner Morgn!<br />
Und mir werdn vertriebn?<br />
Und der Himmel schaut zua!<br />
D´Ouchsn zuingt ou<br />
Und i mir drinn is grod<br />
Wia wounns ma in Lehitzer<br />
o´gstößn hot.<br />
Der Wogn rumplt sperri,<br />
mir toppnt hintno.<br />
Hiaz müaß ma furcht –<br />
Und d´Hoamat bleibt do?<br />
Schauts nimmer um,<br />
stoumpfts nochi der Fuhr!<br />
Ulls is hiaz verlorn –<br />
Und der Himml schaut zua!<br />
1946 – a Johr sou schwar wia ra Stoa!<br />
Rosa Tahedl<br />
Auch unser Dorf erlebte im Frühling 1946 sein Golgatha.<br />
Ein Bär im Bärenzwinger des<br />
Schlosses Krummau. Foto: Micko,<br />
Krummau. (Sammlung Reinhold<br />
Fink)
146<br />
147<br />
Der Winter des Jahres 1945 neigte sich dem Ende zu. In diesen Monaten war<br />
Improvisation in jeder Weise notwendig, wenn man überleben wollte. Wir bekamen<br />
die sogenannte Judenkarte, auf der weder Fleisch noch Milch zugeteilt wurde.<br />
Letzteren Mangel konnte man in den Walddörfern schon umgehen, denn in<br />
jedem Stall standen einige Milchkühe, welche den Fettbedarf der Familie immer<br />
deckten. Die zur Ablieferung vorgeschriebene Menge Milch musste nur am Hausbrunnen<br />
etwas gestreckt werden, ehe man sie in den Kannen zur Molkerei ablieferte.<br />
Doch der Fleischgenuss war rar geworden.<br />
Auch aus dem Stall der Adele Kurz - der Name ist bewusst etwas geändert -<br />
hatten die böhmischen Hirten der Weidegenossenschaft das zur Weihnachtsschlachtung<br />
vorgesehene, gemästete Schwein einfach hinausgetrieben und ohne<br />
jede Entschädigung fort gefahren. Eine Kuh mit ihrem Kalb war schon vorher<br />
denselben Weg gegangen. Das war so in jenen rechtlosen Zeiten, und die Adele<br />
musste zusehen, wie sie mit ihren vier Kindern und der alten Schwiegermutter<br />
zurecht kam, Natürlich mussten zuerst die Stallhasen und gelegentlich eine Henne<br />
den Sonntag als Braten heiligen, denn diese Tiere erschienen nicht in den<br />
Zähllisten der regelmäßig prüfenden Staatsorgane. Weil es aber allen Leuten im<br />
Dorf ebenso erging, suchte jeder eine Möglichkeit der heimlichen Selbstversorgung,<br />
So hatte auch die Adele lange schon den Plan, den fetten Hammel, den<br />
Lämmerbock, wie wir daheim sagten - gegen ein frisch geborenes Lämmlein<br />
auszutauschen und ihn „schwarz“ zu schlachten. Das war natürlich hoch gefährlich<br />
und konnte nur in aller Heimlichkeit geschehen. Der frühe Morgen erschien<br />
dazu als die günstigste Zeit, denn da schliefen die Tschechen noch meistens ihren<br />
Rausch aus. So kam der Herrmounn-Vetter bei nachtschlafender Zeit heimlich<br />
ins Haus und der fette Lämmerbock starb „ohne Requiem“. Haut, Kopf und Klauen<br />
„entsorgte“ man schnell im Misthaufen und Adele machte sich sogleich an die<br />
Verarbeitung des Fleisches. Natürlich war ein Räuchern über einige Tage unmöglich,<br />
aber man kannte ja schon die Technik des Konservierens in „Rex- Gläsern“.<br />
Bald stand der erste Schub dieser Gläser zum Auskühlen in der Küche und Adele<br />
machte sich eben daran, die zweite Fleischhälfte zuzubereiten. Da keuchte der<br />
Nachbarsbub in aufgeregtem Lauf zur Tür herein: „D’Viahzöhler kemmant, mit<br />
die Schandarm, s’Lostauto steht schou int beim Boch“. Und weg war er, um andere<br />
Leute zu alarmieren. Da galt es nun schnell zu handeln. Nach der ersten<br />
Schrecksekunde legte Adele los: Zum Vergraben der Gläser blieb keine Zeit, aber....<br />
Da stand der damals moderne, recht tiefe Kinderwagen, in dem der kleine Toni<br />
noch recht gerne herumkutschiert wurde. Den Strohsack heraus, die Rexgläser in<br />
Das Böhmerwaldmuseum Passau besitzt ein Original der Zeitung „Sumavsky<br />
Hrania“ vom 15. März 1946. Das Blatt erschien in Winterberg und wurde im<br />
damals schon enteigneten Verlag Johann Steinbrenner gedruckt. Auf der Seite<br />
drei findet sich unter der Überschrift “Loueni bez slz“ („Abschied ohne Tränen“)<br />
eine Reportage über den Beginn der Aussiedlung in Winterberg am 10. März<br />
1946, die hier in deutscher Übersetzung wiedergegeben wird:<br />
„Dort tief im Böhmerwald...“<br />
Wir sind kein Volk von Grobianen und Sadisten, dass wir uns an Besiegten rächen<br />
oder uns über sie lustig machen. Wir haben volles Verständnis für diejeni-<br />
Ein Aussiedlungsdokument im Böhmerwaldmuseum<br />
Manfred Pranghofer<br />
Man muss sich nur zu helfen wissen - Schreck in der<br />
Morgenstunde<br />
Kinderwindeln gewickelt dafür hinein, damit es nicht „schepperte“, Strohsack<br />
und Polster drüber - und ein Teil der Schlachtung war getarnt. „Wenn du sie im<br />
Hausflur kommen hörst, setzt du den Toni in seine „Scheesn“ (Wagen) und sorgst<br />
dafür, dass er sitzen bleibt“, befahl sie der zehnjährigen Mizzi. „Und lass ihn ja<br />
nicht heraus!“ Nun blieb nur noch die zweite Fleischhälfte zu verstecken. Da<br />
musste die alte Schwiegermutter aushelfen, „Ahnl, öjs legts enk ins Bett!“ - das<br />
Stück Fleisch schlug Adele inzwischen in ein Leintuch, Dann lief sie zum Bett<br />
der Ahnl knöpfte ihr die weiße Nachtjacke auf und legte ihr das „fleischene Wickelkind“<br />
auf den Bauch. Jacke und Zudeck’ drüber, und: „Ahnl, toats fei ‘a<br />
weng jammerdiern, wounn d’Behm do hant!“ Da hörte man schon ein Poltern<br />
auf der Gred - die Kontrolleure waren da. Einige powidakelten draußen im Stall,<br />
zwei gingen durch Stuben und Kammern, öffneten die Schränke und Truhen,<br />
durchwühlten die Schubladen und achteten nicht auf die ängstlichen Kinder im<br />
Herrgottswinkel, auf die Adele beruhigend einredete. Die Mizzi schaukelte den<br />
Toni im Kinderwagen, und die Ahnl stieß mehr als einen „Kreuzseufzer“ aus<br />
ihrer Brust. Der Adele schien es eine Ewigkeit, bis die fremden Männer wieder<br />
das Haus verließen. Diesmal war es noch glimpflich abgegangen, nur ein Paar<br />
gestrickte Wollsocken und ein Schal aus dem Schrank hatten einem so gut gefallen,<br />
dass er beides mitgehen ließ. „Aber dafür haben wir bis über Ostern hinaus<br />
eine gute „Zubuß“ zu Knödel und Kraut“, sagte Adele, als sie die Ahnl von ihrer<br />
„Fleischeslast“ befreite. Die brummte nur: „Sou dreckert is mei weiße Nochtjackn<br />
nou nia gwen. Wosch’s nur glei aus!“ Das war nun für die Adele das kleinste<br />
Übel. Sie konnte gleich den Strohsack aus dem Kinderwagen mit „säubern“, durch<br />
den wohl wegen des warmen Dunstes der Rex-Gläser von Toni, ein Brünnlein<br />
geflossen war. In der Rückschau kann man über solche Episoden jener harten<br />
Zeiten vielleicht lächeln. Wer sie miterlebt hat weiß: Es war ein arger Schreck in<br />
der Morgenstunde.<br />
Rosa Tahedl
148<br />
149<br />
gen, welche heutzutage unschuldig für alle Verbrechen büßen, die von ihren<br />
Stammesgenossen begangen wurden. Aber sieben Jahre waren eine allzu lange<br />
Zeit, um die Erinnerung an sie kurzerhand zu vergessen. Sieben ewige Jahre haben<br />
wir mit zusammengebissenen Zähnen geschwiegen und gelitten an der Front,<br />
im Konzentrationslager und zu Hause. Endlich haben wir sie erwischt...<br />
Winterberg, 10. März 1946. Halb sechs in der Frühe. Im Postamt warten ungeduldig<br />
acht Briefträger. In den ledernen Taschen haben sie geheime Post, bestimmt<br />
für die Winterberger Deutschen. Eine Korrespondenzkarte, die außer den<br />
angeführten notwendigen Reiseutensilien die Mitteilung über die Rückkehr „heim<br />
ins Reich“ enthält. So, endlich also...<br />
Um sechs machten sich die acht Postboten unter polizeilicher Begleitung auf den<br />
Weg, um 628 Deutschen schonend mitzuteilen, dass die Zeit zum Schnüren des<br />
Bündels gekommen war. Knapp nach Mittag brachen einige Lastautos zusammen<br />
mit Pferdegespannen in die Straßen auf, damit ein historischer Akt beginnen<br />
konnte - die erste Abschiebung, Während die Autos und die Wagen sich mit Gepäck<br />
füllten, patrouillierten in den Straßen Militär und Gendarmeriestreifen. Auch<br />
die örtliche Feuerwehrmannschaft und die Mannschaften von benachbarten Wehren<br />
waren in voller Bereitschaft.<br />
Die Abschiebung liegt in der Hand der Sicherheitsorgane der Polizei unter dem<br />
Kommando von Oberwachtmeister Rajmon und des Leiters der Aussiedlung,<br />
Stabswachtmeister Steinhäusl. Zwei Sammellager füllen sich schnell mit neuen<br />
„Ankömmlingen“. Im gut beheizten Sammelsaal arbeitet die Beamtenschaft des<br />
Stadt-Nationalausschusses zusammen mit der Polizei. Bis fünf Uhr abends ist die<br />
erste Belastungsprobe voll gelungen.<br />
Am Montagmorgen, um 8.40 Uhr bringt die erste Fuhre die Übersiedlergruppen<br />
zum Bahnhof. Das komplette Einsteigen in die Waggons ist um 9.58 Uhr beendet.<br />
Um halb elf setzte sich der Eisenbahnzug unter den „Auf Wiedersehen“ - Grüßen<br />
der Winkenden und begleitet von dem Lied „Dort tief im Böhmerwald...“ in Bewegung<br />
auf die Reise, von der es keine Rückkehr gibt.<br />
„Wir besiedeln Südböhmen...“<br />
ist der Titel eines weiteren interessanten Artikels derselben Zeitung. Er stammt<br />
von dem Vorsitzenden des Besiedlungsausschusses der provisorischen Nationalversammlung,<br />
dem Abgeordneten Dr. Al. Neuman. Dort heißt es unter anderem:<br />
Die Voraussetzung für die Besiedlung ist selbstverständlich die Abschiebung der<br />
Deutschen, von denen es hier in Südböhmen noch rund 170 000 gibt, darunter<br />
noch etwa 13 000 Flüchtlinge aus dem Reich. Die genauen Zahlen werden erst<br />
bekannt sein, wenn die gerade laufende Registrierung der Deutschen mittels spezieller<br />
Registrierungszettel abgeschlossen sein wird, welche jetzt bei allen<br />
Nationalausschüssen oder Verwaltungskommissionen in die Form einer Kartei<br />
gebracht werden. Die Karteien werden nach dem Grad der Entbehrlichkeit der<br />
einzelnen Kategorien der deutschen Bevölkerung in einige Gruppen gegliedert.<br />
Die am ehesten entbehrlichen Gruppen werden in die ersten Etappen der Abschiebung<br />
aufgenommen, notwendige Fachkräfte und Spezialisten werden erst<br />
Das bäuerliche Dorf Kleindrosen war eingebettet in eine Senke, vor Nordwind<br />
geschützt durch den vor allem mit Föhren bewaldeten Höhenzug “Gferat”, vor<br />
den Westströmungen durch den Passinger Höhenzug. Lediglich nach Osten hin<br />
war der Talkessel geöffnet. Dort war Grünland mit Bach und Zufahrtsweg Richtung<br />
Wettern. Dieses Dorf, das man auf Grund der geschützten Lage auch “kleinen<br />
Himmel” nannte, war eine geschlossene Ortschaft, bis auf wenige Streuhausstellen.<br />
Die neun vollbäuerlichen Anwesen waren im Familienbesitz, der Güte<br />
Gottes ergeben mit Freude und Umsicht bewirtschaftet. Es handelte sich um Erbhöfe,<br />
die jahrhundertelang innerhalb deutscher Familien weitergegeben wurden.<br />
Die eher wohlhabenden Betriebe waren überwiegend in der Bauart der<br />
Vierkant-höfe angelegt, bis auf wenige Ausnahmen. Durch das Dorf schlängelte<br />
Das Dorf Kleindrosen<br />
Johann und Marie Bürgstein<br />
zuletzt abgeschoben, wenn sie durch Tschechen ersetzt werden können. Für eine<br />
geordnete Abschiebung der Deutschen sind in jedem Landkreis sogenannte<br />
Sammelzentren vorbereitet, wo die zur Aussiedlung Bestimmten rechtzeitig gesammelt<br />
und zur Abschiebung vorbereitet werden. Die Sammlung der Deutschen<br />
in den Sammelzentren wird nach zuvor eingehend ausgearbeiteten Plänen und<br />
nach den Bestimmungen der durch die Regierung erlassenen Richtlinien durchgeführt.<br />
In den Sammelzentren wird gebührend für die entsprechende medizinische<br />
Versorgung, Unterbringung und angemessene Verpflegung der Aussiedler<br />
gesorgt. Die Vorbereitung und Durchführung der Abschiebung wird<br />
begreiflicherweise einen großen Arbeitsaufwand aller beteiligten Organe erfordern<br />
und zwar in erster Linie bei den Nationalausschüssen und Verwaltungskommissionen,<br />
bei der Polizei und bei den Militär- und Eisenbahnverwaltungen.<br />
Die gesamte Abschiebung wird das Innenministerium durch seine bevollmächtigten<br />
Organe bei den Gebietsbesiedlungsstellen leiten, die bereits heute in Zusammenarbeit<br />
mit den Nationalausschüssen und Kommissionen sorgfältig den<br />
Aussiedlungsplan für ihre Bereiche vorbereiten. Für Südböhmen wurde die<br />
Gebietsbesiedlungsstelle in Budweis eingerichtet. In ihren Wirkungskreis fallen<br />
die Landkreise Budweis, Kaplitz, Krummau, Prachatitz, Schüttenhofen, Blatna,<br />
Strakonitz, Pisek, Moldautein, Neuhaus, Wittingau und Tabor. Die Auswahl der<br />
zur Abschiebung bestimmten Personen wird sich nach dem Grad der Entbehrlichkeit<br />
richten und danach, wie die fortschreitende Besiedlung es erfordern wird.<br />
Von der Abschiebung wird nur eine beschränkte Zahl derer ausgenommen, für<br />
die der Nationalausschuss des Landkreises oder die Kommission zusammen mit<br />
dem Innenministerium die vorgeschriebenen Bescheinigungen über die Wahrung<br />
oder den Rückerhalt der Staatsbürgerschaft ausstellen.
150<br />
151<br />
sich das Bächlein mit seinem silbrigen, frischen Wasser, das aus den Quellen der<br />
näheren und weiteren Umgebung unermüdlich sprudelte. Durch diesen Bach war<br />
die Wasserversorgung der Höfe und Häuser gesichert, die zum Teil einen direkten<br />
Zufluss hatten oder durch Pumpen bedient werden konnten. Auch ein Futtermehlstampfer<br />
wurde durch diese Wasserkraft angetrieben und ein Löschteich<br />
gespeist. Dieser war ein beliebter Tummelplatz für das schwimmende Ferdervieh.<br />
Zur Ortsmitte gehörte auch ein Bildstock mit der Muttergottes, Platz für ein stilles<br />
Gebet und in den Sommermonaten für das Rosenkranz-Beten an jedem Sonntag<br />
Abend. Dort, wo uns bei Besuchen Erinnerungen an eine unbeschwerte Kindheit<br />
einholen, an die alten Wege, die heute keine mehr sind, ist es fremd und kahl<br />
gewor-den. Verweilt man auf der Anhöhe nach Pasern hin und lässt die Blicke<br />
schweifen bis hin zum Dörflein, so findet man nur mehr Gestrüpp und Geröllhaufen,<br />
wo die Bewohner früher ihren Besitz hegten, ohne dass es jemand wagen<br />
konnte, ihnen diesen streitig zu machen. Jener Bach, der über den Tuscherbach<br />
bei Ebenau in die Moldau mündet, schlängelt sich heute einsam durch das<br />
zerschundene Tal.<br />
Zu den Bildern: Oben: Kleindrosen wie es war, Häuser Nr.6, 5 und 2<br />
Rechts oben: Kleindrosen heute<br />
Rechts unten: Bildstock von Kleindrosen heute (Bildgaben Johann Bürgstein)
152<br />
153<br />
Es fällt mir nicht leicht über die Zeit nach der Vertreibung fast aller Deutschen<br />
aus meinem Heimatdorf Guthausen zu schreiben, aber um der erlebten Wahrheit<br />
willen muss es einmal geschehen. Ich will es sachlich und ohne Emotionen tun.<br />
Die Jahre haben Vieles in der Erinnerung abgemildert.<br />
Der Bericht bezieht sich hauptsächlich auf den Landkreis Prachatitz - die Verhältnisse<br />
werden wohl in anderen Gegenden des Sudetengebietes ähnlich gewesen<br />
sein.<br />
Der letzte Aussiedlungstransport aus dem Wallerer Lager war am 10. Oktober<br />
1946. Das Lager bestand noch bis um die Mitte Dezember, wo es offiziell aufgelöst<br />
wurde. Die restlichen etwa 70 Deutschen - meistens waren es Familien, die<br />
wegen des Fehlens des Haupternährers von den Amerikanern in Furth i.W. nicht<br />
angenommen worden wären, wurden als „zwangsverpflichtete“ Arbeitskräfte zu<br />
Bauern ins böhmische Niederland abtransportiert. Sie waren nur die Vorhut jener,<br />
bei denen sich nun „der Transfer“ in andere Richtung ins Landesinnere anbot.<br />
Über die noch verbliebenen Deutschen einige Zahlenangaben: Bei der Volkszählung<br />
im Jahre 1939 lebten im damaligen Landkreis Prachatitz im reichsdeutschen<br />
Gebiet (ohne die Gemeinden nach der Errichtung des Protktorates, die waren<br />
tschechisch, aber mit den Gemeinden Neuthal, Tusset, Humwald und Schönau)<br />
38 214 Personen, davon 37 388 Deutsche und 826 Tschechen (die für Deutschland<br />
optiert hatten)<br />
Im Jahre 1961 lebten im Landkreis noch etwa 770 Deutsche (1,6 % ).<br />
Im Jahre 1991 nur mehr 0,9 % und im Jahre 2001 nur 0,46 % Deutsche.<br />
Diese Angaben stammen aus dem Bezirksarchiv Prachatitz.<br />
Nach der Ausweisung des größten Teils der deutschen Bevölkerung begannen<br />
die Tschechen mit der Neubesiedelung der zum Teil menschenleeren Dörfer. Das<br />
gelang nur sehr zögerlich, denn nur selten wollte sich jemand den schweren Lebensbedingungen<br />
im Böhmerwald stellen. So blieb das Gebiet der Ausplünderung<br />
„der Goldgräber“ überlassen. Ich fasse zusammen: „Sie kamen, sahen, nahmen<br />
und gingen“. Selten blieb jemand über den Winter dort, die neuen Siedler<br />
wanderten oft wie die Zugvögel. Ich führe nur die Nationen an, welche damals<br />
der Reihe nach in mein Heimatdorf kamen: Tschechen, Slowaken, Rumänen,<br />
Bulgaren, Ungarn, Ukrainer (Rusinier) aus der abgetretenen Karpathoukraine,<br />
Deutsche und Zigeuner. Dieses Zusammenleben gestaltete sich natürlich in den<br />
einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich; die Städte hatten vorwiegend eine<br />
tschechische Bevölkerung. Ich werde mich lieber mit den zurückgebliebenen<br />
Deutschen befassen. Alle waren der Meinung: „Hauptsächlich den Winter überdauern,<br />
im Frühling sieht man dann weiter. Die Aussiedlung kann nur eine vorübergehende<br />
Sache sein und eine Willkür der Tschechen. Unsere Leute kommen<br />
Wie es daheim nach dem Ende der Vertreibung<br />
weiterging<br />
wieder zurück. Wer würde denn die Arbeit hier machen?“ So hielten sie trotz<br />
aller Schikanen aus. Sie ließen aber ihr Aussiedlungsgepäck immer vorbereitet in<br />
den Stuben, denn man wusste nie, was denn Behörden einfiel. Die soziologische<br />
Zusammensetzung der Gruppe war ganz einfach. Alle ohne Unterschied standen<br />
vor dem Nichts und konnten nur durch ihrer Hände Arbeit bestehen. Es gab fast<br />
in jedem Dorf noch deutsche Familien, welche man wegen ihrer Arbeitsleistung,<br />
zurückbehalten hatte. Meistens waren das Facharbeiter: in Winterberg die Buchdrucker<br />
bei Steinbrenner, die Glasmacher in Adolf- und Eleonorenhain, die Holzhauer<br />
in fast allen Revieren und die Arbeiter in der Tusseter Holzfabrik. Die Letzteren<br />
hat man dann schon im nächsten Jahr entfernt. In einer Nacht und Nebelaktion<br />
wurden sie alle aus Tusset und Neuthal mit dem Zug binnen zwei Stunden<br />
in die Krummauer Umgebung zur Landwirtschaft verfrachtet. Die nächste Gruppe<br />
waren Familien mit österreichischer Staatsbürgerschaft, deren Weggang in den<br />
nachfolgenden Jahren einsetzte. Eine andere Gruppe waren die Restfamilien der<br />
Internierten und Verurteilten, welche man bei den Transporten nicht wegschaffen<br />
konnte, denn der Haupternährer fehlte und die Amerikaner nahmen sie in Furth<br />
i.W. beim Grenzübergang nicht an. Das waren fast nur Frauen und Kinder. Dann<br />
gab es noch die kleine Gruppe der Antifaschisten, welche die tschechoslowakische<br />
Staatsbürgerschaft wieder erhalten hatte. Ein Zug mit sozialdemokratischen<br />
Antifaschisten aus Wallern und Umgebung mit 228 Personen (81 Familien) war<br />
am 4.10.1946 nach Passau ausgesiedelt worden und ein anderer Zug mit kommunistischen<br />
96 Personen war in die damalige Ostzone weggefahren. Es gab auch<br />
solche Transporte aus Winterberg und der Umgebung von Prachatitz. So war die<br />
Lage nach der offiziellen Beendigung der Aussiedlung. Die Zurückgebliebenen<br />
mussten das ganze Elend der Zerstörung mit ansehen und es kursierten die wildesten<br />
Gerüchte. Es bestand zwar eine Postverbindung mit den ausgesiedelten<br />
Verwandten, aber alle Briefe in beide Richtungen wurden zensiert. So wurden z.<br />
B. von der Staatssicherheit nur in Wallern 1947 im Juni 623 Briefe zensiert, im<br />
Juli 552 Briefe, im September 410 Briefe. Die Tschechen erfuhren also jede private<br />
Kleinigkeiten, meistens waren es ohnehin nur Schilderungen der Not auf<br />
beiden Seiten der Grenze. Noch im Dezember 1947 wurden 509 Briefe geöffnet.<br />
Natürlich wurden auch welche einbehalten und erreichten den Empfänger nicht.<br />
Die Zensur der Briefe über die verschiedenen Postämter des Landkreises dauerte<br />
bis gegen 1960. Natürlich merkten es die Leute und verhielten sich entsprechend<br />
vorsichtig. Ein besonders schweres Los mussten die Kinder ertragen. Nachdem<br />
sie fast zwei Jahre (1945 - 1946) überhaupt nicht zur Schule gehen durften, hieß<br />
es im Herbst 1947 plötzlich, alle müssten in die tschechische Schule gehen, auch<br />
wenn sie kein Wort der Sprache verstanden. So kam es, dass auch die Schulanfänger<br />
einen täglichen Schulweg von 6 km zu Fuß bewältigen mussten und<br />
manchmal vor Müdigkeit in der Klasse einschliefen, wenn sie kein Wort des<br />
Unterrichts verstanden. Da muss ich anerkennend die tschechischen Lehrkräfte<br />
loben, welche überwiegend sehr verständnisvoll zu den deutschen Kindern waren.<br />
Diese waren ja auch willig und in ihrer Begabung dem Lehrstoff gewachsen.<br />
Rosa Tahedl
154<br />
155<br />
So dauerte es nur einige Monate bis sie sich in der fremden Sprache verständigen<br />
konnten. Ihre Eltern aber hatten weiterhin mit der Diskriminierung zu kämpfen<br />
und galten auf Grund der so genannten Restitutionsdekrete (Benesch-Dekrete)<br />
als „vogelfrei“. Weil sich der Mangel an Arbeitskräften überall katastrophal bemerkbar<br />
machte, brauchte man die fleißigen Menschen dringend. Andererseits<br />
wollten die wenigen Neusiedler sie im Grenzgebiet loswerden. So kam nun der<br />
Transfer in Gegenrichtung ins Landesinnere. In Eleonorenhain war in der Glasfabrik,<br />
bei den Glasarbeitern noch so eine „deutsche Insel“, die man unbedingt<br />
dezimieren wollte. Familienweise wurden einige der Facharbeiter in innerböhmische<br />
Glashütten verschickt. Ihre Kinder mussten wieder eine neue Schule<br />
in fremder Umgebung besuchen. Die Wohnungen dort waren primitiv und entsprachen<br />
in keiner Weise der Lebensart in Eleonorenhain. So blieben zum Jahresende<br />
1947 nur mehr 97 Deutsche „auf der Hüttn“. Auch die Holzhauer in den<br />
Dörfern spürten bald die neue Taktik: Dezimierung durch Umsiedlung ins Inland.<br />
Die Bauern dort hatten ihre Arbeitskräfte schon 1945 zum großen Teil verloren,<br />
weil die als „Hausbesetzer“ ins Grenzland gegangen waren. Die dafür<br />
zwangsweise verpflichteten Deutschen - manchmal ganze Familien - waren im<br />
Zuge der Aussiedlung weggeholt worden und zum Teil heimlich über die grüne<br />
Grenze gegangen. Jetzt brachte man Ersatz und holte sich den auf Lastautos aus<br />
dem Grenzgebiet. Sogar deutsch/tschechische Mischehen wurden von dieser<br />
Aktion erfasst. Kein Wunder, dass sich unter den verbliebenen Deutschen zunehmend<br />
der Drang verstärkte, über die Grenze nach Bayern zu kommen. Weil es<br />
legal durch die Weiterführung der Transporte nicht mehr ging, versuchte man es<br />
illegal. So gingen z.B. aus Eleonorenhain im April 1948 in der Nacht an die 30<br />
Deutsche heimlich über die Grenze. Man versuchte Gendarmerie und vor allem<br />
Grenzwachen zu bestechen um wegzukommen, bevor man ins Inland mit dem<br />
Aussiedlungsgepäck abgeholt wurde. Nur zögerlich konnten heimkommende<br />
Internierte auf amtlichem Weg ihren schon ausgesiedelten Familien folgen, für<br />
die andern ging gar nichts. Im Sommer 1947 wurden noch mehrere Familien aus<br />
Wallern, Humwald, Leimsgrub und andere in die Umgebung von Wällischbirken<br />
deportiert. Manche kamen noch weiter bis Pisek und Milevsko. Es kam immer<br />
darauf an, wen dieses traurige Schicksal auf Grund willkührlicher Auslese durch<br />
die Obrigkeit erfasste. Da nützte oft die beste Arbeitsleistung oder das Fachwissen<br />
nichts. Man musste denn zusehen, dass man die so genannte Obrigkeit mit<br />
Geld oder hauptsächlich mit Naturalien „schmierte“ – dann wurde man wenigstens<br />
eine Zeit lang zurückgestellt und konnte bleiben. Es gab für die Tschechen nach<br />
1947, als die Amerikaner die Aussiedlung für beendet erklärten, zwei Gründe für<br />
diese neuerliche „wilde“ Vertreibung: 1. wollte man im Inland Arbeitskräfte haben<br />
und die Zerstreuung der Leute in alle Himmelsrichtungen erwirken, und 2.<br />
fürchtete man Kontakte der Menschen mit ihren ausgewiesenen Bekannten oder<br />
sogar Racheakte dieser Menschen. Kein Wunder, dass unsere Leute, die allem<br />
hilflos ausgeliefert waren, darauf drängten nach Deutschland wegzukommen, aber<br />
da ging amtlich nichts mehr. Besonders als im Frühling 1948 die Rekrutierung<br />
für die Urangruben bei Joachimsthal begann. Diese standen schon unter russischer<br />
Verwaltung und brauchten Arbeitskräfte. Die dort eingesetzten deutschen<br />
Kriegsgefangenen hatte man entlassen müssen und brauchte nun Ersatz. Alle erwachsenen<br />
Deutschen wurden familienweise vorgeladen, ärztlich auf Arbeitstauglichkeit<br />
untersucht – ich übrigens auch -. Am 4.10.1948 ging vor Wallern aus<br />
ein Transportzug ganzer Familien mit Sack und Pack wie zur Aussiedlung ab ins<br />
Erzgebirge. Von allen Richtungen kamen Deutsche nun in die Umgebung von<br />
Joachimsthal. Weipert und umliegende Dörfer im Erzgebirge, wo die Menschen<br />
weg waren, wurden wieder deutsch. Alles, was arbeiten konnte – auch Frauen –<br />
wurde bei der Urangewinnung und Sortierung aus der Pechblende eingesetzt.<br />
Mit primitivsten Werkzeugen wurde ohne jeden Schutz im Stollen gegraben. Folgeschäden<br />
als Krankheit trug jeder davon. In den Fünfzigerjahren arbeiteten dort<br />
auch schon viele tschechische Sträflinge, die nach der kommunistischen Feberrevolution<br />
mit den neuen Enteignungsgesetzen in Konflikt gekommen waren.<br />
Wir Deutsche empfanden die Feberrevolution als Angelegenheit, die uns nichts<br />
anging. Wir hatten ja nichts mehr, was man enteignen konnte. Man wunderte sich<br />
nur, dass ehemalige Stadtgrößen und Verwalter- sogar Gendarmen – plötzlich als<br />
Hilfsarbeiter in unserem Revier auftauchten. Man konnte sich oft der Schadenfreude<br />
nur schwer erwehren. Es war jedoch kaum Zeit, sich näher mit dem Umsturz<br />
zu befassen, denn schon im Sommer 1947 setzte im Wald eine ungeheure<br />
Borkenkäferplage ein, die jahrelang den Wald bedrohte. Da waren nun fachkundige<br />
Holzhauer unersetzlich. Es kamen zwar wegen des guten Verdienstes Saisonarbeiter<br />
aus der Slowakei her, aber der Käfer war weitgreifender und bewahrte<br />
unsere Waldarbeiterpartie vor der Verschleppung ins Landesinnere. Diese Bedrohung<br />
ging auch in den Fünfzigerjahren weiter. Man war nie sicher, ob man<br />
denunziert, abgeholt und „umgesiedelt“ wird. Nur die unermüdliche Arbeit konnte<br />
davor bewahren, sechs Tage in der Woche von früh bis abends war Planerfüllung<br />
im Forst oder in der Glasfabrik angesagt. Trotzdem erwarben sich die Deutschen<br />
als Arbeiter einen guten Ruf und konnten sich auf der untersten sozialen Stufe<br />
stehend auch wirtschaftlich behaupten. Das war allerdings ein zweischneidiges<br />
Schwert, denn wegen der guten Arbeitsleistung bekam niemand die so sehr gewünschte<br />
Aussiedlungsgenehmigung.<br />
Aus der Post der Verwandten wusste man inzwischen, dass dort der Aufbau einer<br />
neuen Existenz voranging, an Rückkehr dachte niemand mehr. Hier ging die Zerstörung<br />
weiter und jeder wollte weg. Das Ansuchen war mit großen Schwierigkeiten<br />
verbunden. Hausdurchsuchungen „mit den bekannten Folgen“ kamen<br />
wieder in Schwung. Man lebte – wie auch die Tschechen – als Gefangene des<br />
Regimes. In dieser Minderheit in der Diaspora hielten alle zusammen, wie man<br />
das heute gar nicht mehr kennt. Die Schicksalsgemeinschaft schweißte zusammen.<br />
Man durfte keine Veranstaltungen besuchen, aber nach dem sonntäglichem<br />
Gottesdienst – Not lehrt beten! – war an einem bestimmten Eck des Stadtplatzes<br />
der Versammlungspunkt, wo man ungestört vor der allgegenwärtigen Geheimpolizei<br />
Informationen austauschen konnte. Es gab keine deutschen Zeitungen (nur
156<br />
157<br />
Der folgende Aufsatz versteht sich als Ergänzung zu dem Artikel im „Erzieherbrief“<br />
vom Jänner 1999 „Die Wiederbesiedlung der ehemals von Deutschen besiedelten<br />
Randgebiete der Tschechischen Republik nach 1945“ von Tomas<br />
Havlaschek:<br />
Die Einführung in die Thematik erscheint mir korrekt, wenn auch sehr eng zusammengefasst.<br />
Über die Frage der Wiederbesiedlung der durch die Vertreibung<br />
der Deutschen z.T. fast menschenleeren Gebiete im Sudetenland kann ich zwar<br />
nicht mit Zahlen operieren, denn seinerzeit fehlte mir der Zugang zu statistischen<br />
Die Wiederbesiedlung des Sudetenlandes<br />
Rosa Tahedl<br />
Daten, die in der Öffentlichkeit nie richtig angegeben wurden, aber ich kann sehr<br />
wohl als Zeitzeugin jener Vorgänge gelten, denn ich lebte bis zum Jahre 1964 in<br />
dem Dorf Guthausen im Böhmerwald. Dieses Dorf lag in der so genannten militärischen<br />
Grenzzone, sodass ich über die Wiederbesiedlung des Böhmerwaldes<br />
aus eigener Erfahrung berichten kann. Von den anderen sudetendeutschen Randgebieten<br />
Böhmens weiß ich nur, dass die Neubesiedlung ähnlich verlief mit Ausnahme<br />
des Raumes um St. Joachimsthal, wo im Erzgebirge - z. B. Weipert - ganze<br />
Dörfer in den Jahren 1947/48 von zwangsweise dort eingelieferten deutschen<br />
Familien, welche in den Urangruben arbeiten mussten, neu besiedelt wurden.<br />
Die Besitznahme der Tschechen in den deutschen Randgebieten Böhmens nach<br />
Kriegsende ist noch in der Erinnerung der deutschen Bevölkerung lebendig, ich<br />
will darauf nicht näher eingehen. Es waren, wie in dem Artikel richtig angegeben,<br />
in der Hauptsache Tschechen, welche aus den tschechischen Anrainerdörfern<br />
kamen und mittels des eroberten deutschen Besitzes einen sozialen und wirtschaftlichen<br />
Aufstieg erreichen wollten, was ihnen auch gelang. Dabei emigrierten<br />
sie zum größten Teil in die deutschen Grenzstädte und deren Umgebung. In<br />
die grenznahen Dörfer kamen sie nur als Staatsbeamte oder Verwalter deutscher<br />
Wirtschaftsbetriebe. So begann dort, wie schon in der ersten csl. Republik, der<br />
Drang, alle sozial höher gestellten Positionen durch Tschechen zu besetzen. Dem<br />
kam ab 1947 der Zuzug von slowakischen Reemigranten zugute, denn die an-<br />
später eine staatskonforme „Aufbau und Frieden“), aber im Radio konnte man<br />
heimlich Österreich und Bayern hören. Auch praktische Tipps wurden in dieser<br />
Notzeit ausgetauscht. Wo bekommt man Hamsterware gegen Holz und Glas?<br />
Wer kann Schuhe besohlen? Wer fertigt Holzschuhe? Wer kann Ausreisegesuche<br />
und anderes Schriftzeug tschechisch ausfüllen, usw.? Die Gesuche wurden ohnehin<br />
stets ohne jede Begründung abgelehnt. Die Gebühren dabei waren sehr hoch und<br />
die Unterlagen schwer zu beschaffen. Es gab in dieser Mangelzeit keine Handwerksbetriebe<br />
mehr, man war in allen Bedürfnissen ganz auf die eigene<br />
Gestaltungskraft angewiesen. Manchmal traf man sich bei Wallfahrten nach Gojau<br />
oder zum hl. Berg; auch zu Begräbnissen kam die Notgemeinschaft immer zusammen.<br />
Urlaub kannte keiner, aber irgendwie klappte es doch an früheren großen<br />
Feiertagen von der Arbeit auszureißen. Der Sonntag war der einzige freie<br />
Tag, an dem man auch einmal in Frauenkleidern statt der Pechhosen ging und<br />
sich bei Bekannten ein Buch zu leihen nahm, das man zwar von früher meistens<br />
kannte, aber jetzt als „Speise der Seele“ empfand. Denn nach Errichtung des<br />
Eisernen Vorhangs wurde die Aussicht auf ein Wegkommen aus diesem Staatskerker<br />
immer kleiner. So vergingen die Jahre in Einerlei der Arbeit und der dörflichen<br />
Verlassenheit. Man hatte gelernt, alle Geschicklichkeit und alles Wissen<br />
zum Überleben einzusetzen. Das strenge Regime der Kommunisten lockerte sich<br />
zu Beginn der Sechzigerjahre uns Deutschen gegenüber etwas auf. Es begann<br />
erst zögerlich Aussiedlungsbewilligungen für alte Leute, die man wegen ihrer<br />
Rente loswerden wollte. Da wittere ich meine Chance und bekam endlich „als<br />
Kind“ mit meinem Vater die Bewilligung zur Ausreise in die Bundesrepublik.<br />
Fast zwei Jahrzehnte einer Fron, von der ich nie geglaubt hätte sie aushalten zu<br />
können, gingen für mich im Jahre 1964 zu Ende.<br />
Quellen: Statistische Zahlen aus dem Bezirksarchiv Prachatitz<br />
Übersetzung der Sammlung „Zlata stezka“. (Goldener Steig) Jahrgang 2001 -<br />
2002 (2003)<br />
Pferde spielten beim Hochzeitszug bei der Budweiser Sprachinsel eine<br />
herausragende Rolle.Künstlerkarte von G. Moest, herausgegeben vom<br />
früheren Deutschen <strong>Böhmerwaldbund</strong>. (Sammlung Reinhold Fink)
158<br />
159<br />
geworbenen Slowaken aus den Donaugebieten Jugoslawiens und vor allem Rumäniens,<br />
welche man ausschließlich in fast leeren Dörfern unterbrachte, ordneten<br />
sich mehr oder weniger willig der tschechischen Dominanz unter. Sie konnten<br />
ja auch nicht mehr zurück. Neusiedler, welche aus der Slowakei gekommen<br />
waren, vermissten bald das Fehlen ihrer doch sehr traditionell gebundenen Lebensweise<br />
und kehrten zu einem Großteil nach ein, zwei Jahren in ihre Heimatdörfer<br />
zurück. Dass dabei Baumaterial und ähnliches waggonweise mitging, ist<br />
selbstverständlich.<br />
Als sich in den nachfolgenden Jahren das Fehlen der deutschen Arbeitskräfte<br />
katastrophal im Westen der Republik bemerkbar machte, setzte bei den Slowaken<br />
vor allem in der Forstwirtschaft ein neuer Trend ein: Sie kamen als Saisonarbeiter<br />
ins Grenzgebiet. Borkenkäferbefall und andere Kalamitäten brachten durch Akkordarbeit<br />
einen guten Verdienst. So nahmen sie die primitiven Verhältnisse und<br />
auch die Dominanz der tschechischen Oberschicht auf sich, kehrten im Herbst<br />
mit blankem Lohn heim und erbauten in ihren slowakischen Dörfern schmucke<br />
Siedlungen. Als sich auch in der einst so blühenden Industrie des Sudetenlandes<br />
das Fehlen der Fachkräfte katastrophal bemerkbar machte, sah sich die Regierung<br />
genötigt, viele Betriebe der Textilindustrie, des Maschinenbaues und der<br />
Schwerindustrie in die Slowakei, die vorher reines Agrarland war, zu verlagern.<br />
Es begann dort eine positive Weiterentwicklung, während in Böhmen und Mähren<br />
der wirtschaftliche Niedergang einsetzte. Dazu kam, dass die Kollektivierung<br />
der Landwirtschaft in der Slowakei viel später als in Böhmen einsetzte. Die Slowakei<br />
gewann dadurch in ihrem Gebiet zum Nachteil der böhmischen Landstriche.<br />
Schon damals - in den ersten Jahren nach Kriegsende - beobachtete ich den Spalt<br />
in der so genannten tschechoslowakischen Nation, jener nach 1918 künstlich geschaffenen<br />
Bezeichnung zweier Völker. Während aber die Tschechen in den 20<br />
Jahren des Bestehens der ersten csl. Republik die Slowakei als eine Art Kolonie<br />
unterbewerteten, wurde jetzt - die Gründe sind sicher vielfältig, sie mögen gesondert<br />
angesprochen werden - der östliche Teil der Republik zu einem selbstbewussten<br />
und in zunehmendem Maße dominierenden Partner des Staatsvolkes.<br />
Nur im Sudetengebiet, dessen Neusiedler immer eine heterogene Gesellschaft<br />
bildeten, blieb der Anspruch des tschechischen Teils auf die soziale Höherstellung<br />
erhalten, denn die so genannte Arbeiterklasse bildete im böhmischen Grenzgebiet<br />
bald ein buntes Völkergemisch aller Balkanstaaten - von Griechenland bis<br />
Österreich. Die Fluktuation war sehr groß; jeder jagte einem schnellen Verdienst<br />
nach, von planmäßiger Besiedlung konnte man in jener Zeit nicht sprechen. Erst<br />
als zu Beginn der 50er Jahre der Kommunismus sich endgültig etabliert hatte,<br />
und das Sudetengebiet schon einsam und ausgeplündert war, setzte die Planwirtschaft<br />
auch mit Versuchen einer planmäßigen Besiedlung ein.<br />
Vom zentralistischen Prag ausgehend, wurden in Zeitabständen der Fünfjahres-<br />
Pläne immer wieder neue Aktionen zur Besiedlung der Grenzgebiete gestartet.<br />
Mit vielen Versprechungen wurde z. B. eine Pionieraktion nach russischem Vor-<br />
bild eingeleitet. Junge Leute beiderlei Geschlechts wurden in die leeren Dörfer<br />
geschickt. Man versprach ihnen, dass sie nach diesem „Arbeitsdienst“ bessere<br />
Berufschancen hätten. Dabei waren im Grenzgebiet längst alle Kleinbetriebe,<br />
Werkstätten, Sägewerke und Geschäfte geschlossen. Es existierte im wesentlichen<br />
nur mehr der landwirtschaftliche Kolchos und die Forstverwaltung. Mit den<br />
primitivsten Mitteln versuchten die jungen Leute die Staatsgüter einigermaßen in<br />
Schwung zu bringen. Unsummen steckte der Staat in den 50er Jahren in die Reparatur<br />
der Unterkünfte. Aber der jugendliche Elan verflog bald angesichts der<br />
rauhen Wirklichkeit, und nach einigen Jahren waren fast alle wieder weg.<br />
Dann folgte die Aktion „Junge Familien“ - mit großem, finanziellen Anreiz wurden<br />
sie ins Grenzgebiet gelockt. Sogar Zwergschulen wurden in den Dörfern<br />
wieder eröffnet. Aber wer wollte schon auf Dauer dort bleiben, wo nur einmal in<br />
der Woche ein fliegender Händler mit den notdürftigsten Waren hinfuhr, und ein<br />
Arzt- oder Zahnarztbesuch eine halbe Tagesreise bedeutete. Dazu kamen noch<br />
die politischen Erschwernisse in der Grenzzone rechts der Moldau, welche hier<br />
besonders prekär gehandhabt wurden, mit peinlicher Überwachung, Ausspähung<br />
und Kontrolle. So blieben auf Dauer eben nur jene Familien, welche auf Grund<br />
ihrer Arbeitsleistung oder als Staatsangestellte gezwungen waren auszuharren,<br />
während die Arbeiter besonders der Staatsgüter nur saisonweise dort aushielten.<br />
Im Staatsforst, wo bei Akkordarbeit doch eine einigermaßen gute Verdienstmöglichkeit<br />
bestand - allerdings bei schwerer, körperlicher Plage - war man an<br />
Arbeitsverträge gebunden. Die Arbeit in der Landwirtschaft der Kolchosen jedoch<br />
war sehr schlecht bezahlt. Es herrschten die chaotischen Verhältnisse der<br />
Planwirtschaft, sodass die Landarbeiter ständig von einem Gut zum anderen pendelten<br />
und selten länger als einen Sommer im Dorf blieben.<br />
Diese Wanderlust kam natürlich einer Bevölkerungsgruppe sehr entgegen den<br />
Zigeunern. Den Begriff „Sinti“ oder „Roma“ kannte man damals weder in der<br />
tschechischen noch in der deutschen Bezeichnung. Sie füllten den Sommer über<br />
doch die Lücken in der Landarbeitergruppe aus, blieben dabei auf Grund ihrer<br />
schlechten Ausbildung immer auf der untersten Sozialstufe und ließen sich leicht<br />
dirigieren. Es gab zwar Versuche, sie zu fördern. So wurden für minderjährige<br />
Jungen in Sablat, Neuofen und Polletitz so genannte Förderheime errichtet, wo<br />
die Burschen einen landwirtschaftlichen Beruf erlernen sollten. Die beiden ersteren<br />
bestanden nicht allzu lange, dann brannten sie ab. Das ganze Förderprojekt<br />
versickerte wie alle ähnlichen Maßnahmen, die Unsummen kosteten, im Sand<br />
der Vergänglichkeit.<br />
Zu Beginn der 60er Jahre kam in die Böhmerwaldstädte eine neue Gruppe von<br />
Bewohnern, die Offiziere der Grenztruppen mit ihren Familien. Städte und Marktflecken<br />
wurden zu Garnisonen, von denen aus man das Militär als Grenzbewacher<br />
in die Militärzone schickte. Dabei eine Bemerkung zu dem angeführtem Artikel:<br />
Das Grenzgebiet war in Zonen eingeteilt. Der niederlandnahe Teil war frei zugänglich,<br />
wenn man auch stets einer Personenkontrolle ausgesetzt war. Daran<br />
folgte bei uns rechts der Moldau die durch Absperrungstafeln gekennzeichnete
160<br />
161<br />
Grenzzone. Sie war etwa acht Kilometer breit und durfte nur mit Ausweis betreten<br />
werden. Daran schloss sich die menschenleere, etwa drei Kilometer breite,<br />
und nur dem Militär zugängliche Sperrzone.<br />
Die Soldaten waren in Kasernen untergebracht und zum größten Teil Slowaken.<br />
Die tschechischen Offiziersfamilien bildeten in den Garnisonen mit der ansässigen<br />
Parteihierarchie bald eine eigene Klasse, die sich von der übrigen Zivilbevölkerung<br />
stark abgrenzte, z.B. mit eigenen Klubs, besonderen und besser versorgten<br />
Einkaufsgeschäften und Unterhaltungen. Man konnte durchaus von einer<br />
Exklusivkaste innerhalb der offiziell benannten „Arbeiterklasse“ sprechen.<br />
Zu den Rest-Deutschen im Sudetengebiet: Man sprach von etwa 150.000 Personen.<br />
Sie wohnten natürlich verstreut über das ganze Grenzgebiet. Die größte Gruppe<br />
waren die von der Ausweisung zurückgestellten Facharbeiter, zu denen auch<br />
unsere Familie gehörte; eine kleinere Gruppe waren die anerkannten Antifaschisten;<br />
die dritte Gruppe waren zur Zwangsarbeit nach Innerböhmen verschleppte<br />
Familien, welche auf Umwegen wieder in den Böhmerwald zurückfanden und<br />
die österreichischen Staatsbürger, die man allerdings oft durch starken Druck zur<br />
Auswanderung nach Österreich gezwungen hat. Der größte Teil dieser Menschen,<br />
die sich auch amtlich als Deutsche bekannten, obzwar man ihnen zu Beginn der<br />
50er Jahre mit Zwang die csl. Staatsbürgerschaft aufoktruiert hatte, reichte laufend<br />
Auswanderungsgesuehe in die Bundesrepublik ein, welche ausnahmslos und<br />
ohne Begründung abgewiesen wurden. Erst in den 60er Jahren konnten zuerst<br />
Rentner und später durch Vermittlung des Roten Kreuzes ganze Familien die<br />
Ausreise erreichen. So kam auch ich im Jahre 1964 in die Bundesrepublik.<br />
In der Dubtschek-Ära, als der Zutritt in die Grenzgebiete Böhmens doch wesentlich<br />
erleichtert wurde, setzte dort eine neue Besiedlungswelle ein. Es waren zwar<br />
viele grenznahe Dörfer vollkommen zerstört, aber einzelne Orte waren wenigstens<br />
als Torso erhalten geblieben. Die noch stehenden Gebäude hatte man als Scheunen,<br />
Ställe, Magazine und Unterkünfte für die Kolchosen verwendet. Weil der<br />
Staat nunmehr solche Unsummen in die daniederliegende Landwirtschaft nicht<br />
mehr investieren wollte, waren diese zur Not noch bewohnbaren Häuser überflüssig<br />
und wurden als Ferienwohnungen um einen Spottpreis an Städter verkauft.<br />
Die Menschen aus den Städten waren froh, ihre Wochenenden und ihren<br />
Urlaub in der guten Luft des Böhmerwaldes verleben zu können und darüber<br />
hinaus dem Spitzelsystem der Städte zu entkommen. Sie investierten viel Mühe,<br />
Geld und persönlichen Einsatz, um dieses neue Eigentum zu restaurieren. So<br />
entstand wenigstens in den Sommermonaten eine neue Mentalität der Bewohner,<br />
die bewusst für sich leben wollten und Bindungen an eine Dorfgemeinschaft ablehnten.<br />
Was früher unvorstellbar war - in einem Dorf leben zeitweise Familien,<br />
die sich gar nicht kennen. Zwischenmenschliche Beziehungen, Brauchtum oder<br />
Kulturaustausch entwickeln sich selbst jetzt noch nicht, wo das Grenzland frei<br />
zugänglich geworden ist. Im Winter ist das freie Land weithin eingeschneit und<br />
fast menschenleer. Die von den ehemaligen deutschen Bewohnern des<br />
Böhmerwaldes restaurierten Friedhöfe, Marterln und Kapellen stehen wie verlo-<br />
Hans Watzliks Vermächtnis an die <strong>Böhmerwäldler</strong><br />
Mit seinen Landsleuten musste auch der Dichter Hans Watzlik im Jahre 1945 den<br />
Böhmerwald verlassen. Vor seinem Tode (er starb am 24. November 1948) schrieb<br />
er nachstehendes „Vermächtnis“ an seine Landsleute, das durch seinen tiefen sittlichen<br />
Ernst und seine unerschütterliche Heimatliebe Allgemeingültigkeit für alle<br />
Heimatvertriebenen beanspruchen kann:<br />
Uns <strong>Böhmerwäldler</strong> hat ein unsagbares Unglück betroffen, ein Unglück, wie es<br />
nicht größer ein Volk berühren kann: wir sind aus der Heimat vertrieben worden.<br />
In dumpfer, niemals berechtigter Rachsucht, hat man uns von einer Stätte verjagt,<br />
die wir in tausendjähriger härtester und entsagungsvollster Mühsal aus Fels und<br />
Dorn und Sumpf zur bewohnbaren, fruchtbaren Landschaft umgeschaffen, die<br />
wir aus öder, feindseliger Wildnis herausgehackt haben, auf dass sie die Menschen<br />
nähre und erfreue. Wir hatten dieses Land niemandem weggenommen, wir<br />
hatten niemand daraus verdrängt. Wir hatten dieses Land rechtmäßig aus Gottes<br />
Hand erworben und es dankbar und würdig in Ehren verwaltet. Mit seinen einsamen<br />
Gipfeln, seinen dunklen Wäldern, mit den innigen Flusstälern und schwermütigen<br />
Seen, den schlichten grauen Walddörfern und den altertümlichen Städtlein<br />
dünkte es uns das schönste Land auf Erden, und wir liebten es wie ein Kind seine<br />
gute Mutter und wir lebten freudig darin und hofften, einst in seiner warmen Erde<br />
die letzte Ruhe zu finden neben den Hügeln der Ahnen. Es ist anders gekommen.<br />
Landsleute, ein grauenhaftes Unrecht ist uns angetan worden.<br />
Nachdem wir alle ererbte und erworbene Habe verloren hatten, wurden wir in<br />
andere unglückliche Länder hineingepresst, die ohnehin schon bersten vor Über-<br />
In Hoffnung und Geduld ausharren<br />
Hans Watzlik<br />
rene Zeugen einer vergangenen Kultur einsam da, niemand der jetzigen Bewohner<br />
bekennt sich dazu.<br />
Die Gegenwart hat in diesem Gebiet marktschreierisch anderes zu bieten. Entlang<br />
der Hauptstraßen und Wanderwege schießen die Attraktionen unserer „multikulturellen“<br />
Errungenschaften wie Pilze aus dem Boden. Bars, Nachtlokale, Spielkasinos<br />
und die dazugehörenden Etablissements schicken schreiende Lichtreklame<br />
in die Nacht. Am Straßenrand und in Toreingängen lungern Menschen, die<br />
einem anderen Gewerbe nachgehen als die einstigen <strong>Böhmerwäldler</strong>.<br />
Doch abseits der Straßen gibt es noch immer die großen allmählich zuwachsenden<br />
Waldblößen, die nur dem Kenner verraten, dass hier einst ein Dorf mit Wohnstätten<br />
jener Leute war, die sich noch immer als <strong>Böhmerwäldler</strong> und<br />
Sudetendeutsche bezeichnen. Aus: Erzieherbrief, April 1999
162<br />
163<br />
Bin jüngst dieselben Wege gegangen<br />
In kalter Nacht mit müdem Blick.<br />
Sah Herbstpracht flammen und sterben –<br />
Erinnern blieb nur zurück.<br />
bevölkerung, in Länder, die sich kaum selber ernähren konnten. Wir sind, gestehen<br />
wir es offen, nicht gerade gern gesehene Gäste. Und Tausende und Abertausende<br />
von uns können keine Arbeit finden und viele leben in menschenunwürdigen<br />
Behausungen. Und viele starren, der Verzweiflung nahe, auf die verdorrte<br />
Erde dieses Sommers nieder und lassen die Hände hängen vor der grauen Zukunft<br />
und hegen keine Hoffnung mehr. Da müssen wir uns fragen: Was haben wir<br />
zu tun in dieser bitteren Lage? Was hilft uns die äußere Not zu bannen? Wie<br />
haben wir uns zu bannen? Wie haben wir uns zu halten?<br />
Vor allem: verzweifeln wir nicht! Was mit uns geschieht und ob wir oder unsere<br />
Kinder einmal wieder heimkehren in unseren unvergesslichen Wald, darüber entscheiden<br />
nicht wir, darüber entscheiden andere Gewalten, darüber wird die unerforschliche<br />
Weisheit des Allmächtigen das letzte Wort sprechen. Aber eines können<br />
und müssen wir versuchen: durchzuhalten! Darum lasset uns in der neuen<br />
Heimat so leben und so handeln, als ob wir für immer hier bleiben müssten und es<br />
keine Rückkehr gäbe! Arbeiten wir! Greifen wir rüstig zu! Und wenn uns ein<br />
Plan, eine Absicht fehlschlägt, lassen wir uns nicht entmutigen. Auch im<br />
Böhmerwald daheim ist kein Baum auf den ersten Schlag umgefallen, und geben<br />
wir vor allem nicht Veranlassung, dass man uns verachtet!<br />
Durch unseren Fleiß, durch Treue, Redlichkeit, Hilfsbereitschaft und durch eine<br />
bescheidene, anständige, würdige Haltung wollen wir der alteingesessenen Bevölkerung<br />
Achtung abzwingen, und sie soll erkennen, dass wir keine Müßiggänger,<br />
keine Schmarotzer, Schieber, Schwarzhändler oder Ämtleinhascher, sondern<br />
von ernstem, bestem Willen beseelte Menschen sind. Und seien wir nicht allzu<br />
empfindlich, wenn das Unverständnis mancher, die noch nichts erlebt und erlitten<br />
haben, unser verbittertes Herz kränkt oder beleidigt! Wir wollen die Widerstrebenden<br />
mit nicht nachlassender Geduld gewinnen und, wie schwer es auch<br />
fallen mag, jene Herzenshärte, die uns manchmal entgegenstößt, durch Liebe<br />
entwaffnen! Und erziehen wir die Kinder, die uns als einziges, letztes, höchstes<br />
Gut geblieben sind, zu ordentlichen Menschen! Und singen wir mit ihnen jeden<br />
Abend, ehe wir sie schlafen legen, das Lied der Heimat! Das Heimweh soll in<br />
ihnen lebendig bleiben! Hat man uns die Heimat entrissen, das Heimweh kann<br />
uns niemand nehmen, und es soll wie ein Samenkorn zu einer schöneren Zukunft<br />
in uns keimen.<br />
Und lasset uns jene geheime Macht, die den Völkern das Schicksal verhängt,<br />
lasset uns Gott bitten, dass er uns, ehe wir eingehen in die ewige Heimat, in die<br />
irdische Heimat zurückführe, ohne die wir in der ganzen weiten Weit kein rechtes<br />
Glück finden können!<br />
Und so wollen wir in Hoffnung und Geduld ausharren.<br />
Du aber, Gott, höre uns! (Aus: „Wir Sudetendeutschen“, Salzburg, 1949)<br />
Bin auf sonnigen Wegen gegangen<br />
In Frühlingsduft, voll Maienglück.<br />
Sah Rosen erblüh´n und welken –<br />
Erinnern blieb nur zurück.<br />
Bin jetzt ein stiller Zecher geworden,<br />
Dem schwer das Wandern Stück um Stück.<br />
Der Becher zerschellte am Leben –<br />
Erinnern blieb nur zurück.<br />
Erinnern<br />
Hans Petrou<br />
Vor 50 Jahren -<br />
verfaulten der Felder Früchte.<br />
Die Säer mussten fort.<br />
Hass verachtete<br />
der Erde Gaben und<br />
der Menschen Hort.<br />
Nach 50 Jahren -<br />
wird, was Hass geschändet,<br />
erneuert mit zitternder Hand.<br />
Bangenden Herzens erschauern<br />
die schuldlos Vertriebenen<br />
in fremd gewordenen - Heimatland.<br />
Vor 50 Jahren -<br />
fruchttragendes, entvölkertes Land.<br />
In Kirchen, die stehen geblieben,<br />
kein Beter Einkehr fand;<br />
nur Rinder und Schafe<br />
in sie getrieben<br />
von gottloser Hand.<br />
Nach 50 Jahren -<br />
erneuern sie Kreuze und Kirchen,<br />
in denen die Ahnen und sie getauft.<br />
Die verbliebenen Häuser,<br />
Wiesen und Felder<br />
werden von Fremden verkauft.<br />
Vor 50 Jahren -<br />
entrechtet, entehrt, verbannt,<br />
aus der Heimat vertrieben.<br />
Sie sind gläubig geblieben<br />
im zerbombten Land.<br />
Nach 50 Jahren -<br />
kehren sie wieder.<br />
Sie zeigen den Kindern<br />
und Enkeln,<br />
was einst sie verband,<br />
und das veränderte Land.<br />
Vor 50 Jahren<br />
Karl Halletz
164<br />
165<br />
Seit 1945 wurden von unseren Vertreibern über 300 Orte, Kirchen und religiöse<br />
Kleindenkmäler mutwillig zerstört. Diese Stätten waren Zeugen unserer Volkskultur<br />
und Spiegelbild unserer inneren Beziehung zum christlichen Gedankengut.<br />
Aus Liebe zu unserer Heimat wurde der Gedanke geboren, wenigstens ein<br />
christliches Denkmal unserer Heimatpfarrei in der Patengemeinde Klaffer wiedererstehen<br />
zu lassen. Von unseren vielen Herrgottszeichen wählten wir die allen<br />
Unsere Gehäng Marter<br />
Grete Rankl<br />
Hinter Bergstation und Schutzhaus<br />
Sicht zu Ossers Brüsten hin.<br />
Seeriegel, davor Kapelle.<br />
Erich Hans kommt in den Sinn.<br />
(Gedenken an die Toten der<br />
Sudetendeutschen bei der Vertreibung<br />
1945/46)<br />
Tännchen, Ebereschen niedrig,<br />
Kolonien Heidelbeer’n.<br />
Steinbrocken, grob, abgeschliffen.<br />
Wolkenzüge nah und fern.<br />
Das Totenbrett deutet:<br />
Die Gewalt<br />
liegt in der Hand Weniger,<br />
die Not trifft die Vielen.<br />
Erlösung<br />
finden zuletzt<br />
die guten Willens handeln.<br />
Erich Hans“<br />
bekannte „Gehäng Moachta“, die in der Heimat nur mehr als Ruine ein trauriges<br />
Dasein fristet. Viele Kindheits- und Jugenderinnerungen ranken sich um das unvergessene<br />
Marterl, auf dem Weg nach Neuofen. Sicher hielt auch hier schon<br />
Adalbert Stifter inne, wenn<br />
er durch den Hochwald zum<br />
Plöckensteiner See wanderte.<br />
Die Muttergottesmarter<br />
wurde 1833 von Josef Pröll<br />
errichtet, der 1770 in<br />
Lichtenberg in OÖ geboren<br />
wurde und Susanna Lustig<br />
aus Gehäng, Gmd. Neuofen,<br />
heiratete. Der künstlerisch<br />
begabte Steinmetz<br />
hat sich in Salnau in mehreren<br />
Werken verewigt.Die<br />
Rekonstru-ierung und Revitalisierung<br />
unserer<br />
Andachtsstätte im Jahre<br />
1988 verdanken wir dem<br />
Heimatbetreuer Dipl. Ing.<br />
Franz Schläger, seiner Ar-<br />
Oben:Festgottesdienst bei der Marter Unten: Votivbild in der Marter, Entwurf<br />
Grete Rankl<br />
Blick zum Brennes, Zwercheck, Scheiben,<br />
auf die beiden Eisenstein.<br />
Erika in Lilablüten,<br />
mini, zierlich, zart, doch fein.<br />
Hell umblaut mit weitem Kranze,<br />
bis der Horizont abschließt,<br />
den mit grünen Tannenwipfeln<br />
mancher nahe Gipfel grüßt.<br />
„Wende den Blick, Wanderer,<br />
ostwärts!<br />
Land siehst du,<br />
einst von deutschen Menschen<br />
gerodet und gestaltet.<br />
Es wandelt sein Antlitz,<br />
seit die Deutschen vertrieben.<br />
Weidenröschen, Glockenblumen,<br />
Wicken und Johanniskraut.<br />
Fingerhüte, Latschenkiefern<br />
auf dem Gipfel, der umblaut.<br />
Teurer Sohn des Böhmerwaldes,<br />
tief war dir ins Herz gesenkt<br />
Heimatliebe, Heimattreue,<br />
wo du auch die Schritt gelenkt:<br />
Auf dem Großen Arber<br />
Josef Bernklau
166<br />
167<br />
Durt, wou da Wold is schier unendli,<br />
und s´Bacherl rauscht im Grund,<br />
wou Du red´n host glernt und s´Betn,<br />
aus da Moutta ihran Mund.<br />
Dös is und bleibt dei Hoamatlond,<br />
bis an die End vom Lebn<br />
und af da Welt is neamd in Stond,<br />
wos Schöiners Dir zu geb´n.<br />
Die Hoamat sollst Du net vagess´n,<br />
wou d´Muatta die geborn,<br />
durt wous Du d´Kinderzeit vobrocht<br />
host<br />
und grouß bist worn.<br />
Durt, wou da rauhe Böhmwind<br />
pfeift<br />
über Felder, Wies´n, Flur,<br />
wou Menschn strotzn voller Kroft<br />
und rein is dö Natur.<br />
So wird die Heimat fremd -<br />
versinkt tief im Gemüt<br />
und kehrt doch wieder<br />
als Erinnerung zurück.<br />
Die Hoamat<br />
Adolf Heidler<br />
Verschwunden sind die Gräber<br />
der Ahnen -<br />
ihre Häuser zerstört.<br />
Orte tragen fremde Namen -<br />
fremd die Sprache die man hört.<br />
beitsgemeinschaft und der großzügigen Opferbereitschaft unserer Heimatpfarrei.<br />
Der Entwurf des Votivbildes in der Marter stammt von Grete Rankl und wurde<br />
vorn Maler Josef Pröll in traditioneller volksnaher Gestaltung ausgeführt. Dieser<br />
ist ein Nachfahre des Erbauers der Gehäng-Marter. Wir sehen auf dem Votivbild<br />
der wieder errichteten Marter unsere Heimatkirche mit dem Gottesacker, auf dem<br />
unsere Ahnen ruhen. Rechts unten erblicken wir eine verbannte Familie als Symbol<br />
für die Vertreibung. Im Hintergrund erhebt sich der Hochficht, der 1945 vielen<br />
Verfolgten Schutz über die rettende Grenze nach Österreich bot. In anschaulicher<br />
Bildkomposition schwebt die Muttergottes von Salnau schützend auf dem<br />
Wolkenband über die Vertriebenen. Ihr zur Seite ist die Heilige Dreifaltigkeit<br />
dargestellt, daneben Gottes Sohn mit dem erdrückenden Baumkreuz, der uns die<br />
schwere Last des Schicksals tragen hilft. Die Inschrift des Bildes lautet: 1945<br />
wurden 4200 Menschen von Salnau vertrieben. Ehre und Treue den Opfern der<br />
Vertreibung, der Gefallenen und Verstorbenen der Heimatpfarrei Salnau. Unsere<br />
Gehäng-Marter wurde in Klaffer zur Gedenkstätte unserer Landsleute erhoben.<br />
Möge sie auch die geistige Verbindung zu unseren Heimatorten lebendig erhalten!<br />
Unsere Gedanken wandern von hier aus über den Hochficht ins unvergessliche<br />
Moldautal und erfüllen uns nicht nur mit Wehmut, sondern auch mit Freude<br />
über diese Stätte der Begegnung bei unseren Heimattreffen. Möge sie uns noch<br />
oft zu frohen Wiedersehensfeiern zusammenführen!<br />
Wir schufen uns Heimat -<br />
auch Arbeit und Brot.<br />
Liebe und Treue<br />
bezwangen die Not.<br />
Jedoch in stillen Stunden<br />
sehnen wir uns zurück,<br />
trinken im Geiste<br />
vom Brunnen der Heimat<br />
Wehmut und Glück.<br />
Als Kinder vertrieben<br />
wurzelten wir im fremden Land.<br />
Die Erinnerung ist geblieben -<br />
wo einst unsere Wiege stand.<br />
Wir nahmen die Heimat<br />
mit in die Fremde,<br />
tragen sie im Herzen immerfort<br />
und gaben ihr im Denken<br />
Ruhe und Hort.<br />
Doch das Land<br />
aus dem wir vertrieben -<br />
das der Kindheit blieb zurück<br />
und ein unerklärbar Sehnen<br />
nach den Fluren von einst<br />
Frieden und Glück.<br />
Und kehren wir<br />
nach Jahrzehnten<br />
ins Kinderland zurück -<br />
ist’s noch die Heimat?<br />
Der Anblick bedrückt.<br />
So wird jeder Abschied<br />
vom geschändeten Land<br />
ein Schritt in uns selbst<br />
- wo die Heimat<br />
Geborgenheit fand.<br />
Erinnerung<br />
Geborgenheit<br />
Karl Halletz<br />
Karl Halletz
168<br />
169<br />
Der Hirschgraben von Gratzen<br />
Foto: Josef Seidel, Krummau,<br />
1912 (Sammlung Reinhold Fink)<br />
Wildschweinfütterung bei Gratzen.<br />
Foto: Hawlan, Gratzen,<br />
1912 (Sammlung Reinhold<br />
Fink)<br />
Schwäne zogen ihre Bahnen im<br />
Gewässer des Neuen Schlosses<br />
in Gratzen. Foto: Josef Seidel,<br />
Krummau, 1913 (Sammlung<br />
Reinhold Fink)<br />
Zwei Hirschfiguren säumten die<br />
Einfahrt vom Sofienschloß bei<br />
Gratzen. (Sammlung Reinhold<br />
Fink)
170<br />
171<br />
Auf der Suche nach Weihnachtsliedern findet sich gleich eine ganze Sammlung<br />
von besinnlichen Gesängen. Fast alle diese Lieder sind auf altes Volksgut zurück<br />
zu führen. Einige davon werden in verschiedenen Ländern nach der gleichen<br />
Melodie, jedoch mit einem anderen Text gesungen. Viele Quellen liegen Jahrhunderte<br />
zurück, in einer Zeit als das Christfest mit der Kirche noch der Mittelpunkt<br />
von Weihnachten war. Einige der heutigen bekannten Lieder entstammen<br />
der jüngeren Zeit, wo das Weihnachtsfest zu einem privaten Familienfest wurde.<br />
Das echte bekannteste Weihnachtslied für Kirche und Familie ist natürlich die<br />
Weise „Stille Nacht, heilige Nacht“, von dem Salzburger Geistlichen Josef Mohr.<br />
Die Melodie stammt von dem Organisten Franz Gruber. Das Lied ist 1818 uraufgeführt<br />
worden und ging in die Unsterblichkeit ein. Fast zur gleichen Zeit erschien<br />
auch das Lied „O Tannenbaum“, das um 1800 zum ersten Mal gedruckt<br />
wurde. Der Urtext stammt allerdings schon aus dem 1600 Jahrhundert. In der<br />
gleichen Zeit verbreitete sich auch die Weise „Ihr Kinderlein kommet“. Das weithin<br />
bekannte und gern gesungene Lied „O du fröhliche, O du selige Weihnachtszeit“,<br />
ist im Ursprung ein sizilianisches Schifferlied gewesen. Mit dem heute geläufigen<br />
Text von Johannes Falk wurde es bei uns in den zwanziger Jahren des letzten<br />
Jahrhunderts populär. Neueren Datums sind die Lieder „Alle Jahre wieder“ und<br />
„Morgen kommt der Weihnachtsmann“. Der Ursprung fast allen weihnachtlichen<br />
Gesanges liegt im Religiösen. „Vom Himmel hoch, da komm ich her“, von Martin<br />
Eine Weihnachtserzählung<br />
Vor Jahren arbeitete ich in einem mittelständischen Betrieb, der jedes Jahr vor<br />
Weihnachten den Kindern der Betriebsangehörigen durch den Weihnachtsmann<br />
kleine Geschenke bescheren ließ. Zu diesem Zweck hat die Betriebsleitung einen<br />
Saal in der Nähe gemietet, der Tage zuvor von freiwilligen Helfern festlich, weihnachtlich<br />
geschmückt wurde. Manchmal hat man auch einen Puppenspieler mit<br />
einem Kasperltheater verpflichtet um den Kindern eine zusätzliche Freude zu<br />
bereiten. Mir persönlich fiel immer die Rolle des Weihnachtsmannes zu. In einem<br />
roten langen Kapuzenmantel, einer Maske vor dem Gesicht und langem<br />
Wer hat nicht gefolgt?<br />
Ernst Braun<br />
Weihnachtliches Liedgut und Brauchtum<br />
Ernst Braun<br />
Jetzt is sie do dö staade Zeit,<br />
gspürst nix wia Ruah und Schweigsamkeit.<br />
Schoi longsom kimmt dö staade Zeit,<br />
d´Natur is voller Schweigsamkeit.<br />
Im Wold zuig´n stumm dö scheich´n Reh,<br />
als schmeckat´ns an ersten Schnee<br />
Koa Vögerl hört ma singa mehr,<br />
dö Bam, dö san vom Laubat leer.<br />
Es blüht koa Bleamerl mehr am Roa,<br />
all´s steht so steif als wia a Stoa.<br />
Dö staade Zeit<br />
Luther steht am Anfang einer reichlichen Folge. Im 16. und 17. Jahrhundert blühte<br />
die weihnachtliche Lyrik besonders reich, damit wurde das Geschehen um Christi<br />
Geburt auch musikalisch verherrlicht.<br />
Weihnachten ohne besinnliche Lieder ist heute genau so undenkbar wie ein Christfest<br />
ohne den Weihnachtsbaum. Rund 25 Millionen Tannen, Fichten und Kiefern<br />
werden in Deutschland jährlich für das Fest gefällt. Der Brauch, zu Weihnachten<br />
einen Baum zu dekorieren, ist allerdings erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts in<br />
die deutsche Weihnachtsstube eingekehrt. Es ist zwar bekannt, dass ein geschmückter<br />
Weihnachtsbaum schon anfangs des 17. Jahrhunderts bei einer Straßburger<br />
Frau gesehen wurde, es dauerte aber noch fast zwei Jahrhunderte, bis der Christbaum<br />
einen festen Platz im Weihnachtsgeschehen eingenommen hatte.<br />
In unserer Zeit erstrahlen die Christbäume, elektrisch beleuchtet, auf vielen öffentlichen<br />
Plätzen in Stadt und Land. Erstmalig gab es die Beleuchtung in Deutschland<br />
im Jahr 1919, in New York aber schon 1912. Der Stern auf der Spitze des<br />
Baumes verkörpert den Stern von Bethlehem, der vor mehr als 2000 Jahren die<br />
Weisen aus dem Morgenland zur Geburtsstätte des Heilands leitete. Die<br />
Weihnachtsglocken sind eine Nachbildung der Orientierungsglocke, deren Klang<br />
für Verirrte in Sturm und Wind wegweisend in eine Zuflucht war, wenn sie auf<br />
den Ruf der Glocke hörten und damit die Richtung behielten.<br />
Die gläsernen und bunten Kugeln als Schmuck des Christbaumes, sollten erstmalig<br />
aus purem Gold von den Germanen an den verschneiten Bäumen des Waldes<br />
aufgehängt worden sein, um den Lichtgott Baldur zu ehren.<br />
Ähnlich verhält es sich auch mit den silbernen Tannenzapfen, die Nachbildung<br />
der von Raureif überzuckerten Tannenzapfen sind, in deren Glanz sich die Wintersonne<br />
spiegelt. Heute sind zwischen manche Familien regelrechte Wettbewerbe<br />
um die schönste Weihnachtsdekoration entbrannt. Die Geschäftswelt hat das längst<br />
erkannt, dass sich mit dem schönsten und höchsten Fest des Jahres auch ein gutes<br />
Geld verdienen lässt.<br />
Adolf Heidler
172<br />
173<br />
weißen Bart, begleitet von zwei Engeln, die mir helfen sollten die Geschenke zu<br />
verteilen, betrat ich den Saal. Das Kasperltheater war zu Ende gegangen und die<br />
Mütter saßen mit ihren Kindern bei Kaffee und Kuchen. Ich trug ein altes, mit<br />
buntem Papier übergeklebten Telefonbuch, in welche die „Sünden der Kinder“<br />
standen, von denen mir die Mütter berichtet hatten. Und dann standen die Kleinen<br />
vor mir, manche recht verlegen, andere wieder recht munter und stockend<br />
sagten sie ihre eingelernten Gedichte auf, oft recht schnell und hastig und froh<br />
erleichtert am Ende. Es gibt nichts Schöneres als zu Weihnachten in leuchtende<br />
Kinderaugen zu sehen, schon aus diesem Grunde habe ich immer die Rolle des<br />
Weihnachtsmannes übernommen. Die Freude der Kinder über die kleinen Geschenke<br />
war damals noch echt und groß. Zu jener Weihnachtsfeier war zum ersten<br />
mal unsere jüngste Tochter Anna mit eingeladen, mit ihren drei Jahren die<br />
Jüngste im Saal. Der Weihnachtsmann ist für sie etwas ganz Neues gewesen und<br />
sie erzählte schon Tage vorher, dass sie zu ihm gehen werde. Sie konnte es kaum<br />
erwarten, Bangigkeit kannte das Kind nicht. Ich hatte mir fest vorgenommen keinen<br />
Kontakt mit ihr aufzunehmen, damit sie mich nicht erkennen konnte. An den<br />
Tischen war nun nach der Bescherung die Ruhe eingekehrt. Unsere Anna klettere<br />
auf den Stuhl, damit sie den Weihnachtsmann besser sehen konnte. Nun kam<br />
auch mein Auftritt. Im Saal war alles still geworden. Flankiert von meinen Engeln<br />
begann ich: „Grüß Gott liebe Eltern und liebe Kinder. Seid ihr alle brav<br />
gewesen?“ „Jaaa“, ertönte es zaghaft zurück. „Sooo, dann will ich einmal sehen,<br />
in meinem Himmelsbuch steht ja alles geschrieben, was ihr das Jahr über angestellt<br />
habt. Seid ihr wirklich so brav gewesen?“ Großes Schweigen ringsum. Da<br />
platzte plötzlich unsere Anna in die Stille: „Weihnachtsmann, ich war immer brav.“<br />
Das konnte ich nun nicht durchgehen lassen. Erst heute Morgen musste meine<br />
Frau die kleine Frechnase zurechtweisen. Ich sagte: „Sieh da die kleine Anna, du<br />
willst immer brav gewesen sein, wer hat denn heute morgen der Mama nicht<br />
gefolgt?“ Die Kleine sah sich im Saal um. Der größere Bruder saß neben ihr, den<br />
konnte sie nicht verpetzen. Aber da ist ja noch einer von der Familie, der ist nicht<br />
da und weil er nicht da ist, so kann ihm auch nichts passieren. Da sagte sie laut<br />
und deutlich: „Der Papa ist nicht brav, der folgt der Mama nicht“. Ich war sprachlos,<br />
das anschließende schallende Gelächter im Saal ließ mir Zeit, mich von diesem<br />
Schreck zu erholen und ich musste nun erst einmal auch mitlachen. Im ersten<br />
Moment habe ich ganz sicher recht verlegen ausgeschaut. Hinter meiner Maske<br />
konnte das aber nicht bemerkt werden.<br />
In der <strong>Böhmerwäldler</strong> Weihnacht, die zum Schönsten im Jahreslaufe gehörte,<br />
war das sich immer wieder erneuernde wunderbare Geschehen der Geburt unseres<br />
Herrn und Erlösers Jesus Christus von einem Kranz christlicher und vorchristlicher<br />
Gebräuche umgeben. Die von den Grenzbergen und der Sprachgrenze geschützte<br />
Waldheimat war eines der Rückzugsgebiete altbaierischen Kulturerbes.<br />
Die Kirche hat das Weihnachtsfest bewusst in die zweite hohe Zeit des Naturjahres,<br />
in die Zeit der Wintersonnenwende (20. bis 23. Dezember) verlegt.<br />
Am Thomastag, den der Volksglaube für den kürzesten Tag im Jahre hielt (21.<br />
Dezember), lud man in der Heimat Adalbert Stifters, in Oberplan, das „Goldene<br />
Rössl“ ein. Dieses (Ross der Sonnenwende) war ausschließlich die Gabenbringerin<br />
am Heiligen Abend. Der Fostertog, wie dieser in der Mundart hieß, war ein<br />
Lostag (von losen, das heißt, “in das Dunkel horchen”, auch “das Los sprechen<br />
lassen” - “löseln” - schließlich “Lossein des Bösen”). Nach anderen war er der<br />
kürzeste Tag, weil man an diesem großen Fasttag später aufstand und abends früh<br />
zu Bett ging, um sich vor dem nächtlichen, oft sehr weiten Gang zur Christmette<br />
noch etwas auszuruhen. Meine Großmutter fastete an diesem Tage, „bis die Sterne<br />
am Himmel standen“. Der Tag hatte nur zwei Mahlzeiten mit Suppe, Zwetschgen-<br />
oder Kletzenkoch. Die Dienstboten bekamen den Weihnachtsstriezel. Nach<br />
dem Essen wurden die Zwetschgenkerne gezählt; wer sie „oichti“ hatte, blieb im<br />
kommenden Jahr noch ledig, wer sie „poari“ besaß, der werde sich verehelichen.<br />
Nach der Mahlzeit wurde der „Brunnen gefüttert“, damit im kommenden Jahre<br />
das Wasser nie ausgehe. Brot, Semmel und Nusskerne wurden in kleiner Menge<br />
ins Wasser versenkt; dabei wurde gesagt: „Brunnen, da hast du Semmel zum<br />
Essen, gib uns das ganze Jahr Wasser!“<br />
Das Vieh in den Ställen bekam Brot und geweihtes Salz. Vor Sonnenuntergang<br />
musste „an“- gefüttert sein, das heißt, die Stallarbeiten mussten beendet sein.<br />
Wegen der Heiligkeit der Nacht war die Ofenstange abgeräumt. Höhepunkt des<br />
Abends war dann das „Goldene Rössl“, welches mit einem Glöcklein läutete und<br />
im Vorhause einen hell erleuchteten Christbaum sowie andere Geschenke für die<br />
Kinder, die Gebete sprachen, hinterließ. Bevor der Christbaum eingeführt war,<br />
kam im Vorhaus ein Licht auf die Mehltruhe und daneben eine Schüssel, in welche<br />
das Goldene Rössl für die Kinder einlegte.<br />
In der Heiligen Nacht, der Mettennacht, der dritten Losnacht im Jahre, wurde an<br />
manchen Orten mit Pistolen geschossen. Man sagte, in dieser Nacht reden die<br />
Pferde und das Vieh im Stalle.<br />
25. Dezember: (da hali Weihnochtstog) Wer auf dem Heimweg von der<br />
Mitternachtsmesse fällt, hieß es, wird im kommenden Jahr sterben. Nach der<br />
Heimkunft gab es - es war nun kein Fasttag mehr – „Hammesuppe“ (Hamme:<br />
mittelhochdeutsch: Schinken); die Hausmutter bereitete auch Käse zu. „Unsera<br />
Weihnachten bei uns daheim<br />
Grete Rankl
174<br />
175<br />
liabm Frau iahn Soumkas“ (Seimkäse), wie er nach jeder Taufe aufgetragen wurde.<br />
Zum Frühstück kamen nach altem Rezept selbst gemachte Fleischwürste auf<br />
den Tisch. Das Hochamt in der Pfarrkirche war besonders feierlich und wurde<br />
instrumental begleitet. In der alten Zeit wurden bei den Weihnachtsgottesdiensten<br />
altüberlieferte Hirtenlieder in der Volkssprache gesungen. Zum Festessen zu Mittag<br />
wurde zweierlei Fleisch zubereitet: Frischfleisch und „Hamme“fleisch.<br />
26. Dezember: (Schteffanitog) Stefan galt als der Rossknecht des Herodes und<br />
war so ältester Pferdepatron. Auch hier bestehen wohl Zusammenhänge mit den<br />
auf dem Rosse reitenden Wodan der Wintersonnenwende, ehemals Haferweihe.<br />
Die Mägde wurden auf dem Kirchplatz von den Knechten mit Hafer beworfen,<br />
„gesteffelt“, wofür so manche Dirn kein Verständnis zeigte. Am Stefanietag musste<br />
Schnaps zur Hand sein, ein wohl mit uraltem Opfertrunk dieser Tage zusammenhängender<br />
Brauch. Abends wurde das Dreikönigsspiel oder ein anderes der überlieferten<br />
religiösen Volksspiele aufgeführt.<br />
27. Dezember: (Johannitog) Der mit dem Feste des Hl. Stephanus zusammenhängende<br />
Dienstbotenwechsel wurde - „Stephanie“ war ein Feiertag - am Johannistage<br />
durchgeführt. Die meisten Dienstboten hatten Truhen, in welche sie ihre<br />
Habseligkeiten packten und bei einem anderen Bauern „einstanden“. Ein „großer“<br />
Bauer hatte einen Knecht und Rossknecht, einen großen und kleinen Meiner,<br />
eine Dirn und eine kleine Dirn, eine Kuchldirn und Kindsdirn. Dazu kamen<br />
noch die Inwohnerfamilien, welche oft die Knechte und Mägde zu vertreten oder<br />
ersetzen hatten. Viele Hofbesitzer hatten auch noch einen Hüter, der im<br />
„Hirtahäusl“ wohnte.<br />
27. Dezember bis 5. Januar: (Jänner) d’Küwatag Eine <strong>Böhmerwäldler</strong> Unikatbezeichnung<br />
für die Tage der zwölf Nächte. Sie waren für die Dienstboten arbeitsfrei.<br />
Manche verbrachten sie bei den Eltern. Leute, die vorübergehend auf dem<br />
Hof das Vieh versorgten, wurden dafür eigens entlohnt.<br />
31. Dezember, Silvester: (s’oldi Joah) In manchen Häusern wurde abends der<br />
Rosenkranz gebetet. Die Nacht zum neuen Jahr war geheimnisumwittert. Um<br />
Mitternacht, Schlag 12 Uhr, hieß es, gehen die im kommenden Jahr Sterbenden<br />
um den Altar der Pfarrkirche. Ein daran zweifelnder Pfarrer, heimlicher Beobachter<br />
von der Kanzel aus, sah die Prozession der den Todgeweihten ziehen. Aus<br />
Schreck darüber starb er. Diese und ähnliche Geschichten waren zum Teil Gesprächsthema<br />
dieses Abends. Wie viele Jahre auch schon vergangen sein mögen,<br />
die Erinnerung an unsere Sitten und Gebräuche zur Weihnachtszeit sind lebendig<br />
geblieben. Sicher hütet jeder von Euch einen Schatz von Erlebnissen, die er nie<br />
mehr hergeben möchte.<br />
Unser Nachbar fragte mich kurz vor Weihnachten, 1981 war es, ob wir noch<br />
keinen Tannenbaum hätten? Wir hatten noch keinen. Er meinte: „Schau a mol zu<br />
mir uma, i hob ebbs B’sunders“. Tatsächlich, er hatte bei seiner Waldarbeit im<br />
Schnee- und Windbruch eine schlanke umgerissenen Tanne gefunden, deren Wipfel<br />
abgebrochen war. Obwohl er schon einen Christbaum hatte, nahm er den schön<br />
gewachsenen Grotzen mit nach Hause. Da stand er nun an den Holzschuppen<br />
gelehnt. „Wos sogst dazua?“, meinte der Konrad. „0 mei, der g’fallt ma!“, meinte<br />
ich. „Ja dann, dann g’hört er dir und nimm eahm a glei mit!“. Geld nahm der<br />
Nachbar nicht dafür. Also sagte ich ein freudiges “Vergelt’s Gott”, trug den Grotzen<br />
nach Hause und richtete ihn in der Werkstatt zurecht. Denn am nächsten Tag<br />
vom 23. auf den 24. Dezember musste ich in Kufstein übernachten. Als Zugführer<br />
bei der Bundesbahn bestimmte der Dienstplan unsere Arbeits- und Freizeit. In<br />
unserem Kufsteiner Zimmer lag ich noch lange wach. Denn der Grotzen erinnerte<br />
mich an die schönen hohen Tannen des Böhmerwaldes. Auf einmal ging mir<br />
ein Licht auf. Zu unserer Hausmusik mit den Kindern brauchte ich noch was für<br />
den Heiligen Abend zum Vorlesen. Rechtzeitig zum Heiligen Abend kam ich vom<br />
Dienst heim. Maria, meine Frau hatte alles vorbereitet, auch den Christbaum aus<br />
der Werkstatt. Die Kinder und ich spielten etwas unsicherer als sonst unsere weihnachtlichen<br />
Weisen vor der Bescherung und ich las mein neues Weihnachtsgedicht:<br />
„Da obrochane Grotzen“. Dann war es, wie die Kinder meinten, endlich soweit.<br />
Ein feiner Glasglockenklang kam aus dem Wohnzimmer. Das Zeichen, dass wir<br />
die Türe öffnen durften. Überwältigt von der Schönheit des Christbaumes, auch<br />
wegen des Baumschmuckes von meiner Frau, staunten und freuten sich alle. Nicht<br />
nur unsere Kinder, auch der Vater, die Mutter war schon im Himmel, meine alte<br />
Tante und unser alter verwitweter Freund Friedrich. Jeder bekam ein kleines Geschenk<br />
und freute sich darüber, auch über die dargebotenen weihnachtlichen<br />
Bäckereien usw. Zu schnell verging der fröhliche Weihnachtsabend und man rüstete<br />
zum Mettengang. Nur, ich saß noch in Gedanken versunken allein beim Christbaum.<br />
Es war als ob - er - mir zuflüsterte:<br />
I war a Tanna - no nit oid<br />
do hot mi da Schnee dadruckt im Winterwold.<br />
Allerhand hob i dalebt -<br />
Stürm und Wind.<br />
A Spinnen ham an mia scho gwebt,<br />
angregnt hots mi und ogschniem.<br />
Zapfn hab i trogn mit Sam -<br />
im Winta warns eisig und lang.<br />
Da obrochane Grotzn (Tannenwipfel)<br />
Karl Halletz
176<br />
177<br />
Tief verschneit war der Böhmerwald. Wiesen, Felder, Täler und Berge lagen unter<br />
einer hohen Schneedecke. An den Sträuchern, Bäumen und Telefonstangen<br />
und deren Drähten hing dicker Raufreif. Endlich nahte der Heilige Abend und ich<br />
war gespannt, was uns, meiner kleinen Schwester und mir das Christkindl bringen<br />
wird. Großvater, der eigentlich unser Stiefgroßvater war, wir hätten keinen<br />
besseren Äjhnl bekommen können, hatte mich in der Adventszeit öfter gefragt,<br />
was ich mir den vom Christkindl wünschte. „Einen Kranz mit Knackwürsten am<br />
Christbaum!“, war immer die Antwort. Die Großmutter, d’ Ahnl, fragte, ob ich<br />
nicht noch was haben möchte. „Ohja, einen spitzigen Haufen Leberpasteten!“.<br />
Pyramide war für mich noch kein Begriff, wohl aber der köstliche Inhalt der<br />
kleinen roten Dosen in Großmutters Kaufladen. Vater und Mutter fragten mich<br />
auch öfter nach meinen Wünschen. „A Klawia, dejs wa wos!“, antwortete ich, -<br />
auch öfter. Die Eltern meinten, da müsse ich aber brav sein. Komische Frage,<br />
Heiliger Abend im Böhmerwald<br />
Karl Halletz<br />
I Dank eich Leut,<br />
weils mi als brochas Trum<br />
habts mögn.<br />
I wünsch eich schene Weihnachtn<br />
und a vui Segn.<br />
Oans freit mi vo dem Gounzn,<br />
weil af mia heit Liachta glaounzn.<br />
Im Wold die andern Toannabam<br />
sehgn sowas kam.<br />
Nachat bin i gwachsn Joahr um Joahr<br />
und lang wordn dabei sogar,<br />
bis mi d’ Stürm und da Schnee ham brocha,<br />
zerscht die Wurzn und an Grotzn nochat.<br />
A oanzigs moi hob i mi gift.<br />
A Saubua hat ma oni gschifft.<br />
D’ Sun hot glacht und mi glei trickat,<br />
a Jagdhund hot des a no gwittert;<br />
Um den wars aber glei gschehn<br />
wia a hot - an Fuchs dasehgn.<br />
dachte ich. Brav war ich doch immer - oder vielleicht doch nicht? Warum ein<br />
Klavier vom Christkindl? Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich weil unser Herr<br />
Oberlehrer ein solches in der Schule hatte, wo er wohnte und, wie mir schien,<br />
schön spielte. Dort habe ich es gesehen. Man brauchte nur die weißen und schwarzen<br />
„Blattln“ drücken, dann klang das schöner als die Orgel in der Kirche. Aber<br />
so ein Klavier konnte sicher nur das Christkindl bringen, denn das war schon was<br />
Himmlisches.<br />
Je näher der Weihnachtsabend kam, um so neugieriger wurde ich. Endlich war es<br />
soweit. Den Nachmittag musste ich brav bei der Ahnl und den Äjhnl (bas<br />
Aiweachtn) verbringen. Als dann die beiden mit mir heim gingen, um zu schauen,<br />
was das Christkindl gebracht hat, da kamen wir gerade zur rechten Zeit. Durch<br />
die verhangenen Fenster fiel helles Licht, viel heller als sonst, auf die große<br />
Schneewächte (Schneegwahn) vor dem Pausn-Stiwl, und... es klingelte in der<br />
Stube.<br />
Vater hatte uns schon an der Haustür empfangen und die Mutter mit dem Schwesterlein<br />
im Arm sagte: „Wenn du ganz brav bist, kannst du durch das Schlüsselloch<br />
das Christkindl sehen!“, Was? Durch das Schlüsselloch? Das darf ich doch nicht,<br />
dachte ich mir. Dafür hab’ ich doch schon Mutters handschriftliche Belehrung<br />
bekommen. Die Neugierde und Vaters Ermunterung bewirkten, dass ich durch<br />
das Schlüsselloch sah. Ui! Da stand ein wunderschöner Christbaum mit brennenden<br />
Kerzen und - ja, - was war denn das? Ein weißer Engel mit Flügeln am Rücken.<br />
stieg auf das weiße Stockerl, auf dem sonst das „Lawoa“, die Waschschüssel,<br />
stand und zündete die Kerzen oben am Baum an. Das erregte mich. „Was<br />
siagst?“, fragte Mutter, die meine Aufregung bemerkte. „An Engel mit Flügel!“…<br />
- „Das is’ s’Christkindl“, meinte laut lachend der Ahnl. Also Flügel hat<br />
s’Christkindl und braucht a Stockerl zum aufisteig’n? Na so was. Wieder klingelte<br />
es in der Stubn und ich sah nur noch was Weißes durchs Schlüsselloch. Die Tür<br />
ging auf. Aus dem wunderbaren Licht kam das Christkind, ging schweigend und<br />
lächelnd an uns vorbei und entschwand durch die Haustür. Das war was. - Ich<br />
muss wohl zu lange dem Christkindl nachgeschaut haben, denn die Mutter meinte:<br />
„Willst nit schaun, was s’Christkindl bracht hat?“ ...Und ob ich wollte. Da<br />
stand ein großer Christbaum, voller Kerzenlichter, Glaskugeln, Zuckerbacht<br />
(Weihnachtsgebäck) und Zuckerstangerl im farbigen Staniolpapier hingen auch<br />
daran. Das war aber gar nichts, denn das hatte ich schon durchs Schlüsselloch<br />
erspäht. Unten am Baum hing ein ganzer Kranz mit Knackwürsten, wie ich’s dem<br />
Ähnl gesagt hatte und aufgeschichtet war ein Blechbüchsenberg (Pyramide) Leberpasteten.<br />
Das machte mich stumm. Erst jetzt sah ich erst das Schönste. Ein<br />
kleines weißes Klavier mit einem gedrechselten Stockerl und das war mit buntem<br />
Stoff gepolstert. Ich glaubte gar nicht recht, was ich da sah. Zaghaft klopfte ich<br />
mit einem Finger auf die Klapperl, und das Klavier gab einen und dann noch<br />
mehrere Töne von sich. „So musst’ es machen“, erklärte mir Vater. Es war alles so<br />
schön und ich konnte es nicht ganz begreifen. Alles, was ich mir gewünscht hatte,<br />
war da, alles freute mich und wie ich merkte, auch die Ahnl, den Ähnl, Vater und
178<br />
179<br />
Heimat -<br />
hinter winterlichen Bergen<br />
tief verschneit liegt Bach und See,<br />
rauhreifumhüllt ist alles -<br />
Baum, Kreuz und Bergeshöh.<br />
Stürme brausen über Waldesrücken,<br />
tragen Schnee hinab ins Tal<br />
bedecken Mauerreste, Brücken<br />
weihnachtlich und Stall.<br />
Werden in der Heili’gen Nacht<br />
Menschen beten<br />
im Kirchlein auf der Höh’<br />
und die Glocken verkünden:<br />
„Gloria in excelsis De?“<br />
Wird dort, wie in alten Zeiten,<br />
jung und alt bei Kerzenschein<br />
innerlich sich vorbereiten -<br />
weihnachtsfroh und selig sein?<br />
Ist des Kirchleins Raum<br />
nur erhellt vom Sternenglanz -<br />
wird Strauch und Baum<br />
kristall-licht-funkelnd zur Monstranz.<br />
Mondlicht strahle millionenfach<br />
in den Schneekristallen,<br />
verkündend Heil’ge Nacht<br />
denen-, die dort weilen.<br />
Allen möge Weihnacht werden<br />
hier - und hinter winterlichen Bergen.<br />
Weihnachtsgedanken - an den Böhmerwald<br />
Karl Halletz<br />
Nachsatz: Noch in den nun schon über 60 Jahren nach unserer Vertreibung begrüßte<br />
ich die Seppm-Baun-Miazl bei unseren Gemeindetreffen, bei den<br />
Sudetendeutschen Tagen usw. mit einem augenzwinkernden: „Griaß di God<br />
Christkindl!“ Und wir freuen uns über das recht unterschiedlich erlebte Christkindl<br />
im Pausn-Stiwl.<br />
Mutter und, o je, das kleine Schwesterlein verschlief alles. Wie lange ich alles<br />
bestaunte, weiß ich nicht mehr.<br />
Wie von weit her kam die Frage des Äjhnl: „Und Koarei, was sagst zum<br />
Christkindl? Hat’s dir nit alles bracht, was du dir gewünscht hast?“ „Jou, jou, uis<br />
is do, da Christbam, d’Leber - Woastschou (Pasteten), da Kranz Knackwürst und<br />
s’ Klavier.“ Wieder fragte der Äjnl: „Und s’Christkindl, hast des nit angschaut<br />
und freud di des nit?“ „Jou, jou , schou“, meinte ich versonnen – „Aber Flügl<br />
hat’s wia d’Gäns’, - kann nit fliagn, braucht a Stockerl zan Bamouzintn“… Weiter<br />
kam ich nicht, denn alle lachten auf einmal und am lautesten der Äjhnl. Als ob<br />
ich mich verteidigen müsste, meinte ich noch: „Dejs hob i durchs Schlüsselloch<br />
g’sehn!“ Und als ob ich beweisen müsste, dass ich genau geschaut hab’ sagte ich<br />
noch: „Und ausgschaut hat’s wias Seppm-Miazei!“ Wieder lachten alle und ich<br />
wusste nicht, warum. Es wurde noch was von fröhlichen Weihnachten gesagt,<br />
aber das war für mich nicht wichtig, denn ich hatte das Christkindl gesehen.<br />
Es war im Herbst anno 1945 als der ehemalige Leutnant Fritz Eckner, ein junger<br />
Lehrer aus dem Böhmerwald, halb ausgeheilt von seiner Kriegsverletzung das<br />
Lazarett an der dänischen Grenze verließ und auf abenteuerlichen Wegen seiner<br />
Heimat zustrebte. Durch zerbombte Städte, verwüstete Landschaften und auf seltenen<br />
Mitfahrgelegenheiten erreichte er Böhmens Grenze. Hier wartete der gefährlichste<br />
Teil seiner Reise. Jeder menschlichen Siedlung ausweichend konnte<br />
er nur in der Nacht dem Instinkt folgend die blaue Bergkette im Süden des Landes<br />
erreichen. So klopfte er nach wochenlanger Odyssee in der Nacht an die Tür<br />
seines Elternhauses. Seine Eltern waren schon gestorben, aber seine Schwester<br />
hatte Haus und Landwirtschaft übernommen, und bei ihr hatte er früher seine<br />
Ferien und im Krieg seine Urlaubstage in friedlicher und geborgener Atmosphäre<br />
erlebt. Nun kam er als menschliches Wrack Einlass bittend in das Haus, welches<br />
für ihn letzte Zuflucht war. Seine Schwester Hilde erkannte ihn zuerst gar nicht,<br />
als er so zerlumpt und abgemagert im Mondlicht stand. Aber dann war ihre Freude<br />
groß, als sie ihn in die sorgsam verdunkelte Küche holte. Die beiden Geschwister<br />
hatten sich immer gut verstanden und es dauerte lange, bis sie sich gegenseitig<br />
die traurigen Erlebnisse der letzten Monate erzählt hatten. Hildes Mann war<br />
irgendwo im Osten vermisst und sie lebte mit den beiden Kindern allein im Haus,<br />
das etwas abseits vom Kirchdorf stand und so der Besetzung durch neue Besitzergreifer<br />
bisher entgangen war, denn diese zogen lieber in die Häuser der geschlossenen<br />
Ortschaft ein, wo sie sich sicherer fühlten.Doch Fritz musste vor dem Zugriff<br />
und vor den Augen der Öffentlichkeit im Schutz des Vaterhauses verborgen<br />
bleiben, wenigstens so lange, bis er sich gesundheitlich wieder erholt hatte und<br />
an Pläne für die Zukunft denken konnte. Eine Anmeldung bei der Gemeinde kam<br />
gar nicht in Frage, denn bisher waren alle Heimkehrer, welche das der<br />
Lebensmittelkarten wegen versucht hatten, nach schwerer Misshandlung in einem<br />
Internierungslager Innerböhmens, im Steinbruch bei der Kreisstadt oder gar<br />
im Kriminalgefängnis in Pisek gelandet. So zog Fritz in die kleine Knechtkammer,<br />
in der man allerhand Gerümpel aufbewahrt hatte. Von dort konnte er bei Gefahr<br />
schnell über die Treppe in die Scheune entkommen, wo Hilde im Heustock eine<br />
tiefe Höhle herausgerafft hatte. Hildes Kinder, die ihren Onkel nur als schmucken<br />
Offizier kannten, wurden am nächsten Morgen angewiesen nicht nur strengstes<br />
Stillschweigen gegen jedermann zu bewahren, sondern sie wurden auch als<br />
Wächter eingesetzt. Weil sie ja nicht zur Schule gehen durften, spielten sie gern<br />
im Freien und sollten sofort melden, wenn sich vom Dorf her eine Menschengruppe,<br />
ein Motorrad oder ein Auto näherten. So vergingen die Wochen. Fritz<br />
gewann unter der sorgfältigen Pflege und Verköstigung – auch ohne Lebensmittelkarten<br />
– seiner Schwester allmählich wieder Kraft und Lebensmut. Auch wenn er<br />
Der Stern der Zuversicht<br />
Rosa Tahedl
180<br />
181<br />
sich tagsüber nur im Hause aufhielt, konnte er wenigstens in der Nacht im Garten<br />
frische Herbstluft genießen und sich dabei Gedanken über seine Zukunft machen.<br />
In der Heimat konnte er nicht bleiben. Es kreisten schon Gerüchte, dass alle<br />
Deutschen weg müssten. Für ihn gab es nur die Möglichkeit, jenseits der Grenze<br />
im Bayerischen wieder Fuß zu fassen. Er musste dort hin. Inzwischen war der<br />
Advent gekommen und eine flockige Schneedecke lag über der Flur. Die Kinder<br />
sprachen schon von Weihnachten, das wohl wieder ohne Vater ein stilles Fest<br />
werden würde. Fritz bastelte kleine Geschenke für sie und Hilde fürchtete sich<br />
schon vor dem Abschied, denn beide waren übereingekommen, dass Fritz am<br />
sichersten in der Weihnachtsnacht auf Skiern über die Grenze kommen würde.<br />
Da wären die Grenzwächter sicher nur vereinzelt im Dienst an der Grenze und<br />
man könne eine Schussfahrt auf Skiern über den Grenzbach schon wagen. Fritz<br />
sah noch einmal seine Sachen durch und Hilde packte das Notwendigste in einen<br />
Rucksack. Wehmütig mustere er seinen Bücherschrank und die Noten – alles<br />
musste als zu schwer zurückbleiben. Besonders um seine gute Geige tat es ihm<br />
leid, die Vater ihm noch während des Studiums als wertvolles Geschenk gekauft<br />
hatte. Als im Sommer der tschechische Befehl kam, alle Musikinstrumente müssten<br />
abgeliefert werden und man diese bei Hausdurchsuchungen mitnahm, wusste<br />
Hilde sich zuerst keinen Rat. Dann brachte sie den Geigenkasten an einem Sonntag<br />
in aller Frühe auf die Orgelempore und versteckte ihn zwischen Notenschrank<br />
und Emporebrüstung. Dort war die Geige vorläufig sicher und sie könnte im<br />
Notfall sagen, ihr Bruder hätte sie im Krieg bei seinem letzten Urlaub dort vergessen.<br />
Man war erfinderisch in jenen Zeiten. Wie gern hätte Fritz sie jetzt bei<br />
seiner Flucht mitgenommen, aber das war unmöglich. Noch einmal verlebte er<br />
einen hl. Abend im Vaterhaus, wo nur die Kinder Weihnachtsfreude empfanden.<br />
Dann hieß es Abschied nehmen von allem, was ihm lieb und teuer war. Als die<br />
Glocken zur Mitternachtsmette verstummt waren und die Lichter der Kirchgänger<br />
auf den Wegen zur Kirche nicht mehr zu sehen waren, zog er auf Skiern los,<br />
an der Steinmauer der Felder entlang bis zur Friedhofmauer, wo schon der helle<br />
Schein aus den Kirchenfenstern auf den Gräbern lag und der Ton der Orgel durch<br />
die Nacht drang. Und da überkam ihn der alte Wagemut, der einst sein Leben so<br />
tiefgreifend gezeichnet hatte: „Ich will meine Geige haben, das muss ich riskieren!“,<br />
blitzte es durch seine Gedanken. Die Skier abgeschnallt und leise zum<br />
Turmeingang, auf die Empore schlich er sich so die Treppe empor. Im Kirchenschiff<br />
war gerade Kommunionempfang und dadurch eine gewisse Unruhe zwischen<br />
den Bänken. Das war auch die Zeit, wo der Chor länger die Möglichkeit<br />
hatte, Sololieder der Weihnachtszeit in den Gottesdienst einzubauen.<br />
Fritz drängte sich durch die Chormitglieder, welche ihn im Halbdunkel wohl kaum<br />
erkannten und erfasste tatsächlich den Geigenkasten mit seinem geliebten Instrument.<br />
Da vernahm er plötzlich, trotz aller Angespanntheit seiner Sinne, wie die<br />
Orgel ein Vorspiel intonierte, das er von früher gut kannte. Und dann setzte der<br />
Sopran der Solosängerin ein: „Maria durch ein `Dornwald ging“, perlten die Töne<br />
durch den Raum. Das alte Lied, welches er immer auf der Geige begleitet hatte!<br />
Da waren plötzlich alle Ängste und jede Furcht in seinen Gedanken ausgeschaltet.<br />
Wie unter einem Zwang öffnete er den Geigenkasten, entnahm das Instrument<br />
und drehte stimmend an den Wirbeln. Zwei Schritte und er stand neben der<br />
Sängerin, die eben die erste Strophe des Liedes beendete. Der alte Organist ließ<br />
vor Schreck für einen Moment die Hände von den Tasten sinken, aber dann setzte<br />
er leise zum Zwischenspiel an. Und jetzt schwang der zarte Geigenklang wie<br />
einst durch das Kirchenschiff. Perlend hell wölbten sich die Töne über der Bassbegleitung<br />
durch die Orgel. Fritz brauchte keine Noten. Der Wellengang der Melodie<br />
war wie eingebrannt in seinem Gedächtnis. Die aufzuckenden Stakkati waren<br />
Dornen im Reigen der Töne. Ja, so ging Maria durch den Dornwald! So war auch<br />
der Dornwald seines Lebens in Tönen umgesetzt!<br />
Doch dann jubelte die Geige ihr „Kyrie Eleison“ in sieghaftem Aufbäumen über<br />
die Köpfe der Zuhörer hinweg, die wegen des ungewohnten Klanges atemlos<br />
lauschten. Die Sängerin setzte zur 2. Strophe an. Sie hatte sich von ihrem Schreck<br />
erholt und hell klang der Text vom Kind, das Maria unter ihrem Herzen trug, mit<br />
dem jubelndem Kyrie durch den weihrauchduftenden Raum. Er fand seine Fortsetzung<br />
in der 3. Strophe „Da haben die Dornen Rosen getragen“, klang es auf<br />
und Orgel und Geige trugen diesen Siegesruf der Rosenblüte über Dornen und<br />
Mühsal in jubelndem „Kyrie Eleison“ hin zu der Krippe am Seitenaltar. Es schien<br />
als käme im Ausklang der Töne ein zartes Echo fast wie Engelsgesang von dort<br />
zurück. Und während dieser zarte Ton sich im Gewölbe der Kirche verlor, packte<br />
Fritz schon seine Geige in den Kasten und verließ, ebenso wortlos wie er gekommen<br />
war, wieder den Chor durch den Turmeingang.<br />
Die Fidel aber trug er mit und steckte sie in seinen Rucksack. Dann schnallte er<br />
die Ski an und zog eine schnurgerade Bahn dem Wald zu. Während der Pfarrer<br />
noch, wie es damals Brauch war, das letzte Evangelium nach Johannes las: „Im<br />
Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott ….“, Strebte Fritz schon in<br />
langen Schwüngen der Grenze zu. Hinter sich aber ließ er den Packen von Angst<br />
und Mutlosigkeit, er hatte sie bei seinem Geigenspiel von der Seele geladen. Er<br />
hatte wieder zu seiner Art gefunden. Über ihm glänzten Myriaden von Sternen<br />
und strahlten ein mattes Licht auf seinen Weg. Er spürte keine Angst mehr und<br />
war sicher, dass er in einigen Stunden die rettende Grenze erreichen würde, denn<br />
in seine Gedanken hatte sich die Zuversicht eingenistet. „Da haben die Dornen<br />
Rosen getragen“. Auch auf seinem Lebensweg würden wieder Rosen gedeihen.<br />
Seine Geige hatte ihm mit ihren Tönen die Hoffnung auf eine gute Zukunft wiedergegeben.<br />
Der Stern der Zuversicht leuchtete ihm auf dem Abschiedsweg aus<br />
der Heimat.
182<br />
183<br />
„Immer doch schreibt der Sieger die Geschichte der Besiegten. Dem Erschlagenen<br />
entstellt der Schläger die Züge. Aus der Welt geht der Schwächere und zurück<br />
bleibt die Lüge.“ So schreibt Bert Brecht (1898 - 1956). Die Vertriebenen<br />
spüren dies in Variationen bis heute. Zeigt nicht die unsinnige Auseinandersetzung<br />
um das „Zentrum gegen Vertreibungen“ in Berlin, dass die Vertriebenen<br />
„besiegte“ Menschen sind, welchen „die Züge“ entstellt werden? Natürlich wissen<br />
wir alle aus den Politikerreden bei unseren Treffen, welchen hervorragenden<br />
Beitrag wir Vertriebenen und Nachkommen geleistet haben, beim Aufbau der<br />
Bundesrepublik. Aber warum will und kann man mancherorts nicht anerkennen,<br />
was es bedeutete, dass die Betroffenen 1950, drei bis fünf Jahre nach dem Verbrechen<br />
der Vertreibung in einer Charta feierlich auf Rache und Vergeltung verzichteten?<br />
Wie klein ist da dagegen das Gegacker jener, die uns nicht als existent<br />
wahrhaben wollen, die uns auch aus der Geschichte vertreiben wollen, die ihnen<br />
eben eine unangenehme Erblast sein mag. Auch das krampfhafte Verehren des<br />
Massenmörders Benesch durch einige tschechische Gruppierungen passt zu den<br />
Verdrängungsversuchen, die so hilflos erscheinen. Es ist schon fast rührend zu<br />
sehen, wie liebevoll aufpolierte Benesch-Figuren aufgestellt werden, um sich hinter<br />
ihnen verstecken zu können und sich nicht mit der Wahrheit seiner Verbrechen<br />
befassen zu müssen.<br />
Es fiel mir nicht leicht, dieses Buch zu den Jahrestagen der Vertreibung als Hauptthema<br />
zusammenzustellen. Es ist in Vielem eine Dokumentation geworden, und<br />
das sollte es auch werden: eine Dokumentation von Einzelschicksalen, nicht von<br />
Staaten, von Völkern, in Namenlosigkeit. Die Opfer der Verbrechen haben Namen.<br />
Es ist nicht Sinn dieses Dokumentierens, Verzweiflung und Wut wachzuhalten,<br />
sondern ein Gedenken zu ermöglichen und die Wahrheit zu geben, auf der die<br />
Brücken gebaut werden können, heute ebenso wie es schon 1950 begonnen und<br />
versucht wurde.<br />
Ein weiterer, schöner Schwerpunkt dieses Bandes stellen einzelne Facetten der<br />
Tierwelt des Böhmerwaldes dar, in Sagen, Forschungen, Erzählungen, in der Kunst<br />
und im Bild.<br />
Ich danke wieder allen, die beigetragen haben durch ihre Einsendungen, ein rundes<br />
Werk zu erschaffen. Den in den Texten Genannten ebenso der Dank, wie den<br />
dort Ungenannten: Martha Hans, Friederike,Ingo und Ulf Hans.<br />
Wir gedenken in Dankbarkeit unserer langjährigen großartigen Mitarbeiterin Maria<br />
Frank, die währen der Entstehung dieses Buches verstorben ist. Ihrem breiten<br />
Wissen haben wir viel entnehmen können, wie auch dieser Band zeigt.<br />
Und in die Seele blüht uns<br />
ein Himmelszweig herein:<br />
Gott grüßt, Gott lächelt wieder<br />
in einem Kindelein<br />
In Segenskraft erschwelend<br />
breitst du die Arme aus:<br />
da irr’n wir nimmer im Elend,<br />
wir sind zu Haus, zu Haus!<br />
Wir sind so herzlich müde.<br />
0 Kind, neig dich uns zu,<br />
Friedlosen uns gibt Friede,<br />
Abgrund der Liebe du!<br />
Wir haben tief gelitten,<br />
der Heimatlosen Schmerz,<br />
es kann ja kaum mehr bitten<br />
das unbeholfene Herz.<br />
Still hält des Sternes Wandel,<br />
die Fraue kniet verzückt,<br />
in ihren blauen Mantel<br />
sind rote Dornrosen gestickt.<br />
In uralt hohler Linde<br />
weilt wunderauserkorn<br />
die Mutter mit dem Kinde,<br />
im Wald hat sie’s geborn.<br />
Von milden Himmelsglocken<br />
erklingt ein jäh’ Geläut.<br />
Weiß Gott! Sind gar erschrocken<br />
wir bangen Elendsleute.<br />
Es dringt ein reich Gefunkel,<br />
ein selig weißer Strahl,<br />
herab in unser Dunkel,<br />
ein Engelschrei ins Tal.<br />
Nachwort<br />
Weihnachten der vertriebenen Menschen<br />
Günther Hans<br />
Hans Watzlik
184<br />
185<br />
Josef Fruth: “In menschlicher Obhut“ (Hinterglasbild)<br />
Triptichon „Vertreibung“ von Frau Gabriele Breit<br />
Grußwort beim Bundestreffen in der Dreiländerhalle am 31. Juli 2005 von Ingo Hans<br />
Als Bundesvorsitzender des Deutschen <strong>Böhmerwaldbund</strong>es begrüße ich Sie auf das Herzlichste<br />
zum 23. Bundestreffen hier in der Dreiländerhalle in unserer Patenstadt Passau.<br />
Noch ist uns dieser neue Treffensort fremd, doch die Menschen, die sich hier zusammen<br />
gefunden haben, sind einander vertraut und so hoffe ich, dass auch dieses Bundestreffen<br />
zu einem großen Familienfest wird.<br />
Das Jahr 2005 ist ein besonderes Jahr. In ihm feiern wir den 200. Geburtstag unseres<br />
großen Dichters Adalbert Stifter, wir begehen den 200. Todestag von Friedrich Schiller,<br />
einer der zentralen Gestalten der deutschen Literaturgeschichte und wir gedenken des<br />
50. Todestages von Albert Einstein, der mit seiner Theorie das Weltbild der physikalischen<br />
Forschung grundlegend erweiterte.<br />
Es ist aber auch das Jahr, in dem sich mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges der Beginn<br />
von Flucht, Deportation und Vertreibung von 14 Millionen Deutschen zum 60. Male<br />
jährt.<br />
Mit dem Ende des Krieges begann der Holocaust der Sudetendeutschen. Wer nicht gefallen,<br />
vermisst, verschleppt oder in Kriegsgefangenschaft war, musste um sein nacktes<br />
Leben bangen. Viele kamen in tschechische Konzentrationslager, wurden misshandelt,<br />
erschlagen oder starben auf den Todesmärschen vor Erschöpfung. Die wilden Austreibungen,<br />
wie sie später genannt wurden, forderten einen immensen Blutzoll unter den<br />
kollektiv verdammten Menschen.<br />
Dann folgte, was als humane Aussiedlung geschehen sollte: Über Nacht zum Packen<br />
aufgefordert, mussten die Sudetendeutschen ihre Habseligkeiten notdürftig zusammen<br />
Dokumentation des Jahres 2005
186<br />
187<br />
schnüren; Wertsachen,<br />
Grundbesitz, Häuser und<br />
Fabriken blieben ebenso<br />
zurück, wie die Gräber<br />
der Angehörigen, die<br />
Stätten der Kultur und<br />
des Glaubens. Durch die<br />
Vertreibung aus der Heimat wurde die wärmende Einheit der Dorf- und Stadt-, der Hausund<br />
Familiengemeinschaften brutal zerrissen. Die vertriebenen Menschen waren entwurzelt<br />
und nicht mehr eingebunden in eine Wertegemeinschaft, die trägt und hält. Auch<br />
daran muss in diesem Gedenkjahr erinnert werden!<br />
Vor 55 Jahren, nur 5 Jahre nach Flucht und Vertreibung, wurde am 5. August in Stuttgart<br />
die „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ verkündet. Sie war die Grundlage unserer<br />
Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten. Der Verzicht auf Rache und Vergeltung gab<br />
uns die moralische Kraft zum Wiederaufbau und zum friedlichen Zusammenleben. Sie<br />
war ein Appell zu harter und unermüdlicher Arbeit, zur Solidarität mit den Mitbürgern<br />
sowie zum Vertrauen auf die geistige und materielle Überwindung des grausamen Geschehens.<br />
Ihr Herzstück bildete das Vertrauen auf die Kraft des Rechtes, vor allem des<br />
Rechtes auf die angestammte Heimat.<br />
Dort, wo die „Charta“ uns Vertriebenen Pflichten auferlegte, wurde sie erfüllt. Unsere<br />
Forderungen hingegen sind offen geblieben und Opfer der „Political Correctness“ geworden,<br />
die unser Bundeskanzler perfekt beherrscht. Er meidet das Gespräch mit den<br />
Vertriebenen und qualifiziert sie im Ausland als „Randgruppe“ ab, für die offensichtlich<br />
die Obhutspflicht nicht mehr gilt.<br />
In Prag, der Hauptstadt des Landes, das über drei Millionen Deutsche entrechtet, enteignet<br />
und vertrieben hat, rechtfertigt er geradezu die Vertreibung oder spricht von „unschuldigen<br />
Tätern“. Zu Lasten deutscher Bürger biedert er sich im Ausland an. Lassen<br />
Sie mich deshalb von dieser Stelle aus der Bayerischen Staatsregierung danken für ihre<br />
stetige politische, ideelle und finanzielle Hilfe. Auch der Sudetendeutschen Stiftung sei<br />
Dank gesagt für die finanzielle Unterstützung, ohne die unsere Großveranstaltung nicht<br />
möglich wäre.<br />
Schon 1979 erkannte Papst Benedikt XVI., der damals Erzbischof von München und<br />
Freising war, in seiner Predigt zum Sudetendeutschen Tag in Bezug auf das Unrecht der<br />
Vertreibung: „Die Weltöffentlichkeit hört aus vielen Gründen nicht gerne davon, es passt<br />
nicht in ihr Geschichtsbild hinein. Sie drängt dazu, dieses Unrecht zu verschweigen, und<br />
auch Wohlgesinnte meinen, dass man um der Versöhnung willen nicht mehr davon sprechen<br />
sollte.“ (Ende des Zitats)<br />
Versöhnung kann jedoch durch kein politisches Papier verordnet werden. Es gibt keine<br />
Schleichwege, die an Recht und Wahrheit vorbeigehen wie viele Politiker glauben. Erst<br />
Bei der Ausstellungseröffnung<br />
v.r.: Frau<br />
Rosa Tahedl, Frau<br />
Gabriele Breit, Oberbürgermeister<br />
Albert<br />
Zankl<br />
Oberbürgermeister unserer<br />
Patenstadt Passau<br />
Albert Zankl eröffnet die<br />
Ausstellungen im Kulturmodell.<br />
wenn ein befriedigender und befriedender Abschluss des Vertreibungsunrechts erreicht<br />
ist, erst dann wird Versöhnung und Verständigung möglich werden.<br />
Die Enteignung von mehr als 3 Millionen Sudetendeutschen, die Vertreibung aus ihrer<br />
Heimat, 250 000 Ermordete und Vermisste – das alles muss Grundlage einer moralischen<br />
Diskussion sein.<br />
In seiner bemerkenswerten Rede im Rahmen der Feierstunde zum 60. Jahrestag des Kriegsendes<br />
gab Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler dem Ausdruck:<br />
„… Noch immer trauern unzählige Menschen in vielen Ländern um den Verlust ihrer<br />
Heimat. … Wir trauern um alle Opfer – um die Opfer der Gewalt, die von Deutschland<br />
ausging, und um die Opfer der Gewalt, die auf Deutschland zurückschlug. Wir trauern<br />
um alle Opfer, weil wir gerecht gegen alle Völker sein wollen, auch gegen unser eigenes.<br />
…“<br />
Und weiter führte er aus: „Wir gedenken des Leids der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen,<br />
der vergewaltigten Frauen und der Opfer des Bombenkrieges gegen die deutsche<br />
Zivilbevölkerung. Wir haben die Verantwortung, die Erinnerung an all dieses Leid<br />
und an seine Ursachen wach zu halten und wir müssen dafür sorgen, dass es nie wieder<br />
dazu kommt. Es gibt keinen Schlussstrich. …“ (Ende des Zitats)<br />
Es gibt keinen Schlussstrich – diese Feststellung richtet sich jedoch nicht nur an uns<br />
Deutsche. Sie richtet sich genauso an diejenigen Völker, die die eigenen Untaten gegen<br />
Deutsche, die Völkermord und Vertreibung als „gerechte Strafe“ für deutsche Schuld zu<br />
definieren versuchen.<br />
Die sudetendeutsche Volksgruppe bekennt sich zu dem in deutschen Namen begangenen<br />
Unrecht. Das Geschichtsbild vieler Tschechen und vor allem der tschechischen Politiker<br />
ist indes nach wie vor von jener Selbstgerechtigkeit geprägt, die schon am Anfang der<br />
Republikgründung stand, die gegen den Willen der vereinnahmten Minderheiten erfolgte<br />
und in den Jahrzehnten kommunistischer Herrschaft verfestigt worden ist.<br />
Wir kommen nur zu einem guten Verhältnis zwischen Sudetendeutschen und Tschechen,<br />
wenn eine Mehrheit der Tschechen einmal nicht mehr sagen wird, die Vertreibung der<br />
Sudetendeutschen war richtig und die Benesch-Dekrete sind rechtens. Deshalb müssen<br />
wir nicht nur aus Gründen der geographischen Nachbarschaft, sondern auch eingedenk<br />
unserer gemeinsamen Geschichte über alles reden und die zur Zeit herrschende Sprachlosigkeit<br />
überwinden.<br />
Dass wir dabei nicht<br />
auf die Hilfe der zur<br />
Zeit in Berlin regierenden<br />
Politiker hoffen<br />
können, zeigt das Verhalten<br />
des deutschen<br />
Bundeskanzlers, das
188<br />
189<br />
Frau Bürgermeister<br />
Dagmar Plenk überreicht<br />
den Kulturpreis<br />
der Stadt Passau für die<br />
<strong>Böhmerwäldler</strong> an Frau<br />
Gabriele Breit.<br />
Die Kulturpreisträgerinnen<br />
Rosa Tahedl und<br />
Gabriele Breit mit Ingo<br />
Hans bei der Matinee<br />
im Kulturmodell.<br />
60 Jahre Vertreibung bedeutet drei Generationen Vertriebener, ihrer Kinder und Enkelkinder.<br />
Eine Zeit des Leidens, des Todes, der Integration, des Wiederaufbaues, des demokratischen<br />
Parlamentarismus. Der Beitrag der Vertriebenen zum heutigen Deutschland<br />
ist bekanntlich enorm. Und dennoch haben sich die deutschen Politiker und die<br />
deutsche Historikerzunft verhältnismäßig wenig mit der Vertreibung auseinandergesetzt.<br />
Lange war die Thematik ein Stiefkind der Geschichte. Heute hat zwar eine gewisse Aufarbeitung<br />
der Tragödie begonnen, allerdings nicht immer mit intellektueller und wissenschaftlicher<br />
Redlichkeit, nicht immer mit Ehrfurcht und Menschenwürde.<br />
60 Jahre war daher auch unser Hauptanliegen, die Bewahrung unseres kulturellen Erbes<br />
und damit die Wahrung unserer Identität. Einer Identität, die die Erlebnisgeneration noch<br />
unmittelbar und bewusst in der heimatlichen Gemeinschaft erlebt hat. Meine Generation<br />
und die der etwas jüngeren<br />
hat diese Identität<br />
bereits durch Überlieferung,<br />
freilich eine existentiell<br />
immer noch sehr<br />
stark verankerte, erworben.<br />
Jahrzehntelang wa-<br />
gekennzeichnet ist von<br />
wirtschaftlichen Erwägungen<br />
und politischem<br />
Machtkalkül.<br />
Deshalb sollten wir unseren<br />
eigenen Weg gehen.<br />
Noch können wir es uns nicht leisten, nur Traditions- und Betreuungsverein zu sein.<br />
Noch gilt für uns die heimatpolitische Verpflichtung, die wir auch den nachfolgenden<br />
Generationen deutlich machen müssen.<br />
ren wir mit den Erzählungen<br />
und Erinnerungen<br />
der Eltern konfrontiert,<br />
die immer wieder<br />
sprechend das Bild der<br />
Heimat und deren grausamen<br />
Verlust aufbauten, und deren Schmerz wir erlebten.<br />
Auch die Enkelgeneration kann diese Identität erfahren, in anderer Weise, nämlich durch<br />
das unbefangene und unbelastete Fragen nach den Ursprüngen, nach der Herkunft – ein<br />
Wissenwollen, das vielleicht notwendig ist, um der Persönlichkeit mit dem Wissen um<br />
sich selbst ihre angemessene Weite und Tiefe zu geben.<br />
Dass dies tatsächlich so ist, zeigen die Anfragen junger Menschen auf unserer Homepage<br />
und das geschichtliche Interesse von Schulklassen an den Berichten über Schicksale<br />
von vertriebenen Zeitzeugen.<br />
Bewahrung der Identität und das Wissen um sie ist an das Erinnern gebunden. Unsere<br />
Kultur, unsere Geschichte dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Deshalb ist es mir ein<br />
großes Anliegen unserer Patenstadt Passau für ihre Hilfe zu danken. Sie ist eine verdienstvolle<br />
Sachwalterin unserer <strong>Böhmerwäldler</strong> Identität.<br />
Auch wir Vertriebenenverbände sind weiter in der Pflicht. Unbeirrt und mit allen uns zu<br />
Gebote stehenden Mitteln müssen wir unsere Position vertreten und verfechten, allerdings<br />
ohne zeitliche Vorgabe<br />
und hektische Ungeduld.<br />
Lassen wir uns<br />
von der Erkenntnis<br />
Adalbert Stifters leiten:<br />
„.... es ist eine heilige<br />
Lehre der Geschichte,<br />
dass Übeln auf uner-<br />
Oberbürgermeister Albert<br />
Zankl zeichnet Bundesvorsitzenden<br />
Ingo<br />
Hans mit dem „Kulturellen<br />
Ehrenbrief“ der<br />
Stadt Passau aus. l. Friederike<br />
Hans<br />
Frau Bürgermeister<br />
Dagmar Plenk überreicht<br />
den Kulturpreis<br />
der Stadt Passau für die<br />
<strong>Böhmerwäldler</strong> an Frau<br />
Rosa Tahedl. Zwei ihrer<br />
Enkel gratulieren ihr<br />
herzlich.
190<br />
191<br />
Einzug in den Dom zur<br />
gemeinsamen Andacht<br />
mit Domdekan Prof. Dr.<br />
Otto Mochti<br />
müdliche aber ruhige Weise“ abzuhelfen ist, auch „wenn es jahrelang dauert“.<br />
Unsere Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten bewährt sich immer mehr als Voraussetzung<br />
für die Zukunft. Denn gerade durch unser Beharren und unser Nichtverzichten auf<br />
Heimatliebe und Tradition haben wir deutschen Vertriebenen der Welt einen Dienst erwiesen:<br />
Wir haben das Recht auf die Heimat nie aufgegeben, es behauptet und gefordert<br />
und dadurch einen gefährlichen Präzedenzfall verhindert, nämlich, dass das Recht auf<br />
die Heimat entbehrlich ist und dass Gewaltpolitiker das Land ihrer Nachbarn nehmen<br />
und die Bevölkerung vertreiben können. Dem muss immer entgegengewirkt werden!!<br />
Ich möchte schließen mit den Worten des Erzbischofs der Diözese Freiburg Dr. Robert<br />
Zollitsch: „Damit Europa immer mehr zu einer Gemeinschaft in Frieden, gegenseitiger<br />
Achtung, Freiheit und Gerechtigkeit werden kann, dürfen wir die Vergangenheit nicht<br />
vergessen und verdrängen. Zukunft braucht Herkunft, braucht eine konstruktive Auseinandersetzung<br />
mit der Vergangenheit. Unsere eigene Geschichte, die Opfer und Märtyrer<br />
erinnern, ja mahnen uns immer wieder aufs Neue, unsere Stimme aufrichtig und mutig<br />
zu erheben, wenn Menschen gewaltsam vertrieben werden und ihre Menschenwürde mit<br />
Füßen getreten wird.“ (Ende des Zitats)<br />
In diesem Sinne grüße ich Euch noch einmal und danke Euch, dass Ihr gekommen seid.<br />
Möge auch dieses 23. Bundestreffen wieder eine Demonstration sein für das Recht auf<br />
Heimat und gegen Vertreibung und gegen Vergessen.<br />
Festlicher Zug durch die Stadt zum Dom.<br />
Stellv. Bundesvorsitzender<br />
Franz Payer spricht<br />
bei der Totenehrung am<br />
Dom<br />
Viele Landsleute sind<br />
nach Passau gekommen<br />
und ziehen in Tracht<br />
durch die Stadt.
192<br />
193<br />
Bundesjugendleiter Stefan<br />
Klotz beim großen<br />
Volkstumsabend, der<br />
Adalbert Stifter gewidmet<br />
sit.<br />
und Lied gestalten die<br />
Gruppen den Abend<br />
Eröffnung der Ausstellungen<br />
in der Dreiländerhalle,<br />
musikalisch umrahmt<br />
von der Böhmerwaldjugend.<br />
Musik<br />
Beim Volkstanzen auf<br />
dem Rathausplatz<br />
Mit Tanz
194<br />
195<br />
Das prächtige Bühnenbild bei der Kundgebung. Bundesvorsitzender Ingo Hans<br />
grüßt seine <strong>Böhmerwäldler</strong><br />
Domdekan Prof. Dr. Otto Mochti zelebriert den Festgottesdienst in der Dreiländerhalle.<br />
Unterstütz wird er durch Pater Daniel Herman aus Prag.<br />
Die Arbeiten vieler fleißiger Hände werden bei der Ausstellung in der Dreiländerhalle<br />
präsentiert. Hier eine Bilderreihe quer durch die Ausstellungsstände.
196<br />
197<br />
Die Ehrengäste des Bundestreffens<br />
2005<br />
Rosenheim 50-Jahrfeier am 1./2. Oktober 05. Die fünf Gründungsmitglieder unserer<br />
Heimatgruppe.<br />
Staatsminster Erwin Huber,<br />
der Leiter der Bayerischen<br />
Staatskanzlei, ist<br />
der Hauptredner bei der<br />
Großkundgebung und<br />
annähernd 2000 <strong>Böhmerwäldler</strong><br />
lauschen seinen<br />
Worten.<br />
Rosenheim 50-Jahrfeier<br />
am 1./2. Oktober 05. Totenehrung<br />
auf dem Friedhof<br />
in Rosenheim.<br />
Oberbürgermeister Albert<br />
Zankl überbringt die<br />
Grüße der Patenstadt bei<br />
der Kundgebung in der<br />
Dreiländerhalle.<br />
Rosenheim Bei der 50-<br />
Jahrfeier mit den „Musikfreunden<br />
Erhard Helget“.
198<br />
199<br />
Frauenarbeitskreis des<br />
DBB in Baden-Württemberg<br />
Referentinnen bei<br />
der Frauentagung 05 v.l.<br />
Anna Pöchmann, Helga<br />
Mühleisen, Friedl Vobis,<br />
Ingeborg Schweigl.<br />
Heidelberg Die Ehrungen bei der Hauptversammlung übernahm<br />
Josef Scherhaufer.<br />
Heidelberg Friedl Vobis<br />
und Franz Strunz beim<br />
Wäldlerball.<br />
Heidelberg Großes Interesse fand eine Stadtführung zum Thema<br />
„Die Kurpfalz und Böhmen“.<br />
Stuttgart Anni Heidinger<br />
und Ingo Schmetzer sorgen<br />
für Speisen zum Faschingstanz.<br />
Stuttgart Anni Bernat<br />
und Maria Riedl hüten<br />
die Kasse am Fasching<br />
im HdH, Edi und Sepp<br />
kontrollieren alles!<br />
Heidelberg Der Singkreis<br />
und die Jugend, unter<br />
der Leitung von Helmut<br />
Unger, bei der Adalbert-Stifter-Ausstellung.
200<br />
201<br />
Göppingen „Jung und<br />
Alt“ beim Kulturnachmittag.<br />
Ludwigsburg Die Trachtenträger unserer Gruppe beim Bundestreffen<br />
in Passau.<br />
Ludwigsburg Jahresausflug über Eger in das Erzgebirge. Nach<br />
der Stadtführung in Eger vor dem Brunnen am Stadtplatz.<br />
Göppingen Unsere<br />
Gruppe auf der Fahrt<br />
zum Bundestreffen bei einem<br />
Besuch im Stift Engelszell<br />
OÖ<br />
Frauenarbeitskreis des DBB in Baden-Württemberg Teilnehmer der Frauentagung in<br />
Nürtingen.<br />
Göppingen Beim Kulturnachmittag<br />
am 16.10.05.
202<br />
203<br />
Bietigheim-Bissingen Die Frauengruppe beim Weihnachtsmarkt<br />
in Bietigheim mit ihrem Verkaufsstand, v.l. Hannelore<br />
Rehberger, Anni Mayer, Emmi Schläger, Anni Schillgalies.<br />
Ingolstadt Unser Vereinsausflug führte uns nach Slowenien – Bled und die Julischen<br />
Alpen. Hier vor dem Rathaus der Landeshauptstadt Ljubljana (Laibach).<br />
Künzelsau Auf der Fahrt nach Passau zum Bundestreffen vor dem Adolf-Webinge-Haus.<br />
Fellbach Unsere HG bei<br />
der alljährlichen Vereinsmeisterschaft<br />
im Tischkegeln.<br />
Bei den Frauen belegte<br />
Hedwig Grill und<br />
bei den Männern Reinhold<br />
Fink den ersten<br />
Platz.<br />
Ingolstadt Der festlich geschmückte Saal zur<br />
Weihnachtsfeier, den unsere fleißigen Böhmerwaldfrauen<br />
mit selbst gebastelter Dekoration und<br />
selbst gebackenen Plätzchen jedes Jahr arrangieren.
204<br />
205<br />
Nürnberg Heimatnachmittag im Rührersaal<br />
Schrobenhausen Unsere Singgruppe am Tag der Heimat .<br />
Bietigheim-Bissingen Weihnachtsfeier mit den Kindern und<br />
Frauen Elke Franz, Claudia Queißer, Erna Bartl.<br />
Nürnberg Totenehrung bei der Wallfahrt nach Philippsreuth mit Alt-Bischof Eder.<br />
Bietigheim-Bissingen<br />
Pferdemarkt – Umzug mit<br />
dem Adalbert-Stifter-<br />
Haus.
206<br />
207<br />
Backnang Stifterabend<br />
im Oktober 05, gestaltet<br />
vom Sing- und Tanzkreis<br />
Backnang und der Singund<br />
Tanzgruppe der <strong>Böhmerwäldler</strong><br />
Esslingen.<br />
Esslingen Die<br />
Kindergruppe<br />
bei der Darbietung<br />
zur Muttertagsfeier<br />
im Vereinsheim<br />
Wolftor.<br />
Landesfrauenarbeitskreis<br />
Bayern Landesfrauenreferentin<br />
Erika Weinert<br />
mit ihren Helferinnen<br />
beim Weihnachtsbazar im<br />
Dezember 05.<br />
Esslingen Ein Teil unserer<br />
„Ehemaligen“ bei der<br />
Freizeit im Adolf-Webinger-Haus<br />
in Lackenhäuser.<br />
Der Aufenthalt mit<br />
alten Freunden, verschiedene<br />
Ausflügen in die<br />
Heimat und das gemeinsame<br />
Singen bleiben uns<br />
in guter Erinnerung.<br />
Esslingen Teilnehmer<br />
unserer Heimatgruppe<br />
beim Bundestreffen in<br />
Passau.<br />
München Die Sing- und<br />
Volkstanzgruppe in Oberplan<br />
bei der Feier zu<br />
Stifters 200. Geburtstag<br />
im Oktober 05.<br />
Backnang Stifterabend<br />
im Oktober 05.
208<br />
209<br />
Kirchheim 50-Jahrfeier, Vorsitzender<br />
Franz Essl jun. beim<br />
Gespräch mit unserer Schirmherrin<br />
über die Feier Frau Oberbürgermeisterin<br />
Angelika<br />
Matt-Heidecker.<br />
Ellwangen Bei der Europeade<br />
in Antwerpen<br />
Kirchheim Prof. Jürgen Essl<br />
aus Stuttgart gestaltete musikalisch<br />
den Familiengottesdienst<br />
an der Orgel in der<br />
Kirche „Maria-Königin“ bei<br />
unserer 50-Jahrfeier.<br />
Ellwangen Bei der Europeade<br />
in Riga<br />
Kirchheim Bei der 50-<br />
Jahrfeier umrahmte die<br />
Spielschar aus Nürtingen<br />
die Adalbert-Stifter-Feier.<br />
Ellwangen Unsere Kindergruppe<br />
„auf den Spuren<br />
der Indianer“.<br />
Kirchheim 50-Jahrfeier,<br />
unser Ehrenvorstand<br />
Franz Essl sen. und die<br />
Gäste bei den Feierlichkeiten.
210<br />
211<br />
Nürtingen Die Kindergruppe gestaltete unser Weihnachtsfeier.<br />
Aalen Der Vorstand und<br />
geehrte Mitglieder bei<br />
der Jahreshauptversammlung.<br />
Nürtingen Unsere Kindergruppe und die Spielschar bei der Weihnachtsfeier.<br />
Aalen Bei der Eröffnung<br />
der Adalbert-Stifter-Ausstellung<br />
v.l. Bürgermeister<br />
Dr. Schwerdtner, Obmann<br />
Werner Marko und<br />
MdL a.D. Gustav Wabro.<br />
Aalen Bei der Eröffnung<br />
der Adalbert-Stifter-Ausstellung<br />
im Rathaus. Unsere<br />
Spielschar umrahmte<br />
die Stunde.
212<br />
213<br />
Das im Oktober 05 neu errichtete Stifter-<br />
Denkmal vor dem Adalbert-Stifter-Heim in<br />
Waldkraiburg.<br />
Landesgruppe Bayern<br />
Nach 5-jähriger Pause wegen Bauarbeiten<br />
ist das Stifterdenkmal auf dem Böhmerwaldplatz<br />
in München wieder frei zugänglich.<br />
Landesverband Baden-<br />
Württemberg Bei der<br />
Jahreshauptversammlung<br />
in Nürtingen.<br />
Ernst Quitterer Am Wege 4<br />
Gunther Fruth Kalendarium 5<br />
Elfriede Fink Denkwürdiges <strong>2007</strong> 17<br />
Ingo Hans Geleitwort 18<br />
Leo Hans Mally Waldfasching 20<br />
Adalbert Stifter Morgens nach dem Balle 20<br />
Karl Halletz Verkehrt verkehrt 21<br />
Rosa Tahedl Eine Osterlegende 22<br />
Anna Kangler Gfrei di ner 23<br />
Mila Czastka Baumblut 23<br />
Ernst Braun Volksglaube um Walpurgisnacht 24<br />
Erich Hans Pflanzen und Tiere des Böhmerwaldes 25<br />
Karl Halletz D’Muttahejnd 25<br />
N.N. Die Tierwelt der Urzeit im Böhmerwald 27<br />
Christof Pötzl Die Zucht von Silberfüchsen am Tillenberg 28<br />
Anton Schacherl Die Volksnamen der Vögel 32<br />
Josef Schramek Beim Girglmathesn tun s’ Fedrnschleißn 33<br />
N.N. Die Zuchtviehausstellung in Wallern 36<br />
Johann Tuma Windbruch und Borkenkäfer 1870 37<br />
Augustin Galfe Ross und Hund im Leben des Landmanns 39<br />
Franz Wöß S’ Wolfablass’n am Martinitag 40<br />
Peter Maier Sage vom Stelzl 40<br />
Hruschka Rudolf Die Hungersnot 1771 41<br />
Rosa Tahedl Haustiere als Partner der Bauernfamilie 42<br />
Franz Bayer Bienenzucht im Böhmerwald 45<br />
Karl Spannbauer Der Hund des Scherenschleifers 46<br />
Adolf Heidler Der Kuckuck 48<br />
Adolf Heidler Ein kurioses Jagderlebnis 49<br />
Adolf Heidler Urwald am Brennetberg 50<br />
Adolf Heidler Der gute Hirt 50<br />
Adolf Heidler Die Tierwelt im Aberglauben 51<br />
Anne Klarner Waldbewohner 54<br />
Anne Klarner Kater Felix 55<br />
Anne Klarner Abendständchen 56<br />
Willi Jung Jugenderlebnis 58<br />
Maria Frank Hühnerhaltung auf dem Veilhof 61<br />
Maria Frank Gänsehaltung in Oppelitz 68<br />
Anna Quitterer Die Gänse 70<br />
Maria Frank Das Entlein Quack-Quack 72<br />
Anna Kangler Bei uns im Böhmerwald war es Sitte... 74<br />
Aalen Bei unserer 1. Mai<br />
Wanderung.<br />
Inhaltsverzeichnis
214<br />
215<br />
Anna Kangler Der Stier Muran 76<br />
Anna Kangler Die Weiße 77<br />
Wenzel Schwarz Do hot mi oamol oaner gfroat 78<br />
Anna Kangler Ein gefährlicher Nachmittag 78<br />
Ernst Quitterer Die Simmentalerinnen 78<br />
Erna Dittrich Die Sache mit dem Esel 80<br />
Karl Halletz D’ Scheck und die Cowboys 85<br />
Karl Spannbauer Der Mordfall 86<br />
Anna Kangler Eine Wilderergeschichte 87<br />
Anna Kangler Jagaglück 88<br />
Maria Frank Stückln vom Wenzalbauern 89<br />
Anna Kangler A Auto 90<br />
Josef Bernklau Erinnern an die Radbusa 91<br />
Sepp Skalitzky Abschied für immer 104<br />
Sepp Skalitzky Über die Grenze 105<br />
Willi Jung Erinnerungen 106<br />
Maria Konstanzer Kriegsende, Besatzung, Vertreibung 109<br />
Elfriede Holub Fahrt ins Ungewisse 111<br />
Herma Faschingbauer Verschleppt und “abgeschoben” 114<br />
Franz N. Praxl Die Vertreibung, Oberplan, Haus Nr.128 121<br />
Rudolf Jungbauer Kriegsende und Vertreibung 123<br />
Hilde Friepes 1945-1960, nach Tonbandaufnahme 125<br />
Franz Tonka Vertreibung, Abschied 137<br />
N.N. Aug’ um Auge, Zahn um Zahn? 141<br />
Rosa Tahedl 1946 - a Johr sou schwar wia ra Stoa! 144<br />
Rosa Tahedl Man muss sich nur zu helfen wissen 146<br />
Manfred Pranghofer Ein Aussiedlungsdokument 147<br />
Johann Bürgstein Kleindrosen 149<br />
Rosa Tahedl Wie es daheim nach der Vertreibung<br />
weiterging 152<br />
Rosa Tahedl Wiederbesiedelung des Sudetenlandes 156<br />
Hans Watzlik In Hoffnung und Geduld! 161<br />
Hans Petrou Erinnern 163<br />
Karl Halletz Vor 50 Jahren 163<br />
Josef Bernklau Auf dem großen Arber 164<br />
Grete Rankl Unsre Gehäng Marter 164<br />
Adolf Heidler Die Hoamat 166<br />
Karl Halletz Geborgenheit 167<br />
Karl Halletz Erinnerung 167<br />
Ernst Braun Weihnachtliches Liedgut und Brauchtum 170<br />
Adolf Heidler Dö staade Zeit 170<br />
Ernst Braun Wer hat nicht gefolgt? 171<br />
Grete Rankl Weihnachten bei uns daheim 173<br />
Karl Halletz Da obrochane Grotzen 175<br />
Karl Halletz Heiliger Abend 176<br />
Karl Halletz Weihnachtsgedanken 178<br />
Rosa Tahedl Der Stern der Zuversicht 179<br />
Günther Hans Nachwort 182<br />
Hans Watzlik Weihnachten der vertriebenen Menschen 183<br />
Hans Ingo Dokumentation 185
216<br />
Bestellungen an:<br />
Frau Anni Heidinger<br />
Im Krautgarten 42<br />
D-74321 Bietigheim Bissingen<br />
„Roßei b’schlong“<br />
Kinderlieder, Spiele und Reime aus dem<br />
Böhmerwald, über viele Jahre gesammelt<br />
und liebvoll zu einem Buch zusammengestellt<br />
von Frau Ingeborg Schweigl, illustriert<br />
mit herrlichen Zeichnungen von Frau<br />
Gabriele Breit.<br />
Ein wunderschönes Buch für Kinder,<br />
Eltern, Omas und Opas, sowie für alle,<br />
die Kinder lieben. Auch Kindergärten,<br />
Kinderhorte und Grundschulen können<br />
Anregungen<br />
darin finden.<br />
Mit diesem Buch kehrt die Kindheit im<br />
Böhmerwald zu uns zurück. Das Kindsein<br />
in der Geborgenheit „dahoam“ wird wieder<br />
lebendig.<br />
Es kostet Euro 15,30 + Versandkosten<br />
Herausgeber: <strong>Deutscher</strong> <strong>Böhmerwaldbund</strong> e.V., Bundesverband und Verein der<br />
heimattreuen <strong>Böhmerwäldler</strong> e.V., Verlag „Hoam!“, Waldkirchen<br />
Böhmerwald-Lexikon<br />
Sammlung geographischer und kultureller<br />
Daten<br />
von Heinz Präuer<br />
Aus dem Innhalt:<br />
Abschnitt A: Das Land<br />
Abschnitt B: Ortsregister in Deutsch und Tschechisch<br />
Abschnitt C: Personen und ihre Werke<br />
Abschnitt D: Gedichte, Romane, Erzählungen,<br />
literarische Erzeugnisse, musikalische<br />
Schöpfungen<br />
Das Buch kostet Euro 10.-<br />
Zu beziehen von: Frau Anni Heidinger,<br />
Im Krautgarten 42, 74321 Bietigheim-Bissingen,<br />
e-mail: A.Heidinger@t-online.de