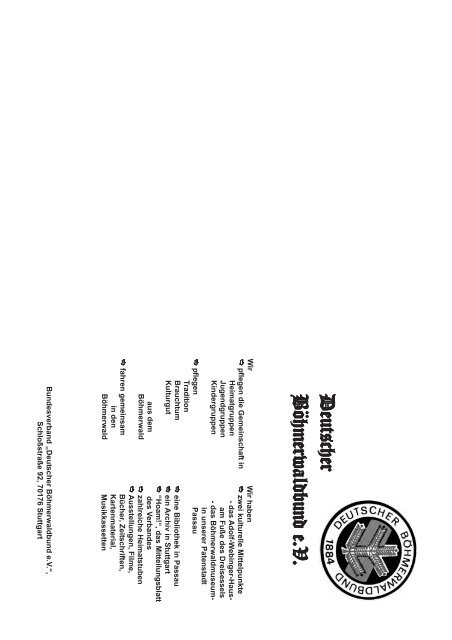Böhmerwäldler Jahrbuch 2005 - Deutscher Böhmerwaldbund eV
Böhmerwäldler Jahrbuch 2005 - Deutscher Böhmerwaldbund eV
Böhmerwäldler Jahrbuch 2005 - Deutscher Böhmerwaldbund eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1<br />
Bundesverband „<strong>Deutscher</strong> <strong>Böhmerwaldbund</strong> e.V.“,<br />
Schloßstraße 92, 70176 Stuttgart<br />
����� eine Bibliothek in Passau<br />
����� ein Archiv in Stuttgart<br />
����� “Hoam!“, das Mitteilungsblatt<br />
des Verbandes<br />
����� zahlreiche Heimatstuben<br />
����� Ausstellungen, Filme,<br />
Bücher, Zeitschriften,<br />
Kartenmaterial,<br />
Musikkassetten<br />
����� fahren gemeinsam<br />
in den<br />
Böhmerwald<br />
aus dem<br />
Böhmerwald<br />
����� pflegen<br />
Tradition<br />
Brauchtum<br />
Kulturgut<br />
Wir<br />
����� pflegen die Gemeinschaft in<br />
Heimatgruppen<br />
Jugendgruppen<br />
Kindergruppen<br />
Wir haben<br />
����� zwei kulturelle Mittelpunkte<br />
- das Adolf-Webinger-Hausam<br />
Fuße des Dreisessels<br />
- das Böhmerwaldmuseumin<br />
unserer Patenstadt<br />
Passau<br />
<strong>Deutscher</strong><br />
<strong>Deutscher</strong><br />
<strong>Böhmerwaldbund</strong> <strong>Böhmerwaldbund</strong> e.V e.V. e.V
2<br />
3<br />
Buch und Offsetdruck Josef Dötsch, Dr. - Schott - Str. 44, 94227 Zwiesel<br />
Bundestreffen <strong>2005</strong><br />
29. bis 31. Juli <strong>2005</strong><br />
Der Deutsche <strong>Böhmerwaldbund</strong> e.V. lädt dazu in die<br />
Patenstadt Passau ein.<br />
Verlag „Hoam!“ Waldkirchen, Böhmerwald<br />
Sitz Stuttgart<br />
Bestellung an: <strong>Deutscher</strong> <strong>Böhmerwaldbund</strong>, Anni Heidinger,<br />
Im Krautgarten 42, 74321 Bietigheim/Bissingen,<br />
Tel. 07147/6141<br />
Herausgegeben vom Deutschen <strong>Böhmerwaldbund</strong> e.V.<br />
Heimatverband der <strong>Böhmerwäldler</strong><br />
Bücher und Musikkassetten für die<br />
Böhmerwaldfamilie und ihre Freunde<br />
Alle Preise in Euro<br />
„Böhmerwaldjahrbuch“ 2004 4,10<br />
„Roßei b´schlong“, Kinderlieder, Spiele und Reime<br />
aus dem Böhmerwald, Ingeborg Schweigl 15,30<br />
„Unsere Heimat, Die Stadt Krummau an der Moldau“ 25,50<br />
„Erich Hans - Und immer rettet die Güte“ 10,50<br />
„Straßenkarte“, südl. Egerland - Böhmerwald<br />
Deutsch/Tschechisch 8,90<br />
„Der Böhmerwald heute“, Farbbildband, D.Raisch 33,10<br />
„Der Böhmerwald“, Bildband, E.Hans 16,30<br />
„Die Kost der <strong>Böhmerwäldler</strong>“ (Kochbuch) 7,60<br />
„Das Böhmerwald - Kratzei“, Über den Brauch des<br />
Ostereischenkens mit Anleitung<br />
zum Verzieren der Ostereier 7,60<br />
„Der Schwerttanz“ im südl. Böhmerwald 5,10<br />
„Das Zephyrin Zettl Buch“ 7,60<br />
„Hütbubensommer“ M. Frank 10,10<br />
„Als wir aus dem Böhmerwald vertrieben wurden“<br />
M. Frank, dokumentarische Berichte 11,70<br />
„Führer durch den Böhmerwald“<br />
Nachdruck Ausgabe Budweis 1888 24,50<br />
„Gruß aus dem Böhmerwald“, R. Fink<br />
200 farbige Ansichtskarten 28,60<br />
„Die Waldlermesse“ MC - 10,20<br />
„Leutln müaßts lusti sei“ MC - 10,20<br />
„Tief drin im Böhmerwald“ MC - 7,60<br />
erarbeitet von Günther Hans<br />
Umschlagbild und Kalendarium von Leopold Hafner<br />
<strong>Böhmerwäldler</strong><br />
<strong>Jahrbuch</strong><br />
<strong>2005</strong>
4<br />
5<br />
Besondere Feiertage:<br />
Karfreitag 25. März; Ostern 27. März; Ostermontag 28.März; Himmelfahrt<br />
5. Mai; Pfingsten 15. und 16. Mai; Fronleichnam 26.Mai; Tag der Deutschen<br />
Einheit 3. Oktober; Reformationsfest 31. Oktober; Allerheiligen 1.<br />
November; Buß- und Bettag 23. November<br />
10 Mo Wilhelm, Gregor, Sebastian<br />
11 Di Werner, Tasso<br />
12 Mi Ernst, Reinhold<br />
13 Do Hildegard, Gottfried, Veronika<br />
14 Fr Felix, Rainer<br />
15 Sa Maurus, Paul Eins.<br />
16 So Marzellus<br />
31 Mo Johann, Ludowika, Petrus<br />
24 Mo Ernst, Thimotheus<br />
25 Di Pauli Bekehrung<br />
26 Mi Alberich, Titus<br />
27 Do Joh. Chrisostomus, Angela<br />
28 Fr Karl d. Gr., Thomas v.<br />
Aquin<br />
29 Sa Valerius, Franz v. Sales<br />
30 So Martina, Adelgunde<br />
3 Mo Genoveva, Berthilde<br />
4 Di Rigobert, Angela, Titus<br />
5 Mi Joh.Nepomuk Neumann, Emilie<br />
6 Do Dreikönig, Ersch.d.Herrn<br />
7 Fr Valentin, Raimund, Reinhold<br />
8 Sa Erhard, Severin<br />
9 So Berthold, Julian<br />
1 Sa Neujahr<br />
2 So Namen Jesu, Abel, Gregor<br />
17 Mo Antonius<br />
18 Di Petri Stuhlf., Karlmann<br />
19 Mi Maria u. Martha, Knud<br />
20 Do Fabian, Sebastian<br />
21 Fr Agnes, Meinrad<br />
22 Sa Vinzenz, Anastasius<br />
23 So Emmerich, Heinr., Maria<br />
Verm.<br />
Eismond, 31 Tage<br />
Jänner<br />
Steinbock<br />
Welch ein rätselhaftes, unbeschreibliches, geheimnisreiches, lockendes<br />
Ding ist die Zukunft, wenn wir noch nicht in ihr sind -<br />
wie schnell und unbegriffen rauscht sie als Gegenwart davon -<br />
und wie klar, verbraucht und wesenlos liegt sie dann als Vergangenheit<br />
da! Adalbert Stifter
6<br />
7<br />
7 Mo Rosenmontag, Richard, Romuald<br />
8 Di Fasching, Hieronimus, Johannes<br />
v.M.<br />
9 Mi Aschermittwoch, Erich, Konrad,<br />
Apolonia<br />
10 Do Gabriel, Scholastika<br />
11 Fr Maria Lourdes, Adolf<br />
12 Sa Reginald, Gaudentus, Eulalia<br />
13 So Reinhilde, Gerlinde, Kath.v.R.<br />
28 Mo Roman, Justus<br />
14 Mo Mathilde, Hiltibert<br />
15 Di Klemens H., Christoph, Longinus<br />
16 Mi Heribert, Cyriakus<br />
21 Mo Eleonore, Petrus, Damian,<br />
Felix<br />
22 Di Petri Stuhlfeier<br />
23 Mi Sieghard, Eberhard<br />
24 Do Mathias, Edilbert<br />
25 Fr Viktor, Walburga<br />
26 Sa Alexander, Nestor<br />
27 So Markward, Leander, Julian<br />
28 Mo Ostermontag, Johann, Guntram,<br />
Malchus<br />
29 Di Berthold, Helmut, Eustachius<br />
30 Mi Dietmut, Roswitha, Quirinus<br />
31 Do Kornelia, Guido, Amos Pr.<br />
7 Mo Rich.K., Felizitas<br />
8 Di Johann v.G.<br />
9 Mi Franziska, Bruno<br />
10 Do Gustav, Emil, Alex, 40 Märt.<br />
11 Fr Ulrich, Theresia, Rosina<br />
12 Sa Maximilian, Beatrix<br />
13 So Paulina, Gerald, Ernst<br />
1 Di Ignaz, Brigitte<br />
2 Mi Mariä Lichtmeß<br />
3 Do Blasius, Ansgar<br />
4 Fr Andreas, Veronika<br />
5 Sa Agatha<br />
6 So Dorothea, Paul, Titus<br />
21 Mo Alexandra, Benedikt<br />
22 Di Lea, Kasimir, Oktavian<br />
23 Mi Otto v.A., Eberhard, Viktorin<br />
24 Do Katharina, Elias, Gabriel, Simon<br />
25 Fr Karfreitag, Maria Verk.,<br />
Heimkehr d. Schwalben<br />
26 Sa Emanuel, Luitger<br />
27 So Ostersonntag, Rupert, Frowein<br />
14 Mo Cyrill u. Meth., Valentin<br />
15 Di Siegfr., Faustinus<br />
16 Mi Juliane, Julian<br />
17 Do Konstantin, Konstantia<br />
18 Fr Simeon, Konkordia, Flavian<br />
19 Sa Konrad, Bonifatius<br />
20 So Leo, Korona<br />
1 Di Albin<br />
2 Mi Karl, Heinrich, Hartwin<br />
3 Do Kunigunde<br />
4 Fr Kasimir, Afrikan, Luzius<br />
5 Sa Gerda, Friedr. Dietmar, Eusebius<br />
6 So Friedolin, Friedrich<br />
Hornung, 29 Tage<br />
17 Do Gertrud, Theodor<br />
18 Fr Eduard, Cyrill v.J.<br />
19 Sa Josef, Nährvater<br />
20 So Irmgard, Wolfram, Hubert, Eugen<br />
Lenzmond, 31 Tage<br />
Feber Wassermann<br />
März<br />
Fische
8<br />
9<br />
11 Mo Rainer, Felix, Leo P.<br />
12 Di Herta, Julius<br />
13 Mi Martin, Ida, Justus<br />
14 Do Ernestine, Hadwig<br />
15 Fr Waldmann, Anastasius<br />
25 Mo Erwin, Markus<br />
26 Di Richard, Ferdinand, Trudbert<br />
27 Mi Hilda, Petrus<br />
28 Do Peter, Ludwig, Theobald<br />
29 Fr Katharina v.S., Sibylla<br />
30 Sa Ludwig, Walburga, Kath.<br />
9 Mo Gregor, Beatus<br />
10 Di Anton, Gordian, Isidor<br />
11 Mi Adalbert, Gangolf, Isidor<br />
12 Do Pankratius<br />
13 Fr Servatius<br />
14 Sa Bonifatius, Mathäus, Korona<br />
15 So Pfingststen, Sophie, Isidor<br />
30 Mo Reinhild, Ferdinand, Johanna<br />
31 Di Angela, Petronella<br />
4 Mo Isidor, Ambros, Irene<br />
5 Di Vinzenz, Emilia<br />
6 Mi Wilhelm, Sixtus, Brunhilde<br />
7 Do Joh.Babt., Luise, Hermann<br />
8 Fr Walter, Klara<br />
9 Sa Waltraud, Hugo<br />
10 So Mathilde, Hulda<br />
18 Mo Werner, Valerian, Apollonia<br />
19 Di Emma, Leo, Kreszenz<br />
20 Mi Viktor, Hildegund<br />
21 Do Konrad, Anselm<br />
22 Fr Wolthelm, Soter u.Cajus<br />
23 Sa Georg, Adalbert, Gerardus<br />
24 So Helmut, Albrecht, Georgi<br />
23 Mo Joh., Renate, Helma<br />
24 Di Dagmar, Wilhelm, Ester<br />
25 Mi Maria Magdal., Gregor,<br />
Urban<br />
26 Do Fronleichnam, Philipp Ner.<br />
27 Fr August v.C., Gerda<br />
28 Sa Wilhelm, Ludwig<br />
29 So Erwin, Irmtrud, Maximilian<br />
1 Fr Irene, Hugo, Theodor<br />
2 Sa Franz v.Paula<br />
3 So Richard B., Agape<br />
16 Sa Benedikt, Herwig<br />
17 So Robert, Rudolf<br />
2 Mo Sigmund, Ruthard<br />
3 Di Phil. u.Jak.<br />
4 Mi Florian, Monika<br />
5 Do Himmelfahrt, Gotthard, Pius V.,<br />
Angela<br />
6 Fr Dietrich, Judit, Gundula<br />
7 Sa Gisela, Notger, Gottfried<br />
8 So Klara, Ida, Michael<br />
1 So Maifeiertag<br />
Ostermond, 30 Tage<br />
Wonnemond, 31 Tage<br />
16 Mo Pfingstmontag,Johann<br />
v.Nepomuk<br />
17 Di Bruno, Giselbert, Dietmar<br />
18 Mi Erich, Johann<br />
19 Do Petrus C., Iro, Alkuin<br />
20 Fr Bernhard, Elfriede<br />
21 Sa Herm., Jos., Konst., Richarda<br />
22 So Julia, Rita, Emil, Helena<br />
April<br />
Widder<br />
Mai Stier
10<br />
11<br />
13 Mo Anton v. Padua, Tobias<br />
14 Di Herwig, Gerold<br />
15 Mi Veit, Vitus<br />
27 Mo Alexander, Carill<br />
28 Di Leo II., Diethilde<br />
29 Mi Peter u. Paul<br />
30 Do Otto, Ehrentraud, Pauli Ged.<br />
11 Mo Benedikt v.N., Olga<br />
12 Di Felix, Heinrich, Johann Gualb.<br />
13 Mi Margareta, Heinr. u. Kunigunde<br />
14 Do Franz v.Sales, Kamilus<br />
15 Fr Egon, Bonaventura, Heinrich<br />
25 Mo Jakob d. Ältere<br />
26 Di Anna, Joachim, Anniela<br />
27 Mi Berthold, Rudolf<br />
28 Do Viktor, Innozenz<br />
29 Fr Martha, Beatrix<br />
30 Sa Ingeborg, Petrus, Chrysost.<br />
31 So Ignatius v.L., Ernestine<br />
6 Mo Herbert, Bertram<br />
7 Di Robert, Lukretia, Gottfried<br />
8 Mi Medardus<br />
9 Do Ida, Ephraim<br />
10 Fr Heinrich v.B., Margareta<br />
11 Sa Paula, Felix<br />
12 So Joh.F., Leo, Rudolf<br />
20 Mo Adalbert, Berthold, Silverius<br />
21 Di Alois, Albanus<br />
22 Mi Rotraud, Paula, Paulus<br />
23 Do Edeltraud, Basilius<br />
24 Fr Johannes d.Täufer<br />
25 Sa Wilhelm, Berta, Eleonore<br />
26 So Herz-Jesu, Johann u. Paul<br />
4 Mo Elisabeth, Ulrich, Prokop<br />
5 Di Cyrill, Method, Hugo, Wilh.<br />
6 Mi Maria Gor., Gottlieb<br />
7 Do Willibald<br />
8 Fr Kilian, Elisabeth<br />
9 Sa Veronika, Gottfried, Luise<br />
10 So Knud, Amalia, Engelb., 7 Brüder<br />
1 Mi Konrad, Nikodemus, Gratian<br />
2 Do Ilse, Petrus<br />
3 Fr Karl L., Erasmus<br />
4 Sa Franz Car., Werner, Quirin<br />
5 So Bonifatius, Winfried, Dorothea<br />
16 Do Benno, Luitgard<br />
17 Fr Adolf, Laura<br />
18 Sa Arnulf, Mark u. Marzell<br />
19 So Emma, Juliana, Romuald,<br />
Gerwas<br />
1 Fr Dietrich, Theobald<br />
2 Sa Mariä Heimsuchung<br />
3 So Thomas Ap., Klothilde<br />
18 Mo Friedrich, Rosina, Arnulf<br />
19 Di Vinzenz v.P., Arnulf<br />
20 Mi Margareta, Hieronymus, Elias<br />
21 Do Helga, Laurentius, Daniel<br />
22 Fr Maria Magdalena<br />
23 Sa Brigitta v.Schw., Arnulf<br />
24 So Christoph, Christ., Siegl.,<br />
Ludov.<br />
Heumond, 30 Tage<br />
Brachmond, 31 Tage<br />
16 Sa Maria v.Bg., Ruth, Irmgard<br />
17 So Alex, Karoline<br />
Juni Zwillinge<br />
Juli Krebs
12<br />
13<br />
15 Mo Maria Himmelfahrt<br />
16 Di Stef.v.Ung., Rochus, Hyazinth<br />
29 Mo Johannes Enthauptung<br />
30 Di Felix, Vinzenz, Benjamin<br />
31 Mi Raimund, Isabella, Paulinus v.T.<br />
12 Mo Maria Namen, Guido<br />
13 Di Notburga, Amatus, Tobias<br />
14 Mi Kreuzerhöhung<br />
15 Do Mariä Schmerzen, Dolores<br />
26 Mo Cyprian, Meinhard<br />
27 Di Adolf, Vinz.v.P., Cosm.u.Dam.<br />
28 Mi Wenzeslaus<br />
29 Do Michael, Raphael, Gabriel<br />
30 Fr Hieronymus, Otto<br />
8 Mo Dominikus, Herwig<br />
9 Di Roland, Roman<br />
10 Mi Laurenz, Lorenz<br />
11 Do Hermann, Susanne, Philomena<br />
12 Fr Klara, Cäcilia, Radegund<br />
13 Sa Reinhild, Reinhold, Hipolith<br />
14 So Eberhard, Maximilian, Eusebius<br />
22 Mo Maria Königin, Thimotheus<br />
23 Di Rosa v. Lima, Philipp<br />
24 Mi Bartholomäus<br />
25 Do Ludwig, Josef v.C., Herm.,<br />
Egbert<br />
26 Fr Margarethe, Gregor<br />
27 Sa Monika, Gebhard<br />
28 So Alfred, Augustus<br />
5 Mo Albert, Laurentia, Roswitha<br />
6 Di Beate, Magnus, Zacharias<br />
7 Mi Dietrich, Regina<br />
8 Do Maria Geburt<br />
9 Fr Bruno, Wilfrieda<br />
10 Sa Jodokus, Diethard, Nikolaus v.T.<br />
11 So Helga, Theodor, Felix<br />
19 Mo Wilma, Sidonia, Arnulf<br />
20 Di Friederike, Traugott, Eustach<br />
21 Mi Matthäus<br />
22 Do Moritz, Emmeran<br />
23 Fr Thekla, Helena, Rotraud<br />
24 Sa Rupert, Gerhard<br />
25 So Irmfried, Firmian, Kleophas<br />
1 Mo Alfons, Petri Kettenf.<br />
2 Di Mariä Heims., Gustav<br />
3 Mi August, Stephan, Lydia<br />
4 Do Johannes MV., Dominik<br />
5 Fr Maria Schnee, Oswald<br />
6 Sa Verklärung d.Herrn<br />
7 So Adalbert, Sixtus, Afra, Kajetan<br />
17 Mi Bertram<br />
18 Do Helene, Rupert<br />
19 Fr Joachim T., Emilia, Ludwig<br />
20 Sa Bernh.v.Clerv., Stephan K.<br />
21 So Franz, Pius X, Balduin, Johanna<br />
1 Do Ägidius, Verena<br />
2 Fr Margarethe, Emmerich, Tobias<br />
3 Sa Gregor d.Gr., Seraphim<br />
4 So Rosalia, Irmgard<br />
16 Fr Edith, Kornelius, Ludmilla<br />
17 Sa Hildegard v.B., Robert<br />
18 So Lambert, Thomas v.V., Titus<br />
Herbstmond, 30 Tage<br />
Erntemond, 31 Tage<br />
August Löwe<br />
September Jungfrau
14<br />
15<br />
10 Mo Franz v.Borg.<br />
11 Di Muttersch. Mariä, Bruno, Burkh.<br />
12 Mi Horst, Emil, Maximilian<br />
13 Do Eduard, Koloman<br />
14 Fr Wilhelmine, Dietmar<br />
15 Sa Theresia, Aurelia<br />
16 So Gallus<br />
31 Mo Reformationsfest, Wolfgang<br />
v.Reg., Christ König<br />
14 Mo Alberich, Seraphim<br />
15 Di Leopold, Albert d.Gr., Gertrud<br />
28 Mo Gerhard, Berta, Günther<br />
29 Di Walter, Erhard<br />
30 Mi Andreas<br />
24 Mo Antonius, Gilbert, Rafael<br />
25 Di Wilhelmine, Ludwig<br />
26 Mi Helmut, Amand<br />
27 Do Sabine, Wolfhard<br />
28 Fr Simon u.Juda<br />
29 Sa Engelhard, Eusebia<br />
30 So Alfons, Hertmann, Klaudius<br />
7 Mo Engelbert, Brunhilde, Willibald<br />
8 Di Gottfried, Severus<br />
9 Mi Theodor, Randolf<br />
10 Do Leo, Andreas, Justus<br />
11 Fr Martin v.T.<br />
12 Sa Emil, Kunibert<br />
13 So Adalbert, Eugen<br />
3 Mo Tag der deutschen Einheit, Ewald,<br />
Gerhard, Kanditus<br />
4 Di Erntedank, Franz v.Assisi<br />
5 Mi Raimund, Placitus<br />
6 Do Bruno, Angela<br />
7 Fr Rosenkranzfest, Amalie<br />
8 Sa Brigitta, Benedikt<br />
9 So Günther, Arnold<br />
21 Mo Mariä Opfer, Amos<br />
22 Di Cäcilia, Alfons, Philomena<br />
23 Mi Buß- und Bettag, Klemens,<br />
Felizitas<br />
24 Do Emilie, Joh.v.Kreuz<br />
25 Fr Katharina v.A.<br />
26 Sa Konrad, Gebhard<br />
27 So Totensonntag, 1. Advent, Gustav,<br />
Oda, Virg., Ute<br />
1 Di Allerheiligen<br />
2 Mi Allerseelen<br />
3 Do Hubert, Martin, Ida<br />
4 Fr Karl Bor., Charlotte, Zacharias<br />
5 Sa Elisabeth, Berthilde<br />
6 So Leonhard, Eleonore<br />
1 Sa Theresia v.K.<br />
2 So Schutzengelfest<br />
17 Mo Ignaz v.Flo., Hedwig<br />
18 Di Lukas, Justus<br />
19 Mi Paul v.Kr., Ferd., Peter v.Alk.<br />
20 Do Wendelin, Vitalis, Felizian<br />
21 Fr Ursula, Irmtraud<br />
22 Sa Kordula, Salome<br />
23 So Johannes v.C., Severin<br />
Nebelmond, 30 Tage<br />
16 Mi Margareta, Otmar, Edmund<br />
17 Do Gregor, Hugo<br />
18 Fr Udo, Eugen, Hilda<br />
19 Sa Elisabeth v. Thür.<br />
20 So Volkstrauertag, Felix v.V., Edm.<br />
Weinmond, 31 Tage<br />
Oktober Waage<br />
November Skorpion
16<br />
17<br />
12 Mo Johanna, Franziska, Alexander<br />
13 Di Lucia, Ottilie<br />
14 Mi Joh.v.Kreuz, Ingeborg<br />
15 Do Christoph, Johann, Valerian<br />
26 Mo 2.Weihnachtsfeiertag, Stephanus<br />
27 Di Johannes Ev., Fabiola<br />
28 Mi Unschuldige Kinder<br />
29 Do Hl. Familie, Thomas v.K.<br />
30 Fr Hermine, David, Reiner<br />
31 Sa Silvester, Melanie<br />
5 Mo Gerald, Julius, Judith<br />
6 Di Nikolaus<br />
7 Mi Ambrosius, Agate<br />
8 Do Mariä Empf., Edith<br />
9 Fr Valerie, Joachim, Peter<br />
10 Sa Herbert, Emma<br />
11 So 3. Advent, Domasius, Sabine<br />
19 Mo Konrad, Thea, Urban V.<br />
20 Di Christian, Christina, Eugen<br />
21 Mi Thomas, Ingomar<br />
22 Do Jutta, Beate, Demetrius<br />
23 Fr Viktoria, Dagobert<br />
24 Sa Hl. Abend, Adam u. Eva<br />
25 So 1.Weihnachtsfeiertag, Christfest<br />
1 Do Natalie, Erich, Edmund<br />
2 Fr Luzius, Herta, Pauline, Brunhilde<br />
3 Sa Franz Xaver<br />
4 So 2. Advent, Barbara, Petr., Joh.v.D.<br />
16 Fr Adelheid, Albine<br />
17 Sa Lazarus, Hilde, Jolanda<br />
18 So 4. Advent, Wunibald, Christoph<br />
Christmond, 31 Tage<br />
Dezember Schütze<br />
Leopold Hafner<br />
Von Leopold Hafner gegossene Sternzeichen bereichern diesmal unser Kalendarium.<br />
Sie sind überigens über ihn erhältlich. Der Künstler feiert im Jahr <strong>2005</strong><br />
seinen 75. Geburtstag. Er wurde am 22.10.1930 in Wallern geboren. Er konnte<br />
dort gerade noch seine Schulzeit abschließen. Nach der Vertreibung begann er<br />
sogleich 1946 seine Bildhauerlehre bei dem Wallerer Bildhauer Ludwig Pinsker,<br />
der sich auch in Perlesreut niedergelassen hatte. Die Gesellenprüfung legte er<br />
1951 an der Staatlichen Fachschule in Zwiesel ab. Im gleichen Jahr wurde er von<br />
Prof. Josef Henselmann in die Akademie der Bildenden Künste, München, aufgenommen.<br />
In seinen Studienjahren beschäftigte er sich erfolgreich mit Portraitarbeiten<br />
und führte bereits auch einige Aufträge aus, wie z.B. 1954 ein Relief des<br />
Fischbrunnens am Marienplatz in München, sowie die figürliche Gestaltung des<br />
Domherrngrabmals in Passau. Vor allem aber war er im Atelier seines Professors<br />
beschäftigt. So konnte er an der Gestaltung der Figuren des Hochaltars im Dom<br />
zu Passau, in dem später auch eigene Werke Aufnahme finden sollten, mitarbeiten<br />
und 1953 dessen Aufstellung leiten. 1959 schloss er sein Studium mit dem<br />
Diplom ab.<br />
Seitdem ist er freischaffender Bildhauer. Sein erstes Atelier richtete er sich im<br />
Schloss Vornbach ein. In diesen ersten Jahren waren die zahlreichen Reisen von<br />
prägender Bedeutung. Jeder vollendete Auftrag, so z.B. die „Kassler Madonna“<br />
in Kassel oder das große Altarbild in Passau Neustift, wurde in eine Studienreise<br />
umgemünzt. Zielorte waren die Museen und Sehenswürdigkeiten in Italien, Griechenland,<br />
Rumänien Ungarn, Moskau, Leningrad, Paris, London, Wien. Seine<br />
beiden Afrikareisen führten ihn über Kairo, Nairobi nach Südafrika bis Windhoek<br />
und Kapstadt. 1967 wirkte er an der Universität in Stellenbosch als Gastlehrer.<br />
1973 war er in diesem Sinn auch in der Missionsschule in Guarabira tätig. Stationen<br />
auf dieser Südamerikareise waren auch Rio de Janeiro und vor allem die<br />
Bildhauerstadt San Salvador. Der alte Sudraum des Klosters in Vornbach war<br />
immer ein offenes Atelier. Offen für junge Kollegen der Akademie, die bei größeren<br />
Aufträgen mitarbeiteten. Offen auch für alle Besucher, die immer mit Wein<br />
oder Bier und Brotzeit empfangen wurden. Aus dieser Zeit stammt auch der bis<br />
heute bestehende große Freundeskreis, unter denen das rumänische Staatsquartett<br />
noch lange eine besondere Rolle spielte und bei seinen Auslandreisen quasi als<br />
Hausmusik das Leben bereicherte.<br />
1968 wurde die Hochzeit mit Brigitte Sekatzek gefeiert. Aus dieser Ehe gingen<br />
sechs Kinder hervor.<br />
1969 verlegte er Atelier und Wohnsitz in den Alten Pfarrhof zu Aicha vorm Wald,<br />
da die Räumlichkeiten in Vornbach für Familie und Atelier zu wenig Platz boten.<br />
Zum Kalendarium
18<br />
19<br />
Der Kern der bildhauerischen Arbeit Leopold Hafners ist der Kirchenraum. Die<br />
Orte seiner Tätigkeit reichen von Tirol und Wien bis Westfalen, von Passau bis<br />
Speyer in die Rheinpfalz. Im Ausland sind Werke in Südafrika, Südamerika und<br />
in den USA zu sehen.<br />
Das Zentrum seines Schaffens war der Raum der Diözese Passau, in der er mit<br />
Diözesanbaumeister Alfred Zangenfeind unter den Kunstreferenten des Domkapitels<br />
in vielen Kirchen die Vorgaben des Konzils umsetzte.<br />
Die Einordnung in die begehende, meist hochwertige Architektur der Kirchenbauten<br />
war dabei immer sein schöpferisches Credo. Die bestehende Umgebung<br />
mit ihren Formen ist der respektierte Ausgangspunkt für die eigene Gestaltung.<br />
Die Einfühlung in die bestehende Formenwelt, in die Denkweise des Künstlers in<br />
dessen Werk man eindrang, ist seine spezielle Methode auch der eigenen Selbstverwirklichung.<br />
Denn trotz aller Einordnung, sein Stil ist unverkennbar, aber der<br />
Umgebung nicht fremd, ganz im Gegensatz zu manchen modernen Werken, die<br />
sich nicht nur aufdringlich in der Form, sondern damit auch meist in der Qualität<br />
von der Umgebung unterscheiden. Diese Einfühlung ist auch sein Weg bei der<br />
Gestaltung der verschiedenen Portraits. Er taucht in die Welt der Portraitierten<br />
ein, liest deren Werke oder Lebensgeschichte, hört die Musik der Zeit, um zu den,<br />
wenn überhaupt überlieferten Gesichtszügen, die innere Dimension zu gewinnen.<br />
Das Material das er bearbeitet, ist verschieden wie die Aufgaben. Zuerst stand<br />
sicher das Holz im Zentrum des Schaffens, das markant bearbeitet auch eine farbige<br />
Fassung erhalten konnte. Heute sind Stein und vor allem Bronze seine bevorzugten<br />
Materialien, aus denen die Werke entstehen. Gerade die Bronze, die ja<br />
zuvor in der sehr direkten und sensiblen Wachstechnik gefertigt werden muss,<br />
kommt seinem einfühlenden Arbeiten entgegen. Es entsteht unter seinen Händen<br />
wie von selbst, da das Wachs direkt modelliert auf jede, auch die unbewusste<br />
Bewegung seiner Finger reagiert und zur Form gelangt.<br />
Bei den kirchlichen Arbeiten ist er sich sehr bewusst, dass die Qualität der Arbeit<br />
über die auf sich selbst reflektierende Galeriekunst hinausgehen muss. Vor einem<br />
Christus, einer Madonna knien sich die Menschen nieder. Die Werke müssen<br />
dem Betrachter, dem hochgebildeten wie dem einfachen Menschen, ein Einstieg<br />
sein in eine Gedankenwelt, die sich nicht in der Kunst erschöpft, sondern sich in<br />
der Transzendenz, im Glauben vollendet.<br />
Offizielle Anerkennung fand er und sein Werk durch den Kulturpreis der Stadt<br />
Passau 1975, den Kulturpreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft 1976, durch<br />
die Berufung in die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste<br />
1982, die Aufnahme der Marmorbüste Gregor Mendel in die Walhalla bei Regensburg<br />
1983, durch den Kulturpreis des Landkreises Passau 1999 und den Kulturpreis<br />
des Kulturkreises Freyung Grafenau 2002. Auswahl aus dem umfangreichen<br />
Schaffen: Kirchen: Arbeiten im Dom zu Passau und im Kaiserdom zu Speyer<br />
und einer Vielzahl von Kirchen in diesen und weiteren Diözesen<br />
1905 Emmi Schuster Lang wurde am 5. 5. 1905 in Prag geboren, lebte aber seit<br />
1926 in Krummau. Neben ihrer Malerei, bei der ausdrucksvolle Landschaften<br />
des Böhmerwaldes eines ihrer Hauptthemen bildeten, widmete sich die Künstlerin<br />
auch der Volkstumspflege. Eine Würdigung erschien im <strong>Jahrbuch</strong> 2004.<br />
1905 Eine Weltbiographie zum Werke Adalbert Stifters und eine Gesamtbibliographie<br />
des Böhmerwaldes seien stellvertretend genannt für das Werk von<br />
Prof. Dr. phil. Eduard Eisenmeier (geb. am 30. 1. 1905).<br />
1805 Der größte Dichter aus dem Böhmerwald, Adalbert Stifter, wurde am 23.<br />
10. 1805 in Oberplan geboren. Galt früher das Hauptaugenmerk mehr dem<br />
Landschaftsschilderer, dem Verfasser von Bildungsromanen, der das Sein - Sollen<br />
darstellt, wurde zunehmend vor allem in der Kunsttherapie die intuitiv aufbauende<br />
Wirksamkeit von Stifters „sanftem Gesetz“ betont.<br />
1805 Der k. u. k. Schiffsmeister in Budweis Adalbert Lanna (* 23.4.1805) war<br />
auf vielen Gebieten unternehmerisch tätig. Er beteiligte sich u. a. am Ausbau der<br />
Pferdeeisenbahn Budweis Linz, baute die nach der Karlsbrücke zweite Moldaubrücke<br />
in Prag, gründete in Budweis eine Sparkasse und eine Handelsschule und<br />
engagierte sich auch auf sozialem Gebiet sowie in der Förderung von Kunst und<br />
Musik.<br />
Denkwürdiges <strong>2005</strong><br />
Elfriede Fink<br />
Brunnen: Jubiläumsbrunnen der altbayerischen Diözesen in Altötting, Patronatsbrunnen<br />
im Domhof zu Passau, Schöpferbrunnen in Passau Kohlbruck,<br />
Gymnasiumsbrunnen Untergriesbach<br />
Denkmäler: Epitaphien der Bischöfe Simon Konrad Landersdorfer und Antonius<br />
Hofmann im Dom zu Passau, Hl. Severin im Museum Boiotro, Adalbert- Stifter<br />
Denkmal am Böhmerwaldplatz in München, Einwanderer Denkmal der<br />
<strong>Böhmerwäldler</strong> in New Ulm, MN, USA.<br />
Portraits: Gregor Mendel, in der Walhalla, Hans Watzlik am Osser, Dr. Walter<br />
Becher, Prof. Werner Heisenberg, Kunstmaler Dieter Stauber<br />
Wer in den Besitz einer seiner Arbeiten gelangen möchte, kann bei Leopold Hafner<br />
nach seinen gegossenen Sternzeichen fragen (Aicha v. W., Alter Pfarrhof).
20<br />
21<br />
Quellen: „Der Böhmerwald erzählt“ von Erich Hans; „Hoam!“.<br />
1945 Hans Multerer, der sich Anfang der 30er Jahre in Neuem als freier<br />
Schriftsteller niedergelassen hatte, verstarb ebenda am 12.6.1945.<br />
1945 Durch seine volkskundlichen Forschungen hat sich der Germanist und<br />
Historiker Rudolf Kubitschek um den Böhmerwald verdient gemacht (gest. am<br />
29. 5. 1945 in Prachatitz).<br />
1945 Der 1866 in der Nähe von Neuem geborene Anton Schott (gest. 4. 4. 1945)<br />
veröffentlichte 50 Romane sowie 30 Bände Erzählungen und Novellen.<br />
1935 „Da ewi Brunn“ oder „Da stodterisch Steffl“ sind bekannte Mundartgedichte<br />
von Zephyrin Zettl aus Stadln im künischen Gebiet (gest. am 4. 7.1935<br />
in Wien). Dem Dichter zum Gedenken, der zeitlebens seiner Heimat eng verbunden<br />
war, hat der Deutsche <strong>Böhmerwaldbund</strong> das „Zephyrin Zettl – Buch“ herausgegeben.<br />
1935 Paul Praxl geboren am 17. 5. 1935 in Wallern, forscht und publiziert sowohl<br />
über den bayerischen, als auch über den böhmischen Teil des Böhmerwaldes<br />
mit hervorragenden Ergebnissen z.B. im Themenbereich der „Goldenen Steige“.<br />
Langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter des Böhmerwaldmuseums in Passau,<br />
zahlreiche Publikationen.<br />
Ansicht von Oberplan.<br />
Um 1823<br />
(Ölgemälde von<br />
Adalbert Stifter)<br />
„In der Mitte des Tales<br />
ist der Marktflecken<br />
Oberplan, der seine Wiesen<br />
und Felder um sich<br />
hat, in nicht großer Ferne<br />
auf die Wasser der<br />
Moldau sieht, und in<br />
größerer mehrere herumgestreute<br />
Dörfer hat.<br />
Das Tal ist selber wieder<br />
nicht eben, sondern hat<br />
größere und kleinere Erhöhungen.<br />
Die bedeutendste ist der Kreuzberg, der sich gleich hinter Oberplan erhebt,<br />
von dem Walde, mit dem er einstens bedeckt war, entblößt ist, und seinen Namen von<br />
dem blutroten Kreuze hat, das auf seinem Gipfel steht. Von ihm aus übersieht man das<br />
ganze Tal. Wenn man neben dem roten Kreuze steht, so hat man unter sich die grauen<br />
Dächer von Oberplan, dann dessen Felder und Wiesen, dann die glänzende Schlange der<br />
Moldau und die obbesagten Dörfer.“Aus: „Der beschriebene Tännling“<br />
„0, es war so schön, da der Baum, worunter ich spielte,<br />
Schön, da des Vaters Haus, schön, da das heimische Tal<br />
Meine Welt war ...“ Gedicht vom September1823<br />
1935 Aus der Lyrik von Helmut Doyscher (* am 1. 5.1935 in Krummau) sind<br />
u.a. die Zyklen „Böhmen“ und „Krummau“ erwähnenswert.<br />
1935 Johann Peter (* 23. 2. 1858 in Buchwald, gest. 14. 2. 1935 in Winterberg),<br />
Autor von Erzählungen, Gedichten und Charakterbildern, setzte in seinem wohl<br />
bekanntesten Werk „Der Richterbub“ seiner Kindheit im Böhmerwald ein bleibendes<br />
Denkmal.<br />
1930 Leopold Hafner wurde am 22.10.1930 in Wallern geboren. Er verschuf<br />
sich bis heute weltweit hohes Ansehen für seine bildhauerischen Arbeiten, u.a. -<br />
für uns <strong>Böhmerwäldler</strong> von besonderer Bedeutung - auch im Hohen Dom zu<br />
Passau.<br />
1915 Zeichnungen, Aquarelle und Ölbilder schuf Ernst Springer, geb. am 25. 9.<br />
1915 in Klösterle.<br />
1915 Am 18. 1. 1915 verstarb in St. Pölten Andreas Hartauer, Glasmacher aus<br />
dem Böhmerwald und Dichter des Liedes „Tief drinn im Böhmerwald“. Sein<br />
Denkmal in Eleonorenhain wurde wieder hergerichtet, ein weiteres wurde auf<br />
der bayerischen Seite des Böhmerwaldes in Mauth erschaffen.<br />
Geleitwort<br />
Fast 60 Jahre nach der Vertreibung aus der angestammten Heimat gibt es immer<br />
noch eine <strong>Böhmerwäldler</strong> Volksgruppe, einen Deutschen <strong>Böhmerwaldbund</strong> mit<br />
seinem Mitteilungsblatt „Hoam!“ und eben auch ein <strong>Böhmerwäldler</strong> <strong>Jahrbuch</strong>.<br />
In ihm kommen Menschen aus dem Böhmerwald zu Wort, die vieles erfahren<br />
haben und erdulden mussten, die sich in entscheidenden Situationen bewährten,<br />
die eingetaucht waren in diesen unaufhaltsamen, grausamen, unentrinnbaren<br />
Strom der Zeitgeschichte des vorigen Jahrhunderts. In ihren Biographien spiegelt<br />
sich deutsche Geschichte wider. Sie sind Zeitzeugen, deren sprachlichen<br />
Äußerungen durch die literarische Gestaltung auch Menschen erreichen können,<br />
die nicht direkt betroffen sind.<br />
Da gibt es Erzählungen aus der heilen Welt der Kindheit und Jugend, werden<br />
Bräuche dargestellt, die den Geist echter böhmerwäldlerischer Volksfrömmigkeit<br />
atmen, finden lebendige historische Exkurse statt, befinden sich aber auch Texte,<br />
in denen man den Schmerz über das Verlorene spürt. Ein umfangreicher Teil des<br />
<strong>Jahrbuch</strong>es ist dem großen Künstler deutscher Prosa, Adalbert Stifter, gewidmet,<br />
dessen 200. Geburtstag wir am 23. Oktober <strong>2005</strong> feiern können. Die geliebte<br />
Heimat Böhmerwald war ein Grunderlebnis seines Schaffens.
22<br />
23<br />
Wie überall auf dem Lande, wo die Menschen noch mehr oder weniger mit der<br />
Natur verknüpft und vielfach in ihren Lebensbedingungen von deren Einflüssen<br />
abhängig sind, so hat sich auch im stillen, entlegenen Böhmerwalde noch allerlei<br />
Aberglaube und Brauchtum erhalten, die das Leben der Bewohner und ihre Feste,<br />
ihr Lieben, Leiden und Hassen, mit einer gewissen Poesie umkleiden. Gleich<br />
der erste Tag des Jahres tritt in diesem Gewande ins Leben. Während die Alten<br />
sich zum Neujahrstage etwas mehr gleichgültig verhalten, huschen dafür die Kleinen<br />
im dämmerigen Neujahrsmorgen von Haus zu Haus, überall ihren Wunsch<br />
aussprechend:<br />
Neujahr im Böhmerwalde<br />
Dieser Spruch, der an die heidnisch-germanische Anschauung von den<br />
Rauhnächten erinnert, wird heute weniger mehr gepflegt, da die damit verbundene<br />
Verpflichtung einer Entlohung an die Wünschenden immer mehr schwand<br />
und damit auch die Neigung zur Sache. Seltener ist auch schon der Brauch, sich<br />
mit Milch, welche neben Sterz auf den Abendtisch kam, wechselseitig zu überschütten.<br />
Ziemlich allgemein hat sich aber auch die Sitte erhalten, alle Gegenstände<br />
des Hauses mit drei Kreuzen und die Türen mit K.M.B., den Anfangsbuchstaben<br />
der hl. drei Könige, zu bezeichnen. Der Hausherr geht außerdem mit<br />
einer Glutpfanne, in die er geweihtes Salz und Weihrauch gelegt hat, stumm an<br />
allen zugänglichen Stellen des Hauses herum, überall räuchernd und mit Weihwasser<br />
besprengend, um die Macht der Hexen und bösen Geister, welche diese<br />
Nacht Gewalt auf Erden haben, von dem Hauswesen abzuwenden und zu bannen.<br />
(Aus: Waldheimat Jän.´32)<br />
Karl Spannbauer<br />
Ingo Hans, Bundesvorsitzender<br />
Betrachtet man das ganze Buch, so ist es nicht nur ein bunter Strauß, die Aufsätze<br />
und Geschichten fügen sich vielmehr zu einem Bild der Landschaft Böhmerwald<br />
mit ihren Menschen und werden zu einer Begegnung mit der verlorenen Heimat.<br />
Urbarmachung und Kultivierung waren Zweck und Ziel der gesamten<br />
achthundertjährigen sudetendeutschen Geschichte und Tradition im Böhmerwald.<br />
Die Leistungen seiner Menschen waren nachgewiesen geschichtsträchtig –<br />
positiv: in Wirtschafts-, Wissenschafts-, Religionskultur sowie auch in der Kunstund<br />
Literaturkultur.<br />
Nur fünf Jahre nach Krieg und Vertreibung waren die Deutschen aus Böhmen<br />
und Mähren mit der 1950 verkündeten Charta der Heimatvertriebenen die<br />
treibende Kraft, durch Europäisierung der Nationalstaaten eine Humanisierung<br />
zu erreichen. Sie haben das Nachkriegsdeutschland mit aufgebaut, sie haben<br />
sich integriert in die gesamtdeutsche Gesellschaft, jedoch in der wirren<br />
bundesdeutschen Identität eine eigene bewahrt.<br />
Seit dem ersten Mai 2004 nun gehört unser Herkunftsland nicht nur geografisch<br />
sondern auch politisch wieder zu Europa, belasten die alten Benesch-Dekrete<br />
als Sanktionierung von Vertreibungsunrecht und -verbrechen direkt die<br />
europäische Wertegemeinschaft. Dagegen permanent zu protestieren und zu<br />
argumentieren wird unsere Aufgabe für die Zukunft sein. Am Weiterbau Europas<br />
im Geiste der Charta der Heimatvertriebenen werden sich die Sudetendeutschen<br />
und mit ihnen die <strong>Böhmerwäldler</strong> klar beteiligen, mit besonderer Blickrichtung<br />
nach Tschechien und der ganz besonderen Forderung nach geschichtlicher<br />
Wahrheit bei Ächtung von Vertreibung in Vergangenheit und Gegenwart und<br />
globaler Einhaltung der Menschenrechte.<br />
Heunt ist die foast Rauhnacht.<br />
Wer hat´s aufbracht?<br />
A alter Monn.<br />
Er ist über d´ Stiegn aufikrochen,<br />
Hat si Händ´ und Füaß ab´brochen;<br />
Schneck ´raus! Schneck ´raus,<br />
Oder i schlag a Loch in dei Haus!<br />
Dafür werden die Kinder gewöhnlich mit kleinen Gaben beschenkt. Mit Tagesanbruch<br />
wird dann das Wünschen eingestellt, da mit dem Tageslichte die Wünsche<br />
ihre Kraft und Wirkung verlieren und nicht mehr angenommen werden. Das<br />
gleiche Hersagen eines Spruches erfolgt am Abende vor dem Dreikönigs<br />
tage, der „foasten (fetten) Rauhnacht“, nämlich:<br />
Oder kürzer:<br />
I wünsch, i wünsch, i woas nit wos,<br />
Greift der Herr in Sock und geb mit wos!<br />
I wünsch´eng neugs Joahr,<br />
´s Christlkindl mit krau´s Hoar,<br />
A langs Leb´n, a guats Leb´n,<br />
An Beutel voll Geld daneb´n,<br />
An viereckigen Tisch,Auf jedem Eck an brot´nen Fisch,<br />
In der Mitt´a Flaschen Wein,<br />
Daß Herr und Frau kann recht lustig sein!
24<br />
25<br />
Aft is s’ wieder gonga, wias ihr hot derfrogt,<br />
daß ihr Suh, den s’ ihr hot zougn vo kloa,<br />
afghejbt hot in ullererschtn Stoa.<br />
Und a Traurigkeit hots überkäima.<br />
I da Kiara hots aft bet’t am Kniahan,<br />
daß der Herrgoud von ihrn Suh sullt näihma,<br />
wos s’ nit aomol ginnt san Feind, san schiahan.<br />
Bet’t und bet’t hots, hot nit afstäih mejgn,<br />
is midn Gsicht am hirchtn Stoanan glejgn.<br />
Hot ihr ullweil gworcht a Zoacha,<br />
daß s’ ihrn Suh nit wäindt derroacha,<br />
daß nuh gnädi mit eahm warn.<br />
Wir ihr ober bong und bonger.<br />
Mit an Herzen, mit an schwarn,<br />
is’s aft endla hoamzua gonga.<br />
(Einsendung Grete Rankl)<br />
Mit dem Palmsonntag beginnt die Palmwoche. Der Pfarrer segnet die mit bunten<br />
Bändern geschmückten Palmbesen. Die geweihten Palmkätzchen trug man nach<br />
Hause und steckte ein paar davon ans Kreuz im Herrgottswinkel. Einige wurden<br />
an die Stalltüre und die Scheunentür genagelt, damit keine Hexen in den Stall<br />
kommen und in der Scheune kein Feuer ausbricht.<br />
Bei vielen Bäuerinnen war es der Brauch ins Hühnernest Palmkätzchen zu legen,<br />
damit die Bruthennen besser brüteten. Ein Umschreiten des Hühnerstalles mit<br />
dem Palmbesen hielten Fuchs und Habicht von den Hühnern fern.<br />
Bei Gewittern verbrannte man im Herd Palmkätzchen, um das Haus vor Blitzschlag<br />
zu schützen. Am Palmsonntag musste jeder im Haus drei Palmkätzchen<br />
schlucken, denn diese bewahrten ihn vor Halsweh und Fieber. Bis in unsere Zeit<br />
hinein mußte sich derjenige, der am Palmsonntag als letzter aus dem Bett stieg,<br />
Palmesel nennen lassen. Die am Gründonnerstag gelegten Eier waren sehr beliebt,<br />
denn nach dem Volksglauben waren sie heilbringend.<br />
Wenn am Gründonnerstag die Glocken nach Rom flogen, die Kirchenglocken<br />
und die Orgel schwiegen, übernahmen bis zum Karsamstag die Ratschen die Stelle<br />
der Glocken ein. (Überarbeitet von Ingomar Heidler)<br />
Frogt n hiaz d Maria und dabei<br />
hot ihr d Rejd a bißl ziattat frei,<br />
oub der drinnad i der Stodt<br />
nid a Hoor,a lichts und a blobi Augn hod ghod?<br />
Und hot e gwißt, daß er Jo draf sogt,<br />
weil: a Muada roat’t in Kinan vül<br />
und siaht ehnter, wos der Herrgoud wüll.<br />
Brauchtum und Volksglauben am Palmsonntag<br />
Adolf Heidler<br />
Do is oamol unser Frau<br />
betn gonga af Gojau.<br />
Is a Sunnta gwejn und afn Roanan<br />
is ulls gsprecklat gwejn vor lauta Bloaman.<br />
Und do kimmt ihr wer i d Nah’d,<br />
der sogt freidi za der Jungfrau: „Lous,<br />
homt an nuiha Fürschtn kriagt z’ Krummau in Gschlouß.<br />
Käima is er af an Rössel, af an junga.<br />
Polmkatzln und Zupfad homs eahm gstrat.<br />
Wou er für is, ducht hot ullsaund blüaht.<br />
Bon a niadn Haustür hant d Leut kniat<br />
und vor Freud homs ulli tonzt und gsprunga.“<br />
Palmsonntag<br />
Heinrich Micko<br />
Anna Klarner: Frühling<br />
(Aquarell)
26<br />
27<br />
Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche. „Kar“ ist im althochdeutschen<br />
Wort „kara“ enthalten und bedeutet Sorge und Trauer. Die Passionswoche beginnt<br />
mit dem Einzug der Palmprozession in die Kirche symbolisch für den<br />
Einzug Christi in Jerusalem. Stolz trugen Kinder und Jugendliche ihren prächtig<br />
geschmückten „Weihpolm“ zur Kirche. Neugierig beobachteten Mädchen<br />
und Buben, wer wohl dieses Jahr den längsten und schönsten Palmbaum trägt.<br />
Die Aufmachung desselben war von Pfarrei zu Pfarrei verschieden. Die<br />
Palmzweige wurden nach der Weihe als Segensbringer daheim aufbewahrt. Mit<br />
kleinen Zweigen schmückte man den Herrgottswinkel, die kräftigeren Äste kamen<br />
ins Dachgebälk. Es war ein Bitten an die Allmacht, das Haus vor Blitz und<br />
Feuersgefahr zu schützen. Der Palmenstamm wurde von einigen Burschen zur<br />
Auferstehungsfeier mitgenommen und vor der Kirche im geweihten Feuer angekohlt.<br />
Nach dieser sog. „Steckerlweihe“ wurden die Stiele als Segensspender<br />
in Hof und Stall angebracht und einige davon in die Felder gesteckt, um die<br />
keimende Saat zu schützen. Höchste Zeit nun, dass die Schulbuben ihre Osterratschen<br />
hervorholen und überprüfen: die Klappern und Handratschen, die Arm<br />
und Doppelratschen, die Kreuzratschen, Knieratschen und die Schubkarrenratschen.<br />
Am „Antlaßpfinsta“ (Antlaß bedeutet Entlass aus der Sünde), dem<br />
Gründonnerstagmorgen, zu Beginn der hl. Kartage, fliegen die Glocken nach<br />
Rom. Zu Mittag schon sind ihre Stellvertreter, die Ratsch’n Buben, unterwegs<br />
und beten den „Engel des Herrn“ und sprechen anschließend: „Wir ratschen,<br />
wir ratschen den Englischen Gruß, dass jeder katholische Christ beten muss.<br />
Fallet nieder auf die Knie und betet drei Vaterunser und drei Ave Marie!“ Abends<br />
ziehen die Buben nochmals durchs Darf und ersetzen das Gebetläuten. Am<br />
Karfreitagmorgen, mittags und um drei Uhr nachmittags hören wir sie wieder.<br />
Mittag mahnen sie: „Wir ratschen, wir ratschen zum Ejss’n is Zeit, ejßt oba nit<br />
z’vüll, s’Fosttog hejt!“ Zur Todesstunde Christi, um drei Uhr nachmittags, erinnern<br />
die Buben mit folgendem Vers an das Leiden und Sterben des Heilands:<br />
„Wir ratsch’n, wir ratsch’n, drum dankt ‚s dem Herrn, der für uns g’storben ist<br />
gern!“ Der Karfreitag ist der traurigste Tag des Jahres. Er trägt auch manches<br />
Geheimnis. ... Glaube und Aberglaube reichen einander die Hände. Wenn es an<br />
den Leidenstagen regnete, hieß es: „Ostern und Karfreitagsregen bringen selten<br />
Erntesegen!“ „Donnert es im April, hat der Reif sein Ziel.“ Eine Wetterregel<br />
weiß, dass Aprilschnee düngt .... Am Karfreitag geht der Bauer zeitlich früh auf<br />
den Acker und sinkt mit ausgebreiteten Armen nieder. Schlägt er mit der Drischel<br />
aufs Feld, kann er „den Scher ausdreschen“. An diesem Tag darf kein Brot gebacken<br />
werden und wer etwas aus dem Hause leiht, bekommt beim Zurückbringen<br />
sicher Unsegen oder gar eine Hexe ins Haus. Alle, die noch gut zu Fuß sind,<br />
besuchen das Hl. Grab. Der Gründonnerstag und der Karfreitag blieben dem<br />
Teilhaben an den ergreifenden kirchlichen Zeremonien vorbehalten und der Karsamstag<br />
war nach Arbeitsschluss schon vom österlichen Auferstehungsjubel erfüllt.<br />
Am Karsamstagvormittag, gegen neun Uhr, kommen die Glocken wieder<br />
von Rom zurück. Damit ist das Rufer und Mahnamt der Ratschen Buben zu<br />
Ende. Vormittag besuchen sie jetzt die Dorfbewohner mit Taschen und Zegern,<br />
um ihren Lohn einzufordern. Sie gehen in die Häuser, knien nieder und rufen:<br />
„Wir läuten den Englischen Gruß, auf dass jeder katholische Christ beten muss!“<br />
Andere wieder verlauten: „Wir ratschen, wir ratschen, die Fost’n ist aus, hiazt<br />
ruckt’s nur mit Göld und Eiern heraus!“ Sie konnten nun Geld, Speck, Osterlaibchen<br />
und Eier in Empfang nehmen, welche die Bäuerin bereits dutzendweise<br />
gefärbt hatte. Das Schenken von Ostereiern weist auf einen längst vergessenen<br />
Fruchtbarkeitszauber hin. Die Eier wurden streng nach Rang verteilt: Vom<br />
Hütbuben über die Kindsdirn, Kleindirn, Kleinknecht bis zur Großdirn und zum<br />
Großknecht steigerte sich die Zahl. Als Dank folgte der Vers: „Für alle ejngere<br />
Gaben, ob Vull oder wejng, recht froihi Oistern winsch ma ejng!“ Leider kam<br />
es auch manches mal vor, dass die Ratschen Buben nicht eingelassen wurden.<br />
Da mussten sich die neidigen Leute folgendes anhören: „Ejs loßt’s uns nit ejni,<br />
ejs neidige Kraum, wir wer’n ejng wos pfeif’n, mir woar t ma nit loang!“ Am<br />
Karsamstagabend folgt nun die ersehnte Auferstehungsfeier. Sie ist uns bis heute<br />
in lebhafter Erinnerung geblieben. Unter feierlichem Geläute zieht die fröh-<br />
Ulrich und Julia mit ihren Palmbuschen (Bildg. Grete Rankl)<br />
Österliches Brauchtum<br />
Grete Rankl
28<br />
29<br />
lich fromme Prozession durch den Ort, vorbei an brennenden Kerzenpyramiden<br />
in den Fenstern und auf sauber gekehrten Straßen mit flatternden Vereinsfahnen<br />
voran. Die Blechmusik, in kurzem Marschtritt, spielt feierliche Weisen. Die Kinder<br />
durften heute „dejs roidi Oisterkuttei“ und die Mädchen „’s ‚neji G’wound<br />
ouleg’n“. Der Pfarrer mit dem Allerheiligsten unter dem seidenen Traghimmel<br />
wusste um die Freude seiner Schäflein, die dem Auferstandenen huldigten und<br />
ihn umjubelten. Der Morgen des Ostersonntags atmete Festtagsfreude. In der<br />
Kirche segnete der Priester Osterfleisch, Osterlaibchen, wie auch die<br />
Gründonnerstagseier, von denen mittags jeder essen musste. Kehrte vom Hochamt<br />
ein Mannsbild früher heim als ein Weiberleut, wird die Glucke meist Hähnchen<br />
ausbrüten, deshalb beeilte sich die Bäuerin als erste ins Haus zu treten, damit<br />
es die viel notwendigeren Hennen gäbe. Der Bauer besprengt die Brotfelder<br />
mit dem neuen, am Vortag geweihten Wasser. Inzwischen vergnügte sich die Jugend<br />
auf dem Dorfplatz mit den verschiedenen Eierspielen: „Eierrudeln“, „Eiereinwerfen“,<br />
und mit dem „Eierpecken“. Alle sind fröhlich, vom Kind bis zum<br />
Greis. Nach der Auferstehung, wohl auch erst in der „Fensterlnacht“, vom Ostersonntag<br />
zum Montag, empfingen die Burschen von den Mädchen, mit denen sie<br />
im Fasching fleißig getanzt hatten, das „Oisterbinkerl“. Es enthielt einen mit Paterln<br />
verzierten Tabaksbeutel oder ein Halstüchel, vielleicht auch gestickte Halftern<br />
(Hosenträger) für das Pfingstreiten und selbstverständlich Scheckl’n, die das<br />
Mädchen selbst gekratzt hatte oder kratzen ließ. Die Scheckl’n sind meist die<br />
rotgefärbten Eier, verziert mit Blumen und Blattmustern und mit einem passenden<br />
Sprüchel drauf. Die Verse verrieten das Herz der Geberin. Weil die Ostereier<br />
in erster Linie für die Liebenden bestimmt waren, hat ihnen die Volkspoesie die<br />
meisten Scheck’l Sprüche gewidmet. Getraute sich ein Mädchen nicht einem<br />
Burschen zu sagen, was ihr Herz bewegt, dann schrieb sie ihr Geheimnis auf das<br />
Ei. Die den Burschen zugedachten Scheckl’n trugen auf sie bezogene Reimsprüche.<br />
Sprüchlein für die Liebenden:<br />
„Im Herzen mein hat niemand Platz als Gott allein und du, mein Schatz!“<br />
„Der Himmel ist blau, die Eier sind rot, ich will dich lieben, bis in den Tod.“<br />
„Deiner will ich stets gedenken und mein treues Herz dir schenken.“<br />
Der Beschenkte musste sich dafür unbedingt mit einem Maibaum am Kammerfenster<br />
seiner Auserwählten erkenntlich zeigen. Nach der „geschlossenen“ Zeit,<br />
die bis Ostern dauerte, wurde dann vielfach Hochzeit gefeiert. Es gab aber, wie es<br />
im Leben so ist, auch Sprüche, die nur an einen Faschingstanz erinnerten:<br />
„Ih dounk da füa Sejmül, ih dounk da f füa’s Bia, ah füa die Zeit, woust mih gliebt<br />
host, oba heirat’n wiar ih di nia.“<br />
Will einer nicht begreifen, dass ihn die Liesl, Kathl oder die Lini nit mejgn, dann<br />
kriegt er einen Scheckel auf dem die Worte stehen:<br />
„Ich bin verliebt bis in den Tod, aber nicht in dich, du Haubenstock!“<br />
Zu einer Absage genügte es aber auch zwei Eier zu geben, das heißt „ein Paar“.<br />
Durch die Klanggleichheit von Paar und „bar“ gilt „ein Paar“ für „bar“ auszahlen,<br />
was soviel bedeutet wie wir sind fertig miteinander. Am Ostermontag war<br />
Altenglische Texte überlieferten den Namen der germanischen Lichts und<br />
Frühlingsgöttin Eostrae. Ursprünglich Göttin des Tageslichts, wurde sie zur Göttin<br />
des Lichtes überhaupt erhoben und mit ihr das ihr gewidmete Fest zum Fest<br />
des zunehmenden Lichts im Frühling. Nur in Englischen blieb der Name Eostrae<br />
im Osterfest als Easter und im Deutschen als Ostern erhalten. Schon die Goten<br />
waren ausgeschert, hatten aus dem kirchenlateinischen pascha ihr paska entlehnt.<br />
Die Schweden folgten mit pask und die Niederländer mit Pasen.<br />
Das althochdeutsche ostarum, osterlih = Ostern, österlich, erreichte die deutschen<br />
Lande über das mittelhochdeutsche osteren. Aus ihm wurde im Rahmen der<br />
Christianisierung das Fest der Auferstehung Christi.<br />
Von Eostrae zu Ostern<br />
Josef Bernklau<br />
das „Emmaus Gehen“ üblich, worunter zumeist ein Gang zu Verwandten, Göjd’n,<br />
Basen und Vejdan gemeint waren. Das Osterfest in solcher Weise begangen, wurde<br />
für Groß und Klein zu einem echten Erlebnis und ließ alle die tiefen Zusammenhänge<br />
zwischen Natur und Mensch, die um diese Zeit der Auferstehung offenbar<br />
werden, ahnen und empfinden.<br />
Kunstvoll gekratzte Scheck’ln aus Salnau und Umgebung (Bildg. Grete<br />
Rankl)
30<br />
31<br />
Osterfeuer<br />
Das ursprünglich heidnische Kultfeuer, in vielen Ländern Europas entzündet und<br />
manchenorts auch „Judas Feuer“ genannt, wird schon in einer alten Chronik des<br />
8. Jahrhunderts erwähnt. Hier und da umwickeln die Pfleger dieses Brauchtums<br />
Wagenräder mit Stroh und Reisig und lassen sie bei Einbruch der Dunkelheit<br />
brennend von einem Berg ins Tal rollen.<br />
Osterkerze<br />
384 in Piacenza entdeckt, im 7. Jahrhundert von allen Titelkirchen Roms verwendet.<br />
Die Anbringung des Kreuzes und der Buchstaben Alpha und Omega wird<br />
zuerst Spanien zugeschrieben. Der Brauch aus Jerusalem, eine brennende Kerze<br />
an die Mitfeiernden weiterzureichen, fand weiteste Verbreitung.<br />
Ostereier<br />
Kreuzfahrer sollen erstmals gefärbte Eier aus dem Orient nach Europa gebracht<br />
haben. Die ersten farbigen Ostereier im christlichen Abendland waren rot. Sie<br />
sollten an das vergossene Blut Christi erinnern.<br />
Osterreiten<br />
In der Oberlausitz zwischen Kamenz und Bautzen ist dieser Brauch über 400<br />
Jahre alt. Er wurde und wird auch andernorts noch ausgeübt. Während des Rittes<br />
der katholischen Sorben (bis zu 600 Reiterpaare) wird die Botschaft der Auferstehung<br />
Christi verkündet und werden österliche Kirchenlieder auf sorbisch gesungen.<br />
Das Osterfest wurde uns in der Heimat zu einem echten Erlebnis und ließ alle<br />
tiefen Zusammenhänge zwischen Natur und Mensch, die um diese Zeit der Auferstehung<br />
offenbar werden, ahnen und empfinden. Das österliche Geschehen bewegte<br />
tief. Lassen wir ihn erzählen, wie er die Osterzeit in seinem Heimatorte<br />
erlebte.<br />
„Auf den Feldern, die meinen Geburtsort (Oberplan) umgeben, war der Schnee<br />
bereits weg, aber sie lagen noch nass und schwarz vor der Sonne. Die ganze<br />
Frühlingssehnsucht, in allen Wesen, besonders aber in Kinderherzen lebendig,<br />
schlug bereits in heller Lohe auf: da kam noch die Karwoche dazu, diese magische<br />
Woche voll religiöser Feier und Gefühle, voll Mysterien und Geheimnisse,<br />
die mit zauberhafter Gewalt für die jungen Herzen wirken. –<br />
Schon am Palmsonntag begann sie in unserer Kirche mit einem Walde aller möglichen<br />
Zweige, die Kätzchen trugen, welche Kätzchen man dort Palmen nennt.<br />
Die Landleute der umliegenden Dörfer hatten den Wald in die Kirche gebracht,<br />
und fast jeder Mann hielt einen Palmenstamm empor, den er schlank und zierlich<br />
aus trockenem Fichtenholze geschnitzt hatte, und an dessen Spitze<br />
Ostern<br />
Adalbert Stifter<br />
Osterreiten im nördlichen Böhmerwald. Wia Künstlerkartenverlag, Teplitz<br />
Schönau. Entwurf G. Zindel.(Sammlung Reinhold Fink)<br />
Der Osterritt an der Moldau bei Wallern. Wia Künstlerkartenverlag, Teplitz<br />
Schönau. Entwurf Fr. Jung Ilsenheim. (Sammlung Reinhold Fink)
32<br />
33<br />
Die Höhepunkte des Naturjahres, wie die Winter und Sommersonnenwende,<br />
sowie das nahende Pfingstfest, wurden von unseren altbayrischen Ahnen uraltem<br />
Brauchtum umgeben, das soweit möglich auch von der Kirche in Ihr Jahr eingebunden<br />
wurde. Besonders eindrucksvoll wurde der Beginn der Sommerzeit um<br />
Pfingsten gefeiert, da die wiedererwachende Natur die Herzen der Menschen öffnete.<br />
Die nun folgenden Tage um die Sommersonnenwende mit den längsten<br />
Tagen und kürzesten Nächten bedeuteten den Höhepunkt vorchristlicher Fruchtbarkeits-<br />
aber auch Abwehrbräuche. Mit der Vertreibung 1946 star-<br />
<strong>Böhmerwäldler</strong> Brauchtum zu Pfingsten<br />
Grete Rankl<br />
sich ein dichter Busch von Palmen ausbreitete, untermischt mit dem dunklen Grün<br />
der Tannen, die dem Ganzen eine düstere, ernste Feier gaben, namentlich wenn<br />
der sanfte blaue Weihrauch der Kirche durch ihre Zweige quoll und über den<br />
Wipfeln die ruhigen Orgeltöne hin schwammen. Dann kam der Montag und die<br />
Vorbereitungen begannen zu dem traurig feierlichen Feste. Die Altäre waren von<br />
oben bis unten mit Schwarz behängt; statt der wehenden Fahnen der Zünfte standen<br />
die nackten Stangen empor; ein emsiges Sägen und Hämmern hörte man des<br />
Nachmittags aus der Kirche ein Gerüste erhob sich ungewöhnlich feierliche<br />
Kirchengebräuche geschahen in den Vormittagen; dann hörte jedes Glockenläuten,<br />
selbst das Schlagen der Uhren auf, was auf mein Kinderherz den Eindruck<br />
der tiefsten Trauer machte. In der Kirche aber stand das schwarze Grab mit seinen<br />
schimmernden Lampen von düsterem Rot und Grün und Blau, und die andächtige<br />
Menge kniete davor. So groß ist die Macht der dem Menschen angeborenen<br />
Religionsweihe, daß mir als Kinde, wenn ich in jenen Tagen kaum erst die<br />
Schwelle der Kirche betreten hatte, schon die Schauer der Ehrfurcht ins Herz<br />
kamen und daß ich in tiefster Andacht und Zerknirschung vor dem heiligen Grabe<br />
kniete, das, obwohl von Menschenhänden gemacht nun nicht mehr Holz und<br />
Leinwand war, sondern das bedeutete, was vor zweitausend Jahren als Geheimnis<br />
der Erlösung geschah und seither in der Seele der Menschen fortwirkte. Dann<br />
löste sich gemach die Trauer: als Vorbote kamen schon Samstagvormittag die<br />
Glocken, ihr Ton war erfreuend und noch Erfreulicheres kündend. Abends war<br />
das Fest der Auferstehung. Sonnenhell war es in der Kirche von hundert funkelnden<br />
Kerzen; erhabene Musik rauschte, und die Menschen waren geputzt, um jenes<br />
Ereignis zu feiern, das als größtes Wunder, als der Grund des Glaubens anerkannt,<br />
wurde, die Auferstehung. So freudenreich ist dies Ereignis, daß bei uns die<br />
fromme Sage geht, die Sonne gehe am Ostersonntag nicht wie gewöhnlich auf,<br />
sondern hüpfe dreimal freudig empor.“ (Einsendung Grete Rankl)<br />
ben leider auch die meisten Bräuche<br />
der Heimat aus, obwohl wir sie bis<br />
heute nicht vergessen haben. Sicher ist<br />
so manchem von uns das Aufstellen<br />
des Pfingstbaumes in froher Erinnerung<br />
geblieben, die ich heute mit euch<br />
auffrischen möchte. Schon Tage<br />
vorher kamen die Hütbuben mit großem<br />
Eifer ihrer Aufgabe nach, in einem<br />
benachbarten Wald einen großen,<br />
schlanken Baum zu holen. Wurde dieser<br />
aber nach altem Brauch in der<br />
Nacht vor dem Aufstellen gestohlen,<br />
musste er erst durch Freibier eingelöst<br />
werden. Nun ging es an die Arbeit.<br />
Zuerst musste der Baumriese fachgerecht<br />
abgerindet werden, sodass er völlig glatt war. Nur die Krone durfte er behalten.<br />
Unterdessen wanden die „Mejscha“ aus grünem Tannenreis einen Kranz,<br />
der mit langen bunten Seidenpapierbändern geschmückt und mit Stricken unter<br />
dem Gipfel aufgehängt wurde. Der Stamm bekam außerdem eine grüne Girlande,<br />
die bis zur Hälfte des Baumes reichte. War jetzt der Pfingstbaum geschmückt,<br />
kam nun der schwerste Teil der Arbeit. Jetzt musste der oft 20 m hohe Riese<br />
aufgestellt werden. Dazu standen bereits die erwachsenen Burschen und Männer<br />
bereit. Mit zusammengebundenen Stangen, Heugabeln und Leitern wurde zuerst<br />
der obere Teil des Baumes ruckweise immer höher gestemmt und mit dem dicken<br />
Ende in die vorbereitete Grube gesenkt. Wenn der Stamm nach schwerer, gefährlicher<br />
Arbeit aufrecht stand, wurde er noch mit großen Scheitern in der Grube<br />
verkeilt. Die Freude über den schönen Baum und die gelungene Aufstellung erfasste<br />
die ganze Dorfgemeinschaft. Der bunt geschmückte, hoch über die Dächer<br />
Salnaus ragende Pfingstbaum lockte jeden Abend die Jugend auf den Dorfplatz<br />
zu gemeinsamen Singen und Musizieren. Jetzt konnten auch die Burschen ihre<br />
Kraft und Geschicklichkeit beim Baumkraxeln beweisen. Für besonders waghalsige<br />
Kletterer winkten sogar Würste vom Gipfel. Noch nicht genug des Fröhlichseins,<br />
tobte sich auch jetzt noch der Übermut der Jugend aus. Es folgte die verrückteste<br />
Nacht des bäuerlichen Jahres, die sog. Rigelnacht (rigeln = rühren, bewegen).<br />
Alles was nicht niet und nagelfest auf den Höfen war, wurde von den<br />
Burschen an alle möglichen und unmöglichen Stellen verschleppt<br />
Krummau: Ostern in der Heimat.<br />
Wächter Verlag, Teplitz Schönau.<br />
Entwurf Fr. Jung Ilsenheim.<br />
(Sammlung Reinhold Fink)
34<br />
35<br />
In der Kinderzeit, da war der Fonleichnamstag noch ein Fest für die ganze Gemeinde,<br />
an dem die Männer, Frauen und Kinder gleichermaßen teilnahmen und<br />
Freude hatten. Das Traditionsbewusstsein ankerte fest in der Bevölkerung und<br />
der Glanz des Tages leuchtete hell in den Herzen. Mit dem Krieg und der nachfolgenden<br />
Vertreibung aus der Heimat, schwand bei auflebenden Wohlstand auch<br />
das Interesse an der gemeinsamen Prozession durch die Dörfer und Städte. Fronleichnam<br />
begann dahin zu welken, wie so vieles Althergebrachtes, das in der ach<br />
so fortschrittlichen Zeit nur noch belächelt wurde. Einst hat dieser Tag noch seinen<br />
festen Bestand in den Familien gehabt. Für die Menschen rückte der<br />
Einst am Fronleichnamstag<br />
Ernst Braun<br />
Himmel bei der Teilnahme an der Prozession ein bisschen näher. Um diese Zeit<br />
im Spätfrühling hielt meistens auch das Wetter was es versprach. Aber mit Gewittern<br />
musste schon gerechnet werden, wenn sie am Nachmittag aufzogen, war<br />
ja schon alles vorbei. – Eigentlich begann es schon am Tag vorher. Da mussten<br />
die Mädchen auf den Dorfwiesen Blumen für ihre Körbchen pflücken, um damit<br />
bei dem Umzug, wenn auch spärlich, einen Blumenteppich auf den Weg streuen<br />
zu können. Bei den Wiesenblumen nahm man am liebsten Gänseblümchen,<br />
Hahenfuß und Sumpfdotterblumen. – Am Fonleichnamstag Morgen hieß es schon<br />
früh aufstehen. Der Gottesdienst begann eine halbe Stunde früher, als sonst an<br />
Sonntagen. Das Frühstück wurde hastig eingenommen, Männer und Frauen beteiligten<br />
sich am Aufbau der Altäre an der Straße. Während die Männer junge<br />
Birken herbei schafften, übernahmen die Frauen das Schmücken mit Blumen und<br />
Bildern. Bei allen Vorbereitungen auf die Prozession, herrschte in den Häusern<br />
ein freudiges Durcheinander. Die Mutter Schwang die meist zur heiße Brennschere,<br />
um sie abzukühlen, fuhr sich dann mit dem Eisen in ihre Haarpracht. Sie<br />
stand dabei vor dem Spiegel und drückte ihre Haare in Wellen zurecht. Die Frauen<br />
wollten auch damals gut aussehen. Die Haare der Mädchen wurden ebenfalls<br />
mit der Brennschere bearbeitet, bis sich die Locken an beiden Seiten der Ohren<br />
treppenartig aufbauschten. Darauf setzte man ein Myrtenkränzchen, das sich im<br />
frischen Grün trefflich von dem weißen Kleid abhob. Aber auch den Buben musste<br />
beim Anziehen geholfen werden. Ihre widerspenstigen Haare sind glatt gebürstet,<br />
nass gemacht und mit einen messerscharfen Scheitel versahen worden. Bei<br />
manchen Familien kam noch eine Haarpomade dazu, sodass der Haarschopf der<br />
Buben glänzte wie frisch gewichst. Während die Mädchen zumeist<br />
und rund um den Pfingstbaum so aufgebaut, dass niemand vorbeifahren konnte.<br />
Die Mägde mussten sich ihre Melk und Stallgeräte am nächsten Morgen selber<br />
suchen. Manche „Buam“ verbauten sogar die Kammerfenster der Mädchen mit<br />
Rasenstücken, sodass es am nächsten Morgen finster blieb und sie verspätet zur<br />
Arbeit kamen. Andere wieder spielten dem Bauern einen Schabernak und zerlegten<br />
den Mistwagen, schleppten die Teile auf den Dachfirst, wo er wieder zusammengebaut<br />
und hoch mit Mist beladen wurde. Das war ein Gaudium für das ganze<br />
Dorf, das Sinn für Spaß und Humor hatte. Der Bauer selbst mochte zusehen,<br />
wie er den Wagen wieder herunterbekam. Man war in den Böhmerwalddörfern<br />
nicht glücklich, als der Pfingstbaum abgeschafft und dafür der Maibaum eingeführt<br />
wurde. Es gab von da an keine Rigelnacht mehr und die Dörfer sind um ein<br />
großes Vergnügen ärmer geworden. Der Pfingstbaum ist noch ein Überbleibsel<br />
aus der Heidenzeit, da der Wald und somit auch der Baum, für die Ahnen etwas<br />
Heiliges war. Bäume und Wälder galten als Wohnsitz von Schutzgeistern. Unter<br />
Bäumen brachten sie ihre Opfer dar. Es lag daher nahe, zu gewissen Festzeiten<br />
Bäume aus dem Wald in das Dorf zu holen und sie vor ihrem Heim als Schutzzeichen<br />
aufzustellen. Die Dorfgemeinschaft platzierte später den Baum in die<br />
Mitte des Ortes, damit alle Bewohner in den Genuss seines Schutzes kamen. Sicher<br />
hing das Aufstellen des Pfingstbaumes auch mit dem Erwachen der Natur<br />
zusammen. Schon im Mittelalter war es Brauch, dass der Bursche seinem Mädchen<br />
den ersten blühenden Zweig oder Strauch überreichte, um ihr seine Liebe zu<br />
bezeugen. Später übernahmen die Dörfer den schönen Brauch und entwickelten<br />
ihn bis zum Pfingstbaum weiter. Als heimatliches Wahrzeichen gehört dieser Baum<br />
zusammen mit der Kirche und dem Wirtshaus zu jeder örtlichen Lebensgemeinschaft.<br />
Adalbert Stifter: Das Mutterherz. Wia Künstlerkartenverlag, Teplitz Schönau.<br />
(Sammlung Reinhold Fink)
36<br />
37<br />
in Weiß zur Prozession antraten, trugen die Buben öfter dunkle Anzüge, die Hosen<br />
waren entweder zu lang oder zu kurz. Die Knie sollten jedoch unbedingt<br />
bedeckt sein. – Viele Väter hatten mit dem Anzug weniger Probleme. Sie rückten<br />
in einer Uniform aus. Veteranen – Krieger - Turnverein, die Feuerwehr, Musikverein,<br />
Radfahrerverein zu Fuß, schmückten im bunten Tuch den Zug. – Kurz<br />
vor Beginn des Hochamtes strömten die Menschen, aus allen Richtungen kommend,<br />
der Kirche im Zentrum zu. Die Vereine maschierten im Gleichschritt, der<br />
Kirchenchor versammelte sich vor dem Portal der Kirche. Die Glocken läuteten<br />
schon wie rasend und verheißungsvoll, als müsste die gesamte Menschheit vor<br />
der einen Kirche eintreffen. Dann war es soweit. In kostbare Messgewänder<br />
gehüllt trat der Priester mit der erhobenen Monstranz aus dem Kirchentor. Über<br />
ihm der Tragehimmel von vier Männern gehalten und es begann sich die Masse<br />
der gläubigen Menschen gemessen Schrittes in Bewegung zu setzten, begleitet<br />
von den getragenen Klängen der Blasmusik. Viele bunte Fahnen schmückten den<br />
von zumeist dunkel gekleideten Menschen gebildeten langen Zug. Im Gegensatz<br />
dazu die weiß gekleideten Mädchen, die Blumen streuend geschlossen, wie auch<br />
die Buben von ihren Lehrern begleitet wurden. Direkt hinter dem Allerheiligsten<br />
gingen die Mitglieder des Frauenvereins von Station zu Station Gebete murmelnd.<br />
Die Messdiener klingelten ohne Unterlass mit ihren Schellen, andere schwangen<br />
Weihrauchkessel und hüllten damit ihre Umgebung in himmlische Nebel. Für<br />
die Baldachinträger war es eine Ehre den Himmel tragen zu dürfen, die Tatsache<br />
des Auserwähltseins konnte man an ihrer zur Schau getragenen Miene erkennen.<br />
In den Fenstern der Häuser, an denen die Prozession vorüber zog, standen Blumen,<br />
Kerzen und Heiligenbilder. Es war wie ein wogendes Meer andächtig betender<br />
Menschen, die in Demut geübt durch die Straßen des Ortes zogen. Das<br />
weibliche Geschlecht war immer reich vertreten. Trotz der Sonnenwärme, die in<br />
den Vormittagsstunden meistens rasch anstieg, liefen manchen Teilnehmer bei<br />
den Zeremonien fromme Schauer über den Rücken. Im Strahl der Sonne begannen<br />
die uniformierten Männer, besonders die Fahnenträger, zu schwitzen und so<br />
mancher dachte ganz unanständig schon an ein kühles Bier. Bei den mehrmaligen<br />
Halt an den Straßenaltären sang der Kirchenchor, „O Engel Gottes eil hernieder“.<br />
Es bimmelten die Glocken und die Böller des Veteranenvereins schossen<br />
am Dorfrand Salut. So ging der Marsch dem Ende entgegen. Manch prüfender<br />
Blick ging auch zum Horizont und galt der Wolkenbildung, wird das Wetter halten?<br />
Nach dem Schlusssegen in der Kirche und dem gemeinsamen Gesang, „Großer<br />
Gott wir loben dich“, strömten die Menschen vom heiligen Geist beseelt zurück<br />
in ihre Wohnungen. Wieder einmal Fronleichnam, wieder einmal dabei gewesen.<br />
Wenn es auch an diesem Tag kein großes Mittagessen gab, dazu war die<br />
Zeit zu knapp, man begnügte sich mit einer warmen Wurst und Brezel, die ein<br />
Händler am Wege anbot.<br />
Freudig sah man im Böhmerwald in dem alljährlichen festlichen Gedächtnis der<br />
Aufopferung Jesu zu Mariä Lichtmess eine besondere Hervorhebung der Taufe<br />
und der damit zusammenhängenden Vorsegnung. „Af Liachtmejssn is unsa Liawi<br />
Frau vüragoanga“ – „ließ sich unsere Liebe Frau vorsegnen“, hieß das. Gleich<br />
nach der Geburt, selten etwas später, wurde mit dem Kind zur Taufe gegangen.<br />
War gerade Sonntag, dann passte es besonders gut, weil nämlich kein Tag „vertragen“<br />
wurde. Alte Leute erzählen oft, dass eine Taufgesellschaft auf dem Wege<br />
in das Pfarrdorf im Schnee stecken blieb, umwarf oder umkehren musste. Professor<br />
Josef Dichtl erzählte mir von einem Täufling, der auf dem weiten Weg zur<br />
Kirche erfror. Bei der Wahl des Namens für das Kind galt altes Herkommen. Die<br />
Vornamen der Eltern waren es vor allem, die in Frage kamen, dann die Namen<br />
der Paten und schließlich Heiligennamen, und zwar von solchen, deren Festtag<br />
noch im laufenden Jahr bevorstand; „zurücktaufen“ sollte man nicht, solche Kinder<br />
lernten später schlecht, hieß es. Nach vollzogener Taufe wurde eingekehrt.<br />
Nicht selten kam es vor, dass die ganze Taufgesellschaft erst in den späten<br />
Längst vergangener Brauch und Aberglaube bei<br />
einer Geburt<br />
Grete Rankl<br />
Wandervogel: Tanz um das Sonnwendfeuer. Künstlerkarte von Robert<br />
Kämmerer. (Sammlung Reinhold Fink)
38<br />
39<br />
Da Houhwald noh steht<br />
Und noh s Bergwossa rinnt:<br />
Solong bleibst mei´ Hoamat<br />
Und ich bleib dei´ Kind!<br />
(Aus „Mein Böhmerwald“ Folge 1 / 2, 9. Jhg.)<br />
Und denat, mei´ Hoamat,<br />
Du bist noh de olt,<br />
Solong noh a´ Berg<br />
Af sein Grundfestn holt.<br />
Bo´ n hergwochsna Bölkla<br />
Net oa´s hon ich kennt.<br />
Und d Oltn? Scho´ viel<br />
In da Ewikeit ent-<br />
Als Adalbert Stifter zwölf Jahre alt war, hörte er sagen: „Das Göttliche, wenn es<br />
auch im Menschen beschränkt ist macht dennoch sein eigentliches Wesen aus; es<br />
entfaltet sich im Lebenswandel, in der Religion, der Kunst, der Wissenschaft.<br />
Was im Leben und in den geistigen Gütern des Menschen unvergänglichen Wert<br />
besitzt, ist also aus der ursprünglichen Gottähnlichkeit der menschlichen Seele<br />
erwachsen...“ Stifter sagt in diesem Zusammenhang von sich selbst, dass dieses<br />
Wort den Kern seines Wesens mit Gewalt getroffen habe. In einem Brief Stifters<br />
lesen wir: „All mein folgendes Leben, ein zweiundzwanzigjähriger Aufenthalt in<br />
Wien, Bestrebungen in Kunst und Wissenschaft, im Umgang mit Menschen, in<br />
Amtstätigkeit führten mich zu demselben Ergebnis, und jetzt im neunundfünfzigsten<br />
Jahre meines Lebens habe ich den Glauben noch; aber er ist mir kein<br />
Glaube mehr, sondern eine Wahrheit wie die Wahrheit der Mathematik.... Diese<br />
Wahrheit ist unbedingt....“<br />
(Altstadler Mundart, oberer Böhmerwald)<br />
Bin hoam wieda kömma<br />
Noh etlina Joahrn –<br />
Ja, war des noh d Hoamat?<br />
Schier fremd bin ich woarn.<br />
Adalbert Stifter, aus seinem Leben<br />
Erich Hans<br />
Wieda dahoam<br />
Zephyrin Zettl<br />
Abendstunden in wein oder bierseliger Laune nach Hause zurückkehrte. Am<br />
Sonntag nach der Taufe war der Taufschmaus. Da gab es Schnaps, Wein, Bier,<br />
Tee, Kaffee, Krapfen, Kolatschen, Striezel, Guglhupf und dgl.. Die Paten, Geladenen<br />
und Verwandten brachten ins „Weisat“ (Taufgabe) Geschirr, Wäsche, kurz<br />
Dinge, die im Haushalt gebraucht wurden. Der Säugling selbst bekam ein gelbes<br />
Band um den Hals, dieses sollte ein Vorbeugungsmittel gegen die Gelbsucht sein.<br />
Die Fingernägel durften dem kleinen Erdenbürger vor einem Jahr nicht geschnitten<br />
werden, da man glaubte, dass er sonst im späteren Leben diebisch werde.<br />
Dafür ersetzten die Zähne der Mutter die Schere. Im ersten Lebensjahr sollte das<br />
Kind nicht abgeregnet werden, denn sonst bekäme es Sommersprossen. In der<br />
Fastenzeit und wenn der Kuckuck schreit, sollte der Säugling nicht „abgenommen“<br />
werden, er würde sonst sicherlich traurig. Die beste Zeit hierfür, so meinten<br />
viele Mütter aus dem Böhmerwald, sei der Fasching. Trotz strenger Wahrung des<br />
Aberglaubens und überlieferter Ratschläge der Vorfahren, starben früher sehr viele<br />
der Kinder noch vor ihrem ersten Geburtstag.<br />
Leopold Hafner: Adalbert<br />
Stifter
40<br />
41<br />
Adalbert Stifter wandte sich als Künstler zunächst der Malerei zu. Dafür bekam<br />
er durch seinen Lehrer Georg Riezlmayer im Stift Kremsmünster, wohin der junge<br />
Adalbert im Jahre 1818 gekommen war, gründliche Anleitungen. Nach achtjähriger<br />
Gymnasialzeit, die ihn nur in den Ferien in die Heimat Oberplan entließ,<br />
ging er 1826 mit einem glänzenden Maturazeugnis zum Studium an die Universität<br />
Wien. Die Reise nach Wien unternahm er gemeinsam mit einem Freund auf<br />
einem Floß. Zunächst studierte Stifter Staatswissenschaften; aber so fleißig er<br />
auch war, dieses Studium entsprach seinem Wesen nicht - er wandte sich bald den<br />
Naturwissenschaften zu und war auch eifriger Student an der Kunstakademie.<br />
Stifters Eltern sein Vater war schon tödlich verunglückt, als Adalbert zwölf<br />
Jahre alt war konnten das Geld für das Studium in Wien nicht aufbringen. So<br />
musste Adalbert sein Brot als Hauslehrer verdienen. Als solcher gewann er bald<br />
hohes Ansehen und wurde in die bekanntesten Häuser Wiens gerufen.<br />
In einem dieser Häuser wurde Stifter als Dichter entdeckt, als ihm ein Mädchen<br />
die Handschrift der Novelle „Der Condor“ aus der Tasche zog. Als Maler strebte<br />
Adalbert Stifter Zeit seines Lebens danach, die Natur als herrlichstes Kunstwerk<br />
Gottes getreu darzustellen, und so lässt er in der Novelle „Nachkommenschaften“<br />
den Maler sein bestes Werk vernichten, weil es nicht dem Kunstwerk Gottes gleichkommt.<br />
Stifter war einer der beachtlichen Maler seiner Zeit. Seine Weltbedeutung<br />
aber fand er als Schriftsteller und Dichter.<br />
Adalbert Stifters Wunsch, Fanni Greipl aus Friedberg als Gattin heimzuführen.<br />
ging nicht in Erfüllung. Die Familie Greipl war wohlhabend; Stifter war ein armer<br />
Hauslehrer, Maler und Schriftsteller, der sich nicht durchringen konnte, trotz<br />
guter Voraussetzungen seinen Studienabschluss zu vollenden. Erst mit 32 Jahren<br />
heiratete er Amalie Mohaupt, ein einfaches Mädchen, dem er trotz dessen schlichten<br />
Denkweisen das ganze Leben treu anhing. Kinder waren der Ehe nicht beschieden.<br />
Das war eine der Bedrückungen, unter denen Stifter litt, er liebte Kinder.<br />
Hart traf Ihn der Tod zweier junger Verwandter, denen er sein Herz zugewandt<br />
hatte.<br />
Zwei geschichtliche Ereignisse bewegten Adelbert Stifter besonders stark: Die<br />
revolutionären Vorgänge des Jahres 1848 und der preußisch - österreichische Krieg<br />
1866. 1848 stießen ihn, der zunächst dem Umsturz und den Ideen von 1848 freundlich<br />
gegenüberstand, die Maßlosigkeit und die Unredlichkeit ab, die im Zuge der<br />
Ereignisse zum Vorschein kamen. „Ich bin ein Mann des Maßes und der Freiheit“,<br />
schrieb er damals. „Wer frei sein will, der muß sich selber beherrschen; die<br />
echte Freizeit liegt in der Verteilung der Macht und der Lasten und Pflichten.“<br />
„Die Verhältnisse sehen, und doch die Verwirrung und Schlechtigkeit geschehen<br />
lassen müssen, ist ein Schmerz, der sich kaum beschreiben läßt.“ (Brief 1849)<br />
Der Krieg des Jahres 1866 entsetzte ihn: zwei Mächte kämpften gegeneinander,<br />
deren Soldaten auf beiden Seiten Deutsche waren. Im Angriff Preußens auf Österreich<br />
sah er einen Frevel ungeheuren Ausmaßes. „Unsere Herzen werden von<br />
den Wirrnissen, die jetzt in Deutschland ausgebrochen sind, wohl alle getroffen....<br />
Deutschland, das Land meiner Liebe und meines Stolzes betrübt mich tief.<br />
Es sollte nicht eine Stimme in demselben geben, welche nicht mit Entrüstung<br />
gegen Lüge und Unrecht spricht.“ (Brief 1866) Gälten bei allen Führungen der<br />
Völker Recht und Sitte, „dann wäre der Krieg unmöglich, und der Mensch dürfte<br />
ohne Erröten sich das Beiwort vernünftig beilegen lassen“. Unter den Eindrücken<br />
der Revolution zog Adelbert Stifter 1848 nach Linz. Wien war ihm vergällt,<br />
obwohl er dort einen Freundeskreis gefunden hatte, dem der Dichter Grillparzer,<br />
der Geologe Simony und andere hervorragende Menschen angehörten. Auch mit<br />
Gustav Heckenast, seinem Verleger, der in Budapest wirkte, verband Stifter eine<br />
feste Freundschaft.<br />
Im Jahre 1850 wurde Adalbert Stifter als Schulrat und Inspektor der Volksschulen<br />
in Oberösterreich angestellt. Damit war er seiner finanziellen Sorge weithin<br />
enthoben, doch nahm ihn das Amt so stark in Anspruch, dass er sich in seinem<br />
Wirken als Künstler beengt sah. Nach fünf Jahren Amtstätigkeit ohne Urlaub,<br />
war seine Gesundheit angegriffen. Stifter arbeitete damals an seinem größten Werk,<br />
am „Witiko“. Er brauchte Erholung und bat um Urlaub. Je älter Adalbert Stifter<br />
wurde, umso mehr zog es ihn in die Nähe seiner Heimat. So suchte er mit Vorliebe<br />
Erholung im Rosenberger Gut am Fuße des Dreisessels. Dort schrieb er große<br />
Teile des Romans „Witiko“, welcher in der Handlung auch in der Landschaft um<br />
das Rosenberger Gut beginnt.<br />
Aus der Welt Adalbert Stifters: Geburthaus in Oberplan. Wia Künstlerkartenverlag,<br />
Teplitz Schönau. Entwurf G. Zindel. (Sammlung Reinhold Fink)
42<br />
43<br />
Sehnend sitze ich hier und hefte das Auge in die Ferne.<br />
Dort, wo des Himmels Blau sanft sich mit Bergen vermischt,<br />
dämmert das freundliche Land der verlassenen Heimat herüber.<br />
Dorten der neblichte Streif, oh, ich erkenne ihn gut.<br />
Dort ist der hochaufragende Wald, der die Heimat beginnt.<br />
Glänzendes Jugendland, wär ich doch wieder in Dir.<br />
Oh, es war schön, da der Baum, worunter ich spielte,<br />
schön, da des Vaters Haus,<br />
schön, da das heimliche Tal meine Welt war.<br />
Nie umwölkte sich damals mein Himmel.<br />
Immer war mir der Tag, der Abend so schön.<br />
Damals kannte nicht Gram noch die unbefangene Seele,<br />
Frohsinn tönte das Spiel, tönten die Berge zurück.<br />
Kindheit in der Heimat<br />
Die Gestalten des Einzelnen<br />
In der Erzählung „Der Hagestolz“ zeichnete Stifter sein Bild vom einzelnen Menschen:<br />
„Jeder ist um sein selbst willen da, aber nur dann ist er da, wenn alle<br />
Kräfte, die ihm beschieden worden sind, in Arbeit und Tätigkeit gesetzt werden,<br />
denn das ist Loben und Genuß und wenn er daher das Leben ausschöpft bis zum<br />
Grunde. Und sobald er stark genug ist, seinen Kräften allen, den großen und den<br />
kleinen, nur allen, diesen Spielraum zu gewinnen, so ist er auch für die anderen<br />
am besten da... Ich sage dir sogar, daß die Hingabe seiner selbst für andere -<br />
selber in den Tod gerade nichts anderes ist, als das stärkste Aufplatzen der Blume<br />
des eigenen Lebens. Wer aber in seiner Armut nur eine Lebenskraft einspannt,<br />
etwa die des Hungers, der ist für sich selber in einer einseitigen und kläglichen<br />
Verrückung, und er verdirbt die, die um ihn sind.“<br />
Die Persönlichkeit<br />
In der Erzählung „Aus der Mappe meines Urgroßvaters“ kennzeichnet Adalbert<br />
Stifter das Wesen einer Persönlichkeit, indem er den alten Obristen sagen lässt:<br />
„Ich lernte nach und nach das Gute von dem Gepriesenen unterscheiden, das<br />
Heißersehnte von dem Gewordenen“. „Wer frei sein will, der muß sich selbst<br />
beherrschen“, konnte man um 1848 im Wiener Boten lesen. „Ich bin ein Mann<br />
des Maßes und der Freiheit.“ „Buben lärmen und wähnen, dadurch Kraft auszudrücken,<br />
Männer handeln und drücken durch die Handlung Kraft aus; und je<br />
Adalbert Stifter alterte, nach heutiger Sicht, früh. Mit 63 Jahren war er ein alter<br />
und kränkelnder Mann geworden, und die Krankheit gab ihn auch nicht mehr<br />
frei. Als er im Herbst 1867 an einer Grippe erkrankte und sein Leberleiden wieder<br />
heftig einsetzte, fühlte er sein Ende nahen. Trotzdem schleppte er sich immer<br />
wieder zum Schreibtisch. Er arbeitete an einer dritten Fassung seiner Erzählung<br />
„Aus der Mappe meines Urgroßvaters“. Sie sollte zu einem zweibändigen Roman<br />
ausgebaut worden. Im Jänner 1868 verschlechterte sich sein Zustand. In den<br />
letzten Jännertagen wies er seinem Freund Aprent das letzte Blatt dieses Romans,<br />
das er geschrieben hatte und sagte: „Hier wird man schreiben: Hier ist der Dichter<br />
gestorben.“ Diese Worte schrieb Aprent auch auf den Rand der Seite, nachdem<br />
Adalbert Stifter am 28. Jänner 1868 gestorben war.<br />
Das Geburtshaus Stifters, in dem er am 23. Oktober 1805 zur Welt kam, ist seit<br />
langem als Gedenkstätte eingerichtet. Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges<br />
und der Vertreibung der Deutschen versuchten die Tschechen, soweit das geht,<br />
Adalbert Stifter als einen der ihren darzustellen und stützen sich dabei vor allem<br />
auf den Roman „Witiko“, den sie als Bericht aus ihrer Frühgeschichte auffassen.<br />
Heimatliebe<br />
Nachdem die Novellen „Der Kondor“ und „Feldblumen“ erschienen waren, wendete<br />
sich Adalbert Stifter mit seiner Erzählung „Das Heidedorf“ seiner Heimat,<br />
dem Böhmerwald zu. Eine ganze Reihe von Erzählungen spielt im Raume um<br />
Oberplan: „Der Hochwald“, „Die Mappe meines Urgroßvaters“, „Der<br />
Waldgänger“, „Der beschriebene Tännling“. selbst der große Roman „Witiko“<br />
handelt in großen Teilen im Böhmerwald.<br />
An diesen Erzählungen wird deutlich wie tief sich Adalbert Stifter mit seiner<br />
Heimat verbunden fühlte. Eines seiner Gedichte unterstreicht das:<br />
Adalbert Stifter: Am Plöckensteiner<br />
See. Verlag Ostmark, Bund deutscher<br />
Österreicher, Linz. Entwurf<br />
von Ernst Kutzer. Ansichtskarte um<br />
1910. (Sammlung Reinhold Fink)
44<br />
45<br />
Das Maß<br />
Immer fragte Adalbert Stifter danach, was die Dinge wollten, wie sie beschaffen,<br />
welchen Gesetzen sie folgten, was das Große an ihnen sei oder das Kleine. Ist die<br />
Rede von Groß und Klein, wie sie gewöhnlich verstanden wird, eine richtige<br />
Rede? Im Jahre 1864 schrieb der Dichter einem Mädchen ins Stammbuch: „Es<br />
gibt nichts Großes und nichts Kleines. Der Bau des durch Menschenaugen kaum<br />
sichtlichen Tierchens ist bewundernswert und unendlich groß, die Rundung des<br />
Syrius ist klein. Der Abstand der Teilchen eines Stoffes und ihre gegenseitige<br />
Stellung und Bewegung kann in Hinsicht ihres Durchmessers so grob sein, als<br />
der Abstand der Himmelskörper von einander. Wir Menschen heißen das uns<br />
Vergleichbare, das von uns Erreichbare, klein das andere ist groß; aber nichts ist<br />
uns völlig vergleichbar oder erreichbar, und alles ist groß, oder über alles können<br />
wir mit beschränkten Augen vergleichen und richten, und dann ist uns nichts<br />
wichtig und groß als wir das andere ist nur da. Gott kennt das Wort groß und<br />
klein nicht, für ihn ist es nur das Richtige“. Und In das Stammbuch eines Fräuleins<br />
von Schlechte schrieb er: „Die großen Taten der Menschen sind nicht die,<br />
welche lärmen, obgleich zuweilen das Wunder des Augenblicks z.B. plötzliche<br />
Aufopferung, Hingebung, und dergleichen groß sein können; aber in der Regel<br />
sind sie Eingebungen von Affekten, die ebensogut und sogar meistens Schwächen<br />
sein können; das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers,<br />
das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides, und darum ist irgend eine Heldentat<br />
unendlich leichter und auch öfter da als ein ganzes Leben voll<br />
Selbstbezwingung, unscheinbaren Reichtum und gelassenem Sterben.“<br />
Der Auftrag des Menschen<br />
In den geistigen Auseinandersetzungen der Jahre um 1848 sah sich Adalbert Stifter<br />
veranlasst, immer wieder seine Stimme zu erheben. Was eigentlich sollte der<br />
Mensch, welches war sein Auftrag? Stifter antwortete auf diese Frage in einem<br />
Zeitungsbeitrag: „Es gibt keine heiligere Pflicht für den Menschen als seine reinste<br />
Menschwerdung, und es kann daher, wenn der Staat eine menschliche Anstalt<br />
sein soll, auch in ihm kein Höheres, kein Angestrebteres geben, als die Menschwerdung<br />
des Menschen in allen Abstufungen der Gesellschaft, wie es in jeder<br />
möglich ist.“<br />
Begegnung<br />
Wo Stifter über die Begegnung zwischen den Menschen spricht, verlangt er<br />
Vertrauensfähigkeit und Vertrauenswürdigkeit. „Gegen die Natur“, sagt er in der<br />
Novelle „Die Narrenburg“, „kann man gar nicht falsch sein man verläßt nur den,<br />
der uns verließ, noch ehe er uns fand, weil er in uns nur seine Freude suchte“.<br />
Liebe<br />
Wenn Adalbert Stifter von Liebe spricht, meint er, dass sie sich zunächst im Sorgenwollen,<br />
im Daseinwollen für jemanden erweist und er stellt im „Nach-<br />
sommer“ eine Grundforderung: „Es ist<br />
größere Liebe, auf die eigene Seligkeit<br />
nicht achten, ja die gegenwärtige Seligkeit<br />
des geliebten Gegenstandes auch<br />
nicht achten, aber dafür das ruhige, feste<br />
und dauernde Glück desselben begründen.“<br />
Familie<br />
In einem seiner Zeitungsaufsätze, die meist im „Wiener Boten“ erschienen, setzt<br />
sich Stifter auch mit dem Wesen der Familie auseinander: „Sie ist die natürlichste,<br />
festeste, und innigste Körperschaft. Aus ihr, wenn sie gut ist, geht die höchste<br />
Würde des menschlichen Geschlechtes und die größte Vollkommenheit der Staatsform<br />
hervor... Die Familie entsteht aus den schönsten und einfachsten Gefühlen<br />
des Herzens... Aus dieser Vereinigung entspringen Kinder, und da hat Gott wieder<br />
den stärksten Trieb und die höchste Liebe für die Kinder in das Herz der Eltern<br />
gepflanzt... Die Freude an ihren wohlgeratenen Kindern hört nie auf ....“<br />
Erziehung<br />
Adalbert Stifter hat in seinen Schriften sehr oft von Erziehung gesprochen. „Der<br />
Nachsommer“ ist ein Erziehungsroman von monumentaler Größe. Aber auch in<br />
den anderen Werken, im „Witiko“, in den „Studien“ und den „Bunten Steinen“<br />
und in seinen sonstigen Erzählungen tritt das erzieherische Moment hervor. „Erziehung<br />
ist wohl nichts als Umgang. Der Unterricht ist viel leichter als die Erziehung.<br />
Zu ihm darf man nur etwas wissen und es vermitteln können, zur Erziehung<br />
muß man etwas sein. Wenn aber einmal jemand etwas ist, dann glaube ich,<br />
erzieht er auch leicht.“ In diesem Zusammenhang formuliert Stifter auch: „Das<br />
Beste, was ein Mensch für einen anderen tun kann, ist doch immer das, was er<br />
für ihn ist“. In einem weiteren Zeitungsaufsatz spricht Stifter über Mängel in der<br />
Erziehung. „... schon im zartesten Alter werden die Keime zum<br />
größer die Kraft vorhanden ist, desto sanfter und unscheinbarer, aber desto nachhaltender<br />
wächst die Handlung daraus hervor.“<br />
Adalbert Stifter: Der Hochwald. Verlag<br />
Ostmark, Bund deutscher Österreicher,<br />
Linz. Entwurf von Ernst<br />
Kutzer. Ansichtskarte um 1910.<br />
(Sammlung Reinhold Fink)
46<br />
47<br />
Mißlingen gelegt; jedem Wunsche, jeder Laune der Kleinen wird nachgegeben.<br />
so daß das Kind oft, da es noch in den Windeln liegt, schon der Tyrann des Hauses<br />
ist, dem jetzt und noch mehr, wenn es größer ist, willfahrt werden muß. So<br />
wird die Leidenschaft und das Unglück erzeugt. Billige Vorstellungen in den<br />
Kinderherzen wuchern lassen und sich damit trösten, daß die Heranwachsenden<br />
schon anders werden würden, ist mindestens ein sehr großer Leichtsinn, wenn<br />
man bedenkt, daß die ersten Kindeseindrücke die dauerndsten sind, daß sie oft<br />
das ganze Leben und den Charakter bestimmen…“<br />
Adalbert Stifter setzte sich nachhaltig für den Ausbau des Schulwesens ein: „Ich<br />
halte Volkserziehung und Volksunterricht für höchst wichtig und eine der ersten<br />
Staatsaufgaben.“ Im gleichen Briefe aus dem Jahre 1865 schrieb Stifter: „Jeder<br />
vorzügliche Staat, vom Altertume bis zu unseren Zeiten, und jeder vorzügliche<br />
Mensch, der in einem Staate lebte und ihn leitete, hat eingesehen, daß Unterricht<br />
und Erziehung die einzige menschliche Grundlage des Staates, und die einzige<br />
Stufe zum Glücke und zur Vollkommenheit des menschlichen Geschlechtes ist.<br />
Nur wo Staaten zu verfallen begannen, wo menschliche Leidenschaften und<br />
menschliche Genußsucht alles andere zu überwältigen anfingen, da vergaß man<br />
auf diese Lehre, da überließ man sich hohlen und unwissenden Genüssen und<br />
ging endlich zugrunde. Daher haben alle starken Staaten ihr erstes Augenmerk<br />
der Erziehung zugewendet und in dem ganzen Gebiete Schulen gegründet.“ Stifter<br />
verweist auch darauf, dass auch Vereine und Verbände für die Erziehung Bedeutung<br />
haben.<br />
Religion<br />
In einem Aufsatz „Mittel gegen den sittlichen Verfall der Völker“ spricht Stifter<br />
auch über die Kirche: „Die Kirche gibt dem Menschen das heilige Gut der Religion,<br />
das Beste, was die Erde hat, oder eigentlich den Himmel. der auf die Erde<br />
gekommen ist. Aus Religion folgt Tugend von selber und alle Wege, die zu Ordnung<br />
und Recht führen. Daher ist ein religiöses Gemüt nicht nur das Heil des<br />
einzelnen, sondern es führt auch zum Wohle aller. Unsere gesamte Priesterschaft<br />
hat daher den heiligen, verantwortlichsten Beruf, durch die eindringendste Lehre<br />
und namentlich durch das edelste Beispiel die echte Religiösität zu begründen<br />
und zu verbreiten...“<br />
Bürger und Staat<br />
Stifter sieht es als die „heiligste Pflicht“ des Staates an, seine Bürger so auszubilden,<br />
dass sie das Wesen der Freiheit erkennen und fähig sind, Maß zu halten. Die<br />
Mitsprache des Volkes im Staate verlangt die Erkenntnis von der Träger- und<br />
Teilhaberschaft jedes Bürgers am Staate. Der vom Untertan zum Staatsbürger<br />
aufsteigende Mensch muss<br />
erkennen, dass nicht Ichsucht, Vergnügen und Bindungslosigkeit dem gemeinsamen<br />
Heile dienen, sondern Pflichterfüllung, Opfermut und Anerkennung des<br />
Ganzen, das durch Volk und Staat dargestellt wird. „Wann werden Völker Völker<br />
sein?“ fragt Stifter 1866 in einem Brief und deutet darauf hin, dass die Völker<br />
dazu hinreifen müssen, sachkundige Führungen auszukristallisieren, sodass<br />
Staaten nicht Menschen, deren Verstand beschränkt ist, „wie als lächerlicher Hohn“<br />
folgen müssen. Dann werde die Geschichte nicht dazu verdammt, „Kassandra“<br />
zu sein. „Die Staaten und Regierungen aber, wenn sie einmal die nötigste und<br />
unaufschieblichste Pflicht der Erhaltung und Zusammenstellung des Ganzen erfüllt<br />
haben, haben keine größere, keine dringlichere Pflicht mehr, als alle im Vereine<br />
aufzustehen, der hereingebrochenen Barbarei einen Damm zu setzen.“<br />
Der Staatsmann<br />
Bedeutsam ist die Aussage Stifters über den Staatsmann im „Nachsommer“, wo<br />
der weise Riesach aus seiner Zeit als Staatsdiener erzählt, dass er es nie vermocht<br />
habe, „die bloßen eigenen Beziehungen oder den augenblicklichen Nutzen des<br />
Staates allein als höchstes Gesetz zu betrachten“. Seine „Ehrfurcht vor den Dingen<br />
war so groß“, dass er bei Verwicklungen darauf sah, was die Dinge forderten.<br />
Wenn seine „Meinung angenommen und ins Werk gesetzt wurde, so hatte die<br />
neue Ordnung der Dinge Bestand, und sie brachte dem Staate größeren Nutzen<br />
als wenn… früher der einseitige“ und augenblickliche „angestrebt“ worden wäre.<br />
Es darf also dem Staatsmann nicht um den augenblicklichen Erfolg gehen, nicht<br />
um einen Nutzen, der für den Augenblick ein gutes Bild erzeugt. Er muß bei<br />
seinen Entscheidungen immer auf die Wirkung in die Zeit bedacht sein, selbst in<br />
die Zeit über ihn hinaus. Damit verwirft Stifter alle politische und sonstige<br />
Adalbert Stifter: Der Hochwald. Verlag Ostmark, Bund deutscher Österreicher,<br />
Linz. Entwurf von Ernst Kutzer. Ansichtskarte um 1910. (Sammlung<br />
Reinhold Fink)
48<br />
49<br />
Völkerschicksal<br />
Über die Vorgänge, die die Geschichte von Völkern bestimmen, könne man sich<br />
kaum klar werden, wenn man selber mitten im Geschehen stehe. Darum griff<br />
Adalbert Stifter in die Geschichte der Römer: „Wenige Völker waren so tapfer,<br />
so weise, so mäßig, so enthaltsam, so zu dem Gemeinschaftlichen zusammenhaltend,<br />
wie die Römer. Die Bildung der alten Welt war sehr groß. Wenn wir<br />
auch in unterer Zeit in manchen Stücken voraus sind, zum Beispiel in der Kenntnis<br />
der Natur, so war uns die alte Welt doch in vielen Dingen weit, weit überlegen,<br />
und wir können ihr nicht mehr nachkommen, namentlich in der bildenden<br />
Kunst, selbst in Dichtungen, in der Geschichte und in der Kraft der Größe ihrer<br />
Charaktere. Die reinen, starken und tugendhaften Römer, als sie die ganze damals<br />
gebildete Welt in ein Reich zusammengebracht hatten, überließen sich nun der<br />
Ruhe und wollten das Leben genießen. Das ging eine Weile gut, solange die<br />
Tugend der Väter nachhielt. Das Genießen wurde aber immer allgemeiner, ihre<br />
Paläste immer schöner, ihre Gärten reicher, ihre Feste verschwenderischer. Die<br />
mit ihnen vereinigten Griechen stiegen von den edlen Gegenständen, mit denen<br />
sie sich früher beschäftigt hatten, zu gemeinen herab, ihre Dichtungen hörten<br />
auf, ihre Bildhauerkunst hörte auf, ihre großen Geschichtsschreiber waren verschwunden,<br />
und wo sie noch etwas in diesen Dingen taten, war es unvernünftig<br />
ausgeschmückt, war kindisch und entbehrte der inneren Männlichkeit. So sank<br />
das große Reich immer tiefer in Weichlichkeit und Genußsucht. Wer nur seine<br />
eigene Unterhaltung sucht, wer nur Reize und Lust für seine Sinne erstrebt, den<br />
gehen andere Menschen, den geht zuletzt das Vaterland nichts mehr an. Die Römer<br />
konnten sich zu dem Gedanken nicht mehr erheben, daß die Entbehrung<br />
und Enthaltsamkeit des einzelnen eine Freude sei, wenn nur das Ganze, das<br />
Reich groß und mächtig und glücklich ist. Im Gegenteile um in ihren ausschweifenden<br />
Genüssen nicht gestört zu werden, nahmen sie von fremden Völkern<br />
Hilfssoldaten, die sie verteidigen sollten. Die fremden Völker wohnten außerhalb<br />
der Grenzen des Römerreiches im Norden und wurden von den Römern<br />
Erfolgshascherei. In einem Zeitungsaufsatz warnt er vor der Wahl „ungestümer<br />
Eiferer und Schreier“, weil sie „hastens und untauglich“ für den Staatsaufbau<br />
sind.<br />
Europäischer Bund<br />
Gesunde Völker in geordneten Staaten, zusammengefasst in einen europäischen<br />
Bund, das fordert Adalbert Stifter zur Sicherung des Abendlandes vor Verfall<br />
und Zerstörung von innen und außen. „Wenn Europa einig ist, dann kann ihm<br />
nichts geschehen!“ Wiederholt rief Stifter Europa auf, einig zu sein, so auch im<br />
„Wiener Boten“ 1849: „Wenn Europa vernünftig, gesittet, kräftig, männlich und<br />
einig ist, hat es … nichts zu fürchten … Aber wenn Europa töricht, ungesittet,<br />
weichlich, weibisch und uneinig ist, wenn sich die Bösen in seinem Schoße gleich<br />
zu den Feinde schlagen, um mit ihm die Beute (und Herrschaft) zu teilen - wie<br />
dann?“ Hier ist auch nach 156 Jahren an Aktualität kaum etwas hinzuzufügen.<br />
ungefähr so betrachtet, wie von uns die<br />
wilden Völker in Asien. Die Römer hießen<br />
sie auch Barbaren. Diese Barbaren<br />
aber waren kräftig, obwohl roh und<br />
unwissend. Aus Hilfssoldaten wurden<br />
sie allgemein Angreifer gegen die morsche<br />
römische Welt, und nach entsetzlichen,<br />
fürchterlichen Kriegen und Verwüstungen<br />
stürzten diese Völker, die<br />
größtenteils deutschen Ursprungs waren,<br />
das Reich und alle Bildung; alles,<br />
was die alte Welt liebenswürdig und<br />
groß gemacht hatte, war dahin, und<br />
viele Jahrhunderte tiefer Finsternis traten<br />
ein. Nach und nach rang sich die<br />
Menschheit wieder empor. Benützte<br />
die Trümmer der Bildung der alten Welt<br />
und kam allmählich auf die Stufe, auf der wir heute stehen.“<br />
Warnung an die Völker<br />
Unter solcher historischer Schau und Einsicht warnte Adalbert Stifter die Völker:<br />
„Untergehenden Völkern verschwindet zuerst das Maß. Sie gehen nach einzelnem<br />
aus, sie werfen sich mit kurzen Blicke auf das Beschränkte und Unbedeutende,<br />
sie setzen das Bedingte über das Allgemeine; dann suchen sie den Genuß und<br />
das Sinnliche, sie suchen Befriedigung ihres Hasses und Neides gegen den Nachbar,<br />
in ihrer Kunst wird das Einseitige geschildert, das nur von einem Standpunkt<br />
gültige, dann das Zerfahrene, Unstimmende, Abenteuerliche, endlich das Sinnreizende,<br />
Aufregende und zuletzt die Unsitte und das Laster, in der Religion sinkt<br />
das Innere zur bloßen Gestalt oder zur üppigen Schwärmerei herab, der Unterschied<br />
zwischen Gut und Böse verliert sich, der Einzelne verachtet das Ganze<br />
und geht seiner Lust und seinem Verderben nach, und so wird das Volk eine Beute<br />
seiner inneren Zerwirrung oder die eines äußeren, wilderen, aber kräftigeren<br />
Feindes.“<br />
Die Verantwortung der Schriftsteller<br />
In der Schrift: „Über Stand und Würde des Schriftstellers“ spricht Stifter über die<br />
Verantwortung und Aufgabe derer, die „durch das glänzende Schwert ihrer Rede<br />
leichtsinnig Irrtum“ verbreiten und „Unheil“ stiften. „Alles Unheil, welches je<br />
die Weltgeschichte erzählt, entsprang daraus, daß man die Gegenstände wider die<br />
Natur behandeln wollte.“<br />
Aus der Welt Adalbert Stifters: Die<br />
Narrenburg. Wia Künstlerkartenverlag,<br />
Teplitz Schönau. Entwurf G.<br />
Zindel. (Sammlung Reinhold Fink)
50<br />
51<br />
Wort an die Künstler<br />
Den Künstlern ruft Stifter zu: „Wenn Völker verkommen, so ist es allemal die<br />
Kunst, welche zuerst von ihnen weicht.“<br />
Das sanfte Gesetz<br />
Das Studium der Naturwissenschaften, die Wanderungen in die Berge, die Beobachtungen<br />
des Malers Adalbert Stifter an der Natur, der tiefe Einblick in geschichtliche<br />
Zusammenhänge und Entwicklungen und das unendliche Feingefühl des<br />
Dichters befähigen Adalbert Stifter in das Wesen der Dinge einzudringen und das<br />
Grundlegende, Grundwirkende zu erspüren und zu erkennen. In der Vorrede der<br />
Sammlung „Bunte Steine“ lesen wir: „Das Wehen der Luft, das Wogen des Kornes...<br />
das Rieseln des Wassers halte ich für groß, den Blitz, das Dröhnen des<br />
Donners und den feuerspeienden Berg halte ich nicht für größer, denn sie sind<br />
auch nur Hervorbringungen jenes Gesetzes, das sanft und unscheinbar wirkt, den<br />
Wind, der das Wogen des Kornes hervorruft, wehen läßt und das Wasser rieseln,<br />
wodurch es das tiefe Tal furcht…<br />
Die vielfältigen, unscheinbaren Geschehen sind es, die auf einige wenige Grundkräfte<br />
zurückgehend, das Werden und Wachsen und Wandeln in der Natur hervorrufen.“<br />
Das Sittengesetz<br />
Und so, wie es in der Natur ist, so ist es auch in den Dingen des Menschen. So wie<br />
jenes sanfte Gesetz, das die Erde gestaltende und die Welt tragende Gesetz ist, so<br />
ist das Sittengesetz die menschtragende Kraft. Es wirkt „still und seelenbelebend<br />
durch den unendlichen Verkehr der Menschen mit Menschen. Die Wunder vorgefallener<br />
Taten sind nur kleine Merkmale dieser allgemeinen Kraft.“ Es sind die<br />
kleinen, die unscheinbaren Tätigkeiten des Menschen, die vielen unentwegten<br />
Pflichterfüllungen, die das Leben tragen und die Wurzel und der Grund für Vorfallendes<br />
und groß Erscheinendes, dessen Ursprung wir später nur schwer erkennen,<br />
weil er unendlich vielschichtig ist.<br />
Aber dieses Sittengesetz ist nicht etwas, was schmeichelndes Glück gewähren<br />
muss. Es ist streng und unerbittlich, wie es andererseits die Menschen trägt.<br />
Stifter sieht wie Herder, dass „kein politisches Gleichgewicht gehoben, kein Frevel<br />
gegen die Rechte der Völker verübt werde, ohne daß sich derselbe rächt und<br />
das gehäufte Übermaß sich einen desto schrecklicheren Sturz bewirkt.“ Stifter<br />
wehrt sich entschieden dagegen, menschliches und staatliches Unglück in den<br />
richtenden Willen Gottes zu setzen: „Was je Gutes und Böses über die Menschheit<br />
gekommen ist, haben Menschen gemacht!“ „Rache ruft Rache hervor“, sagt<br />
der alte Bolemil an einer Stelle des „Witiko“.“<br />
Immer wieder weist Stifter darauf, dass Recht und Sitte die Grundlage menschlichen<br />
Seins bilden. Wo Menschen sittlich verkommen, stirbt das Recht und gehen<br />
die Menschen selber auch unter. Umgekehrt aber spricht Stifter dem Sittengesetz<br />
unausweichbare Wirkung zu, es sei das, was den Menschen und die Menschheit<br />
trägt. „Solange die Geschichte spricht, hat Frevel nie dauernd gesiegt; nur die<br />
Zeit ist die Frage, und was zwischen Anfang und Ende liegt.“ So<br />
Herr Dr. Friedrich Morton, Kustos des Museums in Hallstatt in Oberösterreich,<br />
schrieb an die in Oberplan lebende Nichte des Dichters Frau Ida Mayer: „Sehr<br />
geehrte gnädige Frau! In der Annahme, dass Sie sich für Stifter-Literatur interessieren,<br />
beehre ich mich, Ihnen meinen zum 28. Jänner in der „Linzer Tagespost“<br />
erschienenen Artikel, der einige neue Beziehungen aufdeckt, zu übermit-<br />
Von Adalbert Stifters „Nachsommer“<br />
Franz Fischer<br />
schrieb Stifter 1866 in einem Brief, über die Größe und Gewalt des Sittengesetzes.<br />
In der Vorrede zur Sammlung „Bunte Steine“ schrieb er: „So groß ist die Gewalt<br />
des Rechts und Sittengesetzes, daß es überall da, wo immer es bekämpft worden<br />
ist, doch endlich allzeit siegreich und herrlich aus den Kampf hervorgegangen<br />
ist. Und wenn selbst der Einzelne oder ganze Geschlechter für Recht und Sitte<br />
zugrunde gegangen sind, so fühlen wir sie nicht als besiegt, weil das Ganze höher<br />
steht als der Teil, weil das Gute größer ist als der Tod.“<br />
Aus der Welt Adalbert Stifters: Witiko. Wia Künstlerkartenverlag, Teplitz<br />
Schönau. Entwurf G. Zindel. (Sammlung Reinhold Fink)
52<br />
53<br />
teln.“ Aus diesem verdient hervorgehoben zu werden: „Stifters ‚Nachsommer’,<br />
in dem der große Menschenerzieher seine reifsten Gedanken niederlegte, ist ein<br />
Kind Oberösterreichs, denn in Hallstatt wurde es geboren und der große Erforscher<br />
des Salzkammergutes, Friedrich Simony, stand dabei Patenschaft. Als Stifter<br />
Hallstatt besuchte, führte ihn sein Weg zu Somony, der damals hier ein echtes<br />
Naturforscherleben führte. Kein Wunder also, dass ein Mann wie Stifter von ihm<br />
begeistert war. Hier sah er zum ersten Male in die Werkstätte eines bedeutenden<br />
Naturforschers, hier nahm er Einblick in die unübertrefflichen Seenlotungen<br />
Simonys, in das Leben und Werden der Gebirge. Beide wandern ins Echerntal,<br />
hier zeigt Simony dem Freunde die gewaltigen Felswände und Verwerfungen,<br />
erzählt ihm von dem wunderbaren Farbenspiele des Karlseisfeldes, hier sah Stifter<br />
auch eine jene Steinschleifereien in einer märchenhaft einsamen Werkstätte<br />
am rauschenden Waldbache, wo Marmore zersägt, geschliffen und poliert und zu<br />
schönen Ziersachen verarbeitet wurden. So kam es, dass die Hauptgestalt im<br />
„Nachsommer“, der junge Heinrich, die Züge Simonys trägt, dass er den ganzen<br />
Sommer über mit verlässlichen Führern die Gebirge durchzieht, dass er ganze<br />
Kisten von Gesteinsproben mitbringt, dass er im Ahornswirtshause am Lautersee<br />
(Hallstättersee) seine Leute belehrt, unterhält, in freigebigster Weise freihält. Jetzt<br />
verstehen wir auch Heinrichs Vorliebe für geschliffene Marmore, die im „Nachsommer“<br />
mehrmals hervortritt. Er lässt allerhand Briefbeschwerer schleifen, er<br />
schreibt seinem Gastfreunde einen prachtvollen Marmorsaal zu, er lässt in der<br />
weltfernen Steinschleiferein eine Einbeere herstellen, die als Wasserbecken eines<br />
Springbrunnens dienen soll und dem Vater zum Geschenk gemacht wird. Heinrich<br />
wandert mit dem alten Kaspar im Jänner zum Eis empor. Wenn er es oben<br />
beträchtlich wärmer findet als unten, so erkennen wir darin unschwer Simonys<br />
Forschungen. Die Echernspitze bekam ihren Namen vom Scherntal, die Almhütte,<br />
wo übernachtet wurde, ist die „Wies“, der alte Kaspar ist der alte Loidl, das<br />
Simmi-Eis, wohl nach Simony benannt, ist das Karlseisfeld. Heinrichs umfassende<br />
Lotungen auf dem Lautersee sind nichts anderes als Simonys Lotungen im<br />
Hallstättersee. Simony riet Stifter, sich auf gewisse Gebiete zu sammeln und mehr<br />
Tatsächliches zu erleben. Dasselbe rät der alte Risach seinem jungen Gaste Heinrich.<br />
Bekanntlich zog es Stifter zur Zeichenkunst und Malerei. Ganz zweifellos<br />
wird er daher entzückt gewesen sein von dem gewaltigen Talente Simonys, der<br />
uns Einzelbilder und Landschaftsdarstellungen voll großartiger Feinheit und<br />
Naturtreue hinterließ. Dementsprechend erwacht auch bei Heinrich die brennende<br />
Sehnsucht, Stein und Baum, Fels und Wiese zeichnen zu lernen und wenn ihm<br />
dabei Risach voller Güte beisteht, so darf auch diesbezüglich auf die starke<br />
Beieinflussung durch Simony hingewiesen werden. So zieht Simonys Geist durch<br />
das Leben und Streben Heinrichs, so sind es die einzig schönen Hallstätter Berge<br />
und die anschaulichen Schilderungen Simonys, die Stifter so nachhaltig beeinflussten,<br />
dass er ihnen im „Nachsommer“ ein unvergängliches Denkmal setzte.“<br />
(Aus „Waldheimat“ Sep. ´28)<br />
Übersetzung des Freiheitsbriefes der gegeben wurde von Karl dem Vierten an<br />
Heinzelinus, genannt Bader (oder Bayer) auf dem Bayerhofe bei Rothsaifen, Lkr.<br />
Bergreichenstein<br />
„Wir, Karl der Vierte, von Gottes Gnaden römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer<br />
des Reiches und König von Böhmen, tuen kund kraft dieses Briefes allermänniglichen:<br />
Im Hinblick auf die vielfältigen Dienste und die beständige Treue,<br />
die uns Henczlinus, genannt Bader, unser treuer lieber, bisher in verschiedenen<br />
unseren Geschäften und namentlich bei Auffindung und Aussetzung eines neuen<br />
Weges oder einer öffentlichen Straße, welche Wir gegen Passau oder Bayern zu<br />
bauen beschlossen haben, zu unserem Gefallen erwiesen hat und in Zukunft noch<br />
reichlicher wird tun können, haben Wir ihm und seinen Erben<br />
Freiheitsbrief<br />
Alois Anderle<br />
Aus der Welt Adalbert Stifters: Der<br />
Hochwald. Wia Künstlerkartenverlag,<br />
Teplitz Schönau. Entwurf G. Zindel.<br />
(Sammlung Reinhold Fink)<br />
(Aus „der Hochwald“)<br />
Und wieder war ein König,<br />
Der ritt am Stein vorbei:<br />
Da lagen weiße Gebeine,<br />
Die goldne Kron´ dabei.<br />
Da kam ein grüner Jäger:<br />
„Gelt König, suchst ein Grab?<br />
Sieh da die grauen Felsen,<br />
Ei springe flugs hinab.“<br />
Es war einmal ein König,<br />
Der trug ´ne goldne Kron´.<br />
Der mordete im Walde<br />
Sein Lieb – und ging davon.<br />
Ballade<br />
Adalbert Stifter
54<br />
55<br />
Vor alters schon waren von den Grenzbewohnern Baierns und Böhmens durch<br />
die Urwaldwildnisse des baierisch-bömischen Waldgebirges, wo die Natur sein<br />
Urbeginn allein gewaltet hatte, durch dessen riesige Torfmoore und weite morastige<br />
Filze schmale Fußpfade gebahnt und mühsam erhalten worden, auf denen<br />
die erste Ausbeute von gegenseitigen Beziehungen der Menschen, der Tausch<br />
von Naturprodukten, zur Geltung gelangte. So gingen bereits frühzeitig durch<br />
die ausgedehnte Gebirgssenke zwischen dem 1370 Meter hohen Lusen und dem<br />
eine Höhe von 1330 Meter erreichenden Dreisesselgebirge drei Steige über die<br />
Bergrücken. Der älteste und auch bedeutendste führte von der Böhmerwald-<br />
Der „Goldene Steig“ als uralter Handelsweg im<br />
Böhmerwalde<br />
Paul Meßner<br />
grenzstadt Prachatitz, dem „salis emporium“ Böhmens, das heute noch das „kleine<br />
oder böhmische Nürnberg“ benannt ist, nach der einstigen Römersiedlung<br />
und ehrwürdigen Bischofsstadt Passau, dem Hauptstapelplatze des baierischen<br />
Salzhandels und berührte hiebei Wallern und Böhmisch-Röhren in Böhmen sowie<br />
Bischofsreut und Waldkirchen in Baiern, worauf er in Ilzstadt-Passau endete.<br />
Der zweite, aber jüngere Steig war der „Winterberger Saumbergsteig“, der auch<br />
als „Salzweg“ Passau mit Winterberg verband, das ebenfalls einen Haupthandelsplatz<br />
für das deutsche Hinterland bildete, während der dritte als „Steig<br />
über das Gefild“ von Passau nach der ehemaligen „königlich freien Goldbergstadt“<br />
Bergreichenstein führte, die einst der Mittelpunkt eines reichen Gold- und<br />
Silberbergbaues war, zu dessen Schutz Kaiser Karl IV. die Burg Karlsberg erbaute.<br />
So manche Flur- und Siedlungsnamen stammen noch von diesen alten „gefreiten“<br />
Steigen her, von denen die „Prachatici-via“, also der Prachatitzer Weg, gegen<br />
den Ausgang des Mittelalters immer mehr als „Via-Aurea“, „Goldener Steig“<br />
bezeichnet erscheint. Erst viel später erhalten auch die beiden anderen oberwähnten<br />
Saumwege den Namen „Goldener Steig“.<br />
Im Volksmunde führt dann noch ein vierter mittelalterlicher Gebirgsübergang die<br />
Bezeichnung „Goldener Steig“, der aber eigentlich „Günthersteig“ heißt und von<br />
dem Benediktinermönche und Begründer des Klosters Rinchnach in Baiern, dem<br />
am 9. Oktober 1045 im Alter von 90 Jahren, nach einem harten und rauen Büßerleben<br />
in seiner Einsiedelei bei Gutwasser ober Hartmanitz verstorbenen heiligen<br />
Günther, angelegt wurde.<br />
diesen Gnadenerweis tun zu sollen geglaubt und gestatten und gewähren ihnen<br />
kraft Gnade und königlicher Gewalt in Böhmen, daß sie eine Hufe Landes, mag<br />
es bereits als Wiese oder in irgendeiner anderen Weise gepflegt sein oder anderswie<br />
unbebaut geblieben sein, gelegen unterhalb Kleinlosnitz und Rotensaifen in der<br />
Nähe ihres dortselbst gelegenen Hofes, zu 64 Morgen die Hufe gerechnet, bebauen<br />
oder auch ausroden, und geben ihnen auch die volle und unumschränkte Macht,<br />
besagte Hufe zu besitzen, zu genießen, ruhig, frei und friedlich, sie zu verkaufen,<br />
zu vertauschen, zu belasten und anders über dieselbe zu verfügen, wie es ihrem<br />
Willen gefallen wird. Wir gebieten daher allen und jeden Offizieren unseres Königreiches<br />
Böhmen, jetzigen und künftigen, unseren lieben Getreuen, besagten<br />
Henczlinus in vorbesagter unserer Gnade nicht zu hindern oder zu beschweren<br />
oder von irgendjemand behindern zu lassen, so lieb ist, unsere Ungnade zu vermeiden.<br />
Zu Urkund dieses Briefes unter dem Siegel unserer kaiserlichen Majestät.<br />
Gegeben zu Prag Im Jahre des Herrn 1356,den 11. April, unserer Königreiche<br />
im zehnten, des Kaisertums aber im ersten Jahr.<br />
Auf die Relation des Bischofs von Minden: Johannes Eystetensie, m.P.“<br />
Bemerkung:<br />
Der Bischof von Minden war Dietrich von Portiz, ein intimer Berater Kaiser<br />
Karls des Vierten. – Johan Eystetensis (von Eichstätt) ein Geistlicher, war Schreiber<br />
in der Kanzlei König Karls, dem auf die Fürsprache des Kaisers die Würde<br />
eines Kanonikus im bayerischen Eichstätt mit den Einkünften, doch ohne weitere<br />
Berufspflichten verliehen worden war. Johannes blieb weiterhin Schreiber der<br />
kaiserlichen Hofkanzlei und hieß mit seinem gewöhnlichen Namen Johannes<br />
Zuffrazz. (Quellenangabe: Engelbert Panni: „Geschichte der königlichfreien<br />
Goldbergstadt und der Burg Karlsberg.“)<br />
Ein „armer treibender Säumer“ auf dem „Goldenen Steig“. Radierung von<br />
Karl Meßner
56<br />
57<br />
Dieser Saumweg führte aus dem oberen Flussgebiete des Regen über Zwiesel in<br />
Baiern und über die Einsenkung beim heutigen Eisenstein hinweg nach Hartmanitz<br />
in Böhmen und von da ins Wottawatal nach Schüttenhofen und Prachin. Der uralte<br />
Warensteig von Passau nach Prachatitz wird handschriftlich zum erstenmal<br />
festgelegt im Jahre 1010, als Kaiser Heinrich II. (1002-1024) am 28. April dieses<br />
Jahres den Teil des Nordwaldes, durch welchen der „Goldene Steig“ führte, und<br />
kurz vorher auch die Einkünfte des „Goldenen Steiges“ auf der baierischen Seite<br />
den Niedernburger Nonnen in Passau schenkte.<br />
Daraus schon ist zu ersehen, dass der „Goldene Steig“ bereits zu Beginn des 11.<br />
Jahrhunderts ein vielbenützer Handelsweg gewesen sein musste. Auf der böhmischen<br />
Seite kamen die ganzen Einkünfte des Prachtitzer Weges samt dem damals<br />
noch nicht befestigten Orte Prachatitz durch Schenkung im Jahre 1088 an das<br />
Wyschehrader Domkapitel zu Prag, wie es der Landesfürst Wratislav II. wahrscheinlich<br />
anlässlich seiner Krönung zum König von Böhmen in einer Urkunde<br />
verfügt hatte. Und diese Einkünfte sollen größer gewesen sein als die Einnahme<br />
des Kapitels von seinen sonstigen Gütern. So ist es denn nicht zu verwundern,<br />
dass diese Säumerstraße, von den deutschen Kaisern und böhmischen Königen<br />
mit besonderen ungemein vorteilhaften Privilegien bedacht, als reichliche Goldquelle,<br />
nicht nur für Prachatitz und Passau, sondern auch für bestimmte andere<br />
daran gelegene Ortschaften, die nicht umgangen werden durften, blühenden Wohlstand<br />
brachte und in dankbarer Erkenntnis ihrer außergewöhnlichen Erträglichkeit<br />
bald den Namen „Via Aurea“, „Goldener Steig“ erhielt. Aus dem ursprünglichen,<br />
schon Jahrhunderte hindurch geübten Tauschverkehre der beiderseitigen<br />
Grenzbevölkerung mit Naturprodukten war eben im Laufe der Zeit ein schwungvoll<br />
betriebener Handel hervorgegangen, der sich naturgemäß mächtig entwickeln<br />
musste, um ein wichtiges Nahrungsmittel, das in Böhmen gänzlich fehlende<br />
Salz, aus dem Salzkammergute zu erlangen, für welches die Erzeugnisse verschiedener<br />
Beschäftigungen des eigenen Landes als Gegenwert ausgeführt wurden.<br />
Der eigentliche Lager- und Umschlagplatz für den ganzen böhmischen Salzbezug<br />
war nun lange Zeit hindurch die Grenzstadt Prachatitz allein, die dementsprechend<br />
auch mit wertvollen Vorzugsrechten beteilt war, vor allem mit dem<br />
Stapelrecht und Straßenzwang, dem Wahrzeichen deutscher Stadtwirtschaft im<br />
Mittelalter. Die den Prachatitzer Bürgern verliehenen Salzrechte bestanden:<br />
(Siehe: „Prachatitz, Ein Städtebild“ von Josef Messner, Seite 12).<br />
1. In dem Vorkaufsrechte, wonach Prachatitz von allen Städten Südböhmens allein<br />
die Befugnis hatte, Passauer Salz zuerst anzukaufen und nach Böhmen einzuführen;<br />
2. in dem Stapel- oder Niederlagsrechte, das die Bewohner Böhmens und Mährens<br />
strenge dazu verhielt, ihren Salzbedarf nur von der Hauptniederlage zu<br />
Prachatitz zu beziehen;<br />
3. in dem Straßenzwange, der jeden nach Passau ziehenden Reffträger, Säumer<br />
oder Fuhrmann nötigte, auf seinem Hin- und Rückwege Prachatitz zu berühren<br />
und da das eingeführte Salz oder andere Kaufmannswaren zu verzollen.<br />
Wer diesen Weg umging, lief<br />
Gefahr, Pferde und Ladung zu<br />
verlieren oder musste harte<br />
Geldstrafe zahlen, die teils zur<br />
Ausbesserung des Steiges, teils<br />
zur Instandhaltung der Stadtbefestigungen<br />
von Prachatitz<br />
verwendet wurden. Derartige<br />
Vorrechte bewirkten denn auch<br />
den Aufschwung dieser Stadt zu<br />
einem der hervorragendsten<br />
Verkehrsplätze des Landes, was<br />
sich auch nicht zuletzt in mannigfachen<br />
Baudenkmälern, deren<br />
ursprüngliche Pracht zum<br />
Teile noch erhalten ist, kundgab.<br />
Selbst die minderbegüterten<br />
Bevölkerungsschichten von<br />
Prachatitz sowie auch die aus der nächsten Umgebung der Stadt fanden dabei<br />
öfters Gelegenheit zu redlichem, wenn auch mühsamem Erwerbe. Die Größe des<br />
Verkehrs auf dem „Goldenen Steige“ während seiner vollsten Blütezeit erhellt<br />
wohl daraus, dass damals durch Prachatitz wöchentlich bis 2000 Pferde teils als<br />
Tragtiere (die Ladung eines Saumpferdes betrug durchschnittlich drei Zentner),<br />
teils an Wagen gespannt zogen und den Handel mit Passau vermittelten, während<br />
zur Zeit, da bereits vielfache neue Straßenzüge mit Bewilligung der Landesherren<br />
im Wettbewerbe des Handels sich auftaten, ihre Zahl sich noch auf 500 bis<br />
600 in der Woche belief.<br />
Freilich darf man sich die Saumzüge auf dem Prachatitz-Passauer Steige nicht so<br />
großartig vorstellen, wie es von den deutschen Handelsunternehmungen aus Italien<br />
über die Alpen nach den deutschen Handelsstätten, unter dem Schutze bewaffneter<br />
Goldknechte, im großen durchgeführt wurden. Ein Säumerzug von<br />
schwerbepackten Saumpferden oder Lastwagen brauchte von Prachatitz nach<br />
Passau in der Regel zweieinhalb bis drei Tage. Der Tauschverkehr auf dem „Goldenen<br />
Steig“ beschränkte sich zumeist auf von Kleinfuhrleuten betriebene Frachtgeschäfte,<br />
die nur allzu häufig und allzu sehr von ungünstigen Währungsverhältnissen<br />
oder plötzlich eingetretenem Warenmangel beeinträchtigt wurden.<br />
Sowohl die Gemeinde Prachatitz als solche, wie die überwiegende Mehrzahl der<br />
wohlhabenden Bürgerschaft betrieb den Handel mit baierischem und salzburgischem<br />
Salze auf eigene Rechnung. Auch Ortschaften der nächsten Umgebung<br />
Der „Goldene Steig“ im<br />
Prachatitzer Wald. Aufnahme<br />
von Karl Hofer
58<br />
59<br />
von Prachatitz nahmen regen Anteil an dem Salzhandel mit Passau, waren jedoch<br />
gezwungen, mit ihren Ladungen den Weg durch die Prachatitzer Mautschranken<br />
zu nehmen, wenn sie nicht Ladung und Pferde einbüßen wollten. Der überaus<br />
beschwerlichen Verfrachtung auf den durch den Urwald führenden Knüppel- und<br />
Reisigbündelwegen, in derem moorigen Untergrunde ein Einsinken der schweren<br />
Lasten nicht leicht zu vermeiden war, oblagen Leute, die weniger mit Glücksgütern<br />
gesegnet waren, im Gefühle der Zusammengehörigkeit aber ebenso, wie<br />
die Fuhrleute früherer Jahrhunderte überhaupt, eine große Zunft mit bestimmten<br />
Sitten und Gebräuchen bildeten und zu einer Art Genossenschaft sich zusammenschlossen.<br />
Mit Vorliebe nannten sie sich in ihren zahlreichen, uns erhalten<br />
gebliebenen Bitt- und Beschwerdeschriften die „armen treibenden Säumer“.<br />
Obzwar der Salzhandel das ganze Jahr hindurch betrieben wurde, so galt doch<br />
der Winter, weil er bei eingetretenem Froste eine günstigere Beförderung der<br />
Ware ermöglichte, als die eigentliche Zeit der Säumerei. Mitunter hielten auch<br />
die Passauer Kaufleute das Salz mit dem Bemerken zurück, „damit zur Winterzeit<br />
mehr Frachtgut wäre“ und stellten unter Verständigung der Prachatitzer in<br />
den Sommermonaten die Ausfuhr des Salzes gänzlich ein. Wie bereits erwähnt,<br />
bestand der Verkehr auf dem „Goldenen Steige“ hauptsächlich im Tauschahndel<br />
und einem uralten, stets streng eingehaltenem Gebrauche gemäß, durfte kein<br />
Frächter aus Böhmen es wagen, ohne Gegenladung in Passau Fracht an Salz zu<br />
heischen, denn „Ein Saumb umb den Anderen“ und „Khern umb Salz“ waren<br />
Grundsätze, die genau beachtet werden mussten. Böhmisches Getreide war es<br />
zumeist, welches die Prachatitzer Säumer nach Passau als Gegenwert für das zu<br />
erhaltende Salz führten. Sobald im Spätherbst die Ernte allgemein gedroschen<br />
wurde, belebten sich in den südböhmischen Städten die, wie noch heute in<br />
Prachatitz stark besuchten Wochenmärkte, auf denen genügende Vorräte von Getreide<br />
angekauft werden konnten, um damit die eigentliche Zeit der Säumerei<br />
einzuleiten. Außer Korn, Weizen und Gerste, welche Feldfrüchte die einträglichste<br />
Gegenfracht bildeten, wurde auch noch der früher in zahlreichen bürgerlichen<br />
Branntweinbrennereien zu Prachatitz erzeugte vorzügliche Kornschnaps in bedeutender<br />
Menge nach Baiern verfrachtet. Selbst andere Lebensmittel wie Fische,<br />
welche die großen südböhmischen Teiche lieferten, Butter, Käse, Schmalz,<br />
Erbsen, Eier, ja sogar Bier finden wir unter den Frachtgütern, die in Passau abgesetzt<br />
wurden.<br />
Viel Gewinn erwuchs auch bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts den Prachtitzern<br />
aus dem Handel mit weißem und braunem Malze, das in Prachtitz von einer selbständigen<br />
Innung der Mälzer aus zugeführter Gerste erzeugt wurde, um damit die<br />
zahlreichen baierischen Braustätten zu versorgen, bis dann in Baiern selbst die<br />
Mälzereien sich mehrten, weshalb dann das böhmische Malz weniger gesucht<br />
wurde.<br />
Über die mitgebrachte Gegenfracht musste sich der Säumer in Passau stets ausweisen,<br />
worauf ihm eine Bescheinigung hiefür ausgestellt wurde, und erst nach<br />
Vorweisung dieser erhielt er im<br />
„Salzstadel“, wo das Salz aufgespeichert<br />
war, dieses ausgehändigt.<br />
Bei eingetretenem Salzmangel taten<br />
sich die Passauer Zwischenhändler,<br />
die „Salzherrn“, wie sie genannt<br />
wurden, zusammen und bildeten,<br />
wie man heute sagen würde, einen<br />
„Ring“, indem sie das zugeführte<br />
Salz vollständig aufkauften und es<br />
dann nur mit hohem Preisaufschlage<br />
den Säumern überließen.<br />
Darüber führen die Prachstitzer<br />
Säumer dann Klage, unter anderem<br />
auch, dass ihnen die „Salzherrn“<br />
nicht mehr, wie es früher geschehen,<br />
beim Aufladen des Salzes eine<br />
warme Suppe verabreichen ließen<br />
oder, dass man ihnen den zu<br />
Lichtmeß üblichen Wachsstock, den „Weihknollen“, daran sie im Hause ein ganzes<br />
Jahr zu zünden vermochten, vorenthielte, weiters aber noch, dass, wenn jemand<br />
Salz wolle, er erst die Viertel- und Stadelmeister bestechen müsse. Ebenso<br />
äußert sich die Unzufriedenheit der Säumer darüber, dass sie die Scheiben des<br />
Salzes selbst aus den Kellern auf die Gasse tragen müssen, wo sie es, dem Regen,<br />
Schnee und Ungewitter ausgesetzt, binden und verladen sollen. Eine besondere<br />
und häufig auf den Handelsverkehr ungünstig einwirkende Schwierigkeit bestand<br />
in den unsicheren Geldverhältnissen, was bei dem Umstande, dass in Passau die<br />
verschiedensten Geldarten zusammenliefen, sich hier schlimm fühlbar machen<br />
musste. Da es den böhmischen Säumern nicht immer möglich war, gutes Geld<br />
aufzubringen, büßten sie beim Salzeinkaufe in Passau öfters bedeutende Beträge<br />
ein und sahen sich deshalb gezwungen, Geld zu borgen, um volle Ladungen zu<br />
erzielen. Anläßlich dessen wurden ihrerseits Klagen laut, dass gar bald die Zeit<br />
kommen werde, da sie ihre Gläubiger, die ihnen lange Jahre getreulich geholfen,<br />
endlich doch mit „Fersengeld“, statt mit rechter Münze bezahlen müssten.<br />
Zu den Münzübelständen gestellten sich die allmählich gesteigerten Zollabgaben<br />
und Gefälle, mit denen Straßen und Wasserwege belegt wurden. Bis zum Jahre<br />
1572 hatten die Passauer Kaufherren den Zoll aus eigener Tasche beglichen, jetzt<br />
aber teilen sie die Erhöhung des Zolles den Prachatitzern mit dem Bemerken mit,<br />
dass der Aufschlag nunmehr den Säumern zugerechnet werden würde.<br />
Kreuzstein am „Goldenen Steig“<br />
bei Wallern. Aufn. Karl Hofer
60<br />
61<br />
Dadurch wurde natürlich der Salzpreis erhöht, zu welcher Steigerung noch ein<br />
„Einbindegeld“ und eine Verladegebühr hinzutrat. Unter solchen Umständen ist<br />
es dann erklärlich, das die Prachatitzer Säumer, wie schon öfters früher, auch im<br />
Jahre 1574 neuerdings verlangen, man möge sie doch selbst nach Burghausen,<br />
Hallein oder Schellenberg ziehen lassen, um am Erzeugungsorte des Salzes ihren<br />
Bedarf decken zu können, welches Ansinnen ihnen aber stets zurückgewiesen<br />
wurde, weil dadurch den Passauer Niederlagen nicht geringer Schaden erwachsen<br />
wäre. Das Straßenzwangs- und Wegerecht wurde auch auf dem „Goldenen<br />
Steig“ von den Anteilhabern strenge gehandhabt. Zu dessen Wahrung waren eigene<br />
bewaffnete „Steigwächter, Ueberreiter“ und „Wegmeister“ aufgestellt, die<br />
darauf zu achten hatten, dass weder Straßenmauten, Trankstätten, noch auch Herbergen<br />
von den Säumern umgangen und in ihren Vorrechten beeinträchtigt wurden.<br />
Mancher Säumer musste da, wenn er bei absichtlicher Verkürzung von derlei<br />
Ortsvorrechten ertappt wurde, Pferde und Ladung lassen. In zweiter Linie erst<br />
kamen diese Steigwächter, zumeist in kriegsbewegten Zeiten, als schützendes<br />
Geleite der Saumzüge in Verwendung, denn die düsteren Wälder und versteckten<br />
Schluchten boten da nicht selten flüchtigem Raubgesindel Verborgenheit und sichere<br />
Zuflucht. Doch kam es vor, dass gerade diese Steigwächter durch gemeinen<br />
Missbrauch ihrer Befugnisse den Säumern sehr verderblich wurden. In Verkleidungen<br />
unternahmen sie es nämlich, leichtgläubige Frächter, die auf ihre Vorspiegelungen<br />
eingingen, zur Benützung von verbotenen Schleich- oder Schliefwegen<br />
zu überreden, um sie dann wegen Uebertretung der Weggerechtsame um<br />
Ladung und Pferde strafen zu können. Arge Unsicherheit des Verkehrs machte<br />
sich zur Zeit der Hussitenkriege, welche 16 Jahre lang über Böhmen und die<br />
Nachbarländer große Verwüstung brachten, geltend, sowie auch während der<br />
Drangsale des 30 jährigen Krieges. Zu diesen Zeiten lag der Handel auf dem<br />
„Goldenen Steige“ schwer darnieder.<br />
Um 1620 war der Steig durch Verhaue und Schanzen gesperrt, der Handel vollständig<br />
unterbrochen. Auch im weiteren Verlaufe des 30 jährigen Krieges litt der<br />
Handel daselbst sehr und dies nicht nur infolge der unsicheren Zeitverhältnisse,<br />
sondern hauptsächlich auch durch den Mangel an Transportmitteln, da die Pferde<br />
als Bespannung bei den häufigen Truppendurchzügen gewaltsam in Verwendung<br />
genommen und den Besitzer nur in den seltensten Fällen zurückerstattet wurden.<br />
So kam es, dass die Stadt Prachatitz im Jahre 1645 bloß zwei Pferde besaß. Aber<br />
schon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts häufen sich die Nachrichten von<br />
bedeutendem Rückgange des Passauer Handels und der Verödung des „Goldenen<br />
Steiges“, sodass die Zahl der auf ihm einherziehenden Saumrosse auf 300 in<br />
der Woche herabsank.<br />
Vorbereitet und beschleunigt wurde dieser Rückgang auch durch den Wettbewerb<br />
der Nachbarstädte von Prachatitz, welche Handels- und Niederlangsrechte<br />
für baierisches Salz zu erwerben trachteten, so dass Prachatitz gegen 1500 und<br />
1600 die heftigsten Kämpfe zur Wahrung des Weg- und Zollrechtes auszutragen<br />
hatte. Häufig werden an die Passauer nachdrückliche Beschwerdeschreiben ge-<br />
richtet, dass große Ladungen Salz auf anderen Wegen von Passau gegen<br />
Schüttenhofen, Klattau und Prag gehen, wodurch der Verkauf auf dem „Goldenen<br />
Steige“ stark beeinträchtigt würde. Die Mehrzahl der Streitfälle, in die Prachtitz<br />
mit den Nachbarorten um seine verbrieften Rechte verwickelt wurde, werden<br />
zwar noch zugunsten ersterer Stadt entschieden, der Verfall des Handels wird<br />
aber dadurch doch nicht aufgehalten. Als diese Stadt durch Kauf vom letzten<br />
Sprossen des Geschlechtes der Witigonen, Peter Wock von Rosenberg, im Jahre<br />
1601 in den Besitz Kaiser Rudolfs II. übergegangen war, erneuerte dieser zwar<br />
im Jahre 1607 noch einmal ihre Salzgerechtsame und ebenso bestätigte sie<br />
Ferdinand II. im Jahre 1630. Trotz alledem sank aber der Verkehr auf dem „Goldenen<br />
Steige“ mehr und mehr und dieser selbst verfiel, wie aus einer Urkunde<br />
aus dem Jahre 1664 zu ersehen ist, in der es heißt, „dass der güldene Steig ziemlich<br />
verderbt und kaum zu Fuß sicher zu gehen, viel weniger zu reiten, zu reisen<br />
oder zu säumen sei“.<br />
Andererseits war man bestrebt, das Gmundener Salz in den österreichischen Erblanden<br />
zu begünstigen und dadurch die Einkünfte des kaiserlichen Salzhoheitsrechtes<br />
zu mehren. Dies geschah nicht nur dadurch, dass man das baierische<br />
Salz mit hohem Grenzzolle belegte, sondern zumeist durch Errichtung von kaiserlichen<br />
Niederlagen für die österreichischen Salinenwerke. So erhielt auch<br />
Prachtitz im Jahre 1659 eine derartige Niederlage für Gmundener Salz und ebenso<br />
entstanden im böhmischen Innenlande zahlreiche kaiserliche Legstätten, wodurch<br />
sogar jene zu Prachtitz hinfällig werden musste, was schließlich zu ihrer Aufhebung<br />
im Jahre 1706 führte. Da das baierische Salz mit einem unerschwinglichen<br />
Grenzzolle belegt war, das Passauer Bistum jedoch die aus Böhmen kommenden<br />
Waren ebenfalls hoch besteuerte, für gewisse Erzeugnisse die Einfuhr sogar ganz<br />
verbot, hört im ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts das Säumen auf dem „Goldenen<br />
Steige“ gänzlich auf und die mit so vielen Mühen gebahnte Verkehrsstraße<br />
verfiel vollends.<br />
So mancher Flur- und Ortsname, vereinzelte in Trümmer zerfallene Lug- und<br />
Wachttürme und nicht zuletzt auch vielfache im moorigen Waldboden zutage<br />
tretende Wegreste weisen aber heute noch bedeutungsvoll auf die Richtung dieses<br />
verschollenen, einst so verkehrsreichen „Goldenen Steiges“ hin, der zwei bedeutende<br />
Handelsorte und Nachbarländer enge verknüpfte, und halten die Erinnerung<br />
an die Zeiten wach, da auf dem vielbefahrenen gefreiten Wege zahlreiche<br />
schwerbeladene Saumzüge das bairisch-böhmische Waldgebirge durchschritten.<br />
(Aus „Waldheimat“ Feber 1927)
62<br />
63<br />
Vor vielen Jahren lebte ein junger Köhler in den Wäldern um den Schreinerberg.<br />
Er hatte das Kohlenbrennen von seinem Vater gelernt, der mächtige Meiler in<br />
den Gründen der Waldwildnis gebaut hatte. Als seine Eltern starben, blieb der<br />
junge Köhler allein in der Wildnis und ging allein seinen Gewerbe nach. Nur ein<br />
Rabe, der aus seinem Nest gefallen war und den der Köhler aufgezogen hatte,<br />
blieb sein Gefährte in der Einsamkeit. Man musste nur „Krahan“ rufen, und schon<br />
flatterte der schwarze Geselle heran und wartete auf einen Leckerbissen, den der<br />
Köhler ihm zusteckte. Krahan war ein gelehriges und dankbares Tier, das für den<br />
Köhler am Meiler wachte, wenn dieser nächtens auf seinen Lager in der Nähe<br />
den Meilers ruhte. Wenn nur ein kleines Flämmchen durch die schützende Lehmhülle<br />
des Meilers blecktet oder dunkler Rauch aus ihm aufstieg, schreckte das<br />
krächzende Rufen des Raben den Schläfer warnend auf, damit er sogleich die<br />
undichte Stelle abschließe und ein Ausbrennen des Meilers verhindere. Erst wenn<br />
der Meiler planmäßig angestochen und gelöscht wurde, hatte sich die wochenlang<br />
dauernde Mühe des Kohlebrenners gelohnt. Er konnte die gute Holzkohle<br />
zum Marktort am Handelsweg, dem „Goldenen Steig“ bringen, wo viele Hufschmiede<br />
für die Saumpferde und deren Hufbeschlag gute Abnehmer seiner Holzkohle<br />
waren. Dann tauschte er im Gegenzug alles, was er in seinem Waldleben<br />
nötig hatte und wanderte nach einigen Tagen wieder zufrieden in seine Waldeinsamkeit<br />
zurück.<br />
Einmal in Sommer, als die Sonne gerade ihren höchsten Stand erreicht hatte,<br />
wollte der Köhler auf der Suche nach einen geeigneten Platz für einen neuen<br />
Meiler vom Felsen des Schreinerberges Ausschau halten und wanderte zügig<br />
den Berggipfel zu. Der Rabe Krahan flatterte munter über die Wipfel der Bäume<br />
und meldete mit lautem Krächzen, wenn etwas Ungewöhnlichen im Dickicht zu<br />
sehen war. So kam der Köhler auf die Ostseite des Berges, wo das Felsplatteau<br />
eine herrliche Aussicht auf den Marktflecken zu Füßen des Berges und die Umgebung<br />
bis zum Wuldafluss bot. Er gedachte dort zu rasten. Doch als er die Felsplatte<br />
schon fast erreicht hatte, schreckte er vor einen seltsamen Anblick zurück.<br />
Auf den in der Sommerhitze angewärmten Steinen lag in der Mitte zu einem Rad<br />
geringelt eine große dunkle Schlange, die nur ihren Kopf mit gelben Flecken an<br />
der Seite züngelnd der Sonne entgegenstreckte. Auf den Kopf aber trug sie als<br />
Geschmeide ein kleines, goldenes Krönlein, in dessen Edelsteinen die Sonnenstrahlen<br />
in Regenbogenfarben funkelten. „Die Schlangenkönigin!“, durchfuhr<br />
es den Köhler, der schon von seinen Eltern manche Mären über so ein Tier gehört<br />
hatte. Und rings um die ruhende Schlange ringelten und rollten Schlangen,<br />
große und kleine, kupferrote und graue, wie im Tanz sich umschlingend und ihre<br />
Königin schützend. Es war ein ungewöhnlich zauberhaften Bild auf der Felsplatte,<br />
welches der junge Köhler verborgen hinter einen Baum beob-<br />
achtete. Unschlüssig verharrte er in seinen Versteck, doch das funkelnde Krönlein<br />
sandte verlockende Lichtblitze in seine Gedanken. Er hätte ja talwärts leicht<br />
flüchten können, aber Angst und Furcht hatte er sich in seinen schweren Dasein<br />
längst abgewöhnt. So zog er vorsichtig seine Steinschleuder, die er immer in der<br />
Tasche trug, hervor, legte einen Kieselstein ein und zielte auf das funkelnde Krönlein.<br />
Der Stein schnellte los und nahm in Flug das Krönlein mit, welches auf dem<br />
Ast eines schlanken Ahornbaumes am Abhang hängen blieb. Mit ein paar Sprüngen<br />
hatte der Köhler den Baum erreicht und hangelte sich geschickt in die Baumkrone<br />
hoch. Er bog den Ast zurück und ergriff das blitzende Ding. Gesichert saß<br />
er auf den dicken Ast in der luftigen Höhe; denn an eine Flucht mit dem Geschmeide<br />
war nicht zu denken. Aus allen Felsklüften ringelten Schlangen den<br />
Baum zu, rollten mit giftigen Zischen rund um den Baum und versuchten vergebens<br />
sich an dem glatten Stamm hochzuschlängeln. Einen Fluchtweg gab es bei dieser<br />
Schlangenbelagerung für den Köhler nicht. Er überlegte fieberhaft: Sollte er das<br />
Schlangenkrönlein hinunterwerfen? Da hätte er umsonst Angst ausgestanden. Und<br />
wer weiß, ob die Schlangen damit zufrieden wären?<br />
Während er noch überlegte, schlängelte sich plötzlich die dunkle Königsnatter<br />
daher. Und seltsam! Sie hob ihren Kopf und züngelte zischend aber gut vernehmbar<br />
zu seinen Versteck empor:<br />
„Schwarzer Mann, der gut zielen kann,<br />
gib die Krone her, sonst lebst du bald nicht mehr!“<br />
Der Krakan, welcher über dem Köhler im Geäst saß, krächzte ängstlich und plötzlich<br />
verstand der Köhler auch diesen in menschlichen Lauten.<br />
„Krah, krah, krier! Was gibst du uns dafür?“<br />
Da zischte die Schlange zurück:<br />
„Die Krone gehört mir!<br />
Ich lasse dir dafür, dass du gefeit vor Schlangengift,<br />
und nie ein böser Pfeil dich trifft.<br />
Ihr beide sollt, so wird’s geschehen,<br />
in eurer Rede euch verstehen.“<br />
Der Köhler überlegte noch verwundert, wieso er plötzlich die Sprache der beiden<br />
Tiere in menschlichen Worten verstand, da krächzte der Rabe wieder :<br />
„Das unrecht Gut, wirf es hinaus!<br />
Sonst kommen nimmer wir nachhaust.“<br />
Da merkte der Köhler erst, dass es wirklich unrecht Gut war, das er durch Raub in<br />
seinen Händen hielt, denn es gehörte rechtens der Schlangenkönigin, und er warf<br />
es von Baum hinab. Die Schlangenkönigin fing es geschickt mit ihrem erhobenen<br />
Kopf auf und schlängelte sich blitzschnell unter die nächste Steinspalte, und<br />
ebenso schnell waren auch alle anderen Schlangen verschwunden.<br />
Der Köhler konnte unbeschadet vom Baum herunterrutschen und sich etwas verärgert<br />
über sein sonderbares Abenteuer auf den Heimweg begeben. Allerdings<br />
wunderte er sich sehr, dass er plötzlich wirklich die Sprache des Raben verstand,<br />
der neben ihm dahinflatterte und zufrieden krächzte: „Gut getan, Köhlermann!<br />
Falsches Gut gib stets zurück! Du gewinnst dafür dein Glück!“<br />
Das Schlangenkrönlein<br />
Rosa Tahedl
64<br />
65<br />
„Was soll das für ein Glück sein“, brummte der Köhler; denn Menschen haben<br />
nicht das feine Gespür und den Sinn für zukünftiges Geschehen wie die Tiere.<br />
Aber er war zufrieden als er eine schöne Waldlichtung fand, wo er in der Nähe<br />
die richtigen Stämme für einen neuen Kohlenmeiler fällen könnte. Hier würde er<br />
für Wochen leben, den Meiler hüten und weil er jetzt die Sprache seines Gefährten<br />
verstand, würde er diesen zur Wache am Meiler besonders in der Nacht verpflichten.<br />
Als die Laubbäume zu gilben anfingen, hatte er auch aus dem Meiler so<br />
viel Kohle gewonnen, dass er im Markt sicher den Bedarf für den Winter eintauschen<br />
könne. Als er jedoch mit seinem vollbeladenen Karren in den Markt kam<br />
und beim ersten Hufschmied seine Ware feilbieten wollte, fand er im ganzen Ort<br />
ungewöhnlich reges Leben und viele Wagengespanne neben dem Saumpfade.<br />
Wildes Pferdewiehern klang aus den Ställen. „Ein reicher Kaufmann zieht mit<br />
seinem Gefolge durch und hat in der Stadt Aufenthalt genommen“, erfuhr er vom<br />
Hufschmied, als er seinen Karren in den Hof fuhr, wo die Pferde der Säumer<br />
sonst eingestellt wurden. Dem Krakan befahl er: „Hüte unser Sach und such dir<br />
deine Verpflegung selber!“ Er machte sich dann auf den Weg zur Schänke, um<br />
auch einmal unter Leuten zu sein. Doch er kam nicht weit. Plötzlich war lautes<br />
Geschrei in der Gasse und es lief ein junges Weibsbild mit zerzausten Haaren und<br />
verschlissenen Kleidern daher. Hinter ihr trabte der Gemeindebüttel, der mit einem<br />
Stock fuchtelnd die Frauensperson vor sich her zur Stadt hinaustrieb. Eine<br />
lärmende Bubenschar begleitete die beiden mit wilden Rufen: „Hinaus mit der<br />
Diebin aus unserem Ort! Hinaus mit ihr in die Wildnis, dass Bären und Wölfe sie<br />
fressen!“, lärmte alles Volk durcheinander. Der Köhler stand verwundert ob dieses<br />
Schauspiels am Rand der Straße. Die verfolgte Frau konnte kaum mehr laufen,<br />
als der Büttel und die lärmende Schar von ihr abließen, sie vor das Tor den<br />
Marktfleckens stießen, wo sie wie ein Häufchen Elend hocken blieb. Die Unglückliche<br />
tat ihm leid, ohne dass er genau wusste, wessen man sie beschuldigte.<br />
Als es im Torbogen ruhig wurde, lenkte er seinen Kohlenkarren schnell in die<br />
Einfahrt, lüpfte die schwere Kotze über den Kohlesäcken und deutete der Frau,<br />
sie möge sich schnell dort verstecken. Dann deckte er sie zu und sog den Karren<br />
wieder auf den Hof. Das Ganze ging sehr schnell und niemand hatte etwas bemerkt.<br />
Dann wartete er bis es dämmerig wurde und die ersten Lichter in den<br />
Häusern aufleuchteten. Erst dann wagte er es, die Decke anzuheben und das<br />
verängstigte Wesen zu fragen, warum man es so schmählich aus dem Ort treiben<br />
wollte. Schluchzend erzählte die junge Frau: Sie war Dienstmagd in der<br />
besten Schänke der Stadt. Dort war der reiche Kaufmann mit seinem Tross<br />
einquartiert, der viele schöne Waren aus fremden Ländern weiter bis an den<br />
Hof des Prager Königs transportieren sollte. Er musste ein feiner Herr sein,<br />
denn er trug eine dicke goldene Kette über seinem Samtwams, die er nur über<br />
Nacht ablegte. „Und heute in der Früh war sie verschwunden. Niemand außer<br />
mir war aber in das Zimmer gekommen. Nur ich habe ihm das Bett mit warmen<br />
Steinen anwärmen müssen. So fiel der Verdacht gleich auf mich und alle<br />
meine Beteuerungen halfen mir nichts. Der Rat auf dem Bürgeramt wollte<br />
mich schon fortschicken zur „peinlichen Befragung“, aber wegen der Kosten<br />
haben sie lieber beschlossen, mich aus der Stadt zu jagen und der Waldwildnis<br />
preiszugeben.“ Während sie das erzählte, hockte der Rabe Krakan recht aufmerksam<br />
auf dem Karren, dann krächzte er los: „Krah, krah! Die Goldkette hat der 1.<br />
Reitknecht. Ich habe gesehene, wie er sie in die Satteltasche seines Pferdes gesteckt<br />
hat. Ich habe auch gehört, wie er mit einem Boten ausgemacht hat, er soll<br />
dem Herrn Harbart auf der Burg Gans im Flanitztal ansagen, dass ein reicher<br />
Kaufmann mit vielen Waren durch die Enge des Flanitztales kommen wird. Dem<br />
soll er auflauern und die reiche Beute rauben. Krah, krah! Unrecht Gut tut nicht<br />
gut!“ Die junge Frau wusste das Krächzen den Vogels nicht zu deuten, aber der<br />
Köhler verstand wohl, was er zu tun habe. Er suchte die Herberge des Kaufmanns<br />
auf, doch wegen der späten Stunde ließ ihn der Wirt nicht zu seinem Gast. Da<br />
schlich er um das Haus herum, die Frau hatte ihm das Fenster des Schlafraumes<br />
beschrieben und wieder konnte er seine Schleuder gut gebrauchen. Er zielte und<br />
trat mitten in eine Butzenscheibe. Das Klirren des Glases ließ den Kaufmann das<br />
Fenster öffnen, um nach dem Übeltäter Ausschau zu halten. Da rief ihm der Köhler<br />
leise zu: „Ich habe eine wichtige Botschaft für Euch, die vielleicht Euer Leben<br />
retten kann. Lasst mich mit Euch reden!“<br />
Daraufhin neigte sich der reiche Herr weit aus dem Fenster, sodass er das Flüstern<br />
des Köhlers verstehen konnte. Der berichtete ihm, wo die Goldkette wäre<br />
und welche Gefahr drohe. Der Kaufmann war sehr bestürzt über die Nachricht,<br />
denn er hatte seinen Gefolgsleuten immer vertraut. Deshalb gebot er dem Köh-<br />
Anna Klarner: Eisvogel<br />
(Aquarell)
66<br />
67<br />
Es war einmal ein reicher Fürst, er hieß Witiko. Ihm gehörte alles Land zwischen<br />
den Flüssen Donau und Moldau. Fürst Witiko hatte drei Söhne, die er sehr liebte.<br />
Als sie erwachsen waren, und etwas im Leben leisten sollten, ritt er mit ihnen auf<br />
einen hohen Berg, der inmitten seiner Ländereien lag. Dieser Berg bildete einen<br />
langen, von dichtem Urwald bewachsenen Bergrücken auf dessen Kamm mächtige<br />
Felstürme standen. Sie hatten aber nicht so steile Felswände,<br />
Der Schatz am Dreisesselberg<br />
Rosa Tahedl<br />
ler bei Sonnenaufgang vor der Herberge zu warten. Als nun der Tag anbrach und<br />
der Säumerzug von dem Gefolge zusammengereiht wurde, wollte der Oberreitknecht<br />
sein Pferd an die Spitze des Zuges setzen, aber der Kaufmann forderte<br />
ihn auf, das Pferd vor ihm aufzuzäumen. Als der Reitknecht zum Schluss die<br />
Satteltaschen auflegen wollte, winkte der Kaufmann den Köhler heran und hieß<br />
ihn, die Satteltaschen zu durchsuchen. Da kam die goldene Kette ans Tageslicht<br />
und der ertappte Reitknecht wurde auch des Verrates an dem Säumerzug überführt.<br />
Der reiche Kaufmann war aber, trotzdem sich alles für ihn zum Guten gewendet<br />
hatte, ratlos, wie er seine kostbare Fracht unbeschadet durch die Wälder<br />
des Böhmerwaldes bringen könne. Da bot sich der Köhler an, der ja Weg und<br />
Steg im Walde gut kannte, den Säumerzug auf einen heimlichen „Schliefweg“<br />
abseits der Burg Gans zu geleiten. Und weil sich seine Angaben bisher als wahr<br />
erwiesen hatten, vertraute ihm der Kaufmann und versprach ihm reichen Lohn,<br />
wann er den Zug über das Gebirge brächte. Nun setzte sich der Köhler an die<br />
Spitze des Zuges. Der Rabe Krakan flog vor ihm her und spähte aufmerksam in<br />
das Dickicht. Ohne jeden Schaden kam der Säumerzug in die befestigte Stadt<br />
Pragotitz, noch ehe die Tore am Abend geschlossen wurden. Am nächsten Tag<br />
lohnte der Kaufmann den Köhler für sein gutes Geleit mit reichlichem Lohn. Der<br />
Köhler kehrte auf dem Schleichweg wieder zurück in den Marktort, wo die gerettete,<br />
unschuldige Frau bei seinem Kohlenkarren auf ihn wartete. Nun hätte er<br />
sich von seinem Lohn auch in dem Markt eine Heimstatt erwerben können, aber<br />
Krakan der Rabe krächzte ihm auffordernd zu:<br />
„Krah, krah, krei! Im Walde lebt man frei!<br />
Bist keines Herren Knecht. Dort gilt nur Gottes Recht!“<br />
Genau so empfand es auch der Köhler. Er lud einen reichlichen Vorrat auf seinen<br />
Karren und zog mit seiner neuen Gefährtin hinaus in den Wald, der ihm Schutz<br />
und Arbeit bot. Er war jetzt nicht mehr allein mit seinem gefiederten Freund,<br />
sondern lebte zufrieden mit der jungen Frau in seiner Waldhütte. — Und wenn<br />
sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute dort.<br />
wie ihr sie manchmal auf<br />
Bildern seht, sondern es<br />
waren lauter riesige, von<br />
Wind und Wetter abgeschliffene<br />
Steinhaufen, welche<br />
so aussahen, als hätten<br />
die Riesen in grauer Vorzeit<br />
sie übereinander geschlichtet.<br />
Drei dieser Felstürme<br />
standen nahe beieinander,<br />
und in jeden war ein Sitz in<br />
den obersten Stein gehauen.<br />
Man konnte von dort<br />
aus weit in das Land sehen.<br />
Der Fürst hielt jeden seiner<br />
Söhne an, sich auf einen<br />
solchen Steinplatz zu setzen.<br />
Er selber blieb in ihrer<br />
Mitte auf einem Platz stehen,<br />
wo zu seinen Füßen ein Wildrosenstrauch in voller Blüte stand. Dann sprach<br />
er zu seinen Söhnen: „Ihr seid nun erwachsen, und es möge jeder von Euch nach<br />
Kräften versuchen, zum Wohlstand unseres Geschlechtes beizutragen. Ihr könnt<br />
von hier aus das ganze Land Übersehen, das uns gehört. Sagt mir also, was ihr im<br />
Leben leisten wollt!“ Die drei Söhne sahen unter sich weite, unermessliche Wälder<br />
mit hellen Blößen, dunklen Seen und silberig glitzernden Flüssen, über die<br />
Gottes Sonnenlicht freundlich herabstrahlte. So antwortete der erste Sohn: „Ich<br />
will ein Ritter werden. Ich werde eine feste Burg auf einen Felsen bauen, dort wo<br />
der Fluss Moldau eine doppelte Schleife durch die krumme Au zieht. Von dieser<br />
Burg aus will ich alle Menschen schützen die in unserem Land wohnen, dass<br />
ihnen kein Feind schaden kann.“<br />
Der zweite Sohn, welcher lange in die Ferne nach Süden geschaut hatte, wo das<br />
Silberband der Donau den Blick in die Ferne lockte, antwortete dem Vater: „Ich<br />
will ein Handelsmann werden. Ich werde einen Steig durch den Urwald zwischen<br />
Donau und Moldau schlagen. Und viele Kaufleute, Säumer, sollen mit<br />
ihren Pferden Handelswaren vor allem Salz in unser Land bringen. Es soll<br />
dadurch zu solchem Reichtum kommen, dass man diesen Handelsweg sogar einen<br />
„Goldenen Steig“ nennen wird.“ Der dritte Sohn aber konnte seinen Blick<br />
nicht von den unermesslichen Weiten des Waldes lösen, der wie ein grünes Meer<br />
Woge um Woge in dunkler Wellenflut vor ihnen breitete. Dann sagte er: „Ich<br />
Adolf Harant: Passau,<br />
Römerkastell „Bojotro“
68<br />
69<br />
will mit meinen Knechten in den Wald ziehen und neues Land roden. Wir werden<br />
große Herden weiden und fruchtbaren Ackerboden gewinnen. Allmählich sollen<br />
Dörfer entstehen, wo die Menschen in Ruhe und Frieden miteinander leben können.<br />
Der große Wald hat viel Platz für fleißige Menschen, denen ich ein gerechter<br />
Herr sein will.“ Fürst Witiko merkte, dass seine Söhne sich ein gutes Lebensziel<br />
ausgesucht hatten und gab ihnen seinen besten Rat auf ihren Lebensweg: „Liebe<br />
Söhne“, sprach er, „Ihr werdet euch wahrscheinlich im Leben nur mehr selten<br />
sehen. Deswegen soll dieser Berg, der von heute an nach euren Steinsitzen Dreisesselberg<br />
heißen soll, für euch ein Begegnungsplatz werden. Hinter den Felstürmen<br />
liegen auf dem Bergkamm viele Steine, wie ein Steinernes Meer. Dort ist<br />
der Eingang zu einer Schlucht. In diese Schlucht legte ich einst den wertvollsten<br />
Schatz unseres Geschlechts und rief durch einen Zauber einer alten, weisen Frau<br />
alle Schlangen des Steinmeeres mitsamt ihrer Schlangenkönigin als Wache des<br />
Schatzes dorthin. Dieser Schatz soll euch allen dreien und euren Nachkommen<br />
gemeinsam gehören. Jedes Jahr im Sommer, wenn die Tage lang sind, und die<br />
Sonne genau zwischen den ersten zwei Felstürmen aufgeht, wird die Schlucht<br />
auf eine Weile offen stehen. Aber nur so lange, bis man drei Vaterunser gebetet<br />
hat. Ihr könnt den Schatz sehen, und wenn einer von euch dreien in Not ist, darf<br />
er von dem Schatz mitnehmen, was er braucht, um seine Not zu lindern. Wenn er<br />
aber selber in dem Jahr Reichtümer erworben hat, soll er von seinem Überfluss<br />
etwas hinterlegen und den Schatz vermehren. So soll der Schatz am Dreisesselberg<br />
für euch alle zum Segen werden. Denn das Beste auf der Welt ist, wenn einer<br />
dem anderen aushilft.“<br />
Dann bückte sich Witiko zu dem Wildrosenstrauch, pflückte drei Blüten ab und<br />
sprach: „Damit ihr aber ein Zeichen dafür habt, dass ihr für immer zusammengehört,<br />
gebe ich jedem von euch eine solche fünfblättrige Rose. Ihr sollt sie ebenso<br />
auch eure Nachkommen in eurem Schild und Siegel führen. Die fünfblättrige<br />
Rose soll in Stein gehauen über den Toren der Schlösser, Städte und Paläste prangen,<br />
und jeder von euch soll so erinnert werden, dass euch das Streben nach<br />
Besitz und Reichtum nicht entzweien darf.“<br />
Die drei Brüder merkten sich die Rede des Vaters wohl. Jeder heftete sich eine<br />
Wildrose an sein Wams. Dann zogen sie vom Dreisesselberg aus in die Welt. Es<br />
brach schon die Nacht herein, als der Rittersmann auf dem Weg in die Krumme<br />
Au, wo er sein Schloss bauen wollte, mit seinen Dienern an einen Waldsee kam.<br />
Dieser lag so unbewegt und still wie eine glitzernde Träne des Waldes vor ihnen,<br />
und wurde von einer hohen Felswand abgeschlossen. Keine Welle kräuselte den<br />
Spiegel des Sees. Doch als die Männer näher kamen, sahen sie, dass das Gewässer<br />
von silberglitzernden Fischen wimmelte. Da nahm ein Knecht seinen Eisenhelm<br />
ab und schöpfte ihn voll zappelnder Fische, deren Schuppen wunderbar wie<br />
in Regenbogenfarben glitzerten. Die anderen Knechte machten am Ufer ein Feuer<br />
an und wollten die Fische als Nachtmahl verzehren. Aber je heißer das Wasser<br />
im Eisenhelm wurde, desto munterer sprangen die Fische darin herum, dass das<br />
Wasser ins Feuer spritzte, und es zu verlöschen drohte. Und plötzlich erhob sich<br />
ein Brausen aus der Tiefe des Sees, und eine Stimme erscholl: „Es<br />
sind noch nicht alle zu Hause; es sind noch nicht alle zu Hause!“ Da überkam die<br />
Männer ein Grausen, und sie kippten die zappelnden Fische wieder zurück in den<br />
See. Im selben Augenblick verstummte das Brausen; der See lag wieder reglos<br />
vor ihnen, und der Mond spiegelte sich in seiner Flut. Voll Angst überstanden sie<br />
die Nacht und zogen am nächsten Tag weiter das Moldautal abwärts, wo der<br />
Sohn Witikos auf einem hohen Felsen an der doppelten Moldauschleife eine prächtige<br />
Burg erbauen ließ. Und über das Tor ließ er nach dem Befehl seines Vaters in<br />
Stein die fünfblättrige Rose hauen. Wenn ihr einmal vor dem Schloss stehen werdet,<br />
könnt ihr sie heute noch dort sehen.<br />
Der zweite Sohn zog nach Süden und ist ein tüchtiger Handelsmann geworden.<br />
Er baute mit seinen Dienern einen Weg über das Böhmerwaldgebirge und durch<br />
sumpfige Auen. Dann stellte er ganze Züge von kleinen Pferden mit ihren Führern,<br />
den Säumern, zusammen und brachte reiche Waren aus dem Süden in das<br />
Land seines Vaters. Die Flüsse im Böhmerwald bargen damals noch Muscheln<br />
mit schimmernden Perlen, und in den klaren Waldbächen wusch man sogar Gold<br />
aus dem Sand. So entstanden an diesem Handelsweg bald Städte und Märkte, in<br />
denen wohlhabende Kaufleute mit den Säumern die Waren tauschten. Bald nannte<br />
man diesen Weg den „Goldenen Steig“.<br />
Beide Brüder brachten auch jedes Jahr, wie ihnen aufgetragen war, im Sommer<br />
einen Teil ihres Reichtums zum Dreisesselberg und mehrten den Schatz dort beträchtlich.<br />
Nur der dritte Sohn konnte lange nichts zur Mehrung des Schatzes beitragen.<br />
Seine Knechte waren zwar ehrliche und fleißige Arbeiter, aber wenn sie den steinigen<br />
Boden rodeten, oder als Köhler oder Pechbrenner vom Wald Nutzen zogen,<br />
fristeten sie zwar ihr Leben und mussten nicht Hunger leiden, aber Überfluss<br />
besaßen sie nie. So drängten weder Not noch Reichtum den dritten Sohn<br />
zum Schatz auf den Dreisesselberg. Wenn er im Sommer, da die Sonnenhitze das<br />
Pech an der Borke der Waldbäume rinnen ließ, zum Dreisesselberg hinaufstieg,<br />
dann pflückte er zum Andenken an seinen Vater nur einen blühenden Zweig der<br />
fünfblättrigen Wildrose, nahm ihn mit nach Hause und steckte ihn hinter das Kreuz<br />
zu dem Palmbuschen im Herrgottswinkel.<br />
So blieb der Schatz auf dem Dreisesselberg bis zum heutigen Tag unangetastet<br />
erhalten. Ich könnte euch noch viel erzählen, wie manche Leute später den Eingang<br />
zur Felsenhöhle gesucht haben. Aber weil sie nur den Reichtum wollten,<br />
das Beste aber die Hilfe für den Nächsten und den Zusammenhalt der Sippe<br />
nicht im Sinne hatten, blieb ihnen der Eingang verschlossen. Von den Abenteuern,<br />
welche sie dabei erlebten, erzähle ich ein andermal.<br />
Doch noch immer treffen sich auch heutzutage im Sommer am Dreisesselberg<br />
viele Menschen, die im Land, wo die fünfblättrige Rose blühte, ihre Heimat haben.<br />
Sie suchen zwar nimmer den Schatz, denn keiner kennt die Stunde, wenn die<br />
Felsenschlucht offen steht, aber sie hoffen, dass ihnen der Bergwind leise ins Ohr<br />
flüstert: „Vergesst das Beste nicht!“ Dann gehen sie getröstet wieder nach Hause.
70<br />
71<br />
( Vortrag, in einer Heimatwoche gehalten)<br />
Man muss die Frage, ob unsere Heimat jemals in der Geschichte und in der Kulturgeschichte<br />
eine besondere, über ihren engen Rahmen hinausreichende Rolle<br />
gespielt hat, mit einem „Ja“ beantworten. Dies war der Fall zur Zeit der<br />
Rosenberger (1200 1611), wo sich im südböhmischen Raum, Mittelpunkt Krummau,<br />
ein politisches und kulturelles Machtzentrum herausbildete, das nach allen<br />
Seiten seine diesbezüglichen Einflüsse ausstrahlte. Alle unsere heimischen Historiker<br />
haben sich mit der Geschichte dieses mächtigen Adelsgeschlechtes befasst,<br />
so M. Pangerl, M. Klimesch, V. Schmidt und A. Wagner, der eine Dissertation<br />
darüber geschrieben hat. Trotzdem wäre noch vieles zu klären. Über die<br />
Herkunft der Rosenberger gibt es drei Annahmen:<br />
1. Sie selbst behaupten, von dem römischen Geschlecht der Ursini abzustammen.<br />
Dies ist eine Sage, geschichtlich in keiner Weise begründet und beruht auf dem<br />
Bestreben vieler Adelsgeschlechter, ihre Abstammung möglichst weit in die Vergangenheit<br />
zurückzuverlegen.<br />
2. Die Tschechen nennen den Stammvater Witiko „Vitek“, das Geschlecht<br />
„Vitkowetzer“ und behaupten, es sei ein tschechisches Geschlecht.<br />
3. Pangerl nimmt eine deutsche Herkunft der Rosenberger an und beruft sich auf<br />
das älteste aus dem Jahre 1222 stammende Siegel, auf dem steht, „Witiko von<br />
Plankienberg“. Plankienberg ist eine Burg im oberösterreichischen Mühlviertel<br />
nördlich der Donau. Tatsächlich hatten die Rosenberger viele Besitzungen im<br />
Mühlviertel, von wo sie auch die Leute bei der Besiedlung des Böhmerwaldes<br />
hernahmen Sie hatten auch zu allen Zeiten lebhafte Beziehungen zu den Bischöfen<br />
von Passau, die im Mühlviertel ihre Nachbarn waren. A. Stifter schließt sich<br />
in seinem Roman „Witiko“ dieser Auffassung an und lässt seinen Helden von<br />
Passau aus nach Böhmen reiten.<br />
Der Herrschaftsbereich der Rosenberger reichte von der Donau bis gegen Prag<br />
und nach Südmähren hinein, aber es war durchaus kein geschlossenes, zusammenhängendes<br />
Gebiet. Wie sie ihren Besitz vor dem Jahre 1200 erworben haben,<br />
ist bis heute nicht geklärt. Später entstanden mehrere Linien der Witigonen mit<br />
den Sitzen in Rosenberg, Neuhaus, Landstein und dem Hauptsitz in Krummau.<br />
Zur Zeit König Ottokars II. waren sie bereits das mächtigste, reichste und einflussreichste<br />
Adelsgeschlecht Böhmens und konnten in die hohe Politik bestimmend<br />
eingreifen. Dies soll an einigen Beispielen aufgezeigt werden: Im Jahre<br />
1173 lud Kaiser Friedrich Barbarossa den böhmischen Herrscher Wladislav vor<br />
den Reichstag in Nürnberg, um den böhmischen Thronstreit zu schlichten.<br />
Die Rosenberger und ihre Bedeutung für den<br />
Böhmerwald<br />
Wladislav sandte als seinen Vertreter Witiko von Rosenberg. Das war das erste<br />
Auftreten eines Rosenbergs in einer diplomatischen Mission. Im Jahre 1256 ernannte<br />
König Ottokar II. den Wok von Rosenberg zum Marschall von Böhmen,<br />
also zum höchsten Beamten des Landes. Im Kampf um das Erbe der Babenberger<br />
in Österreich, der zwischen den Königen von Böhmen und Ungarn ausbrach,<br />
befehligte Wok von Rosenberg die Truppen Ottokars und siegte in der Schlacht<br />
bei Kreißenbrunn. Hierauf nahm Ottokar II. die österr. Länder in Besitz und ernannte<br />
zum Dank Wok zum Landeshauptmann der Steiermark. Aber später entzweiten<br />
sich die Rosenberger mit Ottokar, ließen ihn im Stich und verursachten<br />
seine Niederlage gegen Rudolf von Habsburg in der Schlacht auf dem Marchfelde<br />
1278. Sie waren also entscheidend beteiligt an „König Ottokars Glück und<br />
Ende“.<br />
Der Witigone Zawisch von Falkenstein wurde Oberstburggraf von Böhmen und<br />
führte für den minderjährigen König die Regierung. Im Jahre 1397 nahm Heinrich<br />
von Rosenberg als Leiter des „böhmischen Herrenbundes“ den König Wenzel<br />
gefangen und brachte ihn auf die Burg Wittinghausen. Ulrich II. von Rosenberg<br />
(1418 57) war das Haupt der gegenhusitischen Partei. Er leitete auch den<br />
Kampf gegen den König Georg von Podebrad. Der Papst sandte zwei Legaten<br />
(Kardinäle) nach Krummau zu den Verhandlungen. Der berühmte Johann Capistran<br />
hielt auch hier seine Predigten gegen Husiten und Türken. Der gelehrte Humanist<br />
Äneas Sylvius, der spätere Papst Pius II., besuchte Krummau. Aus diesen Tatsachen<br />
wird deutlich sichtbar, welche Bedeutung das Krummau der Rosenberger in<br />
der damaligen Zeit hatte. Im Jahre 1537 richtete Kaiser Ferdinand an Jost von<br />
Rosenberg die Bitte um Überlassung Von 234 Kanonen, die er in den Türkenkriegen<br />
gebraucht hätte. Jost lehnte ab, schickte aber 300 wohlausgerüstete Landsknechte.<br />
Wilhelm von Rosenberg (1545 –92) war Gesandter des Kaisers auf dem<br />
Reichstag in Augsburg. Er war viermal verheiratet, so mit Katharina von<br />
Braunschweig, mit Sophia von Brandenburg, mit Anna von Baden, also mit Angehörigen<br />
der ersten deutschen Herrschergeschlechter. Der Aufwand, der bei den<br />
Hochzeiten (zu denen auch Kaiser Rudolf nach Krummau kam) und auch sonst<br />
getrieben wurde, war weithin berühmt, artete aber schon in Verschwendung aus<br />
und leitete den Verfall ein. Der Nachfolger Wilhelms, der kinderlose Wok ( 1611)<br />
war der letzte seines Stammes.<br />
Alles dies, so bedeutungsvoll es einmal gewesen sein mag und uns Macht und<br />
Größe unseres heimischen Adelsgeschlechts vor Augen führt, hat für die Gegenwart<br />
keine Bedeutung. Aber die Rosenberger haben auch Bleibendes geschaffen.<br />
Sie haben das Hauptverdienst an der deutschen Besiedlung unserer Heimat, indem<br />
sie vorwiegend aus ihren österreichischen Besitzungen die Ansiedler ins<br />
Land riefen, welchem Beispiele die Klöster Hohenfurth und Goldenkron und einige<br />
Adelsfamilien folgten. Die Rosenberger waren sehr kunstsinnig und förderten<br />
in ihrem Herrschaftsbereich alle Künste, so dass man mit Recht von einem<br />
„Südböhmischen Kunstraum“ spricht, der dem Prager Kunstraum zeitweise ebenbürtig<br />
war. Die Kunstschätze, die hier entstanden, sind uns ja erhalten. Da sind<br />
vor allem sichtbar die großartigen Burgbauten in Krummau, Rosenberg.<br />
Josef Bürger
72<br />
73<br />
Gratzen, Neuhaus. Es sind dies gleichsam Glanzlichter im Bilde der heimischen<br />
Landschaft. Im Rosenbergischen Herrschaftsbereich finden wir, wie kaum wo<br />
anders, zahlreiche rein gotische Kirchen von hohem künstlerischen Wert, so in<br />
Krummau, Prachatitz. Hohenfurth, Rosenberg, Unterhaid, Gratzen, Kalsching.<br />
Goiau, Friedberg, Heuraffl. Peter von Rosenberg hatte ja den Ehrgeiz, in Krummau<br />
eine eigene „Bauhütte“ zu gründen (wir würden dazu heute Baudirektion<br />
sagen), wie sie damals nur in ganz großen Städten, z. B. in Köln, Straßburg, Prag,<br />
Wien gestanden. In den von den Witigonen gegründeten Klöstern Hohenfurth,<br />
Krummau, Wittingau wurden alle Künste gepflegt, so vor allem die „Tafelmalerei“<br />
(Malgrund Holztafeln). Die Bilder der „Meister von Hohenfurth und<br />
Wittingau“ werden als Meisterwerke der „Böhmischen Malerschule“ in jeder<br />
Kunstgeschichte erwähnt. Aus der Zeit um 1400 stammen die „schönen Madonnen“,<br />
gotische Statuen der Mutter Gottes mit dem Jesuskinde im Arm. Wir finden<br />
sie vom Rhein bis nach Polen, am häufigsten aber im südböhmischen Raum, so in<br />
Krummau, in Tweras, in Suchenthal. Die „Madonna von Krummau“, heule im<br />
kunsthistorischen Museum in Wien, wird als die künstlerisch wertvollste dieser<br />
Statuen bezeichnet. Die Rosenberger legten eine große Bibliothek an, die nach<br />
ihrem Aussterben nach Prag kam und von den Schweden nach Stockholm mitgenommen<br />
wurde. Die schwedische Königin Christine brachte sie nach Rom und<br />
so befindet sich diese Rosenbergische Bibliothek heute im Vatikan.<br />
Woher stammte der Reichtum der Witigonen, der es ihnen ermöglichte, eine<br />
solche Pracht zu entfalten und noch dazu die Künste so stark zu fördern? Die<br />
Grundlage dazu bildeten wohl die Abgaben aller Art wie Zehent, Robot, Markt<br />
und Mautgebühren, die von den Städten, Märkten und Bauerndörfern ihres<br />
so großen Herrschaftsbereiches geleistet werden mussten. Im Jahre 1473 erfolgte<br />
die Anlage des ersten Silberbergwerkes bei Krummau und in der Folgezeit<br />
entwickelte sich der Bergbau und lieferte einen reichen Ertrag, allerdings<br />
nicht lange. Krummau bekam eine eigene Münzenkammer. Die heute noch<br />
blühende südböhmische Teichwirtschaft geht auf die Rosenberger zurück,<br />
die um 1545 die ersten Teiche anlegten. Wie verhielten sich die Rosenberger<br />
in der in Böhmen immer mehr oder weniger brennenden nationalen Frage?<br />
Wenn auch ihre Herkunft nicht restlos geklärt ist, so halten wir doch mit<br />
guten Gründen an ihrer deutschen Abstammung fest. Ihr Herrschaftsbereich<br />
erstreckte sich sowohl über deutsche als auch über tschechische Gebiete. Sie<br />
stellten Urkunden in der deutschen und tschechischen Sprache aus. Sie hatten<br />
deutsche Dienstleute, so die Turdelinge, die Prüschenk, aber auch tschechische.<br />
Ihr Chronist Brezan war ein Tscheche. In ihrer Familie gab es deutsche<br />
Namen wie Wilhelm, Ulrich, Heinrich, aber auch tschechische wie<br />
Budiwoy, Smil, Zawisch. Sie waren Gegner der Husiten aus religiösen, machtpolitischen<br />
und sozialen Gründen, nicht aus nationalen. Zusammenfassend,<br />
kann man sagen: Die Witigonen waren national unparteiisch, keine Deutschen,<br />
keine Tschechen, sondern „Böhmen“. Sie waren schon damals, ob<br />
bewusst oder unbewusst, Vertreter von einem böhmischen Patritotismus,<br />
den man auch später zeitweise beobachten kann. A. Stifter hält<br />
Ein Brief der Stadt Grafenau an die Stadt Bergreichenstein aus der Zeit des<br />
Beginnes des 30 jährigen Krieges.<br />
Der folgende Brief ist das von sorgloser Zuversicht zeugende Antwortschreiben<br />
der Stadt Grafenau in Bayern an die Bergreichensteiner Stadtväter, die, von Sorgen<br />
für die Zukunft erfüllt, angefragt hatten, ob sich jedenfalls in Bergreichenstein<br />
damals verbreitete Gerücht von Truppenbewegungen gegen die böhmische<br />
Grenze bewahrheite: „Edle, Beste, Ehrnveste, Fürsichtige, Ersam und Weise,<br />
denselben sein unnser Nachberlich guetwillig Diennst zuvor, Insonders liebe<br />
Herrn, Freundt und Nachbern. Dersolben Schreiben haben wir Empfanngen,<br />
unnd darauß mit mehrern verstanden, wie sie sich besorgen, alß möchte das<br />
Bausteine zur Heimatkunde<br />
Rudolf Hruschka<br />
sich in seinem Roman „Witiko“<br />
auch an diese Auffassung, die nationale<br />
Frage spielt darin keine Rolle.<br />
Das historische Verdienst der<br />
Rosenberger besteht darin, dass sie<br />
aus unserer Heimat, diesem entlegenen<br />
Waldland, ein wirtschaftlich,<br />
geistig und künstlerisch hochstehendes<br />
Kulturland gemacht haben.<br />
Bernhard Grueber findet für diese<br />
Tatsachen die schönen Worte: „Das<br />
Wappen der Herren von Rosenberg<br />
ist das stolzeste Banner, das je über<br />
der böhmischen Erde geweht hat.<br />
Dieses reiche und mächtige Geschlecht<br />
verdunkelte durch seinen<br />
Glanz häufig die Landesfürsten, verstand<br />
aber auch, seine hohe Stellung<br />
in würdevoller Weise zu gebrauchen und alle Regentenpflichten zu üben. Unter<br />
allen Adelsfamilien zeichnen sich die Rosenberger durch Kunstliebe aus, sie waren<br />
es, welche den Süden Böhmens kultivierten und späterhin selbst mit dem<br />
glorreichen Kaiser Karl IV. in Bezug auf Kunsttätigkeit wetteiferten.“<br />
Stift Hohenfurt: Klosterkirche -<br />
Grabstein des letzten Herrn von<br />
Rosenberg
74<br />
75<br />
Khriegsvolgck, so Ires berichts Im Bistumb Passau Ligen solle, etwann auf<br />
unnserer Straßen, Zu euch In Behem (Böhmen) khommen, Mögen auch derhalben<br />
hierauf In Anntwortt, verthreulicher guetter Wollmainung nit Pergen, Das unns<br />
im wenigisten nichts bewusst, noch auch unns Im geringisten befürchten, Das<br />
von Khriegs Volgkh, weder zu Roß, noch Fueß, etwas über unnser Straßen<br />
khommen, sonnder Gennzlich (gänzlich) dafür halten, die Herrn, unnd vorderiß<br />
die Löbl. E (-Kammer) von Behemb, disfalls woll versichert sein werden,<br />
Dannenhero auch der unzweifflich Nachberlichen Zuversicht seindt, Sy (sie)<br />
werden Zve (zwei) Straßen noch allerdings wie bißhero offen: dadurch den<br />
Commercien Iren freyen ganng (Gang) lassen, unnd sowoll mit dem Salz, alß<br />
sonnst mit uns guette bestenndige Correspondenz und Gegenhandlung brauchen,<br />
Inmassen dann die Sämer (Säumer) für die Glasshütten hinein ebenfalls ungehindert<br />
Passieren, unnd unnsere Straßen offen sein sollen, Gewartten (gewärtigen)<br />
demnach Irer unbeschwertten Schrifftlichen wilferigen antwortt, unnd sein Inen<br />
Zu guetter Nachparschafft woll gewogen. Datum Gravenau, den 8. Juny Anno<br />
1619. Den Herrn Dienst: und Nachberwillige Burgermaister und Rathe daselb.<br />
(Aus „Waldheimat“ April 1932)<br />
(Dem folgenden Text lässt sich entnehmen, wie umstritten über Jahrhunderte die<br />
Eisensteiner Gegend aus wirtschaftlichen Gründen war. Auch wenn die Texte des<br />
16. und 17. Jahrhunderts schwer zu lesen sind, ist doch deren Informationsgehalt,<br />
u.a. über das damalige menschliche Verhalten, sehr hoch. Am besten verseht man<br />
die Texte, wenn man sie laut liest, da die Lautung ähnlich wie heute ist, die Schreibweise<br />
jedoch große Unterschiede zeigt. (Anm. Hans))<br />
Angefangen von des Spitzberges gewaltiger Bergwand, durch die der forschende<br />
Menschengeist ein sieben Viertel Kilometer langes Riesentor geschaffen hat, um<br />
das unermüdliche pustende Dampfroß an Bayerns Grenze zu führen, bis dorthin,<br />
wo an dieser die allgütige Natur dem jugendlichen Regenbach einen Engpaß geöffnet<br />
hat, um den sonnigen Gefilden des Donautales zuzueilen, bis dort, wo der<br />
Bergkönig Arber treue Grenzwacht hält, erstreckt sich ein liebliches Hochtal,<br />
wohl würdig, als die Perle des Böhmerwaldes genannt zu werden.<br />
Der alte Grenzstreit um Eisenstein und das<br />
Eisenbergwerk<br />
Adolf Harant: Bergreichenstein, Ölbergkapelle am Flehberg<br />
(Zur Fastenzeit fanden hier „Flehprozessionen“ statt<br />
Alois Fürst<br />
Adolf Harant: Bergreichenstein, Nähe Grantlkirche
76<br />
77<br />
Gleich Ringmauern einer alten Stadt, von einem gewaltigen Schutzwall stolzer<br />
Berge umgeben, liegt es vor uns, dieses Hochtal des Friedens, von einem üppigen<br />
Wiesenteppich bedeckt durch den in der Sonne glitzernde Wasserläufe ihre<br />
Silberfäden spinnen. Majestätischer Hochwald umgürtet diese Hochburg des<br />
Friedens. Heute ist industrieller Verdienst spärlich und auch die Landwirtschaft<br />
bietet der hohen Gebirgslage wegen nur einen niederen Ertrag, deshalb kehrt<br />
auch die Armut gerne ein. Doch mit dem zunehmenden Fremdenverkehr hat<br />
Eisenstein einen neuen Lebensfaden gefunden, Handel und Gewerbe blühten auf<br />
und die Schulverhältnisse trugen den Segen der Kultur auch in diese Gegend. Da<br />
das Land Böhmen kaum einen zweiten solchen herrlichen Punkt zu verzeichnen<br />
hat, wurde auch die Aufmerksamkeit beider Reiche auf dieses Gebiet gelenkt. So<br />
fand schon im Jahre 1570 zwischen Böhmen und Bayern eine Grenzverhandlung<br />
statt, über welche ein im Prager Staatsarchiv aufbewahrter Band „Grenzverhandlungen<br />
zwischen Böhmen und Bayern 1462 bis 1637“ ausführlich berichtet.<br />
Graf Georg Guttenstein auf Riesenberg hatte vom böhmischen Könige<br />
den „Waldhwozd“, in dem die künischen Freibauern von Neuern bis Winterberg<br />
hausten, für eine gewisse Summe als Pfandgut erhalten; er erhielt auch das Gebiet<br />
von Eisenstein als dazu gehörig und hatte es im Jahre 1569 den Gewerken<br />
Konrad Geisler und Melchior Fiedler gegen einen Zins zur Anlage eines Eisenbergwerkes<br />
übergeben. Darüber regten sich die Bayern auf und es kam im Jahre<br />
später zu einer Verhandlung zwischen beiden Regierungen. Dieser ging ein Augenschein<br />
voraus. Bei diesem Augenscheine legten die beiden Gewerken ihren<br />
Stiftsbrief vor, der hier im Auszuge wiedergegeben ist. „Die Marchung des den<br />
Gewerken in Eisenpach“ zugewiesenen Raumes nahm seltsamerweise das Dorf<br />
Grün in Böhmen zum Ausgangspunkt und ging „nach dem Wasser der Angla“<br />
genannt, gegen dieHütten und von da gegen den „Zwüsüll“ und hinüber an den<br />
Berg, der „Stefanikhen“ genannt und was an diesen beiden Orten gegen die Hütten<br />
hangend ist, ist ihnen zugehörig. Weiteres werden „Pichelpach, Seepach und<br />
die Seewand“ als Grenzen des „Gebites“ genannt, das sich von der Hütten „zirkelweis<br />
gut eine halbe Meil in die Länge und Breiten“ erstrecken sollte. „Und in<br />
dieser angezeigten Marchung und Revier sollen sie Macht haben, nach dem<br />
Bergwerck des Eisensteins und anderer Metale zu suchen und dieselben zu pauen;<br />
ob sich Gold oder Silber erfände, daß es allweg der Röm. Kais. Majestät Bergordnung<br />
und Freiheiten der Cron Beheimb unvergreif-lich und den Silberkauf<br />
der Kammer unnachteilig sei“. Weiter heißt es da: „Sie sollen auch die Macht<br />
haben, zur mehreren Unterhaltung des Bergwerks der Orten Mahl- und Sägemühlen<br />
aufzurichten, zu backen und zu metzgern. Und wofern sie in den nächsten<br />
vier Jahren bis anno 1573 eine Tafern aufrichten, sind sie das Zapfengeld<br />
zu geben schuldig. Und ist ihnen erlaubt, allerlei Wildbahn, ausgenommen das<br />
Rothwild, davon sollen sie dem Grafen die Gebür als des vierten Theils des<br />
Wildprets zu raichen schuldig seyn; alle Fischwaid und Wasser und dagegen<br />
jedermann verbotten, sich in diesem Bezirck das Weidwercks, Fischerey,<br />
Holzschlagen, Aschenprennen, Pechreißen u. dgl. zu enthalten“.<br />
Auch Polizeirechte wurden eingeräumt. „Sie haben auch das Recht, die so sich<br />
ungebürlich halten, zu verweisen und auszuschaffen, gefänglich, anzunehmen<br />
und wo sich solche Täter nicht von statten lassen, dem Grafen zu berichten und<br />
sie ihm zu überschicken. Und was das Malefiz und solche Täter belangend ist, ist<br />
dem Grafen die Strafe vorbehalten. Wenn das Bergwerck aufhört, so haben sie<br />
Macht, eine Glashütten dort aufzurichten, Felder und Wiesmahden zu machen<br />
und ist dem Grafen niemand mit Mannschaft unterworfen“.<br />
Sie wollten auch gerne, dass von Bayern eine Straße zu ihnen hineingemacht und<br />
auf das eheste vorgenommen werde, weil sie heraus viel lieber als Hinein die<br />
Handlung richten wollten (lieber Handel mit Bayern anstatt Innerböhmen).<br />
„Das Gewerck und den Proviant können sie von wo sie wollen, dahin bringen“.<br />
So die beiden Gewercken. Nun machten aber die Bayern ihre Ansprüche geltend:<br />
„Laut Salbuch, des Klosters Roth raicht das Gebit von Osser an übers Zwerch<br />
Egg, Roth zoll, Stangenrigel und dergleichen Gemerkt, so zunächst bei dem jetzigen<br />
Eisenpruch unterschiedliche Meldungen. Man soll sich beim Kloster Roth<br />
erkhundigen“.<br />
Er hatte die Kommission des großen Ungewitters halber die rechte Gelegenheit<br />
alle Berg, Päche und der Marchungen der Landesgrenze nicht absehen zu können,<br />
weshalb noch ein Augenschein notwendig sein wird. Vom „Zwerchegg“ behaupten<br />
die Bayern die Grenze bis zu dem öden See (Teufelssee) und zum weißen<br />
Tännling auf dem Sitzberg. Als Gewährsmänner werden wiederholt, „die<br />
Frischen in Lehperge, Köstinger Landgericht“ genannt. Herzog Ludwig von Bayern,<br />
der Vater des gegenwärtig Regierdenden habe am Stangenrigel „hinaus bis<br />
gegen den Eisenpach eine große Anzahl landknechtischen Spieß machen lassen“.<br />
„Also (so) sagen entgegen die Zwislerischen Unterthanen Jäeger und<br />
Aschenprenner auf der Glashütten bei unserer Frauen Au und andere. Was die<br />
Böhmen gethan haben, ist nur heimlich und mit Gewalt geschehen. Die Fiedler<br />
von Passau haben hin und wieder auf den Grenzen Bergwerck nachsuchen lassen.<br />
Sie haben sich bei den von Guttenstein eingeschlaipft und anhängig gemacht,<br />
dem ohnedies mit aller Wiederwärtigkheit wohl ist. Der Graf hat sich alsbald<br />
unterstandten, nach erst genommenen Augenschein eine große Anzahl seiner<br />
Unterthanen Glaser und Aschenbrenner mehr weit herein zu schicken über die<br />
Grenze der Herrschaft Zwisl, deren Marchung sie ausgehauen und zu ihrem Vorteil<br />
eingeschlagen. (Es sind da die Marchungen an Bäumen und Haftsteinen gemeint).<br />
Die auch ein Weil hin- und hergegangen und selbst nicht gewusst, wo sie<br />
eigentlich den Weg nach der rechten Grenze wieder anheim nehmen sollen.“ In<br />
einer der Kommission damals vorliegenden Karte wurde der neue „unerdenkliche<br />
Durchgang“ mit einem roten Strich bezeichnet. Guttenstein hatte den Fiedlern<br />
und ihren Hammermeister einen großen ca auf „eine Meil Wegs weit rings an<br />
die Schmelzhütten“ allerlei Freiheiten und Gerechtigkeiten gegeben. Der<br />
Hammermeister hat mit Gewalt „einen Hammer und viel Hüttlein zu seinem<br />
Gesind zu pauen allbereit angefangen. Er sterkt sich auch je länger und je mehr<br />
mit Kohlprennen und Knechten. Gleichfalls bricht er sich den Eisenst-
78<br />
79<br />
ein von Tag zu Tag immer reicher und geschlichter, vertreibt das Eisen, weil er<br />
die Eröffnung der Straße bisher gegen Bayern mit gehaben mögen, meist Teils<br />
nach Böeheim das Pfund um 1 ½ kreizer“.<br />
(Bericht des Vizevam. Heimeran Rothaft von Wernberg vom 14. oktobris 1669.)<br />
Darauf lud eine bayrische Kommission alte Männer, Aschenprenner und Glaser<br />
„aus dem Bodenmais, Lamb, und Lehperg nach Zwisl“ vor und nahm ihre Aussagen<br />
zu Papier. Sehr wertvoll ist da der nachfolgende Befund über eine Besichtigung<br />
der neuen Eisensteiner Anlagen.<br />
Der Weg von „Zwisl“ nach Eisenstein dauerte fünf Stunden. „Auf dem Weg ist<br />
kein Berg, aber große Wildniß, gmös und viel wasser Seugnen. Auch kein Weg,<br />
als was erst ein zwei Jahr her durch den Hammermeister mit Gehen und einem<br />
Saumroß gechehen.“ Der Berichterstatter brachte auch einen Kartenabriß des<br />
Gebietes bei, der bei den Akten liegt. „Zunächst an Wasser ist der Eisenstein<br />
mehr am Tag, an dem Stellen nichts als ein Wild Wasser. So bricht dieser Stein<br />
zweigestaltig, die eine weiß raue, die andere eisen- oder zunterfarb, wie an beiliegenden<br />
Handtsteinen zu sehen“.<br />
Zwischen denen hat es, wie der Hammermeister gezeigt, einen großen Unterschied.<br />
Nämlich dass der eisenfarbene Stein sich demnächst schmelzen lässt, der<br />
weise aber, welchen er anfangs für „wild und unnütz liegen lasen“, hält mehr<br />
Eisen, doch muß er ihn zuvor durch einen „plötz oder puchwerck scheiden“ und<br />
nochmals rösten, alsdann lässt er sich erst schmelzen und sieht nach dem Rösten<br />
nicht mehr weiß, sondern wie die kleinen beiliegenden Steine desselben Musters<br />
ist. So ist dieser Eisenbruch ein völlig Genügen, es sagt auch der Hammermeister,<br />
dass er sich je länger je „gescheidiger“ im Berg erzeigt, also dass er auch erhoffe,<br />
in kurzem Stahl dabei zu finden.<br />
So ist dieser Hammermeister ein junger erfahrener und seines Thuns geschickter<br />
Mann, „beheirath und haust mit seinem Weib auf der Herrschaft Tschnitz zu Adlau<br />
(Todlau) allda er ein Hammer und noch einen anderen Hammer zu Grien auch<br />
unter bemelten Herrn hat und liegt jeder von Eisenstein zwei große Meil, aber der<br />
Weg ist der Berg halber nicht so geschlacht, als bei Zwisl zu machen“.<br />
Beim Eisenbruch sind, wie sie es nennen, drei „Guckhes (Kukse-Anteile) in Werkh<br />
und ist allda jatzmal noch keim Hammer, sondern allein die Schmelzhütten, also<br />
dass der Hammermeister des Orts den Eisenstein allein zererrt (zerinnen macht)<br />
und alsdann stueffsweis zu seinem obermeltem Hammer gegen Grien und Adlau<br />
führen lässt, daselbst macht er allerlei Sorten Eisen, zain, Schin, Plöch, schaufel,<br />
Sagblatter, Büchsenrohr wie nans frimbd und hat Willen, wochentlich in die 20<br />
und 21 Centen.<br />
Solches Eisen wird meist durch die von Glatta (Klattau) in Böheimb verführt,<br />
bayrischerhalb wäre es, wenn die Straße gemacht, viel besser zu bringen. Verkauft<br />
nach dem Pfund, jedes Pfund zu 5 putschänl, so bey 6 Wej den machen.<br />
Gleicht durchaus in der Prob dem laybischen Eisen und die weil etliche von Zwisler<br />
Gätter und Wagen Eisen zuvor bestellt, hat darnach die Kommission bei den zwei<br />
Zenten mit heraus gegen Zwisl auf einen Saumroß geführt, davon jede<br />
Sorte, ein Stangen und eine Schine mit sich heraus gebracht, die man uns einer<br />
bayrischen Ellen lang gemacht dieweil dieser Zeit wegen Gehölz und Paum halber<br />
länger mit khönen auf dem saum roß überbracht werden.“.<br />
Zu dieser Zeit sind an Mannschaften zum „pruch, keln, schmöltzen und führen in<br />
die 30 Persohnen des orts sonach ihr Proviant, Inselt, Fleisch, Schmaltz und dergleichen<br />
meist Teils in Bayern zu Zwisl und ist das Geschmöltz, Plötz, Pochwerkh,<br />
Wasser, Eisenpruch und unsänglich Hochholz alles beyeinand“.<br />
Um 27. Juni 1569 hätte die Auszeigung des den Gebrüdern Fiedler verliehenen<br />
„Bezirks“ stattfinden sollen. Graf Guttenstein hatte zu dieser Tagfahrt auch die<br />
beiden auf der Verleihungsurkunde als Zeugen mitunterfertigen Herren eingeladen:<br />
Sebastian Joachim von Seeberg auf Welharitz und den jüngeren Herrn Adam<br />
von Deschenitz, er selber kam aber nicht. Die Zeugen haben „1 ½ tag auf ihn<br />
gewart und sich dann wieder heim verzogen. Vermutlich hat sich der Graf vor<br />
dem Bayrischen, von denen er gehört“, dass man da geweset, besorget.“<br />
„So liegt dieses Erz 3½ Meil von Glatta und Riesenberg, 3 Meil von Schüttenhofen.<br />
Die Wasser rinnen alle heraus nach Bayern, die gemein Regel aller Grenze und<br />
wie meist Teil aller orten ist, soll wahr sein, nämlich wie Kugel waltzt und Wasser<br />
rinnt, so ist dieses Eisenwerk eihn Mittel zu Bayern.“<br />
Bei der Erfahrung alter Personen wurde festgestellt, dass die Fiedler nicht die<br />
ersten waren, die unterm Sitzberge nach Eisen gegraben haben, „es seint auch<br />
etliche alte grüeb dabei, also dass man ohn Zweifl vor altern auch gearbeitet. Ein<br />
Pach heißt der Zörpach, so die Böeheimb den bayrischen Regen nennen, läuft<br />
noch weitrs heraus, darein rinnet der Eisenpach“.<br />
Kurz darauf ließ der Fürst von Bayern den Hammermeister verhaften und den<br />
Fiedler, Bürger von Passau, „verstricken“, auch etliche Eisenhammerwerke mit<br />
Walter Straub: Am Arbersee
80<br />
81<br />
Anmerkungen: *) Bericht des Heimatforschers Josef Blau. **) Aus „Eisensteins<br />
Vergangenheit“ v. H. Michal, B.S.10. ***) Ekr. Der Berghauptmannschaft Prag<br />
vom 13. Dezember 1010, Z. 3374/09. ****) In letzter Zeit (gemeint ist 1931)<br />
unternimmt die Firma „Prager Eisen“ wieder versuchsweise Grabungen nach Eisenerz<br />
in Dorf Eisenstein. (Anm. d. Schriftl. der Zeitschrift „Waldheimat“). (Aus<br />
„Waldheimat“ 3/1932)<br />
ihm. Damit hatte sowohl der Stritt, als auch die Eisenindustrie vorläufig ein Ende.<br />
Später nach dem Schwedenkriege nahm Graf Heinrich Rothaft von Wernber das<br />
Eisenbergwerk wieder auf. Böhmen ließ aber den Anspruch auf Eisenstein<br />
keineswegs fallen. Während des dreißigjährigen Krieges hatte eine Besichtigung<br />
und Abschätzung der kgl. Waldhwozd stattgefunden. Bei dieser wurde das<br />
Eisensteiner Gebiet „die Wälder bis an den Debernekl“ als mit Bayern strittig<br />
bezeichnet. Siebzig Jahre später aber, 1703 im spanischen Erbfolgekriege, fiel<br />
das Eisensteiner Gebiet bis zum Arber samt den Deffernicker Waldungen an Böhmen<br />
und wurde diesem im Grenzdenterierungsvertrage vom Jahre 1707 auch<br />
bayrischerseits abgetreten. Im Rastatter Friedensvertrage 1714 wurde aber bestimmt,<br />
dass das Churhaus Bayern alle vor Ausbruch des Krieges innegehabten<br />
Gebiete wieder zurückerhalten sollte. Es dauerte aber bis zum Jahre 1764, bis in<br />
dem Grenzhauptvertrage vom 3. März Bayern wenigstens einen Teil der im Kriege<br />
verlorenen und ihm nachher vorenthaltenen Gebiete zurückerhielt*).<br />
Am 20. Juli 1811 wurde vom Eisensteiner Amte beim Bergreichensteiner Schachtamte<br />
um Freifahrung früherer Betriebe und verschütteter Zechen auf den „Roten<br />
Gräben“ wiederum angesucht. Erst am 13. Juli 1826 besuchte Kommissär Franz<br />
Grimm zum Behufe der Freifahrung Eisenstein. Die Durchführung derselben erfolgte<br />
in den Jahren 1827 und 1828. Es bestanden drei Zechen: die Eisensteiner<br />
Zeche, die St. Antonie Zeche und die Hasenbrädl Zeche. Im Jahre 1840 zeigte<br />
Verwalter Ferus beim Schachtamte an, dass das Grubenfeldmaß Skt. Antoni Zeche<br />
auf den Roten Gräben in Dorf Eisenstein sehr schlechtes zum Einschmelzen<br />
nicht geeignetes Erz liefere und ersuchte um Löschung, welchem Ansuchen auch<br />
entsprochen wurde**). Doch der rastlose Menschengeist ließ aber den Eisenbergbau<br />
in dem folgenden Jahrhundert nicht ruhen. In neuester Zeit wurde von<br />
dem Bergbauunternehmer Josef Schmidt-Penitschka in Teplitz am 26. November<br />
1908 um die Verleihung von vier einfachen Grubenmaßen auf Raseneisensteine<br />
unter dem Schutznamen „Segen Gottes V-VIII“ in Dorf Eisenstein angesucht.<br />
Das Revierbergamt in Mies hat aber im Grunde des § 54 a.B.D. bei der Lokalerhebung<br />
konstatiert, dass durch den nach Nordost getriebene Stollen, der im Innern<br />
die alten Schachtgänge traf, bloß aufgeschwemmte, auf Glimmerschiefer aufruhende<br />
und mit einem Verwitterungsprodukte des Urgebirges überdeckte Raseneisensteine<br />
aufgeschlossen wurden und hat diesem Ansuchen keine Folge gegeben<br />
***). So geben nun alte Ueberreste ein stummes Zeugnis von dem erfolglosen<br />
Erwerbfleiße der Vorfahren****).<br />
Die alte böhmische Herrschaft Winterberg grenzte in der Gegend des heutigen<br />
Marktes Kuschwarda in einer offenen Senke an das Hochstift Passau, durch die<br />
auch der Goldene Steig von Passau über Freyung nach Winterberg seinen Umweg<br />
nahm. Hier lebten die Passauer mit den Winterbergern „immer und immer in<br />
Unnachtbarkeit“, da das Land offen und das Wagenwasser als Grenzlinie lange<br />
nicht genau festgesetzt war. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts saßen auf<br />
der Herrschaft Winterberg die Herren Mallowetz von Chejnow, die in dieser Grenzgegend,<br />
welche durch die alte „Königswarte“ geschirmt wurde, großartige Meiereien<br />
und einen ausgedehnten Fischteich angelegt hatten. Solange diese Herren<br />
auf Winterberg saßen, hörten die Grenzstreitigkeiten, an denen wohl beide Teile<br />
gleich schuld waren, nicht auf. Der passauische Hofkammerrat Adeling de<br />
Arnoldstein schreibt im Jahre 1735, als es sich darum handelte, „eine Haubt-<br />
Wagen-Straßen an statt des alten Sämer-Steig“ zu bauen, in seinem Gutachten 1) ,<br />
dass er „einen ganzen Cumulum solcher Historietlen auf die Bahn bringen und<br />
mit voluminosen Acten beweisen könnte“. Von Peter Mallowetz, der von 1531<br />
Ein passauisch-böhmischer Grenzstreit im 16.<br />
Jahrhundert<br />
Dr. Rudolf Kubitschek<br />
Walter Straub: Kieslingbach
82<br />
83<br />
bis 1547 auf Winterberg saß, erzählt er, dass er „öfters das Hoch-Stiftische Territorium<br />
violenter infestiert, seine Gränitzen weithers herein über das sogenannte<br />
Wagen-Wasser zu erweitern gesucht, das Gränitz-Brückel über bemeltes Wagen-<br />
Wasser von diesem obg. Malowetz ein- und andermal zerhackt, ja auch<br />
hereinwerths im Hochstiftlichen Terrain der so genannte Liechtenberg etlichmal<br />
Gewalthätig praetentiert, nicht weniger die noch weithers herein ab 1 ½ Stund<br />
liegende so nominierte Bayrische-Rinne violenter durch seine Jäger, und Leüthe<br />
zerhacket worden, nur um dadurch sein Vermeint-Gränitz und Jurisdiction hereinzuziehen“.<br />
Weiter erzählt er von der Erschießung eines „armen Hoch Stiftisch<br />
Unterthan Nahmens Michael Schneider, der in der Gegend am Schwartz-Wasser<br />
sein Bestand-Fischwässerl ² ) nützen und fischen wolte“ und erwähnt mehrere<br />
solche „Gewalts-Historietlen, so er mit arrestier- und Wegführung der doch im<br />
Hochstiftischen Terrain arbeitenden Unterthanen, als Tellermacher, Aschenbrenner,<br />
und mehr andere dergleichen Leütte exercierte, selbige, wie auch einen Hochstiftischen<br />
Unterthan mit 2 Ochsen aus dem Waagen gespannt, und vom Hochstiftischen<br />
Terrain nacher Winterberg gefänglich geführt, auch endlich aldort excessiv-<br />
Böhmisch gestraft“. Die Passauer griffen jedes Mal auch zu Gegenmaßregeln,<br />
„Repressalien, und zwar einsmals so gar armata Manu (bewaffnet) durch den<br />
damaligen Commandanten mit etlich 40 Mann zu Pferd, die Hochstiftische Jura<br />
defendiren, und Gewalt mit Gewalt begegnen“, und von einem solchen gewaltsamen<br />
Einfall, wenn es nicht überhaupt der Einfall ist, den Arnoldstein erwähnt,<br />
soll im folgenden die Rede sein.<br />
Im Jahre 1547 war Peter von Mallowetz wegen seiner Beteiligung am Aufstande,<br />
der in Böhmen zur Zeit der Schlacht bei Mühlberg gegen den Landesherrn<br />
Ferdinand, Erzherzog von Oesterreich und König von Böhmen und Ungarn ausbrach,<br />
seiner Güter verlustig erklärt worden; die Herrschaft Winterberg behielt<br />
der Landesherr einige Zeit und veräußerte sie im Jahre 1553 an Joachim von<br />
Neuhaus, von dem sie 1554 an die Herren von Rosenberg, die mächtigsten Grundherren<br />
im südlichen Böhmen, kam. In diese Jahre fällt der Einfall Ulrich Tenglers,<br />
des bischöflich, passauischen Hauptmannes von Wolfstein ³). In einem tschechischen<br />
Schreiben 4 ) vom 9. Juli 1548 berichtet der Verweser der Hauptmannschaft<br />
zu Winterberg, Kaspar Aichhorn von Reichenbach, dem Erzherzog Ferdinand,<br />
dem Sohn des Königs und Gemahl der Philippine Welser, der damals böhmische<br />
Statthalter war, dass sich eine große Anzahl von Deutschen, die unter dem bischöflich<br />
passauischen Beamten auf Wolfstein, Ulrich Tengler, stehen, an der<br />
Grenze sammelten, Feuer machten und schossen, Holz niederschlugen und niederbrannten,<br />
ihr Vieh weideten und so auf die königlichen Gründe, die früher<br />
dem Peter Mallowetz gehört hatten, mehr als zwei Meilen weit einfielen, auch<br />
etliche Bäche sich aneigneten, was sie nicht hatten tun dürfen, wie sich viele<br />
Leute erinnern. Diesen Bericht sandte der Erzherzog mit dem folgenden ausführlichen<br />
Schreiben 5 ) vom 16. Oktober, das in einem Entwurfe erhalten ist, an den<br />
König: „Allergnedigster liebster Herr und Vater. Welichermaßen E: Kh: M: Hauptmann<br />
auf Winterberg Kaspar Aichhorn E: M: (E.M. = Eure<br />
Majestät) Eure verordneter Chamer-Rath alhier über Ulrich Tengler des Bischofs<br />
zu Passau Haubtmann zu Wolfstain, umb das Er etlichen E: M: underthanen und<br />
Gewerbßleuten zwai und zwainzig Pferde sambt den waaren, und sechs personen<br />
darbei, aus Ursachen, das Er Aichhorn zween des Bischofs undthanen, die mit<br />
Fischen und anderen auf E: M: grundten gen Winterberg gehörig, Schaden gethan,<br />
ergreiffen und annemen lassen mit gewerter Handt, eingezogen und die sechs<br />
personen in Fenthnuß gelegt, schreiben und slagen thuet. Der wegen E: Kh: M:<br />
auß beigelegten des Aichors Behmischen schreiben, so Ich auch verdeutschen<br />
lassen, mers Inhalt gnedist vernemen. Dieweil dann Soliches nit ain geringe sach<br />
betreffen will, daraus auch, wo solicher muetwill gestattet oder zugelassen, E:<br />
Kh: M: und derselben undtahnen nit wenig schaden und nachtail, fürnemblich<br />
weil gedacht Tengler noch heutigs tags mit andhalbhundt gewappneter leut, wie<br />
Er Aichhorn schreibt, an der graniz liegt und E: M: und derselben undt ahnen<br />
schaden zuezufügen dron thuet, erwachsen wurde und der obgedacht Bischoff zu<br />
Passau, wie ich bericht (bin) jetzig zeit auf E: M: thuniglichen Hoff sein sall. So<br />
were demnach mein gehorsamstes zubedenkhen, E: M: hetten soliche Sach<br />
gemelten Bischoff von Passau mit ehisten fürhalten zue und daneben ernstlich<br />
bevelchen und auferlegen lassen, bei seinen Haubtmann Ulrichen Tengler darob<br />
zu sein und zu verfuegen, damit Er nit allein die armen leut, die Er also unschuldiger<br />
weiß derhalben fenglich eingelegt, wiederumben ledig laß, sondern Ihnen<br />
auch das Jenig, so Er Ihnen in solichen Uberfall von Rossen und anderen<br />
unbefueget sachen entfremddet, wiederum zuerstellen und sich hinfür solches<br />
Adolf Harant:<br />
Bamberg, an der<br />
oberen Regnitzbrücke
84<br />
85<br />
und dergleichen muetwillens und frewels bei auf gelegter ven (pvena) oder straff<br />
massen und enthalten thue, wiewol Ich obgededachten E: M: Haubtmann auß<br />
Winterberg zuegelassen, wie sich Er Tengler etwas mer dergleichen understehn<br />
wellt, sich gewalts zu weren. Soliches hab E: K: M: Ich, auf obgedachtes E: M:<br />
Haubtmannes zu Winterberg schreiben und berichte in gehorsamst anzuzaigen<br />
nit undlassen mugen und thue ich (u.s.w. Zeichen) den 16. Octobris Anno Domini<br />
48“.<br />
Wie der Streit ausgegangen ist wissen wir nicht. Jedenfalls schlief die Sache nicht<br />
sobald ein. Noch zum Jahre 1558, also zehn Jahre später, als die Rosenberger<br />
schon auf Winterberg saßen, überliefert uns der tschechische Chronist der letzten<br />
Rosenberger, Wenzel Brezan, einen Bericht über einen anderen Einfall Ulrich<br />
Tengler. Der Bericht 6 ) lautet deutsch: „Der Winterberger Beamte Johann Czerny<br />
(von Kinof) geriet mit den Deutschen in Zwist wegen eines Landstreifens, als sie<br />
viele Meilen nach Böhmen übergriffen. Ein gewisser Tengler, Beamter des Bischof<br />
von Passau auf Wolfstein in der Nähe Böhmens, ließ über den Bach<br />
„Bagenwasser“ 7 ) eine Brücke bauen und auch eine Viehtränke oder einen Born<br />
hinsetzten, was der Winterberger Beamte weghauen und zerstören ließ und dafür<br />
eine andere Brücke hinbaute, da sich die Deutschen dort neue Grenzen setzen<br />
wollten, um dann auf Herrschaftsgrunde und böhmischem Boden nach ihrem<br />
Gutdünken Fische zu fangen und Wild zu jagen. Der erwähnte Ulrich Tengler<br />
ließ hinter dem Fischteiche auf der Wolfau 8 ) bei einigen Bächen auf den Gründen<br />
des Herrn zuvor einen Galgen aufrichten, alles den Böhmen zur Schmach.<br />
Ueber diese Vorfälle berichtete der Herr Regiernde des Hauses dem Könige, dass<br />
diese Dinge nicht nur ihn, sondern auch das böhmische Königreich angingen.<br />
Darauf befahl der König beiden Parteien bis zur Verfügung der Kommission Frieden<br />
zu halten. Da aber die vom Winde angebrochenen Stege sich unter der Last<br />
der Tragtiere beugten, ließ sie der Winterberger Beamte bis zum „Windewasser“<br />
9 ) wegräumen, damit sie die Tragtiere hinüber treiben könnten.“<br />
Auch im 17. und 18. Jahrhundert ist es in diesem Landstriche zu größeren „Grenzirrungen“<br />
gekommen, wie eine Unmenge Akten in Prager Archiven zu berichten<br />
wissen.<br />
Lehthäuser, Die Goldenen Steige im ehemaligen Fürstbistume Passau, 43. Band<br />
der B.D.H.B.f. Niederbayern.<br />
Anmerkungen: 1)Bstand: Pacht. 2)Wolfstein: Freyung. 3) Alte Akten der Herrschaft<br />
Winterberg im Archiv des Ministeriums des Innern der Tschechoslowakischen<br />
Republik. 4) Grenz. Lit. D.n. 316 im genannten Archive. 4) Zivot Bilema z<br />
Rosenberka, Seite 127, 128. 5) Wagenwasser. 6) „na wlcim poli“, gelegen unter<br />
der „Königswarte“; ein Bach heißt hier heute noch Wolfanbach. 7) In einer tschechischen<br />
Urkunde der böhmischen Landtafel vom Jahre 1531 (gedruckt bei Mares,<br />
Feske sklo, Seite 160) heißt es: „Bach Windischwosser, der zwischen Bayern und<br />
Böhmen die Grenze bildet“, ist also nur ein anderer Name für Wagenwasser. (Aus<br />
„Waldheimat“ Mai 1931)<br />
Willi Fischer: Eule<br />
Willi Fischer, Kulturpreisträger der<br />
Stadt Passau 2003<br />
Willi Fischer: Chor
86<br />
87<br />
Unsere Grenzbevölkerung lebte früher selten in gutem Einvernehmen mit den<br />
bayrischen Nachbarn. Das ganze 15. Jahrhundert, die Zeit der Hussitenkriege, ist<br />
für die böhmisch-bayrischen Grenzbewohner eine lange Kette gegenseitiger Einfälle<br />
und Raub- und Rachezüge, denen vor allem viel Vieh zum Opfer fiel; dabei<br />
wurden aber auch die meisten Höfe und Dörfer längs der Grenze in Asche gelegt<br />
und heute noch erinnern die Namen mancher Oedungen an die einst hier blühenden<br />
Orte, die dann nicht mehr besiedelt und aufgebaut worden sind. Auch später<br />
waren zu dem ewigen Unfrieden die politischen Ereignisse, in denen Bayern gewöhnlich<br />
auf Seite der Feinde Oesterreichs stand, die Ursache. Zu Beginn des 17.<br />
Jahrhunderts war unsere Bevölkerung größtenteils protestantisch; und wie schon<br />
früher, in der Hussitenzeit, hatten sich die bayrischen Nachbarn auch da wieder<br />
große Mühe gegeben, die ketzerischen Böhmen „katholisch“ zu machen; im spanischen<br />
Erbfolgekriege loderte die Kriegsfackel an unserer Grenze auf; in und<br />
nach diesem Kriege nahm Oesterreich den Bayern mehrere Dörfer weg, die<br />
teilweise heute noch zu Böhmen gehören. Das waren die Ortschaften Eisenstein,<br />
Sternhof, Heuhof, Hofberg, Jägersdorf, Bollmau und Grafenried. Erst Maria<br />
Theresia gab im Grenzvertrage vom Jahre 1765 das heutige Bayrisch-Eisenstein<br />
mit dem Arber, dann Hofberg und Jägershof zurück.<br />
In den Franzosenkriegen stieg die Feindschaft aufs höchste. Der österreichische<br />
Heeresteil, der von der unglücklichen Schlacht bei Regensburg her 1809 in ungeordneten<br />
Haufen hinter unsere Grenze floh, entfachte durch sein feindseliges<br />
Verhalten die bitterste Rachsucht in den Herzen der ohnedies durch den Sieg der<br />
französischen Macht ermutigten bayrischen Landbewohner. Diese beschlossen<br />
zur Vergeltung einen Raubzug nach Böhmen. Der ganze Grenzbezirk bis weit<br />
hinter Kötzting rüstete sich dazu. Unsere Landsleute erfuhren aber bald von diesen<br />
Vorbereitungen, die mit großem Geschrei betrieben wurden. Sie verschafften<br />
sich mit großer Mühe und im Geheimen aus Klattau militärische Hilfe. Es kamen<br />
vier Husaren und zwölf Jäger. Der Jüngling Georg Mayer in Flecken, der spätere<br />
Schreiber einer Bauernchronik, wurde nach Neukirchen geschickt, um den Tag<br />
des Einfalls auszukundschaften. In einem Gasthause zu Neukirchen beim hl. Blut,<br />
jetzt heißt es dort „beim Moreth“, erfuhr er alles, was er wissen wollte. Die Jäger<br />
wurden am Vortage des Einfalles in der „Klausen“ bei Kohlheim, die Husaren in<br />
dem der bayrischen Grenze zunächst gelegenen Hofe „Oberhütten“ gegenüber<br />
dem Hangerberge untergebracht. Da bekamen sie von den Bauern viel zu trinken,<br />
besonders Schnaps und sie tranken, bis sie umfielen. Am andern Tage stellte<br />
sich ein Husar im sogenannten „Hüttenwaldl“ am Fuße des Hangerberges<br />
auf. Und da zogen die Bayern schon heran. An ihrer Spitze ritt auf<br />
einem Schimmel der Marktschreiber von Neukirchen; der Haufen kam zu Fuß<br />
nachgezogen mit Hellebarden, alten Degen, Gewehren, Sensen und so weiter<br />
bewaffnet. Sie führten Säcke und Wagen mit, um die Beute einfassen und fortbringen<br />
zu können. Der Zug bestand aus mehr als hundert Mann. Statt nun die<br />
anderen Husaren zu verständigen, von denen ein Mann in der Klausen um die<br />
Jäger reiten sollte, setzte sich der noch berauschte Husar aufs Pferd und ritt gemütlich<br />
den Bayern entgegen. Der Marktschreiber schoß auf ihn. Da wandte der<br />
Husar sein Pferd zur Flucht und machte wunderliche Kapriolen, so dass die Bayern,<br />
in der Meinung, ihr Führer habe ihn getroffen, in die Hände klatschten und<br />
vor Freude einen Heidenlärm machten. Nun erst holte der Husar seine Kameraden<br />
herbei und diese feuerten jetzt aus dem Hüttenwalde auf die Bayern, so dass<br />
diese glaubten, es mit einer größeren Macht zu tun zu haben. Bald wandten sie<br />
sich zur Flucht. Der eine Husar jagte den Marktschreiber in einen Sumpf, wo der<br />
Schimmel stecken blieb; dann spaltete er dem Reiter den Schädel. Ein anderer<br />
verfolgte den Langerbauern von Warzenried bis nach Rittsteig. Als der Verfolgte<br />
nimmer aus noch ein wusste, kroch er auf einen Saustall; der Husar hieb ihm aber<br />
noch die eine Hinterbacke weg. Ein Husar fand bei der Verfolgung den Tod. Ein<br />
Bauer hatte ihn kniefällig um Schonung seines Lebens gebeten. Der gute Kerl<br />
erbarmte sich seiner, der Bauer aber schoß ihn darauf rücklings vom Pferde<br />
herunter. Der Husar wurde dann bei der Leonhardikirche zu Kohlheim begraben.<br />
Eines Mannes Rede — Hören wir nun auch, was der andere Teil sagt!<br />
Das Gedenkbuch des Franziskanerklosters von Neukirchen b.hl. Blut vermerkt<br />
über diesen Fall Folgendes: „Das Treffen bei Rittsteig (1809).<br />
Der Pfleger von Walser in Furth, der Pfleger von Straßmayer in Kötzting, der<br />
Pfleger von Kuzer in Neukirchen besetzten mit einer Anzahl von 500 Mann,<br />
worunter auch waffenfähige Bürger waren, eine Bastei vor Rittsteig, um einen<br />
Einfall der Husaren, die im benachbarten böhmischen Dorfe Kohlheim sich befanden,<br />
abzuhalten. Es waren auch zwei Leutnants vom Infanterieregiment Kurfürst<br />
zugegen, welche die Leute instruieren sollten; aber die einen stürmten auf<br />
gut Glück vor, ohne sich um irgend jemand zu kümmern, während den andern<br />
überhaupt bei der Sache nicht recht wohl war und sich schon vor dem Angriff in<br />
Sicherheit zu bringen suchten; der dritte Teil hielt dem Angriff der 30 Husaren<br />
anfangs zwar stand, als diese mit hochgeschwungenen Säbeln auf die Landesverteidiger<br />
losstürmten. Es fielen von diesen elf Mann, darunter vier aus<br />
Neukrichen. Auf böhmischer Seite die treue Ueberlieferung, auf bayrischer Seite<br />
das Klostergedenkbuch, zwei scheinbar verlässliche Quellen; wo ist die Wahrheit?<br />
So möchte man fragen, wie einst Pontius Pilatus.<br />
Von da an traten ruhigere Verhältnisse ein. Die <strong>Böhmerwäldler</strong> und die Waldbayern<br />
lernten sich mit zunehmender Volksbildung als Angehörige des gleichen<br />
Stammes und Volkes erkennen und die Zerwürfnisse zwischen ihnen, die übrigens<br />
nur von der Herrscherpolitik ausgegangen waren, sind heute dem Volke nicht<br />
mehr als bloße geschichtliche Erinnerungen. (Aus „Waldheimat“ Sep. 1930)<br />
Der letzte Bayerneinfall nach Böhmen<br />
Josef Blau
88<br />
89<br />
Im Jahre 1843, also fünf Jahre vor Aufhebung der Robot, hat das Direktorialamt<br />
Winterberg für die Herrschaft Winterberg, die heutigen Gerichtsbezirke Winterberg<br />
und Prachatitz, folgende Nachtwache-Verordnung erlassen, von der ein Original<br />
im Gemeindeamte Obermoldau erliegt: Das Amt hat mir Missfallen wahrgenommen,<br />
dass 1. die gesetzlichen Nachtwachen entweder gar nicht, oder sehr<br />
unordentlich gehalten, insbesondere<br />
2. die sittlich christkatholische Aufführung von Jahr zu Jahr schlechter wird, und<br />
wenn es so fortgeht, zuletzt mehr uneheliche als eheliche Kinder sein werden.<br />
Zur ersteren Hinsicht haben daher alle Richter und Geschworenen in ihren Gemeinden<br />
bekannt zu geben und darauf zu sehen, dass die Nachtwachen sowohl<br />
von den Bauern, als von den Inleuten, und zwar: a. von Michaelis bis Ostern von<br />
9 Uhr nachts bis 4 Uhr früh, und 6. von Ostern bis Michaelis von 10 Uhr nachts<br />
bis 3 Uhr früh gehalten werden, und es die gesetzliche Schuldigkeit dieser reiheweisen<br />
Nachtwächter ist, immer in und um den Ort herumzugehen und ohne<br />
Unterlaß auf schlechte Leute und Feuer achtzugeben. Die Wächter dürfen sich<br />
nicht unterfangen, sich im Wirtshause oder sonst in einer Stube aufzuhalten, alle<br />
nur einigermaßen verdächtigen Leute, und auch solche aus dem Orte und der<br />
Umgebung, welche nur heimliche Zusammenkünfte, um Unzucht zu treiben, suchen<br />
und halten wollen, sind anzuhalten und zur Untersuchung und Befragung<br />
an das Amt einzuliefern. Sollten einzelne oder gar mehrere in einer Bande vereinigten<br />
Diebe entdeckt werden, so müssen selbe mit Vorsicht eingefangen und<br />
gebunden, geschlossen eingeliefert werden. Sollten sich die Wächter nicht stark<br />
genug fühlen, derlei Diebsbanden überwältigen zu können, so haben sie mit Vermeidung<br />
eines jeden Lärms, damit sie nicht die Flucht nehmen, die nächstgelegenen<br />
Nachbarn zur Hülfe aufzufordern, welche jeder sogleich zu leisten habe. Sobald<br />
ferner die Wächter nur durch den Geruch, Rauch oder auch sonst auf was immer<br />
für Weise Feuer besorgen, so müssen sie gleich der Ursache nachspüren, und um<br />
so mehr bei einem wirklich ausbrechenden Feuer durch rufen, Blasen mit dem<br />
Horn, dann Anschlagen an die Fenster und Türen, die Einwohner wecken und mit<br />
den Ortsglocken stürmen. Diese Nachtwachen sowie das Anhalten aller ausweislosen<br />
Menschen ohne Unterschied ist bei der gegenwärtigen Zeit umso notwendiger,<br />
da in der Umgebung schon mehrere Diebstähle, Raubanfälle, ja schon auch<br />
ein Raubmord geschehen, und Feuer-Anlegen versucht worden ist. Jeder Richter<br />
und Dorfgeschworener hat sich wegen der richtigen Anhaltung der Nachtwachen<br />
persönlich zu überzeugen und die Unfolgsamen unter Jurament und eigener schweren<br />
Bestrafung dem Amte sogleich namentlich anzuzeigen, damit sie mit aller<br />
Strenge der gesetzlichen Bestrafung unterzogen werden können.<br />
3) Nach unserer heiligen Religion und den kaiserlichen Gesetzen haben diejenigen<br />
Eltern und Dienstherrn schwere, zeitliche und ewige Strafen zu erwarten,<br />
welche ihre Kinder und Dienstboten vor einem unzüchtigen Lebenswandel nicht<br />
bewahren, im Gegenteile denselben dazu durch die Gestattung ihrer Schlafstellen<br />
in nicht abgesonderten Gemächern, Stallungen, Scheuern und Böden, durch allzufreien<br />
Umgang Gelegenheit geben, ihnen den Besuch der Tanzhäuser und<br />
„Rockenras“ ohne Aufsicht erlauben, sie vom sogenannten Staudenköder nicht<br />
abhalten, und sich überhaupt um die christliche Aufführung ihrer Untergebenen<br />
und Hausleute nicht bekümmern. Nach dem Dienstboten-Patent dürfen sich nicht<br />
einmal die Knechte und Mädchen ohne Vorwissen ihres Herrn vom Hause entfernen,<br />
und müssen bei erhaltener Erlaubnis zur bestimmten Stunde wieder zu Hause<br />
sein, und diejenigen, welche den Dienstboten zur Ausschweifung, Diebereien<br />
oder Veruntreuungen Gelegenheit geben, müssen den Schaden vollkommen ersetzen,<br />
und sind noch außerdem mit Arresten, empfindlichen Hiebesstrafen zu<br />
züchtigen, und nach Beschaffenheit der Umstände dem Halsgerichte zu übergeben.<br />
Noch größere Pflichten liegen den Eltern bezüglich ihrer Kinder ob, wenn<br />
sie sich vor dem Anklagen beim Jüngsten Gericht und vor der ewigen Verdammnis<br />
Gottes bewahren wollen. Es kann daher euch Richtern und Geschworenen<br />
nicht genug ans Herz gelegt werden, eure Gemeindemitglieder dazu zu verhalten,<br />
dass sie einmal anfangen, auf Zucht und Ordnung zu sehen. Das Amt wird<br />
euch bereitwillig gegen unfolgsame Kinder und Dienstboten die Hand reichen,<br />
und nur an euch und allen Hausvätern wird die Schuld liegen, wenn die ohnehin<br />
schon so tief eingerisse Unzucht sich noch weiter ausbreiten wollte. Alle Dienstboten,<br />
Dienstherren, Eltern und Kinder, welche diese Aufträge nicht befolgen,<br />
habt ihr gleichfalls unter eurem Eid, dem hochwürdigen Herrn Pfarrer und zugleich<br />
auch dem Amte anzuzeigen, und niemanden zu schonen, wenn ihr nicht fremder<br />
Sünden teilhaftig werden wollt. Insbesondere aber habt ihr bekannt zu machen,<br />
dass jeder Vater eines unehelichen Kindes die nämlichen Pflichten wie ein ehelicher<br />
Vater hat, folglich das uneheliche Kind gleichfalls zu ernähren, erziehen;<br />
und jeder Vormund nach dem beim Amte abgegebenen Handschlage verpflichtet<br />
ist, alle unehelichen Väter dazu zu verhalten. Einem solchen unehelichen Vater,<br />
welcher ärger als ein Tier sein Kind nicht anerkennt, und verstoßet und die gesetzliche<br />
Vaterpflicht nicht erfüllt, kann alles bis auf das letzte Scheikl und Hemd<br />
abgenommen und verkauft und selbst den Knechten ihr Lohn mit Beschlag und<br />
Verbot belegt werden. Ihr habt daher alle Vormünder anzuweisen, dass sie ohne<br />
allen Verzug die unehelichen Väter zur Erfüllung dieser Pflichten klagbar verhalten,<br />
und auf diese Art zur Verhütung der Unzucht mitwirken. Gegenwärtige<br />
Kurrenda hat jeder Richter vom Gerichtsschreiber abschreiben zu lassen und solche<br />
in jeder Gemeinde vor allen versammelten Hauswirten, Inleuten, dann Dienstboten<br />
und erwachsenen Kindern zu publizieren. Direktorialamt Winterberg, am<br />
13. April 1843 Hauptmann.<br />
(Aus „Waldheimat“ 4./1933)<br />
Eine Nachtwache-Verordnung vom Jahre 1843<br />
N.N.
90<br />
91<br />
Erwartungsvoll langten wir am Ziel unserer Wanderung in Schwarzbach an, um<br />
das weltberühmte Graphitbergwerk zu besichtigen. Wir schritten über schwarzglänzenden,<br />
schlüpfrigen Boden an vielen Gebäuden vorbei zu einem langgestreckten<br />
Bau mit turmartigem Aufsatz, dem Förderhaus. Als wir den oberen<br />
Stock des Turms erreicht hatten, standen wir vor zwei schwarzen Löchern im<br />
Boden, in deren Mitte je ein Drahtseil hängt. Es ist der Schacht. Ein Glockenzeichen<br />
ertönt und die Förderschale mit einem Wägelchen (»Hunt«) voll Graphit<br />
steigt empor. Im Nu hat es ein Bergmann herausgerissen und zu einem Schienenstrang<br />
geführt, auf dem der Graphit zur Halde befördert wird, wo er liegen bleibt,<br />
bis er verwittert. Ein anderer Mann schiebt einen leeren Hunt auf die freie<br />
Förderschale. Wieder ein Glockenzeichen und er verschwindet in der Tiefe. Nun<br />
erscheint auf der anderen Seite die Förderschale mit einem Hunt. Und so geht es<br />
fort, Tag und Nacht. Jetzt legen wir in einem Nebenraume graphitglänzende<br />
Grubenkittel an und bekommen eine Lampe, denn wir dürfen „einfahren“. Wir<br />
besteigen die Förderschale, die langsam in die Tiefe sinkt. Das Tageslicht verschwindet.<br />
Nun zeigt uns der Steiger den Aufbau des Geländes. Die oberste Schichte<br />
besteht aus Torf, darunter liegt Lehm oder Sand. dann folgt Kalk und Gneis.<br />
Zwischen den Gneisschichten ist die linsenförmige Masse des Graphits eingelagert,<br />
deren Mächtigkeit (Dicke) bis 10 und 20 m beträgt. Da wird ein beleuchteter<br />
Hohlraum sichtbar, von dem Gänge zur Graphitlinse führen. Es ist ein „Füllort“.<br />
Wir sind beim ersten „Lauf“ oder „Horizont“; 12 15 m tiefer liegt der zweite<br />
Lauf u. s. f. Plötzlich ein leichter Aufschlag, wir fühlen wieder festen Boden<br />
unter den Füßen und sind beim 7. Horizonte angelangt, fast 100 m unter der Erde.<br />
Wir Schreiten auf schlüpfrigem Bretterboden, unter dem Wasser rieselt, durch<br />
eine gemauerte Strecke in eine große Halle zur „Wasser-haltungsmaschine“. Das<br />
Grubenwasser ist der größte Feind des Graphitbergbaus. Es wird an der tiefsten<br />
Stelle (im Sumpf) gesammelt und von hier durch ein Pumpwerk obertags gehoben.<br />
Gegenwärtig stehen alle Schächte bis auf einen unter Wasser. Zu dessen<br />
Ableitung wird ein 7 km langer Stollen von Höritz aus unter den tiefsten Schacht<br />
getrieben. Wir kehren zum Füllort zurück, um durch einen mit Balken und Brettern<br />
ausgekleideten Gang zum Graphitlager zu gelangen. Hier „am Ort“ hauen<br />
zwei Bergleute mit Spitz und Berghaue das wertvolle Mineral heraus, das andere<br />
Arbeiter auf Hunten zum Füllort schaffen, wo diese in die Förderschale geschoben<br />
und aufgezogen werden. Als wir die finstere, unheimlich stille Grube verlassen<br />
hatten, führte uns der Steiger in die „Kutterschule“, d. i. eine Halle mit Tischen,<br />
an denen die Lehrlinge, die wie kleine schwarze Teufel aussehen, die Beistiftgraphite<br />
sichten, die dann getrocknet und<br />
Führungsstab des Fürst zu Schwarzenberg gehörendes Graphitwerkes<br />
in Schwarzbach, Kreis Krummau an der Moldau, Böhmerwald. Auf diesem<br />
Foto stellen sich folgende Herren vor (von links nach rechts): Erste<br />
Reihe: H. Proll, Kanzleibeamter; H. Wirbsky, Obersteiger; H. Dr. Walter<br />
Lex, Betriebsleiter; ein Bergrat aus Frauenberg, Name unbekannt; H.<br />
Mikschl, Kanzleibeamter; H. Hable, Obersteiger; Zweite Reihe: H. Josef<br />
Wotawa, Elektrowerkmeister; H. Miesauer, Obersteiger, junger Herr, Name<br />
unbekannt, er war Markscheider (Vermessungstechniker); H. Tutschek,<br />
Kanzleibeamter; H. Gabriel, Obersteiger. Dritte Reihe: H. Rudolf Köpl,<br />
Kanzleibeamter, H. Bednarsch, Maschinenmeister; Rudolf Hartl, Obersteiger;<br />
H. Köpl, Expedient; H. Bednarsch, Mechanik Werkmeister, Sohn des<br />
Maschinenmeisters Bednarsch<br />
Das Graphitbergwerk in Schwarzbach<br />
Vinzenz Schoeps<br />
in Fässer geschüttet werden. Hierauf lernten wir die Aufbereitung des<br />
Raffinadgraphits kennen, der für Gießereien unentbehrlich ist. Der Rohgraphit<br />
wird zerkleinert, mit Wasser gemengt und kommt sodann in Setzkästen, wo das<br />
schwere Material sich absetzt, das leichtere aber in andere, größere Wasserbecken<br />
abfließt. Der Graphitschlamm wird in die Presse gepumpt, aus der die Graphitziegel<br />
herausgenommen und im Trockenhaus getrocknet werden. Zuletzt besuchten<br />
wir die Graphitmühle, wo der schuppenförmige, blättrige Flinsgraphit, der zur<br />
Schmelztiegelerzeugung dient, gemahlen wird. Mit Staunen betrachten wir den<br />
Vorgang. An 5000 Siebe, von den größten bis zu den kleinsten, von verwirrender<br />
Mannigfaltigkeit, klappern durcheinander und rütteln das schwarze Mehl so lange,<br />
bis der reine Flins den letzten Siebgang verlässt. 100 kg Rohgraphit liefern<br />
nur 5 kg Flinsgraphit. (Zusendung Grete Rankl)
92<br />
93<br />
Hier schreibe ich nieder, was ich aus Erzählungen meiner Mutter weiß.<br />
Es war im September Oktober 1938. Die Tschechen machten mobil. Sie errichteten<br />
längs der Grenze gegen Deutschland eine Bunkerkette und stellten das ganze<br />
Gebiet unter strenge militärische Bewachung. Burschen und Männer aus unserer<br />
Heimat, die in den vergangenen Jahren zu den Tschechen einrücken mussten<br />
und als Soldaten ausgebildet worden waren, bekamen den Gestellungsbefehl. Die<br />
Situation in der Bevölkerung war sehr gespannt, man befürchtete Krieg mit<br />
Deutschland. Gegen die Deutschen wollten aber unsere Männer nicht kämpfen,<br />
was zu verstehen war. Kurzerhand verschwanden die meisten, so auch mein Vater,<br />
in den Wäldern am Pleschenberg. Meine Onkeln Seppl und Hans und einige<br />
Nachbarn schachteten sich beim „Hannesveichtler“ einen Misthaufen aus, machten<br />
einen Bretterverschlag und deckten ihn wieder mit Mist ab. In diesem Versteck<br />
verbrachten sie die Zeit. Andere flüchteten nach Österreich oder nach Bayern.<br />
Wir hatten einen tschechischen Pfarrer, er hieß Jakesch. Dieser musste lassen<br />
oder ließ die tschechischen Soldaten mit einem Maschinengewehr<br />
Oben: Graphitbergwerk, Aufn. 1910 (Seidel? Wolf?) Unten: Bergwerkskapelle<br />
von Schwarzbach (Aufnahme anfangs 1920). In der Mitte Rudolf<br />
Hartl, Kapellmeister und Bürgermeister von Mugrau. Der Fahnenträger ist<br />
Herr Tussetschläger. Die Bergmusikkapelle wirkte bei besonders hohen<br />
Anlässen mit. Auch von den umliegenden Orten: Mugrau, Höritz, Oberplan<br />
und Krummau wurde die Kapelle zu Feierlichkeiten gebeten. In Erinnerung<br />
ist z.B. die Grundsteinweihung des Adalbert Stifterdenkmals am<br />
Gutwasserberg am 22.10.1905 geblieben, bei welcher von der Bergwerkskapelle<br />
eine feierliche Hymne intoniert wurde. Der Abschluss des Tages<br />
wurde von festlichen Konzert der Werksmusik und des Männergesangsvereines<br />
im „Grünwebersaal“ gekrönt. (Zusendungen Grete Rankl)<br />
1938 - 1945<br />
Maria Goletz<br />
Ende der Zwanzigerjahre herrschte eine große Arbeitslosigkeit nicht nur im<br />
Böhmerwald, sondern weltweit. Familien, die sich im Ausland angesiedelt hatten<br />
und arbeitslos waren, wurden ausgewiesen und mussten in ihre Heimatgemeinde<br />
zurück und dort aufgenommen werden. Die Gemeinde Altspitzenberg stellte einen<br />
aufgelassenen Bauernhof, dessen Besitzer verstorben waren und keine Erben<br />
hatten, diesen Familien zur Verfügung. Leute aus Österreich, Deutschland, sogar<br />
aus Frankreich fanden hier Unterkunft. Zwei Buben, welche unsere Schule in<br />
Blumenau besuchten, sprachen z.B. nur französisch. Diese Arbeitslosigkeit bekam<br />
besonders unsere deutsche Bevölkerung zu spüren. Es gab keine Unterstützung,<br />
viele mussten betteln gehen, um sich und ihre Familie am Leben zu erhalten.<br />
Sogar unsere ärmliche Einschicht wurde in dieser Zeit von Bettlern überlaufen.<br />
Meine Mutter zählte einmal an einem Tag 40, die um eine warme Suppe, ein<br />
Tröpflein Milch, ein Stück Brot, einen Löffel Mehl oder Schmalz baten. Geld<br />
hatten wir auch nicht, aber keiner ging ohne Gabe von unserem Haus weg.<br />
Besonders leid taten uns Mütter, die mit Kindern unterwegs waren, das kleinste<br />
oft im Kinderwagen.<br />
Notzeit im Böhmerwald<br />
Anna Kangler
94<br />
95<br />
auf den Kirchturm. Von dort schossen sie wild in die Gegend. Die Bevölkerung<br />
war verschreckt und verängstigt, niemand wusste, was wohl jetzt auf sie zukommen<br />
würde. Viele Frauen mit den Kindern und den alten Leuten flüchteten in<br />
entlegene Höfe, die vom Kirchturm nicht eingesehen werden konnten. Sie nächtigten<br />
in den Stuben, auch meine Großmutter, meine Tante Anna und meine Mutter<br />
mit mir, ich war ein halbes Jahr alt. Vier Männer aus unserer Pfarrei nahmen<br />
die Soldaten gefangen. Sie mussten stundenlang mit erhobenen Händen an der<br />
Friedhofmauer stehen und angeblich auf ihre Erschießung warten. Dann wurden<br />
sie aber gefesselt, nach Budweis getrieben und ins Gefängnis gesteckt. Da aber<br />
bald darauf unsere Heimat zu Deutschland gehörte, mussten sie entlassen werden.<br />
So gingen sie den weiten Weg barfuß zurück, man hatte ihnen die Schuhe<br />
abgenommen. Allmählich sickerte die Nachricht durch: Die Deutschen sind im<br />
Anmarsch! Von Andreasberg konnte man weit ins Land hinein schauen, so sah<br />
man die Lichter der Kolonne aus Richtung Linz kommen. Natürlich hat man die<br />
Deutschen mit Freude und Erleichterung empfangen, wurden doch Ungewissheit<br />
und Angst von uns genommen. So ging es heim ins Deutsche Reich! Das Blatt<br />
hatte sich gewendet. Erst wurden die Deutschen unterdrückt, jetzt ließ man es<br />
den Tschechen spüren. Der Frieden dauerte aber nicht lange. Unsere Väter, Onkeln<br />
und Brüder wurden zum deutschen Militär eingezogen. Der schreckliche 2.<br />
Weltkrieg begann und damit das Ende.<br />
Es war das Jahr 1945. Die deutschen Soldaten waren auf dem Rückzug. Ein Hauptmann<br />
mit seinem Burschen machte in unserem Haus Station. Es kamen noch<br />
mehr Soldaten, sie mussten ihre Waffen abgeben und auf die Gefangennahme<br />
warten. Sie waren völlig demoralisiert und mit den Nerven fertig. Meine Großmutter<br />
kochte ihnen Suppe von den wenigen Lebensmitteln, die wir noch hatten.<br />
Sie sagte immer: „Wenn wir ihnen was Gutes tun, werden andere unseren Buben<br />
auch was Gutes tun.“ Es war im Mai 1945. Ich war sieben Jahre alt. Meine Großmutter<br />
und ich waren in der Küche, plötzlich wurde die Tür aufgestoßen und ein<br />
Neger mit einem Gewehr im Anschlag stand vor uns. Zum ersten Mal sah ich<br />
einen Schwarzen. Die Amerikaner waren da. Wir mussten das Haus räumen, so<br />
zogen wir zwei Häuser weiter zu meiner Tante Albine. Unser Haus war beschlagnahmt.<br />
Ebenerdig war die Küche, im 1. Stock hatte der Capitain seinen Posten.<br />
Im Garten standen die Zelte der Schwarzen. Meine Mutter durfte nur zu bestimmten<br />
Zeiten in den Stall um das Vieh zu versorgen. Die Amerikaner waren sehr kinderlieb.<br />
Jeden Morgen riefen sie uns: „Mitzi, Anni, kleine Paula, kommt!“ Wir bekamen<br />
kleine Pfannkuchen mit viel Orangenmarmelade darauf. Wenn wir drei die<br />
gleichen Dirndlkleider an hatten, wurden wir fotografiert und durften mit dem<br />
Jeep mitfahren. Der Soldat Harry kam gern zu meiner Großmutter, er wollte sein<br />
Deutsch verbessern, denn seine Großmutter stammte aus Köln. Er bot uns auch<br />
an, wir sollen unsere ganzen Sachen in einen Lastwagen packen, sie nehmen uns<br />
mit nach Bayern. Meine Großmutter aber sagte empört: „Ich geh doch nicht von<br />
zu Hause weg!“ Doch nach kurzer Zeit mussten wir mit nur 50 kg weg, die Vertreibung<br />
aus unserer Heimat begann.<br />
Leopold Hafner: Antlitz Christi
96<br />
97<br />
Es war im Herbst 1944. Ich unterrichtete damals die 3. Klasse, das waren die<br />
Kinder der Schuljahre 6 bis 8 in Andreasberg. Feindliche Flugzeuge nahmen<br />
häufig Kurs über unser Gebiet, wahrscheinlich bildete die über l000 m hochgelegene<br />
Kirche einen günstigen Richtungspunkt. Wir wurden, wenn die Flugzeuge<br />
von Amstetten her im Anflug waren, über das Postamt verständigt, es blieb uns<br />
genügend Zeit, in den umliegenden Waldungen Schutz zu suchen. Wir spielten<br />
meist Räuber und Schandi, so vergaßen die Kinder die Angst. Einmal an einem<br />
Donnerstag wir hatten daheim an diesem Wochentag schulfrei vertrat ich meine<br />
Mutter zu Hause im Stierwald in unserem Laden. Gegen Mittag kamen zwei Dirndlein<br />
aus der Nachbarschaft und kauften eine Kleinigkeit ein. Ich begleitete sie vor<br />
das Haus, da hörten wir das eigenartige Brummen feindlicher Flieger. Die Mädchen<br />
fingen zu weinen an und klammerten sich zitternd an mich. Ich versuchte,<br />
sie zu beruhigen und wollte sie gerade unters Vordach ziehen, da hörten wir ein<br />
Krachen und beobachteten, wie fünf Bomben auf ein Waldstück in der Nähe des<br />
Dorfes fielen. Das Geschwader brauste über uns hinweg und verschwand in südlicher<br />
Richtung. Mein Vater arbeitete damals mit noch zwei Männern im Fürst<br />
Schwarzenbergischen Wald. Da ihr damaliger Arbeitsplatz in der Nähe der<br />
Bombeneinschläge lag, sorgte ich mich um sie. Zur Mittagszeit wärmten sie sich<br />
nämlich das Essen, dazu zündeten sie ein Feuerchen an, der Rauch hätte leicht<br />
von den Flugzeugen aus bemerkt werden können. So lief ich in Richtung Wald.<br />
Auf halbem Weg kam mir mein Vater entgegen. Er sorgte sich um uns, stand doch<br />
unser Haus dem Waldrand ziemlich nahe. Vom Wald aus hätte er keine Sicht und<br />
daher keinen Überblick gehabt, erklärte er. Die Bomben waren tatsächlich in der<br />
Nähe seiner Arbeitsstelle gefallen, er beschrieb mir genau den Platz, vom<br />
Waldstraßl aus war er leicht zu erreichen. Die Leute der Umgebung waren ziemlich<br />
aufgebracht. Als ich am nächsten Tag nach Andreasberg den einstündigen<br />
Weg zur Schule ging, wurde ich oft aufgehalten und ich musste erzählen. Auch<br />
die Kinder meiner Klasse wollten Genaues wissen, so entschloss ich mich zu<br />
einem Lehrausgang dahin. Als wir an der Blumenauer Schule vorbeikamen,<br />
hielt mich der Schulleiter auf, auch ihm musste ich berichten. Da er die Gegend<br />
nicht so genau kannte, entschloss er sich spontan, mit seiner Klasse (1.2.3.<br />
Jahrgang) an der Besichtigung teilzunehmen. Wir wanderten von hier aus noch<br />
eine gute halbe Stunde zum Ort des Geschehens. Die Kinder, es waren rund 70<br />
an der Zahl, liefen vom Straßl aus gleich zu den Bombentrichtern und sammelten<br />
eifrig Erinnerungsstücke, das waren Metallteilchen. Wir beaufsichtigten,<br />
so gut es möglich war die Schar. Plötzlich kam ein Wind auf. Voll Entsetzen<br />
sahen wir, wie die hohen Fichten rund um die Trichter in dem aufgelockerten<br />
Boden bedrohlich zu schwanken begannen. Aufgeregt<br />
Als der furchtbare Krieg anfangs Mai 1945 seinem Ende zutrieb, befand ich mich<br />
im Mühlviertel in Oberösterreich. Die Situation wurde immer bedrohlicher, weil<br />
der Feind auch hier von allen Seiten anrückte, so beschloss ich die Heimreise. Im<br />
Mühlviertel kannte ich mich gut aus, war ich doch etliche Jahre an verschiedenen<br />
Orten als Lehrerin tätig. Mit der Bahn fuhr ich stets bis zur Endstation Aigen<br />
Schlägl, von da aus mit dem Linienbus nach Krummau und mit dem nächsten<br />
Bus nach Andreasberg. Das war zwar ein Umweg, um in meine Heimat zu gelangen,<br />
aber er war bequem. Im Sommer fuhr ich den kürzeren Weg den Hager Berg<br />
hinauf, über Untermoldau, Schwarzbach, Honetschlag, Ogfolderhaid oft mit dem<br />
Rad, im Winter auch manchmal mit den Skiern. Als der Bus einmal wegen Schneeverwehungen<br />
ausblieb, ging ich den weiten Weg zu Fuß nach Hause, ich brauchte<br />
neun Stunden. Diesmal blieb aber der Zug schon in Rohrbach stehen, man<br />
fürchtete die Tiefflieger, die fahrende Züge häufig angriffen. So schulterte ich<br />
meinen Rucksack und marschierte auf der Straße nach Aigen. Kaum jemand war<br />
unterwegs, auch kein Fahrzeug. In Aigen wollte ich mir Verpflegung besorgen,<br />
um den Weiterweg bewältigen zu können. Aber alle Geschäfte, alle Wirtshäuser<br />
waren geschlossen, kein Mensch auf der Straße, nur in einer Toreinfahrt erblickte<br />
ich einen alten Mann, mit dem ich kurz reden konnte. Er wusste, dass die Amerikaner<br />
ganz nahe wären und jede Stunde mit der Besetzung des Ortes zu<br />
rechnen sei. In dem Augenblick brauste ein Flugzeug tief über die Häuser<br />
hinweg und verschwand hinter dem Hügel von Peilstein. Nun hörte man<br />
schießen und als oben auf der Höhe ein Panzer erschien, gab mir der Mann<br />
den Rat, nicht die eingesehene Straße über den Hager Berg zu<br />
Heimkehr<br />
Anna Kangler<br />
Als die Bomben fielen<br />
Anna Kangler<br />
riefen wir den Kindern zu, schnell auf das Straßl herauszulaufen. Die „Großen“<br />
erkannten die Gefahr bald, ein Teil der „Kleinen“ jedoch brauchte länger. Erst als<br />
sich die erste Fichte zum Glück ganz langsam neigte und dann krachend zu Boden<br />
stürzte, liefen sie schreiend zu uns. Ein kleiner Bub heulte laut, weil er einen<br />
Holzschuh verloren hatte, er wäre zurückgelaufen, hätten wir ihn nicht festgehalten.<br />
Aus sicherer Entfernung beobachteten wir, wie ganz langsam nach einander sieben<br />
große Fichten fielen, oft riss eine die andere mit zu Boden. Uns beiden Verantwortlichen<br />
stand das Entsetzen im Gesicht. Was hätte da Schreckliches passieren<br />
können!!! Gott sei Lob und Dank, wir hatten alle miteinander einen wachsamen<br />
Schutzengel. Als wieder Ruhe eingekehrt war, suchten wir den Holzschuh<br />
des Buben. Wir fanden ihn nicht, wahrscheinlich lag er zerdrückt unter einem der<br />
Baumriesen.
98<br />
99<br />
benützen, sondern mich seitwärts durch den Wald über den Bärnstein durchzuschlagen.<br />
So strebte ich auf Feldwegen das oberste Haus am Waldrand an.<br />
Inzwischen war es später Nachmittag geworden und der Hunger quälte mich.<br />
Vielleicht bekam ich hier etwas Essbares? Die Haustüre war versperrt, so klopfte<br />
ich ans Fenster. Eine Frau öffnete es, sie ließ mich aber nicht ein. Als ich Brot<br />
oder sonstiges kaufen wollte, reichte sie mir drei steinharte „Kasquargln“ durch<br />
das Fenster und schloss es rasch wieder. (Kasquargln kannte ich von daheim:<br />
Topfenkäse wurde mit Kümmel, Salz und Pfeffer durchgeknetet, zu spitzen Kegeln<br />
geformt und an der Luft getrocknet. Sie hielten sich sehr lange essbar.) Ich<br />
steckte sie lose in meine Jackentasche und setzte den Weg durch den Wald fort.<br />
Er war markiert und nach einer guten Stunde stand ich auf dem Bärnstein. Hier<br />
wollte ich eine längere Rast einlegen. Das lange Waldgras vom Vorjahr (wir nannten<br />
es „Soher“) war dürr, ich setzte mich, lehnte mich an einen Stein und begann<br />
den Käse zu nagen, dabei überdachte ich meine Lage. Übermüdet schlief ich<br />
schließlich ein. Ich erwachte, weil ich erbärmlich fror, außerdem hörte ich Stimmen<br />
Männerstimmen. Ich spitzte meine Ohren, konnte aber nicht verstehen, was<br />
sie sprachen. Sie entfernten sich in Richtung Aigen. Sicher waren es Soldaten,<br />
die heimzu trachteten. Ich zog alles an, was ich im Rucksack an Kleidung hatte,<br />
kauerte mich wieder an den Stein und döste vor mich hin. Es war Nacht, so wollte<br />
ich den Morgen abwarten, bis ich den Weg sehen konnte, der mich hinunter in<br />
das Moldautal führen sollte. Im Wald stieß ich auf ein Straßl, auf dessen feuchten,<br />
lehmigen Stellen deutlich Fußspuren von vielen gleichen Schuhen eingeprägt<br />
waren, ein starkes Profil, das mir unbekannt war. Der Wald wich zurück, vor mir<br />
lag das Moldautal, Salnau Bahnhof, der Ort und am anderen Flussufer das Dorf<br />
Salnau. An der Straße stand ein Häuschen, hier erfuhr ich, dass die Spuren von<br />
den vorbeigezogenen Amerikanern stammen. Als ich die Dorfstraße hinunterging,<br />
vor mir plötzlich Einschüsse von einem Maschinengewehr! Der Sand spritzte<br />
gegen meine Beine. Blitzschnell fasste mich jemand von hinten und zog mich<br />
von der Straße weg zu den Häusern heran. Ein Amerikaner! „SS bum – bum“,<br />
sagte er und wies in Richtung Moldau. „Du kommen!“ Er packte mich am Arm<br />
und lief mit mir an der Häuserreihe entlang in das Osen Wirtshaus. In der<br />
Küche lieferte er mich ab. Hier ging es lebhaft zu. Auf dem großen Herd, der in<br />
der Mitte des Raumes stand, brieten die Ami Soldaten Eier in großen Pfannen.<br />
Auf der Ofenbank am Kachelofen gleich neben der Tür musste ich Platz nehmen.<br />
Zwei deutsche Landser, ein anderer in Fliegeruniform, ein Zivilist und<br />
ein junges Mädchen saßen schon hier. Ich wollte etwas fragen, da hieß es streng:<br />
„Sprechen verboten!“ Auf einmal ein Schuss durch das Fenster, das der Moldau<br />
zugewandt war! Glassplitter flogen durch die Luft. Die Amerikaner ließen<br />
sich, wo sie waren zu Boden fallen. Als der Schreck vorüber war, kam der<br />
Ami, der mich gefangen hatte und fragte: „Du, woher? wohin?“ Ich sagte:<br />
„Arbeit in Austria, heim zur Mama!“ Er nickte und schenkte mir ein kleines<br />
Blättchen. Ich drehte es nach allen Seiten und sah ihn ratlos an. Da<br />
nahm er auch eines in die Hand, löste das Papier, schob den Inhalt in den Mund<br />
und begann zu kauen. Ich tat es ihm nach, das Ding schmeckte sehr gut nach<br />
Pfefferminze. Das war mein erster Kaugummi. Wir kannten ja nur das Beißpech!<br />
Am Abend winkte mir dieser Ami: „Du kommen!“ Ich war auf alles gefasst, hatte<br />
doch unsere Propaganda Grausiges von den Feinden verbreitet. Er führte mich in<br />
den Tanzsaal hinauf, hier standen etwa 20 Betten, eines davon wies er mir zu und<br />
verschwand wieder. Nach und nach kamen auch andere Leute herauf. Ich zog nur<br />
die Schuhe aus und setzte mich voll angezogen ins Bett, um wenn nötig die Flucht<br />
ergreifen zu können. Eine ältere Frau legte sich in das Bett neben meinem. „Hab<br />
keine Angst“, sagte sie, „ich muss feststellen, die Amis sind recht anständig. Ich<br />
bin die Wirtin.“ Da war ich sehr erleichtert und schlief ein.<br />
In der Nacht tat es einen gewaltigen Rumser, das Haus erzitterte, die Fenster<br />
klirrten. Wir schreckten alle vom Schlaf auf. Da stand der Ami in der Tür und<br />
winkte mir: „Du kommen!“ Vom Treppenfenster aus zeigte er auf die Moldau<br />
und erklärte: „SS Bruck kaputt, du nix Mama.“ Ich verstand, die deutschen Soldaten<br />
hatten die Moldaubrücke gesprengt. Nun kannte ich aber den Haberdorfer<br />
Steg, der 1 2 km flussaufwärts über das Wasser führte. Sicher wussten die Amis<br />
diesen nicht. Ob es hier eine Möglichkeit zu entkommen gäbe? Ich fand keinen<br />
Schlaf mehr in dieser Nacht, sondern arbeitete in Gedanken einen Fluchtplan aus.<br />
Als es hell wurde, ging ich hinunter in die Küche. Man rief sofort den netten Ami<br />
herbei. Ich zeigte mehr als ich sprach: „Drei Häuser weiter wohnt meine Tante.<br />
Ich möchte mich waschen, kämmen , etwas essen.“ Er nickte, antwortete aber:<br />
„Ich mit du!“ Vor dem 3. Haus blieb er stehen und meinte treuherzig: „Ich warten<br />
auf du“. Ich nickte ihm freundlich zu und verschwand im Hausgang. Rechts hörte<br />
ich Kindergeschrei, so klopfte ich an. Eine Frau öffnete mir und als ich ihr meine<br />
Lage kurz schilderte, machte sie das Fenster zum Garten hinaus auf. „Schlüpf<br />
durch die Riebislstauden“, riet sie mir, „dann bist auf dem Steig, der zum Steg<br />
führt. Bei dem dichten Nebel heute früh entkommst ihnen leicht.“ Ich lief schnell<br />
dahin, am Steg begegnete mir nur ein deutscher Soldat, der ins Mühlviertel heim<br />
wollte. Im Dorf Salnau wohnte meine Freundin und Kollegin Mitzi, sie war die<br />
Tochter der Schestauer Wirtsleute. So kehrte ich dort ein. Die Gaststube war<br />
voller SS Soldaten. Die Mitzi war gleich zur Stelle und ich musste erzählen, was<br />
ich erlebt hatte. Die Zuhörer wurden immer mehr. Nach einem reichhaltigen Frühstück,<br />
das mir aufgetischt wurde, trat ich das letzte Stück der Heimreise an. Bis<br />
Hintering überlegte ich, ob ich auf der Straße, die über Uhligstal führte oder den<br />
kürzeren Weg über das „Krie“, einer hochgelegenen Bergwiese nehmen sollte.<br />
Ich blieb auf der Straße und das war mein Glück, denn ich hörte vom „Krie“ her<br />
ununterbrochen Schießereien zwischen den deutschen Soldaten und den Amerikanern.<br />
Die Freude meiner Eltern war erschütternd, als ich gesund und munter in unsere<br />
Stube spazierte. Sie hatten mich schon verloren geglaubt.
100<br />
101<br />
Mein Vater musste schon früh in den Krieg und wurde 1941 als vermisst gemeldet.<br />
1945 hatten wir immer noch kein Lebenszeichen von ihm. Als meine Mutter<br />
aufgefordert wurde, Vaters Kleidung abzuliefern, weil viele Flüchtlinge, die aus<br />
dem Osten vor den Russen geflohen waren, nichts Warmes anzuziehen hatten,<br />
schlug sie die Hände über den Kopf zusammen und jammerte: „Um Gotts Willn,<br />
der Vater kimmt ja wieder hoam und wenn er dann koa Gwand mehr hat, i kanns<br />
do nit hergeben.“<br />
Sie sinnierte wohl die halbe Nacht, um einen Ausweg zu finden. Als sie in den<br />
nächsten Tagen erfuhr, dass verschiedene Leute ihre Sachen in Rucksäcken über<br />
die Grenze nach Bayern trugen, um sie in Sicherheit zu bringen, entschloss sie<br />
sich, dasselbe zu tun. Sie nähte aus grober Leinwand einen langen Sack und<br />
zwei Tragegurte daran, dass er wie ein Rucksack zu tragen war. Er reichte zwar<br />
weit hinunter, fast bis in ihre Kniekehlen, aber sie konnte darin viel unterbringen.<br />
Als erstes nahm sie den schwarzen Anzug aus dem Schrank, den ihr Mann<br />
sich zur Hochzeit hat nähen lassen und den er nur an hohen Festtagen in die<br />
Kirche getragen hatte, also fast neu war. Sie faltete ihn sorgsam zusammen,<br />
dass er in den Sack passte. Dabei liefen ihr die Tränen über das Gesicht. Die<br />
schwarze Samtweste mit den bunten Blümlein folgte, der graue Trachtenanzug,<br />
die Arbeitskleidung, der grüne Walchjanker, etliche Hemden, die weißen, die<br />
färbigen und die groben leinenen. Mit den Unterhosen, Strümpfen und Socken<br />
stopfte sie den Sack noch aus. Sie schlüpfte in die Traggurte und probierte die<br />
Last aus, indem sie in der Stube hin und herging. „Is gar nit so schwar,“ meinte<br />
sie, „und guat zan Tragn, da kimm i scho hin damit.“ Wohin sagte sie nicht. Es<br />
war ein kalter, strenger Winter im Jahre 1945 auf 46 und sehr schneereich. Eines<br />
Morgens war meine Tante da und sagte zu uns Kindern, dass unsere Mutter<br />
zu Besuch bei Verwandten sei und bald wieder heimkomme, Die Tante versorgte<br />
nicht nur uns Kinder, sondern auch unsere Kuh, die Lisl, und das ganze Hauswesen.<br />
Mein Bruder, der vier Jahre älter war als wie ich, zählte da sieben Jahre,<br />
wusste aber doch um Mutters beschwerlichen, stundenlangen Weg über die<br />
bayerische Grenze. Ich kann mich noch gut erinnern, wie meine Tante am 3.<br />
Tag laut zu weinen begann, als jemand kam und erzählte, dass an der Grenze<br />
heftig geschossen worden war und alle Grenzgänger umgekommen wären. Sie<br />
schluchzte vor sich hin: „Jetzt ham die zwoa Kinder a koa Muatta mehr und nur<br />
wegn dem Gwand.“ In der 4. oder 5. Nacht schrie meine Tante laut auf, sodass<br />
wir aus dem Schlaf gerissen wurden. Wir trauten unseren Augen nicht, mitten in<br />
der Stube stand unsere Mama. Sie sah müde aus, durch und durch nass und halb<br />
erfroren. Zu uns Kindern sagte sie: „Euer Vater hat mir an Schutzengel gschickt,<br />
Als Mutter im tiefen Schnee über die böhmische<br />
Grenze ging<br />
so han i wieder zu euch hoamkemma kinna.“ Ich wollte die Mutter ganz fest<br />
drücken vor lauter Freude sie wieder zu haben, sie aber schrie auf vor Schmerzen.<br />
Ihre Schultern waren vom schweren, stundenlangen Tragen ganz offen,<br />
das Fleisch kam direkt zum Vorschein. Am nächsten Tag erzählte sie, was passiert<br />
war. Ungefähr l00 Menschen kamen zusammen und stapften mit allen möglichen<br />
Sachen über die böhmische Grenze nach Haidmühle. Zwei Männer führten<br />
den Zug an. Es ging alles gut, Mutter stellte den Sack mit der Kleidung des<br />
Vater bei einem Bauern unter und der versprach ihr, die Ware gut zu hüten bis<br />
sie wieder kommt, um sie abzuholen. Auf dem Rückweg passierte es dann. Die<br />
Menge der Grenzgeher hatte sich in kleine Gruppen aufgelöst, Mutter schloss<br />
sich einer an. Auf einmal fielen Schüsse, von überall her Schüsse. Mama fand<br />
Schutz hinter einem dicken Baum und rührte sich nicht. Wie lange sie so still<br />
gestanden ist wusste sie nicht, aber etliche Stunden bestimmt. Als es endlich<br />
ruhig wurde, wagte sie den Heimweg durch Wald und tiefem Schnee. Später<br />
erfuhren wir, dass die beiden Anführer des Zuges getroffen wurden und verblutet<br />
waren. Zu uns Kindern sagte sie: „Jetzt kann euer Vater kemma, sein Gwand<br />
is in Sicherheit, a wenn ma vo der Hoamat fort müssen.“ Sie wartete jeden Tag<br />
auf seine Heimkehr.<br />
So kam die Vertreibung im Mai 1946. Wir durften nur wenig mitnehmen und<br />
auch unsere dürftige Habe wurde noch durchsucht und wertvoll Erscheinendes<br />
weggenommen. Mutter schmunzelte heimlich: „Vaters Sachen kriegen sie doch<br />
nicht, sie san in Sicherheit. Mein weiter, gefahrvoller Weg hat sich gelohnt.“<br />
Wir kamen wie viele andere <strong>Böhmerwäldler</strong> nach Bayern, wir nach Gastag in<br />
die Nähe von Laufen. Nach einiger Zeit, als etwas Ruhe eingekehrt war und wir<br />
uns wieder einigermaßen gefangen hatten, meinte die Mutter: „Mir müassn nach<br />
Haidmühl fahrn und Vaters Gwand holen, dann kimmt er bestimmt a wieder<br />
hoam. Man hört allweil wieder von Spätheimkehrern.“ Eines Morgens im Sommer,<br />
es war sehr heiß, machten wir uns auf die Reise. Im Zug fragten wir die<br />
Mutter über unseren Vater aus, ich kannte ihn überhaupt nicht, denn zwei Jahre<br />
war ich alt, als die Vermisstenmeldung kam, aber auch mein Bruder konnte sich<br />
kaum mehr an ihn erinnern. Mutter erzählte uns viel von ihm, wie gern er uns<br />
alle hatte, wie gut er war, wie fleißig und geschickt. Einen langen Tag waren wir<br />
mit der Bahn unterwegs und endlich hatten wir Haidmühle und den Bauern<br />
erreicht. Der erschrak furchtbar und rief: „Du lebst!!! Alle sagten, die Leute von<br />
der Gruppe wären erschossen worden damals. So han i den Sack aufgmacht und<br />
dei Gwand für nützlichere Sachan eintauscht. Is nix mehr da davon. Gar nix<br />
mehr.“ Da weinte die Mutter lange, ihr Schluchzen tat uns in der Seele weh,<br />
aber was konnten wir tun? Alles Weinen und unsere vorwurfsvollen Augen halfen<br />
nichts, die Kleidung war weg. Der Bauer ließ uns wenigstens bei sich übernachten<br />
und gab uns zu essen. Am Morgen schenkte er uns ein Säcklein Mehl<br />
und einen Laib Brot für die Heimfahrt. Im darauffolgenden Jahr wurde mein<br />
Bruder gefirmt. Es gab noch immer nichts zu kaufen, da meinte die Mutter<br />
wieder: „Wenn ich das gute Gwand vom Vater hätte, könnt ich es umändern,<br />
Maria Enn
102<br />
103<br />
Fast ein halbes Jahr waren der Heidingervater und die Heidingermutter schon aus<br />
der Böhmerwaldheimat vertrieben. Knapp an der böhmischen Grenze waren sie<br />
geblieben, wo das Rauschen der Wälder noch zu hören war und die Sprache noch<br />
nicht fremd klang. Eines Tages kam ihr Sohn aus der Gefangenschaft, ihr einziger,<br />
zerlumpt, krank, die Seele angeschlagen. Ihm galt nun die liebende Sorge der<br />
Heidingermutter. Wenn sie doch seine Starre lösen, sein Herz bewegen könnte!<br />
Es war erstaunlich, mit welch zauberhaftem Geschick sie manchmal aus kaum<br />
etwas Speisen zubereiten konnte, wie sie selbst hungerte und ihm mit einem lieben<br />
Lächeln die kargen Bissen zuschob. Sie wollte ihm auch Kleidung schaffen.<br />
Wenn ich meine Leinwand hätte, die ich im Heustadl daheim versteckt habe,<br />
sinnt sie, so könnte ich aus der Feinen Hemden nähen, die Grobe könnt ich färben,<br />
vielleicht dunkelblau oder braun und es gäbe eine Hose und einen Rock für<br />
den Buben. Ja, wenn er nicht so gewachsen wäre! Als er in den Krieg zog, passten<br />
ihm noch die Sachen des Vaters. Wenn ich nur die Leinwand hätt! Dieser<br />
Gedanke ließ ihr keine Ruhe. Sie sinnierte Tag und Nacht, bis sie dem Heidingervater<br />
einen fertigen Plan vorredete, wie der Schatz über die Grenze zu bringen<br />
wäre. Dem Heidingervater fiel es nicht leicht, den weiten, gefahrvollen, beschwerlichen<br />
Weg über die Grenze zu gehen, denn er war Zeit seines Lebens Leopold Hafner: Der Hl. Nepomuk<br />
Der Opfergang des Heidingervaters<br />
Anna Kangler<br />
dass es dem Buben passt.“ So entschloss sie sich, ihr dunkelblaues Kostüm zu<br />
opfern, es war das einzige gute Kleidungsstück, das sie noch hatte. Es wurden<br />
wenigstens eine kurze Hose und eine Jacke daraus. Die Jahre vergingen, wir Kinder<br />
wuchsen heran, unsere Lage besserte sich, Mama hoffte noch immer auf die<br />
Heimkehr des Vaters und schöpfte immer wieder neue Hoffnung, wenn sie von<br />
Spätheimkehrern hörte. Im Jahre 1983 wurde unsere Mutter schwer krank, musste<br />
eine lebensbedrohende Operation ertragen und bekam kurze Zeit darauf einen<br />
Schlaganfall. Die letzten Worte, als sie noch sprechen konnte waren: „Er wird jo<br />
nou kemma, der Vater, er geht ma schou entgegn.“ Bald darauf schloss sie die<br />
Augen für immer.<br />
Am 14. Oktober 1990 tat sich eine kleine Gruppe zusammen und wir fuhren in<br />
unsere alte Heimat nach Andreasberg. Als ich endlich nach langem Suchen die<br />
Mauerreste meines Elternhauses gefunden hatte, sagte unsere ehemalige Nachbarin,<br />
die Resl, zu mir: „Weißt, dein Vater war so ein guter Mensch.“ Ich freute<br />
mich sehr über diese Worte und so werde ich ihn in Gedanken behalten. Ich glaube,<br />
unser Herrgott hat Mutter und Vater im Tode vereint. Er schenke ihnen die<br />
ewige Ruhe!
104<br />
105<br />
ein redlicher Mann gewesen, der alles Dunkle und Heimliche gescheut hat. Mühe<br />
und Arbeit hatten seine Gestalt gebeugt. Aber dieser Weg musste wohl sein, um<br />
des Buben Willen. So steckte er sich ein festes Stück Brot ein, das Letzte, das<br />
noch in der Tischlade war, nahm einen knotigen Haselnussstock, warf einen kurzen<br />
Blick auf seinen Sohn, der reglos mit hängendem Kopf beim Tisch saß, und<br />
ging. „In Gottes Namen“, murmelte ihm die Mutter nach. Der Sohn hob den Kopf<br />
nicht. Eine ganze Nacht war der Vater gegangen, durch Wälder, Auen und Heideflächen,<br />
über Hügel durch Täler, eine ganze Nacht lang. Als der Morgen dämmerte,<br />
stand er vor seinem Haus, das er einem Kommunisten hat geben müssen. Er<br />
kannte den Einschlupf hinten am Stadel. Mit Mühe zwang er sich durch. Viel Heu<br />
hat er nimmer, stellte er fest, da wird er die Futternot kriegen. Er kroch auf den<br />
Rest des Heustockes und ließ sich unters Dach rollen. Aha, da lag die schöne<br />
Leinwand sicher im alten Taubenkobel, hier konnte keine Maus dazu, hier fand<br />
sie kein Dieb. Mit einem Ruck riss er das hintere Brett auf und tat die zwei Ballen<br />
Leinwand, die feine und die grobe in seinen Rucksack. Nun galt es, lautlos und<br />
eilig wieder zu verschwinden. Bei des Buben Taufpatin konnte er warm und sicher<br />
den Tag verschlafen. Sie hatte ihr Häuschen noch nicht hergeben müssen.<br />
Als der Abend sich über das Land senkte, weckte ihn die Patin. „Hörst“, sagte sie,<br />
„mußt nit allein über die Grenz gehen, so fünfzehn, zwanzig Grenzgeher weiß<br />
ich, sie wollen Sachen hinüber tragen, bist nit allein über die Grenz.“ Als die<br />
gütige Nacht über die Wälder floss, bewegte sich lautlos ein Trupp Menschen der<br />
Grenze zu. Junge, wagemutige Leute waren es, sie schleppten und schlichen, sie<br />
rangen nach Atem, die Pulse flogen. „Die eigene Sach muss man sich stehlen“,<br />
sagte der Vorletzte zum Heidingervater, der manchmal ein Stück zurückbleiben<br />
musste, weil er infolge des raschen Ganges ins Keuchen kam. „Draußen wird<br />
man die War brauchen, wenn man von hier wegmuss“, redete der weiter. Die<br />
jungen Leute eilten, sie mussten ja morgen früh wieder an ihrer Arbeitsstätte sein.<br />
„Die Brücke über die Moldau in Schönau fürcht ich“, sagte der Vordermann wieder,<br />
„da könnt Militär sein. Sind wir aber drüber, dann ist der Wald gleich da, dann ist<br />
es so gut wie geschafft.“ Ein Stocken kam in den Zug, der erste Mann ging vorsichtig<br />
zu Werk. Schritt um Schritt schob er sich an die Brücke heran, spähte,<br />
lauschte —. Wie eine Katze sprang er<br />
den Übergang an, sicherte wieder lange, nichts rührte sich. Die Dunkelheit verschluckte<br />
ihn. Nach einer Weile schrie ein Uhu. Jetzt kam Bewegung in die Leute,<br />
frohes Aufatmen, denn der Übergang war frei. „Denen wirds wohl zu viel<br />
gezogen haben heut Nacht“, hörte der Heidingervater lachen. Am anderen Ufer<br />
sammelte sich der Trupp wieder und setzte seinen Marsch fort. Der Heidingervater<br />
drehte sich noch einmal um zur Moldau hin, um das Tosen des Wassers zu<br />
hören, ehe er ging. Vielleicht hörte er es nie mehr tosen, dieses Wasser. -<br />
Plötzlich zerriss ein Schuss seine Gedanken. Und jetzt war die Hölle los! Salve<br />
um Salve blitzte auf und zerbarst, Erde und Schlamm spritzte hoch, Zweige<br />
flogen, Schmerzensschreie gellten, Flüche erstarben im Moder der Au. Der Heidinger<br />
stolperte dem Wasser zu, da erhielt er einen harten Schlag in den Rücken,<br />
Eine 80 jährige Frau, deren Name nicht genannt werden soll, hat mich gebeten,<br />
ihre Erlebnisse bei der Vertreibung nach ihrer Erzählung aufzuschreiben und sie<br />
veröffentlichen zu lassen. Sie meint, dieses Unrecht sollte nicht in Vergessenheit<br />
geraten und die Jüngeren, die es nicht erlebt haben, sollten auch um das Leid, das<br />
geschehen ist wissen.<br />
Am 23. Mai 1946 wurden wir ausgesiedelt. Um 6 Uhr früh mussten wir uns auf<br />
dem Kirchplatz vor der Schule sammeln. Der Wirt Toni lud unser Gepäck auf<br />
Eine Andreasbergerin erzählt<br />
Anna Kangler<br />
der ihn taumeln und stürzen ließ hinab zum Wasser, zum schäumenden. Der Rucksack<br />
schlug mit einem Schwung vor, legte sich über seinen Kopf und drückte ihn<br />
tief in den Morast. Der Heidingervater hatte gerade noch die Kraft, sein Gesicht<br />
zur Seite zu drehen, um nicht ersticken zu müssen. Dann blieb er liegen wie er<br />
lag. Er hörte Stimmen, Schritte, Kommandorufe, einmal ein Aufweinen Er lag<br />
am Wasser, man fand ihn nicht. Viele Schritte hallten über die Brücke, auch ein<br />
Wagen knarrte darüber. Einmal war es dem Alten, als hätte jemand laut gestöhnt.<br />
Lange währte das Treiben in der Nacht. Der alte Mann fror, denn Wasser sickerte<br />
ihm durch das Hemd bis auf die Haut und die Arme wurden steif, die angespannten<br />
Tragriemen schnürten das Blut ab. Dann wurde die Nacht wieder still und<br />
friedlich. Plötzlich roch der Vater den rauhen Duft des Linnens und er dachte an<br />
seinen Buben. Neuer Mut erfüllte ihn. Er wälzte sich hin und drehte sich her. Er<br />
war in einer verzweifelten Lage: die Beine oben, der Kopf unten und mit dem<br />
Rucksack beschwert, die Arme mit den Tragriemen gefesselt und knapp vor ihm<br />
das Wasser der Moldau. Unsagbare Mühe kostete ihn die Befreiung, aber sie<br />
gelang. Als die Kirchenuhr von Schönau drei gewaltige Schläge tat, saß er schwer<br />
keuchend da und rieb und schlug sich neues Leben in die Arme. Bald tappten<br />
seine steifen Beine dem Wald zu, er kannte den Weg. Er mochte nicht nachdenken<br />
über das Furchtbare, das an der Moldaubrücke geschehen war. Als der erste<br />
Sonnenstrahl über die Waldberge züngelte, schleppte sich eine müde Gestalt in<br />
eine niedrige Stube im Bayerischen Wald: Das Gesicht fast unkenntlich verschmiert,<br />
die Haare verklebt, die Augen mit Blut unterlaufen die Lippen zerfetzt<br />
die Hände zerschunden zehn Jahre älter! Da schrie der Bub auf: „Vater, mein<br />
Vater!“ Er fing die taumelnde Gestalt in seinen Armen auf, Tränen stürzten aus<br />
den grauen Augen des großen Jungen. Der Vater wollte sprechen, schüttelte aber<br />
hilflos den Kopf und schwieg. Als sie die Leinwandballen aus dem Rucksack<br />
nahmen, sahen sie drei tiefe Löcher darin. Und als sie die Ballen auseinander<br />
rollten, fielen drei Geschosse auf den Bretterboden der Stube.
106<br />
107<br />
seinen Wagen und fuhr es uns nach. Wir versorgten noch die Kühe und steckten<br />
ihnen besonders viel gutes Heu auf, damit sie nicht hungern mussten, wenn sie<br />
vielleicht nicht so schnell wer betreut. Es war, als wenn sie den Abschiedsschmerz<br />
spürten, sie sahen uns nach, als wir den Stall verließen und ihr ängstliches Gebrüll<br />
begleitete uns hinaus.<br />
„Schaut nicht um“, sagte unsere Mutter, „dann geschieht euch nicht so hart!“<br />
Im Laufe des Tages wurden unsere Sachen kontrolliert und gefilzt. Ausweise,<br />
Sparkassenbücher, Urkunden, Baupläne, Wertsachen und Schmuck nahm man<br />
uns ab. Das dauerte bis um 5 Uhr Nachmittag. Nun kam ein Lastauto und nahm<br />
ältere Leute und Kinder auf, alle anderen wurden in ein Gefangenenauto regelrecht<br />
hineingestößelt, natürlich stehend. Wir fuhren über Poletitz nach Krummau<br />
und fanden Unterkunft in einem Pferdestall in der Nähe von Weichseln. Hier<br />
blieben wir acht Tage.<br />
Die sanitären Verhältnisse waren grauenhaft, in der Nacht quälten uns die Wanzen,<br />
es war ein Wunder, dass wir nicht krank wurden. Schlimmer aber war die<br />
Ungewissheit: Was hat man mit uns vor? Wie lange müssen wir hier bleiben?<br />
Wohin wird man uns bringen? Eines Tages verfrachtete man uns um 6 Uhr abends<br />
in Viehwaggons, 40 Wagen koppelte man aneinander, alle gesteckt voll unglücklicher<br />
Leute. Mit einem Ruck fuhr der Zug an, fort aus der Heimat. Durch den<br />
Ruck flog alles durcheinander, wir hatten Mühe, bei Taschenlampenlicht wieder<br />
einigermaßen Ordnung zu schaffen.<br />
In den Waggons herrschte beängstigende Enge, wir versuchten auf unseren Bündeln<br />
und Kisten wenigstens abwechselnd zu sitzen. Pilsen war unsere 1. Station.<br />
Hier bekamen wir das erste Essen, einen Eintopf. Darauf wurde mir so schlecht,<br />
dass ich unbedingt an die Luft musste. Es war uns zwar verboten, die Türen zu<br />
öffnen, ich tat es aber trotzdem und sprang in die Nacht hinaus, um zu erbrechen.<br />
Draußen stand ein Soldat, der Wache hielt. In der Finsternis sah ich ihn nicht und<br />
landete direkt auf seinen Schultern. Er war aber keineswegs ungehalten darüber<br />
und als er sah, wie schlecht es mir ging, hatte er Mitleid und versuchte mich zu<br />
trösten mit den Worten: „Arme Frau“. Ich empfand wirklich Trost, denn ich spürte,<br />
nicht alle Tschechen sind herzlos.<br />
In Pilsen standen wir lange. Im Waggon sprang uns die Angst an, dass wir<br />
womöglich ins Innere Böhmens gefahren werden. Niemand sprach mit uns, niemand<br />
wusste, wann und wohin die Weiterfahrt gehen wird. Zum Glück waren wir<br />
beisammen: meine kleine Tochter, meine Mutter, meine Schwestern.<br />
Nach endlosem Warten wurden zwei Loks vor den Zug gespannt und die Reise<br />
ging weiter ins Unbekannte. Alles atmete auf, als jemand rief: „Wir sind in München!“<br />
In München Allach wurden wir entlaust und wir bekamen Verpflegung:<br />
Leberkäse, Brot und Käse. Alle waren ausgehungert, so aßen wir die reichliche<br />
Brotzeit alles auf einmal. Erst später erfuhren wir, dass das Essen für drei Tage<br />
hätte reichen sollen. Um 11 Uhr nachts standen wir in München. Plötzlich hieß<br />
es, in der Kantine gäbe es Bier. Wir liefen mit Kannen über alle Gleise, als<br />
wir ankamen, war das Bier aus. In München wurden einige Waggons abgehängt,<br />
wir fuhren Richtung Rosenheim, standen aber wieder längere Zeit auf freier Strecke.<br />
Aber die Gewissheit, wir sind unter Menschen, die die gleiche Sprache, ja<br />
dieselbe Mundart sprechen, wir sind nicht mehr eingesperrt und bewacht, sondern<br />
frei, gab uns Mut.<br />
In Rosenheim wurden 20 Waggons abgehängt, diese fuhren weiter nach Miesbach,<br />
wir aber nach Wiesmühl. Es war eine schöne, laue Nacht mit sternklarem<br />
Himmel. Am Morgen ging es mit einer Lokalbahn weiter nach Tittmoning. Um 7<br />
Uhr früh kamen wir an und es regnete in Strömen. Die Alten und die Kinder holte<br />
ein Holzgasauto in die Burg. Wir Jungen saßen bei unseren Sachen von früh bis 2<br />
Uhr Nachmittag im Regen. Um 9 Uhr läuteten die Kirchenglocken und Leute<br />
gingen festlich gekleidet der Kirche zu. Da wussten wir, dass es Sonntag ist, wir<br />
hatten alle Zeitrechnung verloren.<br />
Da kam ein Hund und hob bei meinem Bündel das Haxl. Ein alter Bauer, der<br />
unterwegs in die Kirche war, sah es und schimpfte laut: „So iss recht, dem Gsindl<br />
ghört nit mehr.“ Diese Worte erschütterten mich bis ins Innerste. Hunger, Kälte,<br />
Nässe und diese Missachtung brachten mich fast zur Verzweiflung. Endlich wurden<br />
auch wir Letzten in die Burg geholt. Mir versagten vor Entkräftung beinahe<br />
die Beine bei den letzten Metern des Aufstiegs. Im Getreidespeicher fanden wir<br />
wieder zusammen mit unseren Angehörigen. Zu essen gab es wieder nichts, so<br />
legten wir uns bald in die Stockbetten, um im Schlaf wenigstens den Hunger<br />
nicht zu spüren.<br />
Auf einmal Feueralarm! Wir sprangen auf, ließen alles liegen und stehen und<br />
rannten ins Freie. Sollten wir hier unsere letzte Habe auch noch verlieren? Das<br />
Feuer konnte aber rasch gelöscht werden. Jemand hatte Milch für einen Säugling<br />
auf einem Spirituskocher gewärmt und ist damit unachtsam umgegangen. An<br />
Schlaf war aber nach der Aufregung lange nicht zu denken.<br />
14 Tage blieben wir in der Burg, dann kamen Leute vom Arbeitsamt und wir<br />
wurden zu Bauern verteilt. Meine Familie kam nach Höfen bei Laufen. Die Leute<br />
waren gar nicht erfreut über die Einquartierung. Erst wohnten wir im Zuhaus<br />
mehr schlecht als recht. Wenn die Bäuerin Brot backte, hatten wir vom Backofen<br />
den ganzen Rauch in der Stube. Der Hunger begleitete uns weiterhin. Erst als mit<br />
der Zeit die Bauersleute merkten, dass wir anständige, ordentliche Menschen<br />
waren, die Arbeit kannten und auch fest zupacken konnten und wollten, änderten<br />
sie ihre Einstellung. Wir durften in die „gute Stube“ umziehen und Not litten wir<br />
von da an auch nicht mehr.<br />
Acht Jahre arbeiteten wir auf diesem Bauernhof, trugen Freud und Leid mit den<br />
Dorfbewohnern und gewöhnten uns allmählich ein. Langsam kamen wir auch<br />
wieder zu Hab und Gut und freuten uns über jede Kleinigkeit, die wir erwerben<br />
konnten. Heute leben wir gut und zufrieden im neu geschaffenen Eigenheim. Uns<br />
quälen die schrecklichen Geschehen und Erlebnisse nur noch in bösen Träumen,<br />
vergessen können wir sie aber nicht.
108<br />
109<br />
Ich meine damit die Landschaft des breiten Urstromtales der Moldau, welches<br />
den südlichen Böhmerwald in zwei Bergketten scheidet. Am linken Rand liegen<br />
Kubani, Schreiner, Libin, Lissi, Chum und abschließend der Sohöninger; am rechten<br />
Ufer blicken die waldbedeckten Gipfel von Plöckenstein, Hochficht,<br />
Wittinghausen und der Brandauerberg bis zur Teufelsmauer über das von den<br />
<strong>Böhmerwäldler</strong>n sogenannte Unterland. Diese Landschaft, welche vor Jahrhunderten<br />
durch den Siedlerwillen der Klöster Goldenkron und Hohenfurth, sowie<br />
durch die Untertanen der Rosenberger „aus wilder Wurzel“ in ein fruchtbares<br />
Bauernland verwandelt wurde, war geprägt durch den Jahreszeitlichen Ablauf<br />
mit Brauchtum und Sitte dieser Roder und gab dadurch der Gegend ein recht<br />
einheitlichen kulturelles Gepräge. Die Menschen in den behäbigen Dreikant<br />
Bauernhöfen und in den jüngeren Holzhackerdörfern lebten in der Geborgenheit<br />
ihrer deutschen Siedlungen und verstanden es, sich immer den verschiedenen, oft<br />
nicht leichten Lebensbedingungen dieser Bergregion anzupassen.<br />
Die <strong>Böhmerwäldler</strong>, wie sie sich nannten, waren zwar revolutionärem Denken<br />
eher abhold, aber wirtschaftlich wusste man technische Neuerungen immer zu<br />
nutzen. Die erste Lebensader dieser Gefilde war die Moldau, welche in vielen<br />
Mäanderwindungen, eingerahmt von moorigen Auwäldern „talauswärts“ floss.<br />
Als der undurchdringliche „böhmische“ Wald durch die Siedlungsinseln aufgelockert<br />
war und sein grüner Bergmantel löcherig wurde, bekam für die Grundherren<br />
das Holz erst Wert. Es musste aber gewinnbringend zuerst in ferne Gegenden<br />
abtransportiert werden, dazu bot sich das Wasser der Moldau an. Zur<br />
Zeit der Schneeschmelze trugen ihr die Bäche und die künstlich angelegter<br />
„Schwellen“ viel Wasser zu, das man zum Triften des Scheitholzes und zum<br />
Flößen längerer Stämme ausnützen konnte. Zuerst war es das technische Wunderwerk<br />
der damaligen Zeit, der Rosenauer - Schwemmkanal, welcher den Holzreichtum<br />
an die Donau und in die großen Städte brachte. Aber auch die Moldau<br />
bekam durch den Budweiser Schiffbaumeister Adalbert Lanna in einer nach ihm<br />
benannten Moldauregulierungsgesellschaft bis in unser Jahrhundert ein geordnetes<br />
Bett in dem im Frühling das Scheitholz wie eine bewegliche Brücke dahin<br />
floss. Altwässer und „Sumpfreiben“ (Kurven) wurden begradigt aber geblieben<br />
ist immer die Doppelwindung den Flusses, der so bei Oberplan das berührte<br />
Moldauherz bildete. Als dann um die Wende des 19. Jahrhunderts der Bau der<br />
Eisenbahn von Budweis über Krummau, Gojau und Salnau bis zur Landesgrenze<br />
bei Neuthal gebaut wurde, kam eine weitere Lebensader der Wirtschaft hinzu.<br />
„Das grüne Gold“ der Wälder ließ sich nun noch leichter aus dem „armen Gebiet“<br />
wie oft unberechtigter Weise gespöttelt wurde in ferne Lande verfrachten.<br />
Selbst wenn der Hauptgewinn in die Hände des „großmächtigen Wald<br />
besitzers“, des Fürsten Schwarzenberg, floss, gewannen auch die einfachen Waldleute<br />
in der Holzerzeugung und der Fracht der Stämme Verdienst und Brot.<br />
Selbst das größte Hindernis eines gefahrlosen Holztransportes auf der Moldau,<br />
die Teufelsmauer bei Hohenfurth, wusste man zu umgehen. Man brauchte ja im<br />
Verlauf der Industrialisierung ungeheure Holzmengen, besonders als bei Kienberg<br />
eine Papierfabrik der Fa. Porak und weiter flussabwärts die noch größere<br />
Spiro - Papierfabrik bei Krummau entstanden waren. Da half der Bahnhof bei<br />
Lippen Schwebe als wichtiger Umschlagplatz und Umgehung der unbezwingbaren<br />
Teufelsmauer aus. Die Teufelsmauer blieb in ihrer wilden Schönheit weiterhin<br />
ein großes Hindernis für den Holztransport. Doch der findige Mensch fand immer<br />
eine Umgehung dieser sagenumwobenen Stromschnelle. Mir fehlen statistische<br />
Zahlen, aber es waren sicher Tausende von Festmetern an Holz, die die Wellen<br />
der Moldau jedes Jahr in die Ferne trugen. Auch sonst wurde das Gebiet allmählich<br />
für andere Berufeszweige erschlossen. Leinenerzeugung war als Hausindustrie<br />
schon lange da; in Schwarzbach wurde Graphit u.a. für die Budweiser<br />
Bleistiftfabrik Hartmuth abgebaut und auch vielseitiges Holzhandwerk prägte<br />
das Leben in den Markt und Pfarrorten. Man kann sich heute nur mehr schwer<br />
vorstellen, dass in Schwarzbach bei Festen eine Bergmannskapelle in schmucker<br />
Tracht aufspielte, aber auch noch die alte Postkutsche, die der Post Hiasl<br />
aus Friedberg mit dem von prächtigen Federbüschen geziertem Pferdegespann<br />
lenkte, täglich zwischen dem Bahnhof Schwarzbach und Friedberg verkehrte.<br />
Alt und neu bildeten immer eine glückliche Symbiose. Für die Bewohner entwickelte<br />
sich auch der Fremdenverkehr besonders gut. Zuerst waren es nur die<br />
Sommerfrischler, welche die Orte am Fuß des Hochficht in den Sommermonaten<br />
aufsuchten. Glöckelberg, Josefsthal, Neuofen und Hirschbergen wurden in<br />
Budweis und Prag als Geheimtyp geschätzter Urlaubsorte weiter gegeben. Manche<br />
blieben länger dort, wie z. B. der Schriftsteller Johannes Urzidil, der sogar<br />
Ehrenbürger von Glöckelberg wurde; manche priesen zunehmend die für damalige<br />
Verhältnisse guten Wintersportmöglichkeiten. Wanderwege wurden für<br />
Waldgänger und Naturliebhaber markiert und Touristen und Schutzhäuser gebaut.<br />
Das Land im mittleren Moldautal hatte für jeden Naturliebhaber einen eigenen<br />
Reiz, solange der Friede seine Segenshand über das Land breitete. Doch<br />
dann zog drohendes Unheil auf, Hetze und Chauvinismus legten sich Unheil<br />
verkündend auf das Leben der Menschen: Im Jahre 1937 wurde entlang der<br />
Moldau eine Bunkerlinie gebaut man nannte sie „die kleine Maginotlinie“, und<br />
drohende Geschützrohre zielten in Richtung der Grenzberge. Gottlob wurde nie<br />
ein Schuss daraus abgefeuert, aber auch die kurze empfundene Friedenspause<br />
im Jahre 1938 war nur ein Vorspiel des großen Weltenbrandes im 2. Weltkrieg.<br />
Selbst wenn das Moldaugebiet vom Kriegsgeschehen bis zum Ende fast verschont<br />
blieb, brachte die Nachkriegszeit umso größere Schrecken ins Land. Was<br />
jeder zuerst für vollkommen unfassbar hielt wurde im Jahre 1946 zur Gewissheit.<br />
Die durch Jahrhunderte hier ansässige deutsche Bevölkerung musste binnen<br />
weniger Monate ihre Heimat verlasse und das Land blieb fast menschen-<br />
Eine Landschaft ändert ihr Gesicht<br />
Rosa Tahedl
110<br />
111<br />
leer zurück. Die Zeit „der Goldgräber“ begann. Alle möglichen Stationen bis<br />
hinunter in die Balkanländer versuchte man in dem Gebiet anzusiedeln. Sie kamen,<br />
plünderten und zogen wieder ab. Nur wer als Beamter des Staates notgedrungen<br />
meistens in den Landstädten und Märkten ausharren musste, blieb einige<br />
Winter über dort, bis er wieder heim ins Inland verzog. Diese Tendenz verstärkte<br />
sich noch als nach 1948 die Kommunisten die Herrschaft übernahmen. In<br />
den Dörfern blieben als einzige Verdienstmöglichkeiten nur ein Staatsgut (Kolchos)<br />
und eine Forstverwaltung. Die Fluktuation der dort Beschäftigten war bei<br />
beiden ungeheuer groß. Jeder jagte nur einem schnellen Verdienst und einer<br />
Beutemöglichkeit nach und zog dann mit Sack und Pack beladen wieder fort. Es<br />
schien bald, als hasse der neue Staat diesen Landstrich, der ihm als Kriegsbeute<br />
zugefallen war. Der nördliche Gebirgszug mit vier Pfarrgemeinden und den<br />
dazugehörenden Dörfern wurde zu einem riesigen Truppenübungsplatz, von dem<br />
das Donnern der Geschütze und das Rasseln der Panzerfahrzeuge wie Gewittergrollen<br />
über das Land rollten. Der südliche, grenznahe Gebirgskamm aber wurde<br />
Kilometer breit zur militärischen Sicherheitszone, wo Stacheldraht und Wachtürme<br />
das Moldautal säumten. Und in der Mitte dieses Urstromtales zog die Moldau<br />
immer noch ihre alte Bahn, selbst wenn das Stifter Zitat aus dem „Hochwald“ für<br />
diese Landschaft nicht mehr galt. Wie sagte er doch:<br />
„Da ruhen die breiten Waldesrücken und steigen lieblich, schwarzblau dämmernd<br />
ab gegen den Silberblick der Moldau. Es wohnt unsäglich viel Liebes und Wehmütiges<br />
in diesem Anblick.“<br />
In den Fünfzigerjahren aber wurde auch der gemächliche Fluss zum Experimentierobjekt<br />
der Herrschenden. Uralte Pläne aus der Kaiserzeit wurden aus der Schublade<br />
gezogen. Die Moldau sollte angestaut und zum größten Elektrostromlieferanten<br />
Südböhmens werden. So würde das wenig genützte Land doch gewinnbringend<br />
für den Staat werden. Das ging auch sehr leicht, denn das ganze<br />
kilometerlange Kulturland gehörte ja jetzt dem Staat man konnte leicht darüber<br />
verfügen. So schritt die Planung fort und in der 1. Hälfte der Fünfzigerjahre begannen<br />
die Vorbereitungsarbeiten. Zuerst wurde das ganze Gebiet dem Erdboden<br />
gleich gemacht: Die Wälder wurden abgeholzt, alle Bäume auf der Flur gefällt;<br />
das Holz wurde weggebracht und alles Jungholz und Gebüsch verbrannt. Dann<br />
kamen die Dörfer und Weiler an die Reihe; sie wurden gesprengt und auf Hügel<br />
zusammengeschoben; Dachbalken, Schindel, Bretter usw. brannten wie ein Flammenmeer.<br />
Sogar die Kirche in Untermoldau musste dran glauben. Es wurde damals<br />
erzählt: Es war ein Karfreitag, als man den Turm sprengte, da hätten von irgendwo<br />
her Glocken geklungen. Es bilden sich ja immer Legenden, wenn so einschneidende<br />
Geschehnisse vorkommen. Auch der Friedhof wurde aufgelassene die<br />
Grabsteine auf eine Anhöhe bei Schwarzbach gebracht und die Gebeine in ein<br />
Massengrab dorthin umgebettet. Zu diesen Arbeiten hat man alle nur verfügbaren<br />
Kräfte, sogar Militär der sogenannten unzuverlässigen Arbeitstruppen herangeholt,<br />
denn wer -wollte schon freiwillig Totengräber einer Landschaft sein.<br />
Wenn man den Sommer über mit dem Zug von Gojau aus Richtung<br />
Oberplan fuhr, lagen einige Jahre lang schwarze Rauchwolken über dem Land<br />
und es roch nach verbrannter Erde ein bedrückendes Bild für jene, welche das<br />
Land früher gekannt hatten. Ich habe dabei manchmal gedacht, wenn der Zug im<br />
Bahnhof Schwarzbach - Stuben hielt, ob wohl der Mehrerbauernhof der Familie<br />
Stürzl in Planles auch dran glauben musste. Die alte Friedberger Postkutsche fuhr<br />
daran vorbei. An seiner Hauswand war ein Spruch gemalt - das gab es damals an<br />
einigen Häusern im Böhmerwald. Es hieß in schöner Kurrentschrift:<br />
„Ich hab ein Haus, gehört nicht mein<br />
dem zweiten wird es auch nicht sein,<br />
den dritten gehts wie mir,<br />
der vierte bleibt nicht hier,<br />
der fünfte wandert aus,<br />
nun sag mir, wem gehört das Haus?“<br />
Verschwunden die Schrift, verschwunden das Haus wie so viele andere Heimstätten,<br />
Kapellen und Bildstöcke einer alten Kulturlandschaft. Als die Jahre der<br />
Vernichtung übers Land zogen begann auch schon der Bau der Staumauer. Tiefe<br />
Schächte sprengte man in die Talenge zwischen dem Hirschberg und dem<br />
Zigeunerwald bei St. Prokop; denn das Wasser musste auf zwei 100m tiefer liegende<br />
Turbinen geschleust werden. Beim Dorf Lippen wuchs der Staudamm und<br />
unter der Teufelsmauer wurde der 11 m hohe Tunnel als Abflusskanal zum<br />
Anna Klarner: An der Moldau (Aquarell)
112<br />
113<br />
Auffangbecken bei Hohenfurth erbaute. Ein technisches Meisterwerk entstand,<br />
von dem sich die Tschechen einen Überschuss an Kraftstrom für ganz Südböhmen<br />
und das angrenzende Oberösterreich erhofften. Nun, der Wunsch war wohl auch<br />
hier der Vater der enttäuschenden Wirklichkeit; denn durch die ausgedehnte Fläche<br />
des Stausees von über 4800 ha ist auch die Wasserverdunstung so groß, dass<br />
bis zum heutigen Tag die beiden Turbinen besonders in den trockenen Herbstmonaten<br />
nur mit verminderter Kraft laufen können. Ursprünglich sollten auf jede<br />
Turbine 46 qm Wasser in der Sekunde herabstürzen. Diese Menge könnten die<br />
Moldauwellen bei einem Dauerbetrieb wohl kaum liefern. Außerdem musste ja<br />
immer ein kleiner Teil des Moldauwassers aus Naturschutzgründen in das alte<br />
Flussbett über die Teufelsmauer geleitet werden. Bei einem Überfluss an Strom<br />
hätte man wohl in der Gegenwart das umstrittene Kernkraftwerk Temelin bei<br />
Budweis nicht bauen müssen. Ursprünglich sollte nach dem Plan die 296 m lange<br />
Staumauer noch um einige Meter höher werden. Doch dann hätte der Stausee<br />
in Hochwasserzeiten bei Sarau bis an die österreichische Grenze herangereicht.<br />
Die Österreicher hätten -dies sogar zugelassen, aber nur gegen eine Grenzbegradigung<br />
im Plöckensteiner Gebiet. Doch das wollten wiederum die Tschechen<br />
nicht; so blieb es bei einer Staumauerhöhe von 25 m. Die jahrelange Arbeit<br />
am Stauwerk war um die Mitte der 50er Jahre beendet. Im Jahre 1956 begann die<br />
Flutung die wieder etwa zwei bis drei Jahre dauerte. Das Wasser stieg und stieg;<br />
sein Spiegel wurde immer größer. Der Markt Friedberg war in der Friedau schon<br />
zur Hälfte versunken; die St. Bartholomäus Kirche stand auf einer Landzunge<br />
von Wasser umgeben. In Schwarzbach wurde die neu gebaute Stubener Straße<br />
zu einem Damm; in den Wellen versank das Graphitbergwerk; die Bahnstrecke<br />
musste bis über Oberplan hinaus verlegt werden und die grenznahen Dörfer der<br />
Gemeinden Kapellen und Glöckelberg waren nur auf Umwegen zu erreichen.<br />
Fast bis Salnau reichten die Ausläufer das Sees, der in einer Länge von 48 km<br />
und stellenweise in einer Breite von 16 km das Tal füllte. Die bedrückende Fahlfarbe<br />
der Landschaft war dem unruhigen Wechselspiel der Wellen gewichen.<br />
Doch nun drohten den Anwohnern des neuen Sees andere Sorgen. An der Grenze<br />
war der Eiserne Vorhang entstanden; nicht nur die Landgrenze, auch die Wassergrenze<br />
und das war das rechte Ufer den Sees sollte hermetisch geschlossen<br />
werden. Niemand durfte fortan die grenznahen Berghänge betreten, nur Soldaten<br />
patrouillierten in dieser Flur und selbst auf dem See jagten blitzschnelle Boote<br />
des Militärs über das Wasser. Das Nordufer aber lockte trotz aller Kontrollen<br />
nicht nur Fischer und badebegeisterte Einheimische an. Die Deutschen aus der<br />
DDR hatten die Schönheit der Landschaft entdeckt. Sie durften ja nur selten<br />
einen Urlaub im Ausland verbringen, daher kam ihnen das nahe „Böhmische<br />
Meer“ sehr gelegen. Von der Oberplaner und Schwarzbacher Gemeindeverwaltung<br />
wurden Bungalows errichtet und im Sommer vermietet. Bald<br />
sah man dort mehr Trabis als Skoda auf den Parkplätzen der Badestellen.<br />
Das war nicht immer zur Freude der Einheimischen, denn der Einmarsch<br />
der DDR Truppen nach dem Putsch im 68er Jahr hatte die Furcht vor<br />
den „bösen Deutschen“ wieder verstärkt. Manche der Ostdeutschen hegten aber<br />
noch andere Urlaubsgedanken und schmiedeten Fluchtpläne in den nahen Westen.<br />
Ein gravierender Zwischenfall sei hier erwähnte. Von Simbach am Inn hatten<br />
Fluchthelfer ein Kleinflugzeug gechartert, das Ostdeutsche über die Grenze bringen<br />
sollte. Ein waghalsiger Plan, der damals gut vorbereitet in abenteuerlichen<br />
Variationen erprobt wurde. Der Pilot flog über das Mühlviertel, orientierte sich<br />
am Aussichtsturm Moldaublick an der Grenze und landete tatsächlich auf der<br />
Halbinsel bei Stüblern in der Nähe von Friedberg. Er nahm auch einige Fluchtwillige<br />
auf, musste aber vor den schnell anrückendem Militär überstürzt starten.<br />
Einige Ostdeutsche blieben zurück und wurden in der DDR zu langjähriger Haft<br />
verurteilt. In diese Stimmung brachte das Jahr 1989 mit der sanften Revolution<br />
wieder einen gewaltigen Umbruch. Der Eiserne Vorhang brach entzwei, die Welt<br />
wurde auch für den Osten offen. Zuerst war es nur Neugierde die Wanderer und<br />
Radfahrer in so lange verbotene Gefilde lockte. Auch „Westler“ kamen vermehrt<br />
an die Ufer des „Lipno“ - Stausees, der seinen Namen von dem Weiler Lippen<br />
erhalten hatte. Manche suchten vergebens Spuren ihres Elternhauses<br />
und fuhren verbittert wieder weg. Andere scheuten es, mit einen der beiden<br />
Elektroschiffe die Rundfahrt im See zu machen. „Ich könnte nie über unser<br />
versunkenes Dorf schippern. Es wäre für mich eine Schändung der Heimat“,<br />
sagte eine Frau zu mir. Doch das sind vereinzelte Stimmen. Im letzten Jahrzehnt<br />
ist der Moldau Stausee zu einem Urlaubsdorado geworden, wie es in<br />
Der Moldaustausee. Karte aus Erich Hans: Der Böhmerwald
114<br />
115<br />
Wenn ich versuche Sitten und Gebräuche aufzuzählen, die in meiner Heimat üblich<br />
waren, so will ich dies nur tun, um sie nicht in Vergessenheit geraten zu<br />
lassen. Dass diese weit über die Grenzen meines Heimatdorfes hinaus ebenfalls<br />
üblich waren, will ich damit gleichzeitig andeuten.<br />
Sitten und Bräuche im ehemaligen künischen<br />
Gerichte Eisenstraß bei Geburten, Hochzeiten und<br />
Begräbnissen<br />
Adolf Heidler<br />
Böhmen wohl kein zweites gibt. Die Exklusivhotels der einstigen Machthaber<br />
beherbergen heute erholungssuchende Urlauber aller Klassen. Kinder und Jugendliche<br />
tummeln sich vor ihren Zelten und auf dem Wasser surfen braungebrannte<br />
Sportler. Sogar Jachten gleiten mit hellen Segeln über die Wasserfläche<br />
und die Schiffsglocke läutet zur Fahrt über den See. Es ist Leben eingekehrt in<br />
die Gestade am „Lipno“ Stausee zumindest in den Sommermonaten. Man kann<br />
auch das rechte Seeufer betreten und beim Turm der Ruine Wittinghausen weithin<br />
über das lichtüberflutete Land sehen. Für die Menschen aber, die einmal hier<br />
daheim waren, bleibt ein schaler Geschmack zurück. Sie suchen lieber die Blickpunkte<br />
der Erinnerung in diesem neuen Erscheinungsbild: Da grüßt blauverdämmernd<br />
im Westen die Seewand des Plöckensteiner Sees mit dem längst vom<br />
Wald eingedunkelten Stifterdenkmal. Da sieht der Kirchturm der aus einer Ruine<br />
erneuerten Kirche von Glöckelberg aus dem Taleinschnitt zum Grenzübergang<br />
Schöneben. Gegenüber erhebt sich das Wallfahrtskirchlein Gutwasser über Oberplan<br />
und das Auge sucht zu seinen Füßen das versunkene Moldauherz. Da fährt<br />
eine Fähre an jener Stelle vorbei, wo einmal der Teichmüllerbub von Pichlern auf<br />
dar Wulda Bruck stand und sinnierte: „Furt schwimmen die Scheiter, tolaus<br />
ullweil weider und koans kimmt mehr zruck“.<br />
Solche Gedanken passen nicht mehr in das Schema dieser veränderten Landschaft.<br />
Der „Lipno“ Stausee deckt Bauernfleiß und Zerstörungswut mit fließendem<br />
Gleichmut zu. Gottlob sind die Auswüchse des Tourismus, welche sich an<br />
den Staatsstraßen nahe der Grenzübergänge so abstoßend breit machen, an den<br />
Ufern des „Böhmischen Meeres“ nicht so aufdringlich zu spüren. Die heitere<br />
Urlaubswelt ohne sprachliche und soziale Unterschiede der Badegäste verleiht<br />
dem Alltag im Moldautal wenigstens im Sommer Heiterkeit und Lebenslust. Es<br />
ist eine neue Welt, die sich in unbesehwertem Tagesvergnügen der Stifterschen<br />
Schwermut dieser Landschaft entzieht. Ob die Menschen von ihrem Aufenthalt<br />
in der Weite des Moldautales so viel Segen mitnehmen wie einst wer weiß es?<br />
Geburt: Hier tritt uns die erste Frage von Kindern entgegen. Woher kommen die<br />
kleinen Kinder? Dass der Storch sie bringt, ist die allgemeine Auffassung im<br />
ganzen Böhmerwald. Bei uns wurden sie von der „Hewangin“ (Hebamme) aus<br />
Felshöhlen, Steinhaufen und aus hohlen Bäumen geholt und der Mutter ins Bett<br />
gelegt. Manchmal haben Neugeborene sogar die Zigeuner verloren. Jeder Ortsteil<br />
hatte bestimmte Örtlichkeiten mit Eigennamen, die aber meist eine Höhle,<br />
einen Steinhaufen oder aber einen hohlen Baum zu Gegenstand hatten. Eine<br />
Schwangere durfte sich über das Gebetläuten nicht außerhalb des Hauses aufhalten,<br />
da sie sonst den feindlichen Mächten preisgegeben gewesen wäre. Nach der<br />
Geburt durfte sich die Wöchnerin nicht über die „Schorrinna“ (Dachrinne) hinausbegeben,<br />
solange sie nicht beim „Vüregehj“ (Vor oder Hervorsegnung) war.<br />
Die Segnung war gleichzeitig der erste Ausgang der Mutter zur Kirche. Das Neugeborene<br />
wurde in den meisten Fällen am Tage nach der Geburt oder spätestens<br />
am darauf folgenden Sonntag zur Taufe getragen. Die Hauptperson bei diesem<br />
Gange war natürlich der „Taftöt oder Taftot“ (Taufpate). Wer nur Gelegenheit<br />
hatte, die Taufgeher zu sehen und im Besitze einer Schusswaffe war, feuerte diese<br />
ab. Bei manchem Taufgang knallte es an allen Ecken und Enden. Einmal war<br />
es die Mitfreude an diesem großen Ereignis und zweitens sollten die Schüsse die<br />
bösen Geister von dem Kinde, solange es noch nicht getauft war, abhalten und<br />
vertreiben. Die Namengebung oblag in den meisten Fällen den Kindseltern. Früher<br />
gab man dem Kind gern den Namen der Ur oder Großeltern, in der letzen<br />
Zeit aber zumeist den Namen des Taufpaten bzw. der Taufpatin. Das neugeborene<br />
Kind bekam dann später automatisch an seinen Taufnamen die Namen seiner<br />
Vorfahren vorgehängt. Diese wurden aber weder vom Pfarrer in die Matrik eingetragen,<br />
geschweige denn von den Eltern des Kindes bestimmt. Diese Namen<br />
gab ihm die Dorfgemeinschaft, z. B. der Sohn des Hans hieß Adam, also bei den<br />
Dorfbewohnern „Honsodum“, dessen Sohn Georg „Honsodumgirgl“, dessen Sohn<br />
Franz, „Honsodumgirglfronz“. Andrerseits setzte man dem Namen noch den<br />
Hausnamen vor, so dass z. B., wenn der Hausname „Gloser“ lautete, er eben<br />
„Gloserhons’n girglfronz’n Naz“ genannt wurde. Sehr häufig aber gab man auch<br />
den Kindern den Namen des Heiligen, der gerade auf den Geburtstag fiel. Ein<br />
totgeborenes Kind wurde an einem eigens bestimmten Platz auf dem Friedhof<br />
begraben. Machte die Mutter mit dem Kind den ersten Besuch in der Nachbarschaft,<br />
so wurde dem Kind ein Ei geschenkt. Das „Schoderoar“ auch<br />
„Schnoderoiadu“ (Schnatterei) genannt wurde. Vielfach wurde dabei auch der<br />
Spruch gesagt:<br />
Wenn d’Henna ofangan z’gaggern<br />
fongst on zum schnattern<br />
wenn d’Henna onfongand zum leg’n,<br />
fongst on zum red’n!<br />
Jeder, der ein Kind zum ersten Mal zu sehen bekam, sagte: Pfoits Gott (Behüt es<br />
Gott). Dieser Ausspruch sollte das Kind vor Beschreiungen und Verwünschungen<br />
schützen.
116<br />
117<br />
Partnersuche: Die spätere Kindheit zählt bestimmt auch verschiedene Gebräuche,<br />
doch im wesentlichen sind diese nicht von so großer Bedeutung. Interessant<br />
werden die Bräuche erst wieder, wenn der „Bou“ oder das „Deandl“ auf Freiersfüßen<br />
gehen. Von einer offiziellen Verlobung konnte man bei uns nicht reden.<br />
Die Bekanntschaften dauerten manchmal sehr lange, bevor es zu einer Heirat<br />
kam. Beiden Verliebten machten sich das alles heimlich miteinander aus. wenn es<br />
dann soweit war, trat der Freier vor die Eltern der Auserwählten und bat um ihre<br />
Hand. Bis dahin aber war ein langer und schwieriger Weg zu überwinden.<br />
Freigehj, Fensterl’n, Menschern:<br />
Hat ein Bursche ein Mädel sich erkoren, so versucht er, um ihr näher zu kommen,<br />
bei Nacht und Nebel an ihr Kammerfenster zu gelangen. Er will sich ja damit<br />
Gewißheit verschaffen, ob ihm die Auserkorene auch erhört und ihm zugeneigt<br />
ist. Mittwoch und Samstag waren zwei Tage, an denen man bei uns auf die Frei,<br />
zum Fensterln oder zum Menschern ging. Am Freitag, so hieß es allgemein, gehen<br />
die Lausigen auf d’Frei. Darum hielt jeder anständige Bursche die vorgenannten<br />
zwei Tage ein. Stundenweit wurde gelaufen und kein Wetter gescheut.<br />
Und wenn’s Zaunstecken schneibt, „af d Frei wird heut gonga!“ War er am Ziel,<br />
kam auf sein Klopfen die Auserwählte ans Fenster geschlichen. Vorsichtig spähte<br />
sie zwischen den Vorhängen durch, um zu sehen, ob auch der Richtige draußen<br />
war. War dies der Fall, dann wurde getuschelt und erzählt. Aber nur zu schnell<br />
verging die Zeit und der Freier mußte wieder fort. Schnell wurde noch der nächste<br />
Treffpunkt ausgemacht. Der Bursche versuchte noch ein Busserl zu bekommen,<br />
sie aber sagte nur: „s’nächstemoal, heint net“, macht das Fenster zu und<br />
schlüpfte unter die Decke. Erst weit weg vom Haus der Geliebten entringt sich<br />
seiner vor Freude überquellenden Brust ein Juchatzer, der weit hin durch die<br />
Wälder hallt und sogar noch die Liebste aus ihrem Traume weckt. Wieder haben<br />
sich zwei Herzen gefunden und wenn nichts dazwischen kommt, wird bald Hochzeit<br />
sein.<br />
Hochzeit: Eines Tages gegen Abend geht das junge Paar zum Pfarrer „Einschreiben“.<br />
Die einzigen Begleiter sind die zwei Zeugen. Dreimal wird nun das Paar<br />
vom Priester in der Kirche verkündet. Der Wortlaut der Verkündung war ungefähr<br />
folgender: „Aufgeboten und in den heiligen Ehestand wollen treten der ledige<br />
Bauerssohn N. N., geb. am ...., ehelicher Sohn des N. N., Bauer in Eisenstraß und<br />
der N. N., geb. N., und die ledige N. N., geb. am ..., in ...., Tochter des…“, usw.<br />
Bei der ersten und zweiten Verkündigung (im Volksmund hieß es „obag’foll’n“,<br />
durfte das Paar nicht in der Kirche anwesend sein. Nachdem das Aufgebot dreimal<br />
verkündet und von keiner Seite angefochten wurde, kann nun die Hochzeit stattfinden.<br />
Der Hochzeitslader hat es nun tagelang eilig, die vielen Gäste, deren<br />
Namen ihm vom Bräutigam und der Braut schriftlich übergeben worden sind,<br />
persönlich aufzusuchen und zur Hochzeit zu laden. Einen mit farbigen Bändern<br />
geschmückten Stock, um den Hut einen Myrthenkranz und ebenfalls farbige<br />
Bänder, so tritt er ins Haus. Bei der Tür stehenbleibend spricht er: „Geehrte<br />
Familie N. N.! Ich bin beauftragt von dem löblichen Braut<br />
paar euch mit einer herzlichen Hochzeitseinladung zu begrüßen. Der Bräutigam<br />
N. N. und die Braut N. N. haben sich entschlossen in den heiligen Stand der Ehe<br />
einzutreten und bitten euch als Hochzeitsgäste. Die Hochzeit findet im Gasthaus<br />
des N. N. am .. statt. Nach den Frühstück gehen wir in die Kirche zu heiligen<br />
Trauung. Nach der Trauung marschieren wir wieder zurück in die Wirtschaft<br />
zum Hochzeitsmahl“. Dann malt er mit einigen schwungvollen Strichen eine<br />
Zitrone mit Zweigen und Blättern an die Zimmertür, darunter setzt er das Datum,<br />
wann die Hochzeit stattfindet und zuletzt den Preis für das Hochzeitsmahl. Er<br />
übermittelt noch einmal die herzlichsten Grüße von Braut und Bräutigam und<br />
fragt, ob mit Gästen zu rechnen ist, notiert dies und geht weiter in ein anderes<br />
Haus. Schon am frühen Morgen des Hochzeitstages sind die Musikanten<br />
unterwegs, um den Brautführer, die Kranzljungfrau, die Brautmutter und zuletzt<br />
den Bräutigam von zu Hause abzuholen. Lustige Märsche und Landler schmettern<br />
nun die Musikanten in die frische Morgenluft. Im Hause der Braut angekommen,<br />
wird diese vor dem Bräutigam versteckt und erst nach einigen schwierigen<br />
Rätselfragen, die ihm die Brautmutter zu knacken gibt, wird sie ihm zugeführt.<br />
Den bereits anwesenden Hochzeitsgästen, die mit dem Bräutigam gekommen<br />
sind, sowie denen, die sich bei der Braut versammelt haben, wird ein Imbiss,<br />
aber kein Schnaps und kein Bier gereicht. Endlich ist es soweit, dass der<br />
Gang zur Kirche angetreten werden kann. Jetzt ist der Hochzeitslader an der<br />
Reihe: „Geehrtes Brautpaar, Ihr, die Ihr Euch versprochen habt, am heu-<br />
Budweiser Sprachinsel: Vorreiter und Wagen im Hochzeitszug Verlag <strong>Deutscher</strong><br />
<strong>Böhmerwaldbund</strong>, Budweis. Entwurf von G. Moest. Ansichtskarte<br />
um 1910. (Sammlung Reinhold Fink)
118<br />
118<br />
119<br />
119<br />
tigen Tag vor den Traualtar zu treten, um eins dem anderen das Versprechen zu<br />
geben, in Freud und Leid, in Unglück und Gefahr und wie sich das Leben nur<br />
möge gestalten, einer am anderen festzuhalten. Zum letzten Mal seid Ihr als<br />
glückliches Brautpaar zu sehen, nur kurze Zeit und es ist geschehen. Nicht Bräutigam<br />
noch Braut ist fürderhin zu seh’n, sondern ein Ehepaar wird fortan durchs<br />
Leben geh’n. Nun zieht mit Gott und seid stets frohen Mutes, denn täglich wird<br />
sich euer Glück erneuern und was das Leben Schönes bietet, Euch soll’s im<br />
reichen Glück beschieden sein. Nie treffe Euch Unglück, nie Kummer und<br />
Schmerzen, das wünschen Euch alle aus ganzem Herzen.“ Auf einem Schemel<br />
knien nun die Brautleute und erwarten den Segen der Eltern. Diese zeichnen<br />
das heilige Kreuzzeichen auf die Stirne und sprechen dabei: „Der Segen Gottes<br />
ruhe auf Euch und Euren Kindern. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des<br />
Heiligen Geistes.“ „Amen“ sprechen die Brautleute und nicht selten rinnen dabei<br />
Tränen über die Wangen. Noch ein „Vaterunser“ vom Hochzeitslader vorgebetet,<br />
dann setzt die Musik mit einem schneidigen Marsch ein. Juchatzer folgen<br />
auf Juchatzer, die Gesichter hellen sich wieder auf und der Hochzeitszug setzt<br />
sich in Marsch. Kaum aber kommt man an die Haustüre, stellt sich schon das<br />
erste Hindernis in den Weg. Kinder aus der Nachbarschaft haben einen Strick<br />
mit bunten Bändern vor die Haustüre gespannt und Bräutigam und Braut, sowie<br />
auch die anderen Gäste müssen sich den Weg ins Freie durch ein Geldstück<br />
erkaufen (Houchzat afholt’n). Auf dem Weg zur Kirche werden sie noch öfter<br />
aufgehalten. Jetzt nimmt der Brautführer die Braut in seine Obhut und die<br />
Kranzljungfrau (Brautnaschl) hängt sich fest in den Arm des Bräutigams, gefolgt<br />
von der Brautmutter und den zwei Zeugen. An der Spitze des Zuges marschiert<br />
der Hochzeitslader. Bevor man jedoch zur Kirche schreitet, wird im Gasthaus<br />
die „Gaglhenn“ eingenommen (Frühsuppe). Von allen Seiten kommen nun<br />
die geladenen Hochzeitsgäste und jeder Einzelne wird von der Musikkapelle<br />
mit einem Marsch oder einem Landler hineingespielt (Einspiel’n). Ist der letzte<br />
Gast angekommen, so wird mit dem Essen begonnen, doch nicht bevor wiederum<br />
ein Tischgebet vom Hochzeitslader gesprochen wird. Der Brauttisch steht im<br />
Herrgottswinkel, wo der Bräutigam, die Braut, der Brautweiser, die Brautnaschl,<br />
die Brautmutter und die zwei Zeugen Platz nehmen. Nach dem Essen ziehen sie<br />
in die Kirche.<br />
Die Gäste nehmen in den Bänken Platz, während der Bräutigam, die Braut, der<br />
Brautweiser mit der Brautnaschl und die Brautmutter an den Stufen des Hochaltares<br />
knien. Das Eingangslied der Orgel verstummt, und während der Pfarrer<br />
aus der Sakristei tritt und dem Altare zugeht setzt der Kirchenchor ein: „So<br />
nimm denn meine Hände und führe mich an mein selig Ende und ewiglich“,<br />
Braut und Bräutigam legen nun die Hände ineinander und der Priester nimmt<br />
die Trauung vor. Danach begibt sich das junge Paar in die Sitzbänke. Der Bräutigam<br />
führt die Braut aber nur bis zur Bank, dann nehmen aber die Brautmutter<br />
und die Brautnaschl die Braut wieder in ihre Mitte. Der junge Ehemann sitzt<br />
zwischen Brautweiser und den zwei Zeugen. Nach dem „Agnus Die“ schreitet<br />
das junge Paar wieder zum Hochaltar, um dort aus der Hand des Priesters den<br />
Kindersegen zu empfangen. Das Brautpaar verlässt als letztes die Kirche. Ein<br />
schneidiger Marsch ertönt und der Hochzeitslader verkündet: „D’ Brautmutter<br />
hot’s Ofaschüßlrenna dalaubt, tout’s mi oba dabei net übadübarenna!“ Schon<br />
drängen sich eine Anzahl stämmiger Burschen und Männer an die Spitze des<br />
Zuges, die nun um die Wette laufen, um den Hut des Hochzeitsladers zu erwischen.<br />
Dem Gewinner winkt ein zechfreier Hochzeitstag. Der Hochzeitslader<br />
steht etwa dreißig Meter vor den Läufern und hält seinen Hut mit dem Stock in<br />
die Höhe. Sobald er den Stock sinken lässt, ist das das Zeichen zum Start. Den<br />
Hut in der Hand saust er nun die Straße entlang, die Läufer hinter ihm her. Bald<br />
hat ihn einer eingeholt und nimmt ihm den Hut ab, schwenkt in hin und her und<br />
juchatzt dabei. Die Musikanten spielen dem glücklichen „Ofenschüßlrenner“ einen<br />
Marsch (ich möchte hier nicht versäumen, drei der besten Ofenschüßlrenner zu<br />
nennen, die jahrzehntelang solche Rennen gewannen. Röiderhuis Korl, Lorenz<br />
Sepp und Korlhansl Korl). Dann versammeln sich alle im Gasthaus, wo die Tafel<br />
bereits gedeckt ist. Nach dem Tischgebet trägt der Hochzeitslader die erste Schüssel<br />
Suppe an den Brauttisch. Aber er Fällt hin und die Schüssel zerbricht. Zerbricht<br />
die Schüssel, was meistens der Fall war, so bedeutet dies Glück für das<br />
junge Ehepaar. Schon kommt aber die Bedienung und setzt den Brautleuten vor.<br />
Wer nun als erster mit dem Löffel in der Schüssel ist, hat das „Hausrecht“ (Herr<br />
im Haus). Das Hochzeitsmahl besteht oft aus acht bis zehn Gängen. Als vierter<br />
Gang kommt der Schweinsbraten, den wieder der Hochzeitslader auf den Tisch<br />
trägt. Schön aufgeputzt mit einer roten Schleife versehen liegt das Sauschwanzl<br />
obenauf. Kaum aber hat er die Schüssel hingestellt, greift sich die Brautmutter<br />
das Schwanzl und schmeißt es dem Hochzeitslader hinterher, der aber geschickt<br />
ausweicht. Nach dem vierten Gang kommen die „Nochigehjer“ (Nachgeher), die<br />
nun am Tisch Platz nehmen, den die anderen verlassen haben. Während des Mahles<br />
wird den Gästen der Dank für ihr Erscheinen im Namen des Brautpaares durch<br />
den Hochzeitslader ausgesprochen (übers Mahl spielen). Der Dank hat folgenden<br />
Wortlaut: „Es bedankt sich das ehr und tugendhafte Brautpaar gegen den N.<br />
N., Taufpate des Bräutigams, der heute auch erschienen ist, für seine Teilnahme<br />
gepfiffen und geblasen zu seiner Ehr, Musikanten lasst Euch hör’n und spielt<br />
ihm einen Marsch zu Ehr’n.“ Meist wurde das Lieblingsstück des Geehrten gespielt.<br />
So wird einer nach dem anderen abgehakt, und die Musikanten haben<br />
fleißig zu spielen. Zum Brautführer gewendet, spricht der Hochzeitslader: „Der<br />
Brautweiser schaut mich immer von der Seite an, als wenn ich wäre schuld daran,<br />
dass er mit der Kranzljungfer nicht kupelieret ist. Hätte aber der Brautweiser<br />
meinen Verstand und meinen Sinn, so ging er heute noch zum Pfarrer hin und<br />
tät solange plaudern mit ihm, dass er mich möcht bis morgen Abend zur<br />
Kranzljungfer zuwikupliern“. Während die Gäste sich an den Speisen gütlich<br />
tun und sich unterhalten, wird es am Brauttisch auf einmal lebendig. Ein Gast<br />
hat sich unter den Brauttisch geschlichen und der Braut den Schuh ausgezogen.<br />
Schon ist er aus der Tür hinaus, jauchzend und den Schuh schwingend
120<br />
121<br />
(Brautschouhstehl’n). Eine ganze Gruppe zieht nun mit dem „Dieb“ durch das<br />
Dorf und verschwindet dann irgendwo in einer Wirtschaft. Nun ist es Sache des<br />
Bräutigams den Brautschuhdieb zu finden und durch Bezahlen der bereits gemachten<br />
Zeche den Brautschuh auszulösen. Nach dem Hochzeitsmahl wird zum<br />
Brauttanz geschritten. Bevor jedoch der Bräutigam sein junges Weib zum Tanz<br />
führen darf, muss er noch einige Rätsel lösen, die ihm wieder von der Brautmutter<br />
aufgegeben werden. Nach den Antworten wird ihm die Braut über den Tisch<br />
zugeführt. Beim Brauttanz ist es die Aufgabe des Brautweisers sich um die Braut<br />
zu kümmern, damit sie nicht gestohlen wird. Braut und Bräutigam werden als<br />
erstes vom Hochzeitslader zum Tanz aufgeboten, es folgen dann die übrigen Ehrengäste<br />
und Verwandten. Auf einem Zettel aufgeschrieben, fordert er mit folgendem<br />
Worten zum Ehrentanz auf: „Josef A., der Braut ihr vielgeliebter Onkel,<br />
wird aufgeboten mit der Braut ein Ehrntanzl zu tanzen. Vivat, sie soll’n leb’n,<br />
Musikanten lasst Euch hör’n und spielts er a Tanzl zu Ehr’n!“ Der Aufgebotene<br />
begibt sich zur Braut, die der Brautweiser fest im Arm hält und tanzt eine kurze<br />
Runde. Wachsam schreitet der Brautführer hinter dem tanzenden Paar her, um ja<br />
die Braut sofort wieder in seinen schützenden Arm zu nehmen, wenn der Tanz zu<br />
Ende ist. Aber schließlich erwischt doch einer der Gäste die Braut und ist schon<br />
bei der Türe draußen. Jetzt geht es um den Geldbeutel des Brautführers, der die<br />
Braut auszulösen hat.<br />
Manchmal wird dem Hochzeitslader der Zettel mit den Namen der Ehrengäste<br />
entrissen, darauf informiert der die Gäste wie folgt: „Wöit’s selba g’sehn hobt’s,<br />
bin i übafolln wor’n. Schworz af weiß hob i net und a so woaß i’s net. So wünsch<br />
i den Brautleit’n noch viel Glück und Segen und den Houchzatgästen a recht a<br />
guati Unterhaltung bis in d’Fröih!“ Das ist der Auftakt für den allgemeinen<br />
Hochzeitstanz. Von nun an hat der Brautführer für die Sicherheit der Braut nicht<br />
mehr zu sorgen, dies obliegt nun für immer dem Bräutigam. Tritt ein Gast den<br />
Heimweg an, so spielt ihn die Musik hinaus bis vor die Haustür. Das Brautpaar<br />
begleitet den Gast ins Freie und verabschiedet sich dann (Außispiel’n). Erst nach<br />
dem letzten Gast geht auch das neuvermählte Paar nach Hause.<br />
Anmerkung: Die Hochzeitssprüche wurden mir von dem in Eisenstraß lange Jahre<br />
wirkenden Hochzeitslader, Anton Kahlhofer (Seemühle) überlassen.<br />
Tod und Begräbnis Seit eh und je hat man den Toten auf einem Brett aufgebahrt,<br />
welches dann der Tischler entsprechend formte und bemalte und mit irgendeinem<br />
Spruch versah. Dieses Totenbrett wurde dann bei einem Wegkreuz aufgestellt,<br />
wo es die Vorbeigehenden daran erinnerte, ein Vaterunser für den Verstorbenen<br />
zu beten. Ohne Telefon und ohne Telegramm durcheilte die Trauerbotschaft<br />
vom Ableben eines Bewohners den ganzen Ort. Am gleichen Abend noch<br />
zog man in das Trauerhaus zum Beten (Aufbleib’n). Der Besuch der Aufbleiber<br />
sollt die Trauernden leichte über den schweren Verlust, den sie erlitten haben,<br />
hinwegbringen. Außerdem sollten sie nicht allein bei dem Toten sein. Gegen elf<br />
Uhr nachts begann das Gebet und es dauerte länger als eine Stunde. Drei Nächte<br />
hintereinander wurde aufgeblieben. Bevor man den Toten aus dem Haus trug,<br />
Die Maurer und Zimmerer begannen noch bis zum 1. Weltkrieg die Arbeit um 6<br />
Uhr morgens und beendeten sie abends um 6 Uhr. Mancherorts auch erst um 7<br />
Uhr.<br />
Beim Verlassen der Baustelle schlugen die Zimmerleute mit der Hacke ein Kreuz<br />
in einen Balken, damit sich über Nacht keine bösen Geister setzten, denn sonst<br />
könnte am anderen Tag ein Unheil geschehen. Das Setzen des Grundsteines kostete<br />
dem Bauherrn stets ein paar Liter Bier. Ein Nichtberechtigter, der den Bauplatz<br />
betrat, um ihn zu besichtigen, wurde „eingeschnürt“. Dabei wurde eine<br />
Schnur vorgehalten und der Betreffende nicht eher herausgelassen, bis er einen<br />
Doppelliter Bier bezahlte. Mancherorts war es Sitte, wenn der Zimmermeister<br />
einen Bau ausführte, dass der Bauherr den ersten Holznagel mit drei Hieben einschlagen<br />
musste. Brauchte er mehr Schläge, so musste soviel Liter Bier zahlen<br />
als er Schläge mehr brauchte. War der Dachstuhl aufgestellt, wurde ein Fichtenbäumchen<br />
mit bunten Bändern geschmückt und am obersten Ende des Dachgiebels<br />
befestigt. Dann begann die Hebfeier. Der Meister oder der älteste Zimmergeselle<br />
stand nun oben auf dem Dachstuhl und sprach den „Hebspruch“.<br />
Meister, Maurer, Zimmerleut,<br />
für Euch ist froher Festtag heut’.<br />
Hoch ragt der Bau zu Lob und Preis<br />
Von Eurer rüh’gen Hände Fleiß.<br />
Rasch schritt der stolzer Bau voran<br />
Genau wie nach dem Stundenplan.<br />
Das Wetter war uns wohl gewogen,<br />
Das war besondere Gnad von oben.<br />
Auch sonst hat nichts den Bau gestört,<br />
Von Unglück hat man nichts gehört.<br />
Nun steht er unter Dach und Fach<br />
Und strebt schnell der Vollendung nach.<br />
Wir wollen festhalten an den Sitten<br />
Und werfen das Glas zu lauter Splittern.<br />
Handwerksbräuche der Maurer und Zimmerer<br />
Adolf Heidler<br />
setzte man den Sarg an der Türschwelle dreimal hintereinander ab. War das Begräbnis<br />
vorüber begaben sich die Trauergäste zum Leichenschmaus in das Wirtshaus.<br />
Je nach Reichtum uns Ansehen und dauerte dieser oft bis in die Nacht hinein.<br />
Um den Tod gab es in unserer Gegend weniger Sitten und Gebräuche als<br />
beim Eingang in das Leben und bei der Hochzeit.
122<br />
123<br />
Die Scherben vom Glas bezeichnen:<br />
Niemals soll das Glück hier weichen.<br />
Auch wünsch ich noch das Allerbeste,<br />
Das sei mein Spruch zum Hebefeste.<br />
Doch Euch fordere ich nach altem Brauch<br />
Zum Ruf aus voller Kehle auf:<br />
Die Bauherrschaft, sie lebe hoch,<br />
Sie lebe dreimal hoch, hoch, hoch<br />
Nach dem Spruch leert er ein mit Bier gefülltes Glas auf das Wohl des Bauherrn<br />
und wirft es dann hinunter auf die Erde, wo es in tausend Scherben zersplitterte.<br />
Bei der Hebfeier wurde nicht nur gegessen und getrunken, sondern auch getanzt.<br />
Dies zog sich manchmal bis weit in die Nacht hinein. (Überarbeitet von Ingomar<br />
Heidler)<br />
Sagen und Bräuche.<br />
Die verschiedensten Bräuche spielen sich bei der Flachsarbeit ab. Schon am<br />
Fronleichnamstage werden von den Birken, welche zur Verschönerung der errichteten<br />
Altäre gesetzt werden, Äste abgeschnitten und am Johannistage ins<br />
Flachsfeld gesteckt, dieses „gekrönt“. Solange wie diese Ruten soll auch der<br />
Flachs wachsen. Der Flachs verlangt bekanntlich sehr viel Arbeit. So erzählt<br />
man, dass ein fremdes Fräulein im Moldautal eine Bäuerin beim Flachsjäten<br />
antraf und diese um soviel Flachs bat, als zu einem Hemde genügen würde. Es<br />
verlor aber die Geduld und verzichtete auf das Geschenk, als es erfuhr, wie vieler<br />
Arbeit es noch bedürfe, bis ein Linnen daraus würde. – Nach Simrock spielte der<br />
Flachs bei den Germanen eine gar wichtige Rolle und diese Vorstellung ist im<br />
Böhmerwalde noch bekannt. Um Wuotanstag (Mittwoch) darf kein Flachs<br />
Flachsarbeit im Böhmerwalde<br />
N.N.<br />
Leopold Hafner: Der Kunstmaler Dieter Stauber<br />
Leopold Hafner: Gregor Mendel für die<br />
Walhalla bei Regensburg
124<br />
125<br />
gejätet werde, auf das Woutan nicht erzürne und mit seinem Rosse den Samen<br />
zertrete. Auch darf während der „Unternächte“, der zwölf Nächte von Weihnachten<br />
bis Dreikönig, nicht gesponnen werden und auch kein Flachs darf während<br />
der Zeit am Rocken bleiben, da sonst Wuotan durchjagt. Als Hauptgöttin, als<br />
Beschützerin des Flachsbaues, wurde früher Frau Holle (Perchta, Oftara, die Weiße<br />
Frau) angesehen, die an fleißige Spinnerinnen oft Spindel austeilte, faulen aber<br />
den Rocken anzündete oder besudelte. Kamen Weihnachten und zog die Göttin<br />
an der Spinnstube vorüber, so wurden alle Spinnrocken reichlich mit Flachs<br />
behangen; zum Fasching, wo sie zurückkehrte, musste alles abgesponnen sein,<br />
worauf der Rocken versteckt wurde. Fand nun die Göttin dies alles in Ordnung,<br />
so sprach sie ihren Segen: „ So manches Haar, so manches gute Jahr!“ Der<br />
<strong>Böhmerwäldler</strong> verehrt im Anklang an diese Frau Holle die hl. Gertrud als Schutzgöttin<br />
der Spinnerinnen. In einem Kalender vom Jahre 1745 ist diese Heilige<br />
abgebildet mit einer Garnspindel, an der zwei Mäuse nagen. Es bedeutet dies,<br />
dass am Gertrudtage, am 17. März, sowie auch am Vorabende, niemand spinnen<br />
dürfe, sonst fressen die Mäuse das Gespinst vom Rocken.<br />
„Mit Gertrudis läuft die Maus<br />
auf´s Feld hinaus.“<br />
Die Höhe des Flachses im laufenden Jahre erkennt man an den drei Eiszapfen,<br />
welche an den drei Faschingstagen vom Dache herabhängen, sowie aus den Flachspflanzen,<br />
die an diesem Tage in einen Topf gesät und natürlicherweise abgemessen<br />
werden. Wenn am Lichtmessmorgen recht viele Eiszapfen vom Dache<br />
herabhängen, so gerät der Flachs gut. Eine Bäuerin, die Faschingsbäuerin im<br />
Moldautale, spann gern in mondhellen Nächten. In der Feisten Rauhnacht (Abend<br />
des 5. Jänner) spann sie auch, und als der Vollmond das sah, ward er zornig und<br />
warf ihr sieben Spindeln in die Stube hinein, ihr befehlend, sie bis Mitternacht<br />
voll zu spinnen. Aber die Klugheit der Frau siegte. Sie spann auf jede Spindel ein<br />
Garnringel, und als es vom Kirchturme in Oberplan her zwölf Uhr widerhallte<br />
und der Mond wieder in die Stube lugte, lagen die sieben Spindeln umsponnen<br />
vor ihr. Als der Mond das sah, bemerkte er: „Heute hat dir deine Schlauheit geholfen.<br />
Finde ich dich am Dreikönigsabend noch einmal beim Spinnradel, so<br />
wirst du zerrissen, denn die Nacht gehört mir, der Tag gehört dir.“ Die Tochter<br />
der Oberhofbäuerin war ein sehr neidisches Ding. Ihre Mutter ließ durch sie den<br />
Armen öfters Almosen verabreichen. Darüber zornig, sprach die Tochter: „Da<br />
möchte ich lieber im Monde spinnen!“ Und siehe, plötzlich zog sie der Mond zu<br />
sich hinauf, und seitdem muß sie im Monde spinnen und was sie das ganze Jahr<br />
hindurch spinnt, fällt im Herbst herab als sogenannte Marienfäden, da jene Tochter<br />
Marie hieß. Was haben unsere Spinnerinnen jetzt für Bräuche? Öfter machen<br />
die Dirnen „Halbe“, das heißt, sie gehen auf einige Minuten in die frische Luft<br />
hinaus, ein paar Mal „Schlittenfahren“ oder „Schneeball werfen“. Oft gehen Spinnerinnen<br />
mit Rad und Rocken in ein anderes Haus, in die „Rockenfahrt“, „Rockenreis“,<br />
und da wird dann gesungen, Rätsel aufgegeben usw.. Besonders oft hört<br />
man dabei folgende Rätsel:<br />
Doch mit Bedauern sei es gesagt, dass der Flachsbau im Böhmerwalde sehr in<br />
Abnahme begriffen ist. Früher gab es da eine Anzahl Leinweber, heute ist das<br />
nicht mehr. Der „Schnalz“ gesponnener Flachs, wozu eine gute Spinnerin, 1 bis 1<br />
½ Tage zum Spinnen braucht, kostete vor dem Kriege, man staune, nur siebzehn<br />
Kreuzer. Mehr gaben die Garnhändler nicht. Es ist daher kein Wunder, wenn das<br />
Spinnen im Böhmerwalde außer Gebrauch kam, und nur für Hausbedarf noch<br />
vorkommt. Aber leider geht damit auch ein gut Stück des interessanten Volkslebens<br />
verloren. Freilich ist dafür wieder ein Ersatz eingetreten: die Gänsezucht<br />
und die „Federnbälle“. In jedem Dorfe trifft man im Winter allwöchentlich mehrere<br />
Federnbälle. Die ledigen Mägde vom ganzen Dorfe werden abends zusammengerufen,<br />
um Federn zu „streifen“ (schleiten). Es wird bei diesem „Streifen“<br />
meistens gesungen, was bis etwa zehn Uhr dauert. Dann wird Milchsuppe allgemein<br />
aus einer großen Schüssel, die mitten auf den großen Tisch gestellt wird,<br />
gegessen, zuletzt etwas Käse und Brot, oder (was jedoch eine Seltenheit ist) Kaffee<br />
vorgesetzt. Dann geht die Kurzweil erst recht los. Es kommen die ganzen<br />
„Buam vom Dorf“ und noch von anderen Dörfern zusammen und da nimmt der<br />
Blätterbauer Hansl die Mundharmonika, sein Bruder, der Peter, den Triangl,<br />
manchmal der Isidor noch die Zither dazu, und bei dieser Musik wird bloßfüßig<br />
(manchmal in den Strümpfen oder mit den schweren Holzschuhen) getanzt. Die<br />
volkstümlichen Tänze, die da gespielt werden, wenn man sie nach den Ausdrücken<br />
der <strong>Böhmerwäldler</strong> selbst nennt, sind etwa diese: „Die Welt ist ka Kuhhaut“,<br />
„Seitenhalb Höritz liegt Mauthstadt“, „Wien bleibt Wien“, „Der von<br />
Reweschin“ usw.. Ein gut Teil Volksleben spielt sich bei diesen Tänzen ab, und<br />
wie frei es vor sich geht, kann nur der sagen und schreiben, der es selber mitgemacht<br />
hat, der im Volke aufwächst, in ihm lebt, fühlt und denkt. (Aus „Waldheimat“<br />
5/1933)<br />
Rundumadum Ringel,<br />
Ich tritt dir aufs Züngel<br />
Und rupf´ dir zum Graus<br />
Zuletzt die Haare aus.<br />
(Die Auflösung dieses Rätsels ist Spinnrad und Rocken.)<br />
Inwendig rauh, auswendig rau,<br />
Wird ein rauh´s Würmerl draus.<br />
(Das ist der Flachs am Rocken.)<br />
Abends kommen dann die Buam in ein solches Haus und dann wird oft getanzt<br />
oder es werden Spiele gespielt, z.B. „Hirschenabjagen“, „Schuhsuchen“, „Die<br />
Farbe“, Ballen einstreichen“, Nachbar lieben“ usw.. Manchmal hört man dabei<br />
auch das Lied:<br />
„Du floxhoarats Dirndl,<br />
I hob di so gern,<br />
I möcht weg´n dei Floxhoar<br />
A Spinnradl wern.“
126<br />
127<br />
Es war ein schöner klarer Morgen. Ich konnte schon lange nicht mehr schlafen,<br />
denn heute durfte ich mit meiner Mutter zum Jahrmarkt in die Bezirksstadt gehen.<br />
Wir machten uns auf den zweieinhalbstündigen Weg. Bald gesellten sich<br />
andere Frauen zu uns, die alle denselben Weg gingen. Sie hatten viel zu reden<br />
und ich trottete hinter ihnen her. Was sie erzählten, interessierte mich nicht, weil<br />
es gar viel zu schauen gab, denn die Gegend kannte ich noch nicht. Bald waren<br />
wir unten in der Ortschaft Grün. Ich staunte über die vielen Häuser, die hier<br />
beieinander standen. Der Grünbach, der auch bei uns als kleiner Wassergraben<br />
vorbeifloss, war hier schon gut zwei Meter breit. Auf der Brücke stand der Heilige<br />
Nepomuk, seltsamerweise mit schweren Ketten befestigt, da er schon einmal<br />
gestohlen worden war. Auf der Bezirksstraße ging es lebendig zu. Schwerbeladenen<br />
Fuhrwerke wurden von Pferden gezogen, die sich gehörig einstemmen mussten,<br />
um den Wagen zu ziehen. Steirerwägen mit schweren Ackergäulen trabten gemütlich<br />
dahin und leichte Kutschen mit rassigen Pferden flitzten vorbei. Hinter<br />
allen aber staubte es, dass man kaum die Augen offen halten konnte.<br />
Irgendwann kamen wir über eine große Brücke, unter der ein Bach floss. „Das ist<br />
die Angel“, sagte meine Mutter. Ich bestaunte das große Wasser und Mutter erklärte<br />
mir, dass hier auch das Wasser des Grünbaches bereits mitfließt. Dann<br />
waren wir in der Bezirksstadt. Ober den vielen großen Häusern der Stadt lachte<br />
die Sonne. Es wimmelte nur so von Leuten zwischen den aufgestellten Marktbuden.<br />
Lachend, staunend und schwätzend wälzte sich die Menschenmenge durch<br />
die Gassen. Am meisten aber glaube ich, habe ich gestaunt. Auf allen Ständen<br />
schrieen die Verkäufer; einer wollte den anderen übertreffen. Jeder lobte seine<br />
Ware über den Sanktus: „Kaufts, Leutl kaufts, heit kriegts alles um den halben<br />
Preis, morgen kostet es das Doppelte!“ „Hallo Muadarl“, rief ein anderer,<br />
„brauchens keine warmen Schuh für den Winter, heuer wird er streng und kalt, so<br />
dass die Eisbären selber Filzpantoffeln und Ohrenschützer tragen müssen.“ Die<br />
Leute lachten und gingen weiter. Ein Stück weiter drehte sich ein Ringelspiel<br />
(Karussell), und ich durfte auf einem Pferd ein paar Runden drehen. Ach war das<br />
schön. Dann kamen wir zu einem Stand, an dem verkaufte ein „richtiger Türke“,<br />
er hatte eine hohe rote Mütze mit einer schwarzen Quaste auf, echten türkischen<br />
Honig. Meine Mutter kaufte mir ein großes Stück. Je näher es dem Mittag zu<br />
ging, desto mehr Leute kamen und immer öfter verlor ich meine Mutter aus den<br />
Augen. Ihr grauseidenes Kopftuch ließ sie mich aber immer wieder schnell erkennen.<br />
„Jetzt gehen wir in die Wirtschaft zum Altmann Peter und kaufen uns<br />
Wienerwürstchen“, sagte meine Mutter. Schon hatte ich den Duft in der Nase.<br />
Die Gaststube war voll von Leuten und es roch nach allerlei Essen. Ganz hinten<br />
fanden wir bei drei Bauern, von denen jeder einen riesigen Schweins-<br />
Der Herrgott hat die Dirndl zum Lieben erschaffen. Und wie sie geliebt werden,<br />
das ist wohl auf der ganzen Welt anders. Der <strong>Böhmerwäldler</strong> geht halt fensterln.<br />
Das ist aber nicht so einfach. So ohne Vorbereitung darf er sich nicht zum Fester<br />
einer Schönen wagen. Denn wenn dem Burschen „s´Mundwerk“ gut geht, hat er<br />
Aussicht, etwas auszurichten, nämlich dass er soviel erreicht, dass ihm die Holde<br />
im Kämmerlein auch Antwort gibt. Denn dass das Mädchen dem Burschen, wenn<br />
er das erstemal klopfen geht, „eine bettwarme Hand“ gibt, das heißt, sich zu ihm<br />
auf´s Fensterbrett setzt, wird selten vorkommen. Dazu ist ein drei- oder viermaliges<br />
Hingehen notwendig.<br />
Der Bursch lernt eine Reihe von Fenstersprüchen auswendig und richtet sich auf<br />
einige Kreuz- und Querfragen ein. Wenn er glaubt, das nötige Wissen zu besitzen,<br />
macht er sich in einer stockfinsteren Nacht auf den Weg zum Kammerfenster<br />
desjenigen Mädchens, von dem er Erhörung hofft. – Wenn er ankommt, wird<br />
gleich das Fenster probiert, ob es leicht zum aufmachen geht. Das ist gewöhnlich<br />
der Fall. Denn die „Fensterreibl“ sind durch das jahrelange Fenstergehen nicht<br />
mehr recht habfest. Das wird vom Bauer nicht so genau genommen, denn zur<br />
Sicherheit der Mädchen ist ja überall ein tüchtiges Gitter angebracht und auf<br />
diesem Wege hat er sich auch seine „Alte“ zusammengeredet.<br />
Vom Fensterln und was der Bergbauer als Bursch<br />
dabei erlebte<br />
Johann Riedl<br />
Mein erster Jahrmarktsbesuch<br />
Adolf Heidler<br />
braten vor sich auf dem Teller hatte, Platz. Das Wasser floss mir im Mund zusammen.<br />
Endlich kam der Wirt, stellte die Würstchen auf den Tisch. Schön rosarot<br />
lagen sie auf dem Teller, daneben ein großes Kipfl. Die Würstchen dufteten so<br />
herrlich, dass ich dabei fast das Essen vergessen hätte. Als Getränk gab es dazu<br />
ein Kracherl (Limonade), das mir ganz besonders schmeckte. Nach dem Essen<br />
gingen wir noch einmal auf den Markt und Mutter kaufte sich ein Paar warme<br />
Schuhe von dem Marktschreier, der gesagt hatte, dass es einen besonders harten<br />
Winter geben wird, wo sogar die Eisbären Filzpantoffel und Ohrenschützer tragen<br />
müssten. Auf dem Heimweg mussten wir durchs Pumpelwaldl, als es schon<br />
finster wurde. Dort, sagten die Leute, geistert es. Allein wäre ich nicht durch den<br />
Wald gegangen, aber heute waren ja meine Mutter und zwei Nachbarinnen dabei,<br />
da brauchte ich mich nicht zu fürchten. Daheim angekommen übermannte mich<br />
sofort der Schlaf. Im Traume aß ich noch einmal die guten Wienerwürstchen.<br />
Immer wieder musste ich später noch an meinen ersten Jahrmarktsbesuch denken.<br />
(Überarbeitet von Ingomar Heidler)
128<br />
129<br />
Nachdem das Fenster aufgemacht ist, fängt der Bursch mit seiner Litanei von<br />
Fenstersprüchen an. Sind diese heruntergeleiert, „dazwischen fleht er hin und<br />
wieder um Erhörung“, räuspert sich das Mädchen und fängt zu husten an; ein<br />
Zeichen, dass es gewillt ist, mit dem Fenstergeher zu sprechen. Natürlich läuft<br />
die Sache nicht immer so glatt ab und so mancher musste trotz Schöntun und<br />
Redekunst unberichteter Dinge abziehen. Auch ist bei manchem Kammerfenster<br />
ein Gerauf ausgetragen worden. Besonders dann, wenn ein fremder Bursch ein<br />
Mädchen haben will, in das sich ein Dörfler schon verliebt hat. Da kommt so<br />
mancher schneller aus dem Dörflein hinaus als er hineingekommen ist und anstatt<br />
Liebe wird ihm eine Tracht Prügel zuteil und gar manches Loch im Kopfe ist<br />
Zeuge, dass man ungestraft einem „Dörfler“ das Mädchen nicht „abreden“ kann.<br />
Oft fliegen ihm Stäbel und Holzscheitel nach.<br />
Es sitzen ihrer drei auf irgendeinem „Hausbankl“ beisammen. Sie rauchen gemütlich<br />
ihr Pfeiferl, reden allerei, aber ja nicht von den „Menschern“ (Mädchen),<br />
aus Furcht, sie könnten einen „Sinn“ haben, nämlich in ein gleiches Mädchen<br />
verliebt sein. Wenn´s so Zeit zum „Menschergehen“ wird, ranzt sich einer, gähnt<br />
dabei und stellt sich recht faul. Alle sind todmüde und wollen gleich schlafen<br />
gehen. Doch stelle dich ein Weilchen zum Fesnter der Nani. Da kommt bald einer<br />
von den Dreien mit einer Leiter angerückt. Sie ist noch nicht ganz aufgestellt,<br />
kommen die beiden anderen angesegelt. Natürlich großes Hallo. Das Vorrecht<br />
hat aber der erste Ankömmling.<br />
Der Bergbauern-Franzl hatte ein Auge auf die Steinberger Liesl. Der<br />
<strong>Böhmerwäldler</strong> sagt, so groß wie ein „Pflugradl“. Der Liesl war der Franzl auch<br />
nicht zuwider und so kam der Franzl bald zu seiner ersten „Liab“. Ging schön<br />
fleißig alle „Menschernächte“ fensterln, das sind im Walde der Dienstag, Donnerstag<br />
und Samstag, am Freitag gehen nur die Lausigen. Als es schon längere<br />
Zeit gegangen war, spekulierte er eines Tages, dass es auch nicht „dumm“ wäre,<br />
einmal im Kämmerlein der Liesl „gute Nacht“ zu machen. Gedacht, getan. So<br />
schlich er sich denn in einer finsteren Nacht, in der er glaubte, von niemandem<br />
gesehen zu werden, wie ein Einbrecher um den Hof und kam glücklich in die<br />
Kammer der Liesl. Er glaubte schon, gewonnenes Spiel zu haben. Doch die<br />
Rechnung war ohne den Steinberger gemacht worden. Dieser ging zufällig nach<br />
Hause und beobachtete das Treiben des Burschen, den er für einen Dieb hielt.<br />
Doch als er ihn in der Mädchenkammer verschwinden sah, ging ihm ein Licht<br />
auf. Und in derlei Sachen war der Steinberger strenge. Im Geheimen nahm er<br />
sich schon vor, dem unbekannten „Einbrecher“ eine tüchtige Portion Prügel zu<br />
verabreichen. Sofort ging er in die Kammer nach und erwischte den Franzl, der<br />
die Tritte des Bauern hörte und sich unter dem Bette verstecken wollte. Es nutze<br />
alles Sträuben nichts. Franzl musste heraus. Dem Franzl rann der Angstschweiß<br />
von der Stirn und im innersten seiner Seele betete er zu den vierzehn Nothelfern,<br />
ihm einen guten Gedanken einzugeben, um aus der eisernen Umklammerung<br />
zu kommen. Als der Bauer mit seinem Fang in die Stube trat, hatte der<br />
Franzl schon einen guten Einfall. „Bauer“, sagte er ganz demütig, „wenn schon<br />
ich meine Prügel bekomme, so soll sie auch der Lenzbauern-Knecht, der bei eurer<br />
Großdirn oben ist, auch haben.“. Fluchend sperrte der Bauer die Stube ab,<br />
schimpfte über die heutigen gottlosen Burschen und stürmte die Stiege hinauf.<br />
Die Bäuerin lag im Bette. Mitleidig betrachtete sie den Burschen, gedachte der<br />
Zeiten, da sie noch jung war und konnte ihres Mannes Strenge nicht begreifen,<br />
der in seiner Jugend auch kein „Heiliger“ war.<br />
Im Kämmerlein hielt der Steinberger strenges Gericht mit der Großdirn. Obwohl<br />
diese immer beteuerte, dass niemand anwesend sei, durchsuchte der Bauer jeden<br />
Winkel. Aber nichts war zu finden. Mit noch größerem Zorn rannte er in die<br />
Stube.<br />
Franzl hatte sich aber in die Nähe des Fensters gemacht und unauffällig dasselbe<br />
zum Aufmachen hergerichtet. Als nun die Stubentüre aufging, riss der Arrestant<br />
das Fenster auf, schwang sich hinauf und im Hinausspringen rief er zurück.<br />
„Steinberger, fang den Franzl, wenn du ihn erwischst und gib dem Lenzbauern-<br />
Knecht um die mir zugedachten Schläge mehr!“<br />
Nachgerannt ist der Steinberger dem Franzl nicht, und dieser hat sich nicht mehr<br />
erwischen lassen.<br />
Abenteuerlustig ist der „Wäldler-Bua“ und eine zweite Lieb schadet nicht. So<br />
dachte sich unser Franzl, als er mit der Oberbauern-Seffl anbandelte. Der Oberbauer<br />
ging eines Tages in die nächste Stadt auf den Markt. Da er an einem solchen<br />
Tage gewöhnlich etwas länger ausblieb, verabredeten die beiden ein Stelldichein.<br />
Glücklich standen die beiden Liebenden beisammen, als das Haustor<br />
aufging und der Bauer in den Hof trat. Jetzt war guter Rat teuer. Doch Not macht<br />
erfinderisch. Schnell entschlossen nahm sie den Franzl und steckte ihn in den<br />
Saustall. Da war auch der Oberbauer schon zur Stelle. Höchst verwundert fragte<br />
er seine Tochter, was sie hier suchte. Und um eine Ausrede war das Mädchen<br />
nicht verlegen. So erzählte sie, dass ein verdächtiges Geräusch war und fürchtete,<br />
es könnte wieder ein Schwein gestohlen werden wie vor vierzehn Tagen. Es ist<br />
aber nichts zu sehen. „Ich habe auch ein neues Schloss gekauft und wir können es<br />
gleich anbringen“, sagte der Oberbauer. Alle Einwände der Tochter, man könne<br />
ja das Schloss morgen anlegen, halfen nichts. Und so saß der Franzl die ganze<br />
Nacht im Saustall gefangen. Am anderen Tage zeigte der Bauer seiner alten<br />
Schwester, die seit dem Tode seines Weibes die Wirtschaft führte, die Handhabung<br />
de Schlosses. Als sie kurze Zeit darauf Schweine füttern ging und die Tür<br />
etwas öffnete, sprang zu ihrem Entsetzen eine Gestalt aus dem Stalle. Vor Schreck<br />
fiel sie auf denjenigen Körperteil, auf dem jeder Sterbliche zu sitzen pflegt und<br />
der wertvolle Inhalt des Kübels, der den Schweinen zugedacht war, ergoss sich<br />
über sie. Natürlich war großer Zusammenlauf und der Bauer war der Meinung,<br />
dass er wirklich einen Dieb über Nacht eingesperrt hatte. Die Seffl war schön<br />
ruhig und wenn das Gespräch auf den Saudieb kam, wendete sie ihr Gesicht ab,<br />
um das verräterische Erröten niemanden merken zu lassen.<br />
Der Franzl hatte noch mehrere Erlebnisse, ehe er in den Hafen der Ehe landete. In<br />
einen Saustall kam er aber nicht mehr. (Aus „Waldheimat“ Sept. 1928)
130<br />
131<br />
Meine Mutter wusch fast jede Woche, meine Großmutter nur alle vierzehn Tage<br />
oder nach Bedarf. Für meine Mutter begann das Wäschewaschen bereits am<br />
Samstagabend, wenn wir zuerst die zwei Kinder, dann Vater und Mutter in der<br />
großen, verzinkten Blechbadewanne gebadet hatten. Das Wasser war noch handwarm<br />
und enthielt Seife. Das waren die Gründe für meine Mutter, darin die „weiße<br />
Wäsche“ einzuweichen, das waren die Leibwäsche, die Taschen , Hand und<br />
Geschirrtücher und alles, was sonst noch an Kochbarem anfiel. Die Wanne, die<br />
zuvor zum Baden in der Küche gestanden hatte, wurde vor dem Einweichen in<br />
den Stall getragen und auf dem Podest neben der Tür abgestellt. Am Montag<br />
darauf wusch meine Mutter die weiße Wäsche aus dem Einweichwasser und legte<br />
sie in ein Lavoir. Dann weichte sie in dem selben Wasser die „blobe“ (blaue<br />
oder farbige) Wäsche ein. Dazu gehörten die Röcke, Blusen, Schürzen und Kopftücher<br />
meiner Mutter, die Kinderkleidung und die farbigen Männerhemden.<br />
Die weiße Wäsche trug meine Mutter in die Küche und seifte sie auf dem Küchentisch<br />
mit einem Riegel Kernseife ein. Die stark verschmutzten Hemdkrägen<br />
und Manschetten (mundartl. Bixla) und die Flecken von Kuhdreck, Gras und<br />
Obst erhielten mehr Seife, indem sie mit besonderen Druck auf den Seifenriegel<br />
noch ein oder zweimal darüberstrich. Nach dem Einseifen wurde diese Wäsche<br />
in den großen verzinkten Wäschetopf gelegt und auf der Herdplatte gekocht. Als<br />
das Wasser zu kochen begann, blähten sich die Wäschestücke auf und kleine und<br />
große Spritzer fielen auf die heiße Platte. Dort hüpften sie herum, bis sie verdampften<br />
und ein unangenehmer Geruch durch die Küche zog. Um das zu vermeiden,<br />
musste der Deckel abgenommen und die kochende Wäsche mit einem<br />
langen, starken Kochlöffel niedergerührt werden. Wenn ich nicht in der Schule<br />
war, fiel mir diese Arbeit zu. Meine Mutter richtete inzwischen den hölzernen<br />
Waschtrog, das Waschbrett, eine Bürste und die Seife her. In der warmen Jahreszeit<br />
stellt sie den Trog draußen auf der Gred auf den großen Granitstein neben<br />
dem Wassergrand, im Winter auf zwei Melkschemel im Stall. Wenn die Wäsche<br />
schon eine Weile gekocht hatte, bat sie meinen Vater oder einen anderen Erwachsenen,<br />
der gerade im Hof weilte, dass er ihr helfe, den schweren und gefährlichen,<br />
heißen Topf zum Waschtrog zu tragen. Der dampfende Inhalt wurde dann<br />
in den Trog geschüttete und soviel kaltes Wasser dazugegeben, bis sie sich die<br />
Hände nicht mehr verbrühte, wenn sie mit dem Waschen begann. Durch das Kochen<br />
hatte sich der Schmutz in den eingeseiften Wäschestücken schon gelöst und<br />
ging jetzt durch geringe Kraftanstrengung weg. Nur selten nahm sie die Hände,<br />
meistens rieb sie die Wäsche ein paar Mal über die Querrillen des Waschbretts.<br />
Wenn meine Mutter mit der erzielten Sauberkeit eines Stückes nicht zufrieden<br />
war, wurde es abermals mit Kernseife eingerieben und noch einige Male<br />
mit Druck über das Waschbrett geführt, „gerumpelt“, hieß das in der Mundart.<br />
Die Bürste wurde bei der weißen Wäsche nicht eingesetzt; sie würde das feine<br />
Gewebe zerreißen, war die Begründung. Wenn meine Mutter mit der weißen<br />
Wäsche fertig war, wendete sie sich der „bloben“, der farbigen Wäsche zu. Sie<br />
wurde aus dem Einweichwasser herausgewaschen und im Wäschetrog mit dem<br />
noch warmen Wasser weiterbehandelt. War es aber schon zu kalt, goss meine<br />
Mutter warmes nach, um die Reinigungskraft zu erhöhen. Die farbige Wäsche<br />
wurde mit der Hand und dem Waschbrett ebenso behandelt wie die weiße. Nach<br />
dem Auswringen legte man sie zu der weißen in das Schaff.<br />
In Oppelitz stand viele Jahre am Anger unterhalb der Dorfkapelle ein Grand. Er<br />
war aus einem dicken Baumstamm gehauen und hatte zwei Tröge. In den ersten<br />
floss reines Wasser aus einem Rohr. Es kam aus dem „Hirterbrunnen“ und war<br />
für die Allgemeinheit bestimmt, der zweite Trog wurde von den meisten Frauen<br />
im Dorf zum Spülen der Wäsche benutzt. Sein Wasser kam aus dem Überlauf<br />
des ersten. Wenn eine Frau ihre Wäsche gespült hatte, zog sie den Stöpsel heraus<br />
und ließ das nicht mehr ganz saubere Wasser ablaufen. Auch wenn sie nachher<br />
den Stöpsel wieder einsetzte, dauerte es eine geraume Zeit, bis das Wasser wieder<br />
zum Spülen reichte. Auch das Vieh, das auf die Weide ging oder von der Weide<br />
kam, stillte in den zwei Trögen seinen Durst. So konnte es in trockenen Jahren<br />
schon einmal zu Schwierigkeiten kommen. In den dreißiger Jahren des vorigen<br />
Jahrhunderts wurde der hölzerne Grand durch einen aus Beton ersetzt. Mein Vater,<br />
der damals Ortsvorsteher war und gerade eine eigene Wasserleitung gebaut<br />
hatte, kaufte den ersten Trog und schnitt den zweiten, dessen Rand schon zernagt<br />
war, weg. Den Grand transportierte er dann in unseren Hof und stellte ihn auf der<br />
Gred vor der Stallwand auf. Nun brauchte meine Mutter nicht mehr auf den Anger<br />
hinuntergehen, wenn sie die Wäsche spülen wollte, was sie als große Erleichterung<br />
empfand. Nach dem Spülen wurde die farbige Wäsche gleich aufgehängt.<br />
Meine Großmutter hatte dafür im Garten eine Wäschestange, die auf zwei<br />
Pfosten ruhte. Es konnte vorkommen, dass sie zu kurz für alle Wäschestücke<br />
war, dann legte sie sie einfach übereinander. Das verhinderte allerdings, dass<br />
alles gleichmäßig trocknete. Großmutter half sich auf die Weise, dass sie die<br />
dünneren Stücke ans Ende der Stange hängte und sie sofort abnahm, wenn sie<br />
trocken waren. Dann hatte die noch feuchten Stücke genug Platz auf der Wäschestange.<br />
Meine Mutter spannte eine Wäscheschnur aus Hanf. Da wir keine eigenen<br />
Pfosten dafür hatten, band sie das eine Ende an der Ulme fest, die neben dem<br />
Misthaufen wuchs, das andere Ende befestigte sie an einem Gartenzaunpfahl. So<br />
fest sie auch zog, so straff die leere Schnur auch aussah, sie hängte durch, so bald<br />
man mehrere Wäschestücke darauf hängte. Damit sie aber nicht auf dem Boden<br />
streiften, fertigte mein Vater eine Stütze (mundartl. Spreize) aus zwei Latten, die<br />
er durch eine Schraube beweglich verband. Wegen ihres Aussehens nannte sie<br />
meine Mutter Zange. Stütze man mit ihr die Wäscheschnur, hingen alle Stücke<br />
frei in der Luft. Die weiße Wäsche wurde nach dem Spülen auf ein<br />
Rasenstück im Garten auf die Bleiche gelegt. Sie sollte stets nass<br />
Vom Wäschewaschen<br />
Maria Frank
132<br />
133<br />
gehalten werden, damit der Sauerstoff, den das junge Gras ausatmete, zusammen<br />
mit der Kraft der Sonne den „Gilb“, die schmutziggraue Verfärbung der weißen<br />
Wäsche, und die Flecken, oft Grasflecken, bleichen konnte. Diese Wäsche wurde<br />
deshalb mit der Gießkanne immer wieder begossen. Wenn aber meine Mutter<br />
keine Zeit hatte, weil sie ja auch in der Küche, im Stall und auf dem Feld arbeiten<br />
musste, übertrug sie das Begießen der Wäsche uns Kindern. Das war eine Plage!<br />
Eine halbe Gießkanne voll Wasser vom Grand zur Bleiche zu schleppen, erforderte<br />
schon unsere ganze Kraft. Die geringe Wassermenge aber reichte nie aus,<br />
wir mussten drei oder viermal gehen. Füllten wir aber zu viel Wasser in die<br />
Kanne, musste man unterwegs etliche Male rasten, sodass das Wäschebegießen<br />
oft eine Stunde dauerte, während die ersten Stücke schon wieder trocken wurden.<br />
Neben dem Begießen gab das Bleichen auch noch andere Scherereien. War die<br />
Wäsche zu trocken, konnte sie der Wind verwehen, was in den Böen vor einem<br />
Gewitter öfters der Fall war. Es kam auch vor, dass die Hühner mit ihren unsauberen<br />
Krallen über die Wäsche liefen und ihre Spuren hinterließen, oder dass sich<br />
gar die Gänse darauf setzten und ihren Darm entleerten. War so etwas geschehen,<br />
schimpfte meine Mutter sehr. Die Wäsche war nach so einem Ereignis schmutzig<br />
und fleckig und das Säubern verursachte zusätzliche Arbeit. Das Bleichen sollte<br />
drei Tage dauern, damit die Wäsche blütenweiß (mundartl. bliarlweiß) wurde.<br />
Am Abend eines jeden Tages wurde sie eingesammelt; damit sie nicht gestohlen<br />
wird, wurde als Grund angegeben. Am anderen Morgen wurde die Wäsche wieder<br />
gespült, aber nur mäßig ausgewrungen und abermals auf die Bleiche gelegt. Erst<br />
am vierten Tag wurde sie gründlicher gespült, gut ausgewrungen und zum Trocknen<br />
auf die Wäscheschnur gehängt.<br />
Das bisher Gesagte war das übliche Wäschewaschen, man würde heute auch Standard<br />
- Methode oder Standard Technik sagen. Daneben gab es noch Besonderheiten,<br />
über die im Folgenden berichtet wird.<br />
Das Wäscheblau<br />
Vom Herbst bis zum Frühjahr konnte keine Wäsche gebleicht werden, weil in<br />
dieser Zeit das Gras nicht wuchs und keinen Sauerstoff ausatmete. Der „Gilb“<br />
machte sich bemerkbar. Um dennoch eine weiße Wäsche zu erhalten, schütteten<br />
einige Frauen in das letzte Spülwasser Wäscheblau. Meine Mutter griff nie zu<br />
diesem fragwürdigen Mittel, aber meine Großmutter. Ich habe nie gemerkt, dass<br />
Großmutters Wäsche weißer war als die meiner Mutter. Das Wäscheblau Pulver<br />
wurde auch in den Kalk geschüttet, mit dem Räume und Außenmauern getüncht<br />
wurden. Sie zeigte Dann eine bläuliche Farbe mit einem Stich ins Violette.<br />
Das Strümpfewaschen<br />
Die Männer und Kinder, aber auch einige Frauen trugen im Winter handgestrickte<br />
Socken und Strümpfe aus Schafwolle. Weil sie durch das Tragen der Nejschl<br />
(eine Art hölzerner Pantoletten) bei den Arbeiten im Stall, im Hof und auf den<br />
Feldern und das Betreten der Räume ohne Hausschuhe, nur mit den schafwollenen<br />
Socken und Strümpfen, sehr beansprucht wurden, wurden sie im Herbst „abgeflickt“,<br />
d. h. mit einer Sohle und Kappen über den Zehen und an<br />
der Ferse aus Tscherka verstärkt (Tscherka = eine Art Loden aus Schafwolle und<br />
gesponnenem Flachs, in der Gegend hergestellt). Die so zubereiteten Socken und<br />
Strümpfe wurden dann den ganzen Winter hindurch getragen und erst im Frühjahr,<br />
wenn es schon wärmer war, gewaschen. Manchmal waren sie bis dahin schon<br />
steif. Diese Socken wurden in einer warmen, besonders guten Seifenlauge eingeweicht,<br />
auf keinen Fall zusammen mit der anderen Wäsche. Man schüttete immer<br />
wieder warmes Wasser nach und knetete sie. Bald färbte der gelöste Schmutz das<br />
Einweichwasser dunkel. Frauen, die nicht an Seife sparen mussten, bereiteten<br />
dann noch ein zweites und drittes Einweichwasser und schütteten es weg, wenn<br />
zu viel Schmutz darin gelöst war. Nach der weißen und farbigen Wäsche wurden<br />
die Strümpfe in den Wäschetrog gelegt und in dem noch mäßig warmen Wasser<br />
gewaschen. Während die nicht „abgeflickten“ bald sauber waren, erforderten die<br />
mit einem tscherkernem Besatz mehr Mühe. Die Wäscherin drehte sie zuerst um,<br />
so dass die gestrickte Innenseite nach außen gekehrt wurde. Sie wurden ein paar<br />
Mal über das Waschbrett gerieben, bis die eigentliche Farbe der Schafwolle wieder<br />
zu sehen war. Dann wurden sie erneut umgedreht und die Teile aus Tscherka mit<br />
der Bürste bearbeitet. Schon beim Waschen zeigte es sich, dass sowohl die gestrickte<br />
Innenseite als auch die Sohle und die Kappen aus Tscherka erhebliche<br />
Löcher aufwiesen. Die Strümpfe wurden sorgfältig gespült, meist in einem eigens<br />
zubereiteten Wasser, um auch den letzten Schmutz zu entfernen. Danach<br />
wurden sie zum Trocknen aufgehängt. Lebten in einem Haus neben dem Bauer<br />
noch etliche Kinder und Dienstboten, so bildeten die aufgehängten Socken eine<br />
Reihe von beträchtlicher Länge. Die erheblich zerrissenen Socken und Strümpfe<br />
wurden keineswegs weggeworfen. Man trennte die Teile mit den großen Löchern<br />
ab und strickte an die noch brauchbare Wade neue „Füßlinge“ an. Manchmal<br />
reichte es, wenn verschlissene Teile „eingestrickt“ wurden, d. h. die Löcher durch<br />
einen gestrickten Fleck verschlossen wurden. Im nächsten Herbst wurden sie<br />
wieder für den Winter hergerichtet und „abgeflickt“.<br />
Das Waschen der „hausgwirchten Bettwäsche“ Das mundartliche Wort<br />
„hausgwircht“ könnte man in der Schriftsprache mit „hausgewebt“ wiedergeben.<br />
Um aber den Ausdruck zu verstehen, muss man sich das Leben bei uns vor ca.<br />
120 Jahren vorstellen. Damals baute jeder Bauer auf einem seiner Felder Flachs<br />
an. Er wurde gepflegt, geerntet und dann weiterbehandelt, bis aus den holzigen<br />
Stengerln die Fasern zutage traten. Sie wurden gesponnen und aus dem Garn<br />
Stoffe gewebt. Damals sind in vielen Häusern Webstühle gestanden; das haben<br />
mir in meiner Kindheit die alten Leute erzählt. Die Leinwand war also nicht nur<br />
im Hause gewebt worden, sondern die Bauernfamilien verrichteten alle Arbeiten<br />
von der Aussaat des Leins bis zum Garn oder sogar bis zur fertigen Leinwand.<br />
Die daraus hergestellten Stoffe, die flachsene Leinwand, die obrächene Leinwand<br />
und die Tscheka, wurden einerseits wegen ihrer langen Haltbarkeit, aber auch<br />
wegen der vielen Arbeit und Mühe, die für sie aufgewendet worden waren, sehr<br />
geschätzt. Zur Aussteuer jeder Braut gehörte auch eine Menge „hausgwirchte“<br />
Bettwäsche. Nach der Wende vom 19. zum 20. Jh. verdrängten
134<br />
135<br />
die leichteren und farblich gefälligeren Baumwollstoffe die hausgewebte Leinwand<br />
aus der Bettwäsche. Aber im Winter wurde das alte Zeug doch wieder gerne<br />
hervorgeholt, vor allem für die Knechte und die erwachsenen Söhne, die üblicherweise<br />
auf dem Dachboden schliefen. Dort konnte es ziemlich kalt werden.<br />
Manchmal blies der Wind sogar den Schnee durch die Lücken im Dach. Da waren<br />
sie froh über ein prallgefülltes Federbett mit dem schweren Bezug aus hausgewebtem<br />
Leinen. Solche Bezüge wurden in der Regel erst im Frühjahr gewaschen,<br />
wenn es schon wärmer geworden war und das schwere Zeug schneller<br />
trocknete. Diese Bezüge wurden dann auf dieselbe Weise gewaschen wie die<br />
Kochwäsche. Die Hausfrau verwendete aber öfter die Bürste, wenn sie meinte,<br />
dass das Waschbrett für die verlangte Sauberkeit nicht ausreichte. Beim Auswringen<br />
wurde oft der Bauer oder ein anderer Erwachsener zum Helfen gerufen,<br />
denn die Handgelenke der Frau brachten zu wenig Kraft auf und ermüdeten, bevor<br />
alle hausgewebte Wäsche ausgewunden war. Auch diese Bettwäsche wurde<br />
auf die Bleiche gelegt und danach auf der Wäschestange getrocknet, denn ein<br />
Hanfseil hätte die Last nicht tragen können. War keine Wäschestange vorhanden,<br />
hängte man die Wäsche einfach über den Gartenzaun. Man brauchte ja nicht fürchten,<br />
dass die Lattenspitzen Löcher in den Stoff bohren. Die getrocknete hausgewebte<br />
Bettwäsche wurde nicht gebügelt. Man streifte sie nur sorgfältig aus,<br />
legte sie zusammen und brachte sie dann in den Schrank oder die Truhe. Früher<br />
soll man sie auch gemangelt haben. Man wickelte sie um das Mangscheit, das<br />
wie eine riesige Nudelwalze aussah, und wälzte die Rolle mit dem Mangbrett<br />
etliche Male hin und her, bis man glaubte, die gewünschte Glätte erreicht zu haben.<br />
Die Aschenlauge<br />
Als Kind hörte ich einmal, dass früher, als sich die Leute die teuere Kernseife<br />
noch nicht leisten konnten, die Wäsche mit Aschenlauge gewaschen wurde. Das<br />
hielt ich für unmöglich, denn wie konnte die Wäsche mit Asche sauber werden?<br />
Sie wurde eher grau und schmutzig. Ich fragte daher meine Großmutter und sie<br />
erzählte dann:<br />
Man sammelte viel Holzasche in einem Fass oder Schaffel, übergoss sie mit lauwarmem<br />
Wasser und rührte ein paar Mal um. Nach dem letzten Umrühren wurde<br />
eine Weile gewartet. Der schwarze Bodensatz setzte sich unten ab, die leichteren<br />
Ascheteilchen schwammen oben. Nun goss man das obere schmutzige Wasser<br />
vorsichtig ab. Wenn der Bodensatz nicht hell genug (meine Großmutter sagte<br />
„weiß genug“) war, wurde abermals lauwarmes Wasser darauf geschüttet und<br />
umgerührt. Wieder goss man das obere schmutzige Wasser ab und prüfte erneut<br />
den Bodensatz. Der Vorgang wurde sooft wiederholt, bis die Hausfrau mit der<br />
Helligkeit des Bodensatzes zufrieden war. Dann wurde er in den Wäschetopf<br />
geschüttet, die Kochwäsche darauf gelegt, Wasser aufgefüllt und gekocht. Großmutter<br />
nannte keine Mengen und Zeitangaben. Ich war damals nur am Vorgang<br />
interessiert und fragte daher nicht nach. Großmutter meinte zwar, die Wäsche<br />
wäre schon sauber geworden, aber mit Seife und Soda werde heute ein besseres<br />
Ergebnis erzielt.<br />
Als heranwachsendes Mädchen ist man mit einem l0 Jahre jüngeren Bruder schon<br />
geschlagen.<br />
Es begann für mich gravierend, als ich meinen ersten Freund mit nach Hause<br />
brachte. Ihm, der aus einer sehr angesehenen Familie aus einem Nachbarort stammte,<br />
wollte ich natürlich meine Familie und mein Elternhaus im besten Licht zeigen.<br />
Großmutter, die zu Hause war (wie immer) war sehr höflich zu ihm, kochte<br />
Tee und es lief alles bestens, bis, ja, bis mein kleiner Bruder auftauchte.<br />
Plötzlich stand er unter der Stubentür und sein Anblick ist mir auch heute noch<br />
genau gegenwärtig. Die Knie aufgeschlagen, zerkratzte, schmutzige, barfüßige<br />
Beine, das strohblonde Haar kreuz und quer vom Kopf abstehend, die knielange<br />
Hose voller Gras und Dreck, in den Armen eine sich wild sträubende Katze. So<br />
baute er sich vor uns auf und ungeniert starrte er meinen Besucher an, wohl voller<br />
Unverständnis, was dieser Mensch an seiner so völlig uninteressanten Schwester<br />
fand. Voll Verzweiflung merkte ich, dass er sich neugierig vor uns niederlassen<br />
wollte, aber Großmutter rettete die Situation, indem sie ihn, ein Butterbrot versprechend,<br />
mit in die Küche nahm.<br />
Nun die Geschichte mit dem Büstenhalter. Ich war sechzehn oder siebzehn Jahre<br />
alt und bekam mein erstes, zartes Exemplar dieser Art. Eines Tages hing es zum<br />
Trocknen auf der Leine im Garten und mein lieber Bruder, der bei Mutter oder<br />
Großmutter derartiges noch nicht gesehen hatte, riss den Büstenhalter respektlos<br />
von der Leine, stülpte ihn sich vergnügt über den Kopf und rannte laut schreiend<br />
Ohrenschützer, Ohrenschützer durch das Haus. Voller Empörung über diese<br />
Entweihung lief ich, ebenfalls laut schreiend du blöder, blöder Kerl hinter ihm<br />
her. Irgend jemand entriss ihm dann das gute Stück, aber er schrie weiterhin<br />
Ohrenschützer, Ohrenschützer mit Begeisterung.<br />
Das tägliche abendliche Waschen war eine sehr unerfreuliche Sache für ihn und<br />
wenn ich die Aufgabe – ungern - übernehmen musste, war seine stereotype Frage<br />
„was alles?“ und seine Entrüstung lautstark, wenn ich rachsüchtig sagte: „alles!“<br />
In späteren Jahren war er der geliebte Onkel meiner Tochter, war dann ihr Trauzeuge<br />
und ist aus unserem Leben nicht wegzudenken.<br />
Mein kleiner Bruder<br />
Anna Klarner
136<br />
137<br />
Der Geistliche Herr.<br />
Der pfiffigste und schnellste aller Schmuggler war wohl der Wilhelm aus einem<br />
Dorf nahe der Grenze. Er konnte zum Beispiel, wenn ihn jemand beleidigt oder<br />
sein Mädchen ausgespannt hatte, demjenigen auf dem Tanzboden während des<br />
Tanzens so blitzschnell zwei Ohrfeigen versetzen, dass der Betroffene gar nicht<br />
wusste, woher diese gekommen waren. Pfiffig war er auch beim Schmuggel. Eines<br />
seiner Glanzstücke war der Saccharinschmuggel. Man muss vorausschicken,<br />
dass Saccharin damals es handelt sich um die Zeit noch vor dem Ersten Weltkrieg<br />
- nicht handelsüblich war, da in der Herstellung noch viel zu teuer. In der<br />
Schweiz dagegen konnte man es trotzdem preiswert kaufen. Davon wusste der<br />
Wilhelm und zog seinen Nutzen daraus. Er verkleidete sich als Geistlicher Herr<br />
und trug eine Antoniusfigur vor sich her, die mit Saccharin angefüllt war. Seine<br />
Geliebte, als Nonne verkleidet, ging einträchtig neben ihm her. Wenn sie an die<br />
Grenze kamen, setzten sie immer ihre frömmste Miene auf, und der „Geistliche<br />
Herr“ sprach sehr salbungsvolle Worte zu den Zöllnern. Dann hob er die Hand<br />
zum Segen, zeigte ihnen die Antoniusstatue und empfahl ihnen, sich immer betend<br />
an jenen zu wenden, wenn sie etwas verloren hätten. Sichtlich beeindruckt<br />
von dem frommen Mann und der Ordensfrau ließen sie die beiden passieren. Zu<br />
Hause angekommen, entledigte er sich der geistlichen Kleidung und entleerte die<br />
Antoniusfigur. Nachdem er das Sacharin portionsweise abgepackt hatte, zog er<br />
damit ins Landesinnere und belieferte seine Verteilerinnen. Den Hauptverkauf<br />
übernahm die falsche Nonne, während er sich für neue Taten rüstete. Natürlich<br />
verlief die Sache nicht immer so reibungslos. Einmal rannte er um sein Leben,<br />
weil er in schnellstem Lauf von zwei Zöllnern verfolgt wurde. In seiner höchsten<br />
Not rannte er in einen Bauernhof hinein und rief dem Bauern zu: „Schnell, versteck<br />
mich im Saustall, die Finanzer sind hinter mir her!“ Der Wilhelm sprang zu<br />
den Schweinen hinein, und der Bauer warf frisches Stroh über ihn. Die Lage<br />
zwischen den Schweinen war zwar ungemütlich, aber gemessen an dem, was ihm<br />
geblüht hätte, war dies noch das kleiner Übel. Diesmal war er noch davongekommen.<br />
Die schwangere Nonne<br />
Als der Geistliche Herr, alias Wilhelm, wieder einmal mit seiner „Ordensfrau“ in<br />
Schmuggelsachen unterwegs war, war die Nonne bereits im 6. Monat schwanger,<br />
und sie musste trotz ihres weiten Ordenskleides sehr vorsichtig sein, um nicht<br />
aufzufallen. Deshalb trug sie die Antoniusstatue vor sich her. So leise, dass es die<br />
Zöllner gerade hören konnten, sagte der Geistliche Herr: „Ehrwürdige Schwester,<br />
Sie müssen etwas abnehmen.“ Die Nonne setzte ein gütiges Lächeln<br />
Wenn die Leute mit der Regierung und den herrschenden Verhältnissen nicht<br />
einverstanden sind und sie deswegen „nichts zu lachen“ haben, erzählen sie sich<br />
genüsslich Witze oder kurze Begebenheiten, die diese Verhältnisse aufs Korn<br />
nehmen und sozusagen lächerlich machen. Anfang der zwanziger Jahre ordnete<br />
der tschechische Postmeister in Bergreichenstein, der zum Missfallen der Bevölkerung<br />
an die Stelle des deutschen gesetzt worden war, an, dass der Briefträger<br />
keine Päckchen mehr mitnehmen darf. Er solle die Empfänger nur verständigen<br />
und diese müssten die Päckchen selbst beim Postmeister abholen.<br />
Worüber man in Bergreichenstein lachte<br />
Maria Frank<br />
Vom Schmuggel<br />
Irma Springer<br />
nach Ernst Springer<br />
auf und hauchte zurück: „Ja, nach drei Monaten im Orden werde ich leichter<br />
sein.“ Wieder einmal waren sie mit dieser Masche durchgekommen. Aber die<br />
Zöllner haben den Wilhelm noch oft gesucht, denn er verlegte sich auf größere<br />
Objekte und versuchte neue Tricks.<br />
Das Heiratsgut<br />
Nach dem das Kind der „schwangeren Nonne“ geboren war, und der Kindsvater,<br />
der Schmuggler Wilhelm, seine langjährige Freundin nicht heiraten wollte, erwartete<br />
man wenigstens von ihm, dass er Alimente zahlen würde und es waren<br />
nicht die einzigen, wie man wusste. Aber wovon? Das Schmuggelgeschäft wollte<br />
nicht mehr so recht florieren, er musste sich etwas anderes einfallen lassen! Das<br />
Schicksal schien ihm jedoch gewogen zu sein. In einem etwa 20 km entfernten<br />
Dorf nämlich gab es eine wohlhabende Bauerntochter im vorgeschrittenen Heiratsalter,<br />
deren Herz es zu erobern galt. Sogleich machte er sich auf den Weg, um<br />
bei jener Bauerntochter sie hieß Minna vorzusprechen. Gewandt und beredt<br />
wie er war, wusste er auch gleich zu gefallen. Ja, die Minna verliebte sich sogar in<br />
ihn, und man wurde sich einig, dass man heiraten würde. Nun war es damals bei<br />
Besitzenden so, dass auch der einheiratende Partner Geld oder Besitz in die Ehe<br />
einbringen musste. Die Minna befragte also den Wilhelm, wie es denn in dieser<br />
Angelegenheit stünde. Er wolle schon ein Sümmchen Bargeld auf den Tisch legen,<br />
entgegnete er. Dabei wusste er zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht, wo er<br />
es hernehmen solle. Auf das Drängen ihres betagten Vaters erkundigte sich Minna<br />
nun jeden Tag aufs Neue, wo denn nun sein Heiratsgut bliebe. Er indessen<br />
entschuldigte sich damit, er habe noch keine Zeit gehabt es zu holen. Er wolle<br />
dies schon noch besorgen, versprach er. Tatsächlich zählte er ihr eines Tages einige<br />
tausend Kronen auf den Tisch. Er hatte auf dem Viehmarkt ein Ochsenpaar<br />
verkauft ihre Ochsen!! Sie verzieh. Was blieb ihr übrig?<br />
(Aus: Irma Springer: Anekdoten und Episoden aus dem Böhmerwald)
138<br />
139<br />
So warteten einmal vor Dienstschluss gleich drei deutsche Bürger auf ihn. Er las<br />
die Namen der Empfänger vor: „Herr Löbl...!“ Keiner meldete sich. Wieder las<br />
er: „Herr Löbl...!“. Abermals blieb alles still. Da schimpfte der Postmeister: „ja,<br />
wo ist denn dieser Löbl?“ Nach einigem Hin und Her stellte sich heraus, dass er<br />
die Adresse falsch gelesen hatte, denn auf dem Päckchen stand: „An den löbl.<br />
Herrn Andreas Fux“. Die Abkürzung „löbl.“ stand für löblich, wie es damals der<br />
gepflegten Höflichkeit entsprach.<br />
Im Jahre 1946 bezog ein tschechisches Ehepaar eine zuvor verstaatlichte Landwirtschaft<br />
und der ehemalige deutsche Besitzer musste ausziehen. Der Abschied<br />
von dem lieben Vieh fiel den Deutschen sehr schwer. Die Tschechin konnte<br />
nicht melken, deshalb fragte sie die deutsche Frau, ob sie die Arbeit noch übernehmen<br />
wolle. Die Deutsche, die froh war, noch einmal bei ihren Kühen sein zu<br />
können, sagte zu. Als sie dann am Abend die gemolkene Milch der Tschechin<br />
ablieferte, meinte diese, sie hätte nun Milch für zwei Tage, die Deutsche solle erst<br />
danach wieder zum Melken kommen. Die neue tschechische Landwirtin wusste<br />
anscheinend nicht, dass Kühe jede Mahlzeit gemolken werden müssen.<br />
In der Zeit vor der Vertreibung kam es schon häufig vor, dass eine deutsche Familie<br />
binnen einer oder zwei Stunden ihr Haus verlassen und Möbel, Betten, Geschirr,<br />
Wäsche und die meisten Kleider zurücklassen musste. Da oft gute und<br />
modische Stücke darunter waren, zogen die neu eingezogenen Tschechinnen, die<br />
nur mit einer Schachtel oder einem kleinen Koffer gekommen waren, diese Kleidungsstücke<br />
mit Freuden an, wenn sie passten. Die Deutschen kannten diese<br />
Kleider und wussten, welcher Nachbarin sie früher gehört hatten und redeten<br />
darüber. Die Kinder hörten das, liefen hinter der entsprechenden Tschechin her<br />
und riefen respektlos: „Pani Wolfl Pani Wolfl“, wenn die frühere und rechtmäßige<br />
Besitzerin Wolf geheißen hatte.<br />
Wirksame Hiebe<br />
Der Honsirgerlbauer erzählte einmal in der Sitzweil: „Als ich ein junger Bursche<br />
mit 18 oder 20 Jahren war, da hatte der Schofferbauer einmal einen rechten Zorn<br />
auf die alte Müllnerin und wollte ihr etwas Schlimmes antun. Dafür holte er sich<br />
Rat bei der alten Kalupnerin, die ein Schwarzbüchl besaß und sich in solchen<br />
Dingen auskannte. Sie riet ihm, er solle, wenn Vollmond ist, um Mitternacht auf<br />
die Wiese vor der Mühle gehen, schweigend die Joppe ausziehen, die Innenseite<br />
nach außen kehren, auch die Ärmel, sie dann über einen Maulwurfshügel werfen<br />
und mit einem Prügel daraufschlagen. Die alte Müllnerin wird dann die Hiebe<br />
spüren. Der Schofferbauer glaubte ihr das. Damit die ganze Aktion mehr Wirkung<br />
zeigt, nahm er seinen Kleinknecht, seinen Hütbuben und mich mit. Den<br />
Buben schickte er zur Mühle. Dort sollte er beim Fenster der alten Müllnerin auf<br />
die Schmerzensschreie achtgeben. Wir drei, der Schofferbauer, der Kleinknecht<br />
und ich suchten auf der Wiese nach einem großen Maulwurfshaufen. Dann zog<br />
der Schofferbauer seine Joppe aus, wendete sie um und warf sie über das Erdhäuflein.<br />
Sofort hieben wir mit unseren Prügeln mit aller Kraft<br />
Gesammelt und nacherzählt von R.F.S.<br />
Zwei Hirschauer Büblein<br />
Sind einmal zwei Hirschauer Buben in den Wald gegangen, krochen tapfer durch<br />
Busch und Stauden, schlugen frohsame Purzelbäume und sprangen gar barfuß<br />
über Gruben und Baumwurzeln, wie die Hasen und Rehlein solches tun. Auf<br />
einmal kamen sie zu einem tiefen Brunnen, der lag licht und klar vor ihren Augen<br />
wie ein heller Spiegel und so sie näher zu ihm kamen, gewahrten sie darin ihr<br />
eigenes Bild. – Da man in der Hirschau keinen Spiegel kannte, meinten die Büblein,<br />
ihre Wasserbilder wären fremde Buben, die ihnen spottweise alles nachmachten.<br />
So schnitten die vier laut Gesichter und Grimassen auf einander und<br />
beschimpften sich schließlich lautstark, wie dies bei Buben schon immer Brauch<br />
ist. Am Ende aber kam den einen der Büblein eine wilde Wut an und er sprang<br />
einem Feinde nach, um ihn fest am Kragen zu packen. Da plumpste er in das tiefe<br />
Wasser und flugs waren die Trugbilder fort. Wie er nun in arger Not mit dem<br />
Wasser rang und ängstlich um Hilfe schrie, rief ihm der andere, welcher noch am<br />
Brunnenrande stand, schlau zu: „Hansel, ertrink nit derweil, ich lauf heim und<br />
sag´s dem Vatern“. Rannte dann über Stock und Stein, dass er sich mit den Fersen<br />
bis auf den Buckel schlug, heimzu. – Wollen hoffen, dass der Vater nicht zu spät<br />
kam.<br />
Ein Hirschauer am Totenbett<br />
Legte sich einmal ein Hirschauer hin, um zu sterben. Wie er so in den letzten<br />
Zügen lag, überdachte er noch mal schnell sein mühseliges Erdenwandern mit<br />
allen seinen Kreuzwegstationen und lichten Festen, streichelte dabei mit matten<br />
Augen im Wohlgefühle manch erfahrener Freude seine rundliche Ehehälfte, die<br />
geschäftig in der Stube hin und wieder schnellte. Dann tat er mit letzter Anstrengung<br />
das Maul auf und sprach mit leiser Stimme: „Du, Weib, wenn ich stirb, dann<br />
bitte ich dich, es ist mein letzter Wille, heirat unsern Knecht; das ist ein rechtschaffener<br />
Kerl, geht gut mit dem Vieh um und sieht auch brav auf die Wirtschaft“.<br />
– „Ja, ja, Mannerl“, sagte sie darauf, „das hab ich mir schon längst gedacht.<br />
Jetzund aber stirb, stirb in Gott´s Namen!“ – Da tat er einen tiefen Röchler<br />
und war gestorben.<br />
Ein Hirschauer beim Papste<br />
Auf eine Zeit wollten die Hirschauer den päpstlichen Segen für ihr Örtl, versprachen<br />
sich davon mancherlei Vorteil für sich und ihr Vieh. So sandten sie den<br />
Einige Hirschauerstücklein<br />
auf die Joppe. Der Haufen wurde niedriger und niedriger, bis die Joppe schließlich<br />
flach auf dem Boden lag. Dann kam der Hütbub gelaufen und berichtete, die alte<br />
Müllnerin hätte laut und fest geschrien. Da war der Schofferbauer mit der Strafaktion<br />
sehr zufrieden und bezahlte beim Wirt für jeden ein Glas Bier.“
140<br />
141<br />
Der Bauer, der schickt an Joggl aus, er soll den Hafer mähen!<br />
Der Joggl maht an Hobern net und hoam gehen tuat a a net.<br />
Jetzt schickt der Bauer an Bumerl aus, er soll den Joogl beißen!<br />
Der Bumerl beißt an Joggl net, der Joggl maht an Hobern net und hoam gehen<br />
tuat a a net. Jetzt schickt der Baur an Prügl aus, er soll den Bumerl prügeln!<br />
Der Prügl prügelt an Bumerl net, der Bumerl beißt an Joggl net, der Joggl maht an<br />
Hobern net und hoam gehen tuat a a net.<br />
Jetzt schickt der Bauer das Feuer aus, es soll den Prügl brennen!<br />
Das Feuer brennt an Prügl net, der Prügl prügelt an Bumerl net, der Bumerl beißt<br />
an Joggl net, der Joggl maht an Hobern net und hoam gehen tuat a a net.<br />
Jetzt schickt der Baur das Wasser aus, er soll das Feuer löschen!<br />
Das Wasser löscht das Feuer net, das Feuer brennt an Prügl net, der Prügl prügelt<br />
an Bumerl net, der Bumerl beißt an Joggl net, der Joggl maht an Hobern net und<br />
hoam gehen tuat a a net.<br />
Jetzt schickt der Baur an Ochsen aus, er soll das Wasser saufen!<br />
Der Ochs sauft das Wasser, das Wasser löscht das Feuer, das Feuer brennt an<br />
Prügl, der Prügl prügelt an Bumerl, der Bumerl beißt an Joggl, der Joggl maht an<br />
Hobern und hoam gehen tuat a a. (Aus „Waldheimat“ Okt. 1932)<br />
Eine Sprechübung<br />
R. Kelmark<br />
Schlauesten von ihnen in das weite Land Italia nach der alten Stadt Rom. Ein<br />
Hirschauer bleibt allemal ein Hirschauer und wenn er bis an das End der Welt<br />
führe. Kam unser Hirschauer nach mancherlei Irrfahrten endlich nach Rom und<br />
bis zum Papste selber, wurde da in einen großen Saal geführt, glaubte schon, es<br />
wäre der Himmel. Als er dort wartete, zerbrach er sich gar viel den Kopf, wie es<br />
sich wohl ziemte, den heiligen Mann anzusprechen. Und als dann der Papst erschien<br />
und den Segen erteilte, da war er so geblendet von der hellen Pracht und<br />
Herrlichkeit, dass er glaubte, der Papst sei der Herrgott selber. Wie er nun zu ihm<br />
kam und ihm die Hand mit dem Ringe zum Kusse reichte, grüßte er ihn gar ehrfürchtig,<br />
redete dann also zum Papste: „Lieber Gott, ich bitt dich recht sehr, gib<br />
mir auch den Segen für unser Hirschauer Dörfel daheim.“. Da wusste der Papst,<br />
dass er einen Hirschauer vor sich hatte, ward darob gar leutselig und sprach:<br />
„Mein liebes Hirschauerlein, ich bin wohl der Stellvertreter Christi auf Erden,<br />
aber sonst auch nur ein Mensch von Fleisch und Blut wie du, den Segen aber für<br />
dein Dörfel, den magst du wohl haben“, und gab ihm den Segen. Da brummte der<br />
Hirschauer: „Ich hab mir´s schier gedacht, dass ich den Teufel zu hoch erwisch“,<br />
rabbte nach dem Segen und fuhr damit schleunigst heim gegen Hirschau.<br />
(Nach dem Volksmund) Es war einmal ein Mann, der sich recht hart wirtschaftete,<br />
sodass der Löffel am Tisch nicht mehr ihm gehörte. Darum nahm er sich eines<br />
Tages einen Strick und ging damit in den Wald, um sich zu erhängen. Dort trat<br />
ihm aber ein kleines Männlein in den Weg und fragte, wo er hinginge. Der Mann<br />
antwortete, dass er sich den Garaus machen wolle. Das Männlein sagte, er solle<br />
das nicht tun und lieber heim gehen, alle Jahre werde in seinem Hof eine feiste<br />
Sau umrennen und ein Sack voll Geld werde alle Jahre am Stubentisch stehen,<br />
aber nach Ablauf von sieben Jahren müsse er die sieben Wahrheiten wissen. Der<br />
Mann war dessen froh, kehrte um und fand daheim alles so, wie es das Männlein<br />
gesagt hatte. Da lebte er die Jahre in Saus und Braus. Eines Tages lud er alle<br />
reichen Leute der Gegend ein und stellte ihnen ein prächtiges Mahl. Als sie gegessen<br />
und getrunken hatten, fragte er sie, ob sie nicht die sieben Wahrheiten<br />
wüssten. Aber alle sagten, sie wüssten sie nicht. Da lud er das nächste Mal die<br />
Armen und Bettelleute insgesamt von der Straße in sein Haus und bewirtete sie<br />
reich. Wieder fragte er, ob sie die sieben Wahrheiten wüssten. Aber keiner wusste<br />
sie. Nun war schon das siebente Jahr gekommen und er wusste die Wahrheiten<br />
nicht. Nun war schon der siebente Monat da, die siebente Woche, der siebente<br />
Tag und die siebente Stunde. Am letzten Tag verließen ihn alle Dienstleute und er<br />
blieb allein in seinem Haus. Zuletzt kam ein altes Bettelweib dahergehumpelt<br />
und bat, dass es bei ihm über Nacht bleiben dürfe. Der Bauer sagte: „Nein, heut<br />
kann ich dich nicht dalassen. Aber wenn du nicht mehr gehen kannst, will ich<br />
dich zum Nachbarn hinüber tragen.“ Weil aber die Alte inständig bat, er möge sie<br />
im Ofenwinkel schlafen lassen, willigte er zuletzt ein. Als es finster wurde, nahm<br />
er eine geweihte Kreide, zog um sich einen geweihten Kreis und zündete ein<br />
Sterbelicht an. Da fraget ihn das Weib, ob er die sieben Wahrheiten wüsste. „Nein“,<br />
sagte er. Da befahl sie ihm, sich in den Ofenwinkel zu setzten und sie selber<br />
stellte sich in den Kreis, da ging es auch schon huiiih, der ewige Feind stand in<br />
der Tür und schrie: „Sag die sieben Wahrheiten!“ Da begann das Weiblein: „Die<br />
erste, dass ich in den Wald gegangen bin, die zweite, dass du mir den Strick<br />
genommen hast, die dritte, dass der Schusterstuhl drei Haxen hat, die vierte, dass<br />
der Wagen vier Räder hat, die fünfte, dass die Hand fünf Finger hat, die sechste,<br />
dass du mir alle Jahre ein feiste Sau schickst, die siebente, dass die Woche sieben<br />
Tage hat. „Kaum hatte sie ausgesprochen, ging es wieder huiiih und der Teufel<br />
fuhr mit Hinterlassung von Rauch und Stank wütend davon. Als aber der Bauer<br />
in die Stube trat, sah er, wie das Bettelweib die zerlumpten Kleider fallen ließ und<br />
in den Himmel auffuhr.<br />
(Aus „Waldheimat“ Sep. ´31)<br />
Die sieben Wahrheiten<br />
Dr. Heinrich Micko
142<br />
143<br />
Ein mürrischer Novembertag graute und sah verdrossen zu, wie ein eiskalter<br />
Nordwest unaufhörlich Schnee und Regen an die Fensterscheibe der Schule<br />
peitschte, als wollte er ihrer mangelhaften Reinigung durch den alten Diener<br />
Ponkratz verärgert nachhelfen. In der dritten und letzten Klasse der Bürgerschule<br />
in einem Böhmerwaldflecken, die das „Glück“ hatte, neben einigen anderen auch<br />
den Bogner Toni zu ihren Sorgenkindern zu zählen, ging eben die zweite Unterrichtsstunde<br />
ihrem Ende entgegen. Wenn ich Ihnen verrate, dass es sich um eine<br />
Mathematikstunde gehandelt hat, in der einzelnen auf den Zahn gefühlt wurde,<br />
wird Sie es nicht wundernehmen, dass wie auf Kommando ein Seufzer der Erleichterung<br />
durch die Klasse ging, als die Glocke die Zehnuhrpause ankündigte<br />
und der Herr Fachlehrer Rechlinger den um einige „Pintscher“ bereicherten Katalog<br />
fürsorglich in seiner Brusttasche verstaute.<br />
In der Aufregung war es sogar den meisten entgangen, dass der Glockenschwengel<br />
wieder einmal besonders kräftig und anhaltender als gewöhnlich geschwungen<br />
worden, was als ein untrügliches Zeichen dafür galt, dass der Ponkratz, einen<br />
„Grant“ (Zorn) hatte. An und für sich hätte es ja den Schülern gleich sein können,<br />
ob der Schuldiener einen solchen hatte oder nicht; aber auf Grund jahrelanger<br />
Erfahrung konnten sie, ohne abergläubisch zu sein, feststellen, dass sich solcherart<br />
eingeläutete Tage in der Regel für sie kritisch gestalteten. Der Toni wenigstens<br />
konnte schwören darauf. Und weil der Ponkratz sehr oft einen Grant hatte, ist<br />
auch sicherlich nur deswegen immer etwas passiert, denn die Buben stellen<br />
bekanntlich aus eigenem Antrieb nichts Schlechtes an. Wenn sie trotzdem immer<br />
wieder in die Patsche kommen, so ist dies eben nur ein unglückliches Verhängnis.<br />
Oder war es vielleicht kein Verhängnis, dass Toni just im gleichen Augenblick, in<br />
dem der Herr Fachlehrer die Türe hinter sich schloss, in der Bank vor sich einen<br />
steinalten Bauernknödel entdeckte? Und war es kein unglückseliger Zufall, dass<br />
der Herr Fachlehrer Fuchs - genannt der Rotfuchs -, ausgerechnet in dem Augenblick<br />
die Türe öffnete, als Toni die Härte dieses Knödels eben an dieser erproben<br />
wollte und dabei justament die Heldenbrust des Gestrengen traf? Wer hätte ihn<br />
verurteilt oder wäre am Ende gar mit innerer Genugtuung Zeuge dessen gewesen,<br />
was sich nun abspielte? Der Herr Fachlehrer Fuchs war für einen Moment<br />
fassungslos; dann aber rötete sich sein Gesicht, die Zornesadern schwollen<br />
zum Bersten, die Augen sprühten Tod und Verderben und zwischen den sich<br />
sträubenden Borsten des kräftigen, fuchsroten Schnurbartes hindurch, dem er<br />
seinen Spitznamen verdankte, drang stahlhart und messerscharf die Frage: „Wer<br />
war das?“ Einundzwanzig Schäflein - in diesem Augenblicke war die Bezeichnung<br />
gerechtfertigt – standen erblasst in den Bänken, sahen ängstlich<br />
in das drohende Gesicht und schwiegen! Und schwiegen, ob-<br />
wohl die Frage noch zweimal und mit immer drohenderer Schärfe wiederholt<br />
wurde. Einundzwanzig wussten es – und einundzwanzig wussten es nicht! Der<br />
Rotfuchs war starr! Seine Augen wanderten wild von einem zum andern und<br />
bohrten sich tief in jede einzelne der Knabenseelen; aber diese waren und blieben<br />
unergründlich! Das brachte ihn noch mehr in Harnisch und mit vor Erregung<br />
heiserer Stimme schrie er: „Klassenordner, heraus!“ Und war es nicht wieder ein<br />
Verhängnis oder wären Sie vielleicht gar geneigt, es als einen Beweis für die<br />
Existenz einer ausgleichenden Gerechtigkeit anzusehen, dass just der unschuldige<br />
Missetäter in dieser Woche neben einem ihm im Alphabet folgenden Mitschüler,<br />
der die Anständigkeit selber war – das verantwortungsvolle Amt inne hatte?<br />
Die zornfunkelnden Augen und der in unverkennbarer Haltung gezückte Regenschirm<br />
verrieten nichts Gutes und im Vorgefühl der kommenden Ereignisse trat<br />
er gesenkten Hauptes und mit einem Armensündergefühl aus der Bank. Aber auf<br />
dem kurzen Wege bis vor den Katheder erwachte der ganze Lausbub in ihm und<br />
als der Herr Fachlehrer neuerlich die Frage an ihn richtete: „Wer war´s?“, sah er<br />
furchtlos in das Antlitz des grollenden Löwen und antwortete, auf die Verschwiegenheit<br />
seines Leidensgenossen, und der anderen bauend, fest und bestimmt: „Herr<br />
Fachlehrer, ich weiß es nicht.“ Und nachdem auch der Zweite im Bunde dies<br />
beteuerte, mussten beide in die Knie. In dieser Stellung sausten die Hiebe mit<br />
dem vor Nässe triefenden Regenschirm abwechselnd auf die Häupter und die<br />
gekrümmten Rücken der armen Sünder nieder, bis der Züchtigungsrausch unter<br />
dem Eindruck der Krokodilstränen und dem schmerzhaften Aufheulen nach gelungenen<br />
Streichen allmählich verflog. Dann wandte sich der Fuchs um, und durchmaß<br />
langen Schrittes und mit gesenktem Blick den Martersaal. Plötzlich blieb er<br />
vor den Gezüchtigten stehen und einen ernsten Blick auf sie und alle anderen<br />
richtend, versuchte er noch einmal, einen Rassel zu finden, indem er mit eindringlichen,<br />
salbungsvollen Worten an die Wahrheitsliebe, Anständigkeit usw.<br />
appellierte; aber auch dies schlug fehl. So gab er´s denn endgültig auf, maß die<br />
ganze Horde mit einem letzten, verachtungsvollen Blick und bestieg den Katheder,<br />
nicht aber, um – wie vorgesehen und zur Stimmung passend – von den<br />
Hussitenkriegen vorzutragen, sondern um zu prüfen. Was alle erwarteten, trat<br />
ein; der erste, der aufgerufen wurde, war der Held des Tages: Toni. Aber obwohl<br />
der Rotfuchs an die heikelsten Stellen klopfte, er fand keine verwundbare<br />
Stelle, denn Toni hieß nicht umsonst der Geschichtsforscher. Bevor er noch<br />
dazu kam, sich seinen Rachedurst an einem anderen, unschuldigen Opfer zu<br />
stillen, schrillte abermals die Glocke zum Zeichen eines Probe-Feueralarms,<br />
der dem Strafgericht ein jähes Ende setzte. Dass der Feueralarm dennoch die<br />
Atmosphäre nicht ganz gereinigt hatte, bewies die finstere Miene des Gestrengen<br />
in der darauffolgenden Turnstunde; aber die in Reih und Glied aufgestellten<br />
jungen Racker fühlten, dass der Sturm sich gelegt hatte und im Innern nur noch<br />
das schwer zu verdauende Bewusstsein wühlte, im Kampfe gegen 21 Lausbuben<br />
unterlegen zu sein. Sie beobachteten, wie er im Stillen an dieser bitteren<br />
Pille würgte, wie er mehrmals einen „Anrand“ nahm zu sprechen, bis er<br />
Eine Ohrfeige<br />
Anton Jungwirth
144<br />
145<br />
Einige Jahre vor Ausbruch des 2. Weltkrieges nutzte ich die Gelegenheit, tauschte<br />
eine längere Wartezeit als Junglehrer in meiner südböhmischen Heimat mit<br />
den Abenteuer einer Lehrstelle in der östlichsten deutschen Sprachinsel der<br />
Tschechoslowakei und fuhr nach Karpathenrussland.<br />
Weitab von der Bahnlinie Prag – Jasina, die weiter in rumänisches Gebiet führte,<br />
lag der Ort Königsfeld in walddüsterem Tal, umgeben von den Riesen der<br />
Ostbeskiden. - Pop Ivan, Mentschul, Hoverla, so heißen einige dieser mächtigen<br />
Berge, an deren Flanken der Urwald in zerrissenen Schluchten emporsteigt, deren<br />
Gipfel aber über die göttliche Ruhe der Poloninen blicken. Unten im Tal die<br />
grüne Tereschwa, über blockiges Getrümmer rauschend, neben dem Fluss die<br />
Straße mit der langen Doppelzeile wettergebräunter, mächtiger Holzhäuser. Zur<br />
Sommerzeit blühten an den Fenstern bunte Blumen. Zu beiden Seiten des Flusses<br />
und der Dorfstraße steigen bewaldete Hänge auf, vielfach zerrissen von Bachtälern,<br />
aus denen ich im Winter zum ersten Mal das Jaulen der Wölfe hörte.<br />
Auf Grund eines kaiserlich theresianischen Dekretes verließen die jetzigen Bewohner<br />
des „Theresientales“ einst ihre Heimat im Salzkammergut, um hier in<br />
Osten die unwegsamen Wälder zu roden und eine feste deutsche Insel im bunten<br />
Völkergemisch zu gründen.<br />
An den Familiennamen der vielen Zeppezauer, Reisenbüchler, Höfer und Zauner<br />
ist die alte Heimat noch zu erkennen. Der karge Talboden brachte kaum das nötigste<br />
zur Stillung des Hungers hervor, deshalb musste der Wald diese wacke-<br />
ren Leute ernähren. Gewaltig der Wildreichtum, gewaltig auch die Tannen und<br />
Fichten. Sie wurden gefällt, in „Riesen“ zu Tal geschossen und schließlich in<br />
gefährlicher Floßfahrt zur Theiß und weiter in die Ungarische Ebene befördert.<br />
Staunend habe ich ihnen zugesehen, den halbnackten und braungebrannten Flößern,<br />
die auf dem ächzenden Gefüge blankgescheuerter Stämme wie angewurzelt<br />
standen, das Steuerruder in Griff, mit geübtem Blick der Gefahr entgegensehend.<br />
Dann mussten sie blitzschnell handeln, sonst legte die Wucht des Wildwassers<br />
das Floß quer, die Wellen schäumen und quirlen über die Stämme und zerreißen<br />
mit scharfen Knall die Weidenseile. Das nächste Floß stürmt dann dem ersten<br />
in die Flanke, die Stämme lösen sich und treiben in Wirbel flussabwärts. Mancher<br />
hat da sein Leben gelassen!<br />
Ständig musste der deutsche Siedler in Karpathenrussland mit Naturgewa1ten<br />
kämpfen, mit Lebensgefahr fällt er die Stämme mit Lebensgefahr bringt er sie<br />
aus den Bergen, im Sommer über wassergefüllte Holzrinnen, die „Riesen“, im<br />
Winter durch vereiste steile Hohlwege. Der Winter ist hier in den Bergen hart und<br />
lang. Als ich nach Königsfeld kam, war mein Bruder schon einige Jahre als Lehrer<br />
tätig. Sein Beispiel hatte wesentlich dazu beigetragen. dass die jungen Burschen<br />
im Winter nicht nur die Zeit harter Knochenarbeit sehen sondern auch eine<br />
Zeit herrlichen Gleitens auf schmalen Brettern über unberührte verschneite Hänge<br />
oberhalb der Waldgrenze. Die Wölfe, vor denen man mich im dichtbesiedelten<br />
Westen gewarnt hatte, hörte man meist nur am Abend und in der<br />
Das verbotene Tal<br />
Josef Schneider<br />
dann endlich, zwar noch etwas rau, aber doch mit einem leisen Unterton der<br />
Versöhnungsbereitschaft herausstieß: „Ich möchte doch wissen, wer der Lauser<br />
war; wenn er sich freiwillig meldet, geschieht ihm nichts!“ In Toni´s Augen blitzte<br />
es auf. Ein kurzer, aber heftiger Kampf und dann trat er im Schutze des gegebenen<br />
Wortes vor und sagte, dem Lehrer frei ins Auge blickend: „Bitte, Herr Fachlehrer,<br />
ich war´s!“ Im gleichen Augenblicke landete auf seiner linken Wange eine<br />
mit Kraft und Gefühl gewürzte Ohrfeige! Toni zuckte mit keiner Wimper; aber<br />
der Blick, der den Fachlehrer Fuchs aus seinen hellen Knabenaugen traf, kündete<br />
ihm, dass er eine Knabenseele für immer verloren und aus 21 jungen Herzen<br />
einen köstlichen Glauben gerissen hatte. Es tat ihm auch in derselben Sekunde<br />
leid und er hätte wohl gerne den Schlag wieder zurückgenommen, selbst wenn er<br />
auf seiner eigenen Wange gelandet wäre, aber es war zu spät. Und so sehr er um<br />
diese Lausbubenseelen in der Folge auch mit Liebe und Güte rang, sie öffneten<br />
sich ihm nie wieder. (Aus: „Mein Böhmerwald“ Folge 2/3, 7. Jhg.)<br />
Die erneuerte Böhmerwaldtracht.<br />
Serie: Schöne deutsche Trachten.<br />
Böhmerwald, Wallern. (Sammlung<br />
Reinhold Fink)
146<br />
147<br />
Nacht, auch von den vielen Bären der Urwälder sah man tagsüber nur die Spuren<br />
im Schnee. Nur selten vernahm man Klagen, dass Schafe aus dem Pferch gerissen<br />
wurden, oben in den Wäldern gab es für das Raubzeug genügend Nahrung.<br />
Ivan, der Huzule, erzählte wohl gruselige Geschichten von den Wölfen, die ihn<br />
im Winterwald umzingelten, als er mit seiner Axt auf leisen Opanken zum Versteck<br />
seiner Flinte schlich. Nur durch hallende Schläge gegen Baumstämme konnte<br />
er das Raubzeug vertreiben. Oder wie ihm plötzlich oben auf der Verchovina aus<br />
dem Baumgestrüpp ein brauner Bär entgegenkam. Der war vor Schreck genau so<br />
erstarrt wie Ivan. Auf alles gefasst hatte dieser seine treue Axt umklammert, aber<br />
dann sagte er sich wohl, „Der Klügere gibt nach!“ und begann sich langsam,<br />
Zentimeter um Zentimeter, umzudrehen, den Bären dabei so gut es ging im Auge<br />
behaltend. Und, oh Wunder, der Bär machte es genau so und als beide in der<br />
richtigen Laufstellung waren, machten sie sich in entgegengesetzten Richtungen<br />
eiligst davon. Von dieser Geschichte habe ich auch eine andere Version gehört,<br />
als die Holzfäller von Königsfeld eine Arbeitspause einlegen mussten weil oben<br />
im „Bergtal“ die Klause geschlossen wurde und in den Holzrinnen das Wasser<br />
eine Zeitlang versiegte. Da konnten die Männer in der „Koliba“, der zeltartigen<br />
Unterkunft aus Holz mit den Feuer in der Mitte, ihre Erfahrungen dem wissbegierig<br />
lauschenden „taniturbacsi“, dem „Lehreronkelchen“, mitteilen. Von Ivan<br />
Berschnij wurde da erzählt, dem huzulischen Hirten aus dem Tal der Brustura,<br />
den aus dem Latschendickicht auf den Planinen des Mentschu1 eine wütende<br />
Bärenmutter anfiel, und wie sich Ivan mit dem Mut der Verzweiflung und mit<br />
hochgeschwungener Axt auf das Tier stürzte, „slag by ho trafil!“ und ihm den<br />
Schädel spaltete. Da nickten die Holzfäller und über die wettergegerbten Züge<br />
ging ein wissendes Lächeln. Was das Jägerhandwerk und das wilde Getier angeht,<br />
war keinen fremd! Die Jagd hatte früher einmal zu den alten Freirechten<br />
gehört, und auch unter der neuen Ordnung sagte man sich, dass die Wölfe weitaus<br />
mehr aus dem ungeheuren Wildbestand herausholten, als die genügsamen Wäldler<br />
zur Nahrung brauchten.<br />
So verging die Brotzeit unter munteren Gesprächen, einer aus der Runde war<br />
inzwischen mit zwei dicken Steinplutzern von nächsten „Sauerbrunn“ zurückgekommen,<br />
von einer dieser Mineralquellen von köstlichem Wohlgeschmack, die<br />
in dieser Gegend zu Hunderten aus den Boden sickern. Das spritzige Nass des<br />
„Borkud“ oder „Weinbrunnens“, wie die Ungarn sagen, ging reihum, und für den<br />
fremden Gast gab es vieles zu hören.<br />
Besonders spannend wurde es in der „Koliba“, wenn in der Mitte das Feuer flackerte<br />
und draußen die Dämmerung anbrach. Von geisterhaften Dingen wurde<br />
denn erzählt. Umgehen soll es in „Toten Wald“, hoch oben am Kamm, wo die<br />
Unterstände aus dem 1. Weltkrieg zerfallen und verrotteter Stacheldraht mit Wildrosenstacheln<br />
um die Wette des Wanderers Fuß umschlingen. Da steigen die Toten<br />
aus ihren Gräbern, die „Waldfrauen“ locken mit süßen Gesängen ins Verderben,<br />
und dort, wo der Nagelschuh manchmal noch auf klingendes Metall stößt,<br />
ein zerbeulter Sturmhelm liegt da, im Stahl zackt die Spur des Granat<br />
splitters, dort ist es nicht geheuer. Dort kann es das Leben kosten, man erzählt<br />
von einem Jäger, den ein Blindgänger zerrissen haben soll. Auch unten im Tal ist<br />
bei schimmernden Mondschein allerhand los. Die „Wasserfrau“ ruht dort am Ufer<br />
und betört den späten Wanderer mit ihrem blendenden Leib. Wenn auch im klaren<br />
Tageslicht nur ein bizarr geformter alters gebleichter Wurzelstock daraus wird,<br />
die Wirkung der Erzählung bleibt.<br />
Die Huzu1en, zum Stamm der Bergruthenen gehörend, lebten in Quer- und Seitentälern<br />
des mächtigen Waldgebirges, auch in malerischen Einzelgehöften auf<br />
den Poloninen. Sie sollen Nachkommen einer römischen Strafkolonie sein, was<br />
vielleicht auch der Wortstamm „Huz“ = „Räuber“ verrät. Wenn man aber nach<br />
langer Wanderung über die „Verchovina“ in einer ihrer Hütten Zuflucht suchte,<br />
brauchte man nichts zu befürchten, im Gegenteil, das stolze, freiheitsliebende<br />
Völkchen, weit und breit berühmt durch seine farbenfrohen Stickereien und Webarbeiten,<br />
hielt die Gastfreundschaft heilig. Die steilen Dächer so einer Ruthenenhütte<br />
schwingen ihre Flanken fast bis zur Erde, aus ihren Ritzen und Fugen quillt<br />
der Rauch des Herdfeuers, im Innern versucht das Tageslicht durch zwei oder<br />
drei winzige Fensterchen einzudringen, aber das Dämmerdunkel obsiegt,<br />
besonders im Winter, wenn auch diese kleinen Öffnungen sorgfältig mit Fetzen<br />
und Moos verstopft werden. Über Balkenwerk und Geräte hat das offene Herdfeuer<br />
in Laufe der Zeit eine Rußschichte gelegt, die das Halbdunkel noch vorstärkt.<br />
Oft erinnere ich mich an den schon erwähnten Ivan, den ruthenischen Waldläufer.<br />
Wir hatten Freundschaft geschlossen, oft streiften wir, mein Bruder<br />
Budweiser Sprachinsel: Trachten mit Marktstand. Verlag Bund der<br />
Deutschen in Böhmen, Prag. Entwurf von G. Moest. Ansichtskarte mit Stempel<br />
von 1910. (Sammlung Reinhold Fink)
148<br />
149<br />
und ich, mit ihm durch die wilden Wälder, er selbst auf seinen Opanken lautlos<br />
wie ein Tier, das Beil am Gürtel. Grinsend holte er dann aus einem Versteck eine<br />
ungeheuer lange Flinte, schrägte die Spitzen seiner Bleigeschosse an einem Felsblock<br />
ab, um später den stärksten Keiler mit dem ersten Schuss zu fällen. Die<br />
Jagd steckt diesen Menschen so im Blut, dass Jagdrecht und Wilderei unverstandene<br />
Begriffe blieben. Wenn man ihr Vertrauen gewonnen hatte, waren sie stolze,<br />
ehrliche und unbedingt treue Kameraden.<br />
Ungefähr 50 Kilometer in der Luftlinie nach Osten lebten in einen etwas weiteren<br />
Tal in unmittelbarer Nähe des Industriestädtchen Rachov deutsche Siedler aus<br />
der slowakischen Zips. Ihrer alten Heimat zur Erinnerung nannten sie ihr sauberes<br />
Dörfchen „Zipserei“. Oft waren wir bei sommerlicher Bergfahrt über den<br />
Hochplan gewandert, damals blühte der Enzian, die Gipfel ließen in wunderbar<br />
klarer Schönheit ihre waldlosen Kuppen schwingen, auch im Winter war uns das<br />
Antlitz der Karpathen, so dachten wir, gut bekannt. So entstand der Plan einer<br />
Winterüberquerung der Berge zwischen Königsfeld und der Zipserei auf Skiern.<br />
Da war es wiederum Ivan, der uns von diesem Plan abriet. Die Gefahren eines<br />
Wettersturzes seien zu groß, schon mancher einheimische Jäger sei nicht mehr<br />
nach Hause zurückgekommen, wenn ihn auf der Verchovina der Schneesturm<br />
überraschte, die Nacht und die Wölfe! Wir ließen uns aber in jugendlichem Leichtsinn<br />
von unserer Absicht, den Weihnachtsabend im Kreise der Zipsereideutschen<br />
zu verbringen, nicht abbringen. Wir fürchteten die „B1udnica“ nicht, den Irrberg,<br />
der mit seinen sieben Seitentälern bei Nebel den Wanderer narren sollte, es<br />
erschien uns nicht zu schwierig, am ersten Tag der Wanderung die alte Hirtenhütte,<br />
die „Koliba“ am Hange des Mentschul zu erreichen und am Weihnachtstag<br />
auf flinken Brettern die restlichen 40 Kilometer zurückzulegen.<br />
Mit geschulterten Skiern verließen wir am Vortage des Weihnachtsfestes das tief<br />
verschneite Königsfe1d. Die Blockhütten waren neben den dunklen Tannenwächtern<br />
wie im Märchen anzusehen. Bald begann der steile Aufstieg zu den<br />
Almhängen des Mentschu1. Es wurde ein mühsamer Weg, durch knietiefen Schnee<br />
kamen wir nur langsam voran. Stundenlang konnte man noch die Leute des Taldorfes<br />
hören, ein fernes Hundegebell, den schwimmenden Glockenton des<br />
Kirchleins, dann umfing uns das Schweigen des winterlichen Urwaldes. Manchmal<br />
glitt ein Schneeklumpen vom Ast, schlug dumpf unten auf, unser Atem war zu<br />
vernehmen, sonst kein Geräusch in der feierlichen Stille. Im Schnee sahen wir<br />
vereinzelt den Opankenabdruck eines ruthenischen Jägers, in großer Zahl aber<br />
die Spuren von Tieren. Zahllose Hirschfährten, die Zeichen des Wildschweins,<br />
dazwischen immer wieder handtellergroße Stapfen der Waldwölfe.<br />
Das machte uns wenig Sorgen, wir wussten von Ivan, dass man am Tage bei<br />
diesem großen Wildreichtum von den grauen Kerlen nichts zu befürchten hatte.<br />
Sollte tatsächlich eine zu freche Meute den Angriff wagen, würden wir zum unfehlbaren<br />
Mittel der Huzulen greifen und mit einen Stock gegen die Stämme<br />
schlagen, dass es weit durch den Wald dröhnt. Endlich erreichten wir die Waldgrenze.<br />
Es war geradezu erholsam die Skier anzulegen und die „Huitfeld - Bin<br />
dungen“ mit dem metallenen Strammer zu schließen. Einige wütende Bergkrähen<br />
schienen etwas gegen uns zu haben, sie umkrächzten uns wie wild. Dann zischten<br />
die Bretter leise über den Grathang, Wildwechsel wurden überquert, an einer<br />
Stelle hatten Hirsche einen regelrechten Pfad über den Pass getreten. Schneller<br />
als gedacht vergingen die Stunden. Die Gipfel leuchteten in weißer Schönheit,<br />
die Sonne wurde nur gelegentlich von einer rasch zerfließenden Wolke verdeckt,<br />
wir waren zuversichtlich und dachten an die schönen Stunden im Kreise unserer<br />
Freunde, die uns morgen um die gleiche Zeit in Tal der Theiß erwarteten. Der<br />
westliche Himmel begann sich allmählich zu verfärben, etwas zu intensiv, stellten<br />
wir nachdenklich fest, dann kroch die Dämmerung aus den Tälern, von unserem<br />
Nachtquertier noch keine Spur. Endlich entdeckten wir sie in einer Hangmulde,<br />
tief verschneit war die „Koliba“ kaum zu sehen. Als wir davor standen,<br />
blickten wir uns wortlos mit sichtlicher Enttäuschung an: Anstelle einer uns vertrauten<br />
Rundhütte mit Dach und Eingang und Feuerstelle in der Mitte stand hier<br />
ein etwas seltsamer Bau, der vielleicht im Hochsommer vor einem Gewitter etwas<br />
Regenschutz gewähren konnte, aber jetzt im Dezember! Ein bis zum Boden<br />
reichendes schräges Dach, von zwei Seitenwänden gestützt, die der Wind reichlich<br />
zerzaust hatte, vorne frei, das sollte uns vor der grimmigen Kälte schützen?<br />
Leider blieb uns keine andere Möglichkeit, da half kein Schimpfen auf die unzuverlässige<br />
Beschreibung, wir mussten rasch an die Arbeit. Zuerst wurde der Boden<br />
im Innern vom angewehten Schnee gesäubert, dann suchten wir in der Umgebung<br />
einigermaßen trockenes Holz zusammen, woran zum Glück kein<br />
Trachten aus der Budweiser Sprachinsel. Verlag Bund der Deutschen<br />
in Böhmen, Prag. Entwurf von G. Moest. Ansichtskarte um 1910. (Sammlung<br />
Reinhold Fink)
150<br />
151<br />
Mangel herrschte. Gebrochene Baumwipfel ragten hier und dort aus den Schnee.<br />
Schließlich konnten wir sogar die fehlende Wand durch einige kreuz und quer<br />
gesteckte Sparren ersetzen, es war höchste Zeit, im Westen brannte das Abendrot,<br />
kein gutes Vorzeichen für das Wetter am nächsten Tag. Die Barrikade aus Astwerk<br />
war ziemlich kümmerlich, aber sie gewährte doch ein etwas beruhigendes<br />
Gefühl des Schutzes vor der Nacht, die sich jetzt schnell ausbreitete. Bald funkelten<br />
die Sterne in eisiger Pracht. Wir entzündeten in der Mitte unserer engen<br />
„Kolibe“ ein Feuer, setzten Teewasser an und saßen in die Klepperdecken gehüllt<br />
am lodernden Brand. Abwechselnd wollten wir wachen!<br />
Als mich aus unruhigem Schlaf die Hand Erichs aufrüttelte, folgten seltsame Stunden.<br />
Die unglaubliche Stille der Winternacht wurde nur vom Prasseln des Feuers<br />
unterbrochen, dem ich von Zeit zu Zeit neue Nahrung gab. Halb im Traum starrte<br />
ich in das züngelnde Flammenspiel, das unsere vermummten Gestalten in verzerrten<br />
Schatten an die Decke warf. Gedanken steigen hoch, ich denke an die<br />
Vorfahren vor endlos langer Zeit, wie sie damals ihr Feuer, die „rote Blume“,<br />
hüteten. Über diesem Sinnen muss ich wohl etwas eingenickt sein, denn als ich<br />
erschreckt hochfuhr, war das Feuer fast niedergebrannt. Draußen in nächster Nähe,<br />
erscholl ein unheimliches Jaulen. Rasch schürte ich den Brand, auch Erich war<br />
erwacht, wir ergriffen unsere Pistolen und starrten durch die Lücken im Astwerk<br />
in die Nacht.<br />
Endlich wurde so hell. Mit ungelenken Griffen verrichteten wir die notwendigen<br />
Tätigkeiten, schlürften heißen Tee, konnten schließlich die Bindungshebel zuklappen.<br />
Die Fahrt ging weiter! Der Gipfel der „Tempa“ war unser nächstes Ziel.<br />
Von dort mussten wir bei klarer Sicht den Gipfelgrat der „Blischnica“ sehen und<br />
ansteuern können. Mühsam ging es über einen breiten, vereisten Hang bergan.<br />
Die dunklen Wälder in der Tiefe lagen im Nebel, über den Höhen aber war die<br />
Luft sehr klar. Deutlich zeichnete sich seit einiger Zeit das Balkengerüst des<br />
Tempagipfels gegen den Himmel ab. Wir kreuzten eine Bärenfährte. Das milde<br />
Wetter der letzten Tage hat das Tier wahrscheinlich nicht zur Ruhe kommen lassen.<br />
Die tellergroßen Stapfen führen aus dem Tal der Tereschwa herauf, überqueren<br />
den verwehten Grat, verschwinden jenseits im Dunst. Der mächtige Kerl hatte<br />
seine Eindrücke im feuchten Schnee so fest eingepresst, dass sie vereisten und<br />
in Form kleiner Säulchen stehen blieben, als der Wind die lockeren Kristalle<br />
wegblies.<br />
Plötzlich, das Trigonometergerüst, eben noch klar zu sehen, verschwindet im<br />
nebeligen Dunst. Aus der Tiefe wallt es in grauen Massen. Sollte doch ein Wettersturz<br />
eintreten! Aber es dauert nicht mehr lange, noch ein einziges steiles Stück,<br />
dann haben wir die Tempa! Jetzt reißen auch wieder die Schwaden auseinander,<br />
blauer Himmel wird sichtbar, und wir fassen neuen Mut. Klar liegt der Weg vor<br />
uns. Dieser Steilhang, dort drüben die blaue Bergkuppe muss gequert werden,<br />
dann beginnt schon der lange Grat der Blischnica, an dessen Gipfelende uns wahrscheinlich<br />
unsere Freunde aus der Zipserei erwarten. Rasch wird der Marschkompass<br />
gestellt, ein letzter Schluck aus der Feldflasche, einige Bis-<br />
sen, auf geht’s! Erich wirft sich in die<br />
Tiefe, kleiner und kleiner wird seine<br />
Gestalt auf den rasenden Brettern,<br />
endlich tief unten, kommt sie zum<br />
Stillstand und brüllt mir etwas zu. Ich<br />
kann den Sinn der Worte nicht erfassen,<br />
vermeine aber die Aufforderung<br />
zum Nachkommen zu hören und füge<br />
mich in das Unvermeidliche. Meine<br />
Bretter haben keine Stahlkanten, der<br />
unheimlich steile und lange Hang, der<br />
stellenweise verharscht sein muss,<br />
macht mir Sorgen. Sehr bald muss ich<br />
leider erkennen, dass sie nicht grundlos<br />
sind. Die Fahrt wird rasend schnell, der Wind pfeift um die Ohren, und jetzt,<br />
Eisbuckel unterbrechen die Schneefläche, die Bretter hüpfen, springen, jetzt ist<br />
es passiert! Es wirft mich hoch, wirbelt mich in der Luft herum, denn werde ich<br />
zu Boden geschleudert. Zum Glück in weichen Schnee! Gerade noch erwische<br />
ich den entgleitenden Rucksack, richte mich etwas benommen auf! Gottseidank,<br />
der Schädel dröhnt zwar, aber Bretter und Knochen sind heil geblieben. Unten<br />
fragt Erich, warum ich seine Warnung nicht befolgt habe. Er hatte mir zugerufen<br />
nicht im Schuss zu fahren! Dann kam der Nebel! Wir hatten gerade den Hochgrat<br />
erreicht, als mit hohlem Sausen graue Fetzen über die Wächten wehten. In kurzer<br />
Zeit steigerte sich der Wind zum eisigen Sturm, der tief aus dem Tal der Theiß<br />
heraufbrauste und sich mit voller Wucht auf uns stürzte. Schneeflocken und Eiskristalle<br />
trieben horizontal vorbei. Nach wenigen Minuten waren unsere linken<br />
Gesichtshälften mit einer Eiskruste bedeckt, wir holten Reservesocken hervor,<br />
zogen sie über die Handschuhe. Plötzlich sah ich graue Schemen durch den<br />
Nebel huschen, „Wölfe, dort!“ Es waren keine Wölfe, einige Meter voraus<br />
wirft eine kleine Wächte Schatten. Das trübe Licht täuscht! Oder sollte doch<br />
vielleicht der Sturz? Nach einer endlosen halben Stunde müssen wir<br />
fest-stellen, dass wir die Richtung verloren haben. Hier oben können wir<br />
unmöglich bleiben, wir beschließen auf gut Glück in eines der vielen Seitentäler<br />
abzusteigen. Nur noch wenige Stunden Tageslicht! Statt in warmer Stube<br />
Weihnachten zu feiern, werden wir heute wahrscheinlich in Teufels Kü-<br />
Budweiser Sprachinsel.<br />
Männertracht. Verlag Bund<br />
der Deutschen in Böhmen,<br />
Prag. Entwurf von G. Moest.<br />
Ansichtskarte um 1910.<br />
(Sammlung Reinhold Fink)
152<br />
153<br />
che kommen! Fast schon erschöpft arbeiten wir uns durch tiefen Schnee talwärts.<br />
Die Sicht beträgt knapp drei Meter, das Hanggefälle weist den Weg. Endlich lockert<br />
sich der Nebel ein wenig, wir stehen in einem tiefen Einschnitt, Steintrümmer<br />
lagern übereinander, eine vereiste Quelle entspringt, weiter unten tauchen aus<br />
dem Dunst Bäume auf. Wir sind auf den Ursprung eines Tales gestoßen! In der<br />
Talsohle müssen wir von Stein zu Stein springen, gleiten oft am glasigen Eisüberzug<br />
ab und stehen im Wasser. Es gibt keine andere Möglichkeit, zu beiden Seiten<br />
gehen die dicht bewaldeten Hänge steil empor.<br />
Die nächsten Stunden wurden zur Qual. Ich zwinge mich immer wieder nicht<br />
aufzugeben. Schließlich scheint ein Endpunkt erreicht zu sein, die Füße sind gefühllos,<br />
ich mache den Vorschlag unter einer breitkronigen Tanne ein Feuer zu<br />
entfachen und dort die Nacht zu verbringen. Ein passender Baum an einer etwas<br />
weniger steilen Stelle ist auch bald gefunden. Als wir uns auf das fast trockene<br />
Nadelbett unter den schützenden Zweigen kurz ausruhen wollen, hebt oben im<br />
Wald ein schauriges Heulen an. Wortlos schultern wir wieder unsere Bretter und<br />
stolpern weiter. Ein zweiter Vorschlag von mir, die schweren Skier hier irgendwo<br />
aufzubewahren und später wieder zu holen, wird zu unserem Glück, wie sich<br />
herausstellte, nicht verwirklicht. Es wäre mit Sicherheit unser Verderben gewesen!<br />
Langsam geht es weiter. Wir dürfen keine Rast mehr einschieben. Ein bitterer<br />
Weihnachtsabend! Wenn wir wenigstens aus dem eisigen Bachwasser heraus<br />
könnten!<br />
Und dann ist das Wunder geschehen! Mitten in dem jetzt schon wilden Urwald,<br />
dicht neben dem breiter werdendem Bach ein Weg! Kaum einen halben Meter<br />
breit, aber ein wohl gepflegter ebener Jägerpfad! Gerade zur rechten Zeit! Wir<br />
können wieder anschnallen und gleiten! Jetzt erst merke ich die große Müdigkeit!<br />
Der Körper scheint von der vielstündigen Überanstrengung wie ausgeglüht<br />
zu sein. Und doch dürfen wir unseren Sinnen keine Ruhe gönnen, die Lichtkegel<br />
der Taschenlampen enthüllen neue Gefahren.<br />
Unglaublich viele Wildfährten haben den Pfad festgetreten, Rotwild, Schweine,<br />
einmal taucht der Prankenabdruck eines Bären auf, aber bis jetzt keine menschliche<br />
Spur! Solche Wildwechsel sahen wir noch nie! Immer wieder wirft sich<br />
einer von uns über das Eiswasser des Baches und schlürft in durstigen Zügen,<br />
während der andere das Licht über die tief verschneiten Tannendickungen huschen<br />
lässt. Wir glauben zwischen den Bäumen lauernde Augen zu spüren, wir<br />
müssen auf der Hut sein. Dann hören wir es wieder, das klagende Jaulen, es<br />
kommt von den Hängen weit über uns. Beim Trinken entdecke ich auf einem<br />
verschneiten Stein eine seltene Nerzspur! Was wohl unsere Freunde aus der<br />
Zipserei denken werden, dass wir unser Versprechen nicht eingehalten haben?<br />
Vielleicht glauben sie, dass wir wegen des unbeständigen Wetters die Fahrt nicht<br />
angetreten haben. Mitternacht! Der Sturm, im engen Tal schon seit Stunden kaum<br />
spürbar, ist völlig verstummt, Sterne tauchen auf. Auf den verschneiten Bäumen<br />
funkeln Tausende von Kristallen, wenn sie der Lichtstrahl streift. Das<br />
zweite Wunder dieser Nacht geschieht! Jenseits des Baches auf einer Lichtung<br />
ragt ein dunkler Schatten, eine Hütte! Es ist eine verschlossene Jagdhütte, aber<br />
dicht daneben ein unverschlossener Schuppen. Holz ist reichlich an der Wand<br />
aufgestapelt, wir schleppen einen Haufen zusammen, dann brennt das Feuer. Das<br />
Tor ist verschlossen, es sind genügend Ritzen im Dach für den Rauchabzug, die<br />
Huzulen machen es auch so, zusammen gekauert und todmüde liegen wir da,<br />
halb in Schlaf, wirft einer einen Block in die Glut. Funken stieben. Der Bach<br />
rauscht seltsame Melodien in unseren Erschöpfungsschlaf. Bald klingt es wie<br />
Schellengeläute, bald scheinen Schritte um den Bau zu knirschen, dann nur noch<br />
Schlaf! Am nächsten Morgen ging die Fahrt weiter. Gegen Mittag erreichten wir<br />
das Forsthaus. Der Jäger, ein riesiger, bärtiger Ruthene, hatte uns kommen sehen,<br />
stand vor der Tür und schlug die Hände über den Kopf zusammen, als er unseren<br />
Bericht hörte. Beim heißen Tee erzählte er dann, dass wir aus dem Verbotenen Tal<br />
gekommen seien aus dem Wildreservat der Ostbeskiden, wohin ausländische<br />
Staatsmänner zum Abenteuer einer Bärenjagd geführt werden. Vierzehn Bären<br />
hausten nach seinen Angeben allein in dem kleinen Tal, ungezählte Hirsche und<br />
Wölfe. Am größten war sein Erstaunen darüber, dass wir nicht in seine Wolfsfallen<br />
gekommen waren, die er am Weg ausgelegt hatte. Unsere treuen Bretter<br />
haben uns davor bewahrt.<br />
Budweiser Sprachinsel:<br />
Trachtenbild und Bauernhaus.<br />
Verlag <strong>Deutscher</strong><br />
<strong>Böhmerwaldbund</strong>, Budweis.<br />
Ansichtskarte um 1910.<br />
(Sammlung Reinhold Fink)
154<br />
155<br />
Vom Sulzberg bei Ulrichsberg in Oberösterreich eröffnet sich dem Auge ein weiter<br />
Blick in das Moldautal und sein Aulandschaften. Er gleitet über Glöckelberg,<br />
das zumeist in Ruinen steht, ruht auf Oberplan, dem Geburtsort Adalbert Stifters,<br />
und freut sich an den herübergrüßenden Dörfern: Pernek, Salnau und Schönau,<br />
deren Wiesen und Äcker in herber Schönheit vor den dunklen Grenzwäldern des<br />
Plöckensteins hingebreitet liegen. Dahinter ruhen die vertrauten Bergschwünge<br />
des Kubani und Schreiner. Das Moldauherz hat aufgehört zu schlagen. Sein silbernes<br />
Band hat der Stausee verschlungen. Und dann verschattet sich der Blick.<br />
Vergeblich sucht er nach Stögenwald, Fleißheim, Ratschlag, Mayerbach,<br />
Untermoldau, Sarau. Auch wo das Wasser des Sees nicht hinreicht,<br />
In Schauen versunken…<br />
Die Betrachtung der Ansichtskarte von Salnau Bahnhof mit der alten<br />
Moldaubrücke weckt unvergessliche Erinnerungen an unseren Heimatort. Die<br />
alljährliche Scheiterschwemme war ein faszinierendes Erlebnis für jung und alt,<br />
das man am eindrucksvollsten von der Brücke aus beobachten konnte. Dicht gedrängt,<br />
manches Mal auch vereinzelnd, ließ sich das Holz gemächlich von der<br />
„Waldaha“ („Waldache“) in die Ferne tragen. Oft versuchte ich, ein ausgemachtes<br />
Scheit mit den Augen so lange zu begleiten, bis es meinem Blickfeld entschwand.<br />
Ich verspürte immer einem leisen Abschied dabei. Der Anblick der<br />
talaus schwimmenden Scheiter bewegte auch Dr. Alois Ernst Milz, als er 1931<br />
zufällig die Schwemme in Salnau miterlebte. Als er am nächsten Tag mit dem<br />
Zug Budweis verließ, um zu einem Studienaufenthalt nach Münster/Westfalen zu<br />
fahren, blickte er abschiednehmend zurück auf die Stadt, die Moldau und auf die<br />
den Horizont säumenden Berge: den Schöninger, Plöckenstein, Schreiner und<br />
Kubani, Libin - da sprangen die Verse des „Dionys Teichmüller“, bekannt als Dr.<br />
Anton Wallner, zugleich mit der zugehörenden Melodie in sein Bewusstsein und<br />
ließen ihn nicht mehr los. Dem beeindruckenden Erlebnis des Dr. A. E. Milz auf<br />
unserer alten Moldaubrücke folgte die Inspiration zum ergreifendsten und beliebtesten<br />
Volkslied unserer Heimat dem „Wuldalied“, das seine Geburtsstunde<br />
Salnau verdankt. Das Lied ist uns inzwischen ein Stück Heimat geworden und<br />
soll immer erklingen, wenn <strong>Böhmerwäldler</strong> beisammen sind. Es begleitet uns<br />
von der Wiege bis zur Bahre, bei freudigen und traurigen Ereignissen. Den beiden<br />
Schöpfern unseres schönsten Heimatliedes, Dr. Anton Wallner und Dr. Alois Ernst<br />
Milz, ein herzliches „Vergelt’s Gott“ für ihr unvergängliches Geschenk.<br />
Blick vom Sulzberg (Nähe Hochficht) ins Moldautal (Aufn. Grete Rankl)<br />
Moldaubrücke am Salnau – Bahnhof 1930, Aufn. Seidl (Bildg. Grete Rankl)<br />
„Furt schwimman die Scheider tolaus ullwal weida“<br />
Grete Rankl
156<br />
157<br />
Es war kurz nach der Wende, als ich nach langen Jahren wieder in mein Heimatdorf<br />
kam. Ein schwermütiges und trauriges Wiedersehen seit der gewaltsamen<br />
Trennung nach dem Krieg. Das Bild des Ortes hatte sich nachteilig verändert.<br />
Viele Häuser waren verschwunden, abgerissen, der Wald übermächtig geworden.<br />
Ich sah mir den Verfall an und ging erschüttert auf den Bleiberg. Der in der Vorkriegszeit<br />
angelegte Serpentinensteig war kaum noch zu erkennen. Der Pfad, an<br />
dessen Erstellung wir als Schüler mitgeholfen hatten, verlor sich in Gestrüpp und<br />
Wildwuchs. In den Unterrichtsfächern „Knabenhandarbeit“ und „Freihandzeichen“<br />
haben wir ersatzweise Rodungsarbeiten zur Kultivierung am Bleiberg<br />
geleistet. Fast versteckt, hinter verkümmerten Zwergkiefern, fand ich auch<br />
Die alte Bank am Bleiberg<br />
Ernst Braun<br />
öden leere Flächen, dort wo einst tüchtige Menschen gewohnt und das Land zum<br />
Blühen gebracht haben. Der bedeutendste <strong>Böhmerwäldler</strong> Erzähler, Adalbert Stifter,<br />
geb. 23.10.1805 in Oberplan, hat in einer seiner schönsten Erzählungen, im<br />
„Hochwald“ (1841), unserer Heimat ein Denkmal gesetzt. Eine tiefe Liebe verband<br />
den Begnadeten Zeit seines Lebens mit seiner Heimat, die zu einem wesentlichen<br />
Impuls seines Schaffens wurde. Immer wieder erinnern die in seinen Werken<br />
vorkommenden Namen an Orte, die uns einmal Heimat waren: Berg der drei<br />
Sessel, der Plöckenstein mit den See, Glöckelberg, Oberplan, Hirschbergen,<br />
Parkfried, Pernek, Spitzenberg, Salnau, Seewand, Seebach, Friedberg, St. Thoma,<br />
Wittinghausen u.a. Er schildert die Grenzberge:<br />
„Da ruhen die breiten Waldesrücken und steigen lieblich schwarzblau dämmernd<br />
ab, gegen den Silberblick der Moldau; es wohnet unsäglich viel Liebes und<br />
Wehmütiges in diesem Anblicke!“ Was wir fühlen und empfinden, wenn unser<br />
Blick und unsere Gedanken von der Aussichtswarte „Moldaublick“ am hohen<br />
Sulzberg in die Heimat gehen, drückt kaum jemand ergreifender aus als er: „Sehnend<br />
sitze ich hier und hefte das Auge in die Ferne. Dort wo des Himmels Blau<br />
sanft sich mit den Bergen vermischt, dämmert das freundliche Land der verlassenen<br />
Heimat herüber. Dorten der neblige Streif, o, ich kenne ihn gut, dort ist hochaufragend<br />
der Wald, der die Heimat beginnet. Glänzendes Jugendland, wäre ich<br />
doch wieder in dir…“ Adalbert Stifter ist in seiner Welt einer von uns. Er ist<br />
zeitlebens der Heimat treu geblieben und bediente sich auch in der Fremde seiner<br />
heimischen Mundart. Heimweh nach dem Land unserer Kindheit und Jugend<br />
gräbt sich immer tiefer und hinterlässt eine Wunde, die niemals mehr heilen wird,<br />
denn wie es schon Stifter offenbarte: „meine ganze Seele hängt an der Gegend…“<br />
So grüßen wir still den Böhmerwald, die Heimat. Sie gehört uns nach göttlichem<br />
und nach menschlichen Recht!<br />
die Bank meiner Jugend wieder, von Borstengrasbüscheln und Beersträuchern<br />
umrankt. Eine Eidechse, die auf den halb verwitterten, einst glatt gehobelten<br />
Holzplanken gesessen hatte, huschte bei meinem Kommen fort. Breite Moosflächen<br />
hingen zwischen den Fugen der Sitzfläche. Distelzweige breiteten sich<br />
über der Lehne aus. Ich war ergriffen und suchte mir zwischen der natürlichen<br />
Polsterung einen Platz zum Sitzen. Die altersschwache Bank hatte all die Jahre<br />
überdauert und war noch standfest. Spurlos ging jedoch die Zeit auch nicht an ihr<br />
vorüber. Narben und Risse im Holz zeugten von ihrem Alter. Sie wurde hier im<br />
Halbdunkel des Waldes von der unbarmherzigen Witterung gemartert. Ich freute<br />
mich, ein Anhängsel meiner Jugend gefunden zu haben. Bei der Begegnung mit<br />
der alten Bank musste ich unwillkürlich lächeln, wie bei der Begegnung mit einem<br />
guten Bekannten. Da saß ich nun und schaute hinab in das halb zerstörte<br />
Heimatdorf. Genau so wie vor einem Menschenalter schaute ich mich im Land<br />
meiner Jugend um und zum Rücken des breiten Berges gegenüber. Sitzen, schauen<br />
und sinnen. Stille rings herum, den Reiz der vertrauten Landschaft aufnehmen<br />
und sich Gedanken machen über das Geschehen in den langen Jahren der Vergangenheit.<br />
Auf diese Bank nahm ich mir die Zeit, über die unersetzlichen und<br />
verwehten Jahre nachzudenken. Bei der Leblosigkeit der alten Bank tauchten<br />
Erinnerungen auf. In der Strömung und den Geist der damaligen Jugend hatte das<br />
Holz der Bank so manches gesehen und auch zwangläufig für sich behalten. Bestimmt<br />
auch angefangen von der Freude und den Stolz über die schöne Heimat,<br />
die so mancher von der Höhe aus empfand. Aber auch bittere Tränen der Enttäuschung,<br />
sind hier geflossen und ernste Gespräche über menschliche<br />
Unverträglichkeiten wurden hier geführt. Zuneigungen unter jungen Menschen<br />
haben sich auf der Bank abgespielt und Träume von tatenhungrigen, weltbegierigen<br />
jungen Burschen. In der langen Kette von Jahren, die mit der Bank vorübergingen,<br />
alle Menschen, die hier saßen, träumten, dichteten, die sich hier liebten.<br />
Allen jenen, für die diese Bank zum Märchenland wurde, sowie anderen die<br />
manchmal zornig und auch verzweifelt die Lehne anfassten und mit ihrem Schicksal<br />
haderten, weil sie erkennen mussten, dass sie, aus welchen Gründen immer,<br />
gescheitert waren. An diese Menschen musste ich denken, die sich in die Einsamkeit<br />
der Bank zurück gezogen hatten und mit ihrem Kummer allein sein wollten.<br />
Sie fanden vielleicht Trost beim Anblick der Berge ringsum, waren im Sommer<br />
nach einem Regen überrascht von den bunten Reigen des Farbenbogens, der sich<br />
über den dunklen Wäldern der Berge spannte und die bitteren Gedanken etwas<br />
lockerte. Die grausame Faust der Zeit hat die Gemeinschaft der Menschen, die<br />
hier lebten zerschlagen, auseinandergerissen und in alle Winde verstreut. Warum?<br />
Kann das ein Mensch rechtfertigen? Sie sitzen jetzt vielleicht auf anderen<br />
Bänken im gepflegten Park. Auf der alten Bank am Bleiberg, von wild gewachsenen<br />
Gestrüpp umgeben, hat wohl selten noch jemand gesessen in der ganzen<br />
Zeit. Die Bank, eine leblose Selbstverständlichkeit, ein Gegenstand aus Holz,<br />
sonst nichts. Und dennoch beseelt auch von meiner Jugend, meinen Träumen und<br />
Plänen, von vielen Wünschen, die nicht in Erfüllung gingen.
158<br />
159<br />
Über die Geschichte er großen Höritzer Passionsspiele haben wir schon viel berichtet,<br />
dass nach der Vertreibung der ausschließlich deutschen Bewohner die<br />
nachfolgenden Besetzer und Bewohner eine Neuauflage des Passionsspieles ins<br />
Auge fassten, ist nur wenigen bekannt. Es war dies zu einer Zeit, wo das Festspielhaus<br />
noch mehr oder weniger intakt war, nachdem es in der Zeit des Krieges<br />
den Aufführungen völkischer Bühnen und der Laienbühne Höritz zur Verfügung<br />
stand, in der Folgezeit der deutschen Wehrmacht, vornehmlich dem deutschen<br />
Afrikakorps, als Bekleidungslager diente und den nachfolgenden amerikanischen<br />
Besatzern als Tanzsaal. Die Aufführungen des Passionsspieles 1947 in tschechischer<br />
Sprache durch die nunmehr tschechischen Bewohner waren ein erbärmliches,<br />
armseliges Unterfangen, obwohl die kostbaren Kostüme und Requisiten<br />
zum Teil noch zu Verfügung standen. Bezeichnend war, dass man den letzten<br />
Christusdarsteller der Jahre 1933 / 36, Johann Wiltschko, aus dem Zwangsarbeitslager<br />
Pötschmühle herbeischleppte, wobei zu seiner Christusdarstellung hinter<br />
den Kulissen der tschechische Text gesprochen wurde. Es war ein wahrhaft gequälter<br />
und geschundener Christus, der den Tschechen als Gallionsfigur diente.<br />
Nach diesem erfolglosen Versuch eines Neubeginns der Leidensspiele haben die<br />
Tschechen das Festspielhaus zerstört und dem Erdboden gleichgemacht, die Kostüme<br />
und Utensilien geplündert oder vernichtet. 1993, sechsundvierzig Jahre später,<br />
nach dem Fall des Eisernen Vorhanges, wurde ein neuerlicher Versuch begonnen,<br />
diesmal in Ermangelung des 1947 zerstörten Spielhauses auf einer Freilichtbühne.<br />
Zu dieser Zeit, unter dem damaligen Bürgermeister Ing. Cunat, lagen<br />
im Gemeindeamt Pläne auf, die einen Neubau eines Spielhauses in Form eines<br />
Fisches vorsahen. Auch daraus ist nichts geworden. Im ersten Spieljahr 1993,<br />
dem Centarium, erwartete man hiezu an bis zu 20 Spieltagen jeweils 512 Besucher<br />
auf der Freilichtbühne, zu der die Besucher aus der Umgebung und mit Bussen<br />
aus dem Landesinnern gebracht wurden. Man spielte jedes Jahr und wie<br />
wir vermutet hatten nahm die Besucherzahl immer mehr ab. Zur Erinnerung:<br />
Nach den großen Erfolgen des einstigen Passionsspieles und der wachsenden<br />
Bekanntheit war es selbst in Höritz nicht möglich, jedes Jahr zu spielen.<br />
Somit haben sich nach zehn Jahren die Aufführungen bis auf vier im<br />
Jahre 2003 reduziert, mit einer Dauer von 1 1/2 Stunden, bezogen nur auf die<br />
Leidensgeschichte. Das vormalige Höritzer Passionsspiel dauerte sechs Stunden<br />
und war aufgeteilt in eine Vormittags und in eine Nachmittagsaufführung.<br />
Das Spiel als solches zu bewerten bleibt jedem unserer Besucher selbst überlassen.<br />
Es ist kaum davon auszugehen, dass den Darstellern jene innige Einstellung<br />
zu der Leidensgeschichte unseres Herrn inne war, die notwendig ist,<br />
um das Geschehen entsprechend der jahrhundertlangen Tradition vorstellen<br />
zu können. Wir ehemaligen Höritzer begrüßten und bejahten die Neuauflage des<br />
Passionsspieles in unserem Heimatort und glaubten, dass dies zur Stärkung des<br />
christlichen Glaubens in dem vom Kommunismus geschüttelten religionsfeindichen<br />
gegenwärtigen Böhmerwald beitragen könne und die Einbindung der<br />
nunmehrigen Bewohner in das kirchliche Leben zur Folge habe. Wir meinten<br />
auch, dass eine etwaige Einbindung unserer ehemaligen Höritzer in den Neubeginn<br />
durchaus befruchtend gewirkt hätte. Das wäre wohl ein revolutionäres<br />
Unterfangen geworden. So aber haben die jetzigen Verantwortlichen diese einmaligen<br />
Chance einer Versöhnung vorübergehen lassen. Es ist ein weiter Weg zu<br />
diesem Gottvertrauen, das uns Höritzern innewohnte und unser Passionsspiel<br />
formte. Die heutigen Bewohner und Verantwortlichen, die nach dem Fall des<br />
Eisernen Vorhanges und dem Regimewechsel in den böhmischen Ländern keine<br />
religiösen Beschränkungen und keine Repressalien mehr zu befürchten hatten,<br />
blieben trotzdem in ihrer überwältigenden Mehrheit den Gottesdiensten fern, so<br />
dass wir mit Recht befürchten müssen, dass sie das Leidensspiel nur um des Geschäftes<br />
willen betreiben. Zur Erinnerung möchten wir feststellen, dass im einstigen<br />
Höritz der jeweilige Spieltag mit einem Gottesdienst in unserer Pfarrkirche<br />
begann und auch die Mitwirkenden, wenn es ihnen möglich war, an diesem sogenannten<br />
Dankgottesdienst teilnahmen. Das zeigt schon, wie eng das Passionsspiel<br />
mit dem kirchlichen Leben verbunden war So meinen wir mit Recht, dass<br />
jene, die durch die unmenschliche Vertreibung soviel Schuld auf sich geladen<br />
haben, jedwede moralische und ethische Berechtigung fehlt, die<br />
Höritz, geschändete Bergkirche 1965 (Archiv Hans)<br />
Die Höritzer Passionsspiele nach der Vertreibung<br />
Franz Bayer
160<br />
161<br />
Leidensgeschichte unseres Herrn darzustellen. Das Festspielhaus war vor dem<br />
endgültigen Verschwinden lange Zeit eine Ruine und die wenigen noch Überlebenden<br />
von denen, die dieses Haus mit Leben erfüllten, sind heute verstreut in<br />
aller Welt. Ihnen und den in der Fremde oder noch daheim Begrabenen gilt unser<br />
Dank für die kulturhistorische Arbeit, die sie für unser Höritz und die althergebrachten<br />
Volksspiele geleistet haben. Es gab den Versuch eines Neubeginns des<br />
Höritzer Passionsspieles im bayrischen Freyung. Er geht zurück auf die Beschlüsse<br />
des Stadtrates von Freyung, die Höritzer Passionsspiele in der niederbayrischen<br />
Kreisstadt neu zu beleben. Initiatoren waren Prof. Erich Hans, der Vater unseres<br />
Bundesvorsitzenden Ingo Hans, Dir. Toni Neubauer, Dr. Alois Milz, Franz Bartl,<br />
der erste Christusdarsteller der großen Spiele 1893, der Bundvorsitzende des<br />
Heimatverbandes der <strong>Böhmerwäldler</strong>, Ministerialdirigent Adolf Hasenöhrl und<br />
der 1. Bürgermeister der Stadt Freyung, Josef Lang. Dieses Vorhaben einer Neuauflage<br />
des Höritzer Passionsspieles wurde in der Sitzung vom 17. März 1970<br />
einstimmig beschlossen und angenommen. Dass in der Folge die maßgeblichen<br />
Proponenten Dir. Neubauer, Franz Bartl und Dr. A. Milz zu früh verstarben, war<br />
schließlich der Grund, dass dieses Vorhaben nicht mehr verwirklicht werden konnte,<br />
zu einer Zeit, in der noch viele namhafte Darsteller des Höritzer Passionsspieles<br />
am Leben waren, wohl verstreut in Deutschland und Osterreich. Sie hätten<br />
dem neuen Spiel sicher durch ihre Erfahrung auch neue Impulse geben können.<br />
Der Heimatforscher P. Dr. Valentin Schmidt, ein profunder Kenner des Höritzer<br />
Spieles und Verfasser vieler Beiträge über Höritz und sein Passionsspiel, war vor<br />
seiner Bestellung zum Archivar des Stiftes Hohenfurth unter anderem auch Kaplan<br />
der Pfarre Höritz. Schmidt sprach als solcher am Schluss eines geschichtlichen<br />
Umrisses anlässlich seines ersten Dabeiseins beim Passionsspiel von einem<br />
ergreifenden Gottesdienst: „Möge auch das wiedererstandene Spiel ein solcher<br />
sein, Gott und meinem Volke zur Ehre.“ Und ein solcher Gottesdienst waren die<br />
Spiele, Beweise, dass der deutsche Böhmerwald seine Frömmigkeit seine Lebenskraft<br />
nicht verloren hatte und hat.<br />
Europassion.<br />
In den Hoch - Zeiten der Passionsspiele im europäischen Raum, vornehmlich in<br />
den deutschen Landen, gab es mehr oder weniger lockere Verbindungen zwischen<br />
den bekannten Passionsspielorten. Eine solche Beziehung ist uns aus dem<br />
Archiv der Passionsgemeinde Oberammergau bekannt. Nach den Schilderungen<br />
meines Großvaters, der zu jener Zeit Bürgermeister von Höritz war und jenen<br />
meines Vaters (Darsteller des Johannes der Jahre 1923 /27), führten die beiden<br />
eine Delegation von Höritzern in den Jahren 1920 und 1930 zu den dortigen<br />
Spielen. Auf ein mögliches Protokoll können wir leider nicht verweisen, da die<br />
Gemeindechronik von Höritz bis zum heutigen Tage verschollen ist. Das Protokoll<br />
der Passionsgemeinschaft Oberammergau allerdings spricht vom Besuch<br />
einer Abordnung im Jahre 1903, ist im dortigen Archiv einzusehen und wurde<br />
mir anlässlich der Passionsausstellung 1994 in Linz leihweise zur Verfügung<br />
gestellt. Diese Reise der Delegation mit dem Verleger Guido Lang (aus<br />
dieser Spielerdynastie stammen außer einem Christusdarsteller noch weitere hervorragende<br />
Spieler) hat der Protokollführer in dem für uns wichtigen Dokument<br />
minutiös aufgezeichnet und den Besuch der Aufführung beschrieben. Es ist uns<br />
daher ein Beispiel freundschaftlicher Verbindung beider berühmten Passionsspielorte<br />
bekannt. Anders als in jenen Tagen, als es nur vage Verbindungen zwischen<br />
verschiedenen Passionsspielorten gab, vereint die in den Neunziger Jahren gegründete<br />
„Euro – Passion“ alle Passionsspielorte unseres Kontinents. Dieser Euro<br />
Passion gehören derzeit 52 Orte Europas an, allein sieben aus Österreich. Alljährlich<br />
finden in einem Passionsspielort, in welchem gerade aktuell gespielt wird,<br />
Kongresse oder Tagungen statt. Der letzte uns bekannte Kongress fand 2000 in<br />
Oberammergau statt, an dem ich mit einigen unserer Höritzer teilnehmen konnte,<br />
ebenso wie auch eine Delegation aus dem jetzigen Höritz. Oberammergau ist<br />
derzeit neben Erl in Tirol und St. Margarethen im Burgenland der bekannteste<br />
Passionsspielort im deutschen Sprachraum. Jeweils bis zu 5000 Besucher können<br />
den Aufführungen beiwohnen. Vor der Vertreibung zählte Höritz im<br />
Böhmerwald mit 2000 Besuchersitzplätzen im Festspielhaus neben Oberammergau<br />
zu den bekanntesten Spielorten in den deutschen Landen. Was wäre aus Höritz<br />
und seinen Spielen wohl geworden, hätte es die unselige Vertreibung nicht gegeben?<br />
Anna Klarner: Waldhütte<br />
(Aquarell)
162<br />
163<br />
Wenn im Flachland schon längst die Getreideernte vorbei war, da stand in den<br />
höher gelegenen Dörfern und Gehöften des Böhmerwaldes das Getreide erst in<br />
seiner Vollreife. Es kam vor, dass erst Ende September, wenn bereits der erste<br />
Reif über die Fluren gegangen war, der Hafer eingebracht werden konnte. Öfters<br />
hat der vorzeitige Einbruch eines Winters ganze Erdäpfelfelder zugeschneit, dann<br />
konnten die Erdäpfel erst im Frühjahr geerntet werden. Die Getreideernte stellte<br />
den Höhepunkt in der Jahresarbeit eines Bauern dar. In vielen Teilen des<br />
Böhmerwaldes ließ man an einem Eck des Ackers eine größere Anzahl Halme<br />
stehen, „für die Vögel des Himmels“, hieß es. Von der ersten Fuhre wurden die<br />
ersten zwei Graben kreuzweise in die „Leg“ im Hohlborn mit den Worten gelegt:<br />
„Dem Bauern das Brot, den Mäusen den Tod“. Meist wurde die erste Fuhre schon<br />
vor dem Scheunentor mit Weihwasser bespritzt und in manchen Gegenden dazu<br />
ein Vaterunser gebetet. Das Ausdreschen des Getreides begann erst im Spätherbst.<br />
Aus allen Scheunen konnte man die Drischeltakte hören. Ganz selten hörte man<br />
aber nach Lichtmess noch dreschen, bis dorthin hatten die meisten Bauern ausgedroschen.<br />
Der Drischeltakt, diese vertraute Herbst und Wintermelodie des<br />
Bauerndorfes gehört jedoch schon lange der Vergangenheit an.<br />
Allerheiligen und Allerseelen<br />
Sobald sich die Natur zum Winterschlaf rüstete und die letzten bunten Blätter<br />
von den Bäumen fielen, gedachte man im Böhmerwald der Toten. Die letzten<br />
Blumen des scheidenden Sommers trug man auf den Friedhof und schmückte<br />
damit die Gräber. Im Gebete für die Verstorbenen erinnert sich jeder, dass auch<br />
das Leben und Wirken auf dieser Welt nicht von Dauer ist und eines Tages zu<br />
Ende geht. Am Allerseelentag, dem 2. November, lebte im Volksbrauch so mancher<br />
Aberglaube. Es kehren an diesem Tag die Seelen der Verstorbenen wieder<br />
zu den Schauplätzen ihres einstigen Lebens zurück. Die flackernden Lichter auf<br />
den Friedhöfen versinnbildlichen die umherschwirrenden Seelen, darum wurden<br />
am Allerseelentag auf den Gräbern und in manchen Häusern Kerzen angezündet,<br />
um das Andenken der Toten zu ehren. Um Allerheiligen und Allerseelenzeit<br />
wurden die sogenannten „Seelerwecken“ gebacken, die an die ärmere Bevölkerung<br />
verteilt wurden, die von Hof zu Hof zog und ihren Spruch aufsagte: „i tat<br />
schöi bittn um an Seelerweckn!“ Nur selten kam es vor, dass einer dieser Bittenden<br />
leer ausging. Wo keine Seelerwecken mehr vorhanden waren, erhielten sie<br />
eine Geldspende.<br />
Der Totengedenkmonat November<br />
Am Allerheiligen aber ganz besonders am Allerseelentag gedachten wir nach<br />
altem Herkommen aller unserer Verstorbenen. Am Allerseelentage kamen viele<br />
Menschen in ihren Geburtsort, wo Eltern und Geschwister ihre Grabstätten hat<br />
Nach unseren Gräbern<br />
sollt ihr nicht suchen,<br />
nicht ruhelos wie Ahasver<br />
weite Wege verfluchen.<br />
Durch Europa kreuz und quer<br />
verläuft unsere Spur,<br />
in vielen Ländern begraben<br />
sind Menschen, die vorher nur<br />
nebeneinander gewohnt haben.<br />
Die Mahnung der Toten<br />
Ungezählte hat man verscharrt,<br />
kein Kreuz schmückt die Hügel,<br />
einfach in ein Loch gekarrt.<br />
Krieg und Haß führten die Zügel.<br />
Kaum mehr ein Zeichen<br />
vom toten Freund im Grasland,<br />
vom Bruder unter Birken und Eichen,<br />
vom Kameraden im Steppensand.<br />
Sucht uns nicht,<br />
denkt an uns mit einem Gebet.<br />
Das zählt und hat Gewicht<br />
Auf dass die Liebe nicht verweht.<br />
Ernst Braun<br />
Volksbrauch zur Herbstzeit<br />
ten. Dort besprengte sie die Gräber mit Weihwasser und beteten ein Vaterunser<br />
für die armen Seelen. Es war eine der besten und schönsten Sitten, dass wir die<br />
verstorbenen Eltern und andere Lieben, die mit uns im Leben verbunden waren,<br />
nie vergaßen. Aber nicht nur in den Friedhöfen standen Kreuze mit Namen, Geburtstag<br />
und Sterbetag des Verstorbenen, auch draußen in der Landschaft zeugten<br />
Kreuze, Marterl und Bildstöcke von Unfällen und jähem Tod, die besonders<br />
angetan waren, uns Lebenden die Vergänglichkeit vor Augen zu halten. Jeder<br />
Vorübergehende zog den Hut und sprach dem Verstorbenem ein „Herr gib ihm<br />
die ewige Ruh und das Licht leuchte ihm, Amen“.<br />
Zu Allerheiligen verabschiedet sich der Altweibersommer. Die Nacht zwischen<br />
Allerheiligen und Allerseelen war verschrien und gefürchtet. Die „Wilde Jagd“<br />
rast in dieser Nacht hinter den Armen Seelen hinauf zu den Gefilden und wieder<br />
hinunter in die Täler. Fanden sie da nicht einen Baumstock in dem drei Kreuze<br />
eingehakt waren, auf dem sie ausruhen konnten, so ging die Wilde Jagd weiter<br />
bis zum Morgengrauen. Im November stehen auch einige Heilige im Kalender,<br />
auf deren Namen viele <strong>Böhmerwäldler</strong> getauft waren. So St. Leonhard, dem als<br />
Viehpatron viele Kapellen geweiht waren. St. Martin war ein bedeutender Tag,<br />
an dem viele Gänse ihr Leben lassen mussten. Am Clemenstag sagte die Wetterregel:<br />
„Wie der Clemenstag, so der halbe Winter.“ Zwei Tage später steht Katharina<br />
im Kalender. „Kathrein stellt den Tanz ein.“ Ein anderes Sprichwort sagt: „Im<br />
Kathrei’ hot a jeda dö sei, wer do koane hot, hot no nia oane ghot.“ Der letzte<br />
Novembertag ist dem Heiligen Andreas geweiht. „Schneit es auf Andreas, so<br />
bleibt der Schnee hundert Tage liegen.“ Allgemein gilt jedoch für den November:<br />
„Wenn der erste Schnee auf den Kot fällt, gibt’s einen nassen Winter.“ (Überarbeitet:<br />
Ingomar Heidler)<br />
Adolf Heidler
164<br />
165<br />
Der hl. Andreas, der im Volksleben des Böhmerwaldes eine so große Rolle spielt,<br />
wurde zu Bethsaida, einem Dorfe in Galiläa (Nord-Palästina) am Ufer des Sees<br />
Genezareth geboren, war ein Sohn des Jonas, ein Bruder des hl. Petrus und Schüler<br />
des hl. Johannes des Täufers. Andreas war einer der zwölf Apostel Christi.<br />
Nach der Sendung des hl. Geistes verkündete Andreas, wie die Bibel berichtet,<br />
das Christentum bei den Skythen, Sogianern, den Bewohnern der Stadt Sebastopol<br />
im Lande Colchis. Auch in Epirus und Griechenland, besonders in Achaja predigte<br />
er und errichtete zu Paträ (Patras in Griechenland) einen bischöflichen Stuhl.<br />
In dieser Stadt fand er auch den Märtyrertod durch Kreuzigung am 30. November<br />
des Jahres 62. Seine Gebeine ruhen in der Peterskirche zu Rom.<br />
Die Andreasnacht ist im Böhmerwald eine Orakelnacht der Heiratslustigen:<br />
„Andreasabend ist heute, schlafen alle Leute, schlafen alle Menschenkind, die<br />
zwischen Erd´ und Himmel sind, bis auf den einzigen Mann, der mir zur Ehe<br />
werden kann.“ So lautete eines der zahlreichen Wunsch- und Stoßgebetlein, mit<br />
denen heiratslustige Mädchen in der nach dem Urväterglauben von zauberischen<br />
Gewalten beherrschten Andreasnacht insgeheim die Erfüllung ihrer Herzenswünsche<br />
erhoffen. Denn wenn sich beim Dämmerschein des 29. November die Fittiche<br />
dieser Wunsch- und Losnacht herniedersenken, begibt sich Wunderbares auf<br />
Erden. In dem Reiche des Aberglaubens sprossen Hoffnungskeime auf, welche<br />
allen sehnsüchtig gestimmten jungen Menschenkindern, besonders den Heiratslustigen,<br />
die Erfüllung ihrer geheimsten Wünsche, oder gar einen Blick in die<br />
Zukunft, in das erträumte Märchenland voller Liebe, Reichtum und Lebensglück<br />
verheißen. Es heißt nur bei den unterschiedlichen Horchorakeln, der Stimme des<br />
Schicksals zu lauschen oder im Kreise von Altersgenossen allerhand neckische<br />
Fragespiele auf ihre Wirkung zu erproben. Der im Volke fest wurzelnde<br />
Andreasaberglaube hat im Wandel der Zeiten keine Einbuße erlitten und Sankt<br />
Andreas, der Patron aller Liebenden, wird auch heute noch (1932) in allen<br />
Mädchenstuben gesellig oder insgeheim als Befreier von allen Herzensnöten, als<br />
Glückbringer, verehrt. Jung und alt heißt ihn willkommen, weil er die Jugend in<br />
das glückstrahlende Reich eines harmlosen Aberglaubens entführt und auch bei<br />
den sorgenvoll grübelnden Alten die goldenen Erinnerungen wachruft, da die<br />
Großmutter als jugendfrisches Mädchen am Andreasabende selbst mit ihren Gespielinnen<br />
all die von der Urahne angeratenen Orakelsprüche versuchte, um von<br />
der „großen Frage“, ob und wann sie heiraten werde, den Zukunftsschleier zu<br />
lüften. Uralt und immer noch frisch und zauberkräftig wirkt der Zauber der Andreasnacht<br />
auf die im freundnachbarlichen Kreise um den Familientisch gescharten<br />
Mädchen. Namentlich in den entlegenen Einschichten des Böhmerwaldes, wo<br />
Töchter und Mägde einträchtig beisammen sitzen, wird der Andreasabend in<br />
geheimnisvoll beglückter Feststimmung begangen. Ein geriebener Witzbold<br />
mag wohl den Orakelspruch ersonnen haben, den manche Mädchen im<br />
Böhmerwald, die ihren künftigen Stand erkunden wollen, beim Schlage<br />
Leopold Hafner: Der Hl. Andreas<br />
St. Andreastag im Böhmerwald
166<br />
167<br />
Selige, aber auch furchterfüllte Tage wechseln für die Kinder bis Weihnachten.<br />
Am Vorabend zum Nikolaustag, spätestens aber am 6. Dezember, kommt der<br />
Heilige ins Haus. Er wird von den braven Kindern mit Freuden, von den ungezogenen<br />
aber zähneklappernd empfangen. In weißem Kleide mit Bischofshaube<br />
besucht er jedes Haus. Zu Familien mit Kleinkindern begleiteten ihn früher noch<br />
ein oder zwei Engel. Hinterdrein poltert ein knurrender Krampus mit einer furcht-<br />
(Ausschnitt) Unsere Kirche feiert verschiedene Feste, welche zum Herzen dringen.<br />
Man kann sich kaum etwas Lieblicheres denken als Pfingsten und kaum<br />
etwas Ernsteres und Heiligeres als Ostern. Das Traurige und Schwermütige der<br />
Karwoche und darauf das Feierliche des Sonntags begleiten uns durch das Leben.<br />
Eines der schönsten Feste feiert die Kirche fast mitten im Winter, wo beinahe<br />
die längsten Nächte und kürzesten Tage sind, wo die Sonne am schiefsten gegen<br />
Der Heilige Nikolaus, Vorbote des Christkindes<br />
Bergkristall<br />
Grete Rankl<br />
Adalbert Stifter<br />
der Mitternacht an den Hühnerstall klopfend murmeln: „Kraht der Hohn, su krieg<br />
i an Mon, Ober gockert de Henn, so krieg i kenn.“ Und zwingt es nicht ein Lächeln<br />
ab, wenn eine andere Dorfschöne beim Schweinestalle in der Finsternis<br />
geduldig wartet, bis sich ein vergnügliches Grunzen hören lässt? Recht böse ist<br />
es, wenn die Horchende nur den tiefen Baß der Alten vernimmt, denn das deutet<br />
auf einen alten, mürrischen Junggesellen als Freiersmann. Für die Zukunftsforschung<br />
stehen Orakelbräuche in großer Auswahl zu Gebote. Besonderer Beliebtheit<br />
erfreuen sich das Bleigießen, das Haferwerfen, das Lichtelschwimmen, das<br />
Baumrütteln, die Pantoffelprobe, das Gänseorakel, das Heringessen, das Erbsenschütteln.<br />
Viele verlegen sich auf das Nachbarhorchen, das Lauschen nach dem<br />
Hundegebell. Groß ist auch die Auslese unter den von den Mädchen in der Schlafkammer<br />
erprobten Andreasgebeten:<br />
„Heiliger Andreas, meus Deus, Du lieber Schutzpatron,<br />
Ich bitte dich, gib mir einen Schein Vom Herzallerliebsten mein!<br />
Soll ich mit ihm glücklich sein, Mag er erscheinen mit Bier und Wein;<br />
Doch soll ich mit ihm leiden Not. Mag er erscheinen mit Wasser und Brot.<br />
Lasse mich im Traume seh´n, Ob er hässlich oder schön,<br />
Ob er geistlich oder weltlich, Ob er jung ist oder ältlich.<br />
Heiliger Andreas, steh´ mir bei. Dass ich seh´ sein Konterfei.“<br />
Am Andreastage werden im Böhmerwalde nach angebrochener Finsternis auch<br />
„Wulfn“ (Wölfe) abgelassen. Ein paar Burschen schleichen sich, die Peitsche in<br />
der Hand, von einem Haus zum anderen, pochen mit wuchtigen Schlägen an das<br />
Tor und rufen: „D´ Wulfn hant do!“ (Die Wölfe sind da!“) Dann knallen sie mit<br />
ihren Peitschen um die Wette, damit sie verscheucht und von der Gegend vertrieben<br />
würden. Der Brauch des Wolfschusses rührt daher, dass die Hirten mit diesem<br />
Tage ihren Jahreslohn einheimsen, das Hüten beenden und nun die Wölfe<br />
die Weide betreten konnten. Schon seit Galli (16. Oktober) hatten die Hirten gute<br />
Weide, denn von diesem Tage an konnten sie in alle Früchte, die noch am Felde<br />
waren und Wiesen ungehindert dreinhüten, Besitzgrenzen gabs dann nicht mehr,<br />
denn „nach Galli is nix mehr heili“. (Aus: Waldheimat“ Nov. 1932)<br />
erregenden Larve und rasselnder<br />
Kette, schwingender Rute und großem<br />
Sack, in dem so mancher Lausbub<br />
verschwand. Wenn das Gefolge<br />
die Stube betritt, fangen die Kinder<br />
zu beten an. Der Nikolaus lobt<br />
und tadelt, beschenkt die Braven mit<br />
Äpfeln, Nüssen und Kletzenbrot.<br />
Man darf annehmen, dass das Kletzenbrot<br />
als Opferzelten auf die germanische<br />
Vorfeier der Wintersonnenwende<br />
zurückgreift. Es ist das<br />
älteste Kultbrot, das wir kennen. Die<br />
unartigen Kinder aber müssen sich<br />
mit Rüben, Erdäpfeln und einer Rute<br />
begnügen.<br />
Ein Blick in die Legende des Heiligen<br />
sagt, dass St. Nikolaus zur Zeit<br />
des Kaisers Konstantin des Großen<br />
(4.Jhd.) in der kleinasiatischen Stadt<br />
Myra Bischof war und Mitleid mit Hungernden, v. a. Erbarmen mit notleidenden<br />
Kindern hatte. Er teilte Brot und andere Gaben unter den Armen aus. Unsere<br />
heidnischen Vorfahren hatten den Glauben, dass zur dunklen Winterzeit den<br />
Menschen feindlich gesinnte, böse Geister umherziehen. Die Kirche versuchte<br />
diesen Dämonenglauben im christlichen Sinne umzuwandeln und an Stelle jener<br />
heidnischen Geister Heilige christlicher Prägung zu setzen. Dazu war v. a. St.<br />
Nikolaus, der Wohltäter der Armen, trefflich geeignet. Dass auch noch in unserer<br />
Zeit den Heiligen ein furchterregend aussehender „Krampus“ begleitet, mag uns<br />
noch an die heidnische Zeit erinnern.<br />
Nikolaus. Aufn. Grete Rankl
168<br />
169<br />
unsere Gefilde steht und Schnee alle Fluren deckt, das Fest der Weihnacht. Wie in<br />
vielen Ländern der Tag vor dem Geburtsfeste des Herrn der Christabend heißt, so<br />
heißt er bei uns der Heilige Abend, der darauffolgende Tag der heilige Tag und<br />
die dazwischen liegende Nacht die Weihnacht. Die katholische Kirche begeht<br />
den Christtag als den Tag der Geburt des Heilandes mit ihrer allergrößten kirchlichen<br />
Feier, in den meisten Gegenden wird schon die Mitternachtsstunde als die<br />
Geburtsstunde des Herrn mit prangender Nachtfeier geheiligt, zu der die Glocken<br />
durch die stille, finstere, winterliche Mitternachtluft laden, zu der die Bewohner<br />
mit Lichtern oder auf dunkeln, wohlbekannten Pfaden aus schneeigen<br />
Bergen an bereiften Wäldern vorbei und durch knarrende Obstgärten zu der Kirche<br />
eilen, aus der die feierlichen Töne kommen und die aus der Mitte des in<br />
beeiste Bäume gehüllten Dorfes mit den langen, beleuchteten Fenstern emporragt.<br />
Mit dem Kirchenfeste ist auch ein häusliches verbunden. Es hat sich fast in<br />
allen christlichen Ländern verbreitet, dass man den Kindern die Ankunft des<br />
Christkindleins – auch eines Kindes, des wunderbarsten, das je auf der Welt war<br />
– als ein heiteres, glänzendes, feierliches Ding zeigt, das durch das ganze Leben<br />
fortwirkt und manchmal noch spät im Alter bei trüben, schwermütigen oder rührenden<br />
Erinnerungen gleichsam als Rückblick in die einstige Zeit mit den bunten,<br />
schimmernden Fittichen durch den öden, traurigen und ausgeleerten Nachthimmel<br />
fliegt. Man pflegt den Kindern die Geschenke zu geben, die das heilige Christkindlein<br />
gebracht hat, um ihnen Freude zu machen. Das tut man gewöhnlich am Heiligen<br />
Abende, wenn die tiefe Dämmerung eingetreten ist. Man zündet Lichter<br />
und meistens sehr viele an, die oft mit den kleinen Kerzlein auf den schönen<br />
grünen Ästen eines Tannen- oder Fichtenbäumchens schweben, das mitten in der<br />
Stube steht. Die Kinder dürfen nicht eher kommen, als bis das Zeichen gegeben<br />
wird, dass der Heilige Christ zugegen gewesen ist und die Geschenke, die er<br />
mitgebracht, hinterlassen hat. Dann geht die Tür auf, die Kleinen dürfen hinein,<br />
und bei dem herrlichen, schimmernden Lichterglanze sehen sie Dinge auf dem<br />
Baume hängen oder auf dem Tische herum gebreitet, die alle Vorstellungen ihrer<br />
Einbildungskraft weit übertreffen, die sie sich nicht anzurühren getrauen und die<br />
sie endlich, wenn sie sie bekommen haben, den ganzen Abend in ihren Ärmchen<br />
herumtragen und mit sich in das Bett nehmen. Wenn sie dann zuweilen in ihre<br />
Träume hinein die Glockentöne der Mitternacht hören, durch welche die Großen<br />
in die Kirche zur Andacht gerufen werden, dann mag es ihnen sein, als zögen<br />
jetzt die Englein durch den Himmel oder als kehre der Heilige Christ nach<br />
Hause, welcher nunmehr bei allen Kindern gewesen ist und jedem von ihnen<br />
ein herrliches Geschenk hinterbracht hat. Wenn dann der folgende Tag, der<br />
Christtag, kommt, so ist er ihnen so feierlich, wenn sie frühmorgens mit ihren<br />
schönsten Kleidern angetan in der warmen Stube stehen, wenn der Vater<br />
und die Mutter sich zum Kirchgange schmücken, wenn zu Mittage ein feierliches<br />
Mahl ist, ein besseres als in jedem Tage des ganzen Jahres, und wenn<br />
nachmittags oder gegen den Abend hin Freunde und Bekannte kommen, auf<br />
den Stühlen und Bänken herumsitzen, miteinander reden und be-<br />
Nachwort<br />
Die Fortsetzung geschichtlicher Themen und ein erster Teil über Brauchtum im<br />
Jahresverlauf waren Schwerpunkte in diesem Buch. Wie immer will es unterhalten<br />
und zum Nachdenken anregen. Danke all den Mitarbeitern, deren zahlreiche<br />
Beiträge z.T. auch schon für den nächsten Band aufbereitet sind. Es ist großartig,<br />
wieviel Wissen aus dem Böhmerwald wir zusammentragen können. Danke auch<br />
an Martha Hans, der stillen Sammlerin, und ein besonderes Gedenken an zwei<br />
treue Mitarbeiter, die nicht mehr bei uns sind: Michael Radlinger, im Oktober<br />
2003 verstorben, und Josef Schneider, seit Jahrzehnten Begleiter des Buches mit<br />
seinen „Budweiser Geschichten“ und seinen weiteren großartigen Erzählungen.<br />
Kurz nach der Einsendung seines diesjährigen Beitrages musste er uns verlassen.<br />
Günther Hans<br />
haglich durch die Fenster in die<br />
Wintergegend hinausschauen können,<br />
wo entweder die langsamen Flocken<br />
niederfallen oder ein trübender Nebel<br />
um die Berge steht oder die blutrote,<br />
kalte Sonne hinabsinkt. An verschiedenen<br />
Stellen der Stube, entweder auf<br />
einem Stühlchen oder auf der Bank<br />
oder auf dem Fensterbrettchen, liegen<br />
die zaubrischen, nun aber schon bekannteren<br />
und vertrauteren Geschenke<br />
von gestern Abend herum. Hierauf<br />
vergeht der lange Winter, es kommt der<br />
Frühling und der unendlich dauernde<br />
Sommer – und wenn die Mutter wieder<br />
vom Heiligen Christe erzählt, dass nun<br />
bald sein Festtag sein wird und dass<br />
er auch diesmal herabkommen werde, ist es den Kindern, als sei seit seinem letzten<br />
Erscheinen eine ewige Zeit vergangen und als liege die damalige Freude in<br />
einer weiten, nebengrauen Ferne. Weil dieses Fest so lange nachhält, weil sein<br />
Abglanz so hoch in das Alter hinaufreicht, so stehen wir so gerne dabei, wenn<br />
Kinder dasselbe begehen und sich darüber freuen. (Ausschnitt aus A. Stifters<br />
„Bergkristall“, Einsendung: Grete Rankl)<br />
Bund der Deutschen in Böhmen:<br />
Weihnachtskarte. Ansichtskarte,<br />
versandt im Dezember 1912.<br />
(Sammlung Reinhold Fink)
170<br />
171<br />
Noch immer ruft eine Stimme im Wind<br />
wie einst die Hirten zum göttlichen Kind<br />
im dürftigen Stall bei Esel und Rind.<br />
Noch immer umlauern es Bosheit und Neid,<br />
gesellt sich die Liebe im Winkel zum Leid.<br />
Und mancher steht für den Schwachen bereit,<br />
schenkt einer den Frierenden noch sein Kleid.<br />
Hält immer noch Einer die Welt im Lot,<br />
lässt keimen die Saaten im Winter zu Brot,<br />
schenkt allen das Leben und allen den Tod.<br />
Gott schenkt, der Gerechte, sich allen als Kind,<br />
den Herzen, die guten Willens sind.<br />
Weit ruft es die Glocke im Winterwind.<br />
Stimme im Winterwind<br />
Josef Fruth<br />
22. Bundestreffen 25.- 27.07.2003 in der Patenstadt Passau<br />
Kulturpreisverleihung am 25.7.03 im Großen Rathaussaal.<br />
Vor 42 Jahren, am 16. Juni 1961 hat die Stadt Passau die Patenschaft über die vertriebenen<br />
Menschen aus dem Böhmerwald übernommen und sie in ihre Obhut genommen.<br />
Gleichzeitig stiftete sie einen Kulturpreis für die <strong>Böhmerwäldler</strong>, die auf den Gebieten der<br />
Bildenden Kunst, der Literatur, der Musik und der Volkstumsarbeit schöpferisch tätig sind.<br />
Für eine deportierte und in völliger Zerstreuung lebende Volksgruppe bedeutet dieser<br />
Kulturpreis mehr als für eine Bevölkerung, die nach wie vor über die Zeugnisse ihrer<br />
Kultur und Geschichte verfügt und die in ihrer Heimat verbleiben konnte. Mit der Verleihung<br />
des Kulturpreises wird die Bedeutung aufgezeigt, die die Kultur zur Erhaltung und<br />
Weiterführung der Identität der Volksgruppe außerhalb der Heimat hat. Blicken wir heute<br />
auf die große Zahl der Preisträger, die in ununterbrochener Folge seit 1962 geehrt wurden,<br />
so haben wir Anlass zu berechtigtem Stolz, denn als verhältnismäßig kleine Volksgruppe<br />
haben wir eine stattliche Anzahl von herausragenden Persönlichkeiten aufzuweisen.<br />
Eine davon war der Vater unseres diesjährigen Kulturpreisträgers, der Akademische Maler<br />
Wilhelm Fischer. Er wurde am 27. Juli 1968 ebenfalls hier im historischen Rathaussaal<br />
ausgezeichnet. Mit ihm wurde ein Mann geehrt, der der Stadt Passau sehr verbunden war.<br />
Schon lange vor dem Krieg hatte er, der die Dächer und Mauern und die Winkelheimlichkeiten<br />
gerne malte, hier seine Staffelei aufgestellt. Die Böhmerwaldheimat trug<br />
er fest im Herzen. In seiner Dankesrede sagte er damals: „Vieles könnte man erzählen von<br />
der Stille und Unberührtheit der Böhmerwalddörfer, von der Schönheit der Moldaustadt<br />
Bundestreffen 2003 Kulturpreisverleihung. OB Zankl, Kulturpreisträger Willi Fischer<br />
u. Ingo Hans.<br />
Wallern: Des Jahres letzte Stunde. Wia Künstlerkartenverlag, Teplitz<br />
Schönau. Entwurf Fr. Jung Ilsenheim. (Sammlung Reinhold Fink)<br />
Dokumentation des Jahres 2003
172<br />
173<br />
Bundestreffen 2003 Willi Fischer bei seiner<br />
Ansprache zur Ausstellungseröffnung im<br />
Kulturmodell Bräugasse<br />
Die Kunst begleitet auch seinen Sohn Willi<br />
Fischer, unseren diesjährigen Preisträger. Sie war<br />
sein Lebensinhalt. Die Harmonie und die<br />
gesunden Verhältnisse der Böhmerwaldheimat<br />
und der Stadt Krummau, in der er 18 Jahre vor<br />
mir geboren wurde, konnte er allerdings nur in<br />
seiner Kinder- und Jugendzeit erleben. Die<br />
Verwerfungen des 20. Jahrhunderts, rissen auch<br />
ihn, wie viele andere, aus einer geordneten<br />
Lebensbahn. Er verließ Deutschland und fand in<br />
Schweden ein neues Zuhause. Es war für ihn und<br />
seine Frau nicht einfach in einem fremden Land,<br />
unter Menschen mit fremder Sprache Fuß zu<br />
Bundestreffen 2003 Der Chor singt zu Ehren Mozarts - Der alte Steuermann<br />
Lieber Willi wir danken Dir, dass Du die Mühe nicht gescheut hast und uns einen kleinen<br />
Teil Deines Gesamtwerkes für unsere Ausstellung mitgebracht hast. Vielleicht regt es den<br />
Krummau... . Hier war mein Wohnsitz, hier ließ<br />
es sich gut hausen... . Hier wurde mein Schaffen<br />
geformt.... . In diesen Winkeln und Gassen, diesen<br />
stolzen Bürgerhäusern, der ernsten, festen Burg,<br />
spüren wir noch im Abbild das Gewachsene und<br />
Gewordene, das fest Verwurzelte und<br />
Sturmerprobte. Durch den Krieg sind dem<br />
deutschen Volk unwiederbringliche Kulturwerte<br />
verloren gegangen.“<br />
Er drückte seine Freude darüber aus, dass die<br />
Schönheit der Stadt Passau, deren Ehrenbürger<br />
er Ende der 70er Jahre wurde, durch<br />
Kriegseinflüsse nicht gelitten hatte. Er mahnte aber auch: „Wenn wir jedoch behalten wollen,<br />
was uns geblieben ist, müssen wir es erhalten“, und er warnte vor der blinden Anbetung<br />
des technischen Fortschritts, der auch die Zerstörung in sich birgt. „Für verlorengegangene<br />
Werte der Landschaft, der Kultur und des Gemütes gibt es keinen Ersatz.“<br />
Er führte weiter aus: „...Die Kunst ist eine von den Wechselbeziehungen der Dinge in der<br />
Welt, und eines hält das andere, und was nicht gehalten wird, geht verloren.“<br />
Für Wilhelm Fischer war die Kunst eine Weise der Weltfindung: „Ihr scheint die Macht<br />
gegeben, nach rückwärts und nach vorwärts die Tore aufzutun. Sie knüpft an die Gewissheit<br />
des Jetzt den Faden der Ahnung vom Vorher und Nachher, die Kunst verwandelt das Leben.“<br />
Wie sein Vater mit seinen malerischen Mitteln in seinem Werk eine Spur seiner Welt zeigt,<br />
so vermittelt uns Willi Fischer in seinen Werken seine Sicht der Dinge und Menschen. Wir<br />
haben zu Hause eine kleine Plastik, die Willi von seinem Vater gefertigt hat. Sie ist voller<br />
Leben und lässt uns die vielschichtige Persönlichkeit erkennen. Mit den Händen formen<br />
bereitet Freude. Schon kleine Kinder haben dieses gestalterische Bedürfnis. Die Hand<br />
baut konstruktiv auf, das Erlebnis sucht plastischen Ausdruck.<br />
Für uns, die wir nicht diese bildnerische Gabe haben, sind die Kunstwerke Willi Fischers<br />
ein ästhetisches Erlebnis.<br />
fassen. Da gab es Widrigkeiten, Zurücksetzungen und Entmutigungen. Doch sie haben es<br />
geschafft. 1965 ging Willi Fischer noch einmal ein Risiko ein, indem er seine sichere<br />
Arbeitsstelle aufgab, um sich als freischaffender Künstler im eigenen Atelier zu betätigen.<br />
Seitdem ist er als Keramiker international anerkannt, was viele Ausstellungen und Preise<br />
beweisen.<br />
Bundestreffen 2003 Beim Aufbau der “Fischer<br />
Ausstellung” im Kulturmodell Bräugasse.<br />
Bundestreffen 2003<br />
Bürgermeisterin Dagmar<br />
Plenk mit dem Ehepaar<br />
Fischer, Tochter Jutta<br />
Lidberg, Dr. Brunner,<br />
Herr Wachtveitl und Lm.<br />
Hans bei der Eröffnung<br />
der Ausstellung
174<br />
175<br />
Bundestreffen 2003<br />
Im Passauer Alten<br />
Rathaussaal bei der<br />
Kulturpreisverleihung.<br />
Bundestreffen 2003<br />
In fröhlicher Runde beschließen<br />
die Festgäste<br />
die Feierstunde im Alten<br />
Rathaussaal.<br />
Der Stadt Passau, Ihnen Herr Oberbürgermeister Zankl und dem Stadtrat danke ich für die<br />
Auslobung des Kulturpreises. Er ist eine Bekräftigung unserer kulturellen Identität und<br />
eine Bekundung des Zusammenhaltes von Preisträgern und Volksgruppe, sowie ein Ansporn<br />
herausragende Leistungen als kulturelle Kraft der Volksgruppe deutlich zu machen.<br />
Ihnen gilt auch mein Dank für den Schutz, den Sie uns mit der Gabe der Patenschaft<br />
gewähren. Dieser Schutz lässt uns frohen Mutes in die Zukunft schauen.<br />
Gestatten Sie mir zum<br />
Abschluss noch einmal<br />
Wilhelm Fischer aus<br />
Du gibst damit für viele eine Ermutigung, sich nicht abseits zu stellen, sondern ebenfalls<br />
die vielfältige Arbeit für unsere Heimatlandschaft zu fördern.<br />
Bundestreffen 2003 Bundesvorsitzender Ingo<br />
Hans zeichnet den Kulturamtsleiter der<br />
Patenstadt Passau, Herrn Reinhard Wachtveitl<br />
mit dem Ehrenzeichen des Deutschen<br />
<strong>Böhmerwaldbund</strong>es “Gold mit goldenen<br />
Tannenzweig” für seine Verdienste um die<br />
<strong>Böhmerwäldler</strong>, aus.<br />
Wir danken Dir auch dafür, dass Du Deine<br />
Wurzeln im Böhmerwald nie ausgerissen hast.<br />
Auf Deine Frage: „Wo gehören wir eigentlich<br />
hin?“ lautet Deine Antwort im „Sudetenboten“:<br />
„Wir sind zum Kulturdünger in unseren neuen<br />
Heimländern geworden. Wenngleich uns die Rückgabe der Heimat mit friedlichen Mitteln<br />
nicht gelungen ist, so haben wir uns durch anständige Arbeit und Lebensweise ausgezeichnet.<br />
Wir können stolz den Kopf hochhalten.“ Du bist stets ein bekennender Sudetendeutscher<br />
gewesen und hast Dich immer wieder aus dem Ausland zu unserer Problematik zu Wort<br />
gemeldet.<br />
Durch die Annahme dieses Kulturpreises legst Du ein weiteres Bekenntnis zu unserer<br />
Volksgruppe ab. Dafür möchte ich Dir von Herzen danken.<br />
seiner Dankesrede zu zitieren: „Kulturelle Vergangenheit und dynamische Gegenwart wurde<br />
hier gemeinsam mit den Kräften der Patenschaft Passau gesammelt, um den Menschen<br />
Richtung zu weisen. Es wird Vertrauen zu sich und seinen Kräften gegeben und wieder<br />
Heimat geschenkt.“<br />
Ingo Hans, Bundesvorsitzender<br />
einen oder anderen dazu an, einmal eine Reise<br />
nach Vänersborg und Umgebung zu machen, weil<br />
sie neugierig auf Deine Kunstwerke geworden<br />
sind.<br />
Bundestreffen 2003 Lm. Willi Fischer und<br />
Bundesvorsitzender Ingo Hans bei der Matinee<br />
Bundestreffen 2003<br />
Kulturpreisträger Willi<br />
Fischer trägt sich in das<br />
Gästebuch der Stadt<br />
Passau ein.
176<br />
177<br />
Bundestreffen 2003 Mit<br />
Musik und Lied, mit Tanz<br />
und Gedichten gestalten<br />
die Gruppen den Abend.<br />
Bundestreffen 2003<br />
Bundesvorsitzender Ingo Hans eröffnet zusammen mit der Böhmerwaldjugend im Vorraum<br />
der Nibelungenhalle die Ausstellungen und er dankt allen fleißigen Mitarbeitern für die<br />
hervorragende Arbeit und die viele Mühe.<br />
Bundestreffen 2003<br />
Ein wunderschöner<br />
Volkstumsabend in der<br />
Nibelungenhalle , ein<br />
Geschenk der Böhmerwaldjugend<br />
an alle<br />
Besucher.<br />
Bundestreffen 2003<br />
Die Heimatkreise des<br />
Böhmerwaldes stellten<br />
sich mit Ausstellungen<br />
in der Halle vor.<br />
Bundestreffen 2003 Die Böhmerwaldjugend bei der Kranzniederlegung am Dom in Passau<br />
Bundestreffen 2003<br />
Ausstellung des Frauenarbeitskreises<br />
des Deutschen <strong>Böhmerwaldbund</strong>es<br />
in der Nibelungenhalle
178<br />
179<br />
Bundestreffen 2003<br />
Die alte Traditionsfahne<br />
der Böhmerwaldjugend<br />
führt den<br />
Festzug an. (Die<br />
Fahne ist aus Leinen<br />
aus unserer Böhmerwaldheimat<br />
im Jahr<br />
1949 in Handarbeit<br />
hergestellt worden.)<br />
Bundestreffen 2003<br />
Im Eingangsbereich der<br />
Nibelungenhalle informiert<br />
Franz Nodes vom<br />
Verein der heimattreuen<br />
<strong>Böhmerwäldler</strong> die<br />
Landsleute über das<br />
Mitteilungsblatt des<br />
Deutschen <strong>Böhmerwaldbund</strong>es<br />
“Hoam!”<br />
Bundestreffen 2003 Die Ehrengäste marschieren hinter der Böhmerwaldjugend und der<br />
Landesfahne des <strong>Böhmerwaldbund</strong>es Baden-Württemberg beim Trachtenumzug durch die<br />
Stadt zur Nibelungenhalle.<br />
Oberbürgermeister Albert Zankl, der<br />
Patenonkel der <strong>Böhmerwäldler</strong> grüßt die<br />
Teilnehmer des Bundestreffens.(links)<br />
Bundestreffen 2003<br />
Bernd Posselt, MdEP und Bundesvorsitzender<br />
der Sudetendeutschen Landsmannschaft<br />
spricht bei der Großkundgebung<br />
in der Nibelungenhalle zu 2000<br />
<strong>Böhmerwäldler</strong>n<br />
Bundestreffen 2003<br />
Einzug der Fahnen zum<br />
Festgottedienst in den<br />
Hohen Dom zu Passau
180<br />
181<br />
Hildegard Bakule, (unten) umringt von Kindern,<br />
Enkeln und einem Teil des Vorstandes, wurde für<br />
50-jährige Mitgliedschaft mit einer Ehrenurkunde<br />
und dem Treueabzeichen ausgezeichnet.<br />
Kirchheim/Teck<br />
Unser Besuch in Tittling am 26. Juli, anlässlich des Bundestreffens in Passau<br />
Stuttgart Robin Heidinger (l.) mit seiner Mutter<br />
Annette, das jüngste Mitglied in der<br />
Heimatgruppe<br />
Unsere Stubenmusik bestreitet<br />
zahlreiche Auftritte<br />
- auch beim Bundestreffen<br />
in Passau war sie dabei<br />
und verschönte u.a. den<br />
Festakt der Kulturpreisverleihung.<br />
Bopfingen<br />
Bei der Weihnachtsfeier<br />
singt unser Chor Weihnachts-<br />
und Adventlieder<br />
Bundestreffen 2003<br />
Maria Riedl, Anni<br />
Heidinger und Lisa Kern<br />
am Buchstand des<br />
Bundesverbandes in der<br />
Nibelungenhalle
182<br />
183<br />
Aschaffenburg/Miltenberg Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft<br />
Aalen Teilnehmer der Romreise auf dem Petersplatz<br />
Aschaffenburg7Miltenberg<br />
Bundesvorsitzender Ingo<br />
Hans hält die Festrede<br />
bei unserer 25-Jahr-<br />
Feier<br />
Aalen Bockfrühschoppen am<br />
Faschingsonntag im Vereinsheim<br />
Aschaffenburg/<br />
Miltenberg<br />
Einzug der Trachten in<br />
die Kirche von Mömlingen<br />
bei der 25-<br />
Jahr- Feier<br />
Aalen<br />
Ehrung der Landsleute<br />
bei der Hauptversammlung
184<br />
185<br />
Landesverband Baden-<br />
Württemberg<br />
Kindergruppe der BöhmerwaldjugendBacknang<br />
beim Landestreffen<br />
Göppingen Beim Bundestreffen in Passau vor der Nibelungenhalle<br />
Göppingen<br />
Lustig wars bei unserem<br />
Faschingsnachmittag<br />
Göppingen Unsere jungen Mitglieder bei der Muttertagsfeier<br />
Landesverband Baden-Würftemberg des “Deutschen Böhmerwalbundes e.V.”<br />
Der Landesverband wurde bereits am 19.3.1950 in Esslingen gegründet und konnte beim<br />
25. Landestreffen in Esslingen im September 2000 sein 50-jähriges Bestehen feiern. Im<br />
Landesverband sind 22 Heimatgruppen mit 3298 Mitgliedern zusammengeschlossen, in<br />
denen unermüdlich kulturelle und heimatpolitische Arbeit geleistet wird. Es bestehen auch<br />
neun Jugendgruppen mit Sing- und Spielscharen und sechs Kindergruppen.<br />
Anfang der 50er Jahre wurden offiziell auch die ersten Heimatgruppen gegründet. So<br />
konnten bereits die Heimatgruppen Aalen, Backnang, Esslingen, Fellbach, Ludwigsburg,<br />
Nürtingen und Stuttgart ihr 50-jähriges Bestehen feiern.<br />
Der Landesverband führt alle zwei Jahre ein Landestreffen durch. Dabei wurde auch der<br />
Landesjugendtag der Böhmerwaldjugend abgehalten. Der jeweilige Volkstumsabend beim<br />
Landestreffen am Samstagabend wird von der Böhmerwaldjugend gestaltet.<br />
Der Frauenarbeitskreis unter der Leitung von Friedl Vobis und Heimatgruppen zeigen in<br />
einer Ausstellung einen Querschnitt der volkstümlichen Kunst. Sie haben sich auf dem<br />
Gebiet der Erhaltung und Weiterentwicklung des <strong>Böhmerwäldler</strong> Kulturgutes sowie in der<br />
Traditionspflege große Verdienste erworben. Auch der Bund ist mit seinem Bücherstand<br />
vertreten.<br />
Am Sonntagvormittag findet ein Festgottesdienst und eine Kundgebung mit dem<br />
Staatssekretär der Landesregierung und unserem Bundesvorsitzenden Ingo Hans statt.<br />
Fast regelmäßig werden vom Landesverband auch Kulturtagungen durchgeführt.<br />
Baden-Württemberg<br />
Der Landesvorstand<br />
beim Haus der Heimat in<br />
Nürtingen mit dem<br />
Bundesvorsitzenden
186<br />
187<br />
Schmidham<br />
Bei unserem Jahresausflug vor der Wallfahrtskirche am Sonntagsberg bei Steyr<br />
Künzelsau Im Rahmen des Bundestreffens in Passau besuchten wir auch das Hartauer<br />
Denkmal in Mauth<br />
Ellwangen Bei unserer Heimatwoche im Adolf-Webinger-Haus<br />
Esslingen<br />
Brauchtums- und<br />
Handarbeitsausstellung<br />
im Wolfstor in Esslingen.<br />
Er fährt jährlich eine Hauptversammlung und alle zwei Jahre Neuwahlen durch. Sehr bewährt<br />
hat sich die Einführung eines “Jugendfonds”, mit dem Jugend- und Kindergruppen finanziell<br />
unterstützt werden.<br />
Der Landesverband ist auch Bindeglied zu dem Bundesverband und gibt die erarbeiteten<br />
Richtlinien an die Heimatgruppen weiter. So ist er u. a. auch zuständig für die höheren<br />
Ehrungen.<br />
Der Landesvorsitzende hält die notwendigen Kontakte zu den Landesverbänden der Sud.<br />
Landsmannschaft und dem Bund der Vertriebenen im Haus der Heimat in Stuttgart und<br />
nimmt an deren Sitzungen und an den Veranstaltungen der Landesregierung teil, die uns<br />
betreffen.<br />
Oswald Sonnberger, Vorsitzender des Landesverbandes Baden-Württemberg.<br />
Esslingen<br />
Unsere Kindergruppe<br />
bei der Weihnachtsfeier
188<br />
189<br />
Augsburg Unsere Fahnenabordnung<br />
beim Jakobitreffen am Hochstein in<br />
Festtagsstimmung<br />
Schrobenhausen Bei unserer 50-Jahrfeier<br />
Heidelberg<br />
Bei der Weihnachtsfeier<br />
mit dem Nikolaus Franz<br />
Puritscher<br />
Backnang<br />
“Ein Winterabend” Otti<br />
Fechter erzählt Kindern<br />
und großen Zuhörern<br />
Geschichten.<br />
Heidelberg<br />
Unsere Krabbelgruppe<br />
in Eppelheim<br />
Backnang<br />
Unser Frauengruppe<br />
beim Basteln<br />
Heidelberg<br />
Die engere Vorstandschaft<br />
bereitet das 50jährige<br />
Jubiläum vor
Bietigheim-Bissingen<br />
Beim Schmücken des<br />
Umzugswagen für den<br />
Pferdemarkt. Franz<br />
Baier, Nadine Franz,<br />
Franz Bauer, Christa<br />
Gericke, Doris Bauer,<br />
Anni Mayer, Heidi<br />
Kletzenbauer, Herta<br />
Puritscher<br />
190<br />
191<br />
Nürtingen<br />
Auch die Nürtinger<br />
Stubenmusik<br />
umrahmt die 50-<br />
Jahrfeier.<br />
Bietigheim-Bissingen Auf großer Reise nach Paris. Die Reisegruppe im Park von Versailles.<br />
Nürtingen<br />
Unsere Kindergruppe<br />
gestaltet die 50-<br />
Jahrfeier mit.<br />
Augsburg<br />
Ausflugsfahrt in die alte<br />
Heimat, hier in Hohenfurth<br />
Nürtingen<br />
Bei der 50-Jahrfeier,<br />
unsere geehrten<br />
Mitglieder
Ludwigsburg Bei der Hauptversammlung werden 19 Mitglieder für langjährige<br />
Mitgliedschaft und<br />
zwei Frauen mit<br />
der “Silbernen<br />
Ehrennadel” vom<br />
Bund geehrt. Unser<br />
Ehrenvorsitzender<br />
Franz Sonnberger<br />
bekommt die Adolf-<br />
Hasenöhrl-Medaille<br />
vom Bundesvorsitzendenüberreicht.<br />
192<br />
193<br />
Günther Hans Leopold Hafner 17<br />
Elfriede Fink Denkwürdiges <strong>2005</strong><br />
19<br />
Ingo Hans Geleitwort 21<br />
Karl Spannbauer Neujahr im Böhmerwald 22<br />
Heinrich Micko Palmsonntag 24<br />
Adolf Heidler Brauchtum Palmsonntag 25<br />
Grete Rankl Österliches Brauchtum 26<br />
Josef Bernklau Von Eostrae zu Ostern 29<br />
Adalbert Stifter Ostern 31<br />
Grete Rankl <strong>Böhmerwäldler</strong> Brauchtum zu Pfingsten 32<br />
Ernst Braun Einst am Fronleichnamstag 34<br />
Grete Rankl Brauch und Aberglaube bei einer Geburt 37<br />
Zephyrin Zettl Wieda dahoam 38<br />
Erich Hans Adalbert Stifter: Aus dem Leben und Werk 39<br />
Franz Fischer Von Adalbert Stifters „Nachsommer“ 51<br />
Alois Anderle Freiheitsbrief Karls IV. 53<br />
Adalbert Stifter Ballade 53<br />
Paul Meßner Der « Goldene Steig » 54<br />
Rosa Tahedl Das Schlangenkrönlein 62<br />
Rosa Tahedl Der Schatz am Dreisesselberg 66<br />
Josef Bürger Die Rosenberger im Böhmerwald 70<br />
Rudolf Hruschka Brief Grafenaus an Bergreichenstein 73<br />
Alois Fürst Grenzstreit um Eisenstein 75<br />
Rudolf Kubitschek Passauisch – Böhmischer Grenzstreit, 16. Jh. 81<br />
Josef Blau Der letzte Bayerneinfall nach Böhmen 86<br />
N. N. Nachtwache - Verordnung Winterberg, 1843 88<br />
Vinzenz Schoeps Das Graphitbergwerk in Schwarzbach 90<br />
Grete Rankl Bergwerkskapellevon Schwarzbach<br />
92<br />
Maria Goletz 1938 – 1945 93<br />
Anna Kangler Notzeit im Böhmerwald 93<br />
Anna Kangler Als die Bomben fielen 96<br />
Anna Kangler Heimkehr 97<br />
Maria Enn Als Mutter über die Grenze ging 100<br />
Anna Kangler Der Opfergang des Heidingervaters 102<br />
Anna Kangler Eine Andreasbergerin erzählt 105<br />
Rosa Tahedl Eine Landschaft ändert ihre Gesicht 108<br />
Adolf Heidler Bräuche: Geburt, Hochzeit, Tod 114<br />
Adolf Heidler Brauch der Maurer und Zimmerer 121<br />
N. N. Flachsarbeit im Böhmerwald 123<br />
Adolf Heidler Mein erster Jahrmarktsbesuch 126<br />
Johann Riedl Vom Fensterln 127<br />
Maria Frank Vom Wäschewaschen 130<br />
Anna Klarner Mein kleiner Bruder 135<br />
Ludwigsburg<br />
Unsere Frauengruppe<br />
beim Basteln<br />
Fellbach Anlässlich unseres 50-jährigen Bestehens gedenken wir mit einer<br />
Kranzniederlegung im Kleinfeldfriedhof unserer Toten.<br />
Adalbert Stifter Zukunft 4<br />
Leopold Hafner Kalendarium 5<br />
Inhaltsverzeichnis
194<br />
195<br />
Bestellungen an: Frau Anni Heidinger<br />
Im Krautgarten 42<br />
D-74321 Bietigheim Bissingen<br />
„Roßei b’schlong“<br />
Kinderlieder, Spiele und Reime aus dem<br />
Böhmerwald, über viele Jahre gesammelt<br />
und liebvoll zu einem Buch zusammengestellt<br />
von Frau Ingeborg<br />
Schweigl, illustriert mit herrlichen<br />
Zeichnungen von Frau Gabriele Breit.<br />
Ein wunderschönes Buch für Kinder,<br />
Eltern, Omas und Opas, sowie für<br />
alle, die Kinder lieben. Auch Kindergärten,<br />
Kinderhorte und Grundschulen<br />
können Anregungen<br />
darin finden.<br />
Mit diesem Buch kehrt die Kindheit im<br />
Böhmerwald zu uns zurück. Das Kindsein<br />
in der Geborgenheit „dahoam“ wird<br />
wieder lebendig.<br />
Es kostet Euro 15,30 + Versandkosten<br />
(DM 30.-)<br />
Rudolf Kubitschek:<br />
„Böhmerwäldisches<br />
Lachen“<br />
Dieses Büchlein ist ein humorvolles <strong>Böhmerwäldler</strong><br />
Hausbuch, das von Rudolf Kubitschek<br />
bereits während des Zweiten<br />
Weltkrieges geplant war und auch zusammengestellt<br />
wurde, aber nicht mehr gedruckt<br />
werden konnte.<br />
Herr Franz Strunz hat die Manuskripte<br />
dazu im Bezirksarchiv Prachatitz gefunden<br />
und sie dem Deutschen <strong>Böhmerwaldbund</strong><br />
e.V., Bundesverband, zur Verfügung gestellt.<br />
So ist diese mit großer Verspätung von<br />
nahezu 60 Jahren nachgeholte Publikation<br />
der Anthologie von Böhmerwaldhumor<br />
ein Erstdruck. Es ist eine Sammlung von<br />
Schrifttum vieler Autoren, darunter Kubitschek<br />
selbst. Die Schriften sind durchweg<br />
humoristischen Inhalts. Gedichte sind dabei, sowie Theaterdialoge, Schnaderhüpfel<br />
und Erzählungen, die ausnahmslos von Land und Leuten des alten<br />
Böhmerwaldes handeln.<br />
Bestellungen an: Frau Anni Heidinger, Im<br />
Krautgarten 42, D-74321 Bietigheim Bissingen<br />
Es kostet Euro 5,50 + Versandkosten<br />
Irma Springer Vom Schmuggel 136<br />
Maria Frank Worüber man in Bergreichenstein lachte 137<br />
Maria Frank Wirksame Hiebe<br />
138<br />
R.F. S. Hirschauer Stücklein 139<br />
R. Kelmark Eine Sprechübung 140<br />
Heinrich Micko Die sieben Wahrheiten 141<br />
Anton Jungwirth Eine Ohrfeige 142<br />
Josef Schneider Das verbotene Tal 144<br />
Ernst Braun Die alte Bank am Bleiberg 145<br />
Grete Rankl „...In Schauen versunken...“ 154<br />
Grete Rankl „Furt schwimman die Scheider...“ 154<br />
Franz Bayer Höritzer Passionsspiele nach der Vertreibung 158<br />
Adolf Heidler Der Totengedenkmonat November 162<br />
Adolf Heidler Volksbrauch zur Herbstzeit 162<br />
Adolf Heidler Allerheiligen und Allerseelen 162<br />
Ernst Braun Die Mahnung der Toten 163<br />
N. N. Der St. Andreastag im Böhmerwald 164<br />
Grete Rankl Der Heilige Nikolaus 166<br />
Adalbert Stifter Bergkristall (Auszug) 167<br />
Günther Hans Nachwort 169<br />
Josef Fruth Stimme im Winterwind 170
196<br />
Ausgedruckte einzelner Seiten sind möglich, Kosten auf Anfrage.<br />
+ Versandkosten<br />
Kosten für die CD Euro 25.-.<br />
Zu beziehen bei:<br />
Ingo Hans, Hauffstr. 4,<br />
72631 Aichtal<br />
© <strong>Deutscher</strong> <strong>Böhmerwaldbund</strong> e.V.<br />
Nachdem viele Anfragen nach diesem Buch eingegangen sind und eine Neuauflage nicht möglich ist,<br />
hat sich der Heimatkreisrat Krummau entschlossen dieses Werk elektronisch zu verarbeiten und ein<br />
eBook herzustellen.<br />
Der Kreis Krummau<br />
an der Moldau<br />
Die Heimat Adalbert<br />
Stifters<br />
Herausgeber Rupert Essl 1983<br />
Im Selbstverlag des<br />
Heimatkreises Krummau a.M.<br />
Das Heimatbuch<br />
auf CD (eBook)<br />
Bestellung an:<br />
<strong>Deutscher</strong> <strong>Böhmerwaldbund</strong>,<br />
Anni Heidinger, Im Krautgarten 42, 74321 Bietigheim- Bissingen.<br />
Es kostet Euro 25,50 + Versandkosten<br />
Herausgeber des Buches ist der Deutsche<br />
Böhmer-waldbund, der Heimatkreis<br />
Krummau/M. und Verein der<br />
heimattreuen <strong>Böhmerwäldler</strong> e.V.<br />
Das außerordentlich aufschlussreiche<br />
Heimatbuch, mit über 500 Bildern, beinhaltet<br />
nicht nur 900 Jahre Geschichte<br />
und das kulturelle Leben in und um<br />
Krummau, sondern entfaltet einen breitgefächerten<br />
Überblick auf die historische<br />
und örtliche Vergangenheit der<br />
Stadt Krummau im Böhmerwald, seiner<br />
Kirchen und Klöster, der Wirtschaft und<br />
dem Handwerk, der zahlreichen Vereine,<br />
seiner Kultur, Kunst und Theater<br />
nebst dem Schulwesen.<br />
!!! Achtung Sonderpreis !!!