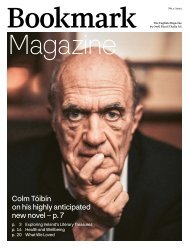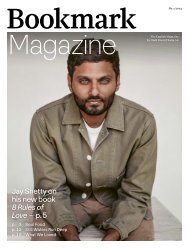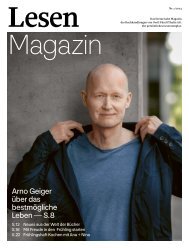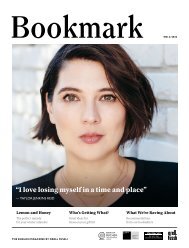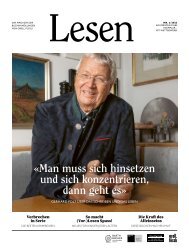Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Es war später Herbst. Thomas Bucheli, der Chef der Wettersendung<br />
Meteo von SRF ging Richtung Saal zu einer Veranstaltung in<br />
Uz nach. Das war vor ein paar Jahren. Dabei fielen ihm die vielen<br />
Störche auf dem Kirchendach auf, die nicht nach Afrika gezogen<br />
sind. Ein weiterer Beweis für den Wandel unseres Klimas. Bucheli<br />
machte in dem Gespräch vor Publikum einen interessanten Vergleich.<br />
Wenn es am Abendessen mal zum Familienkrach kommt,<br />
so sei das ein Gewitter oder eben ein Wetter. Wenn jedoch regelmässig<br />
am Tische gestritten würde, dann müsse man von einem<br />
problematischen Klima reden.<br />
1<br />
2<br />
Natur. Folgender Satz leuchtet ein: «Da der Mensch als Produkt der<br />
Evolution ein Teil der Natur ist und als Körperwesen mitten in ihr<br />
lebt, kann er den Gesamtzusammenhang der Natur nicht verstehen;<br />
denn dazu müsste er eine Position ausserhalb der Natur oder der<br />
Welt einnehmen, was in der Sprache der europäischen Tradition<br />
mit der ‘Position Gottes’ bezeichnet wird.» Diese Schlussfolgerung<br />
stammt aus dem Buch «Homo destructor – Eine Mensch-Umwelt-<br />
Geschichte» 2 von Werner Bätzing. Eine Lektüre für alle, die verstehen<br />
möchten, warum wir bis heute mit dem Naturschutz nicht<br />
weiter sind.<br />
Das Klima –<br />
Neue Bücher<br />
zu einem<br />
brennenden<br />
Thema<br />
Bücher helfen, besser zu verstehen,<br />
Handlungen zu überdenken und trotz<br />
allem Hoffnung zu schöpfen.<br />
Text von Urs Heinz Aerni<br />
«Klimakrise» ist eigentlich<br />
ein falscher Begriff, denn<br />
die Krise betrifft uns Menschen,<br />
nicht das Klima.<br />
Schon 1979 fand die erste Weltklimakonferenz in Genf statt. Fachleute<br />
machten sich damals schon Sorgen, was mit unserem Klima<br />
geschieht. «Klimakrise» ist eigentlich ein falscher Begriff, denn die<br />
Krise betrifft uns Menschen, nicht das Klima.<br />
Heute spüren es alle Menschen durch die zunehmenden Wetterextreme.<br />
Hitze und lange Trockenperioden wechseln sich mit<br />
Starkregen, Stürme und Überschwemmungen ab. Niemand, der<br />
die Entwicklungen auf der Welt und ihre Auswirkungen auf<br />
die Biodiversität beobachtet, lässt es kalt. Die einen reagieren mit<br />
Protesten, andere sammeln Unterschriften und wieder andere<br />
schreiben lesenswerte Bücher dazu.<br />
Ein Geschäft. Aber für die Natur?<br />
Der Churer Luca Mondgenast und der Zürcher Alex Tiefenbacher<br />
kommen aus der IT-Branche respektive Umweltwissenschaften<br />
und stellen sich die Frage, wie gut das System funktioniert, mit<br />
dem Schweizer Unternehmen Geld für Klimaschutzprojekte bezahlen,<br />
ohne selbst aktiv agieren zu müssen. «CO2-Ausstoss zum<br />
Nulltarif – Das Schweizer Emissionshandelssystem und wer davon<br />
profitiert» 1 . Die Europäische Union und die Schweiz setzen<br />
im Kampf gegen die Klimakrise auf das Emissionshandelssystem<br />
(EHS). Es ist ein wichtiges Klimaschutzinstrument und gilt für<br />
Industrieanlagen wie Zement- und Stahlwerke, Raffinerien und<br />
Pharmakonzerne. Diese müssen für jede Tonne Treibhausgas ein<br />
entsprechendes Emissionsrecht vorweisen oder mit anderen Unternehmen<br />
eines aushandeln. Doch das Buch zeigt: Von 2<strong>01</strong>3 bis 2020<br />
bezahlten die grössten Umweltverschmutzer über das EHS mit<br />
92 Millionen Franken nur einen Bruchteil ihrer Klimakosten. Die<br />
meisten Emissionsrechte bekamen sie geschenkt. Einige Konzerne<br />
erhielten sogar mehr Gratisrechte, als sie für ihre Treibhausgase<br />
bräuchten. Müssten sie wie die Schweizer Haushalte und kleinere<br />
und mittlere Unternehmen für ihre Emissionen die normale<br />
CO2-Abgabe bezahlen, hätte sie das 2,9 Milliarden gekostet.<br />
Fazit: Das System funktioniert nicht.<br />
Eine andere Weltgeschichte<br />
Warum tut sich der Mensch so schwer, der Natur, von der er abhängig<br />
ist, nicht besser Sorge zu tragen? Ein Grund könnte darin<br />
bestehen, dass der Mensch immer oft das Wort «Umwelt» verwendet<br />
und damit eine Art Grenze zieht, zwischen sich und der<br />
5<br />
3<br />
4<br />
Eine saftige Rechnung<br />
«Würde die Natur ihre Leistung in Rechnung stellen, würde kein Industriezweig<br />
Gewinne einfahren.» Es wäre wohl eine saftige Rechnung,<br />
die sich die Menschheit nicht leisten könnte. Martin Häusler<br />
nimmt mit seinem Buch «Unsere entscheidenden Jahre» 3 die Wut<br />
der jungen Menschen auf und veranschaulicht, dass in der Tat<br />
ein radikaler Handlungsbedarf besteht, wenn wir auf der Fahrt in<br />
die Katastrophe das Steuer noch herumreissen möchten. Die Fakten<br />
sind bekannt, die Auswirkungen sichtbar und doch geschieht nichts<br />
oder zu wenig. Wenn die Bauern unzufrieden sind, blockieren sie<br />
die Strassen mit Traktoren. Warum darf dann nicht auch die junge<br />
Generation Strassen und Pisten besetzen um ihrer Sorge um ihre<br />
Zukunft kund zu tun?<br />
Abenteuer und Ängste im 21. Jahrhundert<br />
Pierre Ducrozet wurde 1982 in Lyon geboren und jetzt liegt sein<br />
2020 veröffentlichter Roman «Le Grand vertige» mit dem Titel<br />
«Welt im Taumel» 4 vor. Darin wird ein kreativer Geist des<br />
ökologischen Denkens mit einem Team von Weltenbummlern<br />
und Wissenschaftlern auf die Suche nach dem Schlüssel zur Rettung<br />
des Planeten losgeschickt. «Sie betrachten den See, die Steine,<br />
die bald schon das eingebüsste Land zurückgewinnen werden.<br />
Auch die Häuser werden fortwehen. Alles wird wieder von vorne<br />
beginnen.» Ob dieses Zitat ein Happy End verspricht? Während die<br />
einen um die Welt reisen, haben andere Angst vor geschlossenen<br />
Räumen wie die Inuit auf Grönland und was ist «Chronophobie»?<br />
Richtig, die Angst vor der Zeit, die eine Helga-Maria im Roman<br />
«Samota» 5 von Volha Hapeyeva hat.<br />
Eine weitere nachdenklich machende Frage wird in diesem Roman<br />
auch gestellt: Warum kommt so vielen Menschen die Fähigkeit<br />
der Empathie abhanden? Das <strong>Lesen</strong> von guten Büchern lässt nicht<br />
nur auf gute neue Seiten hoffen, sondern auch ebensolche Zeiten.<br />
Und wenn es zu Hause mal am Mittagsessen laut werden sollte,<br />
dann handelt sich hoffentlich nur um ein kleines Unwetter.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
CO 2-Ausstoss zum Nulltarif<br />
Alex Tiefenbacher, Rotpunktverlag, CHF 25.90<br />
Homo destructor<br />
Werner Bätzing , C.H. Beck, CHF 41.90<br />
Unsere entscheidenden Jahre<br />
Martin Häusler, Europa Verlag, CHF 39.90<br />
Welt im Taumel<br />
Pierre Ducrozet, Kommode Verlag, CHF 29.90<br />
Samota<br />
Volha Hapeyeva, Droschl, CHF 34.90<br />
28 <strong>Lesen</strong> <strong>Magazin</strong> Nebenthema<br />
Nebenthema<br />
29