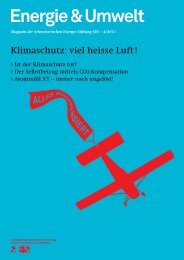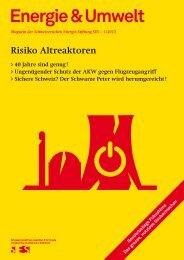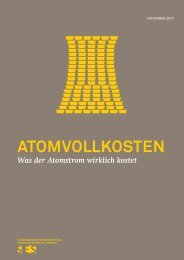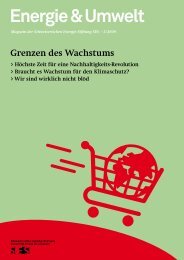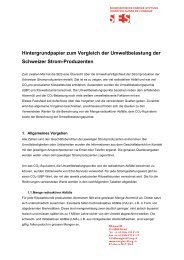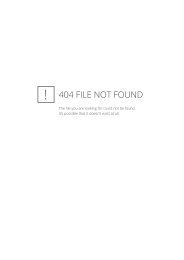Geothermischer Ressourcenatlas der Schweiz - Schweizerische ...
Geothermischer Ressourcenatlas der Schweiz - Schweizerische ...
Geothermischer Ressourcenatlas der Schweiz - Schweizerische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Energieforschung:<br />
Projekt: 100’022 Vertrag: 150’812<br />
2. Vorgehen<br />
2.1 Allgemein<br />
Geothermie im Auftrag des<br />
Bundesamts für Energie BFE<br />
Die Bearbeitung jedes <strong>der</strong> in Figur 1 aufgeführten Untersuchungsgebiete erfolgt gemäss dem in<br />
Andenmatten und Kohl (2003) erarbeiteten Ablauf in folgenden Schritten:<br />
1. Sichtung verfügbarer geologischer, hydrogeologischer und petrophysikalischer Daten<br />
2. Erstellen eines geologischen Modells<br />
3. Numerische Simulation des Temperaturfeldes<br />
4. Anpassen des Modells an gemessene Temperaturdaten<br />
5. Bestimmen des regionalen Wärmeflusses<br />
6. Analyse <strong>der</strong> regionalen hydrogeologischen Bedingungen<br />
7. Quantifizieren <strong>der</strong> vorhandenen geothermischen Ressource<br />
8. Definition von geothermisch interessanten Regionen unter Einbezug von Daten zur<br />
Oberflächennutzung<br />
2.2 Quantifizieren <strong>der</strong> vorhandenen geothermischen Ressource<br />
Das Hauptziel bei <strong>der</strong> Evaluation des geothermischen Potentials in einem Gebiet ist nicht nur die<br />
Quantifizierung <strong>der</strong> verfügbaren Energie, son<strong>der</strong>n auch die Bewertung von hydrothermalen Zonen,<br />
die es erlauben die Energie auch zu för<strong>der</strong>n. Die total verfügbare Energie, EHIP (Heat in Place), ist<br />
definiert als<br />
EHIP P<br />
= ρc<br />
⋅ ∆T<br />
⋅ V<br />
[J] (1)<br />
wobei ρcP die spezifische Wärmekapazität des Gesteins [J m -3 K -1 ], ∆T die nutzbare<br />
Temperaturdifferenz [K] und V das Volumen des Reservoirs [m 3 ] ist.<br />
Die nutzbare Energie, Eut, lässt sich aus <strong>der</strong> för<strong>der</strong>baren thermischen Leistung, pth, eines Systems<br />
bestimmen. Eut ist die Energiemenge, die mit Hilfe eines Entzugsmediums (in <strong>der</strong> Regel Wasser)<br />
während einer Zeitspanne, dt, mit <strong>der</strong> Leistung pth entzogen werden kann:<br />
pth P f<br />
E<br />
ut<br />
= ( ρc<br />
) ⋅ ∆T<br />
⋅ Q<br />
[W] (2)<br />
= ∫ p ⋅ dt<br />
[J] (3)<br />
th<br />
wobei (ρcP)f die spezifische Wärmekapazität des Fluids [J m -3 K -1 ] und Q die För<strong>der</strong>rate [m 3 s -1 ] ist.<br />
Für die Bestimmung <strong>der</strong> nutzbaren geothermischen Energie wird in dieser Arbeit nachfolgend eine<br />
Dublettennutzung mit einer Injektions- und Produktionsbohrung angenommen. Dies ist die einfachste<br />
Form <strong>der</strong> Nutzung, bei <strong>der</strong> eine nachhaltige hydraulische Bewirtschaftung des Untergrundes<br />
gewährleistet ist. In <strong>der</strong> Regel entspricht hier die Produktionsrate <strong>der</strong> Reinjektionsrate.<br />
Selbstverständlich ist dies nicht unbedingt die ökonomisch sinnvollste Nutzung, dies zeigt sich in <strong>der</strong><br />
Praxis durch die häufige Anwendung von Singlet-Bohrungen.<br />
Die För<strong>der</strong>rate, Q, kann für ein Dubletten-System in porösem Medium mit einer iterativen Formel nach<br />
Gringarten (1978) prognostiziert werden:<br />
Q<br />
4π<br />
⋅ Tr ⋅ ∆P<br />
b<br />
2<br />
( 3 ⋅ Q ⋅ c ⋅ ∆t<br />
/ π ⋅ ∆z<br />
⋅ r )<br />
i+<br />
1 =<br />
[m<br />
ln i<br />
w<br />
3 s -1 ] (4)<br />
wobei Tr die Transmissivität [m 2 s -1 ] ist, ∆Pb die maximale Grundwasserabsenkung in <strong>der</strong><br />
För<strong>der</strong>bohrung [m], ∆t die Zeitspanne, während <strong>der</strong> die För<strong>der</strong>temperatur nicht messbar sinkt [s] (Dies<br />
entspricht einer Betriebszeit von ca. 30 Jahren), c das Verhältnis zwischen Wärmekapazität des<br />
Fluids und des Aquifers [-], ∆z die Reservoirhöhe [m], rw <strong>der</strong> Bohrlochradius [m] und Qi die För<strong>der</strong>rate<br />
beim i-ten Iterationsschritt [m 3 s -1 ]. Nach Gringarten (1978) kann zudem auch die Distanz zwischen<br />
3