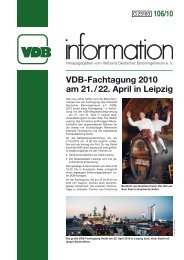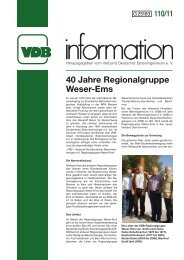Mitgliederversammlung und Vortragsveranstaltung 12. April 2005 in ...
Mitgliederversammlung und Vortragsveranstaltung 12. April 2005 in ...
Mitgliederversammlung und Vortragsveranstaltung 12. April 2005 in ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Das Referententeam<br />
der <strong>Vortragsveranstaltung</strong><br />
der Regionalgruppe<br />
Rhe<strong>in</strong>land-<br />
Pfalz/Saarland; v.l.<br />
Wolfgang He<strong>in</strong>ecke,<br />
Prof. Stefan Röhl<strong>in</strong>g,<br />
Stefan Kl<strong>in</strong>ger, Gerhard<br />
Wetzel <strong>und</strong><br />
Siegfried Riffel.<br />
zu dicht liegende Bewehrung oder auch Bluten<br />
des Betons bei dicken Bodenplatten. Als gelungenes<br />
gebautes Beispiel führte Dr. Schmidt<br />
die Alsterpassage Hamburg an.<br />
Dr. Richter, BetonMarket<strong>in</strong>g Ost GmbH, erläuterte<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Vortrag Anmerkungen zur<br />
Richtl<strong>in</strong>ie „Wasser<strong>und</strong>urchlässige Konstruktionen“<br />
die neue WU-Richtl<strong>in</strong>ie. Die Richtl<strong>in</strong>ie<br />
gilt als „anerkannte Regel der Technik“<br />
(juristischer Begriff), sie ist bauaufsichtlich<br />
allerd<strong>in</strong>gs nicht e<strong>in</strong>geführt, weil der Inhalt<br />
bauaufsichtliche Aufgaben nicht berührt. Die<br />
Bauphysik, die Regelungen für Baufeuchte,<br />
Wasserdampfdiffusion <strong>und</strong> Tauwasserbildung<br />
auf Raumflächen betrifft, ist nicht Gegenstand<br />
der Richtl<strong>in</strong>ie. Sie ist als Rahmennorm zu verstehen<br />
<strong>und</strong> stellt Festlegungen, Nachweise<br />
<strong>und</strong> Empfehlungen für Planung, Bemessung<br />
<strong>und</strong> Ausführung bereit. Sie gilt nur <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />
mit DIN EN 206-1 <strong>und</strong> DIN 1045 <strong>und</strong><br />
sollte im Vertrag vere<strong>in</strong>bart werden. Zukünftig<br />
wird von jedem nicht geregelten Fugenabdichtungssystem<br />
e<strong>in</strong> Verwendbarkeitsnachweis<br />
<strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es allgeme<strong>in</strong>en bauaufsichtlichen<br />
Prüfzeugnisses (ABP) verlangt. (Fugenbleche<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> dieser Richtl<strong>in</strong>ie selbst <strong>und</strong> -bänder<br />
<strong>in</strong> DIN 7865, DIN 18541 <strong>und</strong> E DIN 18197<br />
geregelt.) Wasser<strong>und</strong>urchlässige Bauwerke<br />
<strong>in</strong> der Beanspruchungsklasse 1 „drückendes<br />
Gr<strong>und</strong>wasser“ s<strong>in</strong>d gr<strong>und</strong>sätzlich <strong>in</strong> die<br />
Überwachungsklasse 2 nach DIN 1045-3<br />
e<strong>in</strong>zuordnen.<br />
Prof. Röhl<strong>in</strong>g nahm Stellung zu der Frage<br />
„Was ist e<strong>in</strong>e ausreichende M<strong>in</strong>destbewehrung<br />
zur Rissbreitenbeschränkung bei Zwang<br />
im frühen Alter ?“. Die Größe der Rissbreitenbeschränkung<br />
<strong>und</strong> die Kosten s<strong>in</strong>d direkt proportional,<br />
d. h. e<strong>in</strong>e Kostensenkung br<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>e<br />
Abm<strong>in</strong>derung der Rissbreitenbeschränkung<br />
<strong>und</strong> die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit für das Auftreten<br />
größerer Rissbreiten nimmt zu. Die der Planung<br />
zugr<strong>und</strong>e gelegte Rissbreitenbeschränkung<br />
wird bei den Vertragsgestaltungen<br />
häufig nicht berücksichtigt. Betontechnologische<br />
Maßnahmen werden ebenfalls häufig<br />
nicht vorgesehen. Die Rechenwerte der Rissbreite<br />
s<strong>in</strong>d nur als Anhaltswerte zu verstehen,<br />
die <strong>in</strong>folge streuender E<strong>in</strong>flussfaktoren<br />
nur mit e<strong>in</strong>er gewissen Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
auftreten <strong>und</strong> überschritten werden können.<br />
Die Bed<strong>in</strong>gungen bei der Erhärtung des Betons,<br />
Witterungse<strong>in</strong>flüsse <strong>und</strong> tragwerksbed<strong>in</strong>gte<br />
Zwangspannungen bee<strong>in</strong>flussen die<br />
Rissbildung. Sie werden nur vere<strong>in</strong>facht angenommen.<br />
Dr. Schmidt, Bilf<strong>in</strong>ger Berger AG, sprach <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em zweiten Vortrag über Nachbehandlung<br />
nach den Regelwerken im Vergleich zu den betontechnischen<br />
Erfordernissen. Die Regelungen<br />
zur Nachbehandlung <strong>in</strong> DIN 1045-3 <strong>und</strong><br />
ZTV-ING s<strong>in</strong>d nicht <strong>in</strong> jedem Fall ausreichend<br />
für das Erreichen der erforderlichen Dauerhaftigkeit,<br />
da die Umgebungsbed<strong>in</strong>gungen,<br />
die die Hydratation bee<strong>in</strong>flussen, nicht ausreichend<br />
berücksichtigt werden. Die Wirkung<br />
komplexer Umwelte<strong>in</strong>flüsse auf die Hydratation<br />
des Betons im Randbereich (Betonoberfläche)<br />
bedarf e<strong>in</strong>er Modellbetrachtung. Mit<br />
dem Softwarepaket TEMP!Riss (Zentrales<br />
Labor für Baustofftechnik Bilf<strong>in</strong>ger Berger<br />
AG) können 3D-Verteilungen von Temperatur,<br />
Festigkeit <strong>und</strong> Spannung <strong>in</strong> Betonbauten<br />
aufgr<strong>und</strong> der Hydratationswärmeentwicklung<br />
<strong>in</strong> der Erhärtungsphase berechnet <strong>und</strong> darauf<br />
basierend die Nachbehandlung entsprechend<br />
durchgeführt werden.<br />
Alle Beiträge s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er 50seitigen Dokumentation<br />
zusammengestellt, die den Mitgliedern<br />
der Regionalgruppe 14 <strong>und</strong> auch den<br />
anderen Regionalgruppen gegen e<strong>in</strong>e Schutzgebühr<br />
von 2,50 € zur Verfügung gestellt<br />
wird. (Bestellungen unter email s.roehl<strong>in</strong>gtaucha@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
oder telefonisch unter<br />
043298-66689). Entsprechende Dokumentationen<br />
s<strong>in</strong>d zukünftig von allen turnusmäßigen<br />
Fachtagungen der Regionalgruppe<br />
Sachsen/Sachsen-Anhalt vorgesehen.<br />
Tagung des Jahres 2004 der VDB-Regionalgruppe<br />
14 (Sachsen/Sachsen-Anhalt)<br />
Am 5. Oktober 2004 fand die dritte Tagung der<br />
Regionalgruppe Sachsen/Sachsen-Anhalt im<br />
Jahr 2004, diesmal <strong>in</strong> Dresden, statt.<br />
Dr. Schützhold vom Planungsteam der IPRO<br />
Dresden AG erläuterte im ersten Vortrag die<br />
Baugeschichte der Frauenkirche, bis zur Zerstörung,<br />
die Sicherung der Ru<strong>in</strong>e <strong>und</strong> berichtete<br />
über den Wiederaufbau von der ersten<br />
Idee bis zum heutigen Stand.<br />
Anfang des 18. Jahrh<strong>und</strong>ert war die spätgotische<br />
Vorgängerkirche „Unserer lieben<br />
Frauen“ nicht mehr nutzbar <strong>und</strong> musste abgebrochen<br />
werden. George Bähr erhielt 1722<br />
neben anderen (auch Knöffel) den Auftrag für<br />
e<strong>in</strong>en Entwurf e<strong>in</strong>er neuen Kirche. Nach drei<br />
Jahren lag e<strong>in</strong>e „genehme“ Planung vor <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong> Jahr später wurde die Baugenehmigung<br />
erteilt. Die Bauzeit zog sich von 1726 bis 1743<br />
mit mehreren Unterbrechungen h<strong>in</strong>, sodass<br />
tatsächlich wie heute (!) elf Jahre gebaut wurde.<br />
Im Alter von 60 Jahren begann George<br />
Bähr den Bau. Er starb 1738, als die Kuppel<br />
kurz vor der Vollendung stand. Die Weihe war<br />
1734 ohne Kuppel, das Auge der Innenkuppel<br />
schloss e<strong>in</strong> Deckel ab. E<strong>in</strong>e Änderung der<br />
Konstruktion der Kuppel von der kupfergedeckten<br />
Holzkuppel zur Ste<strong>in</strong>kuppel wurde<br />
zum Problem, hat aber dem Bau die Seele<br />
gegeben <strong>und</strong> ihn <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>malig gemacht.<br />
Bähr hatte im Entwurf bereits vorgesehen,<br />
dass größere Lasten von den Pfeilern<br />
über Spiramen (e<strong>in</strong>e Wortschöpfung Bährs,<br />
die <strong>in</strong> der Architekturgeschichte nicht wieder<br />
auftaucht) auf die Außenmauern übertragen<br />
werden können. Des Preußenkönigs Kanonade,<br />
die Dresdens Innenstadt weitgehend<br />
zerstörte, hatte der Kuppel nichts anhaben<br />
können. Die Kirche musste aber vier Gr<strong>und</strong>sanierungen<br />
über sich ergehen lassen. Die<br />
zwei letzten wurden von 1928 bis 1932 <strong>und</strong><br />
von 1938 bis 1943 durchgeführt. Der dabei<br />
e<strong>in</strong>gebaute Stahlbetonr<strong>in</strong>ganker trug dazu<br />
bei, dass die Kirche die schreckliche Bombennacht<br />
des 13. Februar unbeschadet überstand.<br />
Da aber der ganze Neumarkt brannte<br />
(über Geschw<strong>in</strong>digkeit <strong>und</strong> Temperatur e<strong>in</strong>es<br />
planmäßig erzeugten Feuersturms ist schon<br />
viel berichtet worden), schmolzen die oberen<br />
Kirchenfenster, die nicht zugemauert waren.<br />
Der hölzerne Innenausbau entzündete sich,<br />
die silikatische B<strong>in</strong>dungsmasse des Sandste<strong>in</strong>s<br />
kristallisiert bei Temperaturen über<br />
600 °C um, was mit e<strong>in</strong>em Festigkeitsabfall<br />
e<strong>in</strong>hergeht. Zwei Tage nach dem Angriff<br />
kippte die Kirche <strong>in</strong> Südrichtung um. Nur der<br />
Choranbau bis zum Hauptsims <strong>und</strong> der Treppenturm<br />
E blieben stehen.<br />
Die 1946/47 begonnene Enttrümmerung wurde<br />
durch Prof. Nadler, dem Nestor des sächsischen<br />
Denkmalschutzes, gestoppt, womit<br />
e<strong>in</strong>e Voraussetzung für e<strong>in</strong>en Wiederaufbau<br />
gegeben wurde. Bis 1993 blieb der Trümmerberg<br />
als Denkmal unverändert liegen. Der<br />
1990 durch Pfarrer Dr. Hoch <strong>und</strong> Prof. Güttler<br />
verfasste Aufruf zum Wiederaufbau „Ruf aus<br />
Dresden“ fand e<strong>in</strong>en enormen Widerhall <strong>in</strong><br />
Deutschland <strong>und</strong> später <strong>in</strong> der Welt, der es<br />
1993 ermöglichte, den Auftrag zur Planung<br />
des Wiederaufbaus durch die <strong>in</strong>zwischen<br />
entstandene Stiftung zu erteilen.<br />
• 1993: Beg<strong>in</strong>n der archäologischen Enttrümmerung.<br />
10 000 Ste<strong>in</strong>e (Werkste<strong>in</strong>e)<br />
wurden geborgen, gemessen, bezeichnet<br />
<strong>und</strong> gelagert, 4 000 davon wurden nach<br />
e<strong>in</strong>er Sanierung wieder e<strong>in</strong>gebaut.<br />
• Mai 1994: Gr<strong>und</strong>ste<strong>in</strong>legung <strong>und</strong> Beg<strong>in</strong>n<br />
des Wiederaufbaus, 1. Bauabschnitt Keller<br />
mit Unterkirche (Weihe 1996) <strong>und</strong> gleichzeitig<br />
2. Bauabschnitt mit Erstellung des<br />
unterirdischen Außenbauwerks als Weiße<br />
Wanne für Funktionsräume.<br />
• 1996: Beg<strong>in</strong>n des 3. Bauabschnitts, mit dem<br />
von außen sichtbaren Kirchengebäude.<br />
• 22.7.2004: Feierliche Montage der Laternenhaube<br />
mit dem Turmkreuz.<br />
Der neue Sandste<strong>in</strong> kam aus Ste<strong>in</strong>brüchen<br />
<strong>in</strong> der Sächsischen Schweiz. Noch ist er hell<br />
<strong>und</strong> muss zusammen mit den alten Ste<strong>in</strong>en<br />
wirken. Diese dürfen auf ke<strong>in</strong>en Fall aufgehellt<br />
werden, denn das Eisensiliziumoxid wirkt<br />
5