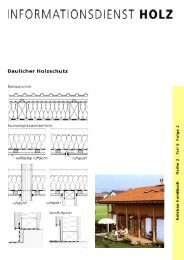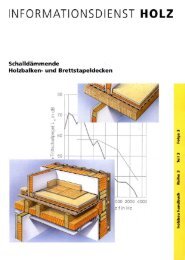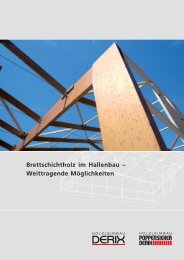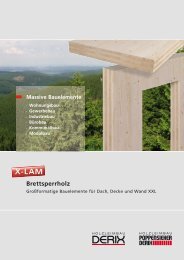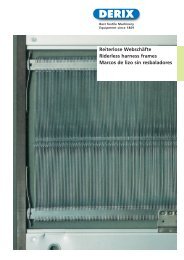R03 T04 F01 Grundlagen Brandschutz 1996 2001.pdf
R03 T04 F01 Grundlagen Brandschutz 1996 2001.pdf
R03 T04 F01 Grundlagen Brandschutz 1996 2001.pdf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vorbeugender und abwehrender <strong>Brandschutz</strong><br />
sind eng miteinander verknüpft.<br />
Einige Anforderungen des vorbeugenden<br />
<strong>Brandschutz</strong>es resultieren eigentlich aus<br />
den begrenzten Möglichkeiten der Feuerwehren<br />
im abwehrenden <strong>Brandschutz</strong>.<br />
Beste Beispiele dafür sind die Festlegungen<br />
der Grenzen der Gebäudehöhen in<br />
den einzelnen Gebäudeklassen. Bei<br />
„Gebäuden geringer Höhe" wird die Höhe<br />
des obersten Geschoßfußbodens des<br />
Geschosses, das für den ständigen Aufenthalt<br />
von Personen geeignet ist, mit 7<br />
m festgelegt. Begründet ist diese Festlegung<br />
durch die Länge der bei allen Feuerwehren<br />
vorhandenen Steckleitern, die<br />
eine Anleiterung bis 8 m Brüstungshöhe<br />
erlauben. Gleiches gilt für die Festlegung<br />
der Hochhausgrenze, die mit 22 m Höhe<br />
durch die zur Verfügung stehende Länge<br />
der Drehleitern begründet ist. Eine Übersicht<br />
über die einzelnen Komponenten<br />
des <strong>Brandschutz</strong>es gibt Bild 3.1.<br />
Die grundsätzlichen Anforderungen an<br />
den vorbeugenden baulichen <strong>Brandschutz</strong><br />
sind in den Landesbauordnungen<br />
niedergelegt. In den Landesbauordnungen<br />
sind jedoch kaum Aussagen über<br />
den anlagentechnischen <strong>Brandschutz</strong><br />
oder betrieblich organisatorischen <strong>Brandschutz</strong><br />
zu finden.<br />
In allen Bauordnungen sind Hinweise enthalten,<br />
daß neben dem baulichen <strong>Brandschutz</strong><br />
noch andere Möglichkeiten existieren,<br />
die gewünschten Schutzziele zu erreichen.<br />
Die Formulierungen lauten z.B.:<br />
„ Von den Forderungen kann abgewichen<br />
werden, wenn Bedenken wegen des<br />
<strong>Brandschutz</strong>es nicht bestehen."<br />
Die Landesbauordnungen sind in vielen<br />
Bereichen interpretierbar und lassen<br />
unterschiedliche Lösungswege zu,<br />
wenn nachgewiesen wird, daß das<br />
Schutzziel erreicht wird. Die Landesbauordnungen<br />
bieten ein „<strong>Brandschutz</strong>konzept<br />
von der Stange", daß<br />
durchaus durch ein „maßgeschneidertes<br />
<strong>Brandschutz</strong>konzept" ersetzt<br />
werden kann.<br />
Es gibt drei besondere Schwierigkeiten,<br />
ein sinnvolles, gut durchdachtes <strong>Brandschutz</strong>konzept<br />
für ein Gebäude aufzustellen<br />
und es über die Nutzungsdauer des<br />
Gebäudes beizubehalten:<br />
Die Notwendigkeit einer weitreichenden<br />
Koordination, da bei der Erstellung<br />
eines <strong>Brandschutz</strong>konzeptes nahezu<br />
alle an der Planung beteiligten Fachleute<br />
mitwirken:<br />
- Architekt,<br />
- Bauingenieur/Tragwerksplaner,<br />
- der Planer der Außenanlagen,<br />
Bild 3.1 Die Komponenten in einem <strong>Brandschutz</strong>konzept<br />
- die Fachplaner der Gewerke Heizung,<br />
Sanitär, Elektro und Lüftung.<br />
- die Fachbehörden ( Bauaufsicht,<br />
<strong>Brandschutz</strong>beauftragte usw.)<br />
Die Notwendigkeit, die betrieblich- organisatorischen<br />
Nutzungsbedingungen<br />
richtig einzuführen und durchzuhalten.<br />
Die Änderungen an den baulichen<br />
Anlagen des Gebäudes über die Nutzungsdauer<br />
brandschutztechnisch<br />
nicht relevant oder so zu gestalten, daß<br />
die neuen Belange des <strong>Brandschutz</strong>es<br />
dann berücksichtigt werden.<br />
Es bedarf also von Beginn an einer intensiven<br />
Abstimmung der am Bau Beteiligten<br />
(Bauherr, Architekt, Ausführende), um<br />
ein dem Gebäude und der Nutzung angepaßtes<br />
<strong>Brandschutz</strong>konzept aufzustellen.<br />
Die Planer müssen die Schutzziele<br />
bereichsweise definieren und die notwendigen<br />
Maßnahmen daran ausrichten.<br />
Zwingend notwendige und evtl. auszugleichende<br />
Maßnahmen müssen identifiziert<br />
werden, um sie in ein „maßgeschneidertes<br />
Gesamtkonzept" umsetzen<br />
zu können.<br />
3.2 Elemente von<br />
<strong>Brandschutz</strong>konzepten<br />
<strong>Brandschutz</strong>konzepte setzen sich - wie<br />
bereits erwähnt - aus den drei Hauptbereichen<br />
bauliche Maßnahmen<br />
• anlagentechnische Maßnahmen<br />
und<br />
organisatorische Maßnahmen<br />
zusammen. Nach [3.1] sollte ein individuelles<br />
<strong>Brandschutz</strong>konzept für jedes<br />
Gebäude aus folgenden Einzelschritten<br />
zusammengesetzt werden:<br />
Liegenschaftsanalyse<br />
Hierunter ist die Erfassung der<br />
- Gebäudedaten (Lage, Geometrie,<br />
Nutzung)<br />
- Arbeitsabläufe während der Nutzung<br />
- Organisationsaufbau der Nutzer<br />
- Umgebungsbedingungen (Verkehrstrassen,<br />
Nachbargebäude)<br />
zu verstehen.<br />
9 Brandgefahrermittlung<br />
Die erfaßten Daten aus der Liegenschaftsanalyse<br />
werden im Hinblick auf<br />
einen potentiellen Brand untersucht. In<br />
einem ersten Schritt werden die Brandlasten<br />
ermittelt (vgl. auch Abschnitt 2.5,<br />
DIN 18 230). Es folgt die Überprüfung,<br />
ob ein Brand entstehen kann und<br />
wodurch besondere Brandgefahren<br />
entstehen können. Dieser Schritt könnte<br />
als Schwachstellenanalyse bezeichnet<br />
werden. Abschließend werden bei<br />
der Brandgefahrermittlung die möglichen<br />
Brandausbreitungen auf angrenzende<br />
Bereiche unter Berücksichtigung<br />
möglicherweise unterschiedlicher Nutzungszustände<br />
(Tag/Nacht) untersucht.<br />
<strong>Brandschutz</strong>maßnahmen<br />
Aus den beiden vorgenannten Punkten<br />
ergibt sich die potentielle Brandgefahr<br />
und damit die Möglichkeit, die vorbeugenden<br />
<strong>Brandschutz</strong>maßnahmen und<br />
die notwendigen Randbedingungen für<br />
die abwehrenden Maßnahmen festzulegen.<br />
Das beschriebene Vorgehen führt<br />
sicherlich immer zu einer subjektiven<br />
Bewertung des <strong>Brandschutz</strong>planers. In<br />
der Schweiz wird daher ein Verfahren<br />
(SIA 81 [3.2]) angewendet, das als eine<br />
Methode der systematisierten Risikobewertung<br />
zur quantitativen Beurteilung<br />
der Brandgefährdung, des Brandrisikos<br />
und der Brandsicherheit anerkannt<br />
ist [3.1, 3.2, 3.3]. In der SIA 81<br />
wird, vereinfacht ausgedrückt, das vor-