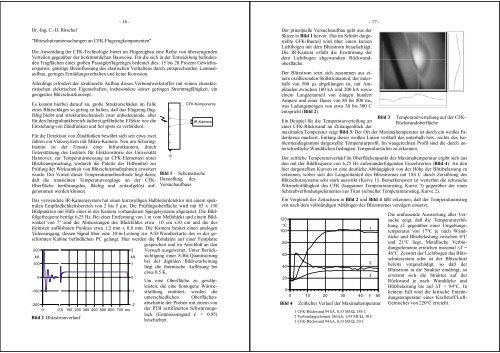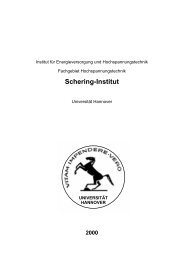1997 - Fachgebiet Hochspannungstechnik - Schering-Institut
1997 - Fachgebiet Hochspannungstechnik - Schering-Institut
1997 - Fachgebiet Hochspannungstechnik - Schering-Institut
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dr.-Ing. C.-D. Ritschel<br />
- 16 -<br />
"Blitzschutzuntersuchungen an CFK-Flugzeugkomponenten"<br />
Die Anwendung der CFK-Technologie bietet im Flugzeugbau eine Reihe von überzeugenden<br />
Vorteilen gegenüber der herkömmlichen Bauweise. Für die sich in der Entwicklung befindenden<br />
Tragflächen eines großen Passagierflugzeuges bedeutet dies: 15 bis 20 Prozent Gewichtsersparnis,<br />
günstige Beeinflussung des elastischen Verhaltens durch entsprechenden Laminataufbau,<br />
geringes Ermüdungsverhalten und keine Korrosion.<br />
Allerdings erfordert der strukturelle Aufbau dieses Verbundwerkstoffes mit seinen charakteristischen<br />
elektrischen Eigenschaften, insbesondere seiner geringen Stromtragfähigkeit, ein<br />
geeignetes Blitzschutzkonzept.<br />
Es kommt hierbei darauf an, grobe Strukturschäden im Falle<br />
eines Blitzschlages so gering zu halten, daß das Flugzeug flugfähig<br />
bleibt und strukturmechanisch zwar unbedeutende, aber<br />
für den Integraltankbereich äußerst gefährliche Effekte wie die<br />
Entstehung von Zündfunken und hot spots zu verhindern.<br />
Für die Detektion von Zündfunken bewährt sich seit etwa zwei<br />
Jahren ein Videosystem mit Mikro-Kamera. Neu am <strong>Schering</strong>-<br />
<strong>Institut</strong> ist der Einsatz einer Infrarotkamera, durch<br />
Unterstützung des <strong>Institut</strong>s für Elektrowärme der Universität<br />
Hannover, zur Temperaturmessung an CFK-Elementen unter<br />
Blitzbeanspruchung, wodurch die Palette der Hilfsmittel zur<br />
Prüfung der Wirksamkeit von Blitzschutzmaßnahmen erweitert<br />
wurde. Der Vorteil dieser Temperaturmeßmethode liegt darin,<br />
daß die transienten Temperaturvorgänge an der CFK-<br />
Oberfläche berührungslos, flächig und zeitaufgelöst aufgenommen<br />
werden können.<br />
CFK-Komponente<br />
IR-Kamera<br />
Bild 1 Schematische<br />
Darstellung des<br />
Versuchaufbaus<br />
Das verwendete IR-Kamerasystem hat einen kurzwelligen Halbleiterdetektor mit einem spektralen<br />
Empfindlichkeitsbereich von 2 bis 5 µm. Die Prüflingsoberfläche wird mit 85 x 130<br />
Bildpunkten mit Hilfe eines in der Kamera vorhandenen Spiegelsystems abgetastet. Die Bildfolgefrequenz<br />
beträgt 6,25 Hz. Bei einer Entfernung von 1 m vom Meßobjekt und einem Bildwinkel<br />
von 7° sind die Abmessungen des Blickfeldes etwa 10 cm x10 cm und die des<br />
kleinsten auflösbaren Punktes etwa 1,2 mm x 0,8 mm. Die Kamera besitzt einen analogen<br />
Videoausgang, dessen Signal über eine 10-m-Leitung zur A/D-Wandlerkarte des in der geschirmten<br />
Kabine befindlichen PC gelangt. Hier werden die Rohdaten auf einer Festplatte<br />
gespeichert und im Anschluß an den<br />
200<br />
2 Versuch ausgewertet. Unter Berück-<br />
kA<br />
100<br />
kA<br />
1<br />
sichtigung einer 8-Bit-Quantisierung<br />
bei der digitalen Bildverarbeitung<br />
liegt die thermische Auflösung bei<br />
etwa 0,5 K.<br />
0<br />
0<br />
Um eine Oberfläche zu gewährleisten,<br />
die eine homogene Wärme-<br />
-100<br />
-1 strahlung emittiert, werden die<br />
unterschiedlichen Oberflächen-<br />
-200<br />
-2<br />
0 0,5 100 200 300 400 500 600 700 ms<br />
Bild 2 Blitzstromverlauf<br />
abschnitte der Proben mit einem von<br />
der PTB zertifizierten Schwärzungslack<br />
(Emmissionsgrad ε = 0,95)<br />
beschichtet.<br />
- 17 -<br />
Der prinzipielle Versuchsaufbau geht aus der<br />
Skizze in Bild 1 hervor. Das im Schnitt dargestellte<br />
CFK-Bauteil wird über einen kurzen<br />
Lichtbogen mit dem Blitzstrom beaufschlagt.<br />
Die IR-Kamera erfaßt die Erwärmung der<br />
dem Lichtbogen abgewandten Rückwandoberfläche.<br />
Der Blitzstrom setzt sich zusammen aus einem<br />
oszillierenden Stoßstromanteil, der innerhalb<br />
von 500 µs abgeklungen ist, mit Amplituden<br />
zwischen 100 kA und 200 kA sowie<br />
einem Langzeitanteil von einigen hundert<br />
Ampere und einer Dauer von 80 bis 800 ms,<br />
was Ladungsmengen von etwa 30 bis 300 C<br />
entspricht (Bild 2).<br />
Ein Beispiel für die Temperaturverteilung an<br />
einer CFK-Rückwand im Zeitaugenblick der<br />
Bild 3 Temperaturverteilung auf der CFK-<br />
Rückwandoberfläche<br />
maximalen Temperatur zeigt Bild 3. Der Ort der Maximaltemperatur ist durch ein weißes Fadenkreuz<br />
markiert. Entlang dieser weißen Linien verläuft das unterhalb bzw. rechts des Isothermendiagramms<br />
dargestellte Temperaturprofil. Im waagerechten Profil sind die durch unterschiedliche<br />
Wanddicken bedingten Temperaturstufen zu erkennen.<br />
Der zeitliche Temperaturverlauf im Oberflächenpunkt der Maximaltemperatur ergibt sich aus<br />
den mit der Bildfrequenz von 6,25 Hz aufeinanderfolgenden Einzelwerten (Bild 4). An den<br />
hier dargestellten Kurven ist eine deutliche Abhängigkeit von der Höhe der Blitzbelastung zu<br />
erkennen, wobei sich der Langzeitanteil des Blitzstromes mit 184 C durch Zerstörung des<br />
Blitzschutzsystems sehr stark auswirkt (Kurve 1). Bemerkenswert ist weiterhin die schwache<br />
Wärmeleitfähigkeit des CFK (langsamer Temperaturanstieg, Kurve 3) gegenüber der eines<br />
Schraubverbindungselementes aus Titan (schneller Temperaturanstieg, Kurve 2).<br />
Ein Vergleich der Zeitachsen in Bild 2 und Bild 4 läßt erkennen, daß der Temperaturanstieg<br />
erst nach dem vollständigen Abklingen des Blitzstromes verzögert einsetzt.<br />
Die umfassende Auswertung aller Ver-<br />
120<br />
suche zeigt, daß die Temperaturerhö-<br />
°C<br />
100<br />
1<br />
hung ∆T gegenüber einer Umgebungstemperatur<br />
von 17°C je nach Wanddicke<br />
und Blitzbelastung zwischen 6°C<br />
80<br />
und 21°C liegt. Metallische Verbindungselemente<br />
erreichen maximal ∆T =<br />
60<br />
40<br />
2<br />
46°C. Zerstört der Lichtbogen das Blitzschutzsystem<br />
oder ist der Blitzschutz<br />
bereits vorgeschädigt, so daß der<br />
Blitzstrom in die Struktur eindringt, so<br />
20<br />
3 erwärmt sich die Struktur auf der<br />
Rückwand je nach Wanddicke und<br />
0<br />
0 10 20 30 40 s 50<br />
Blitzbelastung bis auf ∆T = 84°C. In<br />
keinem Fall wird die kritische Entzündungstemperatur<br />
eines Kraftstoff/Luft-<br />
Bild 4 Zeitlicher Verlauf der Maximaltemperatur Gemisches von 220°C erreicht.<br />
1 CFK-Rückwand 94 kA, 0,33 MJ/Ω, 184 C<br />
2 Verbindungselement 186 kA, 1,93 MJ/Ω, 30 C<br />
3 CFK-Rückwand 94 kA, 0,33 MJ/Ω, 29 C