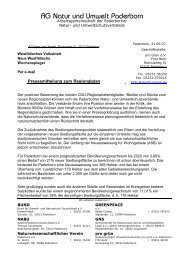Wasserrechtliche Bewilligung zur - pro grün eV Paderborn
Wasserrechtliche Bewilligung zur - pro grün eV Paderborn
Wasserrechtliche Bewilligung zur - pro grün eV Paderborn
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seite 18<br />
(z.B. Ottilien-Brunnen am Inselbad, Padulusbrunnen in Schloß Neuhaus und die<br />
Warme Pader im Paderquellgebiet) erhöhte Werte von NaCl. Bei Salzkotten treten<br />
wesentlich höher konzentrierte NaCl-Wässer fördernde Quellen mehrfach<br />
auf und nehmen noch an Zahl zu.<br />
2. Für das Bielefelder Fördergebiet wahrscheinlich bedrohlicher ist das Vordringen<br />
sulfathaltiger Wässer aus dem Gebiet östlich der Osning-Störung nach W. In<br />
Lippspringe werden solche Wässer als Heilquellen genutzt. Als Trinkwasser<br />
sind sie ungeeignet.<br />
3. Wesentlich größer ist - allerdings zunächst für das <strong>Paderborn</strong>er Tiefenwasser -<br />
die Gefahr, dass bei zu starker Entnahme von Tiefenwasser Wasser aus dem<br />
Einzugsgebiet im Bereich des unbedeckten Karstes der <strong>Paderborn</strong>er Hochebene<br />
so schnell und in so großer Menge dem Tiefenwasseraquifer zufließt, dass das<br />
Wasser nicht mehr (wie bis jetzt möglich) ohne <strong>grün</strong>dliche Reinigung direkt in<br />
das Verteilernetz geleitet werden kann. Die Wasserwerke <strong>Paderborn</strong> GmbH hat<br />
aus diesem Grund größtes Interesse an der strikten Beschränkung der Förderung<br />
von Tiefenwasser und fördert selbst derzeit nur rund 6,5 Mio. cbm/a, obwohl<br />
über Wasserrechte in Höhe von 14 Mio. cbm verfügt werden könnte.<br />
Niederschlag und Grundwasserneubildung<br />
Das Einzugsgebiet für das Bielefelder Tiefenwasser wird mit 84 qkm angegeben, der<br />
durchschnittliche Niederschlag mit 1004 mm/a.<br />
Diese Zahl ist das Fazit der Berechnungen auf S. 34 des Aktualisierten Hydrogeologischen<br />
Gutachtens des Instituts für Angewandte Hydrogeologie GbR in Garbsen. Der Wert<br />
wird durch die in ihrer Höhenlage stark exponierte und weit abgelegene Messstation<br />
Veldrom (343 m) und eine zweite Station (Nassesand, 265 m), die zwar im Einzugsgebiet<br />
liegt, aber einen um 23 Jahre kürzeren Beobachtungszeitraum aufweist, in die Höhe getrieben.<br />
Scheidet man diese beiden Werte aus, kommt man zu einem durchschnittlichen<br />
Niederschlag in der Periode von 1961-1997 (36 Jahre) von 931 mm/a. Dieser Wert scheint<br />
mir realistischer zu sein.<br />
Bleibt man bei dem im Gutachten berechneten Verhältnis von Grundwasserneubildung zu<br />
Niederschlag: 344:1004 x 100 (mm/a) = 34,3 %, das mir realistisch erscheint, und wendet<br />
dies auf den Jahresniederschlag von 931 mm an, so ergibt sich als neuer Wert der<br />
Grundwasserneubildung 319 mm/a. Die Grundwasserneubildung im Einzugsgebiet von 84<br />
qkm beträgt somit im Mittel <strong>pro</strong> qm 0,319 cbm x 84 x 1.000.000 = 26.796.000 cbm/a, das<br />
ist rund 2,1 Mio. cbm weniger als im lAH-Gutachten (S. 7) als langjähriges Mittel errechnet<br />
wird.<br />
Stellt man dem die Gesamtabflüsse der bilanzrelevanten Bäche und Flüsse in Höhe von<br />
14,5 Mio. cbm/a und die beabsichtigte Gesamtentnahme aus dem Tiefenwasser (inkl.<br />
Detmold, Schlangen u.a.) lt. lAH-Gutachten in Höhe von 12,4 Mio. cbm/a, zusammen 26,9<br />
Mio. cbm/a gegenüber, dann bleibt kein Restdargebot für trockene Zeiten übrig, die in den<br />
letzten 20 Jahren nicht selten mit 1 - 3 Monaten Dauer aufgetreten sind.<br />
Dass im lAH-Gutachten die Berechnung für Trockenjahre ein Restdargebot in Höhe von<br />
4,1 Mio. cbm/a ergibt (S. 7 unten), kann nicht ernst genommen werden. Es ist daher ver-