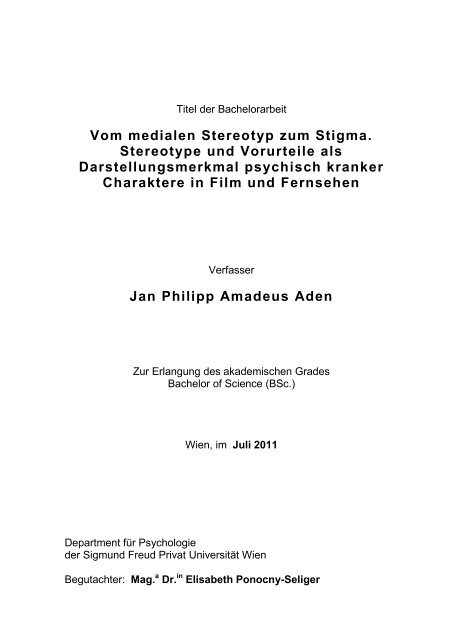5 Stereotype, Stigma und Vorurteile
5 Stereotype, Stigma und Vorurteile
5 Stereotype, Stigma und Vorurteile
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Titel der Bachelorarbeit<br />
Vom medialen Stereotyp zum <strong>Stigma</strong>.<br />
<strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> als<br />
Darstellungsmerkmal psychisch kranker<br />
Charaktere in Film <strong>und</strong> Fernsehen<br />
Verfasser<br />
Jan Philipp Amadeus Aden<br />
Zur Erlangung des akademischen Grades<br />
Bachelor of Science (BSc.)<br />
Wien, im Juli 2011<br />
Department für Psychologie<br />
der Sigm<strong>und</strong> Freud Privat Universität Wien<br />
Begutachter: Mag. a Dr. in Elisabeth Ponocny-Seliger
EIDESSTAATLICHE ERKLÄRUNG<br />
Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass die vorliegende Arbeit von mir eigenständig unter<br />
ausschließlicher Zuhilfenahme der im Text angeführten Mittel/Programme verfasst wurde.<br />
Außerdem erkläre ich, dass die gegenständliche Arbeit bisher an keiner anderen<br />
Hochschule in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt wurde.<br />
___________________ ______________________<br />
Ort, Datum Unterschrift
Abstrakt<br />
Die Frage nach der Repräsentanz stigmatisierender <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong><br />
bezüglich psychisch kranker Personen in Mainstream- Filmen <strong>und</strong> Fernsehserien<br />
wurde anhand 15 besucherstarken Mainstream-Filmen <strong>und</strong> 9 Serienepisoden von<br />
3 Mainstream-Serien analysiert. Zur Untersuchung stand eine überzufällige<br />
Häufung der <strong>Stereotype</strong> Gefährlichkeit, Inkompetenz, Unberechenbarkeit,<br />
psychisch Kranke haben eine abnormale Beziehung zu Lieb <strong>und</strong> Sexualität,<br />
geringe Lebensqualität, psychisch Kranke fallen ihrer Umwelt zur Last <strong>und</strong><br />
Determinierung durch die Erkrankung. Zudem wurde die Hypothese einer<br />
gehäuften Objektdarstellung, hinsichtlich der Narrativenperspektive psychisch<br />
Kranker formuliert.<br />
Die Erhebung erfolgte mittels quantitativer Medienanalyse, bei welcher induktive<br />
Kategorien die Beobachtungen systematisieren, ergänzt durch qualitative<br />
Beobachtungen. Diese Beobachtungen orientieren sich an den <strong>Stereotype</strong>n<br />
Infantilität, Selbstschuld an der Erkrankung, psychische Erkrankungen haben eine<br />
schlechte Prognose, sowie psychisch Kranke seien schwierige Gesprächspartner.<br />
Statistisch konnten alle <strong>Stereotype</strong>, bis auf den der Inkompetenz, als verwendetes<br />
Darstellungsmerkmal identifiziert werden, außerdem stellt die Objektdarstellung<br />
psychisch kranker ProtagonistInnen ein geläufiges Stilmittel dar. Im Rahmen der<br />
qualitativen Beobachtungen einzelner Charaktere konnte zusätzlich die<br />
Verwendung stereotyper Darstellungselemente festgehalten werden, wobei die<br />
Eigenverschuldung des Vorliegens einer psychischen Erkrankung, nur geringfügig<br />
in die Rollenzeichnung psychisch kranker Charaktere einfließt.<br />
Die Ergebnisse bekräftigen die Annahme, dass <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> als<br />
zentrales Darstellungsmerkmal psychisch kranker Charaktere in Mainstream-<br />
Filmen <strong>und</strong> Fernsehserien zum Einsatz kommen. Dies ist insbesondere<br />
hinsichtlich öffentlicher <strong>und</strong> Selbststigmatisierung der Betroffenen kritisch zu<br />
reflektieren.
Abstract<br />
The issue of the presence of stigmatizing stereotypes and prejudices about<br />
mentally ill people in mainstream movies and television series is analyzed using<br />
15 highly frequented mainstream movies and 9 episodes of 3 mainstream series.<br />
Hypothesized stereotypes such as dangerousness, incompetence and<br />
unpredictability of mentally handicapped people are used for the investigation.<br />
Furthermore stereotypes such as an abnormal relation to love and sexuality, the<br />
assumption of low quality of life, being a burden to the environment and being<br />
determined by the disease are taken into account.<br />
Also hypothesized is the representation of mentally ill people, mostly referred to<br />
as objects, from a narrative perspective.<br />
Quantitative media analysis using inductive categories supplemented by<br />
qualitative content analysis is used to systematize the observations. The<br />
qualitative observations focus stereotypes such as infantile behavior, self-blame<br />
for the disease, the idea that mental disorders have a poor prognosis and that<br />
mentally ill people are difficult to talk to.<br />
All stereotypes, except the stereotype of incompetence, have been identified as<br />
instruments for allegorizing mentally ill individuals. Furthermore, the object-<br />
representation of mentally ill protagonists turns out to be a common stylistic device<br />
in mainstream movies.<br />
Not only quantitative investigations but also qualitative research proofed the use<br />
of stereotypical representation elements. However, the negligence of the existence<br />
of mental diseases is only marginally taken into account when drawing the picture<br />
of a mentally ill character in mainstream movies or television-shows.<br />
The findings of this study corroborate the assumption that stereotypes and<br />
prejudices are central features of representing mentally ill characters in<br />
mainstream films and television series which has to be carefully reflected due to<br />
public- and self-stigmatization of the aggrieved party.
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Einleitung............................................................................9<br />
2 Was ist ein Stereotyp.......................................................10<br />
2.1 <strong>Stereotype</strong> bezüglich psychisch kranker Menschen ...........14<br />
3 Was ist ein <strong>Stigma</strong>............................................................17<br />
3.1 <strong>Stigma</strong>tisierung psychisch Kranker......................................21<br />
4 Was ist ein Vorurteil.........................................................24<br />
4.1 <strong>Vorurteile</strong> bezüglich psychisch Kranker...............................27<br />
5 <strong>Stereotype</strong>, <strong>Stigma</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> .................................29<br />
6 Massenmedien <strong>und</strong> deren Einfluss ................................32<br />
6.1 Einfluss von Massenmedien generell ...................................32<br />
6.2 Massenmedien <strong>und</strong> die Gruppe der psychisch Kranken.....34<br />
6.2.1 Mediale Darstellung psychisch kranker Menschen......................... 35<br />
6.2.2 Bedeutung der medialen Darstellung für psychisch kranke<br />
Menschen..................................................................................................... 36<br />
7 Zusammenfassung <strong>und</strong> Überleitung zum Empirieteil ..38<br />
8 Erläuterung des Untersuchungsgegenstandes ............42<br />
7
8<br />
8.1 Explizieren des empirischen Vorgangs................................ 42<br />
8.1.1 Die Hypothesen .................................................................................. 43<br />
8.1.2 Das Sampling...................................................................................... 44<br />
9. Die Kategorien ................................................................ 47<br />
9.1 Erläuterung der Kategorien................................................... 47<br />
9.2 Zuordnung der Kategorien (Operrationalisierung der<br />
<strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong>) .......................................................... 58<br />
10 Beschreibung der Stichprobe ...................................... 59<br />
11 Statistische Verfahren .................................................. 64<br />
12 Ergebnisse ..................................................................... 64<br />
12.1 Quantitative Hypothesentestung ........................................ 64<br />
12.2 Rein qualitativ erhobene Ergebnisse.................................. 73<br />
13 Diskussion ..................................................................... 79<br />
13.1 Kritik <strong>und</strong> Ausblick............................................................... 88<br />
14 Literaturverzeichnis ...................................................... 91<br />
15 Anhang ........................................................................... 94<br />
16 Lebenslauf...................................................................... 97
1 Einleitung<br />
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, inwieweit stigmatisierende<br />
<strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> gegenüber psychisch kranken Menschen in filmischen<br />
Mainstream-Formaten repräsentiert sind. In der theoretischen<br />
Auseinandersetzung mit <strong>Stigma</strong>ta, <strong>Stereotype</strong>n <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong>n sollen diese<br />
Begriffe anhand verschiedener paradigmatischer Zugänge, die sich mit diesen<br />
Begriffen auseinandergesetzt haben, definiert werden <strong>und</strong> jeweils auf die<br />
gesellschaftliche Gruppe der psychisch Kranken angewendet werden. Wie in der<br />
Fragestellung deutlich wird, werden die drei Begriffe synthetisiert werden. Damit<br />
bilden sie, als stigmatisierende <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> stigmatisierende <strong>Vorurteile</strong> die<br />
Gr<strong>und</strong>lage für die Ausarbeitung von Beispielen, in denen die stereotypen <strong>und</strong><br />
vorverurteilenden Inhalte der <strong>Stigma</strong>tisierung psychisch Kranker deutlich gemacht<br />
werden sollen. Da in dieser Arbeit von stigmatisierenden <strong>Stereotype</strong>n <strong>und</strong><br />
<strong>Vorurteile</strong>n ausgegangen wird, werden negative <strong>Stereotype</strong>n <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> im<br />
Fokus der Untersuchung stehen, sowie gesellschaftliche Annahmen scheinbar<br />
positiver Art lediglich hinsichtlich ihrer latent stigmatisierenden Konnotation oder<br />
Konsequenzen für die Betroffenen untersucht werden. Die Repräsentation der<br />
<strong>Stigma</strong>tisierung durch <strong>Vorurteile</strong> <strong>und</strong> <strong>Stereotype</strong>n in kommerziellen Kino- <strong>und</strong><br />
Fernsehformaten stellt das leitende Erkenntnisinteresse dieser Arbeit dar <strong>und</strong> ist<br />
der Gegenstand der Medienanalyse im empirischen Teil. Zusammengefasst soll<br />
im theoretischen Teil der Inhalt stigmatisierender stereotyper <strong>Vorurteile</strong> gegenüber<br />
psychisch kranken Menschen ausgearbeitet <strong>und</strong> in Form von quantifizierbaren<br />
Kategorien formuliert werden , sodass im empirischen Teil Aussagen über deren<br />
Repräsentation in den benannten massenmedialen Formaten erarbeitet werden<br />
können.<br />
Die Relevanz des Erkenntnisinteresses, also welche Bedeutung das Maß an<br />
Repräsentation von stigmatisierend stereotypen <strong>Vorurteile</strong>n für die betroffene<br />
Gruppierung haben kann, soll in einem eigenen Kapitel über den Einfluss von<br />
Massenmedien auf die Meinungsbildung in der Bevölkerung <strong>und</strong> den daraus<br />
resultierenden Konsequenzen für die stigmatisierte Gruppe, geklärt werden. In der<br />
Diskussion soll der Aspekt der Konsequenzen der Erkenntnisse aus den<br />
9
empirischen Daten, für psychisch kranke Menschen im Vordergr<strong>und</strong> stehen <strong>und</strong><br />
Gegenstand eines möglichen Ausblickes sein.<br />
Theorieteil<br />
2 Was ist ein Stereotyp<br />
Der Begriff Stereotyp wurde erstmals 1922 von Walter Lippmann, der <strong>Stereotype</strong>n<br />
als eine Art innere Bilder bezeichnete, die dem Individuum beim Erfassen der<br />
Außenwelt helfen, in der Literatur verwendet (vgl. Brigham, 1971, S. 16) <strong>und</strong><br />
durchläuft seither verschiedene Definitionsansätze (vgl. Jonas, 2002, S. 6f.). Die<br />
Akzente, welche die Definition dieses Begriffes mitbestimmt haben, haben sich<br />
seit den 50er Jahren des 19ten Jahrh<strong>und</strong>erts verändert. Die Dimensionen<br />
Ätiologie, Funktion oder Inhalt von <strong>Stereotype</strong>n fanden bei unterschiedlichen<br />
Autoren verschiedene Erklärungsansätze (vgl. Jonas, 2002, S. 6f.). So fügt z.B.<br />
John Brigham (1971) sechs Ansätze zur Definition des <strong>Stereotype</strong>nkonzeptes an.<br />
Er definiert <strong>Stereotype</strong>n als Generalisierungen, die nicht korrekterweise<br />
vorgenommen werden, Konstrukte deren Validität nicht feststellbar ist, Konzepte<br />
<strong>und</strong> Kategorisierungen, Resultate von Denkprozessen fehlerhafter Art, rigide<br />
Generalisierungen <strong>und</strong> schließlich als Habitualisierungen (vgl. Brigham, 1971, S.<br />
17ff.).<br />
In der wissenschaftlichen Entwicklung des <strong>Stereotype</strong>nkonzeptes können zwei<br />
Hauptströmungen ausgemacht werden, welche die Definition des Wortes <strong>und</strong><br />
<strong>Stereotype</strong>nkonzeptes selbst ab den 1950ern am stärksten beeinflusst haben.<br />
Beim ersten Ansatz wird dem Stereotypisieren die Funktion der Rechtfertigung<br />
von Annahmen über bestimmte kategorisierte Objekte beigemessen. Bei dem<br />
zweiten einflussreichen Konzept werden die kognitive Leistung des<br />
Stereotypisierens <strong>und</strong> deren soziale Funktion fokussiert (vgl. Jonas, 2002, S. 7).<br />
Der Schwerpunkt des <strong>Stereotype</strong>nkonzeptes liegt in Forschungen bis in die<br />
1990er Jahre auf der kognitiven Betrachtung dieses Phänomens (vgl. Stangor &<br />
Lange, zit. nach Jonas, 2002, S. 2). In kognitiv ausgerichteten Definitionen wird<br />
das <strong>Stereotype</strong>nkonzept z.B. als ökonomisch sinnvolle, rationalisierte Form der<br />
Wahrnehmung (vgl. Macrae & Bodenhausen, 2001, S. 239) aufgefasst, die als<br />
10
eine Folge von kognitiven Kapazitätslimits entsteht. Durch eine stereotype<br />
Wahrnehmung kommt es zu einer Komplexitätsabnahme der sozialen<br />
Informationen, die zahlreich auf das Individuum einwirken. So gelingt es Eindrücke<br />
z.B. aus der Personwahrnehmung besser zu verarbeiten <strong>und</strong> zu ordnen (vgl.<br />
Madon et al., 2006, S. 178f.). Dabei wird im Prozess des Stereotypisierens vom<br />
Individuum auf kognitiv repräsentierte Kategorien <strong>und</strong> Konzepte (vgl. Macrae &<br />
Bodenhausen, 2001, S. 239) zurückgegriffen, die in Form von Glaubenssätzen<br />
z.B. bezüglich sozialer Gruppierungen manifest werden können (vgl. Madon et al.,<br />
2006, S. 178f.).<br />
Bezüglich der Terminologie innerhalb des <strong>Stereotype</strong>nkonzeptes können die zwei<br />
Begriffe target <strong>und</strong> perceiver als gr<strong>und</strong>legend für das Verständnis dieses<br />
Konzeptes angesehen werden. Dabei wird das wahrnehmende, Subjekt, welches<br />
Kategorisierungen <strong>und</strong> Bewertungen vornimmt, in der wissenschaftlichen Literatur<br />
als perceiver bezeichnet. Der Gegenstand dieser Kategorisierung <strong>und</strong> Bewertung,<br />
also das Objekt auf welches sich die Stereotypisierung richtet, wird in der<br />
wissenschaftlichen Terminologie target benannt (vgl. Jonas, 2002, S. 6).<br />
Kai Jonas (2002) führt in seiner Arbeit Henri Tajfel als Kritiker einer rein<br />
individualkognitiven Definition von <strong>Stereotype</strong>n an. Dieser sehe dabei die<br />
funktionale Komponente von <strong>Stereotype</strong>n für soziale Gruppen nicht berücksichtigt<br />
(vgl. Jonas, 2002, S. 9). Daher werden vier Aspekt sozialer <strong>Stereotype</strong>n von ihm<br />
hinzugefügt:<br />
1.) Die Verwendung von <strong>Stereotype</strong>n ist eine Rationalisierung von die<br />
Aufmerksamkeit betreffenden Ressourcen, mit der Möglichkeit des<br />
Rekurses auf bereits vorhandene Wissensstrukturen.<br />
2.) Ein Mittel zum Erhalt des eigenen sozialen Status.<br />
3.) Die Möglichkeit Ideologien zu bilden <strong>und</strong> zu rechtfertigen, sowie daraus<br />
resultierenden Verhaltensweisen, welche die Gr<strong>und</strong>lage von in- <strong>und</strong> out-<br />
group -Phänomenen darstellen.<br />
4.) Es wird die Möglichkeit geboten, sich als Mitglied einer Gruppe zu fühlen<br />
<strong>und</strong> gruppenkonform handeln <strong>und</strong> denken zu können.<br />
(vgl. Tajfel zit. nach Jonas, 2002, S. 9).<br />
11
Neben der Differenzierung von <strong>Stereotype</strong>n in sozial <strong>und</strong> individuell, ist ebenfalls<br />
von Bedeutung wie sich der Prozess des Stereotypisierens vollzieht <strong>und</strong> unter<br />
welchen Bedingungen sich dieser entfaltet. Im Prozess des Stereotypisierens<br />
können im Wesentlichen drei aufeinander folgende Schritte unterschieden werden.<br />
Diese Schritte beziehen sich auf die Verarbeitung von so genannten social cues<br />
<strong>und</strong> deren Übersetzung in die individuelle Wahrnehmung <strong>und</strong> den<br />
Handlungsvollzug gegenüber einer Person oder Gruppe. Der erste Schritt besteht<br />
darin bei Konfrontation mit einer Person zunächst die sichtbaren Zeichen dieses<br />
Individuums zu erfassen <strong>und</strong> auf Gr<strong>und</strong>lage dieser Cues eine Kategorisierung<br />
vorzunehmen. Im zweiten Schritt werden bestimmte Eigenschaftszuschreibungen,<br />
mittels Assoziation mit der gefassten Kategorie, aktiviert. Im dritten Schritt wird<br />
das Individuum oder die Gruppe dann gemäß eines stereotypen Konstruktes<br />
wahrgenommen <strong>und</strong> im Sinne dieses Konzeptes interpretiert <strong>und</strong> bewertet (vgl.<br />
Casper, Rotherm<strong>und</strong> & Wentura, 2010, S. 131).<br />
Ein weiteres Modell, welches <strong>Stereotype</strong> als kognitive Gr<strong>und</strong>lage einer<br />
Personenbewertung anführt, ist die Theorie des Labellings, die im Zuge des<br />
<strong>Stigma</strong>prozesses in dieser Arbeit noch näher thematisiert werden wird (Kapitel<br />
3.1, 4.1 <strong>und</strong> 5.). In diesem Zusammenhang soll es jedoch um die Rolle der<br />
<strong>Stereotype</strong>n für labelling-effects gehen. Im Konzept der labelling-effects wird das<br />
Phänomen der Beurteilung <strong>und</strong> Bewertung eines Individuums (target), aufgr<strong>und</strong><br />
dessen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder Kategorie, durch ein<br />
anderes Individuum (perceiver) behandelt. Dabei wird davon ausgegangen, dass<br />
die Mitgliedschaft des target-Objektes in einer bestimmten Gruppe dazu führt,<br />
dass dessen passive Beurteilung von der Gruppenzugehörigkeit stark beeinflusst<br />
wird. Solche Gruppen oder Kategorien können durch unterschiedlichste Faktoren<br />
wie Rasse, Klasse, sexuelle Orientierung, Geisteszustand usw. definiert sein.<br />
<strong>Stereotype</strong> bilden in diesem Modell die kognitive Basis der Bewertung dieser<br />
Gruppen. Jene wirken in Form von Glaubenssätzen, impliziten<br />
Persönlichkeitstheorien, Schemata oder Prototypen. Es wird davon ausgegangen,<br />
dass die Bewertungen von Personen, die einer bestimmten Gruppierung<br />
angehören so vorgenommen werden, dass die bestehenden <strong>Stereotype</strong> in all<br />
ihren Unterformen konsistent bleiben können. Im Sinne der Konsistenz<br />
individueller oder kollektiver Konstrukte werden bestehende <strong>Stereotype</strong>n bezüglich<br />
einer etikettierten Gruppe, zum Maß für die Bewertung <strong>und</strong> Interpretation des<br />
12
Verhaltens eines Individuums einer betroffenen Kategorie. Neben der kognitiven<br />
Komponente im Modell der labelling-effects gibt es noch eine affektive<br />
Komponente, die Einfluss auf die Bewertung von Personen einer bestimmten<br />
Gruppe hat. Es wird davon ausgegangen, dass weder rein kognitive noch<br />
ausschließlich affektive Mechanismen die Bewertung von bestimmten etikettierten<br />
Gruppen, bestimmen. Die affektive Komponente ist dafür verantwortlich wie positiv<br />
oder negativ der perceiver gegenüber z.B. einer sozialen Gruppe eingestellt ist.<br />
Die Kognition bildet lediglich ab welche Glaubenssätze bzw. <strong>Stereotype</strong> bezüglich<br />
dieser Gruppe beim perceiver bestehen, wobei damit nicht entschieden ist, ob<br />
diese positiv oder negativ sind. Es besteht jedoch die Annahme, dass beide<br />
Dimensionen eng miteinander zusammenhängen <strong>und</strong> sich gegenseitig<br />
beeinflussen. Somit ist die Verknüpfung von Stereotyp <strong>und</strong> Affekt<br />
ausschlaggebend für die Bewertung einer Person aus einer bestimmten<br />
etikettierten Gruppierung (vgl. Jussim, Manis, Nelson & Soffin, 1995, S. 228ff.).<br />
Relevant für das Auftreten von stereotyper Wahrnehmung <strong>und</strong> Bewertung ist<br />
folglich die Möglichkeit, kategorisieren zu können. Auf der einen Seite führen wie<br />
bereits erwähnt zunächst sichtbare social cues zur Einordnung einer Person in<br />
eine bestimmte kognitiv repräsentierte Kategorie, wie z.B. ein faltiges Gesicht<br />
erlaubt den Träger dieses Merkmals in die Kategorie alter Mensch einzuordnen<br />
(vgl. Casper, Rotherm<strong>und</strong> & Wentura, 2010, S. 131). Außerdem kann bereits im<br />
Vorfeld bekannt sein, etwa durch vorhergehende Informationen, dass eine Person<br />
einer bestimmten Gruppierung angehört. Also ohne, dass der perceiver von<br />
vorhandenen Merkmalen auf eine Zugehörigkeit des target Objektes zu einer<br />
bestimmten Kategorie schließen muss. Dann kann es dazu kommen, dass die<br />
Kategorisierung direkt in die Bewertung der Person einfließt <strong>und</strong> es zu labelling<br />
effects kommt (vgl. Jussim, Manis, Nelson & Soffin, 1995, S. 228ff.). Im ersten Fall<br />
kann von einer induktiven Entstehung stereotyper Wahrnehmung <strong>und</strong> Bewertung<br />
gesprochen werden, da vom Vorliegen einiger Merkmale auf eine generalisierte<br />
Kategorie geschlossen wird <strong>und</strong> diese in Folge kognitiv wirksam wird. Im Falle der<br />
labelling effects handelt es sich um eine deduktive Entstehung stereotyper<br />
Wahrnehmung <strong>und</strong> Bewertung, da das Wissen über die Zugehörigkeit der target<br />
Person zu einer bestimmten etikettierten Kategorie dazu führt, dass beim<br />
perceiver <strong>Stereotype</strong> kognitiv wirksam werden (vgl. Jonas, 2002, S. 41).<br />
13
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass <strong>Stereotype</strong> im wesentlichen<br />
kognitive Strukturen in Form von Vorstellungsinhalten <strong>und</strong> Schemata sind (vgl.<br />
Jussim, Manis, Nelson & Soffin, 1995, S. 228ff.), welche der Rationalisierung der<br />
Wahrnehmung <strong>und</strong> Verarbeitung der Außenweltreize dienen (vgl. Macrae &<br />
Bodenhausen, 2001, S. 239) <strong>und</strong> sowohl durch Deduktion, als auch durch<br />
Induktion aktiviert werden können (vgl. Jonas, 2002, S. 41). Außer der kognitiven<br />
Funktion haben <strong>Stereotype</strong> noch soziale Funktionen, wie etwa die der Selektion<br />
<strong>und</strong> Ausgrenzung von Personen zum eigenen Statuserhalt. Darüber hinaus bilden<br />
<strong>Stereotype</strong> die kognitive Basis für <strong>Stigma</strong>tisierung <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> (vgl. Jonas,<br />
2002, S. 7ff.) <strong>und</strong> werden in dieser Funktion für die vorliegende Arbeit relevant<br />
sein. In der kognitiven Definition des <strong>Stereotype</strong>nkonzeptes können die<br />
Vorstellungsinhalte sowohl negativer, als auch positiver Ausprägung sein <strong>und</strong> sind<br />
nicht zwangsläufig mit schädlichen Konsequenzen für das betroffene target Objekt<br />
verb<strong>und</strong>en. Es kann also zwischen negativen <strong>und</strong> positiven <strong>Stereotype</strong>n<br />
unterschieden werden (vgl. Angermeyer & Matschinger, 2004, S. 1050). Wann<br />
<strong>und</strong> unter welchen Bedingungen der Einfluss von <strong>Stereotype</strong>n in der Bewertung<br />
<strong>und</strong> Wahrnehmung von Personen <strong>und</strong> Gruppen negativ wirksam wird, soll im<br />
Kapitel über das <strong>Stigma</strong> näher erläutert werden.<br />
2.1 <strong>Stereotype</strong> bezüglich psychisch kranker Menschen<br />
In diesem Kapitel soll es darum gehen, welche <strong>Stereotype</strong> bezüglich der Gruppe<br />
psychisch kranker Menschen existieren <strong>und</strong> weniger darum, wie bzw. ab wann es<br />
zur Kategorisierung eines Menschen in diese Gruppierung kommt. Das bedeutet,<br />
dass die Wirksamkeit deduktiver <strong>Stereotype</strong> im Vordergr<strong>und</strong> dieses Abschnittes<br />
stehen wird, um die bestehenden Glaubenssätze in der Gesellschaft besser<br />
identifizieren zu können.<br />
Gegenüber psychisch kranken Menschen bestehen sowohl negative als auch<br />
positive <strong>Stereotype</strong>. Ein positives Stereotyp über psychisch kranke Personen ist<br />
beispielsweise, dass Menschen dieser Kategorie mit Genialität assoziiert sind (vgl.<br />
Genie <strong>und</strong> Wahnsinn). Zentrale negative <strong>Stereotype</strong> bezüglich psychisch kranker<br />
Menschen sind, dass Menschen, welche dieser Kategorie zugeordnet werden,<br />
erstens gefährlich seien, zweitens selber für das Vorliegen ihrer Kondition<br />
14
verantwortlich seien, drittens ihre Erkrankung eine schlechte Prognose habe <strong>und</strong><br />
chronisch sei, sowie viertens, dass Personen mit einer psychischen Krankheit<br />
unberechenbar seien <strong>und</strong> sich nicht in sozial akzeptierte Rollen fügen wollten (vgl.<br />
Hayward & Brights zit. nach Angermeyer & Matschinger, 2004, S. 1050).<br />
Außerdem konnten von Martin Taylor <strong>und</strong> Michael Dear (1981) vier Hauptgruppen<br />
von <strong>Stereotype</strong>n identifiziert werden, die:<br />
1.) psychisch kranke Menschen als Gefahr beschreiben;<br />
2.) Betroffene als schuldig für ihre Erkrankung <strong>und</strong> als Resultat eines<br />
schwächlichen Charakters kennzeichnen;<br />
3.) Inkompetenz <strong>und</strong> das Bedürfnis psychisch Kranker nach<br />
Entscheidungsträgern fokussieren;<br />
4.) Infantilität <strong>und</strong> die Notwendigkeit von Führungsfiguren für die Erkrankten<br />
als wesentliche Merkmale psychisch Kranker sehen<br />
(vgl. Corrigan & Rüsch, 2002, S. 317 ; Taylor & Dear,1981, S. 230ff.).<br />
In einer Studie von Matthias Angermeyer <strong>und</strong> Herbert Matschinger (2004)<br />
konnten 5 Faktoren (siehe unten) bezüglich stereotyper Annahmen gegenüber an<br />
Schizophrenie erkrankten Menschen bestätigt werden. Die Stichprobe hat eine<br />
Größe von n= 5025 <strong>und</strong> beinhaltet Männer <strong>und</strong> Frauen ab dem Alter von 18<br />
Jahren (vgl. Angermeyer & Matschinger, 2004, S.1049). Dabei wurden für die<br />
einzelnen Items <strong>Stereotype</strong> bezüglich schizophrener Menschen verwendet, wie<br />
Schizophrene Personen begehen brutale Straftaten, Schizophrenie ist die Folge<br />
eine unmoralischen Lebensstils oder schizophrene Menschen brauchen eine<br />
Führungsfigur. Dazu sollen die identifizierten Faktoren mit einigen dazugehörigen<br />
<strong>Stereotype</strong>n vorgestellt werden. Der erste Faktor Gefährlichkeit besteht aus Items,<br />
in denen z.B. der Zusammenhang von Schizophrenie <strong>und</strong> Sexualdelikten, sowie<br />
Brutalität in Straftaten erfragt wurde. Als zweiter Faktor konnte Selbstverschuldung<br />
des Vorhandenseins einer schizophrenen Erkrankung herausgearbeitet werden.<br />
Zu dieser Dimension werden <strong>Stereotype</strong> wie das Auftreten von Schizophrenie als<br />
Frage von Disziplin <strong>und</strong> Willensstärke oder, dass erfolgreiche Menschen seltener<br />
an Schizophrenie erkranken, gezählt. Faktor 3 bezieht sich auf das Merkmal<br />
Kreativität. Zu diesem Faktor sind <strong>Stereotype</strong> wie, Wahnsinn <strong>und</strong> Genie sind eng<br />
verb<strong>und</strong>en oder Künstler haben ein höheres Risiko an Schizophrenie zu<br />
15
erkranken, zugeordnet. Der vierte Faktor bezieht sich auf Unberechenbarkeit <strong>und</strong><br />
Inkompetenz. Hierzu werden <strong>Stereotype</strong> wie Menschen mit Schizophrenie sind<br />
völlig unberechenbar, Menschen mit Schizophrenie können ihr Leben nicht alleine<br />
händeln oder schizophrene Menschen sind nicht in der Lage logisch zu denken,<br />
angeführt. Der fünfte <strong>und</strong> letzte Faktor behandelt das Thema der schlechten<br />
Prognose der Erkrankung. Dieser Dimension sind <strong>Stereotype</strong> zugeordnet in denen<br />
unter anderem behauptet wird, dass es keine erfolgreiche Behandlung gegen<br />
diese Erkrankung gibt (vgl. Angermeyer & Matschinger, 2004, S.1053f.).<br />
Das Vorliegen einer psychischen Krankheit kann zu einer Etikettierung führen.<br />
Auch ehemalige Patienten, die an einer psychischen Krankheit gelitten haben,<br />
können in diese Kategorie fallen. Gemäß der labelling Theorie werden Individuen,<br />
welche der Kategorie der psychisch Kranken angehören <strong>und</strong> als Mitglieder dieser<br />
Gruppe identifiziert worden sind, im Sinne bereits zuvor existierender <strong>Stereotype</strong><br />
auf Seiten der perceiver wahrgenommen <strong>und</strong> bewertet (vgl. Sibicky & Dovidio,<br />
1986, S. 148).<br />
Auch auf der Ebene des Verhaltens passen sich die perceiver in der Interaktion<br />
mit psychisch kranken Menschen ihren bestehenden <strong>Stereotype</strong>n bezüglich der<br />
Gruppe der psychisch Kranken an. Die Verhaltensanpassung wird z.B. in der<br />
Veränderung der Sprache deutlich, die sich den bestehenden Erwartungen <strong>und</strong><br />
vor allem Vorstellungen anpasst. Allerdings ist dieser Effekt auch auf Seiten der<br />
psychisch kranken Personen zu beobachten. Es wird davon ausgegangen, dass<br />
sie gesellschaftliche <strong>Stereotype</strong> internalisiert haben <strong>und</strong> in Folge dessen ihr<br />
Verhalten an die antizipierte Erwartung Dritter anpassen. So kommt es zu<br />
stereotypenkonformen Verhalten auf Seiten der Betroffenen <strong>und</strong> vor allem zur<br />
Aufnahme dieser <strong>Stereotype</strong> in ihr Selbstkonzept (vgl. Jones et al. zit. nach<br />
Sibicky & Dovidio, 1986, S. 148).<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass <strong>Stereotype</strong> bezüglich psychisch<br />
kranker Menschen bestehen <strong>und</strong> diese direkte Auswirkungen auf die Betroffenen<br />
selbst, sowie auf deren Wahrnehmung <strong>und</strong> Bewertung durch andere haben (vgl.<br />
Sibicky & Dovidio, 1986, S. 148) <strong>und</strong> sowohl negativ, als auch positiv sein können<br />
(vgl. Angermeyer & Matschinger, 2004, S. 1050).<br />
Zentrale <strong>Stereotype</strong> gegenüber psychisch kranken Menschen zielen im<br />
Wesentlichen auf die durch die hier vorgestellten Faktorenanalyse identifizierten<br />
16
Themenbereiche bzw. Dimension ab (vgl. Taylor & Dear, 1981, S. 230ff. <strong>und</strong><br />
Angermeyer & Matschinger, 2004, S. 1053f.).<br />
Die Zustimmung zu diesen <strong>Stereotype</strong>n soll im Kapitel über die <strong>Vorurteile</strong> näher<br />
thematisiert werden. Auch auf die stigmatisierende Wirkung von <strong>Stereotype</strong>n soll<br />
im Kapitel über stigmatisierende <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> näher eingegangen<br />
werden, indem auf integrative Konzepte verwiesen werden soll.<br />
3 Was ist ein <strong>Stigma</strong><br />
Im alten Griechenland fungierte der Begriff <strong>Stigma</strong> als Bezeichnung für Zeichen<br />
am menschlichen Körper, die auf Mangel an Moral oder andere Sonderheiten des<br />
Trägers aufmerksam machen sollten. Ein <strong>Stigma</strong> offenbarte anderen Menschen<br />
den negativen sittlichen Zustand des <strong>Stigma</strong>tisierten oder kennzeichnete diesen<br />
als Träger einer ungewöhnlichen Eigenschaft. Insbesondere wiesen die in Haut<br />
gebrannt oder geschnittenen Zeichnen Menschen aus, mit denen Kontakt besser<br />
vermieden werden sollte. Betroffen waren unterschiedlichste Personen wie<br />
Sklaven oder Räuber, die jedoch eine negative gesellschaftliche Konnotation<br />
gemeinsam hatten. In späteren Zeiten, in welchen das Christentum eine<br />
einflussreiche gesellschaftliche Stellung innehatte, herrschten zwei parallel<br />
existierende Annahmen bezüglich der Bedeutung von <strong>Stigma</strong>ta vor. Der Begriff<br />
des <strong>Stigma</strong>s wurde in medizinischen Kontexten als Bezeichnung für körperliche<br />
Unstimmigkeiten verwendet. Aus der religiösen Perspektive wurde eine solche<br />
Unstimmigkeit als fleischliches Zeichen der Gnade Gottes gedeutet (vgl.<br />
Goffman,1963, S. 9).<br />
Heute existieren viele Definitionen dieses Begriffs, die sich auf Definitionen aus<br />
Wörterbüchern beziehen oder auf verwandte Begriffe wie etwa Stereotyp<br />
rekurrieren.<br />
Eine große Zahl von Autoren bezieht sich bei der Definition von <strong>Stigma</strong> auf Erving<br />
Goffman. Er leitete mit seiner Konzeptualisierung des <strong>Stigma</strong>begriffes eines Welle<br />
von Forschungsarbeiten ein, die sein Konzept von <strong>Stigma</strong> auf verschiedenste<br />
Bereiche anwendeten, wie etwa Arbeitslosigkeit oder psychische Erkrankungen,<br />
17
wodurch eine interdisziplinärere Betrachtung des <strong>Stigma</strong>s entstand (vgl. Link &<br />
Phelan, 2001, S. 363ff.).<br />
Goffman (1963) definiert ein <strong>Stigma</strong> als Diskrepanz zwischen virtualer <strong>und</strong><br />
aktualer sozialer Identität. Die virtuale soziale Identität gründet auf impliziten<br />
Forderungen, die Menschen an andere, gemäß der antizipierten sozialen Identität,<br />
stellen. Die Antizipation erfolgt mittels sozialer Kategorisierungen, aus denen<br />
Erwartungen bezüglich der Identität der anderen resultieren. Die aktuale soziale<br />
Identität hingegen setzt sich aus tatsächlich vorhandenen Eigenschaften einer<br />
Person zusammen. Weist eine Person eine negative Eigenschaft auf, welche in<br />
ihrer sozialen Kategorie nicht zu erwarten ist, also der virtualen sozialen Identität<br />
nicht entspricht, so kann es dazu führen, dass die Person aufgr<strong>und</strong> dieser nicht<br />
antizipierten Eigenschaft zum Gegenstand von Abwertung wird. Eine Eigenschaft,<br />
die als ursächlich für die benannte Diskrepanz <strong>und</strong> in Folge für die<br />
Herabminderung deren TrägerInnen ist, definiert Goffman (1963) als <strong>Stigma</strong>.<br />
Entscheidend, ob ein Attribut zu Diskreditierung führt <strong>und</strong> somit zum <strong>Stigma</strong> wird,<br />
ist relativ zu der sozialen Position, die ein Individuum in der Gesellschaft einnimmt.<br />
Für einige Menschen sind bestimmte Eigenschaften normal, die bei Personen<br />
anderer sozialer Gruppen zu einer <strong>Stigma</strong>tisierung führen. Es werden drei sich<br />
unterscheidende Typen von <strong>Stigma</strong>ta voneinander abgegrenzt. Die<br />
Unterscheidung trennt <strong>Stigma</strong>ta bezüglich körperlicher Makel, Charakterfehler <strong>und</strong><br />
<strong>Stigma</strong>ta hinsichtlich der Phylogenetik. Charakterfehler werden assoziiert mit<br />
Mangel an Beherrschung oder Schwäche des Willens <strong>und</strong> werden an<br />
Suchterkrankungen, bestimmter sexueller Orientierungen oder psychischen<br />
Krankheiten festgemacht. Phylogenetische <strong>Stigma</strong>ta betreffen Bereiche wie<br />
Nationalität, Ethnie oder Glaube. Die soziologische Gemeinsamkeit der drei Typen<br />
liegt darin, dass Personen aufgr<strong>und</strong> eines bestimmten Attributs von sozialer<br />
Teilhabe ausgeschlossen werden, obgleich eine Partizipation einfach herzustellen<br />
wäre (vgl. Goffman, 1963, S. 10ff.).<br />
Es gibt weitere Dimensionen nach denen <strong>Stigma</strong>ta von einander unterschieden<br />
werden können. Eine Dimension unterscheidet hinsichtlich des Akteurs, der die<br />
<strong>Stigma</strong>tisierung vornimmt. Dabei wird zwischen public stigma <strong>und</strong><br />
Selbststigmatisierung differenziert (vgl. Schomerus, 2010, S. 253). Das public<br />
stigma bezeichnet <strong>Stigma</strong>tisierungen, die von außen, also von außerhalb der<br />
18
eigenen Person, vorgenommen werden. Die <strong>Stigma</strong>tisierung von außen<br />
manifestiert sich z.B. in Diskriminierungen am Arbeitsmarkt oder weiteren<br />
Benachteiligungen struktureller <strong>und</strong> sozialer Natur. Selbststigmatisierung<br />
bezeichnet den <strong>Stigma</strong>tisierungsvorgang, der sich innerhalb einer Person<br />
vollzieht, die von einem bestimmten Merkmal betroffen ist. <strong>Vorurteile</strong> <strong>und</strong><br />
abwertende Annahmen werden von der betroffenen Person auf sich selber<br />
angewendet. Bestehende gesellschaftliche <strong>Vorurteile</strong> werden internalisiert <strong>und</strong><br />
gegen die eigene Person oder stigmatisierte Gruppe, deren Mitglied die oder der<br />
Betroffene aufgr<strong>und</strong> einer Eigenschaft ist, angewendet (vgl. Schomerus, 2010, S.<br />
253f.). Eine weitere zentrale Unterscheidungsdimension ist die der Visiabilität, die<br />
mit zahlreichen Konsequenzen, auf welche noch näher eingegangen wird, für die<br />
Betroffenen verb<strong>und</strong>en ist. Die Visiabilität, für die Goffman (1963) den synonymen<br />
Gebrauch Wahrnehmbarkeit vorzieht, ist entscheidend ob ein <strong>Stigma</strong><br />
diskreditierend oder diskreditierbar ist (vgl. Goffman, 1963, S.56ff.). Ist ein <strong>Stigma</strong><br />
diskreditierend, so ist es bereits ohne intensiveren Kontakt zu dessen TrägerIn, für<br />
andere sicht- bzw. wahrnehmbar. Diskreditierende <strong>Stigma</strong>ta sind <strong>Stigma</strong>symbole,<br />
die ein hohes Maß an Information vermitteln, dass eine betroffene Person<br />
TrägerIn eines bestimmten Merkmals ist. Diskreditierbare <strong>Stigma</strong>ta sind durch ihr<br />
geringes Maß an Informationsvermittlung über einen persönlichen Makel<br />
gekennzeichnet. Es handelt sich um <strong>Stigma</strong>ta mit einer geringen Visiabilität.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der für andere erschwerten oder fehlenden Wahrnehmbarkeit, ist die<br />
Steuerung der Information über das <strong>Stigma</strong>, von Seiten des Betroffenen die<br />
Hauptaufgabe in sozialer Interaktion. Diskreditierung <strong>und</strong> Diskreditierbarkeit sind<br />
zwei <strong>Stigma</strong>ausprägungen, die unmittelbar durch die Visiabilität, also<br />
Wahrnehmbarkeit, bedingt sind (vgl. Goffman, 1963, S.56ff.).<br />
Der Begriff der Visiabilität ist allerdings von drei anderen Begriffen abzugrenzen,<br />
damit er als Wahrnehmbarkeit von Defekten einer Person, auf den Sachverhalt<br />
der <strong>Stigma</strong>definition/-unterscheidung angewendet werden kann. Zunächst wird<br />
eine Abgrenzung zum Bescheid-gewußt-sein vollzogen. Hierbei handelt es sich<br />
um den Fall, dass ein <strong>Stigma</strong> direkt wahrnehmbar ist <strong>und</strong> andere schnell von der<br />
Existenz der Brandmarkung bescheid wissen. Entscheidend dabei ist aber wie<br />
hoch der Wissensstand der wahrnehmenden Personen über das <strong>Stigma</strong> ist <strong>und</strong><br />
aus welchen Quellen der Wissensstand resultiert (Tratsch, Fachzeitschrift etc.).<br />
Außerdem wird eine Unterscheidung zur Aufdringlichkeit gezogen. Die<br />
19
Aufdringlichkeit gibt den Grad der Beeinträchtigung einer Interaktion durch das<br />
<strong>Stigma</strong> an, denn die Sichtbarkeit allein muss nicht auch zu einer Beeinträchtigung<br />
führen, weshalb diese Abgrenzung gezogen wird. Zuletzt wird von der Visiabilität<br />
der Begriff wahrgenommener Herd differenziert. Der wahrgenommene Herd<br />
bezieht sich auf bestimmte Lebensbereiche <strong>und</strong> Settings, in denen das <strong>Stigma</strong><br />
negative Effekt für den oder die Betroffene auslöst, denn bestimmte <strong>Stigma</strong>ta<br />
entfalten nur unter speziellen Umstände negative Auswirkungen auf die<br />
TrägerInnen. Die Abgrenzungen zur Visiabilität beziehen sich wie hier beschrieben<br />
auf bereits durch andere identifizierte <strong>Stigma</strong>ta <strong>und</strong> deren Ausprägungen <strong>und</strong><br />
Relevanzen (vgl. Goffman,1963, S. 64ff.).<br />
Bei diskreditierbaren, verborgenen <strong>Stigma</strong>ta sind zunächst andere Faktoren der<br />
Auswirkungen relevant. Diane Quinn <strong>und</strong> Stephenie Chaudoir (2009) benennen<br />
vier Faktoren, die bei Identitäten mit verborgenen <strong>Stigma</strong>ta dahingehend Einfluss<br />
auf die Betroffenen nehmen, dass es zu psychischem Stress kommt. Der erste<br />
Faktor ist das Anticipated <strong>Stigma</strong>. Das antizipierte <strong>Stigma</strong> gibt den vom<br />
Betroffenen erwarteten Grad der Brandmarkung durch andere Personen an, wenn<br />
diese von dessen <strong>Stigma</strong> erfahren. Zweitens wird Centrality als relevanter Faktor<br />
identifiziert. Die Zentralität gibt an wie zentral das <strong>Stigma</strong> zum Selbst des/der<br />
Betroffenen gelegen ist. Der dritte Faktor lautet Salience. Die Salienz gibt an wie<br />
auffallend bzw. störend das <strong>Stigma</strong> für den/die TrägerIn ist. Je aufdringlicher <strong>und</strong><br />
präsenter ein <strong>Stigma</strong> ist, desto höher ist der empf<strong>und</strong>ene psychische Stress. Als<br />
letzten Faktor wird das cultural stigma angegeben. Dabei ist das Niveau der<br />
sozialen Diskriminierung, wegen eines bestimmten Merkmals, als relativ zur<br />
jeweiligen Kultur anzusehen. Unterschiedliche <strong>Stigma</strong>ta werden in verschiedenen<br />
Kulturen unterschiedlich be- bzw. abgewertet (vgl. Quinn & Chaudoir, 2009, S.<br />
636f.).<br />
Bruce Link <strong>und</strong> Jo Phelan (2001) betonen zusätzlich die Rolle der Etikettierung<br />
als Teil der <strong>Stigma</strong>tisierung einer Person. Der Begriff Labeling unterstreicht den<br />
Anteil der <strong>Stigma</strong>tisierung einer Person, der auf soziale Prozesse zurückzuführen<br />
ist <strong>und</strong> nicht in der betroffenen Person selbst wurzelt (vgl. Link & Phelan, 2001, S.<br />
368). Das Labeling stellt den Ausgangspunkt für einen vierstufigen<br />
<strong>Stigma</strong>tisierungsprozess dar, welcher bereits im Zusammenhang mit <strong>Stereotype</strong>n<br />
thematisiert worden ist (vgl. Link & Phelan, 2001, S. 368ff.)<br />
20
Zusammenfassend kann ein <strong>Stigma</strong> bei einer Person als vorhanden angesehen<br />
werden, wenn eine Eigenschaft vorliegt, die mit einem negativen <strong>Stereotype</strong>n<br />
assoziiert ist (vgl. Goffman, 1963, S. 12) <strong>und</strong> Elemente von Etikettierung,<br />
Ausgrenzung <strong>und</strong> Statusverlust nach sich zieht (vgl. Link & Phelan, 2001, S. 382),<br />
wobei der Grad der Wahrnehmbarkeit entscheidend ist, welche Faktoren,<br />
bezüglich der Einschränkung durch das <strong>Stigma</strong>, für die Betroffenen bedeutsamer<br />
sind (vgl. Goffman, 1963, S. 56ff.).<br />
3.1 <strong>Stigma</strong>tisierung psychisch Kranker<br />
Das Vorliegen einer psychischen Erkrankung ist als <strong>Stigma</strong> zu bezeichnen (vgl.<br />
Schulze, Janeiro & Kiss, 2010, S. 276). Psychisch kranke Menschen werden mit<br />
negativen <strong>Stereotype</strong>n assoziiert (vgl. Schomerus, 2010, S. 253) <strong>und</strong> sind in Folge<br />
dessen mit Abwertung, Diskriminierungen <strong>und</strong> Statusverlust konfrontiert (vgl.<br />
Schulze, Janeiro & Kiss, 2010, S. 276 ; Rüsch, 2010, S. 288). Bei psychischen<br />
Erkrankungen handelt es sich meist um versteckbare <strong>Stigma</strong>ta, die von anderen<br />
Menschen nicht unmittelbar erkannt werden müssen (vgl. Quinn & Chaudoir,<br />
2009, S. 635) <strong>und</strong> haben daher eher diskreditierbaren Charakter (vgl. Goffman,<br />
1963, S. 56), was jedoch nicht für jedes Störungsbild zutrifft (vgl. Schulze, Janeiro<br />
& Kiss, 2010, S. 280f.). Der Grad, indem eine psychische Krankheit als<br />
stigmatisierend empf<strong>und</strong>en wird hängt von den vier von Quinn <strong>und</strong> Chaudoir<br />
(2009) beschriebenen Faktoren, antizipiertes <strong>Stigma</strong>, Zentralität, Salienz <strong>und</strong> dem<br />
kulturellen <strong>Stigma</strong>, ab. Beim antizipierten <strong>Stigma</strong> tendieren die Betroffenen zu<br />
Geheimhaltung, da sie überwiegend negative Reaktionen ihres Umfelds bei<br />
Bekanntmachung ihrer Diagnose erwarten (vgl. Quinn & Chaudoir, 2009, S. 636).<br />
Der Prozess der <strong>Stigma</strong>tisierung wird in vier aufeinander aufbauende Schritte<br />
eingeteilt. Dabei bildet die Etikettierung durch eine Diagnose als Abweichung von<br />
der Bevölkerungsnorm den ersten Schritt. Diese, die Abweichung vom<br />
Bevölkerungsdurchschnitt anzeigende Etikette, bildet dann die Gr<strong>und</strong>lage für<br />
Assoziationen mit negativen <strong>Stereotype</strong>n wie etwa Unberechenbarkeit oder<br />
Gefahr. Die assoziierten <strong>Stereotype</strong> evozieren bei anderen Menschen Emotionen,<br />
die ihre Ausprägung in Furcht oder Ärger finden können. Der letzte der vier<br />
Schritte ist die Ausgrenzung. Psychisch kranke Menschen werden als nicht mehr<br />
21
zu einer sozialen Gruppe dazugehörig aufgefasst, sondern in eine andere eigene<br />
verschoben (vgl. Link & Phelan, 2001, S. 363ff.).<br />
Die Wirkung eines <strong>Stigma</strong>s findet in unterschiedlichen Bereichen ihren Ausdruck.<br />
So kann sich eine stigma-bedingte Diskriminierung in einer öffentlichen oder<br />
strukturellen Diskriminierung manifestieren. Öffentliche Diskriminierung wird von<br />
Personen des öffentlichen Lebens vollzogen, die eine bestimmte Relevanz für den<br />
Lebensvollzug des psychisch Kranken haben. Bei der Suche nach Wohnungen<br />
oder einer Arbeitstelle können öffentliche Benachteiligung von Vermietern oder<br />
Personalchefs gegen den/die TrägerIn einer psychischen Krankheit ausgeübt<br />
werden. Die strukturelle Diskriminierung bezieht sich auf Regeln <strong>und</strong> Prozesse<br />
des sozialen Lebens, deren Systematik zur Benachteiligung von Menschen mit<br />
einer psychischen Krankheit führt. Ein Beispiel struktureller Diskriminierung ist die<br />
Benachteiligung von psychisch Kranken im Krankenversicherungssystem (vgl.<br />
Corrigan zit. nach Rüsch, 2010, S. 287).So fordern einige Gesellschaften z.B.<br />
höhere Prämien für Menschen mit einer psychiatrischen Vorgeschichte (vgl.<br />
Rüsch, Angermeyer & Corrigan, 2005, S. 227). Eine weitere entscheidende<br />
Dimension in der die negative Wirkung des <strong>Stigma</strong>s einer psychischen Erkrankung<br />
stellt die Selbststigmatisierung durch die Betroffenen selbst dar. Die<br />
Selbststigmatisierung bezeichnet eine Abwertung der eigenen Person aufgr<strong>und</strong><br />
des Merkmals der psychischen Erkrankung (vgl. Rüsch, 2010, S. 287).<br />
Die <strong>Stigma</strong>tisierung psychisch kranker Menschen kann sich implizit <strong>und</strong> explizit<br />
äußern. In Forschungen im Bereich der Sozialpsychologie kommt den automatisch<br />
<strong>und</strong> unbewusst ablaufenden Einstellungsbildungen eine immer größere Rolle zu.<br />
Die automatischen <strong>und</strong> weitgehend unreflektierten Reaktionen auf <strong>Stigma</strong>ta<br />
werden implizit genannt. Implizite Einstellungen entstehen durch unbewusste<br />
Assoziation von sozialen Kategorien mit negativen Attributen. Solche impliziten<br />
Einstellungen äußern sich auch im Verhalten <strong>und</strong> manifestieren sich insbesondere<br />
in nonverbalen Reaktionen. Explizite Einstellungen sind reflektierte <strong>und</strong><br />
durchdachte Schlussfolgerungen. Bei der Äußerung expliziter Einstellungen<br />
spielen andere gr<strong>und</strong>sätzliche Einstellungen <strong>und</strong> soziale Erwünschtheit eine Rolle.<br />
Explizite <strong>und</strong> implizite Einstellungen müssen nicht übereinstimmen. So kann<br />
implizit die Diagnose Schizophrenie mit Gefahr assoziiert werden, wobei dies<br />
explizit so nicht gedacht oder geäußert würde. Die Diskrepanz zwischen impliziten<br />
22
<strong>und</strong> expliziten Einstellungen ist ein Faktum innerhalb der <strong>Stigma</strong>tisierung<br />
psychisch Kranker mit dem sich die Betroffenen konfrontiert sehen (vgl. Rüsch,<br />
2010, S. 292).<br />
In einer Studie von Beate Schulze, Maya Janeiro <strong>und</strong> Helena Kiss (2010) wird<br />
sich unter anderem der Frage gewidmet, welche <strong>Stigma</strong>-Erfahrungen Menschen<br />
mit der Diagnose Schizophrenie oder Borderline-Persönlichkeitsstörung gemacht<br />
haben. Dabei gaben Betroffene beider Erkrankungen an, dass die Erfahrung von<br />
„Zurückweisung <strong>und</strong> Ausgrenzung“(vgl. Schulze, Janeiro & Kiss, 2010, S. 280) mit<br />
21,4% der Nennungen bei schizophrenen Patienten <strong>und</strong> 28,3% bei Personen mit<br />
der Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung einen großen Bestandteil des<br />
Erlebens ihrer <strong>Stigma</strong>tisierung darstelle. Zudem geben Betroffene von Borderline-<br />
Persönlichkeitsstörung mit 34% der Nennungen an auf ihre Erkrankung reduziert<br />
zu werden, sodass etwa positive Leistungen <strong>und</strong> Erfolge nicht wahrgenommen<br />
werden. Außerdem berichten 17% der Betroffenen dieser Diagnose von<br />
abwertenden Kommentaren bezüglicher sichtbarer Folgen ihrer Krankheit, wie z.B.<br />
Schnittverletzungen oder Narben. Menschen, die von Schizophrenie betroffen<br />
sind, nennen mit 35,8%, dass eine sehr präsente <strong>Stigma</strong>-Erfahrung das fehlende<br />
Ernstnehmen der Symptomatik <strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen Leidensdruck sei.<br />
Außerdem sehen sich Personen dieser Gruppe als „Sündenböcke“ (Schulze,<br />
Janeiro & Kiss, 2010, S. 280) diffamiert <strong>und</strong> als ursächlich für Belastungen<br />
Angehöriger angesehen. Zudem sei die <strong>Stigma</strong>tisierung durch ihre Erkrankung<br />
von Konfrontation mit Drohungen bezüglich „Zwangsbehandlungen“ (Schulze,<br />
Janeiro & Kiss, 2010, S. 280) gekennzeichnet, wie 14% der Nennungen zeigen.<br />
Die Daten sind durch qualitativ ausgewertete Befragungen von Personen, die an<br />
Schizophrenie oder einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erkrankt sind,<br />
gewonnen worden. Die Bef<strong>und</strong>e zeigen, dass <strong>Stigma</strong>-Erfahrungen je nach<br />
psychischer Störung <strong>und</strong> dem begleitenden Symptomen variieren. Die Art wie <strong>und</strong><br />
was als <strong>Stigma</strong> wahrgenommen wird, ist relativ zur Erkrankung <strong>und</strong> deren<br />
Störungsbild. Dabei ist die Visiabilität ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal,<br />
welches die <strong>Stigma</strong>-Erfahrung maßgeblich mitbestimmt. So berichteten die von<br />
einer Boderline-Persönlichkeitsstörung betroffenen Personen häufiger von <strong>Stigma</strong>-<br />
Erfahrungen als an Schizophrenie Erkrankte, wobei sich 17% der Nennungen von<br />
Boderline-Patienten auf Diffamierung bezüglich unmittelbar wahrnehmbarer<br />
Zeichen ihrer Krankheit beziehen. Die Schizophrenie hingegen zieht keine Folgen<br />
23
dieser Art für die Betroffenen nach sich (vgl. Schulze, Janeiro & Kiss, 2010, S.<br />
280f.).<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das <strong>Stigma</strong> einer psychischen<br />
Krankheit zu Ausgrenzung <strong>und</strong> Abwertung durch andere <strong>und</strong> die Betroffenen<br />
selbst führen kann (vgl. Schomerus, 2010, S. 253). Die Diskriminierungen können<br />
verschiedene Ausprägungen annehmen <strong>und</strong> in den unterschiedlichsten<br />
Lebensbereichen auftreten (vgl. Rüsch, 2010, S. 287), wobei die Reaktionen der<br />
Umwelt auf psychische Erkrankungen von den jeweiligen Symptomen des<br />
Störungsbildes abhängen. Dabei spielt die Wahrnehmbarkeit der Erkrankung<br />
durch andere eine zentrale Rolle (vgl. Schulze, Janeiro & Kiss, 2010, S.280f.).<br />
4 Was ist ein Vorurteil<br />
In der sozialpsychologischen Literatur werden <strong>Vorurteile</strong> häufig als positive oder<br />
negative Bewertung von sozialen Gruppen <strong>und</strong> deren Mitgliedern definiert (vgl.<br />
Mackie & Smith, 1998, S. 500f.). Die betroffenen Gruppen sind dabei vielfältig <strong>und</strong><br />
können neben Rasse, Geschlecht, Nationalität oder Behinderungen durch viele<br />
mögliche Merkmale definiert sein. Entscheidend ist, dass <strong>Vorurteile</strong>, unabhängig<br />
davon auf welche Kategorie sie sich beziehen, dieselbe Struktur haben <strong>und</strong><br />
denselben Regeln folgen. Die Struktur ist kultur-übergreifend, über die Zeit<br />
konstant <strong>und</strong> kommt nicht nur bei bestimmten oder gegen bestimmte Gruppen vor<br />
(vgl. Crandall & Eshleman, 2003, S. 415). Die kognitive Gr<strong>und</strong>lage von <strong>Vorurteile</strong>n<br />
wird von <strong>Stereotype</strong>n gebildet. Besonders diese Komponente zeigt die enge<br />
Verknüpfung des Konzeptes der <strong>Vorurteile</strong> mit dem der <strong>Stereotype</strong> (vgl. Devine,<br />
1989, S. 5). Einigen Konzepten zu Folge ist die Beziehung zwischen <strong>Vorurteile</strong>n<br />
<strong>und</strong> <strong>Stereotype</strong>n so stark, dass davon ausgegangen wird, dass Menschen mit<br />
vielen <strong>Vorurteile</strong>n stärker dazu neigen generell mit <strong>Stereotype</strong>n überein zu<br />
stimmen. Das bedeutet, dass <strong>Vorurteile</strong> die Übereinstimmung mit <strong>Stereotype</strong>n<br />
erhöhen. Diese Annahme bestätigt die traditionelle Theorie, dass <strong>Vorurteile</strong> zu<br />
erhöhtem Gebrauch von <strong>Stereotype</strong>n führt, welche damit als Mittel zur<br />
Rechtfertigung sozialer Ungerechtigkeit fungieren (vgl. Sherman, Stroessner,<br />
Conrey & Azam, 2005, S. 607). Die Theorie der inevitability of prejudice beinhaltet<br />
24
die Annahme eines noch stärkeren Zusammenhanges der beiden Konzepte.<br />
Diese Theorie postuliert, dass solange <strong>Stereotype</strong> bestehen, diese zwangsläufig<br />
<strong>Vorurteile</strong> zur Folge haben. Dabei reicht allein das Wissen über bestehende<br />
<strong>Stereotype</strong> bezüglich einer bestimmten Gruppe aus, dass <strong>Vorurteile</strong> gegen diese<br />
aktiviert werden (vgl. Devine, 1989, S. 5). Patricia Devine (1989) widerspricht der<br />
Annahme, dass allein das Bescheidwissen über <strong>Stereotype</strong> zur Entstehung von<br />
<strong>Vorurteile</strong>n führt <strong>und</strong> sieht diese Hypothese auch als empirisch nicht gestützt an.<br />
Nicolas Rüsch <strong>und</strong> Patrick Corrigan (2002) fassen diese Kritik zusammen <strong>und</strong><br />
definieren <strong>Vorurteile</strong> unter anderem in Rekurs auf Patricia Devine (1989), als eine<br />
Übereinstimmung mit bestehenden, negativ konnotierten <strong>Stereotype</strong>n, welche eine<br />
emotionale Reaktion auslösen.<br />
Innerhalb des Modells der labelling effects (vgl. Kapitel 2. <strong>und</strong> 3.) wird was die<br />
Bewertung von Personen einer bestimmten etikettierten sozialen Gruppe angeht,<br />
zwischen kognitiven <strong>und</strong> affektiven Komponenten differenziert. <strong>Vorurteile</strong><br />
repräsentieren die aktivierte affektive Reaktion auf eine bestimmte Gruppe bzw.<br />
ein bestimmtes Label <strong>und</strong> sind verantwortlich für die Sympathie, die der perceiver<br />
gegenüber dem target Objekt aufbringt. Also ob die Gruppe negativ assoziiert ist,<br />
d.h. nicht gemocht wird, oder ob positive Emotionen aktiviert werden <strong>und</strong> dies<br />
dazu führt, dass die bewertete Gruppierung positiv bewertet wird.<br />
Zusammenfassend bedeutet dies für das labelling Model, dass bestehende<br />
Emotionen bezüglich einer Gruppe in Form von <strong>Vorurteile</strong>n für die Bewertung<br />
einer Gruppe relevant sind. Gemäß diesem Modell haben <strong>Vorurteile</strong> die<br />
Eigenschaft emotionale Reaktionen bezüglich einer bestimmten Kategorie zu<br />
repräsentieren (vgl. Jussim, Manis, Nelson & Soffin, 1995, S. 229f.).<br />
Wie bereits erwähnt sind <strong>Vorurteile</strong> per se nicht negativ. Jedoch verwenden<br />
einige AutorInnen wie etwa Christian Crandall <strong>und</strong> Amy Eshleman (2003) eine<br />
Vorurteilsdefinition, welche die in <strong>Vorurteile</strong>n steckenden negativen Evaluationen<br />
sozialer Gruppen <strong>und</strong> deren Angehörigen fokussiert. Die Existenz positiver<br />
<strong>Vorurteile</strong> wird damit keineswegs bestritten, jedoch hätten diese weniger Relevanz<br />
für die meisten wissenschaftlichen Fragestellungen, was sich auch im spärlichen<br />
Vorkommen von Literatur bezüglich positiver <strong>Vorurteile</strong> ausdrückt (vgl. Crandall &<br />
Eshleman, 2003, S. 414). Der Autor schließt sich einer gr<strong>und</strong>sätzlichen<br />
25
Negativdefinition an, da diese im Kontext der <strong>Stigma</strong>tisierung psychisch Kranker<br />
relevanter ist.<br />
Eine wichtige Unterscheidungsdimension innerhalb des Vorurteilskonzeptes stellt<br />
die Differenzierung zwischen expliziten <strong>und</strong> impliziten <strong>Vorurteile</strong>n dar. Leanne Son<br />
Hing, Greg Chung-Yan, Leah Hamilton <strong>und</strong> Mark Zanna (2008) entwickelten auf<br />
Gr<strong>und</strong>lage dieser Differenzierung das 2-dimensional model of prejudices.<br />
Historisch betrachtet wurden <strong>Vorurteile</strong> als bewusst <strong>und</strong> explizit charakterisiert. In<br />
neueren Forschungen werden implizite bzw. latente <strong>Vorurteile</strong> fokussiert. Diese<br />
werden durch automatisch aktivierte negative Assoziationen mit bestimmten<br />
Gruppierungen bestimmt. Im zwei-dimensionalen Modell stehen sich also<br />
<strong>Vorurteile</strong> bewusster <strong>und</strong> automatisch unbewusster Natur gegenüber. Außerdem<br />
liegt diesem Modell die Annahme zu Gr<strong>und</strong>e, dass das Wesen von <strong>Vorurteile</strong>n von<br />
Individuum zu Individuum stark differiert, d.h. es eine große Spannweite bezüglich<br />
der Natur von <strong>Vorurteile</strong>n gibt. Jedoch können vier charakteristische Gruppen von<br />
Vorurteilstypen identifiziert werden. Diese lauten (1) aversive racists, (2) principled<br />
conservatives, (3) modern racists <strong>und</strong> (4) truly low in prejudice. Wobei modern<br />
racists <strong>und</strong> principlied conservatives, als Vorurteilformen gesehen werden, die im<br />
politisch konservativen Millieu angesiedelt werden. Während aversiv racists <strong>und</strong><br />
truly low in prejudice bei politisch liberalen Personen verortet werden können (vgl.<br />
Son Hing, Chung-Yan, Hamilton & Zanna, 2008, S. 971ff.).<br />
Moderner Rassismus bezeichnet eine Art von rassistischen <strong>Vorurteile</strong>n, die im<br />
bürgerlichen Millieu vorkommen <strong>und</strong> dadurch gekennzeichnet sind, dass<br />
rassistische <strong>Vorurteile</strong> nicht direkt geäußert werden <strong>und</strong> wenig eindeutig sichtbar<br />
sind. Diese Form kommt, wie bereits erwähnt bei Menschen mit traditionellen<br />
Werten vor. Aversiver Rassismus ist ein auf Samuel Gaertner <strong>und</strong> John Dovidio<br />
zurückgehendes Konzept, welches eine Vorurteilform beschreibt, die bei<br />
Menschen mit liberalen Glaubenssätzen vorkommt. Dabei geht es um den inneren<br />
Konflikt bei Menschen, die einerseits egalitäre Werte internalisiert haben, jedoch<br />
trotz ihrer bewusst vorurteilsfreien Haltung, unbewusst negative Emotionen<br />
gegenüber Personen anderer Rassen haben. Diese Gefühle sind allerdings<br />
unbewusst, weshalb sich die vorhanden impliziten <strong>Vorurteile</strong> nur äußerst subtil<br />
zeigen (vgl. Nail, Decker & Harton, 2003, S. 754f.). <strong>Vorurteile</strong> können auch als<br />
Konsequenz von prinzipiellem Konservatismus auftauchen. Außerdem besteht die<br />
26
Möglichkeit, dass Menschen eine tatsächlich auch implizit geringe Ausprägung in<br />
<strong>Vorurteile</strong>n haben (vgl. Son Hing, Chung-Yan, Hamilton & Zanna, 2008, S. 971ff.).<br />
Zudem postulieren die AutorInnen, die Beziehung der einzelnen Vorurteilstypen<br />
zu bestimmten Ideologien bzw. Welthaltungen. Also wie hoch einzelne Vorurteils-<br />
Typen in einer Person ausgeprägt sind, hängt somit auch mit der Zustimmung zu<br />
bestimmten Ideologien zusammen. Dazu wurden drei unterschiedliche Gruppen<br />
bezüglich ihrer Werthaltungen gebildet <strong>und</strong> deren Zustimmung erfragt. Dabei<br />
konnten Effekte identifiziert werden, die den Einfluss der Anhängerschaft zu<br />
bestimmten Ideologien belegen konnten, was sich zudem auf den Gebrauch ex-<br />
<strong>und</strong> impliziter Vorurteilsformen auswirkt (vgl. Son Hing, Chung-Yan, Hamilton &<br />
Zanna , 2008, S. 976f.).<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Konzept des Vorurteils<br />
bezüglich der Funktion (vgl. Sherman, Stroessner, Conrey & Azam, 2005, S. 607),<br />
sowie deren Bewertung als positiv oder negativ (vgl. Crandall & Eshleman, 2003,<br />
S. 414) unterschiedlich definiert wird. Außerdem können <strong>Vorurteile</strong> in ihrer<br />
Typologie unterschieden, sowie als von generellen Werthaltungen abhängig<br />
angesehen werden (vgl. Son Hing, Chung-Yan, Hamilton & Zanna , 2008, S.<br />
971ff.). Ebenfalls gilt es dem engen Verhältnis zwischen <strong>Vorurteile</strong>n <strong>und</strong> dem<br />
Konzept der <strong>Stereotype</strong> Rechnung zu tragen (vgl. Sherman, Stroessner, Conrey &<br />
Azam, 2005, S. 607), wobei die Komponente der Emotionalität bzw. Affektivität bei<br />
<strong>Vorurteile</strong>n, insbesondere für die Bewertung anderer, ein wichtiges<br />
Charakteristikum darstellt (vgl. Jussim, Manis, Nelson & Soffin, 1995, S. 229f.).<br />
4.1 <strong>Vorurteile</strong> bezüglich psychisch Kranker<br />
Ausgehend von einer Vorurteilsdefinition, welche diese als Übereinstimmung mit<br />
negativen <strong>Stereotype</strong>n bestimmt, wie etwa von Patricia Devine (1989)<br />
vorgeschlagen, sollen in diesem Abschnitt Auffassungen thematisiert werden, mit<br />
denen in der Bevölkerung Übereinstimmung herrscht. Dazu untersuchten Arthur<br />
Crisp <strong>und</strong> Co-AutorInnen (2000) in einer repräsentativen Erhebung mit n=2679<br />
Personen im Alter ab 16 Jahren in Großbritannien die bestehenden Meinungen<br />
bzw. Einstellungen gegenüber Menschen mit einer psychischer Krankheit. Die<br />
27
Befragten sollten neben soziodemographischen Daten, ihre Meinung über<br />
Menschen mit psychischen Krankheiten angeben. Diese Fragen wurden aus<br />
Themen entlehnt, welche auf der bereits im Kapitel <strong>Stereotype</strong> bezüglich<br />
psychisch Kranker erwähnten Studie von Peter Hayward <strong>und</strong> Jenifer Bright (1997)<br />
basieren. Diese Themen lauten: (1) Gefährlichkeit; (2) schwierige<br />
Gesprächspartner, (3) können nur sich selber etwas vorwerfen; (4)<br />
Unberechenbarkeit; (5) können sich zusammenreißen; (6) haben eine schlechte<br />
Prognose <strong>und</strong> (7) sprechen schlecht auf Behandlung an (Hayward & Bright zit.<br />
nach Crisp et al., 2000, S. 4f.).<br />
Daraus bildeten Arthur Crisp <strong>und</strong> KollegInnen (2000) 8 Skalen nämlich : (1)<br />
danger to others, (2) unpredictable, (3) hard to talk to, (4) feel different, (5) selves<br />
to blame, (6) pull self together, (7) not improved if treated <strong>und</strong> (8) never recover.<br />
Jene Skalen wurden für 7 verschiedene psychische Störungen abgefragt. Die<br />
verwendeten Störungen lauteten (1) Depressionen, (2) Panikattacken, (3)<br />
Schizophrenie, (4) Demenz, (5) Essstörungen, (6) Alkoholabhängigkeit, <strong>und</strong> (7)<br />
Drogensucht. Beantwortet wurden die Items auf einer fünf-stufigen Skala, die<br />
zwischen zwei Extremen rangiert, wie z.B. gefährlich- nicht gefährlich. Für diese<br />
Untersuchung interessant waren allerdings jene Befragte, die mit negativen<br />
Einstellungen Übereinstimmung angaben, also auf der Skala die beiden Werten<br />
ab dem mittleren Punkt in Richtung z.B. gefährlich wählten (vgl. Crisp et al., 2000,<br />
S. 4f.).<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass die Übereinstimmung mit bestimmten negativen<br />
Ansichten über psychisch kranke Menschen stark von deren jeweiligen Diagnose<br />
abhängt. Es konnte etwa gezeigt werden, dass Menschen die unter<br />
Alkoholabhängigkeit, Drogensucht oder Schizophrenie leiden, von 70% als<br />
gefährlich für andere eingeschätzt werden <strong>und</strong> sogar von 80% als unberechenbar.<br />
Menschen mit einer Depression wurden von 62% als schwierig im Gespräch<br />
beurteilt <strong>und</strong> 19% gaben an, dass depressive Menschen sich zusammennehmen<br />
könnten. Insgesamt 23% halten depressive Menschen zudem für gefährlich. Mit<br />
Ausnahme von Demenzerkrankten, werden Menschen mit psychischen Störungen<br />
nicht als unheilbar angesehen, sondern bekommen von den Befragten<br />
optimistische Prognosen zugesprochen. Insgesamt kann jedoch gesagt werden,<br />
dass abhängig von der jeweiligen Erkrankung negative Ansichten bezüglich<br />
28
psychisch kranker Menschen herrschen, was besonders deutlich bei der<br />
Gefahreneinschätzung bezüglich psychisch kranker Menschen sichtbar wird <strong>und</strong><br />
sich zudem stark auf die schizophrene Erkrankung konzentriert. Für diese<br />
Fehleinschätzung machen die AutorInnen auch medial vermittelte Meinungen <strong>und</strong><br />
Bilder von psychisch Kranken verantwortlich <strong>und</strong> bezeichnen diese übermittelten<br />
Darstellungen als stigmatisierend (vgl. Crisp et al., 2000, S. 5f.). Für diese Arbeit<br />
bedeutend ist, dass in dieser Studie Zustimmung zu negativen <strong>Stereotype</strong>n zu<br />
erheben versucht wurde <strong>und</strong> somit gemäß der Definition von Patricia Devine<br />
(1989) auf diesem Wege diese als <strong>Vorurteile</strong> identifiziert werden können. Da die<br />
Zustimmung mit den verwendeten Annahmen von Störungsbild zu Störungsbild<br />
stark divergieren, sollen für den weiteren Verlauf dieser Arbeit nur die Annahmen<br />
verwendet werden, welche die stärkste negative Zustimmung bekommen haben,<br />
da diese am repräsentativsten für psychische Krankheiten generell sind. Dazu<br />
zählen die Annahmen psychisch kranke Menschen seien gefährlich,<br />
unberechenbar <strong>und</strong> schwierig als Partner in einer verbalen Kommunikation (vgl.<br />
Crisp et al., 2000, S.4ff.).<br />
Auch der affektiven Komponente von <strong>Vorurteile</strong>n (vgl. Devine, 1989, S. 5)<br />
bezüglich psychisch kranker Personen soll kurz anhand des Beispiels des<br />
Attributes der Gefährlichkeit von Menschen mit einer psychischen Erkrankung<br />
Rechnung getragen werden. Dabei ist das Gefühl bzw. die affektive Reaktion der<br />
Angst die emotionale Komponente dieses Vorurteils (vgl. Corrigan & Rüsch, 2002,<br />
S. 317). Im folgenden Kapitel sollen Zusammenhänge dieser Art noch näher<br />
erläutert werden.<br />
5 <strong>Stereotype</strong>, <strong>Stigma</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong><br />
In diesem Kapitel sollen die Konzepte des <strong>Stigma</strong>s, der <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong><br />
miteinander verb<strong>und</strong>en werden. Es soll um eine systematische Darstellung gehen,<br />
inwieweit diese Modelle verknüpft sind <strong>und</strong> wie deren Zusammenwirken erklärt<br />
wird. Dazu werden Modelle vorgestellt, in denen die Interdependenz dieser<br />
Konzepte deutlich wird. Diese Modelle werden sich überwiegend konkret auf die<br />
Differenzkategorie der psychisch kranken Menschen beziehen. Einige Theorien<br />
sind in vorherigen Kapiteln bereits kurz beschrieben worden. Hier werden diese<br />
29
nochmals detaillierter beleuchtet <strong>und</strong> auf psychisch kranke Menschen bezogen.<br />
Es soll also um eine Art Synopsis der einzelnen Ansätze gehen.<br />
In der Zwei-Faktoren-Theorie von <strong>Stigma</strong> wird die <strong>Stigma</strong>tisierung psychisch<br />
kranker Menschen in drei Komponenten unterteilt, die emotionale, kognitive <strong>und</strong><br />
die des Verhaltens. Die kognitive Komponente wirkt in Form von <strong>Stereotype</strong>n,<br />
wohingegen der emotionale Aspekt durch <strong>Vorurteile</strong> manifestiert wird. Die dritte<br />
Komponente der <strong>Stigma</strong>tisierung zeigt sich auf der Ebene des Verhaltens. Die<br />
Verhaltenskomponente wirkt als Diskriminierung bzw. diskriminierendes Verhalten.<br />
Doch wie wirken diese drei Komponenten zusammen? In diesem Modell fungieren<br />
<strong>Stereotype</strong> als negative Meinung bezüglich einer bestimmten Kategorie. Das in<br />
diesem Modell verwendete Konzept der <strong>Stereotype</strong> gibt allerdings noch nicht an,<br />
ob Übereinstimmung mit dieser negativen Meinung herrscht oder nicht. Herrscht<br />
jedoch Übereinstimmung <strong>und</strong> ist diese mit einer negativen emotionalen Reaktion<br />
verb<strong>und</strong>en, so wird in diesem Modell von einem Vorurteil gesprochen.<br />
Diskriminierung ist eine, sich aus einem Vorurteil ergebende Reaktion auf der<br />
Verhaltenebene (vgl. Rüsch, Finzen, Berger & Angermeyer, 2004, S.4-5).<br />
Die Zwei-Faktoren-Theorie differenziert zudem zwischen öffentlicher- <strong>und</strong><br />
Selbststigmatisierung. Ein konkretes Beispiel, bezogen auf das <strong>Stigma</strong><br />
psychischer Erkrankung, soll an dieser Stelle illustrieren wie dieses Modell<br />
funktioniert.<br />
Gegeben ist das Wissen über das Stereotyp der Inkompetenz. Dieses kann in der<br />
Öffentlichkeit oder bei einer betroffenen Person selbst liegen. Bei Zustimmung zu<br />
dieser Ansicht kann in der Öffentlichkeit das Gefühl des Ärgers entstehen. Stimmt<br />
eine psychisch kranke Person selbst mit diesem Stereotyp überein, kann dieses<br />
gegen sich selbst gerichtete Vorurteil zu einem Gefühl von geringer<br />
Selbstwirksamkeit oder geringem Selbstwert führen. Auf der Ebene des<br />
Verhaltens kann es von Seiten der Gesellschaft zu diskriminierendem Verhalten,<br />
etwa in Form von Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Suche nach<br />
einer Unterkunft führen. Als Verhaltensreaktion eines Betroffenen kann es zu<br />
Aufgabe bei der Job- oder Wohnungssuche kommen (vgl. Rüsch, Finzen, Berger<br />
& Angermeyer, 2004, S.4).<br />
Bruce Link <strong>und</strong> Jo Phelan (2001) entwerfen eine ähnliche Theorie des Ablaufs<br />
von <strong>Stigma</strong>tisierungsprozessen, wobei einige Akzente anders gesetzt werden. So<br />
30
ezieht sich dieser Ansatz auf, von der Gesellschaft ausgehende <strong>Stigma</strong>tisierung,<br />
also dem public stigma. Wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, erfolgt der<br />
<strong>Stigma</strong>tisierungsprozess in vier aufeinander aufbauenden Schritten. Zu Beginn<br />
steht die Identifikation von Andersartigkeit bestimmter Personen. Diese Differenz<br />
wird dann durch eine bestimmte Bezeichnung zu einer Etikette. Im zweiten Schritt<br />
werden die <strong>Stereotype</strong> wirksam; die etikettierte Gruppe wird nun mit negativen<br />
<strong>Stereotype</strong>n assoziiert, in denen kulturelle Wertvorstellungen ihren Ausdruck<br />
finden. Im vierten Schritt wird dann eine Separierung der einen Gruppe im<br />
Kontrast zu anderen vollzogen. Zuletzt führt dies zu Statusverlust <strong>und</strong><br />
Diskriminierung (vgl. Link & Phelan, 2001, S. 366f.). An dieser Stelle soll die<br />
Tragweite dieses Konzeptes in Bezug auf die funktionale Definition von<br />
<strong>Stereotype</strong>n, <strong>Vorurteile</strong>n <strong>und</strong> <strong>Stigma</strong>tisierung, bearbeitet werden. Jenseits von rein<br />
kognitiven Definitionen bekommen die drei Konzepte <strong>Stigma</strong>, <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Vorurteile</strong> bei Bruce Link <strong>und</strong> Jo Phelan (2001) eine wichtige Bedeutung im<br />
Gefüge gesellschaftlicher Machtverhältnisse. So wird postuliert, dass die<br />
Ausübung von <strong>Stigma</strong>tisierung <strong>und</strong> damit auch die Bildung bzw. Entwicklung<br />
spezifischer <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> 1 unmittelbar mit dem Zugang zu<br />
ökonomischer, politischer <strong>und</strong> sozialer Macht verb<strong>und</strong>en ist. Pointierter formuliert<br />
ist die Entwicklung <strong>und</strong> der Gebrauch der drei Konzepte nur durch ein<br />
Machtgefälle der einen Gruppe gegenüber einer anderen möglich, wobei Macht<br />
verschiedenste Bereiche betreffen kann. Abweichungen zu identifizieren <strong>und</strong> zu<br />
benennen, sowie <strong>Stereotype</strong> zu konstruieren <strong>und</strong> zu gebrauchen, sowie diese für<br />
Exklusion <strong>und</strong> Separation nutzbar zu machen ist abhängig von Macht (vgl. Link &<br />
Phelan, 2001, S. 367).<br />
Diese Ansicht korrespondiert mit anderen Definitionsansätzen, die z.B.<br />
<strong>Stereotype</strong> als sozial funktional ansehen <strong>und</strong> ihren Charakter als Rechtfertigung<br />
für Exklusion <strong>und</strong> Schaffung von outgroups (Tajfel zit. nach Jonas, 2002, S. 9)<br />
betonen. Für diese Arbeit relevant ist der Ansatz von Bruce Link <strong>und</strong> Jo Phelan<br />
(2001) unter anderem deshalb, weil hier der stigmatisierende Charakter von<br />
<strong>Stereotype</strong>n <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong>n im Zentrum steht. In Rekurs auf die Forschungsfrage<br />
ist die postulierte Auffassung von <strong>Stereotype</strong>n, dem Begriff des<br />
stigmatisierenden <strong>Stereotype</strong>s entsprechend. Hier wird nämlich der Begriff des<br />
1 <strong>Vorurteile</strong> werden nicht explizit genant, doch sind durch die Inklusion von Emotionen in diesem<br />
Modell repräsentiert (vgl. Jussim, Manis, Nelson & Soffin, 1995, S.229f.).<br />
31
negativen <strong>Stereotype</strong>n als Teil <strong>und</strong> wesentlicher Bestandteil des<br />
<strong>Stigma</strong>tisierungsprozesses verstanden (vgl. Link & Phelan, 2001, S. 367).<br />
Auch <strong>Vorurteile</strong> verstanden als negative Evaluation von Gruppen, wie unter<br />
anderem von Christian Crandall <strong>und</strong> Amy Eshleman (2003) postuliert, sind Teil<br />
des <strong>Stigma</strong>tisierungsprozesses gegenüber psychisch kranken Menschen (vgl.<br />
Rüsch, Finzen, Berger & Angermeyer, 2004, S. 4f.). Dies wird zudem an der<br />
Vorurteilsdefinition, welche <strong>Vorurteile</strong> als Übereinstimmung mit negativen<br />
<strong>Stereotype</strong>n begreift, deutlich (vgl. Rüsch, Finzen, Berger & Angermeyer, 2004, S.<br />
4f.). Aufgr<strong>und</strong> dieser Beteiligung von <strong>Vorurteile</strong>n an der <strong>Stigma</strong>tisierung psychisch<br />
Kranker bzw. der Gruppe der psychisch Kranken, wird in dieser Arbeit von der<br />
Existenz stigmatisierender <strong>Vorurteile</strong> ausgegangen. Auch in anderen<br />
Forschungen ist die Arbeitsdefinition des Vorurteils als Negativum weit verbreitet<br />
(vgl. Crandall & Eshleman, 2003, S. 414).<br />
An den verschiedenen Modellen wird die enge Beziehung <strong>und</strong> das<br />
Zusammenwirken der drei Konzepte Stereotyp, <strong>Stigma</strong> <strong>und</strong> Vorurteil deutlich.<br />
Auch wenn Abgrenzungen <strong>und</strong>urchsichtig <strong>und</strong> wenig eindeutig erscheinen (vgl.<br />
Jonas, 2002, S. 6) wird in dieser Arbeit, auf der Ebene der Theorie, von einem<br />
synonymen Gebrauch dieser Begriffe Abstand genommen. Für den empirischen<br />
Gebrauch dieser Konzepte, in der medialen Erhebung, wird jedoch auf einen<br />
synonymen Gebrauch zurückgegriffen.<br />
6 Massenmedien <strong>und</strong> deren Einfluss<br />
6.1 Einfluss von Massenmedien generell<br />
Der Einfluss von Medien auf die Wahrnehmung <strong>und</strong> Meinungsbildung in der<br />
Gesellschaft ist sehr groß. Dabei ist neben den traditionellen Medien wie<br />
Fernsehen <strong>und</strong> Radio auch das Internet zu einem bedeutenden Einflussfaktor<br />
herangewachsen. Die klassischen Medien weiten ihr Angebot bzw. ihre<br />
Reichweite durch Online-Angebote weiter aus. Der Fernsehkonsum nimmt trotz<br />
des Internets einen großen Raum im medialen Konsum in westlichen Ländern ein.<br />
Der durchschnittliche Fernsehkonsum pro Tag beträgt in den meisten<br />
32
Industrieländern mehrere St<strong>und</strong>en (vgl. Cuenca, 2001, S. 527). In Österreich<br />
beträgt der tägliche Fernsehkonsum bei Personen ab 10 Jahren durchschnittlich<br />
2:30 St<strong>und</strong>en (vgl. STATISTIK AUSTRIA, Zeitverwendungserhebung 2008/2009).<br />
Es wird davon ausgegangen, dass lediglich 20% der aufgenommenen Information<br />
erinnert werden. Aus diesem erinnerten Prozentsatz werden Einstellungen,<br />
Meinungen <strong>und</strong> Wahrnehmungsmuster auf Seiten der Konsumenten gebildet.<br />
Dadurch wird der mediale Einfluss zu einem wesentlichen Sozialisationsfaktor<br />
bezüglich Wahrnehmungsmuster, der die Bedeutung des familiären Einflusses<br />
<strong>und</strong> des individuellen Wissens, sowie individueller Erfahrung zu übersteigen<br />
beginnt (vgl. Cuenca, 2001, S. 527). Dies konnte auch empirisch belegt werden. In<br />
einer von der Glasgow Media Group veröffentlichten Studie konnte gezeigt<br />
werden, dass trotz persönlicher Erfahrung mit einer bestimmten sozialen<br />
Gruppierung medial transportierte Bilder einer Gruppe stärkeren Einfluss auf die<br />
persönliche Einstellung haben können als persönlich Erlebtes (vgl. Philo zit. nach<br />
Philo, 1997, S. 171). Auf diese Studie soll an späterer Stelle noch näher<br />
eingegangen werden.<br />
Innerhalb des Diskurses über den Einfluss von Massenmedien auf Einstellung<br />
<strong>und</strong> Verhalten nehmen zwei Theorien eine bedeutende Stellung ein. Zum einen<br />
die cultivation theory <strong>und</strong> die social learning theory (vgl. Stout, Villegas &<br />
Jennings, 2004, S. 544). In der cultivation theory wird davon ausgegangen, dass<br />
die tatsächliche Realität stark von der medial vermittelten Wirklichkeit beeinflusst<br />
wird. Konkret wird angenommen, dass die Wahrnehmung der<br />
TelevisionsrezipientInnen dahingehend beeinflusst wird, dass das Erleben der<br />
äußeren Welt den Schemata <strong>und</strong> Werten der fiktional-medialen Welt angepasst<br />
wird. Dieser Effekt steigt mit der Häufigkeit des Fernsehkonsums an (vgl. Gerbner<br />
zit. nach Stout, Villegas & Jennings, 2004, S. 544).<br />
In der Theorie des sozialen Lernens wird postuliert, dass Lernen nicht nur durch<br />
direkte Erfahrung, sondern auch durch Beobachtung vollzogen wird. Auch beim<br />
Beobachten medialer Inhalte wird viel über kulturelle Umgangsformen vermittelt.<br />
Durch das Fernsehen können also Handlungsanweisungen in bestimmten<br />
sozialen Situationen vermittelt werden, welche dann im realen Leben ihre Wirkung<br />
entfalten (vgl. Bandura zit. nach Stout, Villegas & Jennings, 2004, S. 544).<br />
33
Medien erfüllen häufig die Funktion als primäre Informationsquelle. Wenn keine<br />
persönlichen Erfahrungen <strong>und</strong> nur wenig Wissen über bestimmte Lebensbereiche<br />
oder Gruppen bei einem Individuum bestehen, so fungieren Massenmedien als<br />
erste Informationsquelle. Dadurch haben diese die Macht Vorstellungen <strong>und</strong><br />
Konzepte über Gruppen aufzubauen <strong>und</strong> haben darüber hinaus durch ihre<br />
Berichterstattung die Gewalt, zu definieren was als „normal“ anzusehen ist <strong>und</strong><br />
was nicht (vgl. Davis & Baron zit. nach Lloyd, 2002, S. 74). Somit können<br />
Massenmedien diskriminierende Wirkung haben <strong>und</strong> fungieren in manchen Fällen<br />
sogar als Quelle negativer <strong>Stereotype</strong> (vgl. Angermeyer & Schulze, 2001, S. 3)<br />
<strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> bezüglich bestimmter Gruppierungen (vgl. Cuenca, 2001, S. 527).<br />
6.2 Massenmedien <strong>und</strong> die Gruppe der psychisch Kranken<br />
Massenmedien evozieren Interesse an bestimmten Gruppen <strong>und</strong> formen deren<br />
Wahrnehmung in der Bevölkerung. So ist auch die Gruppe der psychisch kranken<br />
Menschen Teil der medialen Thematisierung (vgl. Cuenca, 2001, S. 527). Darüber<br />
hinaus können Medien als Hauptinformationsquelle über psychische Krankheiten<br />
angesehen werden (vgl. Borinstein zit. nach Wilson, Nairn, Coverdale & Panapa,<br />
1999, S. 232).<br />
In der bereits unter Kapitel 6.1. erwähnten Studie von Greg Philo wurde der Inhalt<br />
von Printmedien, Fernsehsendungen <strong>und</strong> Filmen <strong>und</strong> deren Zusammenhang mit<br />
Einstellungen einzelner gegenüber psychisch kranken Menschen untersucht.<br />
Dabei kamen die Methoden der Inhaltsanalyse, sowie Fokusgruppeninterviews<br />
zum Einsatz. Es konnte gezeigt werden, dass falsche Glaubenssätze bezüglich<br />
psychisch kranker Personen zum Teil direkt auf deren mediale Darstellung<br />
zurückzuverfolgen sind. Außerdem werden Emotionen, die mit fiktionalen<br />
filmischen Figuren verb<strong>und</strong>en sind, auch im tatsächlichen Leben wirksam. So<br />
werden beispielsweise Analogieschlüsse zwischen psychisch kranken<br />
Charakteren aus Filmen oder Serien mit tatsächlich erkrankten Menschen<br />
gezogen. Zudem konnte, wie bereits erwähnt, festgestellt werden, dass direkt auf<br />
mediale Darstellung rückführbare Einstellungen gegenüber psychisch kranken<br />
Menschen persönliche Erfahrungen in Punkto Einfluss übertrifft. Die ProbandInnen<br />
machten zuvor nämlich mehrere Besuche in einem psychiatrischen Krankenhaus<br />
34
<strong>und</strong> standen in einem direkten Austausch mit Erkrankten. Zusammengefasst kann<br />
gesagt werden, dass medial generierte Bilder über psychisch kranke Menschen<br />
einen großen Einfluss auf die Einstellung der Gesellschaft gegenüber dieser<br />
Gruppe hat. (vgl. Philo zit. nach Philo, 1997, S. 171f.). Wie diese Darstellung<br />
genau aussieht soll im nächsten Abschnitt genauer beleuchtet werden.<br />
6.2.1 Mediale Darstellung psychisch kranker Menschen<br />
Die Darstellung psychisch kranker Menschen in Massenmedien kann generell als<br />
negativ angesehen werden (vgl. Gerbner zit. nach Wilson, Nairn, Coverdale &<br />
Panapa, 1999, S. 232). Dazu untersuchten Clair Wilson, Raymond Nairn, John<br />
Coverdale <strong>und</strong> Aroha Panapa (1999) die Darstellung psychisch Kranker in<br />
Fernsehsendungen, die zur Hauptsendezeit (19:00-22:30) in den Jahren<br />
1995/1996 in Neuseeland ausgestrahlt wurden. Für die Analyse wurden insgesamt<br />
14 Folgen verschiedener Serien herangezogen in denen psychisch kranke<br />
Charaktere auftreten. Als psychisch krank identifizierten die AutorInnen<br />
Protagonisten, die von anderen Charakteren so bezeichnet werden, deren<br />
psychiatrische Vorgeschichte thematisiert wird, Personen denen eine konkrete<br />
psychiatrische Diagnose zugesprochen wird oder ohne direkte Diagnose in der<br />
Serie als psychisch krank klassifiziert werden. In den 14 untersuchten Serien<br />
konnten 20 Charaktere als psychisch krank identifiziert werden. Davon waren 11<br />
männlich <strong>und</strong> 9 weiblich. Als gefährlich bzw. aggressiv konnten 15 von 20<br />
Charakteren ausfindig gemacht werden. Das Merkmal der Kindlichkeit wurde von<br />
14 Charakteren erfüllt. Auch das Stereotyp der Unberechenbarkeit konnte bei 12<br />
der 20 ProtagonistInnen identifiziert werden. Des Weiteren wurden 12 Charaktere<br />
als unproduktiv, 9 als asozial, weitere 9 als vulnerabel, sowie 6 als gefährlich-<br />
inkompetent, dargestellt. Darüber hinaus erfüllten 6 die Kriterien einer Darstellung<br />
als vertrauensunwürdig, 6 als behütend <strong>und</strong> emphatisch, sowie 4 als social<br />
outcasts. Eine wesentliche Aussage dieser Studie ist, dass die Darstellung<br />
psychisch kranker ProtagonistInnen in diesem Sample, als äußerst negativ<br />
angesehen werden kann. Dabei stehen angstauslösende Attribute, wie z.B.<br />
Gefährlichkeit <strong>und</strong> Unberechenbarkeit, <strong>und</strong> Darstellungen von Abnormalität, sowie<br />
35
Fokussierung von Differenzen zur Normalität im Vordergr<strong>und</strong> (vgl. Wilson, Nairn,<br />
Coverdale & Panapa, 1999, S. 232ff.)<br />
Einige Ergebnisse dieser Studie weichen den AutorInnen zu Folge von Resultaten<br />
anderer Studien ab. Dies sei allerdings durch die Wahl des untersuchten Mediums<br />
zu erklären. In vielen Studien ist sich der Darstellung psychisch Kranker in Filmen<br />
gewidmet worden <strong>und</strong> nicht wie in diesem Fall in Fernsehserien (vgl. Wilson,<br />
Nairn, Coverdale & Panapa, 1999, S. 237).<br />
Eine vergleichbare Studie untersuchte die Darstellung von psychisch kranken<br />
Charakteren im neuseeländischen Kinderfernsehen. Gegenstand der<br />
Medienanalyse waren Kinderserien, deren angegebene Zielgruppe Kinder unter<br />
10 Jahren sind. Insgesamt fielen 128 Episoden von Kinderserien, die innerhalb<br />
einer Woche gesendet wurden, in das Sample. Es konnten 6 ProtagonistInnen als<br />
psychisch kranke Figuren definiert werden. Von den sechs als psychisch krank<br />
identifizierten Charakteren hatten drei die Rolle eines Bösewichtes <strong>und</strong> weitere<br />
drei die einer Witzfigur. Zudem waren alle Figuren männlichen Geschlechts. Die<br />
Darstellungsdichotomie von Bösewicht <strong>und</strong> Witzfigur kann als äußerst stereotyp<br />
bezeichnet werden. Die psychisch kranken Figuren fungieren als Objekte von<br />
Spott oder Auslöser von Angst (vgl. Wilson, Nairn, Coverdale & Panapa, 2000, S.<br />
440ff.).<br />
Die vorgestellten Studien stützen die Annahme negativer <strong>und</strong> stereotyper<br />
Darstellung psychisch kranker Menschen in den Medien. Welche Effekte diese<br />
Darstellungsform für die Betroffenen haben kann, soll im nächsten Abschnitt näher<br />
erläutert werden.<br />
6.2.2 Bedeutung der medialen Darstellung für psychisch kranke Menschen<br />
Im Zusammenhang mit der <strong>Stigma</strong>tisierung psychisch kranker Menschen hat es<br />
Untersuchungen gegeben wie sich filmische Darstellungen auf das Verhalten der<br />
RezepientInnen auswirken können. Ines Winkler <strong>und</strong> KollegInnen (2008)<br />
fokussieren ihre Untersuchung auf die Effekte filmischer Darstellungen hinsichtlich<br />
des Bedürfnisses nach sozialer Distanz. Dazu wurden in einem Vorher-Nachher-<br />
Design Einstellungen gegenüber psychisch kranken Personen erhoben. Das<br />
36
Vorher- Nachher- Design bezieht sich auf den Besuch des Filmfestivals<br />
AusnahmeIZustand. Innerhalb dieses, durch die B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland<br />
tourenden Festivals, wurden internationale Dokumentationen, die den<br />
Themenbereich psychischer Erkrankung behandeln, gezeigt. Die<br />
Einstellungsmessungen bezüglich des Wunsches nach sozialer Distanz wurden<br />
bei ProbandInnen vor dem Anschauen der Filme <strong>und</strong> nach deren Betrachtung<br />
erhoben. Neben soziodemographischen Daten wurde die Einstellung mittels<br />
sieben Items erhoben. Diese bestanden aus verschiedenen vorgestellten<br />
Situationen, wie etwa der Frage, ob der Befragte einem/einer psychisch Kranken<br />
eine Wohnung vermieten würde oder auf die eigenen Kinder aufpassen lassen<br />
würde. Diese Situationen mussten auf einer fünfstufigen Skale von ganz bestimmt<br />
bis überhaupt nicht beantwortet werden. Als Kontrollgruppe fungierte ein Sample<br />
von Personen die sich den Film Miami Vice angeschaut haben, einen Film, der<br />
nicht explizit das Thema der psychischen Erkrankung aufgreift (vgl. Winkler et al.,<br />
2008, S. 33ff.).<br />
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Ab- <strong>und</strong> Zunahme sozialer Distanz<br />
eine große Abhängigkeitsbeziehung zum filmischen Inhalt hat. Es konnte bei<br />
manchen Filmen ein Anstieg <strong>und</strong> bei anderen Filmen auch eine Reduktion der<br />
sozialen Distanz verzeichnet werden. Signifikante Ergebnisse konnten lediglich bei<br />
einer filmischen Darbietung festgestellt werden. Dies führen die Autoren jedoch<br />
auf die Zusammensetzung ihres Samples zurück. Die BesucherInnen des<br />
Festivals hatten ohnehin ein geringes Bedürfnis nach sozialer Distanz, was auch<br />
im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich wird. Außerdem kannten über 90% der<br />
Besucher des Filmfestivals jemanden mit einer psychischen Erkrankung oder<br />
waren bzw. sind selbst von psychischen Störungen betroffen (32,7%). Bei anderen<br />
Filmen konnten jedoch bei einzelnen Items sowohl signifikante Anstiege, als auch<br />
eine überzufällige Abnahme der sozialen Distanz beobachtet werden.<br />
Zusammenfassend kann über diese Studie gesagt werden, dass mediale<br />
Darbietungen des Themas psychische Erkrankung Einfluss auf die Einstellungen<br />
der RezipientInnen haben. Dieser Einfluss kann sich sowohl in Ab– als auch<br />
Zunahme an sozialer Distanz manifestieren. Aufgr<strong>und</strong> der zur Verfügung<br />
stehenden Stichprobe könnten die Effekte bei einem anderen Sampling noch<br />
deutlicher ausfallen (vgl. Winkler et al., 2008, S. 33ff.).<br />
37
In der Literatur wird der Einfluss von filmischen oder televisionären Darstellungen<br />
psychischer kranker Menschen unter anderem mit der cultivation theory <strong>und</strong> der<br />
Theorie des social learning erklärt. Die unter 6.1. bereits dargestellten Ansätze<br />
wurden von Patricia Stout, Jorge Villegas <strong>und</strong> Nancy Jennings (2004) konkret auf<br />
die Gruppe der psychisch kranken Menschen bezogen. Genauer gesagt die<br />
individuellen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Konsequenzen der medialen Darstellung<br />
psychisch Kranker. Im Sinne der cultivation theory verwenden Personen mit<br />
einem hohen Fernsehkonsum medial vermittelte Perspektiven in der<br />
Wahrnehmung <strong>und</strong> Bewertung psychisch kranker Mitmenschen. Dabei überformt<br />
das mediale Bild alle Begegnungen mit betroffenen Menschen. Gemäß der<br />
Theorie des sozialen Lernens vermitteln Medien <strong>und</strong> insbesondere das Medium<br />
Fernsehen, Verhaltensentwürfe gegenüber Menschen mit einer psychischen<br />
Erkrankung. Es werden sozial anerkannte Modelle präsentiert, welche<br />
Umgangsweisen gegenüber Menschen dieser Gruppe adäquat sind <strong>und</strong> zur<br />
gängigen Handlungsroutine werden können (vgl. Stout, Villegas & Jennings, 2004,<br />
S. 544).<br />
Die bisher vorgestellten Ansätze konzentrieren sich darauf, was die mediale<br />
Darstellung psychisch Kranker mit nicht betroffenen Personen macht. Allerdings<br />
kann die Darstellungsweise dieser Gruppe auch auf deren Mitglieder selbst direkte<br />
negative Auswirkungen <strong>und</strong> Konsequenzen haben. Negative mediale Darstellung<br />
der eigenen Gruppe kann nämlich auch zu Selbststigmatisierung führen.<br />
Betroffene Personen lehnen ihre Selbstdefinition an die medial vermittelten Bilder<br />
an. Außerdem antizipieren sie <strong>Stigma</strong>ta, die ihnen durch ihre Diagnose von<br />
Nachbarn oder Bekannten widerfahren können (vgl. Philo zit. nach Philo, 1997, S.<br />
172).<br />
7 Zusammenfassung <strong>und</strong> Überleitung zum Empirieteil<br />
Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden die Begrifflichkeiten bzw. Konzepte der<br />
<strong>Stereotype</strong>, <strong>Stigma</strong> <strong>und</strong> Vorurteil geklärt, deren Einbettung in psychologische<br />
Modelle dargestellt, sowie deren Verbindungen untereinander erläutert. Darüber<br />
hinaus wurde explizit festgehalten, was stigmatisierende <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong><br />
38
sind. Dazu wurden Studien herangezogen, welche mit zahlreichen <strong>Stereotype</strong>n<br />
<strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong>n gearbeitet haben <strong>und</strong> mittels Faktorenanalysen zentrale<br />
Hauptgruppen extrahieren konnten (vgl. Crisp et al., 2000, S. 4ff. ;Taylor & Dear,<br />
1981, S. 230ff.). Da es in dieser Arbeit um die Repräsentation stigmatisierender<br />
<strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> bezüglich psychisch kranker Menschen in Mainstream-<br />
Filmen <strong>und</strong> Fernsehserien geht, sollen nun aus den vorgestellten Studien einige<br />
<strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> extrahiert werden <strong>und</strong> Gegenstand der Medienanalyse<br />
sein. Dazu werden einzelne Kategorien als Indikator für das Vorhandensein dieser<br />
Darstellungsmuster fungieren. Darüber hinaus werden noch andere, nicht explizit<br />
in der wissenschaftlichen Literatur genannten <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong><br />
hinzugefügt <strong>und</strong> Gegenstand der Untersuchung sein. Es ergibt sich also eine<br />
Auswahl aus bereits von anderen Autoren erarbeiteten <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong>,<br />
sowie inhaltlich wenig bis gar nicht untersuchte Annahmen, deren<br />
Repräsentativität in den genannten Medien näher beleuchtet werden sollen. Das<br />
Vorkommen einiger <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> wird mittels quantitativer Kategorien<br />
erhoben <strong>und</strong> andere mit einer qualitativen Analyse der Serien <strong>und</strong> Filme. Auch<br />
qualitativ relevante Aspekte werden den quantitativen Kategorien ergänzend<br />
hinzugefügt. Hierzu folgt eine Übersicht der zur Untersuchung stehenden<br />
<strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> mit stigmatisierender Wirkung, die Gegenstand der<br />
folgenden Analyse sind.<br />
Die quantitativ zu erhebenden stigmatisierenden <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong>:<br />
1.) Gefährlichkeit<br />
2.) Inkompetenz<br />
3.) Unberechenbarkeit<br />
Diese <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> sind abgeleitet aus den Studien von Clair Wilson,<br />
Raymond Nairn, John Coverdale <strong>und</strong> Aroha Panapa, (1999), Martin Taylor <strong>und</strong><br />
Michael Dear (1981), Matthias Angermeyer <strong>und</strong> Herbert Matschinger (2004),<br />
sowie von Arthur Crisp <strong>und</strong> Kollegen (2000).<br />
4.) Abnormale Beziehung zu Liebe <strong>und</strong> Sexualität<br />
5.) Psychische Erkrankung führt zu geringer Lebensqualität<br />
6.) Psychisch kranke Menschen als Last für ihr Umfeld ( Reaktionen anderer)<br />
39
40<br />
7.) Psychisch kranke Menschen als unfrei <strong>und</strong> determiniert durch ihre<br />
Erkrankung<br />
Diese stigmatisierenden <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> sind nicht explizit aus der<br />
Literatur ableitbar <strong>und</strong> werden den gängigen Annahmen hinzugefügt.<br />
Die oben stehenden 9 <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> werden, wie bereits erwähnt,<br />
quantitativ durch zugeordnete Kategorien untersucht. Die jeweiligen<br />
Erhebungskategorien werden im empirischen Teil dieser Arbeit genau erläutert<br />
<strong>und</strong> begründend zugeordnet.<br />
Neben der quantitativen Analyse sollen weitere <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong><br />
untersucht werden. Diese werden jedoch durch eine qualitative Analyse erarbeitet<br />
<strong>und</strong> stellen eine wichtige Ergänzung zur statistischen Empirie dar. Außerdem sind<br />
diese explizit aus der Literatur abgeleitet.<br />
Qualitativ zu erhebende stigmatisierende <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong>:<br />
1.) Infantilität<br />
2.) Selbstschuld an der Erkrankung<br />
3.) Schwierige Gesprächspartner<br />
4.) Schlechte Prognose<br />
Diese <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> sind aus den Studien von Martin Taylor <strong>und</strong><br />
Michael Dear (1981), sowie von Arthur Crisp <strong>und</strong> Kollegen (2000) abgeleitet.<br />
Alle in dieser Arbeit verwendeten stigmatisierenden <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong><br />
stellen lediglich eine Auswahl aus einer Vielzahl bestehender negativer Annahmen<br />
über psychisch kranke Menschen dar. Gemeinsam haben diese jedoch, dass sie<br />
potenziell stigmatisierend sein können <strong>und</strong> negative Folgen für die betroffene<br />
Gruppe implizieren.<br />
Über die bisherigen Untersuchungsgegenstände hinaus soll in dieser<br />
Forschungsarbeit eine weitere Kategorie untersucht werden. Es handelt sich um<br />
die Kategorie der narrativen Perspektive. Von der Untersuchung dieser Kategorie<br />
wird sich erwartet, Informationen darüber zu erhalten, inwieweit psychisch kranke<br />
ProtagonistInnen als Anschauungsobjekte in den besagten Medien dargestellt<br />
werden. Die leitende Hypothese hinter dieser Kategorie fokussiert, inwieweit<br />
einem Bedürfnis nach Distanz auf Seiten der Medienkonsumenten Rechnung
getragen wird, wobei die Kategorie Subjektperspektive als Antagonie zur<br />
Objektdarstellung fungiert.<br />
Die Identifikation eines Charakters erfolgt mittels alltagspsychologischer<br />
Indikatoren. Als solche können sowohl unkommentierte psychopathologische<br />
Verhaltensweisen als auch Wahrnehmungsmuster gelten, sowie explizit benannte<br />
Diagnosen <strong>und</strong> Bef<strong>und</strong>e. Darüber hinaus können auch Zuschreibungen anderer<br />
Charaktere, die den betroffenen Charakter als psychisch krank bezeichnen,<br />
hinzugezogen werden. Dieses Vorgehen orientiert sich grob an dem von Clair<br />
Wilson, Raymond Nairn, John Coverdale <strong>und</strong> Aroha Panapa (1999).<br />
Nähere Erläuterungen zum konkreten Vorgehen sollen im folgenden Empirieteil<br />
gegeben werden.<br />
41
Empirieteil<br />
8 Erläuterung des Untersuchungsgegenstandes<br />
In diesem Kapitel soll es darum gehen, welches Material als Informationsträger in<br />
dieser empirischen Erhebung untersucht werden soll. Dargestellt werden soll,<br />
welche Fernsehserien <strong>und</strong> Filme es zu analysieren gilt <strong>und</strong> warum das<br />
verwendete Sample ausgewählt wurde. Außerdem wird es um eine Skizzierung<br />
des konkreten Vorgehens in der Medienanalyse gehen. Dabei sollen zum einen<br />
die Methodik <strong>und</strong> zum andern die Entscheidung für die gewählten Medien Film<br />
<strong>und</strong> Serie fokussiert werden.<br />
8.1 Explizieren des empirischen Vorgangs<br />
Um die Frage nach der Repräsentativität von stigmatisierenden <strong>Stereotype</strong>n <strong>und</strong><br />
<strong>Vorurteile</strong>n in Mainstream Filmen <strong>und</strong> Fernsehserien zu erheben, wurde sich in<br />
dieser Untersuchung für zwei unterschiedliche, jedoch einander ergänzende<br />
Zugänge entschieden.<br />
Der erste Zugang besteht aus einer quantitativen Analyse des gegebenen<br />
Materials. Die auftretenden psychisch kranken Protagonisten der Serien <strong>und</strong> Filme<br />
werden mittels eines festgelegten Kategorienrasters hinsichtlich stigmatisierender<br />
stereotyper oder vorurteilshafter Darstellung untersucht. Die Kategorien, auf<br />
welche an späterer Stelle (Kapitel 9.) näher eingegangen werden soll, zielen auf<br />
die Identifikation einiger in Kapitel 7. genannten <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> ab.<br />
Diese quantitative Analyse soll parallel durch qualitative Beobachtungen<br />
angereichert werden, um so ein inhaltlich plastischeres Bild der medialen<br />
Darstellung psychisch kranker Charaktere zu erlangen.<br />
Damit ist bereits der zweite Zugang angesprochen. Neben den stigmatisierenden<br />
<strong>Stereotype</strong>n <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong>n, deren Repräsentativität quantitativ <strong>und</strong> qualitativ<br />
erhoben werden, sollen weitere (in Kapitel 7. gekennzeichnet) rein qualitativ<br />
erhoben werden. Diese ebenfalls durch zusätzliche Kategorien quantitativ zu<br />
42
erheben, würde den Rahmen dieser Bachelorarbeit übersteigen. Doch um diesen<br />
Darstellungselementen ebenfalls Rechnung zu tragen, werden auch sie Teil der<br />
Medienanalyse sein.<br />
Durch verschiedene statistische Verfahren, sollen darüber hinaus stigmatisierend<br />
stereotype Darstellungskomplexe identifiziert werden. Einige Hypothesen werden<br />
sich auf diese Darstellungsmuster beziehen <strong>und</strong> die Frage nach der<br />
Repräsentativität einzelner <strong>Stereotype</strong> um die Dimension beispielsweise<br />
interagierender <strong>Stereotype</strong> oder Kombinationen zu erweitern.<br />
Ankerpunkte bzw. Informationsträger sind psychisch kranke Charaktere. Es wird<br />
das Vorkommen stigmatisierend stereotyper Darstellung von Personen in Filmen<br />
<strong>und</strong> Serien erhoben. Die Stichprobe der Charaktere soll in der Ergebnisdarstellung<br />
näher beleuchtet werden.<br />
8.1.1 Die Hypothesen<br />
In dieser Arbeit sollen 7 Haupthypothesen getestet werden. Als Prämisse für die<br />
angeführten Hypothesen fungiert die Annahme, dass <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong><br />
eine zentrale Form medialer Darstellung von psychisch kranken Charakteren<br />
darstellt (vgl. Angermeyer & Schulze, 2001, S. 3).<br />
Hypothese 1: „Psychisch kranke ProtagonistInnen werden überzufällig häufig mit<br />
Gewalt assoziiert“. Diese Hypothese lässt sich unter anderem aus der Studie von<br />
Clair Wilson, Raymond Nairn, John Coverdale <strong>und</strong> Aroha Panapa (1999) ableiten.<br />
Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass 15 von 20 psychisch kranken<br />
Charakteren als gefährlich dargestellt wurden.<br />
Hypothese 2: „ Psychisch kranke Charaktere werden als inkompetent ihr Leben<br />
autark zu führen dargestellt“. Diese Hypothese bezieht sich auf den Stereotyp der<br />
Inkompetenz, welcher in Studien von Martin Taylor <strong>und</strong> Michael Dear (1981) als<br />
zentrale <strong>Stereotype</strong>n-Hauptgruppe extrahiert werden konnte. Dabei spielt das auf<br />
andere angewiesen sein eine zentrale Rolle.<br />
Hypothese 3: „ Psychisch kranke ProtagonistInnen, die gehäuft unter Kontrolle<br />
ihrer Symptome stehen, weisen eine höhere aktive Aggression auf“. Mit dieser<br />
Hypothese soll das Vorurteil bzw. das Stereotyp der Unberechenbarkeit geprüft<br />
43
werden. Die Unberechenbarkeit wird in der Literatur unter anderem mit Gefahr<br />
assoziiert (vgl. Wilson, Nairn, Coverdale & Panapa, 1999, S. 235).<br />
Hypothese 4: „ Die Beziehung psychisch kranker Charaktere zu Liebe <strong>und</strong><br />
Sexualität wird als normabweichend dargestellt“. Diese Annahme lässt sich aus<br />
bestehenden gesellschaftlichen Diskursen ableiten. Außerdem entspricht diese<br />
Hypothese der Annahme, dass insbesondere schizophrene Personen häufig in<br />
Sexualdelikte verwickelt seien (vgl. Angermeyer & Matschinger, 2004, S.1053f.).<br />
Hypothese 5: „ Psychisch kranke Charaktere werden als Störung im sozialen<br />
Gefüge dargestellt“. Dabei spielt die Überlegung eine Rolle, dass psychisch<br />
kranke Menschen autoritäre Personen in ihrer Nähe brauchen, welche<br />
Entscheidungen für sie treffen müssen <strong>und</strong> eine generell versorgende Funktion<br />
übernehmen müssen. Dieses Stereotyp ist von Martin Taylor <strong>und</strong> Michael Dear<br />
(1981) herausgearbeitet worden.<br />
Hypothese 6: „ Mit einer psychischen Erkrankung geht eine geringe<br />
Lebensqualität einher“. Diese Überlegung kann als Ausdruck gesellschaftlicher<br />
Laienkonzepte über das Leben als psychisch kranker Mensch angesehen werden.<br />
Mit dieser Hypothese soll die genannte gesellschaftliche Annahme überprüft<br />
werden.<br />
Hypothese 7: „ Psychisch kranke Charaktere treten in Form von<br />
Anschauungsobjekten auf“. Bei dieser Hypothese handelt es sich um ein<br />
besonderes Erkenntnisinteresse des Autors. Dabei soll untersucht werden,<br />
inwieweit einem möglichen Bedürfnis nach Distanz, auf Seiten nicht von einer<br />
psychischen Erkrankung betroffenen Personen, Rechnung getragen wird. Die<br />
Kategorien der Hauptgruppe Narrative Perspektive sollen diesen Sachverhalt<br />
erheben.<br />
8.1.2 Das Sampling<br />
Bei der Auswahl der zu untersuchenden Medien, wurde sich für Mainstream Filme<br />
<strong>und</strong> Fernsehserien entschieden. Bei den Filmen erfolgte das Sampling nach dem<br />
Kriterium der Zuschauerzahl bzw. Kommerzialität. Ausgewählt wurden die jeweils<br />
44
drei kommerziell erfolgreichsten Filme jedes einzelnen Jahres in der Zeitspanne<br />
2006-2010.<br />
Die Auswahl der untersuchten Fernsehserien erfolgte nach theoretischem<br />
Sampling. Kriterien für die Auswahl bestanden zum einen in der Thematisierung<br />
psychischer Erkrankung bzw. dem Vorkommen psychisch kranker Charaktere.<br />
Darüber hinaus sollten die Serien eine relativ große Reichweite besitzen, also<br />
nicht gänzlich unbekannt sein. Damit soll sichergestellt sein, dass es sich um<br />
Formate handelt, mit welchen sich die Konsumenten auch tatsächlich konfrontiert<br />
sehen. Wären die ausgewählten Serien lediglich mediale Randerscheinungen, so<br />
hätte die Darstellungsweise keine Relevanz für die <strong>Stigma</strong>tisierung psychisch<br />
kranker Menschen in der Gesellschaft.<br />
8.1.2.1 Das Sample der Mainstream Filme<br />
Das Sample der Filme wird aus den meistbesuchten Kinofilmen der 2006-2010 in<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland gebildet. Dabei werden die jeweilige Top 5 der<br />
einzelnen Jahre herangezogen <strong>und</strong> drei ausgewählt. In der Regel setzt sich die<br />
Stichprobe aus den tatsächlich drei erfolgreichsten Filmen zusammen. Allerdings<br />
wird in manchen Fällen von dieser Auswahl abgesehen, da sich auch<br />
Fortsetzungen bereits berücksichtigter Filme auf den drei Spitzenplätzen befinden.<br />
Um eine möglichst große Bandbreite thematisch verschiedener Filme in die<br />
Untersuchung aufnehmen zu können, rücken daher Filme aus den fünf<br />
erfolgreichsten Filmen des betroffenen Jahres an die Stelle der Fortsetzungen.<br />
Dies war beispielsweise im Jahre 2006 bei Ice Age 2 der Fall, an dessen Stelle<br />
dann der Film Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders rückte. Auf diese<br />
Weise wurde folgendes Sample generiert:<br />
1.) Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders<br />
2.) The Da Vinci Code<br />
3.) Fluch der Karibik 2<br />
4.) Ratatoullie<br />
5.) Keinohrhasen<br />
45
46<br />
6.) Die Simpsons – Der Film<br />
7.) Mamma Mia<br />
8.) Ein Quantum Trost<br />
9.) Madagascar 2<br />
10.) Avatar Aufbruch nach Pandora<br />
11.) Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los<br />
12.) Sex and the City 2<br />
13.) Für immer Shrek<br />
14.) Eclipse – Biss zum Abendrot<br />
15.) Harry Potter <strong>und</strong> der Halbblutprinz<br />
Als Datenquelle für die Besucherzahlen der einzelnen Filme diente das<br />
Internetportal http://www.insidekino.de .<br />
8.1.2.2 Sample der Mainstream Fernsehserien<br />
Die Stichprobe der Fernsehserien wurde mittels theoretischen Samplings<br />
gewonnen. Dieses erfolgte nach den bereits unter 9.1.1. genannten Kriterien.<br />
Dazu wurden drei Serien in das Sample aufgenommen, aus denen jeweils drei<br />
Episoden ausgewählt wurden. Die zur Untersuchung stehenden Serien mit den<br />
jeweils drei Episoden lauten:<br />
1. Dr. House<br />
• Episode 32 : Ferndiagnose (Staffel 2 Folge 10)<br />
• Episode 111 : Einer flog in das Kuckucksnest - Teil 1 (Staffel 6 Folge 1)<br />
• Episode 112 : Einer flog in das Kuckucksnest - Teil 2 (Staffel 6 Folge 2)<br />
2. Monk<br />
• Episode 24 : Mr. Monk, sein Bruder <strong>und</strong> drei Kuchen (Staffel 2 Folge 11)
• Episode 68 : Mr. Monk <strong>und</strong> der neue Psychiater (Staffel 5 Folge 7)<br />
• Episode 117 : Mr. Monk muss zur Gruppentherapie (Staffel 8 Folge 8)<br />
3. Desperate Housewives<br />
• Episode 111: Showdown (Staffel 5 Folge 24)<br />
• Episode 121 : Der große Krach (Staffel 6 Folge 10)<br />
• Episode 131 : Entstehung eines Monsters (Staffel 6 Folge 20)<br />
9 Die Kategorien<br />
Die, in dieser Arbeit verwendeten Kategorien stellen die quantitative<br />
Operrationalisierung einiger stigmatisierender <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> dar. Im<br />
Kapitel 9.2. sollen die konkreten Operrationalisierungen der <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Vorurteile</strong> durch Zuordnung der einzelnen Kategorien genauer expliziert <strong>und</strong><br />
begründet werden. Außerdem sollen unter 9.1. die einzelnen Kategorie erläutert<br />
<strong>und</strong> somit intersubjektiv nachvollziehbar gemacht werden.<br />
9.1 Erläuterung der Kategorien<br />
Folgend sollen in einer Übersicht die einzelnen Erhebungskategorien beschrieben<br />
werden.<br />
Die Haupt- <strong>und</strong> Unterkategorien:<br />
1.) Gewalt<br />
a.) physische Aggression gegen psychisch kranke ProtagonistInnen<br />
47
Diese Kategorie greift, wenn Handlungen Dritter mit der Intention ausgeführt<br />
werden dem psychisch Kranken körperliche Schmerzen zuzufügen. Dazu zählen<br />
nicht nur direkt ausgeführte Handlungen, sondern auch jegliche Form von Gewalt,<br />
die sich gegen den Körper der ProtagonistInnen richten <strong>und</strong> auf Initiierungen<br />
dritter zurückgehen (automatische Folterinstrumente, Ketten). Somit zählt auch<br />
jede Form von erzwungenen physisch schmerzhaften Körperhaltungen dazu, die<br />
auch durch den Druck psychischer Gewalt bewirkt werden. Wichtig ist dabei das<br />
Ziel, welches auf körperlichen Schmerz der/des psychisch Kranken abzielen<br />
muss. Bezugspunkte sind immer die in Handlungen (direkt, indirekt, aktiv, passiv)<br />
Dritter, mit der Intention körperlichen Schmerz beim psychisch kranken<br />
Protagonisten hervorzurufen. Wichtig ist, dass die Handlungen zu sehen oder zu<br />
hören sind <strong>und</strong> nicht bloß vermutet werden können. Diese Kategorie ist<br />
unabhängig davon ob die aggressiven Handlungen eine Folge des Auftretens der<br />
krankhaften Symptome sind. Es soll nämlich generell erhoben werden, inwieweit<br />
eine psychischkranke Person passiver Gegenstand physischer Gewalt ist.<br />
b.) psychische Aggression gegen psychisch kranke ProtagonisInnten<br />
Diese Kategorie greift bei jeder Form nicht körperlicher Aggressivität, die auf der<br />
Basis verbaler oder nonverbaler Kommunikation stattfindet <strong>und</strong> von Dritten mit der<br />
Intention ausgeführt wird, dem psychisch kranken Protagonisten seelischen<br />
Schmerz zuzufügen. Bezugspunkt dabei ist die intendierte Schädigung der<br />
psychischen Verfassung des psychisch kranken Protagonisten, unabhängig davon<br />
ob die Wirkung erreicht wird. Sprachliche Abwertung, nicht Beachtung oder<br />
öffentliche Erniedrigung wie Bloßstellen, stellen die gemeinten Handlungen dar.<br />
Wichtig ist, dass die Handlungen zu sehen oder zu hören sind <strong>und</strong> nicht bloß<br />
vermutet werden können. Diese Kategorie ist unabhängig davon, ob die<br />
aggressiven Handlungen eine Folge des Auftretens der krankhaften Symptome<br />
sind. Es soll nämlich generell erhoben werden, inwieweit eine psychisch kranke<br />
Person passiver Gegenstand psychischer Gewalt ist.<br />
48
c.) physische Aggression von psychisch kranken ProtagonistInnen ausgehend<br />
Diese Kategorie greift, wenn Handlungen der/des psychisch Kranken zu<br />
körperlichen Schmerzen bei Dritten führen, unabhängig davon, ob dies intendiert<br />
ist oder nicht. Dazu zählen nicht nur direkt ausgeführte Handlungen, sondern auch<br />
jegliche Form von Gewalt, die sich gegen den Körper Dritter richten <strong>und</strong> auf<br />
Initiierungen des psychisch kranken Protagonisten zurückgehen (automatische<br />
Folterinstrumente, Ketten). Somit zählt auch jede Form von erzwungenen<br />
physisch schmerzhaften Körperhaltungen dazu, die auch durch den Druck<br />
psychischer Gewalt bewirkt werden. Wichtig dabei ist nicht das Ziel, welches auf<br />
den körperlichen Schmerz Anderer abzielen muss, sondern allein die Ausführung.<br />
Bezugspunkte sind immer die Handlungen (direkt, indirekt, aktiv, passiv) des<br />
psychisch Kranken, die körperlichen Schmerzen bei Dritten, in der Interaktion mit<br />
der/dem psychisch kranken Protagonisten hervorzurufen. Wichtig ist, dass die<br />
Handlungen zu sehen oder zu hören sind <strong>und</strong> nicht bloß vermutet werden. Diese<br />
Kategorie ist unabhängig davon, ob die aggressiven Handlungen Teil des<br />
Symptomkomplexes des Protagonisten sind. Es soll nämlich generell erhoben<br />
werden, inwieweit eine psychisch kranke Person Akteur physischer Gewalt ist.<br />
(Bei Filmen mit FSK 12 reicht es auch, wenn die Handlung zu erahnen ist <strong>und</strong><br />
ganz wichtig das Resultat (z.B. Opfer oder Verletzungen) zu einem späteren<br />
Zeitpunkt zu sehen ist!) Die Kategorie greift dann, wenn die gewaltvolle Handlung<br />
angedeutet wird. Sieht man nur das Resultat <strong>und</strong> keine dazugehörige angedeutete<br />
Handlung, bekommt diese Szene eine Wertung, in welcher das Resultat gezeigt<br />
wird, in dieser Kategorie die jedoch nicht größer als 1 sein darf.<br />
d.) psychische Aggression von psychisch kranken ProtagonistInnen ausgehend<br />
Diese Kategorie greift bei jeder Form nicht körperlicher Aggressivität, die auf der<br />
Basis verbaler oder nonverbaler Kommunikation stattfindet <strong>und</strong> von psychisch<br />
kranken ProtagonistInnen ausgeführt wird <strong>und</strong> Dritten, ob intendiert oder nicht,<br />
seelischen Schmerz zufügt. Bezugspunkt dabei ist die Schädigung der<br />
psychischen Verfassung Anderer durch den/die psychisch Kranke(n), unabhängig<br />
49
davon ob eine Wirkung erreicht wird. Sprachliche Abwertung, Nicht- Beachtung<br />
oder öffentliche Erniedrigung wie Bloßstellen stellen die gemeinten Handlungen<br />
dar. Wichtig ist, dass die Handlungen zu sehen oder zu hören sind <strong>und</strong> nicht bloß<br />
vermutet werden können. Diese Kategorie ist unabhängig davon, ob die<br />
aggressiven Handlungen Teil des Symptomkomplexes des/der psychisch Kranken<br />
sind. Es soll nämlich generell erhoben werden, inwieweit eine psychisch kranke<br />
Person Akteur psychischer Gewalt ist.<br />
2.) Narrative Perspektive<br />
a.) Aus der Perspektive des/der psychisch kranken ProtagonistIn<br />
(Subjektperspektive)<br />
Diese Kategorie greift, wenn der Zuschauer Teil des Wahrnehmungssystems<br />
des/der psychisch kranken ProtagonistIn ist. Wenn der Zuschauer Teil dessen ist,<br />
was nur der/dem psychisch Kranken zugänglich ist, wie alle Art sinnlicher<br />
Wahrnehmungsprozesse oder Introspektion, dann ist dies zu vermerken. Etwa<br />
wenn die Kamera die direkte optische Perspektive des/der ProtagonistIn<br />
repräsentiert oder verbal nicht umgesetzte Gedanken hören kann. Bezugspunkt ist<br />
die imaginierte oder direkte sinnliche Wahrnehmung des/der psychisch Kranken,<br />
die dem Zuschauer unmittelbar zugänglich sein muss.<br />
b.) Psychisch kranke ProtagonistInnen als Anschauungsobjekt (Objektperspektive)<br />
Diese Kategorie greift, wenn der/die psychisch kranke ProtagonistIn auftritt <strong>und</strong><br />
aus distanzierter Kameraperspektive, wie beispielsweise der Vogelperspektive<br />
gezeigt wird. Außerdem wenn über die psychisch kranke Person von einem<br />
Erzähler gesprochen wird. Dabei ist zu unterscheiden oder ob der Erzähler die<br />
Person selbst bespricht oder den Plot der Geschichte voranbringt. Nur beim ersten<br />
Fall greift diese Kategorie. Außerdem, wenn andere Personen über den/die<br />
50
ProtagonistIn in dessen Abwesenheit sinnieren. Dabei muss explizit der psychisch<br />
kranke Charakter als Person thematisiert werden.<br />
3.) Reaktionen der Umgebung<br />
a.) negative Reaktion<br />
Diese Kategorie greift, wenn bei Auftreten eines Symptoms oder dem<br />
Störungsbild entsprechende Verhaltensweisen in der Interaktion mit Dritten, bei<br />
jenen eine abwehrende, aggressive oder vermeidende Reaktion ausgelöst wird.<br />
Eine negative Reaktion zeichnet sich darin aus, dass sie auf den Kampf-Flucht-<br />
Mechanismus zurückzuführen ist.<br />
b.) positive Reaktion<br />
Diese Kategorie greift, wenn bei Auftreten eines Symptoms oder dem<br />
Störungsbild entsprechende Verhaltensweisen in der Interaktion mit Dritten, bei<br />
jenen eine auf die/den psychisch Kranke(n) abgestimmte Reaktion ausgelöst wird,<br />
die eine für den Protagonisten angenehme Wirkung zur Folge haben soll,<br />
unabhängig davon ob diese eintritt oder nicht. Bezugspunkt ist die wohlwollende<br />
Intention der Dritten. Die Bewertung der Intention erfolgt, wenn diese nicht deutlich<br />
formuliert werden aus dem inhaltlichen Kontext. Aber nur, wenn diese nicht<br />
deutlich durch zuvor gesprochenes oder nonverbale Merkmale wie Lächeln oder<br />
verbaler Aufwertung wie Lob oder Bestätigung, manifest werden.<br />
c.) positive Reaktion unter der Bedingung einer besonderen kompensatorischen<br />
Eigenschaft<br />
Wenn eine positive Reaktion, wie bei b.) beschrieben, unter Bedingung des<br />
Auftretens einer kompensatorischen Eigenschaft erfolgt. Diese Kategorie hat nicht<br />
51
zur Vorraussetzung, dass ein Symptom aufgetreten sein muss. Hierbei gilt es<br />
zunächst, die kompensatorische Eigenschaft genau zu definieren <strong>und</strong> jegliche<br />
positive (im Sinne von b) Reaktion, die der/die ProtagonistIn als mittel- oder<br />
unmittelbare Folge, des Auftretens dieser Eigenschaft bekommt zu registrieren.<br />
Bezugspunkt ist die kompensatorische Eigenschaft <strong>und</strong> nicht die Symptome.<br />
4.) Freiheit <strong>und</strong> Kontrolle<br />
a.) unter Kontrolle der Symptome<br />
Diese Kategorie greift, wenn der/die psychisch kranke ProtagonistIn Handlungen<br />
vollzieht (diese können auch imaginiert sein) in denen die Symptome seiner<br />
Erkrankung sichtbar werden, d.h. sie auf die Handlungsebene übertragen werden.<br />
Die aus der Erkrankung resultierenden Handlungen müssen einem Zwang<br />
unterstehen, d.h. der/die psychisch Kranke kann nur so handeln <strong>und</strong> nicht anders.<br />
Diese Kategorie greift nur, wenn das Symptom auf der Handlungsebene zu sehen<br />
ist oder die Ursache für ein bestimmtes sichtbares Verhalten ist (vom Gefühl zur<br />
Handlung). Wenn die Erkrankung als Ursache für Handlung dient, dann muss dies<br />
auch sichtbar sein, d.h. es müssen symptomverwandte Merkmale auftauchen,<br />
sodass eine Kausalität angenommen werden kann. Wenn z.B. Gewalt dazu führt,<br />
dass Symptome ausgelebt werden können, so ist der Akt der Gewalt nicht dazu zu<br />
zählen, wenn währenddessen nicht Symptommerkmale auftreten. Nur wenn<br />
Symptome wirklich für sichtbare Handlungen verantwortlich sind oder sich in ihnen<br />
zeigen greift diese Kategorie.<br />
b.) Symptomfrei<br />
Symptomfreiheit liegt vor in der restlichen Auftrittszeit, in der das Symptom nicht<br />
direkt handlungsleitend ist.<br />
52
c.) Wie oft sieht sich der/die Betroffene selbst als nicht handlungskompetent<br />
aufgr<strong>und</strong> seiner Erkrankung.<br />
Diese Kategorie greift, wenn der/die psychisch kranke ProtagonistIn selbst,<br />
aufgr<strong>und</strong> seiner/ihrer Erkrankung seine/ihre Handlungsunfähigkeit auf bestimmten<br />
Feldern bemerkt. Dies kann sich von dem/der ProtagonistIn selbst verbal oder<br />
nonverbal thematisiert äußern oder durch Äußerungen anderer in der Interaktion<br />
mit dem Betroffenen. Nonverbal bei Verzweiflungsgesten oder Äußerungen<br />
bezogen auf das Nichtvorhandensein bestimmter Fähigkeiten aufgr<strong>und</strong> der<br />
Erkrankung. Die Erkrankung muss dem Betroffenen aber nicht bewusst sein. Beim<br />
Verspüren eines Defizits, wobei dieses Spüren sichtbar sein muss. Dies betrifft<br />
jedoch nicht die praktische Umsetzung von Alltagsaufgaben, sondern meint das<br />
Fühlen <strong>und</strong> Erleben oder Umsetzen von Wünschen oder Träumen. Alltägliche<br />
Handlungsfertigkeiten sind davon ausgenommen.<br />
d.) Zutrauen von Handlungskompetenz<br />
Diese Kategorie greift, wenn jemand trotz der Erkrankung Wünsche in die Tat<br />
umsetzt <strong>und</strong> sich selber etwas zutraut. Dabei ist wichtig, dass ein Bezug zur<br />
Krankheit besteht, also dass das „Trotz“ betont wird, von ihm selbst oder anderen.<br />
Die Erkrankung wird als nicht hinderlich verbal oder nonverbal in Kommunikation<br />
mit anderen oder allein thematisiert oder umgesetzt.<br />
5.) Hilflosigkeit<br />
a.) auf andere angewiesen<br />
Bei dieser Kategorie ist es wichtig, dass die Hilfe von Dritten unkommentiert<br />
gezeigt wird. Diese Kategorie untersucht wie selbstverständlich psychisch Kranke<br />
als von anderen abhängig gezeigt werden. Diese Kategorie greift, wenn<br />
Alltagsaufgaben von anderen Personen als dem/der psychisch kranken<br />
53
ProtagonistIn ausgeführt werden. Die Zeit, in welcher das Ausführen der Aufgaben<br />
von anderen sichtbar ist, zählt. Erledigte Aufgaben, die vermutlich von anderen<br />
erledigt wurden, können nicht gewertet werden, sondern nur die Momente der<br />
Sichtbarkeit. Alltagsaufgaben sind alle Bereiche, die für ein autarkes Leben in<br />
unserer Gesellschaft notwendig sind.<br />
b.) Erfolgreiche Bewältigung von Alltagsaufgaben<br />
Bei dieser Kategorie ist es wichtig, dass die Bewältigung von Alltagsaufgaben<br />
unkommentiert gezeigt wird. Diese Kategorie untersucht wie selbstverständlich die<br />
Autonomie der psychisch Kranken dargestellt wird. Das selbstverständliche<br />
Erledigen von Alltäglichem (Haushalt. Hygiene etc.). Alltagsaufgaben sind alle<br />
Bereiche, die für ein autarkes Leben in unserer Gesellschaft notwendig sind.<br />
c.) Erfolglose Bewältigung von Alltagsaufgaben<br />
Bei dieser Kategorie geht es um das Scheitern bei der Bewältigung von<br />
Alltagsaufgaben. Wie lange wird ein/e psychisch Kranke/r als unfähig dargestellt<br />
sich selber zu versorgen. Wichtig ist, dass sich die Unfähigkeit auf Aufgaben<br />
bezieht, die für das autonome Leben im Alltag notwendig sind.<br />
6.) Liebe <strong>und</strong> Sexualität<br />
a.) liebendes Subjekt<br />
Diese Kategorie greift, wenn der psychisch kranke Charakter Liebe empfindet<br />
bzw. verliebt ist. Dies kann sich verbal äußern oder dem Zuschauer deutlich<br />
suggeriert werden. Gezählt wird immer, wenn auf der Handlungsebene oder durch<br />
verbales Thematisieren deutlich gemacht wird, dass der/die ProtagonistIn verliebt<br />
ist, sowie Äußerungen oder Handlungen gegenüber einer Person, die dieses<br />
54
Gefühl deutlich machen. Auch wenn die Figur allein ist <strong>und</strong> emotional besetzt an<br />
eine bestimmte Person denkt oder Eroberungstaktiken entwickelt.<br />
b.) geliebtes Objekt real<br />
Diese Kategorie greift, wenn eine dritte Person in den psychisch kranken<br />
Charakter verliebt ist <strong>und</strong> er Zielobjekt von Handlungen ist, die als werbendes<br />
Verhalten gedeutet werden können. Auch gefühlvolle Gedanken einer Person an<br />
den/die psychisch Kranke(n) zählen dazu.<br />
c.) geliebtes Objekts imaginär/phantasiert<br />
Diese Kategorie greift, wenn eine dritte Person in den psychisch kranken<br />
Charakter verliebt ist <strong>und</strong> er Zielobjekt von Handlungen ist, die als werbendes<br />
Verhalten gedeutet werden können. Auch gefühlvolle Gedanken einer Person an<br />
die/den psychisch Kranke/n zählen dazu. Allerdings unter der Bedingung, dass<br />
dies nicht real ist sondern der Gedankenwelt des/der psychisch Kranke/n<br />
entspringt oder Teil eines Traumes ist.<br />
d.) beteiligt an physischen Zuneigungen im sexuellen Sinne real<br />
Diese Kategorie greift, wenn der/die psychisch Kranke Teil einer freiwilligen<br />
zärtlichen Interaktion ist. Diese Zärtlichkeit muss sich in dieser Kategorie<br />
körperlich ausdrücken. Dies gilt nur für zärtliche oder sexuelle Handlungen mit<br />
einer anderen Person, Selbstbefriedigung ist ausgeschlossen, da es um<br />
Attraktivität für andere in dieser Kategorie geht.<br />
e.) beteiligt an physischen Zuneigungen im sexuellen Sinne imaginär/phantasiert<br />
55
Diese Kategorie greift, wenn der/die psychisch kranke ProtagonistIn Teil einer<br />
freiwilligen zärtlichen Interaktion ist. Diese Zärtlichkeit muss sich in dieser<br />
Kategorie körperlich ausdrücken. Dies gilt nur für zärtliche oder sexuelle<br />
Handlungen mit einer anderen Person, Selbstbefriedigung ist ausgeschlossen, da<br />
es um Attraktivität für andere in dieser Kategorie geht. Unter der Bedingung, dass<br />
diese Handlungen/ Interaktionen der Gedankenwelt bzw. Träumen des/der<br />
psychisch Kranken entspringen.<br />
f.) in Partnerschaft lebend ja/nein<br />
In dieser Kategorie geht es darum, ob der psychisch kranke Charakter in einer<br />
Partnerschaft lebt oder nicht.<br />
7.) Qualität der Lebenssituation<br />
a.) unglücklich/betrübt<br />
Diese Kategorie greift, wenn ein psychisch kranker Charakter sichtbare Zeichen<br />
von Trauer oder Unwohlsein im weitesten Sinne aufweist. Zeichen sind traurige<br />
Gesichtsausdrücke, gekennzeichnet z.B. durch Weinen oder sonstige gängige<br />
Zeichen von Trauer, sowie verbale Äußerungen, in welchen der/die ProtagonistIn<br />
selbst seine persönliche negative Befindlichkeit thematisiert. Diese Kategorie greift<br />
nut bei realen Begebenheiten <strong>und</strong> nicht bei imaginierten Inhalten<br />
b.) fröhlich/glücklich<br />
Diese Kategorie greift, wenn ein psychisch kranker Charakter, sichtbare Zeichen<br />
von Freude oder Wohlsein im weitesten Sinne aufweist. Zeichen sind freudiger<br />
Gesichtsausdruck, gekennzeichnet z.B. mit einem Lächeln oder Lachen, sowie<br />
verbale Äußerungen, in welchen der/die ProtagonistIn selbst seine persönliche<br />
56
Zufriedenheit thematisiert. Diese Kategorie greift nur bei realen Begebenheiten<br />
<strong>und</strong> nicht bei imaginierten Inhalten.<br />
c.) in klinischem Kontext<br />
Diese Kategorie liegt vor, wenn ein psychisch kranker Charakter in<br />
psychiatrischen Kontexten oder anderen Räumlichkeiten psychologisch<br />
psychiatrischer Versorgungsstätten gezeigt wird.<br />
d.) in nicht klinischen Kontexten<br />
Diese Kategorie liegt vor, wenn ein psychisch kranker Charakter in Kontexten<br />
auftritt, die klar von klinischen Kontexten abzugrenzen sind.<br />
e.) Ort positiv<br />
Diese Kategorie liegt vor, wenn ein psychisch kranker Charakter in Kontexten<br />
gezeigt wird, die allgemein positiv assoziiert sind. Dabei ist es wichtig, dass dieser<br />
Ort deutlich als positiv zu erkennen ist.<br />
f.) Ort negativ<br />
Diese Kategorie liegt vor, wenn ein psychisch kranker Charakter an negativen<br />
Orten gezeigt wird. Dunkelheit, sowie die umgebende Klangwelt sind wichtige<br />
Indikatoren dieser Kategorie.<br />
Im Laufe der Untersuchung werden jedoch nicht alle Kategorien explizit in der<br />
Ergebnisdarstellung auftauchen, da einige aus Gründen des Umfangs dieser<br />
Bachelor-Arbeit keinen direkten Einzug in die Analyse gef<strong>und</strong>en haben.<br />
57
9.2 Zuordnung der Kategorien (Operrationalisierung der<br />
<strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong>)<br />
An dieser Stelle soll die konkrete Operrationalisierung der <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Vorurteile</strong>, durch Zuordnung von Kategorien, vorgestellt werden.<br />
Stereotyp/Vorurteil Gefährlichkeit :<br />
physische Aggression von psychisch kranken ProtagonistInnen<br />
psychische Aggression von psychisch kranken ProtagonistInnen<br />
Stereotyp/Vorurteil Inkompetenz :<br />
erfolglose Bewältigung von Alltagsaufgaben<br />
auf andere angewiesen<br />
Stereotyp/Vorurteil Unberechenbarkeit :<br />
unter Kontrolle der Symptome<br />
physische Aggression von psychisch kranken ProtagonistInnen<br />
psychische Aggression von psychisch kranken ProtagonistInnen<br />
Stereotyp/Vorurteil Abnormale Beziehung zu Liebe <strong>und</strong> Sexualität :<br />
liebendes Subjekt<br />
geliebtes Objekt real<br />
Stereotyp/Vorurteil Eine psychische Erkrankung führt zu einer geringen<br />
Lebensqualität<br />
unglücklich/betrübt<br />
negativer Ort<br />
Stereotyp/Vorurteil Psychisch Kranke sind eine Belastung für ihre Umwelt<br />
negative Reaktionen<br />
Stereotyp/Vorurteil Menschen mit einer psychischen Erkrankung sind unfrei <strong>und</strong><br />
determiniert durch ihre Erkrankung<br />
unter Kontrolle der Symptome<br />
58
10 Beschreibung der Stichprobe<br />
Die Stichprobe besteht insgesamt aus 19, als psychisch krank identifizierten<br />
Charakteren. Dabei stammen 7 ProtagonistInnen aus Filmen <strong>und</strong> 12 aus den nach<br />
theoretischen Gesichtspunkten ausgewählten Serien. Die geringe Anzahl der<br />
filmischen Charaktere kann auf das Sample der cineastischen Formate<br />
zurückgeführt werden. In lediglich 5 der 15 erfolgreichsten Filme aus den Jahren<br />
2006-2010 traten als psychisch krank identifizierte Charaktere auf. Filme wie Ein<br />
Quantum Trost oder Die Simpsons – der Film weisen ProtagonistInnen auf, deren<br />
Verhalten oder Lebensgeschichte auf psychopathologische Auffälligkeiten<br />
schließen lassen. Jedoch sind deren Rollen <strong>und</strong> Funktionen nicht darauf ausgelegt<br />
eine psychisch kranke Person in den thematischen Diskurs einzuführen. Darüber<br />
hinaus weisen einige Charaktere wie etwa Captain Jack Sparrow aus Fluch der<br />
Karibik 2, eine signifikante Eigendynamik auf, sodass diese beinahe als eigene<br />
Differenzkategorie betrachtet werden können. Außerdem weisen einige Figuren,<br />
welche sich an der Grenze der Differenzkategorie psychisch krank bewegen,<br />
vordergründige Merkmale anderer sozialer Kategorien auf. Damit repräsentieren<br />
solche Charaktere nicht die interessierende soziale Gruppierung der psychisch<br />
Kranken. Einen solchen Fall stellt etwa der Großvater Abraham Simpson dar.<br />
Die übrigen Filme verzichten ganz auf psychisch kranke ProtagonistInnen in ihrer<br />
Geschichte.<br />
Aus den Serien konnten 12 verschiedene Charaktere der Kategorie psychisch<br />
krank identifiziert werden. Die höhere Anzahl an betroffenen Personen ist auf die<br />
spezielle Wahl der einzelnen Episoden zurückzuführen, wobei darauf geachtet<br />
wurde, dass psychische Erkrankungen explizit thematisiert werden. Allerdings<br />
wurden auch bei den Serien, im Falle einiger Charaktere auf deren Aufnahme in<br />
das Sample verzichten. Dabei handelt es sich um Personen deren Auftrittsanteil<br />
äußerst gering ist bzw. deren sprachlicher Anteil als lediglich peripher angesehen<br />
werden kann. Dies trifft auf einige Personen bei Dr. House – Einer flog in das<br />
Kuckucksnest Teil 1 + 2, sowie bei Monk – Mr. Monk muss zur Gruppentherapie,<br />
zu. Die weiteren auftretenden PatientInnen dienen nämlich überwiegend als<br />
Statisten für das klinische Setting, weshalb diese keinen Einzug in die Stichprobe<br />
gehalten haben. Außerdem wurde die Figur des Gregory House lediglich in Folgen<br />
59
dem Sample hinzugefügt, in welchen er explizit als psychisch kranke Person<br />
auftritt.<br />
Die Stichprobe setzt sich aus 15 menschlichen ProtagonistInnen, 3<br />
anthropmorphen Tieren, sowie einem Fabelwesen zusammen. Trotz der<br />
verschiedenen Gattungszugehörigkeit der Charaktere können eindeutige<br />
Geschlechtszuweisungen vorgenommen werden. In dieser Stichprobe ergibt sich<br />
eine Verteilung von 3 (15%) weiblichen <strong>und</strong> 16 (85%) männlichen Figuren.<br />
Abb. 1 : Geschlechterverteilung weiblich/männlich<br />
Diese Verteilung ist bei p= .004 dahingehend signifikant, dass männliche<br />
Charaktere in dieser Stichprobe überzufällig häufig repräsentiert sind.<br />
Bei 10 von 19 Personen (53%) liegt eine besondere Eigenschaft vor. Solche<br />
Eigenschaften sind z.B. „übernatürliche“ Merkmale, wie magische Fertigkeiten,<br />
oder w<strong>und</strong>ersame Wahrnehmungsqualitäten, welche in den Bereich des<br />
Mystischen tendieren. Die besonderen Eigenschaften können sich jedoch auch in<br />
einer Überdurchschnittlichkeit ausdrücken. So reicht die Variation bei<br />
Eigenschaften dieser Art von Hochintelligenz über künstlerische Fähigkeiten, bis<br />
hin zu außergewöhnlichen Anpassungsleistungen.<br />
60
Abb. 2 : Vorliegen einer besonderen Eigenschaft<br />
Dabei kommt Übernatürlichkeit lediglich bei männlichen Charakteren vor.<br />
Überdurchschnittlichkeit kommt unter Frauen gerade bei einer von 3 weiblichen<br />
ProtagonistInnen vor. Dabei handelt es sich um eine psychiatrische Patientin aus<br />
den Episoden Einer flog in das Kuckucksnest Teil 1 <strong>und</strong> 2. Ihre besondere<br />
Eigenschaft liegt in einer außergewöhnlichen Fertigkeit im musischen Umgang mit<br />
dem Cello. Dem gegenüber stehen die besonderen Eigenschaften zehn<br />
männlicher Charaktere, welche sich bei den Figuren des Adrian Monk, Dr.<br />
Gregory House, Ambros Monk <strong>und</strong> Prof. Robert Langdon in einer besonderen<br />
Ausprägung intellektuell-kognitiver Fähigkeiten manifestieren. Hinsichtlich der<br />
besonderen Eigenschaft ist der Charakter des Eddy Orlofsky aus der Desperate<br />
Housewives Episode Die Entstehung eines Monsters als männliches Äquivalent<br />
zur Cellistin aus Dr. House zu sehen, da er sich mit besonderen zeichnerischen<br />
Fähigkeiten abhebt. Die übernatürlichen Eigenschaften der zwei männlichen<br />
Darsteller erfüllen eine übersteigert kompensatorische Funktion. Auch bei den<br />
Monk Brüdern ist von kompensatorischen Eigenschaften zu sprechen, jedoch wird<br />
etwa Grenui´s olfaktorische Genialität im Film Das Parfum, in religiöse Analogien<br />
eingebettet. So kommt es in den Schlussszenen etwa zu messianischen<br />
Anspielungen. Der zweite Protagonist mit übernatürlichen Fähigkeiten ist<br />
Rumpelstilzchen aus Shrek 3. Er besitzt die magische Fähigkeit verheißungsvolle<br />
Verträge zu erstellen, welche durch Zauber ihre Wirkung entfalten. Gemeinsam<br />
haben Grenui <strong>und</strong> Rumpelstilzchen, dass ihre Gabe Teil ihres Wesens ist <strong>und</strong><br />
nicht als erworben, sondern als angeboren aufgefasst werden kann. Bei<br />
Rumpelstilzchen ist es Teil seiner Gattung als Märchenwesen. Die olfaktorische<br />
Wahrnehmungsqualität Grenui´s wird in den Anfangssequenzen als „Gabe“<br />
bezeichnet, was den passiven Erwerb dieser Fähigkeit unterstreicht. Auch bei<br />
61
Adrian <strong>und</strong> Ambros Monk wird von „Gabe <strong>und</strong> Fluch“ gesprochen, wobei immer<br />
wieder deutliche Hinweise auf das Erfahren neurotischer Erziehungsmuster der<br />
beiden gegeben werden, womit hinsichtlich der Ätiologie auf Umweltfaktoren<br />
hingedeutet wird. Dennoch kann festgehalten werden, dass eine besondere<br />
Eigenschaft in Form einer pränatalen „Segnung“, lediglich psychisch kranken<br />
Männern zu Teil wird. Wobei jene Segnungen in ihrer Nützlichkeit für den<br />
jeweiligen Träger ambivalenten Charakters sind. Auch bei künstlerischen<br />
Fertigkeiten kann von einem angeborenen Talent gesprochen werden, welches<br />
jedoch einen Kultivierungsprozess durchlaufen muss, um fruchtbar gemacht zu<br />
werden. Die Person des Eddy Orlofsky wird etwa zu gewissen Kunstkursen<br />
geschickt, um seine Fertigkeiten zu verbessern.<br />
Erlernte oder vielmehr durch externe Faktoren erworbene Fähigkeiten sind<br />
beispielsweise die perfekte Umweltanpassung der Figur des Buck in Ice Age 3,<br />
welche letztlich das Überleben der anderen Charaktere in der unterirdischen<br />
Dinowelt sichert <strong>und</strong> als Resultat eines Lernprozesses angesehen werden kann.<br />
Besonderes Fachwissen wie bei Prof. Robert Langdon oder die diagnostische<br />
Kompetenz eines Gregory House können ebenfalls zu dieser Gruppe gezählt<br />
werden.<br />
In einer Partnerschaft leben insgesamt 3 von 19 (16%) der identifizierten<br />
Charaktere.<br />
Abb. 3 : Charaktere mit <strong>und</strong> ohne Partner<br />
Diese Verteilung weist mit p= .004 auf ein überzufälliges Vorkommen nicht in<br />
Partnerschaft lebender Personen in dieser Stichprobe hin.<br />
62
Dabei ist auffallend, dass keine der weiblichen Protagonistinnen in einer<br />
Partnerschaft lebt, jedoch zwei Charaktere unter diesem Zustand stark leiden <strong>und</strong><br />
sehr weit gehen, diesem Mangel Abhilfe zu schaffen. Barbara Orlofsky<br />
vernachlässigt beispielsweise ihren kleinen Sohn <strong>und</strong> Katherine Mayfer inszeniert<br />
gar einen Mordversuch durch Selbstverletzung. Bei beiden Protagonistinnen kann<br />
das Verlassenwerden durch einen früheren Partner als Auslöser ihrer<br />
Symptomatiken angesehen werden.<br />
In einigen Fällen werden explizit psychiatrische Diagnosen vergeben. Dies ist bei<br />
7 psychisch kranken Personen der Fall. Dabei handelt es sich ausschließlich um<br />
Personen, die auch in klinischen Kontexten gezeigt werden. Figuren, welche nicht<br />
in klinischen Kontexten auftreten, bekommen, trotz teils auffälliger Symptomatik,<br />
keine Diagnose zugesprochen. Jedoch erhalten auch nicht alle der in<br />
Einrichtungen des Ges<strong>und</strong>heitswesens auftretenden Personen eine konkrete<br />
Bezeichnung ihrer Erkrankung. Außerdem liegt in einem Fall eine Komorbidität<br />
vor.<br />
Abb. 4 : Verteilung der explizit vergebenen Diagnosen in klinischen Hauptgruppen<br />
Zu den vergebenen Diagnosen gehören Manien, Bipolare Störung,<br />
Halluzinationen, Wahn, Tablettenabhängigkeit, sowie Zwänge <strong>und</strong> Phobien.<br />
Weitere nicht explizit vergebene Diagnosen lauten: Alkoholabhängigkeit, Wahn,<br />
Manie, Hypochondrie, Klaustrophobie, psychotische Symptome, sowie zwanghafte<br />
Obsessionen.<br />
Des Weiteren werden Charaktere dieser Stichprobe mit bestimmten<br />
Bezeichnungen <strong>und</strong> Attributen versehen. Diese sind überwiegend als<br />
Diffamierungen zu bezeichnen. Einige Beispiele dafür sind Monster, Verrückter,<br />
63
Verbrecher sowie gestört oder Teufel. Jene Titulierungen <strong>und</strong> Attribute sind<br />
Ausdruck der gesellschaftlichen <strong>Stigma</strong>tisierung psychisch kranker Menschen.<br />
11 Statistische Verfahren<br />
Für die folgende Untersuchung werden Binomialtests, sowie eine Korrelation als<br />
statistische Verfahren zur Hypothesenprüfung zum Einsatz kommen. Außerdem<br />
stellen qualitative Beobachtungen einen weiteren Teil der Ergebnisse.<br />
12 Ergebnisse<br />
12.1 Quantitative Hypothesentestung<br />
Hypothese 1: „Psychisch kranke ProtagonistInnen werden überzufällig häufig mit<br />
Gewalt assoziiert“.<br />
In der vorliegenden Stichprobe weisen 15 Charaktere (79%) psychische oder<br />
physische Gewalt, die sich gegen andere richtet, auf. Diese Verteilung lässt bei p=<br />
.0095 auf ein überzufällig häufiges Auftreten dieses Merkmals schließen. Das<br />
Ergebnis stützt damit die Hypothese einer gehäuften Repräsentation des<br />
Stereotyps der Gefährlichkeit psychisch kranker Personen.<br />
Über die aktive Aggressivität hinaus kann festgestellt werden, dass psychisch<br />
kranke Charaktere Mitmenschen durch ihre Symptomatik in große Gefahr bringen<br />
ohne aktive Aggression auszuführen. So veranlasst etwa König Julian<br />
(Madagaskar 2) unter Einfluss manischer Selbstüberschätzung eine<br />
Opferungszeremonie, bei welcher eine andere Person in einen Vulkankrater<br />
geworfen werden soll. Auch der Charakter des Harold wird bei einem Versuch<br />
Adrian Monk <strong>und</strong> dessen Psychiater aus einer Geiselhaft zu befreien von seinen<br />
Symptomen eingeholt <strong>und</strong> bringt die Befreiungsaktion damit beinahe zum<br />
Scheitern.<br />
64
Allerdings wird Aggression, bei der Figur Buck aus Ice Age 3, als positives<br />
Merkmal offeriert. Beispielsweise durch seinen Kampf gegen eine fleischfressende<br />
Pflanze oder einen gefährlichen Raubsaurier fungiert seine Brutalität als<br />
Überlebensgarant der Hauptfiguren. Jedoch ist er der einzige Charakter dessen<br />
Aggression eine positive Funktion inne hält. In der vorliegenden Stichprobe<br />
befinden sich 5 Charaktere (26%), die ein oder mehrere Personen getötet haben<br />
oder die zumindest in einer festen Absicht zu Morden, agieren. Zu diesen<br />
Charakteren sind der Mönch Silas (Sakrileg), Grenui, Rumpelstilzchen, sowie die<br />
Serienfiguren David Williams <strong>und</strong> Eddy Orlofsky aus Desperate Housewives zu<br />
zählen. Auffallend ist, dass sich unter den 5 Charakteren keine weibliche Person<br />
befindet. Die Rollen von Serienmördern (Eddy Orlofsky <strong>und</strong> Grenui), Rächern<br />
(David Williams) oder fanatischen Gotteskämpfern (Silas) bleiben männlichen<br />
Protagonisten vorbehalten. Die weiblichen Charaktere zeichnen sich verstärkt<br />
durch psychische Aggression aus. So agiert Barbara Orlofsky in einem<br />
gewaltvollen Verhältnis zu ihrem Sohn, ausschließlich mit psychischen<br />
Verletzungen. Sie ergießt Spott über ihren Sohn <strong>und</strong> lässt kaum Gelegenheiten<br />
aus, ihn zu demütigen. Selbst als dieser noch ein kleiner Junge war, bekam er<br />
psychische Aggression von seiner Mutter zu spüren. Auch Katherine Mayfair ist<br />
durch ihre wahnhafte Fixierung auf Mike Delfino zu hoher psychischer Aggression<br />
geneigt. Ihre Handlungen haben jedoch eine gewisse Ambivalenz, welche die<br />
Grenze zwischen symptombedingten <strong>und</strong> rationale kalkulierten Aggressionen<br />
unscharf macht. Dennoch wird der Charakter der Katherine Mayfair durch ihre<br />
psychischen Aggressionen zu einer hoch aggressiven Figur stilisiert, welche nicht<br />
davor zurückschreckt, Familien zerstören zu wollen. Der Grossteil ihres Handelns<br />
steht jedoch in direktem Bezug zu ihrer Erkrankung, was in späteren Episoden<br />
deutlicher zum Vorschein kommt. Somit sind in 2 von 3 weiblichen Figuren zum<br />
einen das stigmatisierende Stereotyp der Gefährlichkeit psychisch kranker<br />
Menschen sowie das verbreitete Vorurteil, dass Frauen zu höherer verbaler bzw.<br />
psychischer Aggression neigen, repräsentiert.<br />
Neben der Aggression gegen Dritte ist die Autoaggression ein Merkmal vieler<br />
Charaktere. Es weisen insgesamt 6 Charaktere (31%) deutliche autoaggressive<br />
Handlungen auf. Diese sind in ihren Ausprägungen äußerst heterogen <strong>und</strong> reichen<br />
von Selbstgeißelung bis zu tatsächlichem Suizid. Letzteres trifft jedoch nur in<br />
65
einem Fall zu. Vordergründig tritt suizidales Verhalten bei den 6 selbstdestruktiven<br />
Charakteren dieser Stichprobe auf.<br />
Hypothese 2: „ Psychisch kranke Charaktere werden als inkompetent ihr Leben<br />
autark zu führen dargestellt“.<br />
Das hiermit getestete stigmatisierende Stereotyp der Inkompetenz lässt sich nicht<br />
bestätigen. Lediglich 5 Personen (26%) werden bei erfolglosen Versuchen der<br />
Alltagsbewältigung gezeigt. Gegenüber 14 Personen (74%), welche nicht in solch<br />
defizitärem Bilde erscheinen. Als auf andere angewiesen wurden 7<br />
ProtagonistInnen (37%) gezeigt. Dieser Anteil entspricht ebenfalls keiner<br />
überzufälligen Repräsentation dieses Merkmals.<br />
Ein weiteres Element im Rahmen des <strong>Stereotype</strong>n der Inkompetenz ist das<br />
Vorhandensein von Führungsfiguren, welche wichtige Entscheidungen für die<br />
psychisch kranke ProtagonistIn trifft <strong>und</strong> als Autoritätsfigur fungiert.<br />
Führungsfiguren dieser Art sind insgesamt 4 Charakteren (21%) zur Seite gestellt.<br />
Diese Führungsfiguren sind allesamt männlichen Geschlechts <strong>und</strong> in ihrer<br />
Präsenz <strong>und</strong> Bedeutung für die psychisch kranke Person als heterogen zu<br />
bezeichnen. Die Autoritäten zeigen sich in Form eines geistlichen Mentors,<br />
Psychiaters, sowie in einem Fall als ebenfalls erkranke Person. Elemente einer<br />
Führungsfigur zeigt Katherine Mayfair´s Tochter, Allerdings fehlt hier die<br />
hierarchische Struktur im Verhältnis, um von einer Entscheidungstreffenden bzw.<br />
Führungsfigur zu sprechen. Die Assistentinnen von Adrian Monk fungieren in<br />
ähnlicher Weise. Sie sind lediglich Helferinnen in für den Protagonisten als<br />
peripher empf<strong>und</strong>enen Angelegenheiten des Alltags. Zusammenfassend kann<br />
gesagt werden, dass weiblichen Entscheidungsträgerinnen im Gegensatz zu ihren<br />
männlichen Pendants die hierarchisch autoritären Merkmale fehlen.<br />
Insgesamt 15 Charaktere (79%) werden ohne Personen dieser Art in ihrer Umwelt<br />
dargestellt, sodass auch dieser Aspekt der <strong>Stereotype</strong>n nicht als überzufällig<br />
repräsentiert angesehen werden kann.<br />
Hypothese 3: „ Psychisch kranke ProtagonistInnen, die gehäuft unter Kontrolle<br />
ihrer Symptome stehen weisen eine höhere aktive Aggression auf, wobei<br />
zusätzlich davon ausgegangen werden kann, dass determinierte Charaktere<br />
überrepräsentiert sind“.<br />
66
Mit dieser Hypothese soll zum einen die Repräsentation des <strong>Stereotype</strong>n der<br />
Unberechenbarkeit <strong>und</strong> zum anderen der des Determinismus durch die<br />
Erkrankung eruiert werden.<br />
Es gibt einen großen positiv linearen Zusammenhang von r= .512 (p= .0125)<br />
zwischen aktiver Aggression <strong>und</strong> dem Grad an Kontrolle, welche die Symptomatik<br />
über die betroffene Person ausübt. Dieser besteht dahingehend, dass Charaktere,<br />
welche im Handeln stark durch ihre Symptomatik determiniert sind, ein höheres<br />
Maß an Aggression aufbringen. Darüber hinaus ist ein überzufälliges Vorkommen<br />
von Personen, deren Handlungen vom jeweiligen Krankheitsbild geleitet werden,<br />
zu verzeichnen (p< .001).<br />
Damit kann die Repräsentation dieses stigmatisierenden Merkmals als gegeben<br />
angesehen werden. Selbst Charaktere, die in ihrer Rolle als kompetente<br />
Persönlichkeiten dargestellt werden, stehen mindestens einmal unter Kontrolle<br />
ihrer Erkrankung <strong>und</strong> lassen die Symptomatik zu einem handlungsleitenden<br />
Moment werden. Damit ist die Verlässlichkeit der Charaktere in Frage gestellt, da<br />
diese die potentielle Gefahr einer externen Einflussnahme durch die Erkrankung in<br />
sich tragen. Dieses Stereotyp wird besonders an den Charakteren Buck <strong>und</strong><br />
Harold deutlich. Buck ist ein perfekt angepasstes Wesen, welches wie ein Lotse<br />
die Hauptfiguren durch einen prähistorischen Dschungel navigiert. Doch auch er<br />
wird immer wieder von wirren Gedanken eingeholt, welche ihn für eine gewisse<br />
Zeit gefangen halten. So führt er beispielsweise, als es um die wichtige Frage der<br />
Nachtlagerbestimmung geht, einen Dialog mit halluzinierten Gesprächspartnern,<br />
die in Form von Saurierschädeln sein Gegenüber bilden <strong>und</strong> sogar<br />
mitentscheiden. Harold ist zwar kein alltagskompetenter Charakter, verbringt<br />
jedoch die Leistung, Mr. Monk <strong>und</strong> dessen Psychiater nach einer Geiselnahme<br />
aufzuspüren. Doch wie bereits erwähnt wird Harold´s zwanghafter<br />
Symptomkomplex wirksam, <strong>und</strong> die Befreiungsaktion gerät durch diesen<br />
Kontrollverlust in Gefahr. Die Macht seiner Symptome hat es ihm verwehrt als<br />
alleiniger Retter dazustehen. Damit wird die Fähigkeit, ein gesetztes Vorhaben<br />
vollenden zu können, in Frage gestellt. Es wird unberechenbar, ob psychisch<br />
kranke Menschen in der Lage sind verlässlich zu sein. Mit diesem Stereotyp in der<br />
medialen Darstellung wird die Berechtigung des Vertrauens in psychisch kranke<br />
Menschen nicht direkt negiert, jedoch als ungesichert dargestellt.<br />
67
Der Zusammenhang mit aktiver Aggressivität kann an Hand der Figur des Grenui<br />
veranschaulicht werden. Dieser Charakter kann als Getriebener seiner Erkrankung<br />
gesehen werden. Sein Handeln ist so stark auf die Befriedigung seiner Obsession<br />
gerichtet, dass sein Verhalten zur Gefahr für andere Menschen wird. Auch Grenui<br />
ist kein inkompetenter Charakter, welcher durch seine Erkrankung<br />
handlungsunfähig gemacht wird. Der symptomatische Einfluss ist jedoch so groß,<br />
dass er zum Mörder wird.<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die gegenständliche Stichprobe die<br />
Hypothese des Zusammenhanges zwischen Aggression <strong>und</strong> Symptomkontrolle,<br />
sowie die überzufällige Darstellung des Determinierungsmusters verifiziert werden<br />
konnte. Die stigmatisierenden <strong>Stereotype</strong> Unberechenbarkeit <strong>und</strong> Determinierung<br />
durch die Erkrankung können als stark repräsentiert angesehen werden.<br />
Hypothese 4: „ Die Beziehung psychisch kranker Charaktere zu Liebe <strong>und</strong><br />
Sexualität wird als normabweichend dargestellt“.<br />
Psychisch kranke Personen dieser Stichprobe leben überzufällig häufig nicht in<br />
Partnerschaften (siehe Kapitel 10). Allerdings werden 7 Charaktere (37%) als<br />
liebende Subjekte dargestellt. Demgegenüber stehen jedoch 15 Personen (79%),<br />
die nicht geliebt werden. Diese Verteilung entspricht bei p= .0095 einer<br />
signifikanten Häufung von ProtagonistInnen, die nicht als geliebtes Objekt gezeigt<br />
werden. Diese Ergebnisse spiegeln wider, dass psychisch Kranke zwar Liebe<br />
empfinden können, jedoch nicht als Objekt physischen oder psychischen<br />
Begehrens auftreten. Das Vorurteil der Asexualität kann in der Darstellung dieses<br />
Samples nicht bestätigt werden, obgleich einige Charaktere gemäß dieser<br />
Annahme gezeichnet sind (unter anderem Monk). Gestörtes Verhältnis zu Liebe<br />
<strong>und</strong> Sexualität ist bei einigen Charakteren symptomatisch. So wird etwa Eddy<br />
Orlofsky´s mörderisches Potential durch eine gestörte Beziehung zum weiblichen<br />
Geschlecht aktiviert. Katherine Mayfair <strong>und</strong> Barbara Orlofsky leiden maßgeblich<br />
unter ihrem partnerschaftlichen Mangel. So versucht Barbara etwa die Lücke,<br />
welche ihr früherer Partner durch seinen Auszug hinterlassen hat durch Alkohol zu<br />
füllen. Ihr Bedürfnis nach Sicherheit durch einen Mann wird vor ihre elterliche<br />
Führsorgepflicht gestellt, was sich unter anderem darin ausdrückt, dass sie offene<br />
sexuelle Handlungen vor den Augen ihres Kindes zulässt, oder, statt ihn zu hüten,<br />
auf „Männersuche“ in eine Bar fährt. Auffallend ist, dass zwischen den weiblichen<br />
68
Charakteren zwei extremisierende Pole existieren. Auf der einen Seite stehen<br />
Katherine Mayfair <strong>und</strong> Barbara Orlofsky, welche als abhängig von Partnerschaft<br />
gezeigt werden <strong>und</strong> eher von ihrem „Liebesbedürfnis“ geheilt werden müssten. Auf<br />
der anderen Seite steht eine Person, deren Sexualität zu keinem Zeitpunkt<br />
thematisiert wird. Ihre Darstellung kann als asexuell bezeichnet werden. Dabei<br />
handelt es sich um die Cellistin aus Dr. House. Die weiblichen Charaktere dieser<br />
Stichprobe können in ihrer Beziehung zu Liebe <strong>und</strong> Sexualität als stark<br />
normabweichend aufgefasst werden.<br />
Der Charakter des David Williams illustriert eine weitere Beobachtung, welche<br />
den Zusammenhang von psychischer Erkrankung <strong>und</strong> Liebe/ Sexualität abbildet.<br />
Nach seiner traumatischen Erfahrung des Verlusts seiner Familie steht der<br />
Gedanke der Rache im Vordergr<strong>und</strong> seines Lebens. Mit Einsetzen seiner<br />
psychischen Erkrankung ist es ihm unmöglich wieder zu lieben. Hierbei wird in der<br />
Serie auf Vorher Nachher- Kontraste fokussiert.<br />
Ein weiterer Charakter unterstreicht die scheinbare Absurdität von Sexualität im<br />
Zustand psychischer Erkrankung. Buck berichtet über vergangene Beziehungen<br />
mit einer Annanas, flirtet mit einem Flugsaurier <strong>und</strong> phantasiert eine Partnerschaft.<br />
Sein Auftreten <strong>und</strong> Thematisieren partnerschaftlichen <strong>und</strong> sexuellen Inhalts<br />
verschiebt diesen Bereich ins Imaginäre <strong>und</strong> somit in den Dunstkreis seiner<br />
Symptomatik. Dadurch wird deutlich wie absurd Partnerschaft <strong>und</strong> Sexualität in<br />
seiner Lebenssituation ist. Liebe im Kontext dieser Figur macht den Bereich<br />
Partnerschaft <strong>und</strong> Sexualität eines psychisch kranken Charakters zum<br />
Gegenstand von Hohn <strong>und</strong> Spott.<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Hypothese der abnormalen<br />
Sexualität anhand der gegenständlichen Stichprobe nur bedingt gestützt werden<br />
kann. Psychisch kranke ProtagonistInnen können zwar lieben, jedoch bleibt das<br />
Lieben oft einseitig oder ist in einem pathologischen Maße übersteigert.<br />
Hypothese 5: „ Psychisch kranke Charaktere werden als Störung im sozialen<br />
Gefüge dargestellt“.<br />
Das Umfeld von 14 Personen (73%) reagieren häufiger negativ ablehnend als<br />
positiv ermutigend auf die psychopathologische Symptomatik der Betroffenen.<br />
Diese Verteilung ist mit p= .002 signifikant.<br />
69
Besonders deutlich wird die Belastung des Umfeldes der Betroffenen bei<br />
Katherine Mayfair, der Cellistin <strong>und</strong> Adrian Monk. Der Bruder der Cello spielenden<br />
psychiatrischen Patientin aus Dr. House ist ihretwegen nicht in der Lage gewesen,<br />
trotz beruflicher Notwendigkeiten, den Wohnort zu wechseln. In regelmäßigen<br />
Abständen wird sie (die Cellistin) von ihrer Schwägerin besucht.<br />
Wegen Katherine Mayfair´s Erkrankung muss ihre Tochter per Flugzeug anreisen<br />
<strong>und</strong> sie unterstützen. Auch dies ist ein Beispiel dafür, wie psychisch kranke<br />
Personen als Anstrengung <strong>und</strong> Störfaktor fungieren können. Adrian Monk hat<br />
einen zwanghaft strukturierten Alltagsablauf, welcher eigene Regeln <strong>und</strong><br />
Dynamiken besitzt. Diesem Aufbau muss auch seine jeweilige Assistentin folgen.<br />
Durch diese Symptomatik ist Mr. Monk als anstrengender Mensch <strong>und</strong> Arbeitgeber<br />
zu bezeichnen, der seinen Assistentinnen den Arbeitsprozess erschwert. Ein<br />
weiterer Charakter dieser Reihe ist Barbara Orlofsky. Die Belastungen ihrer<br />
Erkrankung für den Sohn Eddy werden so drastisch beschrieben, dass darin die<br />
eigentliche Ursache seiner Störung zu finden ist. Damit fungiert die psychische<br />
Belastung für andere als Multiplikator weiterer <strong>und</strong> vor allem intensiverer<br />
Störungen bei Personen des unmittelbaren Umfeldes. Dieser Effekt wird in Folge<br />
an der Person ihres Sohnes veranschaulicht.<br />
Hypothese 6: „ Mit einer psychischen Erkrankung geht eine geringe<br />
Lebensqualität einher“.<br />
Psychisch kranke ProtagonistInnen werden signifikant häufiger explizit<br />
unglücklich als explizit fröhlich dargestellt (p= .002). Außerdem sind die<br />
Auftrittsorte psychisch erkrankter Personen mit p< .001 überzufällig häufig negativ<br />
gegenüber Orten, die positive Assoziationen wecken. Die signifikante<br />
Repräsentation dieses stigmatisierenden Stereotyps kann als gegeben angesehen<br />
werden. Besonders markant zeigt sich dieses Stereotyp an der Person des<br />
Ambros Monk. Seine Auftrittszeiten finden zu 83% an einem negativen Ort statt.<br />
Dieser Ort ist überwiegend das bedrückend dunkle <strong>und</strong> zugestellte Elternhaus der<br />
Monkbrüder. Ein Ort, welcher als Abbild des seelischen Innenlebens von Ambros<br />
Monk angesehen werden kann. Neben den räumlichen Konsequenzen eines<br />
zwangsbestimmten Lebensstiles <strong>und</strong> imaginärer mütterlicher Introjekte, die in<br />
Form implizit exekutierter Regeln innerhalb dieses Hauses ihre Wirkung entfalten<br />
(numerische Ordnung der Kaffeebecher). Ambros Monk weist zudem ein<br />
70
esonders hohes Maß an Traurigkeit auf, welche in 90% seiner Auftritte manifest<br />
werden.<br />
Auch Grenui bewegt sich in überwiegend negativen Örtlichkeiten. Er visitiert zwar<br />
prunkvoll schöne Anlage <strong>und</strong> Gebäude, wie etwa die Blütenfelder von Grasse oder<br />
den Palazzo eines Stadtherrn. Allerdings sind seine persönlichen Domizile stets in<br />
Dunkelheit getaucht <strong>und</strong> wecken beängstigende, negative Assoziationen. Grenui<br />
ist ein unglücklicher Charakter, der zwar bei den meisten seiner Auftritte<br />
emotionslos wirkt, jedoch gerade gegen Ende des Filmes seine Gebrochenheit<br />
<strong>und</strong> Trauer über seine Form der Existenz deutlich manifest werden lässt.<br />
In der vorliegenden Stichprobe wird an Hand mehrer Charaktere demonstriert,<br />
dass eine psychische Erkrankung Einschränkung bedeutet <strong>und</strong> niedrige<br />
Lebensqualität als Begleiterscheinung inkludiert zu sein scheint.<br />
Auffallend ist, dass den Charakteren, deren fröhlichen Auftrittsanteile gegenüber<br />
den unglücklichen überwiegen, die Diagnose Manie zugesprochen werden kann.<br />
Die manischen Symptome scheinen für eine Art Leichtigkeit <strong>und</strong> Frohsein die<br />
Vorraussetzung in diesem Sample zu bilden. Die beiden manischen Charaktere<br />
haben zu 60% <strong>und</strong> 64% fröhliche Auftrittsanteile. Der Mittelwert der Stichprobe<br />
hinsichtlich Fröhlichkeit beträgt ansonsten 14,27%. Allerdings ist überhöhter<br />
Frohsinn hier Teil des Krankheitsbildes. Lediglich in einem Fall wird am Ende einer<br />
Folge dieser Sachverhalt reflektiert, sodass eine Behandlungseinsicht entstanden<br />
ist. Dabei handelt es sich um den Zimmergenossen von Gregory House. Der<br />
zweite manische Charakter, König Julian aus Madagaskar 2, reflektiert nicht über<br />
seine Erkrankung. Allerdings besteht dahingehend auch keine Notwendigkeit, da<br />
er als Monarch Defizite oder Störungen nicht in derselben Form gespiegelt<br />
bekommt wie beispielsweise andere Charaktere. Außerdem ist seine Rolle auf<br />
Amüsement für die Zuschauer ausgelegt.<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass psychische Erkrankungen mit<br />
geringer Lebensqualität assoziiert ist. Dies drückt sich vor allem in der<br />
Stimmungslage des Betroffenen, sowie an den mit ihm verb<strong>und</strong>enen Örtlichkeiten<br />
aus. Bezüglich dieses Merkmals konnten einige besonders stereotype Charaktere<br />
extrahiert <strong>und</strong> diskutiert werden.<br />
Hypothese 7: „ Psychisch kranke Charaktere treten in Form von<br />
Anschauungsobjekten auf“.<br />
71
Es gibt 18 Figuren (95%), die mindestens einmal als Anschauungsobjekt fungiert<br />
haben. Diese Verteilung entspricht mit p< .001 einer hoch signifikanten Häufung<br />
dieses Merkmals. Bei insgesamt 7 Charakteren (37%) wird mindestens einmal<br />
Einblick in deren subjektive Wahrnehmung gegeben. Bei p= .179 konnte eine<br />
signifikante Unterrepräsentation dieser Darstellungsform nicht bestätigt werden.<br />
Wenn jedoch die Subjektperspektive greift, so ist diese häufig entweder mit<br />
Gewalt oder der spezifischen Symptomatik verknüpft.<br />
So wird etwa bei Morden bzw. Angriffen der Charaktere Eddy Orlofsky <strong>und</strong> Grenui<br />
häufig die Subjektperspektive als Darstellungselement verwendet. Diese zeigt sich<br />
vor allem in der individuellen Blickperspektive, welche der Zuschauer mit dem<br />
Protagonisten teilt. Außerdem kann schweres Atmen als Subjektmerkmal in<br />
Verbindung mit Gewalt identifiziert werden. Verarbeitungen sensueller Reize als<br />
häufig verwendetes Merkmal dieser Perspektive wird vornehmlich bei der<br />
Darstellung pathologischer Wahrnehmungsmuster verwendet. Dies geschieht bei<br />
Personen wie Ambros Monk, Prof. Langdon <strong>und</strong> Grenui. In den ersten beiden<br />
Fällen wird demonstriert wie eine Phobie die Wahrnehmung verzerrt. Bei Ambros<br />
Monk äußert sich dies, als er sein Haus verlassen muss <strong>und</strong> sich alles um ihn<br />
herum bedrohlich zu färben <strong>und</strong> drehen beginnt. Bei Prof. Langdon wird das<br />
Näherrücken von Wänden angedeutet <strong>und</strong> gibt Einblick in die Wahrnehmung<br />
eines Klaustrophobikers. Grenui stellt in gewisser Weise einen Sonderfall dar, da<br />
sich die/der ZuschauerIn mit dessen subjektiver Wahrnehmung auf vielen<br />
verschiedenen Gebieten konfrontiert sieht. Sowohl bei Gewalt <strong>und</strong> Auftreten der<br />
Symptomatik, als auch bei Erscheinen seiner besonderen Eigenschaft war der/die<br />
ZuschauerIn Teil seiner Wahrnehmung.<br />
Allerdings ist Grenui zudem eine Person mit einer der höchsten Rate an<br />
Objektdarstellung. Dies ist auf die Verwendung eines Erzählers zurückzuführen.<br />
Jedoch berichtet dieser nicht bloß über das Geschehen des Filmes oder bringt<br />
den Plot voran, sondern er sinniert bzw. macht Feststellungen über den Charakter<br />
des psychisch kranken Protagonisten. Ähnliches ist auch bei Eddy Orlofsky zu<br />
beobachten. Während seiner Gewalttaten wird Einblick in sein Erleben gegeben,<br />
die restliche Zeit jedoch wird er als eine Art klinischer Fall besprochen, dessen<br />
pathologische Genese Gegenstand von Vermutungen <strong>und</strong> Feststellungen ist.<br />
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass eine Subjektperspektive primär die<br />
72
Funktion hat Einsicht in die Pathologie eines Menschen zu erhalten, während<br />
Emotionen oder Wahrnehmungen anderer Ausrichtungen fokussiert. Liebe oder<br />
Fröhlichkeit könnten ebenfalls Gegenstand dieses Perspektivenmodus sein.<br />
Festgehalten werden kann, dass die Objektperspektive ein signifikant häufig<br />
gewählter Erzählmodus bezüglich psychisch kranker Charaktere in medialen<br />
Darstellungen ist.<br />
Abschließend lässt sich sagen, dass 6 stigmatisierende <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong><br />
in diesem Sample als repräsentiert angesehen werden können. Jedoch ist das<br />
Stereotyp der abnormalen Beziehung zu Partnerschaft <strong>und</strong> Sexualität nur<br />
unvollständig repräsentiert. Die Annahme einer Darstellung als inkompetent<br />
konnte hingegen vollständig falsifiziert werden.<br />
12.2 Rein qualitativ erhobene Ergebnisse<br />
Stereotyp der Infantilität:<br />
Dieses Stereotyp ist in seiner Ausprägung äußerst vielseitig. Viele Charaktere<br />
treten phasenweise infantil auf. Zum Teil handelt es sich dabei um situative<br />
Regressionen oder um tatsächlich kindlich entworfene Rollen, welche den<br />
charakterlichen Kern der Figur widerspiegeln sollen.<br />
Im Falle der situativen Regressionen, werden häufig die Paradoxie bzw. die<br />
Widersprüche innerhalb einiger psychisch kranker Charaktere verdeutlicht. Dies<br />
drückt sich in einer gewissen Spaltung der Person aus, welche auf der einen Seite<br />
aus Kompetenz, Stärke oder Gewalt besteht, auf der anderen Seite jedoch<br />
Aspekte existieren, die den Betroffenen wie ein ängstliches oder verspieltes Kind<br />
wirken lassen. Charaktere, welche dieses Merkmal erfüllen sind z.B. Buck, Monk,<br />
Harold <strong>und</strong> Prof. Langdon. Die innerpersonale Widersprüchlichkeit wird besonders<br />
an der Figur des Buck deutlich. Er ist ein hoch aggressiver Überlebenskünstler,<br />
der die meiste Zeit seiner Auftritte keinerlei infantilen Züge aufweist. In seiner<br />
Symptomatik wird jedoch ein spielerisch kindlicher Anteil deutlich. Er spielt mit<br />
Schädelhandpuppen <strong>und</strong> wälzt sich dabei auf der Erde. An solchen Stellen wird<br />
die Paradoxie dieses Charakters besonders überzeichnet. Allerdings zeigt die<br />
Beobachtung, dass die Infantilität als eine Art Korrelat der Symptomatik auftritt <strong>und</strong><br />
73
sie zeigt zusätzlich den engen Zusammenhang von psychischer Erkrankung <strong>und</strong><br />
Infantilität. Prof. Langdon krümmt sich vor Angst in einem engen Lastwagen,<br />
wobei seine Sitzhaltung eine fetale Stellung suggeriert. In der Reaktion seiner<br />
Gefährtin wird die Infantilität dieses Momentes jedoch deutlicher. Sie legt ihm die<br />
Hände aufs Gesicht, um ihm Linderung zu verschaffen. Dabei erzählt sie, dass<br />
dies mit ihr, als sie ein Kind war, auch immer so gemacht worden sei. Prof.<br />
Langdon weist, wie auch Buck, ansonsten keine weiteren infantilen<br />
Verhaltenweisen auf. Auffallend ist, dass auch hier die Infantilität gemeinsam mit<br />
der klaustrophobischen Symptomatik auftaucht. Weitere situative Regressionen<br />
sind etwa bei den Charakteren Adrian Monk <strong>und</strong> Harold vorhanden. Die<br />
Situationen ihres regressiven Verhaltens, finden im therapeutischen Setting statt.<br />
In einer Gruppentherapie streiten sich Mr. Monk <strong>und</strong> Harold auf dem Niveau<br />
zehnjähriger Buben. Es werden infantile Worte gebraucht, wobei Adrian Monk mit<br />
einem kindlich neologistisch anmutenden Begriff die verbale Infantilität in jener<br />
Situation am deutlichsten verkörpert. Dies geschieht in Anwesenheit des<br />
Therapeuten. Hier wird das kognitive Schema Familie wirksam, bzw. liegen<br />
Assoziationen dahingehend nahe. Im Schema Familie kommt dem männlichen<br />
Therapeuten die väterliche Rolle zu. Mr. Monk <strong>und</strong> Harold treten als streitende<br />
Brüder auf. Eine solche Eltern-Kind Analogie unterstreicht die Regression der<br />
Protagonisten im therapeutischen Kontext zusätzlich.<br />
Neben den situationsbedingten Regressionen gibt es Figuren, deren Charakter<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich infantil gezeichnet ist oder Verhaltensweisen gehäuft kindliche Züge<br />
tragen. Als solche Charaktere können König Julian <strong>und</strong> Dr. House´<br />
Zimmergenosse in der Psychiatrie Alvie, angesehen werden. Besonders kindlich<br />
wird König Julian konstruiert. Sein erster Auftritt beginnt mit der Präsentation einer<br />
Verkleidung. Er präsentiert seinem Volk das Resultat eines Verkleidungsspiels<br />
<strong>und</strong> möchte dafür Applaus ernten. Zudem gibt er an späterer Stelle preis, dass er<br />
einmal „Pfeiffer“ werden wolle. Dazu gibt er auch gleich eine Demonstration seines<br />
Könnens <strong>und</strong> entledigt sich einiger klanglos feuchter Pfeiftöne. Diese Situation<br />
erinnert, von der gescheiterten Demonstration einmal abgesehen, an kindliche<br />
Berufswünsche wie Astronaut oder Superstar. Ähnlich wie König Julian wird auch<br />
Alvie häufig kindlich dargestellt. So zeigt er Dr. House wie ein aufgeregter Junge<br />
die Anstalt. Darüber hinaus wird er trotzig dargestellt <strong>und</strong> boykottiert<br />
psychiatrische Hilfe wie ein bockiges Kind. Allerdings ist er auch ein Charakter,<br />
74
der immer wieder anprangert, dass die Psychiatrie die beherbergten Patienten wie<br />
Kleinkinder behandle.<br />
Auffallend ist, dass ProtagonistInnen, die eine gewisse Kontinuität in ihrer<br />
infantilen Auftrittsweise zeigen, die Diagnose Manie haben. Es können daher<br />
Effekte vermutet werden, die von dieser Diagnose hinsichtlich infantiler<br />
Darstellung ausgehen.<br />
Allerdings tritt das Stereotyp der Infantilität selten als charakterliches Kontinuum<br />
auf, sondern entsteht im Kontext spezifischer Symptombilder oder spezieller<br />
Situationen. Die Infantilität äußert sich in diesen Fällen meist als Regression,<br />
welche mit Abschluss der Situation wieder vorüber ist.<br />
Stereotyp des schwierigen Gesprächspartners:<br />
Die Konversationstypen dieser Stichprobe sind als heterogen zu bezeichnen. Es<br />
gibt Charaktere, die phasenweise überhaupt nicht sprechen können/wollen, <strong>und</strong><br />
andere, die in ihrer Kommunikation hinsichtlich der Verständlichkeit für andere<br />
Defizite aufweisen. Allerdings sind viele Protagonisten eloquent <strong>und</strong> können<br />
beispielsweise ihre Expertise ohne Probleme verbal kommunizieren. Dr. House<br />
<strong>und</strong> Prof. Robert Langdon sind die markantesten Vertreter dieser Gruppe. Wobei<br />
Gregory House ebenfalls als schwieriger Gesprächspartner gelten kann, sich dies<br />
jedoch auf die Form <strong>und</strong> Manier bezieht, <strong>und</strong> weniger auf dessen<br />
Ausdrucksvermögen. Auch Rumpelstilzchen widerlegt diesen <strong>Stereotype</strong>n, durch<br />
seine Kunst der Verführung. Er verführt andere Personen mit gekonnter Zunge zu<br />
Vertragsabschlüssen <strong>und</strong> beweist dabei besonderes Geschick während des<br />
„Verkaufsgespräches“.<br />
Charaktere, die gar nicht sprechen bzw. einen Großteil ihrer Auftrittszeit ohne<br />
verbale Artikulationen gezeigt werden, werden durch die Charaktere der Cellistin<br />
<strong>und</strong> Freedommaster der Serie Dr. House repräsentiert. Auch die Figur des Grenui<br />
kann als schwieriger Gesprächspartner angesehen werden. Seine Antworten sind<br />
überwiegend lakonischer Natur <strong>und</strong> sind selten Teil eines Dialoges, sondern<br />
tauchen in Frage-Antwort Situationen auf. In einem großen Teil seiner Auftrittszeit<br />
spricht Grenui nicht. Zudem wird erwähnt, dass er erst sehr spät sprechen gelernt<br />
habe. Des Weiteren wird an vielen Stellen deutlich, dass sein Wortschatz große<br />
Defizite aufweist. Diese drei Charaktere bestätigen das Stereotyp in Richtung<br />
75
Wortkargheit mit der Konsequenz, dass in Gesprächen mit psychisch kranken<br />
Personen, das verbale Feedback des Betroffenen gering sein dürfte.<br />
Eine andere Gruppe, die als schwierige Gesprächspartner zu bezeichnen sind,<br />
erfüllt den Stereotyp in entgegengesetzter Richtung. Die verbal aufbrausende<br />
Gruppe zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass ihre Sprechgeschwindigkeit<br />
besonders hoch <strong>und</strong> der transportierte Inhalt besonders unverständlich ist. König<br />
Julian, Buck <strong>und</strong> Alvie stellen Konversationstypen dieser Art dar. Ihre Sprechweise<br />
ist reich an Tempo <strong>und</strong> Informationsdichte. Dabei werden nicht selten kluge<br />
Gedanke formuliert, doch scheinen diese im Angesicht ihres Vortrags an Gewicht<br />
zu verlieren. Buck referiert beispielsweise über Fre<strong>und</strong>schaft <strong>und</strong> Beziehungen.<br />
König Julian spricht über die Liebe <strong>und</strong> das Werben um Frauen, sowie über<br />
Lebensmotivation. Beide Vorträge sind jedoch mit vielen komödiantischen<br />
Elementen versetzt, welche den Eindruck erwecken können, das Gesagte habe<br />
nicht soviel Gewicht. Auf der anderen Seite wird sich dabei des Schemas des<br />
weisen Narren bedient, welcher unerwartet weise Ratschläge erteilt oder<br />
verkörpert. Trotz dessen ist die Form der Kommunikation als teilweise zerfahren<br />
<strong>und</strong> wirr zu bezeichnen.<br />
Auffallend ist außerdem die spezielle Kommunikation im therapeutischen Setting.<br />
Der verbale Austausch ist hier unter anderem von Trotzigkeit (Dr. House),<br />
Anpassung (Harold) oder Uneinsichtigkeit (Monk) geprägt. Abwehr <strong>und</strong> Symbiose<br />
sind markante Momente, welche die Kommunikation in diesem Kontext prägen.<br />
Allerdings können, wie bereits erwähnt, die meisten Charaktere in ihrer<br />
Kommunikation als nicht herausstechend schwierig angesehen werden. Vielmehr<br />
glänzen einige Charaktere mit Schlagfertigkeit <strong>und</strong> Ausdrucksvermögen. Etwa<br />
gelingt es David Williams durch eine verbindliche Art, seine Tarnung bis zum<br />
Schluss aufrecht zu erhalten. Am Gelingen seines Racheplans ist die Fähigkeit zu<br />
verbindlicher Kommunikation, in hohem Maße mitbeteiligt.<br />
Dieses Stereotyp ist lediglich bei einzelnen Charakteren auffindbar <strong>und</strong> zudem<br />
äußerst heterogen in seiner jeweiligen Manifestation.<br />
Stereotyp des Selbst Schuld an der Erkrankung:<br />
Keinem der 19 Charaktere wird explizit Schuld an ihrer Erkrankung gegeben. Es<br />
kann jedoch zwischen zwei Gruppen unterschieden werden. Auf der einen Seite<br />
76
stehen diejenigen, zu deren Krankheitsursache keine Angaben gemacht oder<br />
Hinweise gegeben werden. Die tatsächliche Ursache wird nicht thematisiert <strong>und</strong><br />
bleibt somit offen. Ein Beispiel dafür ist Grenui. Die Ursache seiner Erkrankung<br />
bekommt beinahe mystische Dimensionen. Bei diesem Charakter wird noch am<br />
ehesten auf unerklärbare Faktoren seiner Pathogenesse verwiesen. Wohingegen<br />
bei den meisten anderen Charakteren die Ursache <strong>und</strong> somit auch die<br />
Verantwortung für die Erkrankung nicht thematisiert wird.<br />
Auf der anderen Seite wird bei einigen ProtagonistInnen auf mögliche<br />
Entstehungsgründe verwiesen. Diese Gründe sind zumeist auf externe Faktoren<br />
zurückzuführen <strong>und</strong> weisen damit die Eigenverschuldung des/der ProtagonistIn<br />
von ihm/ihr fort. Besonders deutlich wird dies in der Desperate Housewives Folge<br />
Die Entstehung eines Monsters illustriert. Die Folge endet mit der Feststellung,<br />
dass Monster durch andere Monster erschaffen würden. Hiermit wird die Schuld<br />
an Eddy´s Erkrankung von ihm selber abgekehrt. Stattdessen sei das Verhalten<br />
der Mutter Barbara der entscheidende Faktor für seine Erkrankung. Wie bereits<br />
erwähnt wird beim Charakter des Adrian Monk auf eine Kindheit/Erziehung<br />
verwiesen, welche von neurotischen Regeln, Weisungen <strong>und</strong> Verhaltensweisen<br />
geprägt war. Auch hier wird die Verantwortung für die Entstehung der<br />
Symptomatik auf den externen Faktor Mutter bzw. Erziehung verschoben. Auch<br />
bei Alvie wird ein externer Faktor als verantwortlich präsentiert. Dieser Faktor ist<br />
ein Trauma. Dabei wird erwähnt, dass Alvie Objekt sexueller Übergriffe eines<br />
Verwandten geworden sei, als er noch ein Kind war. Charaktere dieser<br />
Darstellungsformen können als Opfer von Personen oder Umständen bezeichnet<br />
werden. Im vorliegenden Sample ist diese Form Ätiologievorstellung<br />
diskursdominant.<br />
Allerdings sollte auch dabei auf die Unterscheidung von Auslösern <strong>und</strong> Ursachen<br />
geachtet werden. Katherine Mayfair <strong>und</strong> Barbara Orlofsky zeigen ihre Symptome<br />
jeweils nachdem sie von ihren Partnern verlassen wurden. Ihre pathologischen<br />
Reaktionen auf diese Ereignisse können eventuell auf eine Prädisposition<br />
schließen lassen <strong>und</strong> können das Fehlen anderer Coping-Strategien erklären.<br />
Allerdings wird dies zu keinem Zeitpunkt thematisiert <strong>und</strong> kann lediglich als<br />
Relativierung des vorher Gesagten gesehen werden.<br />
77
Trotzdem werden die betroffenen Personen dieser Stichprobe als unschuldig für<br />
ihre Erkrankung betrachtet. Ihnen werden keine Charakterfehler oder unsittlichen<br />
Lebensformen unterstellt, welche für ihre Erkrankung verantwortlich sein könnten.<br />
Hinsichtlich der Entstehung der Erkrankung trifft die Betroffenen keine Schuld.<br />
Allerdings bekommen sie Verantwortung für den Verlauf <strong>und</strong> den<br />
Genesungsprozess zugesprochen. Sie selber sind zwar nicht der Gr<strong>und</strong> für ihre<br />
Erkrankung, allerdings können sie Einfluss auf deren Verlauf nehmen. Dieser<br />
Aspekt hängt stark mit Überlegungen zu Prognosen zusammen, weshalb nähere<br />
Erläuterungen im folgenden Absatz zum thematischen Gegenstand werden sollen.<br />
Stereotyp der schlechten Prognose:<br />
Die Prognosen des jeweils vorliegenden Störungsbildes werden explizit kaum<br />
thematisiert. Bei insgesamt 5 Charakteren wird das Thema der Prognose<br />
aufgegriffen <strong>und</strong> zumeist subtil geäußert. Bei 2 Charakteren wird auf eine eher<br />
schlechte Prognose hingedeutet. So befindet sich Monk in seiner bereits 1999<br />
Therapiest<strong>und</strong>e <strong>und</strong> ist sich sicher, dass er noch viele mehr benötigen wird.<br />
Darüber hinaus steht in seiner Krankenakte ein Vermerk, dass er unheilbar sei. In<br />
einer therapeutischen Sitzung verkündet Monk selbst, dass Veränderungen<br />
unmöglich seien. David Williams entgegnet dem Gesprächsversuch einer anderen<br />
Darstellerin, dass es bei ihm keinen Sinn habe, da bereits viele TherapeutInnen<br />
nichts erreicht hätten.<br />
Diesen Charakteren stehen 3 andere ProtagonistInnen gegenüber, deren<br />
Prognose positiv thematisiert wird. Eine andere Figur aus Desperate Housewives,<br />
spricht mit der Tochter von Katherine Mayfair. Dabei vertritt jene die Haltung, dass<br />
nach einer Behandlung alles wieder gut würde. Sie müsse dafür jedoch in<br />
Behandlung gehen. An dieser Stelle wird deutlich, dass, ohne dies explizit zu<br />
thematisieren, Heilung eine selbstverständliche Option bei psychischen<br />
Erkrankungen sei. Implizit wird die Position transportiert, dass es<br />
Behandlungen/Therapien gibt, welche zur Heilung führen können. Bei 2 weiteren<br />
Charakteren wird sogar die Heilung von Akutsymptomen sichtbar. Dr. House wird<br />
von seiner Sucht <strong>und</strong> seiner psychotischen Symptomen, als geheilt aus der<br />
Psychiatrie entlassen. Ebenso wird die „sprachlose“ Cellistin als geheilt entlassen,<br />
wobei hier lediglich akute Symptome aufgelöst werden konnten <strong>und</strong> sich<br />
Rehabilitationsmaßnahmen anschließen sollen. Insbesondere vom Heilungserfolg<br />
78
des Dr. House motiviert beschließt Alvie ebenfalls den Weg in Richtung Heilung zu<br />
gehen. Er sagt, dass er ges<strong>und</strong> werden wolle <strong>und</strong> daher die angedachten<br />
Medikamente auch wirklich nehmen werde. An dieser Stelle wird deutlich, dass<br />
hier eine Position vertreten wird, dass Heilung möglich ist. Jedoch ist die<br />
Vorraussetzung ein gewisses Maß an Compliance. Nachdem dies von Dr. House<br />
aufgebracht wurde setzte dessen Heilung ein. Damit lässt sich der Bogen zum<br />
Stereotyp der Selbstverschuldung zurückspannen. Den PatientInnen wird also<br />
hinsichtlich der Prognose Verantwortung gegeben, sie sind in der Lage aktiv<br />
Einfluss auf ihre Erkrankung zu nehmen. Entscheiden sie sich gegen eine<br />
Zusammenarbeit mit der behandelnden Institution oder verweigern die<br />
Medikamenteneinnahme so tragen sie selber Schuld an der Ausprägung <strong>und</strong><br />
Dauer der Erkrankung. Es kann hiermit bestärkt werden, dass Schuld hinsichtlich<br />
der Entstehung nicht beim Betroffenen selbst liegt, jedoch die Verantwortung für<br />
den Verlauf sehr wohl bei den PatientInnen liegt.<br />
Dennoch kommt das Stereotyp der Selbstverschuldung in dieser Stichprobe nicht<br />
zum Einsatz der Rollenzeichnung.<br />
13 Diskussion<br />
Die Untersuchung an der vorliegenden Stichprobe, welche aus der Analyse von<br />
15 Kinofilmen, sowie 9 Episoden dreier Serien generiert wurde, deutet auf einen<br />
stark stereotypen bzw. <strong>Vorurteile</strong> reproduzierenden Darstellungsmodus hin.<br />
Insgesamt konnten 5 der 7 quantitativ erhobenen <strong>Stereotype</strong>/<strong>Vorurteile</strong> als<br />
repräsentiert ausfindig gemacht werden. Bei einem weiteren Stereotyp ist nur ein<br />
Merkmal nicht signifikant häufig Teil der Darstellung. Lediglich die Annahme der<br />
Verwendung eines <strong>Stereotype</strong>n konnte vollständig verworfen werden.<br />
Die <strong>Stereotype</strong> sind stigmatisierenden Charakters <strong>und</strong> erfüllen zu einem großen<br />
Teil die Kriterien einer rein negativen Darstellung. Diese Beobachtung<br />
korrespondiert mit Annahmen der wissenschaftlichen Literatur, in denen eine<br />
überwiegend negative Darstellung psychisch kranker ProtagonistInnen postuliert<br />
wird (vgl. Gerbner zit. nach Wilson, Nairn, Coverdale & Panapa, 1999, S. 232).<br />
Besonders negativ assoziierte <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> sind diejenigen, welche<br />
79
mit Fremdgefährdung in Verbindung gebracht werden können bzw. generell Angst<br />
auslösend sind. Dazu zählen in der vorliegenden Untersuchung insbesondere die<br />
<strong>Stereotype</strong> der Gefährlichkeit <strong>und</strong> der Unberechenbarkeit. Die beiden Annahmen<br />
sind für die gegenständliche Stichprobe charakteristisch <strong>und</strong> sind ein wesentliches<br />
Merkmal vieler Charaktere. Eine frühere Untersuchung aus den späten 1990er<br />
Jahren von Clair Wilson, Raymond Nairn, John Coverdale <strong>und</strong> Aroha Panapa<br />
(1999) spiegelt diesbezüglich ähnliche Ergebnisse wider. Gefährlichkeit <strong>und</strong><br />
Unberechenbarkeit stellten zwei der drei häufigsten Darstellungsmuster psychisch<br />
kranker ProtagonistInnen in Fernsehserien dar. Diese Untersuchung wurde in den<br />
Jahren 1995/96 durchgeführt. (vgl. Wilson, Nairn, Coverdale & Panapa, 1999, S.<br />
237). Auch circa zehn Jahre später kann sich diese Stereotypie in der Zeichnung<br />
psychisch kranker Charaktere halten. Die Überzufälligkeit der Reproduktion der<br />
<strong>Stereotype</strong> Gefährlichkeit <strong>und</strong> Unberechenbarkeit (siehe Hypothese 1 <strong>und</strong> 3) in<br />
der vorliegenden Untersuchung, deuten angesichts der 1999 publizierten<br />
Untersuchung an einem Sample von 1995/96, auf Kontinuität <strong>und</strong> Rigidität<br />
hinsichtlich der beiden Merkmale hin.<br />
Bei genauerer Betrachtung handelt es sich beim Stereotyp der Gefährlichkeit um<br />
ein Konzept, welches sich facettenreich präsentiert. Die Heterogenität der<br />
Merkmalsausprägungen wird auch in dieser Analyse deutlich. Es gibt Mörder,<br />
Retter, Rächer <strong>und</strong> Charaktere, welche Aggressionen in Form psychischer Gewalt<br />
ausagieren. Auffallend dabei ist, dass weibliche Charaktere ein hohes Maß<br />
psychischer Aggressivität aufweisen. An Bezeichnungen wie Mörder, Retter oder<br />
Rächer werden andere kognitive Schemata im Zusammenhang mit psychisch<br />
kranken Personen <strong>und</strong> Gefährlichkeit wirksam. Aus den verschiedenen<br />
vorhandenen Aggressionsprofilen ergibt sich die Frage, ob es zu einer<br />
<strong>Stereotype</strong>nkombination kommen kann. Das heißt, dass die Etikette psychisch<br />
krank implizit mit Mördern oder Rächern verknüpft werden. Umgekehrt könnte dies<br />
bedeuten, dass Figuren mit ausgeprägten Racheimpulsen automatisch in die<br />
Differenzkategorie psychisch krank fallen. An dieser Stelle wird die Problematik<br />
der induktiven <strong>und</strong> deduktiven <strong>Stereotype</strong> (vgl. Jonas, 2002, S. 41) deutlich. (siehe<br />
Kapitel 2). Wie bereits angesprochen besteht unter den verschiedenen<br />
Aggressionsprofilen jedoch eine starke Heterogenität, sodass hier schwer<br />
verallgemeinernde Aussagen über den/die aggressiven psychisch Kranke(n)<br />
getroffen werden können. Festgehalten werden kann, dass innerhalb der<br />
80
Differenzkategorie psychisch krank Platz für die unterschiedlichsten Formen von<br />
Aggression ist. Es bleibt jedoch zu diskutieren inwieweit sich die Aggressivität <strong>und</strong><br />
Gefahr, die von psychisch kranken Charakteren ausgeht, von denen „ges<strong>und</strong>er“<br />
ProtagonistInnen unterscheidet. Der identifizierte Zusammenhang von aktiver<br />
Aggression <strong>und</strong> Kontrolle durch die Symptome (siehe Hypothese 3) lässt<br />
diesbezüglich Vermutungen zu. Ein mögliches Merkmal spezifisch „psychisch<br />
kranker Aggression“ ist ihr kombiniertes Auftreten mit einer erkrankungsnahen<br />
Symptomatik. Viele Charaktere weisen eine Kombination dahingehend auf, wobei<br />
dies für physische <strong>und</strong> psychische Aggression gleichermaßen zutrifft. Das<br />
bedeutet, dass ein Zusammenhang zwischen dem Vorliegen einer psychischen<br />
Erkrankung bzw. deren Symptomatik <strong>und</strong> Aggression/ Gefahr medial suggeriert<br />
wird, wobei Aggression <strong>und</strong> Gefahr als heterogenes Konstrukt zu begreifen ist.<br />
Das stark repräsentierte Stereotyp des Determinismus (siehe Hypothese 3)<br />
unterstreicht angesichts der voranstehenden Beobachtung das Gefahren-/<br />
Aggressionspotential, welches von einer psychisch kranken Person zu erwarten<br />
ist.<br />
Im Kontext des <strong>Stigma</strong>diskurses hat dieser <strong>Stereotype</strong>n- <strong>und</strong> Vorurteilskomplex<br />
eine höchst stigmatisierende Wirkung. Anhand des <strong>Stigma</strong>prozesses (vgl. Link &<br />
Phelan, 2001, S. 366ff.) wird angesichts der benannten <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong><br />
die Gefahr der Diskriminierung psychisch kranker Menschen deutlich. Auf diesen<br />
Aspekt soll später noch näher eingegangen werden.<br />
Die Sexualität psychisch kranker ProtagonistInnen fällt hingegen weitaus<br />
homogener aus. Vor allem das geringe Vorkommen verpartnerter Personen (siehe<br />
Hypothese 4) gibt Aufschluss über die mediale Verwendung psychisch kranker<br />
Rollen. Im Spiel der Liebe werden diese nämlich als Verlierer dargestellt. Sie<br />
können als Opfer vergangener Beziehungen auftreten, was besonders auf<br />
weibliche Charaktere zutrifft <strong>und</strong> in einigen Fällen durch psychische <strong>und</strong> physische<br />
Gewalt kompensiert wird. Die schlechte Position psychisch kranker Menschen im<br />
Gefüge von Partnerschaft <strong>und</strong> Liebe wird darüber hinaus durch die geringe<br />
libidinöse Resonanz anderer Charaktere bezüglich der psychisch Kranken (siehe<br />
Hypothese 4) deutlich. Die Rolle begehrenswerter Individuen wird den Betroffenen<br />
nur selten zu Teil. Insgesamt drei Charaktere kanalisieren ihren Liebesfrust durch<br />
Aggression, wobei es sich nicht um Sexualdelikte handelt. Dieses Stereotyp,<br />
81
welches etwa im Laiendiskurs über schizophrene PatientInnen existiert <strong>und</strong> von<br />
Matthias Angermeyer <strong>und</strong> Herbert Matschinger (2004) in einer Studie verwendet<br />
wurde, kann daher in dieser Form als nicht repräsentiert angesehen werden. Die 3<br />
Charaktere spielen jedoch auf einen Zusammenhang zwischen unerfülltem<br />
Liebesleben <strong>und</strong> Aggression an. Da die meisten erkrankten ProtagonistInnen kein<br />
Begehren erfahren, kann es passieren, dass falsche Kausalitäten angenommen<br />
werden können. Denn gleichgültig ist den Betroffenen Liebe <strong>und</strong> Sexualität in<br />
dieser Stichprobe nicht. Die Vermutung einer asexuellen Darstellung konnte nicht<br />
bekräftigt werden, obgleich einige Charaktere auch einem solchen Profil<br />
entsprechen. Die Charaktere sind nämlich nicht signifikant selten liebende<br />
Subjekte. Es ergibt sich also das Dilemma liebesfähiger Subjekte, welche keine<br />
Erwiderung ihrer Bedürfnisse erfahren.<br />
Weitere Beobachtungen legen nahe, dass das medial vertretene Konzept<br />
psychischer Krankheit dies nicht zulässt. Vorsichtig formuliert kann von einer<br />
funktionalen Trias gesprochen werden. Psychische Krankheit wird durch<br />
traumatische Beziehungserlebnisse ausgelöst, eine psychische Erkrankung ist ein<br />
Hindernis für Partnerschaft oder Attraktivität <strong>und</strong> letztlich unterstreicht das Fehlen<br />
von Partnerschaft trotz des bestehenden Bedürfnisses die geringe Lebensqualität<br />
der Betroffenen. Es scheint als fungiere die Dimension Liebe <strong>und</strong> Partnerschaft<br />
mit der Funktion, die benannten drei Momente zu verdeutlichen. Ein ernsthafter<br />
<strong>und</strong> vor allem nicht pathologischer Liebesdiskurs, der ohne ein trotz auskommt,<br />
konnte lediglich in einem Fall vermerkt werden.<br />
Das Spannungsfeld von Partnerschaft <strong>und</strong> psychischer Erkrankung findet auch in<br />
einem Item eines von Ines Winkler <strong>und</strong> KollegInnen (2008) verwendeten<br />
Fragebogens zur Messung von sozialer Distanz Ausdruck. Hier fungiert dieser<br />
Bereich als Parameter zur Messung von Distanzbedürfnissen. Es kann also<br />
vermutet werden, dass dieser Diskurs von der Frage nach Vereinigung mit dem<br />
erkrankten Subjekt überformt ist. Vereinigung als Antagonie zur Distanz, wie bei<br />
Winkler <strong>und</strong> KollegInnen (2008) verwendet, gibt Anlass zu dieser Interpretation.<br />
Vereinigung steht zu dem der Bildung von in- <strong>und</strong> outgroups diametral entgegen,<br />
vielmehr bedeutet sie deren Aufhebung. Damit sei auch auf die sozialen<br />
Funktionen von <strong>Stereotype</strong>n verwiesen (vgl. Tajfel zit. nach Jonas, 2002, S. 9).<br />
Das Zeigen normaler <strong>und</strong> funktionierender Partnerschaftsverhältnisse würde durch<br />
82
das Element der Vereinigung, die Ausgrenzung in eine outgroup erschweren.<br />
Darüber hinaus würden damit zentrale Aspekte des Modells des<br />
<strong>Stigma</strong>tisierungsprozesses von Bruce Link <strong>und</strong> Jo Phelan (2001) fehlen.<br />
Das fehlende Anzeigen von Vereinigung ist nämlich sinnbildlich für einige Schritte<br />
im Modell des <strong>Stigma</strong>tisierungsprozesses von Bruce Link <strong>und</strong> Jo Phelan (2001).<br />
So würde die Kenntlichmachung der Abweichung von der Bevölkerungsnorm<br />
geschwächt, ebenso die letztendliche Ausgrenzungen unwahrscheinlicher, da eine<br />
Vereinigung Inklusion impliziert (siehe Kapitel 5). Psychisch kranke<br />
ProtagonistInnen erhielten so ein Stück „Normalität“ in ihrer Darstellung zurück, da<br />
ihre scheinbare Abweichung zur Bevölkerungsnorm geringer erscheinen würde.<br />
Weshalb aber die Selbstverständlichkeit gelebter körperlicher <strong>und</strong> seelischer<br />
Intimität psychisch kranker Menschen keinen größeren Platz im<br />
Darstellungsmodus erhält, lässt vermutlich auf die Stärke <strong>und</strong> Präsens ihres<br />
<strong>Stigma</strong>s schließen. Dieses <strong>Stigma</strong> wird jedoch durch die Reproduktion, sowie das<br />
Anbieten von Schemata/ <strong>Stereotype</strong>n weiterhin genährt. In dieser Untersuchung<br />
sind im Falle der Sexualität nur indirekte <strong>Stereotype</strong> erfasst worden. Das heißt<br />
<strong>Stereotype</strong>, die nicht betont wurden, sondern einfach als gegebenes Faktum in die<br />
jeweilige Darstellung eingeflossen sind. Damit wird die implizite Dimension dieser<br />
stereotypen Darstellungsform deutlich.<br />
Mit der Frage der Vereinigung ist die Thematik der Generativität verb<strong>und</strong>en. Es<br />
gibt zwar psychisch kranke Personen mit Kindern, wobei diese vor Ausbruch der<br />
jeweiligen Erkrankungen geboren wurden. Darüber hinaus existieren Beispiele in<br />
dieser Untersuchung, anhand derer gezeigt werden kann, dass psychische<br />
Erkrankung innerfamiliär weitergegeben wird. Es handelt sich dabei nicht um<br />
biologistische Verweise, sondern Darstellungselemente, die auf den negativen<br />
Einfluss psychisch kranker Eltern auf ihre Kinder hinweisen. In einem Fall geht der<br />
negative Einfluss so weit, dass gar ein Serienmörder als Resultat misslungener<br />
Erziehungsarbeit steht.<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Darstellung psychisch kranker<br />
Personen hinsichtlich Liebe <strong>und</strong> Sexualität als Ausdruck impliziter <strong>Stigma</strong>tisierung<br />
interpretiert werden kann. Diese <strong>Stigma</strong>tisierung ist jedoch nicht offen thematisiert,<br />
sondern äußert sich in scheinbaren Selbstverständlichkeiten, wie etwa der<br />
partnerlosen Darstellung oder dem unkommentierten Fehlen begehrt zu werden.<br />
83
Durch diese Selbstverständlichkeit der beschriebenen Darstellung liegt das implizit<br />
stigmatisierende (vgl. Rüsch, 2010, S. 292) Moment, das sich im bereits<br />
erwähnten theoretischen Modell der <strong>Stigma</strong>tisierung (vgl. Link & Phelan, 2001, S.<br />
363ff.) abbilden <strong>und</strong> gemäß sozial funktionaler Aspekte von <strong>Stereotype</strong>n<br />
interpretieren lässt (vgl. Tajfel zit. nach Jonas, 2002, S. 9).<br />
Ein funktionaler Aspekt der spezifischen Thematisierung von Liebe <strong>und</strong> Sexualität<br />
im Zusammenhang mit psychischer Erkrankung fokussiert das Hervorheben<br />
geringer Lebensqualität. Ungeachtet dessen handelt es sich bei dem Stereotyp<br />
der geringen Lebensqualität um einen der am deutlichsten repräsentierten dieser<br />
Stichprobe. Die überwiegende Darstellung des „Unglücklichseins“, sowie die<br />
größtenteils negativen Auftrittsorte (siehe Hypothese 6) sprechen für einen<br />
gehäuften Einsatz dieser <strong>Stereotype</strong>n in der medialen Darstellung im vorliegenden<br />
Sample. Zu beobachten ist zudem, dass besonders bei manischen Charakteren<br />
auf eine betrübte Darstellung verzichtet wird. Die manischen Figuren sind in das<br />
von Clair Wilson, Raymond Nairn, John Coverdale <strong>und</strong> Aroha Panapa (2000)<br />
identifizierte Darstellungsmuster psychisch kranker ProtagonistInnen im<br />
Kinderfernsehen einzuordnen. Die Autoren bemerkten eine<br />
Darstellungsdichotomie, welche die zwischen Bösewicht <strong>und</strong> Witzfigur kontrastiert.<br />
Die rein manisch dargestellten Charaktere entsprechen der Darstellungsweise<br />
einer Witzfigur, wie von Clair Wilson, Raymond Nairn, John Coverdale <strong>und</strong> Aroha<br />
Panapa (2000) postuliert. Damit fallen sie aus dem in dieser Arbeit verwendeten<br />
Muster zur Identifikation von geringer Lebensqualität heraus. Die übrigen<br />
Charaktere erfüllen jedoch die angesetzten Kriterien <strong>und</strong> führen damit zu der<br />
Deutlichkeit der Ergebnisse.<br />
Geringe Lebensqualität ist ein Merkmal, welches mit anderen <strong>Stereotype</strong>n <strong>und</strong><br />
<strong>Vorurteile</strong>n korrespondiert. In Bezug auf Liebe <strong>und</strong> Sexualität ist dieser Effekt<br />
bereits ausführlich diskutiert worden. Hinsichtlich Gefahr <strong>und</strong> Aggression fungiert<br />
vor allem Frust, als Folge <strong>und</strong> Ursache geringer Lebensqualität, als Antrieb<br />
aggressiv kompensierenden Verhaltens. Damit wird zwar eine beinahe<br />
entschuldigende Erklärung für manche Verhaltenweisen offeriert, wobei das<br />
stigmatisierende Moment das markantere Profil aufweist. Psychisch krank zu sein<br />
wird als enorme Last für den Betroffenen dargestellt <strong>und</strong> bringt ihn damit in eine<br />
bemitleidenswerte Position. Damit verb<strong>und</strong>en ist auch die Belastung für das<br />
84
jeweilige Umfeld. Als eine Folge dieser Belastung wird in der vorliegenden Arbeit<br />
die negativen Reaktionen anderer als Parameter dieses <strong>Stereotype</strong>s gewählt.<br />
Dabei konnte beobachtet werden, dass Reaktionen auf Krankheitserscheinungen<br />
wie etwa spezifische Symptomatik, signifikant häufiger negativ als positiv<br />
unterstützend (siehe Hypothese 5) sind. Diese Form des Umgangs anderer mit<br />
der Symptomatik Betroffener lässt darauf schließen, dass Anstelle von Mitleid <strong>und</strong><br />
Ermutigung mit Abwertung zu rechnen ist. Bezüglich des antizipierten <strong>Stigma</strong>s<br />
(vgl. Quinn & Chaudoir, 2009, S. 636), ist dieser Stereotyp besonders<br />
problematisch (siehe Kapitel 3). Auch die Inanspruchnahme des Umfeldes durch<br />
die/den psychisch Kranke(n) ist Teil des Diskurses. Dabei ist die Darstellung unter<br />
den 19 Charakteren jedoch als heterogen zu bezeichnen <strong>und</strong> lässt keine<br />
generalisierten Aussagen zu.<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ausprägung dargestellter<br />
Negativreaktionen sowie das Fokussieren auf defizitäre Lebensqualität, als hoch<br />
eingeschätzt werden kann. Besonders in den negativen Reaktionen des Umfeldes<br />
werden Handlungsentwürfe im Umgang mit psychisch kranken Menschen<br />
angeboten, welche im Sinne der Theorie des sozialen Lernens in der Realität als<br />
adäquate Reaktionsformen reproduziert werden (vgl. Stout, Villegas & Jennings,<br />
2004, S. 544) (siehe Kapitel 6.2.2.). Da die angebotenen Reaktionsmuster in<br />
ablehnend negativer Art gestaltet sind, kann dieses Stereotyp als Anleitung zur<br />
Exklusion <strong>und</strong> othering gesehen werden. Die explizite <strong>Stigma</strong>tisierung findet im<br />
Zusammenhang mit diesem Stereotyp besonderen Ausdruck <strong>und</strong> deutet auf eine<br />
weitere Ebene der <strong>Stigma</strong>tisierung hin. In den untersuchten Medien sind nämlich<br />
Prozesse einer Diskriminierung sichtbar. Diskriminierung ist die <strong>Stigma</strong>tisierung<br />
auf der behavioralen Ebene (vgl. Rüsch, Finzen, Berger & Angermeyer, 2004, S.<br />
4).<br />
Das Stereotyp der Inkompetenz konnte nur in geringem Maße identifiziert werden<br />
<strong>und</strong> ist kein vordergründiges Darstellungsmerkmal psychisch kranker<br />
ProtagonistInnen. Auch die Infantilität, welche rein qualitativ untersucht wurde, trifft<br />
lediglich auf wenige Charaktere zu <strong>und</strong> steht primär in Verbindung mit einer<br />
spezifischen Diagnose. Dieses Ergebnis widerspricht dem Ergebnis einer früheren<br />
Untersuchung bei der Infantilität ein wesentliches Zeichen psychisch kranker<br />
Charaktere darstellt (vgl. Wilson, Nairn, Coverdale & Panapa, 1999, S. 232ff.).<br />
85
Bezüglich dieses Aspektes deuten sich Veränderungstendenzen an, welche<br />
jedoch auf diesen Stereotyp begrenzt bleiben.<br />
Das Vorhandensein besonderer Eigenschaften, die bei ca. der Hälfte der<br />
Charaktere ausfindig gemacht werden konnten, kann als positives Stereotyp (vgl.<br />
Hayward & Brights zit. nach Angermeyer & Matschinger, 2004, S. 1050)<br />
bezeichnet werden. Allerdings trägt dieses auch eine latent stigmatisierende<br />
Dimension in sich. Zum einen wird eine starke Assoziation von „Genie <strong>und</strong><br />
Wahnsinn“ aktiviert <strong>und</strong> zum anderen unterstreicht ein besonderes Merkmal,<br />
welches sogar übernatürliche Züge tragen kann (siehe Kapitel 10), die<br />
Andersartigkeit psychisch kranker Menschen vom Bevölkerungsdurchschnitt. Das<br />
Wort Besonders trägt bereits das Sondern in sich <strong>und</strong> unterstreicht damit<br />
Absonderung <strong>und</strong> Sonderbarkeit psychisch kranker Menschen.<br />
Das Vorhandensein einer psychischen Erkrankung aufgr<strong>und</strong> charakterlicher<br />
Defizite oder unmoralischer Lebensentwürfe konnte durch qualitative<br />
Beobachtungen nicht gestützt werden. Das eigene Verschulden der Erkrankung<br />
wird überwiegend auf externe Faktoren verschoben <strong>und</strong> bezieht sich<br />
vordergründig auf den Krankheitsverlauf <strong>und</strong> nicht auf deren Entstehung. Damit<br />
verb<strong>und</strong>en ist die überwiegend vertretene Vorstellung, die Erkrankung durch<br />
eigenes Handeln positiv beeinflussen zu können. Die Prognose der meisten<br />
Charaktere, so denn thematisiert, legt eine potentielle Heilung oder Verbesserung<br />
der Symptomatik nahe.<br />
Auch die Rolle des Geschlechts zeigt einige Auswirkungen auf die Darstellung<br />
psychisch kranker Personen. Diese bestehen dahingehend, dass Frauen vermehrt<br />
zu psychischer Gewalt neigen <strong>und</strong> keine übernatürlichen, sondern lediglich, wie in<br />
einem Fall gezeigt, eine überdurchschnittliche Fertigkeit beherrschen. Das wirft die<br />
Frage auf ob Charaktere wie Grenui oder Adrian Monk auch als Frauen möglich<br />
wären? In dieser Stichprobe bleiben Genialität, sowie besondere Begabungen<br />
beinahe ausschließlich männlichen ProtagonistInnen vorbehalten.<br />
Zusammengefasst scheinen Geschlechtereffekte zu bestehen, welche aufgr<strong>und</strong><br />
des geringen Vorkommens weiblicher Charaktere statistisch nur schwer zu<br />
evaluieren waren.<br />
Gesondertes Interesse galt, über die Repräsentation stereotyper Darstellungen<br />
hinaus, der erzählerischen Perspektive. Hierbei konnte ein verstärkter Einsatz von<br />
86
Objektperspektiven gegenüber subjektnahen Erzählmodi beobachtet werden<br />
(Hypothese 7). Die psychisch kranken Charaktere geraten damit tendenziell in die<br />
Rolle von Anschauungsobjekten. Diese Beobachtung kann als weitere<br />
Manifestation, der outgrouping Tendenzen gesehen werden. Der Vergleich mit<br />
einer „Freakshow“ würde den Sachverhalt nicht korrekt widerspiegeln, wobei das<br />
Unterstreichen von Andersartigkeit bei dieser Darstellungsform mitschwingt.<br />
Besonders deutlich wird dies beim Einsatz von ErzählerInnen, welche den/die<br />
MedienrezipientIn mit auf eine exotische Reise in das Leben eines/einer psychisch<br />
Kranken entführt. Dadurch wird Andersartigkeit betont <strong>und</strong> zusätzliche Distanz<br />
geschaffen.<br />
Die Untersuchung zeigt, dass in der jeweils stereotypen Darstellung zahlreiche<br />
Merkmale auftauchen, welche einerseits das bestehende <strong>Stigma</strong> psychischer<br />
Erkrankung illustriert <strong>und</strong> andererseits fördert. Dieser Aspekt lässt sich gut am<br />
Beispiel der negativen Reaktionen des Umfeldes demonstrieren. Am ablehnenden<br />
Verhalten des Umfeldes wird deutlich, in welchem Maße psychisch kranke<br />
Personen Abwertung <strong>und</strong> sogar Diskriminierung ausgesetzt sein können. Damit<br />
wird bestehende <strong>Stigma</strong>tisierung medial abgebildet. Doch führt dies zu einer<br />
Entstigmatisierung oder fördert eine solche Darstellung eine weitere<br />
<strong>Stigma</strong>tisierung? Anhand der Umfeldreaktionen ist diese Frage nicht schlüssig zu<br />
beantworten. Doch angesichts der anderen <strong>Stereotype</strong> können in der Literatur<br />
deutliche Hinweise auf die Richtung der medialen Effekte hinsichtlich<br />
<strong>Stigma</strong>tisierung gef<strong>und</strong>en werden.<br />
Gemäß der Theorie des sozialen Lernens werden, wie bereits erwähnt, Modelle<br />
präsentiert, was einen angemessenen Umgang mit psychisch kranken Menschen<br />
darstellt. Angesichts stereotyper Darstellungen in Richtung Gefährlichkeit <strong>und</strong><br />
Unberechenbarkeit, würde dies eine vorsichtige Interaktion mit Betroffenen<br />
implizieren. Hinsichtlich der Partnerwahl wird suggeriert, dass es unüblich sei sich<br />
in Personen mit einer psychischen Erkrankung zu verlieben. Auf der Ebene der<br />
Interaktion implizieren die in dieser Arbeit identifizierten Darstellungsmuster<br />
Distanzempfehlungen.<br />
Noch kritischer ist die mediale Darstellung psychisch Kranker im Hinblick auf die<br />
cultivation theory (vgl. Gerbner zit. nach Stout, Villegas & Jennings, 2004, S. 544)<br />
zu sehen. Eine langsame Verschmelzung televisionär vermittelter <strong>Stereotype</strong> mit<br />
87
der Wahrnehmung in der Lebenswirklichkeit bedeutet angesichts der<br />
Repräsentativität stigmatisierender <strong>Stereotype</strong> in diesem Sample, viele zu<br />
erwartende Negativeffekte. Aus der Wahrnehmung psychisch Kranker als<br />
gefährlich, unberechenbar, determiniert durch die Symptomatik <strong>und</strong> nicht<br />
begehrenswert lassen sich zahlreiche Konsequenzen ableiten, die zum einen<br />
Einflüsse auf das soziale Leben der Betroffenen <strong>und</strong> gesamtgesellschaftlich auf<br />
politische Entscheidungen haben könnte. Führt medial überformte Wahrnehmung<br />
zu Übereinstimmung mit bestehenden <strong>Stereotype</strong>n bezüglich der betroffenen<br />
Gruppe, so kann am Ende der Zwei-Faktoren-Theorie von <strong>Stigma</strong>ta (vgl. Rüsch,<br />
Finzen, Berger & Angermeyer, 2004, S.4f.) öffentliche Diskriminierung stehen.<br />
Damit können die medial präsentierten stigmatisierenden <strong>Stereotype</strong>, wie bereits<br />
angedeutet (Tajfel zit. nach Jonas, 2002, S. 9), als Rechtfertigung von Exklusion<br />
<strong>und</strong> outgroup Phänomenen fungieren.<br />
Wie eine Studie (vgl. Philo zit. nach Philo, 1997, S. 172) zeigen konnte,<br />
überformen mediale Bilder die Vor- <strong>und</strong> Einstellungen von Menschen bezüglich<br />
psychisch kranker Personen. Ähnlich wie bei der cultivation theory, kann daher die<br />
Wichtigkeit medialer Darstellung unterstrichen werden. Vor allem ist<br />
problematisch, dass die Darstellungsmuster persönliche Erfahrungen überdauern<br />
können (vgl. Philo zit. nach Philo, 1997, S. 172). Die Rigidität in der Wirkung<br />
medialer Bilder kann also dazu führen, dass die soziale Distanz gegenüber den<br />
Erkrankten auch durch Entstigmatisierungsprogramme, deren Strategie in der<br />
Arbeit mit persönlichen Begegnungen besteht, massiv erschwert wird.<br />
Allerdings konnten Antistigmaprogramme, die mit dem Medium Film gearbeitet<br />
haben keine so großen Effekte wie erhofft erzielen (vgl. Winkler et al., 2008, S.<br />
33ff.). Jedoch ist einschränkend zu sagen, dass sich Tendenzen andeuten <strong>und</strong> bei<br />
anderer Stichprobe mit größeren Effekten zu rechnen ist.<br />
13.1 Kritik <strong>und</strong> Ausblick<br />
Abschließend kann gesagt werden, dass in dieser Arbeit die Repräsentativität<br />
stigmatisierender <strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> in Mainstream-Filmen <strong>und</strong><br />
Fernsehserien beobachtet werden konnte. Bei den diskutierten Effekten handelt<br />
88
es sich jedoch nur um Hypothesen, welche folgender Validierungen bedürfen. Es<br />
handelt sich bei dieser Untersuchung lediglich um einen Einblick in die Bandbreite<br />
der medialen Darstellungsformen der Differenzkategorie psychisch krank.<br />
Allerdings konnten gewisse Systematiken identifiziert werden. Obgleich diese<br />
auch einer Alphakorrektur nach Bonferroni-Holm standhalten, gilt es diese in<br />
Anbetracht der kleinen Stichprobe zu relativieren. Insbesondere das geringe<br />
Vorkommen psychisch kranker Charaktere in Mainstream-Filmen der letzten fünf<br />
Jahre ist für die geringe Größe der Stichprobe mitverantwortlich. Wobei dies schon<br />
eine Beobachtung für sich darstellt. Anzumerken ist an dieser Stelle noch, dass<br />
psychisch kranke Charaktere nicht als token Personen fungieren, wie es etwa bei<br />
ethnischen Minderheiten der Fall ist.<br />
Spätere Untersuchungen sollten eine größere Anzahl von <strong>Stereotype</strong>n<br />
untersuchen <strong>und</strong> das Sample auf weitere Medien wie Nachrichten, Zeitschriften,<br />
Daily Soaps oder Internet ausweiten. Damit würde der Fülle medialer Einflüsse<br />
gerechter. In dieser Arbeit liegt der Fokus ausschließlich auf Filmen <strong>und</strong><br />
Fernsehserien, weshalb der Einfluss auf die Gesellschaft, gerade in Anbetracht<br />
der immer größer werdenden Bedeutung des Internets, als relativiert angesehen<br />
werden muss. Diese Arbeit versteht sich als punktueller Einblick in die<br />
Verwendung medialer Stereotypien <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> hinsichtlich der Gruppe der<br />
psychisch kranken Menschen.<br />
Wünschenswert für die Zukunft wäre eine Darstellung, die weniger auf <strong>Stereotype</strong><br />
aufbaut <strong>und</strong> damit die Grenzen zwischen Kranken <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>en durchlässiger<br />
werden lässt. Einige Charaktere tragen ihre Erkrankung bereits als beiläufiges<br />
Merkmal neben anderen zentraleren Aspekten ihres Charakters. Eine solche<br />
weniger differenzfokussierte Rollenzeichnung könnte das Vorliegen einer<br />
psychischen Erkrankung zu einem Merkmal unter vielen machen. Dadurch können<br />
scheinbare Widersprüche, wie psychische Erkrankung <strong>und</strong> geliebt zu werden oder<br />
einen Partner zu haben, aufgehoben werden <strong>und</strong> verlören ihre Position als implizit<br />
vorausgesetztes soziodemographisches <strong>und</strong> charakterliches Merkmal. Dazu<br />
müssten jedoch festgelegte <strong>und</strong> konsistente Strukturen (vgl. Wilson, Nairn,<br />
Coverdale & Panapa, 1999, S. 232ff.) wie Gefährlichkeit <strong>und</strong> Unberechenbarkeit,<br />
in der filmischen Dramaturgie reduziert werden, wie es bereits hinsichtlich<br />
infantiler Darstellungsmuster geschehen zu sein scheint. Langfristig sollten aus<br />
89
psychisch kranken Charakteren, ProtagonistInnen werden, deren Erkrankung eine<br />
Eigenschaft unter vielen ist <strong>und</strong> die Differenzen zwischen Ges<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Kranken<br />
an Gewicht verlieren. Die Gestaltung einiger Charaktere gibt Hoffnung für einen<br />
Entwicklungsverlauf in diese Richtung. Nicht zuletzt hätte dies eine positive<br />
Auswirkung auf die Reduktion von Selbststigmatisierung der Betroffenen, welche<br />
ihr Selbstkonzept mit stigmatisierenden <strong>Stereotype</strong>n speisen (vgl. Philo zit. nach<br />
Philo, 1997, S. 172). Zum Abschluss steht das Fazit, dass stigmatisierende<br />
<strong>Stereotype</strong> <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong> zum gegenwärtigen Zeitpunkt <strong>und</strong> bezüglich der<br />
vorliegenden Stichprobe ein zentrales Gestaltungsmerkmal psychisch kranker<br />
Charaktere darstellt. Die damit verb<strong>und</strong>enen negativen Effekte könnten durch eine<br />
Veränderung der Darstellungsmuster das äußere Leben, sowie die Selbstsicht<br />
positiv beeinflussen.<br />
Die Analyse diese Samples legt nahe, dass mediale Darstellungsformen<br />
psychischer Erkrankung, durch die Reproduktion von <strong>Stereotype</strong>n <strong>und</strong> <strong>Vorurteile</strong>n,<br />
an der Aufrechterhaltung des <strong>Stigma</strong>s der Differenzkategorie psychisch krank, mit<br />
verantwortlich zu sein scheinen. Einzelne Charaktere werden bereits in weiten<br />
Teilen weniger stereotyp gezeichnet, stellen jedoch eine Minorität dar. Allerdings<br />
geben sie eine Idee zukünftiger Darstellungen psychisch kranker Charaktere.<br />
90
14 Literaturverzeichnis<br />
Angermeyer, M. C. & Matschinger, H. (2004). The <strong>Stereotype</strong> of Schizophrenia<br />
and Its Impact on Discrimination Against People With Schizophrenia: Results<br />
From a Representative Survey in Germany. Schizophrenia Bulletin, 30, 1049-1061<br />
Brigham, J. C. (1971). Ethnic <strong>Stereotype</strong>s. Psychological Bulletin,76,15-38<br />
Casper, C., Rotherm<strong>und</strong>, K. & Wentura D. (2010). Automatic <strong>Stereotype</strong> Activation<br />
Is Context Depent. Social Psychology,41,131–136<br />
Corrigan, P. W. & Rüsch, N. (2002). Mental Illness <strong>Stereotype</strong>s and Clinical Care:<br />
Do People Avoid Treatment Because of <strong>Stigma</strong>? Psychiatric Rehabilitation Skills,<br />
6, 312-334<br />
Crandall, C. S. & Eshleman A. (2003). A Justification–Suppression Model of the<br />
Expression and Experience of Prejudice. Psychological Bulletin, 129, 414-446<br />
Cuenca, O. (2001). Mass media and psychiatry: an introduction. Current Opinion<br />
in Psychiatry, 14, 527-528<br />
Devine, P. G. (1989). <strong>Stereotype</strong>s and Prejudice: Their Automatic and Controlled<br />
Components. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 5-18<br />
Goffman, E. (1963). <strong>Stigma</strong>. Über Techniken der Bewältigung beschädigter<br />
Identität. (1.Auflage) Frankfurt am Main: Suhrkamp 1975<br />
Jonas, K. (2002). <strong>Stereotype</strong>nentstehung im Intergruppenkontext. Göttingen:<br />
Unveröffentlichte Dissertation.<br />
Jussim, L., Nelson, T. E. , Manis, M. & Soffin, S. (1995). Prejudice, <strong>Stereotype</strong>s,<br />
and Labeling Effects: Sources of Bias in Person Perception. Journal of Personality<br />
and Social Psychology, 68, 228-246<br />
Link, B. G. & Phelan, J. C. (2001). Concepualizing stigma. Anual Review of<br />
Sociology,27,363-385<br />
Lloyd, B. T. (2002). A Conceptual Framework for Examining Adolescent Identity,<br />
Media Influence, and Social Developemnt. Review of General Psychology, 6, 73-<br />
91<br />
Mackie, D. M. & Smith, E. R. (1998). Intergroup Relations: Insights From a<br />
Theoretically Integrative Approach. Psychological Review, 105, 499-529<br />
Macrae, N. C. & Bodenhausen G. V. (2001). Social cognition: Categorical person<br />
perception. British Journal of Psychology , 92, 239–255<br />
91
Madon, S., Guyll, M., Hilbert, S. J., Kyriakatos, E. & Vogel, D. (2006). Stereotyping<br />
the Stereotypic: When Individuals Match Social <strong>Stereotype</strong>s. Journal of Applied<br />
Social Psychology, 36,178–205<br />
Philo, G. (1997). Changing media reprasentation of mental health. Psychiatric<br />
Bulletin, 21, 171-172<br />
Quinn, D. M. & Chaudoir, S. R. (2009). Living With a Concealable <strong>Stigma</strong>tized<br />
Identity : The Impact of Anticipated <strong>Stigma</strong>, Centrality, Salience, and Cultural<br />
<strong>Stigma</strong> on Psychological Disstress and Health. Journal of Personality and Social<br />
Psychology, 97,634-651<br />
Rüsch, N. (2010). Reaktionen auf das <strong>Stigma</strong> psychischer Erkrankung.<br />
Sozialpsychologische Modelle <strong>und</strong> empirische Bef<strong>und</strong>e. Zeitschrift für Psychiatrie,<br />
Psychologie <strong>und</strong> Psychotherapie,58,287-297<br />
Rüsch, N., Angermeyer, M.C. & Corrigan, P.W. (2005). Das <strong>Stigma</strong> psychischer<br />
Erkrankung: Konzepte, Formen <strong>und</strong> Folgen. Psychiatrische Praxis, 32, 221–232<br />
Rüsch, N., Berger, M., Finzen, A. & Angermeyer, M. C. (2004). Das <strong>Stigma</strong><br />
psychischer Erkrankungen – Ursachen, Formen <strong>und</strong> therapeutische<br />
Konsequenzen. In Berger, M. Psychische Erkrankungen – Klinik <strong>und</strong> Therapie,<br />
elektronisches Zusatzkapitel <strong>Stigma</strong>.<br />
Schomerus, G. (2010). Das <strong>Stigma</strong> psychischer Krankheit. Ein Gegenstand der<br />
Psychotherapie?. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie <strong>und</strong><br />
Psychotherapie,58,253-255<br />
Schulze, B. Janeiro, M. & Kiss, H. (2010). Das kommt ganz drauf an� Strategien<br />
zur <strong>Stigma</strong>bewältigung von Menschen mit Schizophrenie <strong>und</strong> Borderline-<br />
Persönlichkeitsstörung. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie <strong>und</strong><br />
Psychotherapie,58,275-285<br />
Sherman, J. W., Stroessner, S. J., Conrey, F. R. & Azam, O. A. (2005). Prejudice<br />
and <strong>Stereotype</strong> Maintenance Processes: Attention, Attribution, and Individuation.<br />
Journal of Personality and Social Psychology, 89, 607-622<br />
Sibicky, M. & Dovidio, J. F. (1986). <strong>Stigma</strong> of Psychological Therapy: <strong>Stereotype</strong>s,<br />
Interpersonal Reactions, and the Self-Fulfilling Prophecy. Journal of Counseling<br />
Psychology, 33,148-154<br />
Stout, P. A., Villegas, J. & Jennings, N. A. (2004). Images of Mental Illness in the<br />
Media: Identifying Gaps in tne Research. Schizophrenia Bulletin, 30, 543-561<br />
Taylor, S. M. & Dear, M. J. (1981). Scaling Community Attitudes<br />
Toward the Mentally III. Schizophrenia Bulletin, 7, 225-240<br />
Wilson, C., Nairn, R., Coverdale, J. & Panapa, A. (1999). Mental illness depictions<br />
in prime-time drama: identifying discursive resources. Australien and New Zealand<br />
Journal of Psychiatry, 33, 232-239<br />
92
Wilson, C., Nairn, R., Coverdale, J. & Panapa, A. (2000). How mental illness is<br />
portrayed in children´s television. British Journal of Psychiatry, 176, 440-443<br />
Winkler, I. et al. (2008). Das Filmfestival “Ausnahme|Zustand” – Eine Strategie<br />
gegen die <strong>Stigma</strong>tisierung psychisch kranker Menschen? Psychiatrische Praxis,<br />
35, 33-39<br />
http://www.insidekino.de<br />
http://www.statistik.at/web_de/presse/052105<br />
93
15 Anhang<br />
Tab. 1: Korrektur der signifikanten Ergebnisse nach Bonferroni-Holm<br />
Variablen Verfahren p-Werte Korrektur<br />
Objektperspektive ><br />
Subjektperspektive Binomialtest nein Binomialtest <br />
nein Binomialtest Fröhlich Binomialtest .002 .0062<br />
Negative Reaktion > Positive Reaktion Binomialtest .002 .0071<br />
Partner ja < nein Binomialtest .004 .0083<br />
Geliebtes Objekt ja < nein Binomialtest .0095 .01<br />
Aktive Aggression ja > nein Binomialtest .0095 .0125<br />
Aktive Aggression <strong>und</strong> Unter Kontrolle<br />
der Symptome Korrelation .0125 .0166<br />
Auf andere angewiesen ja > nein Binomialtest .179 .025<br />
Erfolglose Bewältigung ja > nein Binomialtest .034* .05<br />
* gegenteilige Signifikanz<br />
Tab. 2: Verwendetes Kategorienraster<br />
Überkategorie Unterkategorie<br />
Gewalt<br />
physische Aggression gegen psychisch kranke ProtagonistInnen<br />
psychische Aggression gegen psychisch kranken ProtagonistInnen<br />
physische Aggression von psychisch kranken ProtagonistInnen ausgehend<br />
psychische Aggression von psychisch kranken ProtagonistInnen ausgehend<br />
Narrative<br />
Perspektive<br />
Subjektperspektive<br />
Objektperspektive<br />
Reaktionen<br />
der Umgebung<br />
negative Reaktion<br />
positive Reaktion<br />
positive Reaktion unter der Bedingung einer besonderen kompensatorischen<br />
Eigenschaft<br />
Freiheit <strong>und</strong><br />
Kontrolle<br />
unter Kontrolle der Symptome<br />
Symptomfrei<br />
Wie oft sieht sich der/die Betroffene selbst als nicht Handlungskompetent<br />
aufgr<strong>und</strong> seiner Erkrankung<br />
Zutrauen von Handlungskompetenz<br />
Hilflosigkeit<br />
auf andere angewiesen<br />
Erfolgreiche Bewältigung von Alltagsaufgaben<br />
94
Liebe <strong>und</strong><br />
Sexualität<br />
Qualität der<br />
Lebenssituation<br />
Erfolglose Bewältigung von Alltagsaufgaben<br />
liebendes Subjekt<br />
geliebtes Objekt real<br />
geliebtes Objekts imaginär/phantasiert<br />
beteiligt an physischen Zuneigungen im sexuellen Sinne real<br />
beteiligt an physischen Zuneigungen im sexuellen Sinne imaginär/phantasiert<br />
in Partnerschaft lebend ja/nein<br />
unglücklich/betrübt<br />
fröhlich/glücklich<br />
in klinischem Kontext<br />
in nicht klinischen Kontexten<br />
Ort positiv<br />
Ort negativ<br />
95
16 Lebenslauf<br />
Name:<br />
Aden, Jan Philipp Amadeus<br />
Adresse:<br />
Alserstraße 14/1/7 1090 Wien<br />
Geburtsdatum:<br />
20.08.1988<br />
Geburtsort:<br />
49177 Ostercappeln (Deutschland)<br />
Studium:<br />
Seit Sommersemester 2009 zusätzlich Psychologie an der Sigm<strong>und</strong> Freud<br />
Privatuniversität Wien<br />
Seit Wintersemester 2008/2009 Psychotherapiewissenschaft an der Sigm<strong>und</strong><br />
Freud Privatuniversität Wien<br />
Abitur:<br />
26.06.2008 am Ratsgymnasium Osnabrück<br />
Schulische Laufbahn:<br />
Ratsgymnasium Osnabrück Schuljahr 2001/2002 bis Schuljahr 2007/2008<br />
Hans Callmeyer - Orientierungsstufe Innenstadt Osnabrück Schuljahr 1999/2000<br />
bis Schuljahr 2000/2001<br />
Gr<strong>und</strong>schule Belm-Vehrte Schuljahr 1995/1996 bis Schuljahr<br />
1998/1999<br />
97