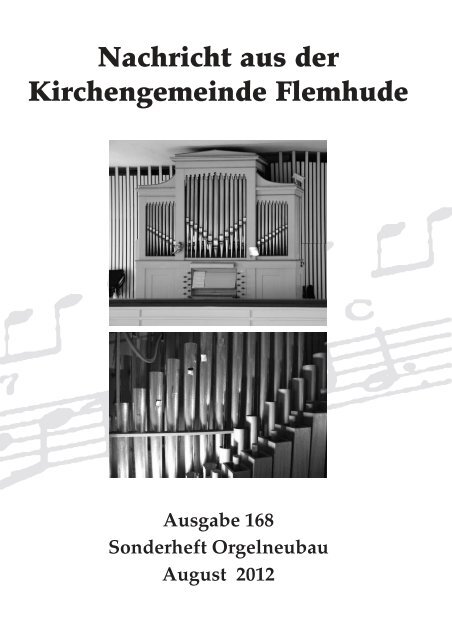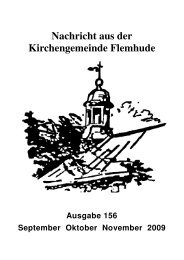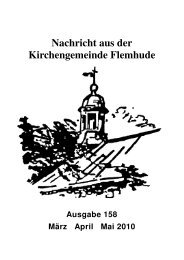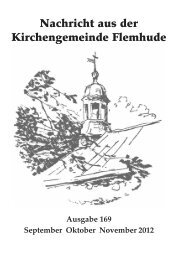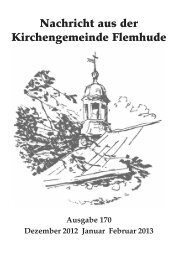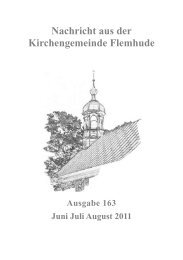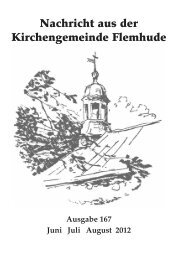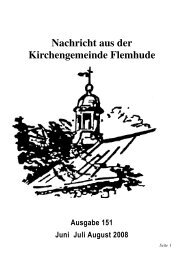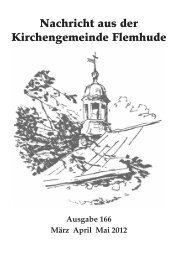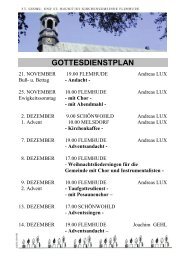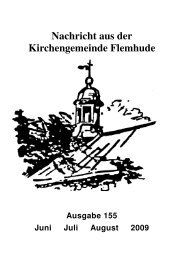Sonderheft Orgelneubau - Kirchengemeinde Flemhude
Sonderheft Orgelneubau - Kirchengemeinde Flemhude
Sonderheft Orgelneubau - Kirchengemeinde Flemhude
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nachricht aus der<br />
<strong>Kirchengemeinde</strong> <strong>Flemhude</strong><br />
Ausgabe 168<br />
<strong>Sonderheft</strong> <strong>Orgelneubau</strong><br />
August 2012
Nachricht aus der <strong>Kirchengemeinde</strong> <strong>Flemhude</strong><br />
Ausgabe Nr. 168 Impressum<br />
Herausgeber <strong>Kirchengemeinde</strong> <strong>Flemhude</strong><br />
Kirchkamp 1 · 24107 <strong>Flemhude</strong><br />
kircheflemhude@gmx.net<br />
www.kirche-flemhude.de<br />
Redaktion und Ursula Grell (verantwortlich),<br />
Layout Carsten Bock, Birgit von Brandis, Joachim Gehl<br />
Druck und Falz L&S Digital GmbH & Co. KG<br />
Köpenicker Straße 51 · 24111 Kiel<br />
Verteilung Konfirmandinnen, Konfirmanden<br />
und Gemeindeglieder<br />
Auflagenhöhe 2.500<br />
Bankverbindung Kontonummer 11 991 · BLZ 210 602 37 · EDG Kiel<br />
Kirchenkreis Altholstein - Rechtsträger 3300<br />
2
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />
Grußworte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
Benefizkonzert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
Warum eine neue Orgel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
Die Arbeit des Orgelbau-Ausschusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
Jahrzehntelange Erfahrung im Orgelbau: Rudolf von Beckerath . . . . . . . . . 12<br />
Wissenswertes über die Orgel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
Pfeifenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />
Kosten und Finanzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />
Orgelpfeifen-Patenschaft: Wie geht das? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
Die Kosten einer Orgel – was steckt dahinter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
Mit dem Orgelbau alleine ist es nicht getan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />
Der Organist – verschiedene Wege führen zum Ziel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
Unser Organist – ein Werdegang im Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />
Von <strong>Flemhude</strong>r Orgeln und Organisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />
Kleine Orgelgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />
Stimmen aus der Gemeinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />
Spendenaufruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />
Spendenzusage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />
Liebe Leserin, lieber Leser!<br />
In Kürze wird mit dem Neubau unserer Orgel begonnen. Mit dieser Sonderausgabe<br />
des Gemeindebriefes möchten wir Sie umfassend über das große Projekt<br />
informieren. Wir laden Sie ein, uns auf dem Weg zu begleiten. Auf dass Sie nach<br />
der Lektüre dieses Heftes sagen können: Ja, den Neubau unserer <strong>Flemhude</strong>r<br />
Orgel unterstütze ich gern!<br />
Denn das ist das zweite Anliegen: Mit der Herausgabe dieser Informationsschrift<br />
starten wir eine große Spendenaktion. Helfen auch Sie mit, dass das Vorhaben<br />
zu einem guten Ende geführt wird.<br />
Ihr Redaktionsteam<br />
3
Foto: Marion v. d. Mehden<br />
Grußwort Schirmherr Axel Milberg<br />
Liebe Kirchenmitglieder,<br />
verehrte Freunde und Förderer,<br />
gerne habe ich die Schirmherrschaft für den <strong>Orgelneubau</strong><br />
der St. Georg- und Mauritiuskirche in <strong>Flemhude</strong><br />
übernommen.<br />
Die Kirche <strong>Flemhude</strong> hat sich einen weit über die<br />
Region hinausgehenden Ruf erworben als ein Ort, an<br />
dem neben Gottesdiensten vielfältige Festlichkeiten<br />
wie Hochzeiten, Taufen und öffentliche Konzerte zu<br />
einem unvergesslichen Erlebnis werden. Neben dem<br />
Flair der historischen Mauern spielt die Orgel als „Königin<br />
der Instrumente“ eine prägende Rolle.<br />
Leider ist diese Mitte des 19. Jahrhunderts gebaute und letztmalig vor 50 Jahren<br />
renovierte Orgel mechanisch und klangtechnisch sehr in die Jahre gekommen.<br />
Ein Gutachten bescheinigt außerdem „einfachste Bauweise und eine schwache<br />
handwerkliche Leistung“. Vor diesem Hintergrund wird ein Neubau notwendig,<br />
um der Bedeutung dieser Orgel und der Kirche gerecht zu werden.<br />
Ein solches Projekt ist mit hohen Kosten verbunden, die die <strong>Kirchengemeinde</strong><br />
aus eigenen Mitteln finanziell nicht alleine bewerkstelligen kann.<br />
Und so möchte ich Sie als Schirmherr aufrufen, sich am <strong>Orgelneubau</strong> zu beteiligen.<br />
Jede auch noch so kleine Spende ist wertvoll.<br />
Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen von ganzem Herzen und wünsche<br />
Ihnen für die folgenden Jahre und Jahrzehnte viel Freude und Genuss beim<br />
Klang dieses wunderbaren Instrumentes.<br />
München, im Juni 2012<br />
4<br />
Schirmherr Axel Milberg
Grußwort Bischofsbevollmächtigter Gothart Magaard<br />
Liebe Schwestern und Brüder,<br />
Orgeln und Menschen haben manches gemeinsam.<br />
Wir Menschen leben von dem Himmelsatem, der uns<br />
Erdlingen eingehaucht wurde. „Da machte Gott den<br />
Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den<br />
Odem des Lebens in seine Nase“. Wir sind Bürger<br />
zweier Welten: Die Erde gibt uns Boden unter die Füße,<br />
der Himmel schenkt uns die Luft, die wir zum Leben<br />
brauchen. Und mehr noch: Der Atem trägt unser<br />
Sprechen und Singen, der geformte Atem der Sprache<br />
stiftet Gemeinschaft und ernährt Geist und Seele,<br />
wenn wir uns gute, wahre Worte sagen und singen.<br />
Auch die Orgel lebt vom Atem des Windes. An sich selbst ist sie Holz und<br />
Metall. Aber wenn der Wind einschießt, dann atmet die Orgel den Himmel ein<br />
wie ein lebendiges Wesen. Die Luft des Windes und der Geist des Organisten<br />
führen sie zu ihrer Bestimmung, und sie klingt und schwingt „zu Gottes Ehre<br />
und zur Recreation des Gemüths“, wie J.S. Bach seinen Schülern ins Stammbuch<br />
schrieb. Ihr Klang öffnet unsere Seelen, berührt, tröstet, ermutigt und macht<br />
fröhlich.<br />
Ich freue mich über den mutigen Entschluss Ihrer Gemeinde, eine neue Orgel<br />
für die St. Georg- und Mauritiuskirche zu bauen. Das ist ein großes Werk für<br />
eine kleine Gemeinde! Ich bin sicher: Mit Engagement und Tatkraft wird es gelingen.<br />
Gottes Segen und gutes Gelingen für diesen Weg! Möge in nicht zu ferner<br />
Zukunft das neue Instrument vielstimmig Gott loben und die Gemeinde in<br />
ihrem Singen inspirieren und leiten.<br />
Ihr<br />
Gothart Magaard,<br />
Bischofsbevollmächtigter<br />
5
Grußwort Pastor Andreas Lux<br />
Allein die Ohren sind die Organe eines Christenmenschen,<br />
hat Martin Luther gesagt. Er meint freilich zuerst<br />
die Ohren, die das Wort des Evangeliums vernehmen,<br />
und er stellt sie gegen den Dienst der Augen an<br />
diversen Bildwerken und Reliquien seiner religiösen<br />
Gegenwart.<br />
Dass die Ohren dann auch noch anderes hören dürfen<br />
als gesprochene Worte, würde der Reformator uns freilich<br />
ohne Weiteres durchgehen lassen. War doch die<br />
Musik diejenige der Künste, der er viel abgewinnen<br />
konnte und die er mit Leidenschaft gepflegt hat. So<br />
manches geistliche Lied geht auf ihn zurück. Und dort,<br />
wo protestantischer Gesang erschallte, war stets auch die Orgel dabei, die allein<br />
im Posaunenchor ein gleichwertiges Gegenüber fand.<br />
Wir können uns auch heute kaum vorstellen, wie Gottesdienst, wie Hochzeit<br />
oder auch Trauerfeier in der Kirche ganz ohne Orgelklang auskommen sollten.<br />
Und darum spielt es für uns in <strong>Flemhude</strong> mit unserer alten Kirche eine besondere<br />
Rolle, über ein gutes und dem Raume entsprechendes Instrument verfügen<br />
zu können. Wir möchten mit der neuen Orgel für unser so viel besuchtes Gotteshaus<br />
nun Stückwerk und Flickwerk hinter uns lassen, möchten für uns wie für<br />
spätere Generationen eine Orgel hineinstellen, die sich hören lassen kann und<br />
bei deren Klang Künftige sagen: Da haben sie etwas Ordentliches zustande gebracht!<br />
Wäre schön, wenn zum Vorhaben auch das Gelingen käme, und dazu gebe Gott<br />
seinen Segen.<br />
6<br />
Pastor Andreas Lux
Benefizkonzert<br />
am Sonntag, 9. September, 17:00 Uhr<br />
in der Kirche <strong>Flemhude</strong><br />
Zum Abschied von der ursprünglichen Marcussen-Orgel<br />
spielt Andreas Bronnmann<br />
Werke von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian<br />
Bach und Felix Mendelssohn-Bartholdy.<br />
An kleinen Beispielen werden außerdem die<br />
Mängel und Defizite des Instrumentes aufgezeigt.<br />
Für mögliche Paten besteht Gelegenheit,<br />
sich die der neuen Orgel entsprechenden<br />
Pfeifen anzuschauen und anzuhören.<br />
Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für den<br />
<strong>Orgelneubau</strong> wird gebeten.<br />
Register Foto: Horst Kay<br />
„Die orgl ist doch in meinen augen und ohren der könig aller<br />
instrumenten.“<br />
Wolfgang Amadeus Mozart in einem Brief an seinen Vater vom 18. Oktober 1777<br />
7
Warum eine neue Orgel?<br />
Der Neubau einer Orgel gehört für eine kleine <strong>Kirchengemeinde</strong> sicherlich zu<br />
den größten finanziellen und ideellen Herausforderungen, denen sie sich stellen<br />
kann – oder muss. Für unsere <strong>Flemhude</strong>r <strong>Kirchengemeinde</strong> stellte sich die Frage<br />
einer Orgelsanierung aufgrund zunehmender Klagen verschiedener Organisten<br />
in den vergangenen 15 Jahren immer wieder einmal, bis schließlich im Frühjahr<br />
2009 ein Sachverständigengutachten zum Zustand der Orgel in Auftrag gegeben<br />
wurde.<br />
Die gemeinsame Begehung mit unserem Organisten und den Mitgliedern des<br />
Musikausschusses ergab ein im Ergebnis eindeutiges Bild, für das der Orgelsachverständige<br />
Dr. Joachim Walter in seinem Gutachten deutliche Worte findet:<br />
„Die Orgel ist – positiv ausgedrückt – von einfachster Bauweise. Die verarbeiteten<br />
Materialien (Pressspan-, Sperrholzplatten und ähnliches), die Konstruktionsweise<br />
mit Bindfadentraktur für Pedal und Manualladen und nicht zuletzt der<br />
unbefriedigende Klang der Orgel (wie z.B. Grundtonregister, die nicht tragen<br />
bzw. nicht klar ansprechen und der artifizielle Klang der Manualzungen) spiegeln<br />
dieses Grundübel der Orgel wider.“<br />
Dieser Befund wurde im Kirchenvorstand intensiv erörtert und führte schließlich<br />
zu der Entscheidung, dass statt des „Kann“ ein „Muss“ zu folgern sei. Die<br />
Möglichkeit einer Orgelreparatur statt eines Neubaus wurde zwar intensiv in<br />
Erwägung gezogen, ließ sich allerdings nach Rücksprache mit dem Orgelsachverständigen<br />
nicht verantworten, „da die zu erwartenden Kosten den erhofften<br />
Nutzen vor dem Hintergrund des Wertes des Instrumentes nicht rechtfertigen<br />
würden.“<br />
Nun ist die Entscheidung gefallen und unsere kleine <strong>Kirchengemeinde</strong> stellt<br />
sich mit Tatkraft und Zuversicht der großen Herausforderung eines <strong>Orgelneubau</strong>s.<br />
Hierbei stehen wir in der Verantwortung, noch vorhandene historisch<br />
wertvolle Materialien behutsam<br />
in das Gesamtkonzept einzu -<br />
beziehen, um (wieder) eine<br />
Orgel zu erhalten, von der der<br />
damalige <strong>Flemhude</strong>r Organist<br />
C. Hildebrandt im Jahr 1869<br />
schwärm te: „Das ganze Werk ist<br />
ein Meis terwerk in jeder Beziehung<br />
und zeugt von großer Um -<br />
sicht und Tüchtigkeit der Erbauer.“<br />
Tobias Schubert<br />
Luftführung an unserer alten Orgel<br />
Foto: Joachim Gehl<br />
8
Vordenker und Weichensteller:<br />
Die Arbeit des Orgelbau-Ausschusses<br />
Unser Orgelbauvorhaben entwickelt sich momentan sehr dynamisch und hatte<br />
dabei doch einen langfristigen Vorlauf. Nach der Begutachtung der bestehenden<br />
Orgel durch den Orgelsachverständigen, Herrn Dr. Walter, im März 2009<br />
und seiner Empfehlung für einen <strong>Orgelneubau</strong> beschloss der Kirchenvorstand<br />
im Juni 2009, das Projekt eines <strong>Orgelneubau</strong>s in Angriff zu nehmen. Beauftragt<br />
wurde ein neu eingerichteter Orgelausschuss, in enger Zusammenarbeit mit<br />
dem Orgelsachverständigen die Möglichkeiten für einen Neubau konzeptionell<br />
und planerisch auszuloten und dem Kirchenvorstand entsprechende Beschlussvorlagen<br />
zu unterbreiten.<br />
Dieser Orgelbau-Ausschuss nahm im September 2009 seine Arbeit auf. Unter<br />
Mitwirkung von Claus Alpers, Almuth Busch, Joachim Gehl, Iris Milberg-<br />
Schoeller, Susanne Witt und Tobias Schubert sowie im ersten Jahr maßgeblich<br />
unterstützt durch unseren Organisten Andreas Bronnmann erstreckte sich die<br />
gemeinsame intensive Arbeit über einen Zeitraum von insgesamt zweieinhalb<br />
Jahren, die die Auftragsvergabe und die nun bevorstehende Bauphase maßgeblich<br />
vorbereitete.<br />
In den insgesamt 24 Sitzungen stand zunächst die gemeinsame Einarbeitung in<br />
die sehr komplexe Materie des Orgelbaus im Vordergrund: Geschichte, technische<br />
Besonderheiten und historische Bezüge. Denkmalpflegerische Aspekte galt<br />
es ebenso zu bedenken wie Klangeindrücke zu sammeln, über Klang-Ideale engagiert<br />
zu streiten und immer wieder auch Exkursionen zu verschiedenen Orgeln<br />
zu unternehmen. Die Reisen führten uns in den Jahren zwischen 2009 und<br />
2011 nach Schwentinental (Babel-Orgel), Gleschendorf (Bruhn-Orgel, ursprünglich<br />
Marcussen), Kirchbarkau (Marcussen), Fockbek (Woehl), Kiel (St. Nikolai:<br />
Mutin Cavaillé-Coll-Orgel und große Orgel von Kleuker, restauriert von Babel;<br />
St. Jürgen: von Beckerath), Lübeck (Johanneum: Klein) und Halstenbek (Erlöserkirche:<br />
von Beckerath).<br />
Wichtige inhaltliche Arbeitsschwerpunkte lagen in der Erarbeitung einer Orgeldisposition<br />
sowie eines Leistungsverzeichnisses unter Federführung des Orgelsachverständigen<br />
und mit engagierter fachlicher Begleitung durch unseren Organisten<br />
Andreas Bronnmann, in Kontakten zum Nordelbischen Kirchenamt<br />
zu Fragen des Fundraisings, in der Erarbeitung von Entwürfen für die Öffentlichkeitsarbeit<br />
und Spendenwerbung in Zusammenarbeit mit einer hiesigen<br />
Werbedesignerin sowie in der Prüfung der Möglichkeiten zur Einwerbung von<br />
Drittmitteln (öffentliche Mittel, Stiftungen, Sponsoring; Kontakte zu Firmen<br />
und Banken etc.). Der Entwicklung kreativer Ideen zur Beteiligung der Gemeinde<br />
an dem Großvorhaben und zur weiteren Einwerbung von Spenden<br />
widmete sich im Rahmen einer gemeinsamen Klausurtagung zusätzlich auch<br />
der gesamte Kirchenvorstand.<br />
9
Im September 2011 wurden die an der Ausschreibung teilnehmenden Orgelbaufirmen<br />
zu einem Auswahlgespräch mit Orgelsachverständigem und Orgel-Ausschuss<br />
nach <strong>Flemhude</strong> eingeladen, um eine gute Grundlage für die dem Kirchenvorstand<br />
vorzulegende Vergabeempfehlung zu schaffen.<br />
Die Erarbeitung dieser Beschlussvorlage für den Kirchenvorstand zur Auftragsvergabe<br />
an eine der infrage kommenden Firmen erwies sich noch einmal als ambitioniertes<br />
und zeitintensives Unterfangen, galt es doch, die verschiedenen<br />
Auffassungen und begründeten Meinungen „unter einen Hut“ zu bringen, um<br />
eine abgewogene und vor allem auch nachhaltige Entscheidung vorzubereiten,<br />
die auch nachfolgende Generationen gutheißen können.<br />
Diese Klippen sind mittlerweile umschifft und der Kurs ist klar: Am Horizont<br />
leuchtet (klingt!) eine neue Orgel, gebaut von der renommierten Hamburger Orgelbaufirma<br />
von Beckerath. Die eigentliche Arbeit des Orgel-Ausschusses ist<br />
nunmehr abgeschlossen, unser Dank gilt allen Beteiligten für ihr Engagement<br />
und die viele in die komplexe Materie investierte Zeit und Energie! Ein kleineres<br />
Gremium begleitet das Orgelbauvorhaben weiter in seiner Ausführungsphase<br />
bis zu seiner Fertigstellung: Vielleicht schon Pfingsten 2013 – so Gott will und<br />
nichts dazwischenkommt!<br />
Tobias Schubert<br />
„Die Orgel wird seit alters und zu Recht als die Königin<br />
der Instrumente bezeichnet, weil sie alle Töne der Schöpfung<br />
aufnimmt und die Fülle des menschlichen Empfindens zum<br />
Schwingen bringt.“<br />
Papst Benedikt XVI<br />
10<br />
Foto:<br />
Joachim Gehl
Spieltisch mit zwei Manualen und Pedal Foto: Horst Kay<br />
11
Jahrzehntelange Erfahrung im Orgelbau:<br />
Rudolf von Beckerath GmbH Hamburg<br />
Orgelbaumeister Christoph Randel in der<br />
Werkstatt<br />
Intonierlade für die Vorintonation in der<br />
Werkstatt<br />
12<br />
Jede Orgel ist ein Unikat, ist ganz wesentlich<br />
Handarbeit. Orgeln kauft man<br />
nicht „von der Stange“, sondern wählt<br />
sehr sorgfältig eine Werkstatt aus. Der<br />
<strong>Flemhude</strong>r Kirchenvorstand hat sich für<br />
die Orgelbaufirma Rudolf von Beckerath<br />
in Hamburg entschieden. Dabei handelt<br />
es sich um einen mittelständischen Betrieb<br />
mit zur Zeit 14 Mitarbeitern: Einem<br />
Tischlermeister, einer Pfeifenbauerin und<br />
im übrigen ausgebildeten Orgelbauern.<br />
1949 vom Namensgeber gegründet, hat<br />
die Firma inzwischen über 400 Orgeln<br />
für Kirchen und Konzertsäle weltweit<br />
gebaut. Von Beckerath ist stark im Ausland<br />
engagiert, viele Aufträge kommen<br />
aus den USA, aber auch in Japan, Korea<br />
und im europäischen Ausland erklinken<br />
von Beckerath-Orgeln. Gerade wurde<br />
das Material für eine neue Orgel an der<br />
Universität Sydney ausgeliefert. Natürlich<br />
ist das Unternehmen auch im Inland<br />
vertreten, besonders im norddeutschen<br />
Raum. So hat zum Beispiel die Kieler St.<br />
Jürgen-Kirche ein Beckerath-Instrument.<br />
„Bei uns wird noch weitgehend so gearbeitet<br />
wie vor 250 Jahren“, sagt Orgelbaumeister<br />
Christoph Randel bei einem<br />
Rundgang durch die große Werkstatt<br />
(knapp 2.000 m 2 Grundfläche). So werden<br />
aus den im eigenen Schmelzofen<br />
hergestellten Zinn-Blei-Legierungen unterschiedlich<br />
feine Bleche gegossen, die<br />
anschließend auf die gewünschte Materialstärke<br />
heruntergehobelt werden. Aus<br />
diesen werden die Pfeifen von Hand<br />
über Formstücke rund geschlagen. Eben -<br />
falls von Hand werden danach die Näh -
te gelötet, und zwar mit einem Material,<br />
das der Zusammensetzung der jeweiligen<br />
Legierung entspricht. Für Automatisierung<br />
ist da kein Platz, denn keine<br />
Pfeife ist wie die andere. Lediglich für<br />
die Entwurfs-Zeichnungen bedient man<br />
sich des Computers.<br />
„Das Klangbild einer Orgel wird ganz<br />
wesentlich durch Länge, Durchmesser<br />
und Material der Pfeifen bestimmt“, erklärt<br />
Geschäftsführer und Mitinhaber<br />
Holger Redlich. In der <strong>Flemhude</strong>r Orgel<br />
wird die längste Pfeife 2,70 m messen,<br />
die kleinste gerade mal einen Zentimeter.<br />
Von den 20 Registern werden fünf in<br />
Holz (Fichte) gebaut. Noch vorhandenes<br />
historisches Material muss sehr behutsam<br />
und maßvoll eingearbeitet werden, Holzpfeifen vom Fuß her gesehen<br />
um das Gesamt-Klangbild nicht zu stören. Die nicht benötigten Teile werden auf<br />
dem Kirchenboden verstaut – es sei denn, es gibt Kaufinteressenten.<br />
Wahrscheinlich noch im September wird mit dem Abbau unserer alten Orgel begonnen.<br />
Lediglich der Prospekt (Frontansicht) bleibt erhalten. Dann geht es in<br />
der Werkstatt an die Arbeit: Drei Windladen und über 1.000 Pfeifen in unterschiedlichen<br />
Größen und Formen sind zu bauen, Spieltisch und Trakturen (Verbindungsteil<br />
zwischen Taste und Pfeife) müssen angefertigt werden. Die Montage<br />
in unserer Kirche ist für das kommende Frühjahr geplant.<br />
Danach beginnt eine ganz wichtige, mehrere Wochen dauernde Arbeit: Die Intonation.<br />
Hierbei wird jede einzelne Pfeife in ihrem Klangcharakter auf den Raum<br />
hin optimiert. Das erfordert von dem Intonateur höchste Konzentration und natürlich<br />
ein hochsensibles Gehör.<br />
Nach bisheriger Planung könnte Pfingsten 2013 die neue Orgel erstmals erklingen.<br />
Aber auch danach wird uns das Unternehmen von Beckerath begleiten.<br />
Vertraglich ist geregelt, dass das Instrument vom Hersteller regelmäßig gewartet<br />
wird.<br />
Text und Fotos Ursula Grell<br />
„Für uns ist es reizvoll, in einer so schönen, alten Kirche<br />
eine Orgel bauen zu dürfen.“<br />
Holger Redlich, Geschäftsführer der Firma von Beckerath<br />
13
Wissenswertes über die Orgel<br />
Innerhalb der Kirchenmusik nimmt die Orgel eine herausragende Stellung ein.<br />
Jeder kennt den typischen Orgelklang. Über den Aufbau und die Funktionsweise<br />
herrscht aber weitgehend Unklarheit. Dabei ist das Prinzip, nach dem Orgeln<br />
arbeiten, denkbar einfach. Um Töne zu erzeugen, wird Luft, Orgelbauer<br />
sprechen von Wind, in die Pfeifen geblasen. Die Bälge werden heutzutage mittels<br />
eines Elektromotors, der wie ein Ventilator funktioniert, mit Wind gefüllt.<br />
Damit nicht alle Pfeifen gleichzeitig erklingen, ist der Zugang des Windes zu<br />
den Pfeifen durch ein Ventil gesperrt. Das Ventil ist direkt mit einer Taste der<br />
Klaviatur am Spieltisch verbunden. Drückt der Spieler eine Taste herunter, wird<br />
das Ventil geöffnet und die Pfeife erklingt. Unsere Tasten-, Streich- und Blasinstrumente<br />
wie Klavier, Geige, Trompete zeichnen sich dadurch aus, dass sie nur<br />
eine bestimmte Klangfarbe erzeugen können. Auf der Orgel kann durch die unterschiedliche<br />
Bauweise der Orgelpfeifen mit verschiedenen Klangfarben gespielt<br />
werden. Die Klänge können je nach Beschaffenheit der einzelnen Pfeife<br />
z.B. laut oder leise, hoch oder tief, schrill oder dumpf sein.<br />
Die Orgel besteht aus folgenden Hauptteilen: Pfeifenwerk, Windladen mit<br />
Windversorgung, Traktur und Spieltisch. Von diesen Hauptteilen sind für den<br />
Besucher der Kirche in der Regel nur die Pfeifen zu sehen, die in der vorderen<br />
Reihe des Gehäuses stehen, dem sogenannten Prospekt. Die übrigen rd. 1.000<br />
Pfeifen unserer Orgel stehen im Gehäuse.<br />
Die Pfeifen lassen sich erstens nach dem Material unterscheiden. In unserer Orgel<br />
werden zu einem Drittel Holzpfeifen verwendet. Die anderen Pfeifen werden aus<br />
Metall gefertigt (Zinn- Blei- Legierung). Die Holzpfeifen sind eckig. Die Metallpfeifen<br />
haben eine runde Form. Hinsichtlich der Art der Tonerzeugung unterscheidet<br />
man zwischen Lippenpfeifen (gewöhnliche Pfeifen, die wie eine Blockflöte funktionieren)<br />
und Zungenpfeifen (schnarrende Pfeifen, die wie eine Klarinette mit<br />
einem beweglichen Zungenblatt gebaut sind). Der überwiegende Teil der Pfeifen<br />
ist oben offen. Die oben verschlossenen Pfeifen nennt man „gedacte“ Pfeifen.<br />
Die Tonhöhe der Lippenpfeifen wird durch ihre Länge bestimmt. Je länger eine<br />
Pfeife ist, desto tiefer klingt sie. Die Pfeifenlänge wird in der englischen Maßeinheit<br />
„Fuß“(‘) angegeben. 8‘ entspricht ca. 2,50 m. Die Länge der Zungenpfeife<br />
hat für ihre Tonhöhe keine Bedeutung. Vielmehr ist die Länge der schwingenden<br />
Metallzunge entscheidend. Alle 8 -Register entsprechen in ihrer Tonhöhe<br />
der des Klaviers. Die genaue Tonhöhe der Pfeifen wird wie bei allen anderen<br />
Instrumenten durch „Stimmen“ festgelegt.<br />
Die Klangfarbe einer Pfeife wird im Wesentlichen durch das Material (Holz<br />
oder Metall) und ihre Form bestimmt. Als Formen der Lippenpfeifen sind insbesondere<br />
die zylindrisch offenen und die konisch verlaufenden Pfeifen in jeweils<br />
unterschiedlichen Durchmessern (Weitenmensur) von Bedeutung. Bei den<br />
Zungenpfeifen spielt für den Klang die Breite der Metallzunge und die Form<br />
14
des als Resonanzkörper dienenden Bechers eine Rolle. Beim Bau einer neuen<br />
Orgel besteht die ganz große Kunst des Orgelbauers darin, im Rahmen der Intonation<br />
die Abstimmung jeder einzelnen Pfeife auf den Raum, die anderen<br />
Töne des Registers und die Orgel zu gewährleisten und damit die Klanganforderungen<br />
des Auftraggebers zu erfüllen.<br />
Ein Register ist eine über den gesamten Tonumfang reichende Reihe von Pfeifen<br />
mit gleicher Klangfarbe, die als Einheit ein- oder ausgeschaltet werden kann. In unserer<br />
neuen Orgel gehören zu jedem der 20 Register jeweils 56 Pfeifen (die Pedalregister<br />
haben nur 30 Pfeifen). Pro Taste der Klaviatur klingt in der Regel genau eine<br />
Pfeife des Registers. Der Organist bedient die Register, indem er die Registerzüge<br />
genannten Knaufe zum Einschalten herauszieht und zum Abschalten wieder hineinschiebt.<br />
Wenn er also „alle Register zieht“, dann werden alle Register der Orgel<br />
mit Wind versorgt und es ertönt der volle Klang der Orgel. Die Verbindung von den<br />
Registerzügen zu den Registern wird mechanisch über die Registertraktur hergestellt.<br />
Beim Entwurf des Instrumentes legt der Orgelbauer zusammen mit dem Auftraggeber<br />
fest, welche Register zum Einsatz kommen sollen (Disposition). Mit dieser<br />
Festlegung ergibt sich das Klangbild, das die Orgel dem Zuhörer bieten kann.<br />
Zum Kernbestand jeder Orgel gehört das Register „Principal“. Die zylindrisch offenen<br />
Lippenpfeifen sind von mittlerem Durchmesser und aus Metall gefertigt.<br />
Das Windwerk ist eine Baugruppe der Orgel, die für die gleichmäßige Erzeugung,<br />
Regulierung und Verteilung der Druckluft (Wind) zuständig ist. Das<br />
Windwerk besteht aus dem Gebläse (Erzeugung), einem Magazinbalg (Regulierung)<br />
und Windkanälen (Verteilung), die den Wind zu den Windladen leiten,<br />
auf denen die Pfeifen stehen. In ihnen befindet sich die Technik, die den Zustrom<br />
des Windes zu den aktivierten Registern und zu den durch die Tastatur<br />
angesprochenen Pfeifen ermöglicht.<br />
Eine Orgel wird vom Spieltisch aus gespielt. Unsere Orgel setzt sich aus drei sogenannten<br />
Teilwerken zusammen, denen jeweils eine eigene Klaviatur zugeordnet<br />
ist. Der Organist bedient die als 1. und 2. Manual bezeichneten Klaviaturen mit den<br />
Händen, während das Pedal mit den Füßen gespielt wird. Jedes Teilwerk ist mit<br />
einer eigenen Windversorgung ausgestattet. Die Register unserer Orgel sind den<br />
drei Teilwerken fest zugeordnet, wie dem Pfeifenverzeichnis entnommen werden<br />
kann. Die Disposition unserer Orgel lässt jedoch erkennen, dass es zwei Ausnahmen<br />
gibt. Unser Organist wünschte, dass er die Register Octave 4 und Trompete 8<br />
auch mit dem Pedal spielen könne. Deshalb wird es eine mechanische Verbindung<br />
(Transmission genannt) vom Pedal zu den beiden Registern geben, die im 1. Manual<br />
bereits vorhanden sind. In unserer Orgel wird wieder ein Tremulant zum Einsatz<br />
kommen. Das ist eine Vorrichtung, die für einzelne Teilwerke den Wind periodisch<br />
variiert, so dass die Töne schweben. Verwendet wird der Tremulant häufig,<br />
um eine Melodiestimme gegenüber den Begleitstimmen herauszuheben.<br />
Quelle: Wikipedia Claus Alpers<br />
15
Orgelpfeifen- Verzeichnis<br />
16
Kosten und Finanzierung<br />
Der „Finanzierungsplan zum <strong>Orgelneubau</strong> in der St. Georg- und Mauritiuskirche“,<br />
den wir zur kirchenaufsichtlichen Genehmigung beim Nordelbischen Kirchenamt<br />
eingereicht haben, sieht Gesamtkosten in Höhe von rd. 400.000,- € vor.<br />
Die mit rd. 325.000,- € größte Position ist der Preis für die neue Orgel. Hierbei<br />
handelt es sich um einen Festpreis, der sich lediglich durch Wirksamwerden der<br />
sog. „Zinnklausel“ nach oben verändern kann. Da Zinn einen wesentlichen<br />
Werkstoff für die neuen Orgelpfeifen darstellt und der Metallpreis Marktpreisschwankungen<br />
unterworfen ist, ist es üblich, dass sich der Anbieter gegen mögliche<br />
Verluste absichert. Derzeit ist die Situation am Weltmarkt eher so, dass uns<br />
keine Preiserhöhung droht.<br />
Der zweite wesentliche Kostenfaktor in Höhe von 51.000,- € sind die zusätzlichen<br />
Baukosten für ergänzende Maßnahmen wie z.B. Veränderungen auf der<br />
Empore (siehe S. 22). Auch die Einwerbung der Finanzmittel kostet Geld. Es<br />
muss ausgegeben werden u.a. für den Druck dieses <strong>Sonderheft</strong>es, für Planung<br />
und Herstellung eines Exposés und des daraus abgeleiteten Flyers, mit denen<br />
wir Sponsoren gewinnen wollen. Verwaltungskosten sind nicht zu vermeiden.<br />
Hier fällt insbesondere das Honorar des Orgelsachverständigen ins Gewicht,<br />
das sich in seinen Sätzen für Beratungsstunden und für Begleitung und Abnahme<br />
der Baumaßnahme nach der Honorarrichtlinie für Orgelsachverständige<br />
richtet. Letzter Posten in unserer Kostenkalkulation ist ein Betrag für Unvorhergesehenes,<br />
den wir mit 20 % der zusätzlichen Bau-, Werbe- und Verwaltungs -<br />
kosten angesetzt haben.<br />
Grundsätzlich sollen die Mittel für den <strong>Orgelneubau</strong> nicht dem Kirchenhaushalt<br />
entnommen werden. Die gute Nachricht vorweg: Wir haben derzeit Eigenmittel<br />
aus Vermächtnissen und Spenden in Höhe von rd. 200.000,- €. Den Differenzbetrag<br />
in Höhe von 200.000,- € wollen wir durch Spenden und Zuschüsse<br />
aufbringen: Firmenspenden, Spenden von Privatpersonen, Vergabe von Pfeifenpatenschaften<br />
sowie Zuwendungen von Stiftungen, Kreditinstituten und<br />
den politischen Gemeinden. Auch die Nordkirche beteiligt sich mit 20 % der eingeworbenen<br />
Spenden (max. 5.000,- €). Aber nicht nur andere sollen Geld geben.<br />
Auch Gruppen aus der <strong>Kirchengemeinde</strong> wie z.B. der Chor sind nicht untätig.<br />
Zwei Konzerterlöse und der Erlös aus dem Verkauf einer CD mit Weihnachtsmusik<br />
sorgen für die Reduzierung der Finanzierungsdifferenz.<br />
Mit der Verteilung dieses <strong>Sonderheft</strong>es „<strong>Orgelneubau</strong>“ beginnt offiziell die<br />
„Werbekampagne“. Das <strong>Sonderheft</strong> richtet sich insbesondere an die Haushalte<br />
in unserer Gemeinde, die mit der anhängenden „Spendenzusage“ eine Orgelpfeifen-Patenschaft<br />
(siehe S. 20) erwerben oder einen Geldbetrag spenden kön-<br />
18
nen. Die in Frage kommenden Firmen werden in gesonderten Schreiben um<br />
Spenden gebeten. In einigen Fällen werden Vertreter der Orgel-Arbeitsgemeinschaft<br />
persönlich bei den potentiellen Geldgebern und den politischen Gemein -<br />
den vorsprechen. Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Alle Spender erhalten<br />
eine Spendenbescheinigung.<br />
Mit den Stiftungen, die Projekte wie unseren <strong>Orgelneubau</strong> fördern, stehen wir<br />
bereits seit geraumer Zeit in Kontakt. Dort werden jetzt ebenfalls die entsprechenden<br />
Anträge auf Förderung gestellt.<br />
Claus Alpers<br />
Im Orgelgehäuse Foto: Horst Kay<br />
19
Orgelpfeifen-Patenschaft: Wie geht das?<br />
Der Leser des Kapitels „Kosten und Finanzierung“ weiß, dass die Mittel zur Finanzierung<br />
der neuen Orgel zu großen Teilen durch Spenden eingeworben werden<br />
müssen. Wir unterscheiden die herkömmliche Spende und die Übernahme<br />
einer Orgelpfeifen-Patenschaft. Wie wird man nun Pate für welche Orgelpfeife?<br />
Zunächst einmal: 1.004 Pfeifen warten auf einen Paten. Sie sind im Pfeifenverzeichnis<br />
aufgeführt, das auf den Seiten 16 und 17 abgebildet ist. Einige Begriffe<br />
aus diesem Verzeichnis sind in dem Artikel „Wissenswertes über die Orgel“ erläutert.<br />
Wir haben unsere Pfeifen in vier Preiskategorien (50 €, 100 €, 200 €, 500 €)<br />
eingeteilt, die sich grundsätzlich an der Pfeifengröße orientieren. Was ist nun zu<br />
tun? Die Übernahme einer Patenschaft für eine oder mehrere Orgelpfeifen kann<br />
schriftlich (Vordruck Spendenzusage) oder auch telefonisch beim Kirchenbüro<br />
erklärt werden. Den Vordruck finden Sie in diesem <strong>Sonderheft</strong> auf Seite 35 und<br />
in einem Flyer, der im Kirchenbüro und in den Kirchen in <strong>Flemhude</strong> und Schön -<br />
wohld sowie im Bürgerhaus in Melsdorf ausliegt. Sollten Sie sich nicht für eine<br />
bestimmte Pfeife entscheiden können/wollen, werden wir die Auswahl entsprechend<br />
der Betragshöhe treffen.<br />
Jeder Pate erhält zeitnah eine Patenschaftsurkunde und eine Spendenbescheinigung.<br />
Natürlich kann eine Patenschaft auch verschenkt werden – eine originelle<br />
Idee für Taufe oder Konfirmation, für Geburtstage oder andere Anlässe. Das<br />
Pfeifenverzeichnis wird wöchentlich aktualisiert und ist auf unserer homepage<br />
und im Kirchenbüro einzusehen. Die Namen der Spender/Paten werden, sofern<br />
das Einverständnis vorliegt, im Gemeindebrief veröffentlicht.<br />
Claus Alpers<br />
20<br />
Foto: Horst Kay
Die Kosten einer Orgel – was steckt dahinter?<br />
Der Bau einer Orgel ist ein Projekt, dessen Planung und Kosten durchaus mit<br />
einem Hausbau vergleichbar sind. Und wir legen unsere Hoffnungen und<br />
Wünsche für ein Instrument, das länger stehen soll als so manches Haus, vertrauensvoll<br />
in die Hände eines Orgelbauers. Wohl jeder von uns hat mit verschiedenen<br />
Professionen und handwerklichen Leistungen schon seine Erfahrungen<br />
gemacht. Doch Hand aufs Herz – über Orgelbauwerkstätten denken wir<br />
wohl eher selten nach.<br />
Kaum ein Instrument ist in äußerer Ausstattung und innerer Zusammensetzung<br />
so variabel wie eine Orgel. Das gilt dann natürlich auch für die Kosten. Doch<br />
wie setzen sich diese zusammen, wie muss ein Orgelbauer kalkulieren, damit<br />
auch er im ständig enger werdenden Wettbewerb sein Auskommen hat?<br />
Damit der Orgelbauer überhaupt arbeiten kann, hat er zunächst einmal Betriebskosten<br />
zu berücksichtigen, wie jeder andere Handwerker auch. Orgelbau<br />
besteht immer noch zu ganz großen Teilen aus Handarbeit, von deren Qualität<br />
hinterher der Klang der Orgel ganz wesentlich abhängt. Entsprechend qualifiziert<br />
sind die Orgelbauer, deren Arbeit Elemente aus Möbeltischlerei, Metall -<br />
bearbeitung, Feinmechanik, Elektronik und technischem Zeichnen enthält. So<br />
besteht fast die Hälfte der Kosten für eine Orgel aus Löhnen und Lohnnebenkosten.<br />
Ein weiterer wesentlicher Faktor sind die Materialkosten, die zumindest zum<br />
Teil von Weltmarktpreisen abhängig sind, wie wir das beim Zinn für den Pfeifenbau<br />
beobachten können. Für unsere Orgel wird mit einem Zinnbedarf von<br />
ca. einer Tonne gerechnet, der Preis für Zinn liegt zur Zeit bei ca. 15 000<br />
€/Tonne. Rechnen wir zusätzlich zu den Materialkosten noch den Zeitaufwand<br />
von bis zu 300 Stunden pro Register zusammen, ergibt sich ein Registerpreis<br />
von bis zu 20 000 €. Bei einer Orgel wie der unseren, die 20 Register haben wird,<br />
ist die Preisgrößenordnung „Einfamilienhaus“ schnell erreicht.<br />
Es ist das Bestreben eines jeden Orgelbauers, und auch die Erwartung einer<br />
jeden <strong>Kirchengemeinde</strong>, ein Instrument zu erhalten, dessen Wert auch nach<br />
Jahrzehnten noch sichtbar und vor allem hörbar ist. Und so kann und muss<br />
jeder Orgelbauer erwarten können, dass seine hochspezialisierte handwerkliche<br />
Arbeit und auch seine Kreativität, die die Orgel in den Gesamtzusammenhang<br />
des umgebenden Raumes einfügen muss, angemessen entlohnt wird, denn er<br />
wird „seine“ Orgel noch über Jahre begleiten und pflegen.<br />
Birgit von Brandis<br />
21
Mit dem Orgelbau alleine ist es nicht getan<br />
Der Neubau der Orgel erfordert auch bauliche Ergänzungsmaßnahmen. Zum<br />
Umfang dieser zusätzlichen Arbeiten befragten wir Iris Milberg-Schoeller, die in<br />
der Orgel-Arbeitsgruppe für die bautechnischen Belange des Projektes zuständig<br />
ist.<br />
Frage: Frau Schoeller, kann die Empore das Gewicht der neuen<br />
Orgel tragen?<br />
Milberg-Schoeller: Unser Architekt Herr Hartwig Kühne hat ein statisches Aufmaß<br />
mit der neuen Orgel angefertigt und dieses dann durch<br />
einen Statiker prüfen lassen. Wir erhielten erfreulicherweise<br />
eine positive Antwort, die da lautet: „Das Gewicht der<br />
neuen Orgel kann von der alten Empore aufgenommen<br />
werden.“ Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für die<br />
Verstärkung von Trägerbalken und Stützsäulen.<br />
Frage: Für den Chor soll auf der Empore mehr Platz geschaffen<br />
werden – was ist vorgesehen?<br />
Milberg-Schoeller: Mit Sicht aus dem Kircheninnenraum soll rechts von der<br />
Orgel ein Chorpodest gebaut werden. Es wird aus zwei<br />
Stehflächen mit unterschiedlichen Höhen bestehen.<br />
Frage: Bleibt die recht steile Treppe zur Orgelempore erhalten und<br />
was wird mit dem Treppenaufgang zum Dachboden?<br />
Milberg-Schoeller: Die Treppe, die vom Kirchenvorraum zur Empore führt,<br />
bleibt erhalten. Der neue Orgelkorpus fällt größer aus als<br />
der alte, d.h. er hat eine größere Tiefe, die bis auf 20 cm an<br />
die Außenwand desWestgiebels heranreicht. Somit kann<br />
der jetzige Aufgang zum Bodenraum nicht erhalten bleiben.<br />
Es muss eine neue Treppe gebaut werden, die hinter dem<br />
Chorpodest und der neuen Rückwand verlaufen wird.<br />
Frage: Welche weiteren Veränderungen sind vorgesehen?<br />
Milberg-Schoeller: Mit der Entscheidung zum <strong>Orgelneubau</strong> mussten auch die<br />
Vorgaben aus den Richtlinien der „Allgemeinen Verwaltungs -<br />
anordnung über die Durchführung von Orgelbauvorhaben<br />
in der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ berücksichtigt<br />
werden. Hierzu gab es einen Besichtigungstermin,<br />
zu dem u.a. das Landesamt für Denkmalpflege als mit<br />
genehmigende Behörde eingeladen war. Dabei wurde festgestellt,<br />
dass die momentane Holzlattung zur optischen Ab-<br />
22
trennung des hinteren Orgelraumes vom vorderen Emporenbereich<br />
denkmalpflegerisch nicht von Bedeutung ist.<br />
Hier soll nun eine neue Rückwand entstehen, die sich optisch<br />
an den alten baulichen Vorgaben orientiert.<br />
Frage: Was haben die Untersuchungen zum Raumklima ergeben?<br />
Milberg-Schoeller: Seit über einem Jahr wird das Raumklima in der Kirche aufgezeichnet.<br />
Die gewonnenen Daten werden zur Zeit ausgewertet.<br />
Nach Vorliegen der Ergebnisse werden weitere Entscheidungen<br />
getroffen werden müssen.<br />
Frage: Rechnen Sie mit unangenehmen Überraschungen beim Aus -<br />
bau der alten Orgel?<br />
Milberg-Schoeller: Vor Überraschungen ist man niemals geschützt, aber ich<br />
gehe davon aus, dass wir, falls sich Probleme ergeben sollten,<br />
diese auch lösen können.<br />
Die Fragen stellte Ursula Grell<br />
Foto: Joachim Gehl<br />
23
Der Organist – verschiedene Wege führen zum Ziel<br />
A, B, C, D- Musiker: Wer jetzt meint, wir sortierten unsere Musiker nach Alphabet,<br />
der irrt. Es handelt sich vielmehr um Stufen in der Ausbildung zum Organisten<br />
und letztendlich zum Kirchenmusiker.<br />
Ohne den Musiker, der sie spielt, bleibt auch die schönste Orgel stumm. Doch<br />
was wissen wir über den Weg desjenigen, den wir meistens von hinten sehen,<br />
fast akrobatisch gefordert beim Spielen unserer Orgel.<br />
Um es vorwegzunehmen: Man muss nicht Kirchenmusiker sein, um in der Kirche<br />
die Orgel zu spielen. Um ganz am Anfang zu beginnen, reicht die sogenannte<br />
„D-Prüfung“, eine Ausbildung und Prüfung, die der Kirchenkreis abnimmt. Der<br />
nächste Schritt ist ein zweijähriges Studium an einer Kirchenmusikschule mit<br />
abschließender C-Prüfung, die den Absolventen berechtigt, nebenberuflich und<br />
eigenverantwortlich für die Kirchenmusik zu sorgen. Grundlage ist aber auch<br />
hier schon ein umfangreicher Fächerkanon, der u.a. Klavier, Gesang, Chorleitung<br />
und natürlich Orgelkunde umfasst, aber auch den zukünftigen Arbeitsbereich<br />
erkennen lässt, nämlich den Einsatz in der Kirche. So gehören Kirchenmusikgeschichte,<br />
Liturgik und Theologische Information zu den Ausbildungsfächern.<br />
Wer dann weiterstudiert, legt im Anschluss nach einem dann vierjährigen Studium<br />
an einer Kirchenmusikschule oder einer Musikhochschule die B-Prüfung<br />
ab. Sie qualifiziert den Musiker für den hauptberuflichen Dienst. In der Regel ist<br />
dies ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Prüfung als A-Musiker, für den die<br />
Regelstudienzeit vier bis sechs Jahre umfasst. Ein so ausgebildeter Musiker ist<br />
qualifiziert für den kirchenmusikalischen Dienst an Hauptkirchen mit den<br />
Schwerpunkten Chorarbeit und Orgelspiel. Ein solcher Kirchenmusiker ist also<br />
sowohl als Organist als auch als Chorleiter und Musikpädagoge gefordert.<br />
Soweit die Theorie. In der Praxis ist die Beschäftigung der Organisten oder Kirchenmusiker<br />
oft von finanziellen Zwängen begleitet. Stellen werden herabgestuft<br />
oder mit Honorarvertragskräften besetzt. Wobei natürlich nicht ausgeschlossen<br />
ist, dass diese sich mit Kreativität und Engagement in ihrer Gemeinde<br />
engagieren.<br />
Birgit von Brandis<br />
„Versäume keine Gelegenheit, dich auf der Orgel zu üben.<br />
Es gibt kein Instrument, das am Unreinen und Unsauberen im<br />
Tonsatz wie im Spiel alsogleich Rache nähme als die Orgel.“<br />
24<br />
Robert Schumann in „Musikalische Haus- und Lebensregeln“
Unser Organist Andreas Bronnmann –<br />
ein Werdegang im Überblick<br />
Frage: Wie fing es eigentlich an mit dem Interesse für Musik?<br />
Bronnmann: Musik mache ich eigentlich, solange ich denken kann. Mein Vater<br />
spielte Akkordeon, das hat mich damals stark beeindruckt. Mit<br />
vier Jahren bekam ich mein erstes eigenes Kinderakkordeon, das<br />
ich heute noch besitze. Meine Brüder und ich lernten Musik spielerisch<br />
und spielten Melodica, Glockenspiel, Akkordeon, Schlagwerk,<br />
Harmonium oder Heimorgel.<br />
Frage: Wann war für Dich klar, dass Du Berufsmusiker werden wolltest?<br />
Bronnmann: Ich hatte in Dirk Zylsdorf einen ziemlich guten Schlagzeuglehrer<br />
gefunden. Dirk ermutigte mich, Musik mit Schwerpunkt Schlagzeug/Percussion<br />
zu studieren und eröffnete mir damit völlig<br />
neue Horizonte. So kam zum ersten Mal der Gedanke auf, dass<br />
aus meiner Leidenschaft ein Beruf werden könnte.<br />
Frage: Dann wäre aus dir ja fast ein Schlagzeuger geworden!<br />
Bronnmann: Das bin ich ja auch. Schon vor dem Studium habe ich in verschiedenen<br />
Formationen besonders im Jazz gespielt. Man ist ja als Musiker<br />
auch ständig im „Werden“ und nie fertig.<br />
Frage: Wie bist Du denn zur Kirchen -<br />
musik und zur Orgel gekommen?<br />
Bronnmann: Da gab es für mich ein regelrechtes<br />
„Schlüsselerlebnis“. Ich<br />
hörte die „Toccata“ (BW565)<br />
von Johann Sebastian Bach<br />
im Radio. Die war auch in<br />
der guten und vielseitigen<br />
Schallplattensammlung meiner<br />
Eltern enthalten. Schon<br />
als Kind hatte ich sie häufig<br />
gehört, jetzt, als Jugendlicher,<br />
wollte ich sie unbedingt spielen.<br />
Hochmotiviert übte ich<br />
viele Stunden, bis ich sie beherrschte.<br />
Und jetzt wusste<br />
ich auch: Ich werde Organist.<br />
Foto: Horst Kay<br />
25
So kam ich zu Hans-Dietrich Ott in Flintbek, der mich auf die Aufnahmeprüfung<br />
an der Musikschule vorbereitete. Das bedeutete<br />
zwei Jahre lang viele Stunden tägliches Üben der Fächer Klavier,<br />
Orgel, Gesang und Musiktheorie. In Hamburg studierte ich dann<br />
elf Semester Kirchenmusik und schloss das Studium mit der<br />
B-Prüfung ab. Nach dem Studium blieb ich als freischaffender<br />
Künstler, Organist, Pianist und Lehrer zunächst in Hamburg und<br />
seit jetzt schon zehn Jahren bin ich Organist in <strong>Flemhude</strong>.<br />
Frage: Was ist Dir für die nächste Zeit wichtig?<br />
Bronnmann: Also erst einmal freue ich mich als Organist natürlich sehr auf die<br />
neue Orgel. Und ich freue mich auf eine gute, fruchtbringende<br />
Zusammenarbeit mit den Orgelbauern, die ja auch Künstler sind,<br />
auf eine gegenseitige Inspiration, damit etwas großes, kreatives<br />
Neues entstehen kann : Soli Deo Gloria!<br />
26<br />
Die Fragen stellte Birgit von Brandis<br />
Foto: Horst Kay
Von <strong>Flemhude</strong>r Orgeln und Organisten<br />
„Alles zum Ruhm des dreimalbesten Gottes“.<br />
Mit diesem Bekenntnis beginnt der Text,<br />
der den ersten Beleg für das Vorhandensein<br />
einer Orgel in der <strong>Flemhude</strong>r Kirche enthält.<br />
Eindrucksvoll ist diese historische Quelle<br />
schon äußerlich: Es ist die große holzgeschnitzte<br />
Stiftungstafel, die auf der Rückseite<br />
des Altars hängt und seit 1685 in lateinischer<br />
Sprache die bedeutenden Stiftungen des<br />
„unvergleichlichen Patrons“ Hans Henrich v.<br />
Kielmansegg für die <strong>Flemhude</strong>r Kirche<br />
preist. Die „Freigebigkeit“ des auf Quarnbek<br />
wohnenden Patrons ermöglichte nicht nur<br />
die Aufstellung des beeindruckenden barokken<br />
Altars, sondern auch die Anschaffung<br />
einer „wohlklingenden Orgel“.<br />
Die Vermutung, dass es bis 1685 in der <strong>Flemhude</strong>r<br />
Kirche keine Orgel gegeben hat, lässt<br />
Foto: Horst Kay<br />
sich nicht durch lokale Quellen stützen, ist<br />
aber nicht ohne historische Basis. Experten<br />
machen deutlich, dass zwar schon im 13./14. Jahrhundert Orgeln zur Ausschmückung<br />
der Liturgie erklangen, belegt aber nur für damals bedeutende Kirchen.<br />
Wenn es in einer Kirche keine Orgel gab, sind dafür nicht nur Kosten- und<br />
Platzgründe ausschlaggebend gewesen, sondern die katholische Messe war und<br />
ist stark auf den Altarraum konzentriert, so dass es zur Hervorhebung des liturgischen<br />
Geschehens genügte, im Chorbereich eine Kleinorgel (Positiv/Regal) zu<br />
haben – so vielleicht auch in <strong>Flemhude</strong>.<br />
Nach Einführung der Reformation (1526/27) rückte auch in <strong>Flemhude</strong> die Wortverkündigung<br />
in den Mittelpunkt des Gottesdienstes, weshalb eine Kanzel und<br />
Kirchenbänke angeschafft wurden und der Gemeindegesang ein wichtiges Element<br />
wurde im Sinne der aktiven Einbeziehung der Gemeinde in das gottesdienstliche<br />
Geschehen (allgemeines Priestertum!).<br />
So wie erst 1685 der vorreformatorische Altar ersetzt wurde, ist zu vermuten,<br />
dass auch die kirchenmusikalische Ausstattung aus der vorreformatorischen<br />
Zeit bestehen blieb – zumal die <strong>Flemhude</strong>r Kirche im 16./17. Jahrhundert<br />
immer baufälliger geworden war „wegen Alters und böser Zeiten“, wie es auf<br />
der Stiftertafel heißt.<br />
Deshalb ist anzunehmen, dass Pastor Hohenholz (1680 bis 1692 in <strong>Flemhude</strong><br />
und sehr wahrscheinlich der Verfasser des Textes auf der Stiftungstafel und selber<br />
Stifter des schönen Kronleuchters) der erste war, der bei der Gestaltung des<br />
27
Gottesdienstes das liturgische Orgelspiel auf dem neuen Instrument einbeziehen<br />
konnte. Vielleicht erklang auch in <strong>Flemhude</strong> zunächst der Gemeindegesang<br />
und das Orgelspiel nur wechselweise zum Lobe Gottes, denn die uns vertraute<br />
Begleitung des Gesangs durch die Orgel soll erst im 18. Jahrhundert üblich geworden<br />
sein. Der großzügige Gönner der <strong>Flemhude</strong>r Kirche, H.H. v. Kielmansegg,<br />
konnte sich nur kurze Zeit an der Orgelmusik in „seiner“ Kirche erfreuen, denn<br />
er verstarb mit nur 49 Jahren 1686 auf Quarnbek.<br />
Die Orgel war, wie ab dem 17. Jahrhundert üblich, an der Westwand der Kirche<br />
errichtet worden – auch das eine nachreformatorische Entwicklung. Das war im<br />
Falle der <strong>Flemhude</strong>r Kirche durchaus problematisch, denn diese Seite der Kirche<br />
stand dem Wetter ausgesetzt unmittelbar über dem Ufer des großen <strong>Flemhude</strong>r<br />
Sees. Mehrfach musste das Mauerwerk repariert, teils sogar erneuert<br />
werden. Weil auch noch das Kirchendach undicht geworden war, musste die<br />
Orgel bereits 1741/42 überarbeitet werden (Orgelbauer Puck). Schon 1779<br />
waren wieder Reparaturen notwendig (Orgelbauer Mittelhäuser).<br />
1828 wurde nicht nur die abgesackte Orgelempore erneuert und vergrößert,<br />
sondern die „trefflich construirte“ Orgel im Rahmen einer Innenrenovierung<br />
der Kirche auf zwei Manuale und 18 Register erweitert. Zum Lob und Ruhme<br />
„des dreimalbesten Gottes“ erklang das Instrument aber nur noch bis 1835.<br />
Dann verstummte die Orgelmusik in der <strong>Flemhude</strong>r Kirche, denn die zur Zahlung<br />
verpflichteten Besitzer der zur <strong>Kirchengemeinde</strong> gehörenden Güter zögerten<br />
die Entscheidung für den kostenträchtigen <strong>Orgelneubau</strong> hinaus.<br />
Auch die gelobte <strong>Flemhude</strong>r Orgel hätte ohne Organisten nicht zum Lobe Gottes<br />
erklingen können. Im ältesten erhaltenen Kirchenbuch (ab 1692) werden<br />
bereits in den allgemeinen Ausführungen zu den Amtshandlungen auch die<br />
Aufgaben des Organisten beschrieben, z.B. bei Hochzeits- und Beerdigungs -<br />
zeremonien. 1693 wird der <strong>Flemhude</strong>r Organist, leider nicht namentlich, im Zusammenhang<br />
mit einer Konfimandin genannt, die vermutlich „bey dem Hen<br />
Organisten alhier“ in Stellung war. Ab 1698 aber sind etliche Namen von Organisten<br />
dokumentiert, z.B. durch Eintragungen zum Tode der „Frau Organistin“<br />
oder von Kindern des Ehepaares.<br />
Durch diese Quelle wissen wir auch, dass der Organist Johann Stolley die <strong>Flemhude</strong>r<br />
Orgel von 1698 bis zu seinem Tode 1728 gespielt hat. Begraben wurde er<br />
in der Kirche, wie schon seine zweite Ehefrau, die wenige Wochen vor ihm gestorben<br />
war. In der Kirche, genauer unter der Orgelempore, fand auch der<br />
Nachfolger im Organistenamt, Jürgen Kückelhahn, 1775 seine letzte Ruhe.<br />
Von Kückelhahn heißt es: Er versah „seinen Dienst ordentlich, verreiste selten,<br />
ehrte den Pfarrer gebührend, ging nicht ins Wirtshaus, hatte keine anderen Las -<br />
ter an sich, lebte friedlich mit den Ortsansässigen und seiner Frau…“ (zitiert<br />
nach Clausen, J. P., S.33).<br />
Weniger „gerühmet“ wurde vermutlich zumindest von den eingepfarrten Gütern<br />
der Organist Thomas Carstens, der bis 1814 die <strong>Flemhude</strong>r Orgel spielte.<br />
28
Bitterlich beklagte er sich immer wieder<br />
über den erbärmlichen Zustand<br />
des Organistenhauses, das nur noch<br />
ein „zusammengeflickter Kasten“ war.<br />
Sein Nachfolger im Amt wurde 1814<br />
Johann Hildebrandt. Mit diesem begann<br />
für die <strong>Flemhude</strong>r Organisten<br />
eine neue Ära: Sie wurden durch staatliche<br />
Verfügung zugleich offiziell die<br />
Lehrer der Kinder im Schuldistrikt der<br />
Foto: Archiv <strong>Kirchengemeinde</strong> <strong>Flemhude</strong><br />
Dörfer Quarnbek, <strong>Flemhude</strong> und Achterwehr.<br />
Vorher hatten die Organisten nur Privatunterricht erteilt. Diese Ämterverknüpfung<br />
bestand offiziell bis 1912; aber noch bis ca. 1946 übten die <strong>Flemhude</strong>r<br />
Lehrer das kirchliche Amt nebenbei aus. So verwundert es nicht, dass zum<br />
Beispiel 1887 in der Stellenausschreibung für die „Küster-, Organisten- und Lehrer-Bedienung<br />
in <strong>Flemhude</strong>“ nicht nur darauf hingewiesen wird, dass ohne<br />
zusätzliche Vergütung Turnunterricht erteilt und die Schulräume geheizt werden<br />
müssen, sondern auch der Kirchenchor zu leiten sei und die Fähigkeit zum<br />
Orgelspiel und Gesangsunterricht nachgewiesen werden müsse.<br />
Der bereits erwähnte Johann Hildebrandt war der Organist, in dessen Amtszeit<br />
die v. Kielmanseggsche Orgel 1835 nach 150 Jahren endgültig verstummte. Dieses<br />
Instrument - sehr wahrscheinlich mit dem typischen hellen, durchsichtigen<br />
Klang der einzelnen Stimmen einer Barockorgel – wurde schließlich bei der bekannten<br />
Firma Marcussen & Reuter (seit 1830 in Apenrade ansässig) in Zahlung<br />
gegeben und ein <strong>Orgelneubau</strong> beauftragt. In der Werkliste der heutigen Orgelbaufirma<br />
Marcussen & Sohn ist diese <strong>Flemhude</strong>r Orgel 1838 als Nummer 19 aufgeführt.<br />
Das zweimanualige Instrument wurde zu Neujahr 1841 eingeweiht.<br />
Zeittypisch erklang nun in der <strong>Flemhude</strong>r Kirche eine damals moderne romantische<br />
Orgel, deren Stimmen symphonisch verschmelzen. Ein solcher weicher,<br />
warmer Klang wurde als weit schöner empfunden als der inzwischen als<br />
„scharf“ abgelehnte der Barockorgeln.<br />
Der ehemalige <strong>Flemhude</strong>r Pastor Kobold, zugleich selber Kirchenmusiker,<br />
merkt in seiner grundlegenden Beschreibung der <strong>Flemhude</strong>r Kirche unüberhörbar<br />
kritisch an: „Vermutlich versuchte man keine Reparatur, weil das Werk dem<br />
veränderten Geschmack (Romantik!) nicht mehr entsprach. Lieber wollte man<br />
eine der „modernen“ Orgeln, mit denen damals gerade Marcussen unser Land<br />
überschwemmte“ (S.47, Fußnote e).<br />
Dazu passt, dass der <strong>Flemhude</strong>r Pastor Johann Diedrich Kähler 1869 bei seinem<br />
Wechsel nach Kirchbarkau zumindest einen vertrauten Orgelklang hörte, denn auch<br />
dort stand seit 1852 eine noch heute erhaltene Marcussen-Orgel. Auch als das <strong>Flemhude</strong>r<br />
Pastorenehepaar Baumgarten die Pfarrstelle in Siebenbäumen übernahm,<br />
fanden sie dort eine inzwischen restaurierte Marcussen-Orgel vor, gebaut 1890.<br />
29
Die für <strong>Flemhude</strong> festgelegte Verbindung von Organisten- und Lehreramt war<br />
zwar finanziell gegenüber einer reinen Lehrerstelle von Vorteil, aber für manchen<br />
der Amtsinhaber war die zusätzliche „kirchliche Mühewaltung“, wie der Lehrer<br />
und Organist Nicolai Lähndorf (von 1888 bis 1910 hier aktiv) beklagte, sehr belastend,<br />
denn auch er war durch das Organistenamt stets angebunden. Probleme ergaben<br />
sich mit Organisten, wenn diese trotz entsprechender Zeugnisse das Orgelspiel<br />
doch nicht zur Zufriedenheit beherrschten. Einer hatte die Marcussen-Orgel<br />
innerhalb eines Jahres durch Unkenntnis und Nachlässigkeit regelrecht verdorben.<br />
Im Ersten Weltkrieg mussten auch in <strong>Flemhude</strong> die zinnernen Orgelpfeifen zum<br />
Einschmelzen an die Rüstungsindustrie abgegeben werden. Lobend hob der damalige<br />
Pastor Harmsen in diesem Zusammenhang 1917 die Musikalität eines<br />
Vertretungslehrers hervor, der sogar die nun verstümmelte <strong>Flemhude</strong>r Orgel<br />
ausgezeichnet spielte.<br />
Weil Pastoren und Organisten eigentlich darauf angewiesen sind, gut zusammenzuwirken,<br />
wenn Wortverkündigung und Kirchenmusik gemeinsam das<br />
gottesdienstliche Geschehen bereichern sollen, ist bemerkenswert, dass in <strong>Flemhude</strong><br />
ein Pastor etliche Jahre unter dem unprofessionellen Orgelspiel geradezu<br />
litt, vermutlich auch mancher der Gottesdienstbesucher. Dieser Pastor betrachtete<br />
den damaligen Organisten als ein schweres Erbe, das seine Vorgänger ihm<br />
hinterlassen hatten. Ohne einen begabten Organisten kann auch eine wohlklingende<br />
Orgel nicht beeindrucken.<br />
Ab 1966 wurde die <strong>Flemhude</strong>r Marcussen-Orgel nach und nach erneuert und<br />
erweitert, offenbar nicht immer fachgerecht. Inzwischen lohnt sich nach Meinung<br />
von Experten eine Reparatur bzw. Restaurierung dieser Orgel aus dem 19.<br />
Jahrhundert finanziell nicht mehr. Den ansprechenden Prospekt der Orgel wird<br />
man hoffentlich erhalten und in einen <strong>Orgelneubau</strong> integrieren können, sozusagen<br />
als Ausdruck der Verbundenheit mit der Geschichte der <strong>Flemhude</strong>r Orgeln<br />
und Organisten. Möge auch die künftige, dritte Orgel in der <strong>Flemhude</strong>r Kirche<br />
„zum Ruhm des dreimalbesten Gottes“ erklingen.<br />
Gerlind Lind<br />
Verwendete Quellen:<br />
Baumgarten, U.H. (Hrsg.): Das älteste <strong>Flemhude</strong>r<br />
Kirchenbuch von 1692 bis 1733, <strong>Flemhude</strong>r<br />
Quellen Band 1, 1993<br />
Berendonk, G., Wiegand, A., Baumgarte, U.:<br />
Kurioses aus den <strong>Flemhude</strong>r Kirchenbüchern,<br />
<strong>Flemhude</strong>r Hefte 4, 1992<br />
Clausen, P. J.: Illustrierte Ahnenliste (Entwurf<br />
im Archiv der AG Dorfchronik Quarnbek und<br />
überarbeitet im Internet)<br />
30<br />
Kobold, H.: Die St. Georg- und Mauritius-Kirche<br />
in <strong>Flemhude</strong>, <strong>Flemhude</strong>r Hefte 1, 1989/90<br />
Lind, G.: „O selige Zeiten der Schulmeisterei“<br />
– Historisches aus den Schulen Stampe und<br />
<strong>Flemhude</strong> von 1692 bis 1918, <strong>Flemhude</strong>r Hefte<br />
10, 1998<br />
Lind, G.: „Das Gesicht der Schule ist immer<br />
das Spiegelbild des Dorfes“ – Historisches aus<br />
den Schulen Stampe und <strong>Flemhude</strong> von 1919<br />
bis 1961/64, 2001<br />
Marcussen & Son: Werkliste unter<br />
www.marcussen-son.dk
Kleine Orgelgeschichte<br />
Um 246 v. Chr. baute in Alexandria (heute Ägypten) der griechische Ingenieur<br />
Ktesibios den Vorläufer der heutigen Orgel, genannt Hydraulis. Eine Metallglocke<br />
wird in einen mit Wasser (griech.: Hydor) gefüllten Behälter gedrückt, so<br />
dass die dort verdichtete Luft (der Orgelbauer spricht von Wind) über einen Mechanismus<br />
etwa sieben Blasinstrumente erklingen lässt, die von gleicher Bauart,<br />
aber unterschiedlicher Tonhöhe sind. Das Blasinstrument mit vermutlich einfachem<br />
Rohrblatt hieß Aulos, war in der Antike weit verbreitet und klang etwa<br />
wie eine Schalmei. Ihre Ansteuerung erfolgte über grobe Hebel, die gezogen<br />
oder gedrückt wurden.<br />
In Persien sollen solche Orgeln als militärische Signalinstrumente verwendet<br />
worden sein, im antiken Rom dürften sie das grausige Treiben der Gladiatorenkämpfe<br />
in den Arenen untermalt haben. Das Instrument geriet in Vergessenheit,<br />
wohl auch deshalb, weil das christianisierte Rom die Erinnerung an solche heidnischen<br />
Volksbelustigungen tilgen wollte. Mitte des 8. Jh. gelangte eine Orgel als<br />
Gastgeschenk des oströmischen Kaisers Konstantin (Byzanz) an den Hof des<br />
Frankenkönigs Pippin den Kurzen. 824 wird von einer Orgel im Aachener Münster<br />
berichtet, Canterburry und Rom folgen im 10. Jh., Lübeck 1259 und Neumünster<br />
etwa 1280.<br />
Die Windversorgung der Wasserorgeln war zwar sehr effizient, der Mechanismus<br />
aber störanfällig. Er wurde wohl bald durch Blasebälge ersetzt, wie sie z. B.<br />
bei Schmieden gebräuchlich waren. Die groben Hebel wandelten sich zu Tasten.<br />
Das für die Orgel so charakteristische Pedal entstand vermutlich aus Faden -<br />
schlaufen, welche an den Tasten angebracht waren, um lange Töne mit dem Fuß<br />
zu halten. Das gleichfalls charakteristische Vorhandensein mehrerer Manuale<br />
entstand aus der Zusammenführung der Tastatur der großen Orgel (für das<br />
brausende Spiel zum Eingang und Ausgang) und der kleinen Orgel zu Begleitaufgaben,<br />
entweder auf Brusthöhe (daher Brustwerk) oder im Rücken des Organisten<br />
(Rückpositiv) an jetzt einer Stelle. Orgeln im heutigen Sinne gibt es in Kirchen<br />
seit etwa 1400, kleine Orgeln ohne Pedal (Positive) waren verbreitete<br />
Hausinstrumente, tragbare Orgeln (Portative) wurden als Prozessionsinstrument<br />
genutzt.<br />
Die christliche Kirche hat sich immer zum musizierten Lobe Gottes bekannt (anders<br />
als der Islam), allerdings war etwa bis zur Jahrtausendwende nur die<br />
menschliche Stimme wertvoll genug, Gott zu preisen. Deshalb kennt auch die<br />
orthodoxe Kirche keine Instrumentalmusik. In Synagogen finden sich Orgeln<br />
wohl seit Anfang des 19. Jahrhunderts.<br />
31
Ohne Zweifel war die Orgel (natürlich von ihrer Größe abhängig) das lauteste<br />
Instrument überhaupt und konnte leicht mit dem vollbesetzten Orchester mithalten.<br />
Neudeutsch gesagt: Zum Volldröhnen – statt Disco – ab in die Kirche. Im<br />
19. Jh. allerdings wurden Lautstärke und dynamische Bandbreite oft auf Kosten<br />
des Farbenreichtums und des nuancierten Anschlages erkauft. In Konzertsälen<br />
werden Orgeln oftmals zur größten Klangsteigerung eingesetzt, zum Beispiel.<br />
beim Eingangschor „Veni, Creator Spiritus“ der 8. Symphonie Gustav Mahlers,<br />
uraufgeführt 1910 in München. Die Orgel der Jahrhunderthalle in Breslau verfügte<br />
1913 über 200 Register (eine übliche mittlere Kirchenorgel hat derer heute<br />
15 bis 40), und die größte spielbare Orgel der Welt befindet sich in einem Kaufhaus<br />
in Philadelphia (USA), wo nach einer Erweiterung 1940 374 Register<br />
klingen können. Orgeln wurden z. T. geradezu industriell gefertigt. Als Reflex<br />
dieser zeittypischen Gigantomanie wendete sich die Orgelbewegung (in<br />
Deutschland seit 1925, besonders Albert Schweitzer und Hans Henny Jahnn)<br />
mehr dem kunsthandwerklichen Orgelbau zu, Klangideal war das des Barock.<br />
Heute werden wieder vermehrt Klangideale romantischer Orgeln berücksichtigt.<br />
Im frühen Mittelalter diente die Orgel also der exclusiven Prachtentfaltung<br />
weltlicher Macht. Dieses Insignium wurde von der Kirche übernommen, eine<br />
auch einschüchternde Wirkung gerne in Kauf nehmend. Die Orgel ist aber auch<br />
leise spielbar und ermöglicht wie kein anderes von einem einzelnen Menschen<br />
gespieltes Instrument, Klänge introvertiertester Abgeschiedenheit darzustellen,<br />
wovon unzählige Orgelwerke bedeutender Komponisten zeugen. Weil die<br />
Orgel beliebig lange Töne erzeugen kann, ist sie besonders zur Darstellung feinster<br />
polyphoner Musik (Fugen) geeignet.<br />
Charakteristisch für den Orgelklang ist die durch ihre Pfeifen produzierte Obertonreihe,<br />
welche klanglich-physikalisch mathematischen Gesetzen folgt und so<br />
ein Sinnbild des Kosmos als geordnete Schöpfung ist. Die Vielfalt der Pfeifen<br />
und Register ist aber auch Abbild der Vielfalt der Schöpfung, auch der zum orgelbegleiteten<br />
Gotteslob versammelten Gemeinde. Dieser liturgischen Aufgabe<br />
wegen werden Orgeln vor dem gottesdienstlichen Gebrauch geweiht. Charles<br />
Marie Widor (1844 – 1937), Organist in Paris, Schöpfer der berühmten Toccata<br />
der 5. Orgelsymphonie und Lehrer Albert Schweitzers, sagt: Orgelspielen heißt<br />
einen mit dem Schauen der Ewigkeit erfüllten Willen offenbaren.<br />
32<br />
Reinfried Barnett,<br />
Kreiskantor des Kirchenkreises Altholstein Bezirk Nord
Warum spende ich für die neue Orgel?<br />
Stimmen aus der Gemeinde<br />
Als ich kürzlich einen runden Geburtstag gefeiert habe, bat ich meine Gäste anstelle<br />
von Geschenken um eine Spende für den Neubau der <strong>Flemhude</strong>r Orgel.<br />
Dabei ist eine beträchtliche Summe zusammengekommen, die meine Frau und<br />
ich noch aufgestockt haben. Damit wollten wir unsere Verbundenheit zu unserer<br />
Kirche und unserer Gemeinde zum Ausdruck bringen.<br />
Diethelm und Ingeburg Schiemann, Achterwehr<br />
Ich spende für die neue Orgel,<br />
weil die Kirchenmusik in unserer <strong>Flemhude</strong>r Kirche lebendig bleiben soll und<br />
ein schöner Orgelklang den Chor und andere Musiker „beflügelt“.<br />
Es gibt schon Ideen für Orgelmusiken und Duo-Konzerte mit guten Solisten,<br />
z.B. für Gesang und Orgel.<br />
Der <strong>Flemhude</strong>r Kirchenchor freut sich zudem auf die vergrößerte Orgelempore<br />
mit ausreichend Stehplatz für alle.<br />
Darum unterstütze ich dieses Projekt.<br />
Ute Berger, <strong>Flemhude</strong><br />
Weil ich persönlich gerne etwas zur Finanzierung unseres Orgelbaus beitragen<br />
möchte.<br />
Maren Osbar, Rajensdorf<br />
Die Anschaffung einer Orgel ist ein Großprojekt, wohl vergleichbar mit einem<br />
Hausbau, und aus dem Etat der <strong>Flemhude</strong>r <strong>Kirchengemeinde</strong> unmöglich zu<br />
stemmen.<br />
Bei Durchsicht der interessanten gelben „Nachricht aus der <strong>Kirchengemeinde</strong><br />
<strong>Flemhude</strong>“ ist für mich immer wieder auffallend, wie viele Menschen sich uneigennützig<br />
für andere engagieren, um ein gutes Zusammenleben in unserer <strong>Kirchengemeinde</strong><br />
zu gewährleisten. So ist auch der <strong>Orgelneubau</strong> meines Erachtens<br />
nur möglich, wenn sich viele nach ihren Möglichkeiten finanziell beteiligen.<br />
Als Melsdorfer Ortschronist bin ich bemüht, Unterlagen und Materialien aus<br />
der Vergangenheit – und damit Altes - für die Zukunft zu bewahren. Deshalb<br />
spende ich für einen <strong>Orgelneubau</strong> aus Überzeugung und – so denke ich – bestimmt<br />
auch im Sinne meines geschätzten Großvaters Paul Dornbusch sen.<br />
(1869-1959), der Musiklehrer in Melsdorf war und von dem auch ich als „notleidender“<br />
Jugendlicher zum Wochenende immer einmal wieder eine kleine<br />
„Spende“ erhielt.<br />
Rolf Dornbusch, Melsdorf<br />
33
Ich spende für den Neubau unserer Kirchenorgel, da ich gerne einen Beitrag für<br />
unser Gemeindeleben leiste und auch den kommenden Generationen die Möglichkeit<br />
einer klangvollen Orgel geben möchte.<br />
Claas S. Schmidt, Melsdorf<br />
Seit unserer Kindheit leben wir in der <strong>Kirchengemeinde</strong> <strong>Flemhude</strong>. In der Feldsteinkirche<br />
haben wir gelacht und geweint. Der Klang der Orgel hat uns in vielen<br />
glücklichen, aber auch in traurigen Momenten begleitet. Das möchten wir in<br />
Zukunft nicht missen, und darum unterstützen wir die <strong>Kirchengemeinde</strong> bei<br />
der Anschaffung einer neuen Orgel durch eine Spende.<br />
Regina und Wolfgang Staschull, Strohbrück<br />
S p e n d e n a u f r u f<br />
Der Neubau unserer <strong>Flemhude</strong>r Orgel ist eine große Herausforderung und erfordert<br />
eine gewaltige finanzielle Kraftanstrengung. Tragen auch Sie zum Gelingen<br />
des Projektes bei<br />
mit der Übernahme einer oder mehrerer Orgelpfeifen-Patenschaft(en)<br />
mit dem Verschenken einer Orgelpfeifen-Patenschaft<br />
mit einer einfachen Spende ohne Gegenleistung<br />
Jeder noch so geringe Betrag ist willkommen. Die Spenden sind steuerlich absetzbar.<br />
Die Spender erhalten eine Spendenbescheinigung.<br />
Der <strong>Kirchengemeinde</strong>rat<br />
34<br />
S P E N D E N K O N T O<br />
Kirchenkreis Altholstein<br />
EDG Kiel<br />
Konto 11991<br />
BLZ 210 60237<br />
Verwendungszweck:<br />
RT 3300<br />
<strong>Orgelneubau</strong> <strong>Flemhude</strong>
Spendenzusage<br />
Patenschaft<br />
❍ Ich übernehme eine Orgelpfeifen-Patenschaft zum Preis von<br />
❍ 50 € ❍ 100 € ❍ 200 € ❍ 500 €<br />
❍ Ich wünsche den Ton ............ aus dem Register ............<br />
❍ Ich habe keine Wunsch-Orgelpfeife. Bitte weisen Sie mir eine Pfeife zu,<br />
die dem von mir genannten Preis entspricht.<br />
❍ Folgender Name soll in die Patenschafts-Urkunde eingetragen werden:<br />
..............................................................................................................................<br />
Spende<br />
❍ Ich spende der <strong>Kirchengemeinde</strong> <strong>Flemhude</strong> für die neue Orgel einen Betrag<br />
in Höhe von<br />
....................... €<br />
Mit der Veröffentlichung meines Namens im Gemeindebrief bin ich<br />
einverstanden/nicht einverstanden*).<br />
Die Spende ist steuerlich absetzbar. Sie erhalten von uns eine Spendenbescheinigung.<br />
...................................................................<br />
Name/Vorname<br />
...................................................................<br />
Straße/Hausnummer<br />
...................................................................<br />
Postleitzahl/Ort<br />
...................................................................<br />
Telefon/Email<br />
...................................................................<br />
Datum/Unterschrift<br />
Bitte senden/faxen Sie die ausgefüllte Spendenzusage an:<br />
<strong>Kirchengemeinde</strong> <strong>Flemhude</strong> - Kirchkamp 1 - 24107 Quarnbek-<strong>Flemhude</strong><br />
Tel. 04340-8164 Fax 04340-9031<br />
Bankverbindung siehe Nebenseite<br />
*) Nichtzutreffendes bitte streichen<br />
35