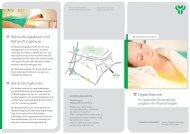Projektarbeit Alexander Siebrecht - Kliniken Essen-Mitte
Projektarbeit Alexander Siebrecht - Kliniken Essen-Mitte
Projektarbeit Alexander Siebrecht - Kliniken Essen-Mitte
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Krankenpflegeschule der <strong>Kliniken</strong> <strong>Essen</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Henricistraße 92<br />
45136 <strong>Essen</strong><br />
Kurs 2008 / 2011 (Oberkurs)<br />
Kursleitung:<br />
Lernbereich 2: Ausbildungs- und Prüfungssituation von Pflegenden<br />
Teilbereich 6: Persönliche Gesunderhaltung<br />
<strong>Projektarbeit</strong> zur mündlichen Abschlussprüfung in der Gesundheits- und<br />
Krankenpflege am 22. September 2011<br />
Möglichkeiten der persönlichen Gesunderhaltung in der beruflichen Pflege am<br />
Beispiel des betrieblichen Gesundheits- und Eingliederungsmanagements<br />
Betriebsverpflegung im Spät- und Nachtdienst und als Handlungsfeld der<br />
betrieblichen Gesundheitsförderung<br />
Name :<br />
Adresse :<br />
Abgabedatum :
Inhaltsverzeichnis Seite<br />
1. Einleitung ..............................................................................................................3<br />
2. Vorwort .................................................................................................................4<br />
3. Definition...............................................................................................................5<br />
3.1 Macht ............................................................................................................5<br />
3.1.1 Definition Max Weber, 1980 ...............................................................5<br />
3.1.2 Definition Hannah Arendt, 2003..........................................................5<br />
3.2 Hierarchie .....................................................................................................5<br />
3.2.1 Hierarchie im religiösen Kontext.........................................................5<br />
3.2.2 Hierarchie im sozialwissenschaftlichen Kontext .................................5<br />
4. Praxisbeispiel und Transfer....................................................................................6<br />
5. Zusammenfassung................................................................................................13<br />
6. Ausblick ...............................................................................................................14<br />
7. Eigenständigkeitserklärung ..................................................................................15<br />
8. Literaturverzeichnis..............................................................................................16<br />
Seite 2
1. Einleitung<br />
Das betriebliche Gesundheitsmanagement ist mittlerweile ein wichtiges Thema in der<br />
Berufswelt. Die Anforderungen an Arbeitnehmer, speziell in der Pflege, werden laut<br />
aktueller Prognosen stetig zunehmen. Da Gesundheitsprävention sowohl<br />
gesellschaftlich als auch im Rahmen der Ausbildung in der Gesundheits- und<br />
Krankenpflege immer mehr in den Fokus rückt, ist es sinnvoll sie auch im Berufsleben<br />
einzugliedern. Zum einen da man viel Zeit in seinem Beruf verbringt, zum anderen<br />
kann gelebte Gesundheitsprävention im Berufsleben auch als Vorbild und Anreiz im<br />
Privatleben dienen. Außerdem reduziert entsprechende Prävention die Fehlzeiten von<br />
Arbeitnehmern, wodurch der Bedarf an betrieblichem Eingliederungsmanagement<br />
verringert wird.<br />
Ich möchte mich in meiner Facharbeit mit dem Handlungsfeld der „Ernährung“,<br />
speziell betriebliche Versorgung im Schichtdienst, auseinandersetzen. Ich halte dieses<br />
Thema für wichtig, da viele so genannte Zivilisationskrankheiten eng mit falscher<br />
Ernährung und falschen Ernährungsgewohnheiten verknüpft sind. Schichtdienst stellt<br />
eine besondere Belastung für den Körper dar, daher ist hier eine optimale Versorgung<br />
sinnvoll. Da ich selbst im Schichtdienst arbeite, ist dies für mich natürlich von<br />
Interesse.<br />
Seite 3
2. Vorwort<br />
Zunächst geht es um die Klärung der Frage, warum Betriebsverpflegung ein wichtiges<br />
Handlungsfeld der betrieblichen Gesundheitsprävention ist und warum es gerade für<br />
Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege sinnvoll ist. Es gilt im Weiteren<br />
den Fokus auf den Ist-Zustand zu richten. Dazu zählen die eigene Erfahrung, der<br />
Austausch mit Arbeitskollegen und Möglichkeiten, wie man im Betrieb z.B. anhand<br />
eines Fragebogens Anregungen, Wünsche, Mängel und Kritik erfahren kann.<br />
Hier ist auch die Verknüpfung mit dem Lernbereich „Macht und Hierarchie“<br />
anzusiedeln, da man über diesen Weg in Kommunikation treten kann und die<br />
Möglichkeit besteht, Hierarchien zu ändern bzw. abzubauen.<br />
Nach der Erarbeitung des Ist-Zustandes folgen Lösungsmöglichkeiten, wie man eine<br />
entsprechende Betriebsverpflegung gestalten könnte, um eine adäquate Versorgung<br />
der Mitarbeiter, die durch Ihre Dienstzeiten nicht am regulären Mittagessen<br />
teilnehmen können, zu gewährleisten.<br />
Im Ausblick geht es um die Möglichkeit, die Versorgung eventuell auf die Mitarbeiter<br />
in der Nachtschicht auszuweiten.<br />
Seite 4
3. Definition<br />
3.1 Macht<br />
3.1.1 Definition Max Weber, 1980<br />
„Jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen<br />
Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht.“<br />
3.1.2 Definition Hannah Arendt, 2003<br />
„Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun,<br />
sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit Ihnen zu<br />
handeln. Über Macht verfügt niemals ein einzelner; sie ist im Besitz einer Gruppe und<br />
bleibt nur solange existent, als die Gruppe zusammenhält.“<br />
3.2 Hierarchie<br />
3.2.1 Hierarchie im religiösen Kontext<br />
„In den Religionen entspricht Hierarchie der Rangordnung Ihrer Repräsentanten und<br />
wird in der katholischen Kirche durch den Klerus gebildet. Die hierarchische Ordnung<br />
der Kirche gilt als von Gott angeordnet und von Jesus Christus eingesetzt.“<br />
3.2.2 Hierarchie im sozialwissenschaftlichen Kontext<br />
„Durch Verhältnisse der Über- und Unterordnung bestimmte Ordnung der sozialen<br />
Beziehungen in Gruppen, Institutionen, Organisationen und in der Gesamtgesellschaft;<br />
zugleich auch Name für die Gesamtheit der Träger einer hierarchischen Ordnung. Der<br />
differenzierten Ausübung von Herrschaft dienend, besteht eine Hierarchie aus<br />
mehreren Hierarchieebenen, deren Angehörigen bestimmte Befugnisse bzw.<br />
Verpflichtungen zugeordnet sind; idealtypisch von der Soziologie als Herrschafts-<br />
system mit fest gefügter Rangordnung, genau abgegrenzten Befugnissen und eindeutig<br />
festgelegter Weisungs-, Befehls- und Kommunikationsstruktur beschrieben.“<br />
Seite 5
4. Praxisbeispiel und Transfer<br />
Das betriebliche Eingliederungsmanagement hat zum Ziel, Arbeitsunfähigkeit der<br />
Arbeitnehmer möglichst zu überwinden und erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen.<br />
Um Erkrankungen und der Gefahr der Chronifizierung bei vorbelasteten Mitarbeitern<br />
zu begegnen und Arbeitsfähigkeit zu erhalten, ist das Handlungsfeld der Gesundheits-<br />
prävention ideal. Als langfristiges Ergebnis verfügt der Betrieb dadurch über gesunde<br />
und motivierte Mitarbeiter, Arbeitsunfähigkeitszeiten reduzieren sich und es kommt<br />
zu einer langfristigen Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter. Durch<br />
höhere Zufriedenheit bindet man die Arbeitnehmer besser an den Betrieb, dadurch<br />
wird Erfahrung und Wissen gesichert und das Betriebsimage wird gesteigert.<br />
Gerade in einem Krankenhaus sollte Gesundheitsprävention genutzt werden, da nicht<br />
nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Patienten davon profitieren und hier das<br />
Betriebsimage in Bezug auf Gesundheit wichtig ist.<br />
Schulung und Beratung zu beispielsweise Gesunderhaltung und Lifestyle-<br />
Management für Patienten wird erfolgreicher und besser akzeptiert, wenn im<br />
betreffenden Krankenhaus diese Themen entsprechend umgesetzt werden und das<br />
Gesundheitsimage damit begründet werden kann.<br />
Innerhalb der Gesundheitsprävention gilt der Ernährung, gerade in der<br />
Betriebsverpflegung, besonderes Augenmerk. Gesundheitliche Beeinträchtigungen<br />
können gerade auch durch mangelhafte oder fehlende Möglichkeiten einer<br />
ernährungsphysiologischen Betriebsverpflegung entstehen und fördern damit so<br />
genannte Zivilisationskrankheiten wie z.B. Diabetes mellitus oder verschiedene<br />
Herzerkrankungen. Gerade der Typ 2-Diabetes führt später durch die von ihm<br />
bedingten Komplikationen und Folgeerkrankungen zu erhöhten Arbeitsunfähigkeits-<br />
zeiten der Arbeitnehmer.<br />
Der Betriebsverpflegung kommt insofern eine wichtige Rolle zu, da man davon<br />
ausgehen kann, dass wer sich während der Arbeitszeit nicht adäquat ernährt, dies auch<br />
insgesamt nicht tut. Der Trend in der Gesellschaft geht eindeutig Richtung Fast Food<br />
und Junk Food und beschränkt damit die Möglichkeit, Ernährungsfehler während der<br />
Arbeitszeit auszugleichen. Diese Form der Ernährung lockt unter anderem dadurch,<br />
dass sie einfach zu bekommen und schmackhaft ist. Wenige Menschen lassen sich<br />
begeistern durch z.B. Ernährungskurse an adäquate Ernährung herangeführt zu<br />
werden. Solche Kurse entsprechen nicht dem Verständnis von Lifestyle des Großteils<br />
Seite 6
der Gesellschaft und die meisten Menschen verknüpfen mit „gesunder“ Ernährung<br />
kein leckeres <strong>Essen</strong>, hohe Kosten und großen Aufwand dies zuzubereiten. Lernt man<br />
hingegen im Rahmen der Betriebsverpflegung ernährungsphysiologisch ausgewogene<br />
und vor allem schmackhafte Ernährung kennen ist die Chance höher, dass man dies in<br />
den privaten Bereich übernimmt. Insofern kommt der Ernährung im Betrieb eine<br />
starke Vorbildfunktion zu.<br />
Es ist sinnvoll, möglichst früh mit vorbeugenden Strategien zu beginnen und gerade<br />
bei jungen, gesunden Menschen ist es schwierig, diese für freiwillige Angebote zur<br />
Verhaltensprävention zu gewinnen. Der ideale Zeitpunkt ist die Situation von jungen<br />
Menschen in der betrieblichen Ausbildung, da gerade diese einen tief greifenden<br />
Lebensstilwechsel erleben, wenn sie in das Berufsleben eintreten. Dies trifft vor allem<br />
in der Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege verstärkt zu. Gerade die<br />
Umstellung vom geregelten Schulalltag hin zum Schichtdienst mit Arbeit an<br />
Wochenenden ist meist schwierig, der Alltag muss völlig neu organisiert werden und<br />
es muss gelernt werden mit neuen, ungewohnten Belastungen umzugehen. Häufig geht<br />
dieser Wechsel damit einher, das vorher ausgeübter Sport eingeschränkt oder ganz<br />
eingestellt wird, da man beispielsweise nicht mehr die Möglichkeit hat, an einem<br />
regelmäßigen Training in einem Sportverein teilzunehmen. Hier kann betriebliche<br />
Gesundheitsförderung dazu beitragen, dass dieser Übergang in einen neuen<br />
Lebensabschnitt erleichtert wird und die Auszubildenden lernen mit Belastungen im<br />
Beruf kompetent umgehen zu können und das neue Leben als Arbeitnehmer souverän<br />
und gesundheitsfördernd zu managen.<br />
Aktuelle Studien zeigen, dass die Bevölkerung immer früher und stärker unter<br />
Übergewicht leidet und daher scheint eine wichtige präventive Maßnahme zu sein,<br />
dieses möglichst zu verhindern. Das Problem der Mangel- bzw. Fehlernährung wird in<br />
der Gesundheits- und Krankenpflege durch den Schichtdienst noch weiter forciert. Es<br />
werden besondere Anforderungen an den Körper gestellt und dieser benötigt eine<br />
adäquate Ernährung, um sich diesen zu stellen. Aber gerade in Spät- und Nachtdienst<br />
ist die Versorgung schwierig und häufig findet eine gesundheitsgerechte Ernährung<br />
nicht statt. Dies kann weitere Beschwerden nach sich ziehen, z.B. Magen-Darm-<br />
Beschwerden und Appetitlosigkeit. Verstärkt werden kann die Problematik dadurch,<br />
dass Schichtarbeiter meist unregelmäßiger essen und sich auch weniger Zeit dafür<br />
lassen. So kenne ich die häufige Situation in Spätdiensten, dass Zeit für eine reguläre<br />
Pause nicht gegeben ist und man nur schnell etwas zu sich nimmt oder die Pausen sich<br />
einfach verschieben und man keine Regelmäßigkeit für die Mahlzeiten einhalten kann.<br />
Seite 7
Für den Ist-Zustand möchte ich mich auf die Betriebsverpflegung in den <strong>Kliniken</strong><br />
<strong>Essen</strong>-<strong>Mitte</strong>, speziell Betriebsteil Huyssens-Stiftung beziehen, da ich hier die meiste<br />
Zeit meines bisherigen Arbeitsleben verbracht habe. Auf die reguläre Versorgung am<br />
Mittag gehe ich dabei nur am Rande ein, da sie für mich aufgrund meiner<br />
Arbeitszeiten im Schichtdienst nicht in Betracht kommt und ich mich deshalb nur mit<br />
der Verpflegung im Spätdienst der Pflege beschäftigen möchte.<br />
Im Spätdienst ist in der Regel zwischen 17.00 und 18.00 Uhr Zeit für die Pause, da in<br />
dieser Zeit Versorgungsassistenten den Patienten ihr Abendessen reichen und die<br />
Patienten mit der Einnahme Ihres <strong>Essen</strong>s beschäftigt sind.<br />
Bis 18.00 Uhr ist die Cafeteria im Haus offiziell geöffnet. Meistens wird aber bereits<br />
gegen 17.30 Uhr angefangen, die Reste der angebotenen Speisen abzuräumen. Zur<br />
Auswahl stehen zu diesem Zeitpunkt in der Regel: Frikadellen, Bockwürstchen, selten<br />
einige wenige Brötchen, unter Umständen Reste von zwei bis drei Salaten vom<br />
Mittag, ein Obstkorb, Süßigkeiten und die so genannten „Snacks am Nachmittag“,<br />
bestehend aus Pizza, Flammkuchen und Baguette. Für die Zubereitung der Snacks<br />
werden fünf bis zehn Minuten benötigt, da diese in einem speziellen Ofen fertig<br />
gebacken werden. Mit der Zeit, die man benötigt um zur Cafeteria zu gelangen, der<br />
Zubereitung eines Snacks und dem Weg zurück auf die Station ist ein Großteil der<br />
Pause ausgeschöpft und die Zeit für die Einnahme der Mahlzeit ist enorm reduziert.<br />
Allerdings muss fairerweise zugegeben werden, dass die Kollegen in der Cafeteria<br />
anbieten, dass man einen entsprechenden Snack kurz vorher telefonisch in Auftrag<br />
gibt und man diesen dann nur noch abholen braucht, die Zeit der Zubereitung also<br />
entfällt.<br />
Dies sind meine persönlichen Beobachtungen und die von Arbeitskollegen in der<br />
Pflege, mit denen ich mich zum Thema dieser Facharbeit ausgetauscht habe.<br />
Hier findet sich die Verknüpfung zum Thema Macht und Hierarchie, da von der<br />
Küche des Hauses sowohl die Zeit vorgegeben wird, zu der man Betriebsversorgung<br />
wahrnehmen kann, als auch die Art und Weise der Verpflegung.<br />
Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung wäre hier eine Anpassung<br />
angebracht und begründet mit der bereits genannten besonderen Situation der<br />
Arbeitnehmer nicht nur im Schichtdienst in der Pflege, sondern auch der anderen<br />
Mitarbeiter, die außerhalb normaler Arbeitszeiten arbeiten, z.B. im ärztlichen Dienst.<br />
In Zukunft werden die Zahlen der Mitarbeiter, die am Nachmittag arbeiten,<br />
womöglich noch steigen, so ist z.B. bereits zu beobachten, dass mittlerweile<br />
Operationen teilweise weit in den Nachmittag hinein durchgeführt werden, bedingt<br />
Seite 8
sicher auch durch die Schaffung des neuen Bettenhauses. Des Weiteren wird sich mit<br />
der Renovierung des Altbaus wahrscheinlich auch die Bettenzahl der Klinik erhöhen<br />
und die Zahl der Arbeitnehmern, speziell in der Pflege, steigen und der Bedarf der<br />
Betriebsversorgung am Nachmittag ebenfalls.<br />
Um den tatsächlichen Bedarf, Wünsche und Anregungen, aber auch Mängel und<br />
Kritik der Arbeitnehmer an der Verpflegung im Betrieb in Erfahrung zu bringen und<br />
möglicherweise bereits Interesse an ausgewogener Ernährung zu wecken, könnte z.B.<br />
eine Mitarbeiterbefragung mithilfe eines Fragebogens durchgeführt werden. Im Zuge<br />
einer solchen Befragung kann auch eine Analyse des Ernährungsverhaltens der<br />
Arbeitnehmer erfolgen.<br />
Die Ergebnisse dieser Umfrage dienen nicht nur als wichtige Grundlage für weitere<br />
Planungen, sondern die Einbeziehung der Beschäftigten und ihrer Anliegen durch<br />
diese Befragung ist ein wichtiges Instrument, welches von der WHO als dringend<br />
notwendig für die Gesundheitsförderung erachtet wird.<br />
Eine Vorlage für einen solchen Fragebogen stellt z.B. die BKK in Ihrer<br />
Internetpräsenz zur Verfügung, dieser kann an die Bedürfnisse des Betriebes<br />
angepasst werden<br />
Um die Motivation bei den Beschäftigten und damit den Rücklauf der Fragebögen zu<br />
erhöhen, werden Verlosungen empfohlen. So könnten z.B. passend zur Thematik<br />
Kochbücher verlost werden.<br />
Was wären mögliche Lösungsansätze, um die Verpflegung im Nachmittagsbereich zu<br />
gewährleisten? Die vorhandene Qualität der Speisen, die zur regulären Mittagszeit<br />
gereicht werden, scheinen gängigen Anforderungen an ausgewogene Kost zu erfüllen,<br />
das kann man anhand der Gütesiegel festmachen, die unsere Küche in den<br />
vergangenen Jahren erhalten hat. Hier sind das RAL (Gütezeichen für Diät und<br />
Vollkost) und die Auszeichnung der GDV (Gütegemeinschaft für Diät und Vollkost),<br />
„Kompetenz richtig <strong>Essen</strong> (Speisenvielfalt und Diäten)“ zu nennen. Hinzu kommt die<br />
bereits im Betriebsteil Knappschafts-Krankenhaus im Rahmen der Klinik für<br />
Naturheilkunde vorhandene Vollwert-Küche.<br />
Damit sind wichtige Grundlagen für eine ernährungsphysiologische sinnvolle<br />
Ernährung bereits vorhanden und eine Anpassung der Betriebsverpflegung wird<br />
vereinfacht und mit weniger Kosten verbunden sein als wenn diese Gegebenheiten<br />
nicht vorhanden wären. Man kann bereits auf Spezialwissen zum Thema Vollwertkost<br />
zugreifen, es bestehen schon Kontakte zu entsprechenden Lieferanten und der Betrieb<br />
hat Erfahrungen zum zeitlichen Aufwand, der zur Zubereitung benötigt wird. Auch ist<br />
Seite 9
eine Anpassung der Küchenausstattung nicht vonnöten, es ist sogar eine Kosten-<br />
senkung bei Einkauf der Lebensmittel möglich, da bei Vollwertkost der Posten der<br />
teuren Fleischkomponente minimiert wird.<br />
Um eine gesundheitsgerechte Betriebsverpflegung einzuführen, gilt es zunächst den<br />
Küchenleiter von der Notwendigkeit und Machbarkeit neuer und alternativer<br />
Angebote zu überzeugen. Aber natürlich muss auch das Küchenpersonal mit<br />
einbezogen werden. Es wird beispielsweise von der BKK empfohlen, die Mitarbeiter<br />
der Küche frühzeitig und gleichberechtigt in die Überlegungen und Planungen<br />
einzubeziehen. Da auch bei dieser Berufsgruppe die gesundheitlichen Belastungen<br />
erheblich sind, gilt es diese entsprechend zu motivieren und eventuell kann man die<br />
Planung für die Erweiterung der Betriebsverpflegung mit Gesundheitsförderungs-<br />
maßnahmen für eben diese Mitarbeiter verknüpfen bzw. einführen. Dazu gehören<br />
natürlich auch entsprechende Fortbildungen für die Mitarbeiter der Küche, um das<br />
hohe Niveau der Betriebsverpflegung zu sichern.<br />
Verpflegung am Nachmittag muss nicht bedeuten, dass der gleiche personelle und<br />
gerätetechnische Aufwand wie bei der Zubereitung für die reguläre Verkostung am<br />
Mittag betrieben wird. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Mahlzeiten<br />
entsprechend vorzubereiten und später anzubieten. Auch hier gibt die BKK Beispiele,<br />
wie beispielsweise das sogenannte „Thermophorensystem“, bei dem die Speisen<br />
entsprechend zubereitet werden und unter bestimmten Voraussetzungen warm gelagert<br />
und später zur Verfügung gestellt wird. Alternativ besteht die Möglichkeit eines<br />
„Tiefkühlsystems“, bei dem die Speisen fertig zubereitet später im Heißluftofen oder<br />
in der Mikrowelle regeneriert werden. Letzteres wäre eine Möglichkeit ohne großen<br />
weiteren Personalaufwand adäquate Verpflegung im Spätdienst zur Verfügung zu<br />
stellen. Entsprechendes <strong>Essen</strong> würde mit der regulären Mittagsverpflegung zubereitet<br />
und in der Cafeteria vorgehalten und die Beschäftigten nutzen die auf den meisten<br />
Stationen vorhandene Mikrowelle zur Regeneration. Damit der Aufwand<br />
überschaubar bleibt, sollte dieses Angebot nur auf die Beschäftigten im Betrieb<br />
beschränkt sein und nicht auf Besucher und Patienten ausgeweitet werden. Es könnte<br />
sogar das gleiche Speisenangebot wie mittags genutzt werden. Abweichende<br />
Speisenpläne könnte man über das Intranet verbreiten, auf das theoretisch jeder im<br />
Haus Zugriff hat.<br />
Dort könnte man auch ein Bestellsystem integrieren und die Versorgung ganz von der<br />
Cafeteria entkoppeln. Dieses kann in das bestehenden Bestellsystem der Patienten-<br />
versorgung integriert werden und über eine Eingabemaske erfolgen. So könnte man<br />
Seite 10
die vorhandenen Speisewagen, die ja über eine Kühl- und Warmhaltemöglichkeit<br />
verfügen dazu nutzen, die Beschäftigten direkt am Arbeitsplatz zu versorgen. Die<br />
Speisewagen kommen sowieso zur möglichen Pausenzeit auf die Stationen und<br />
könnten neben dem <strong>Essen</strong> für die Patienten auch die Verpflegung für das Personal<br />
enthalten. Dafür könnte man die gesamte Infrastruktur der Patientenverpflegung<br />
nutzen und hätte dadurch wiederum weniger benötigten Personalaufwand in der<br />
Cafeteria. Alternativ kann man die Bestellung auch über die Diätassistentinnen, die<br />
morgens auf allen Stationen anzutreffen sind und die <strong>Essen</strong>swünsche der Patienten<br />
aufnehmen, abwickeln. Dafür wäre dann ein System mit Bestellscheinen sinnvoll, die<br />
zentral auf den Stationen gesammelt werden, da die Mitarbeiter des Spätdienstes zu<br />
diesem Zeitpunkt nicht auf der Station sind. Die Abrechnung könnte bei beiden<br />
Beispielen über die Gehaltsabrechnung vollzogen werden, dies lässt sich bestimmt<br />
über die EDV einrichten.<br />
Diese Lösungsansätze würden wiederum Zeit sparen, die bisher benötigt wird, um sich<br />
in der Cafeteria zu versorgen. Damit wäre wieder in der Pause mehr Zeit zur<br />
Einnahme des <strong>Essen</strong>s und ein Punkt der Gesundheitsprävention erfüllt, nämlich nicht<br />
in Hast und bewusst Nahrung zu sich zu nehmen.<br />
Um den gesamten Themenkomplex im Betrieb einzuführen, könnte man zunächst<br />
verschiedene Aktionen durchführen. Dies könnte zunächst die Information über<br />
ernährungs-physiologisch sinnvolle Verpflegung sein, man könnte dazu aufrufen, von<br />
zu Hause bekannte Rezepte einzureichen, eventuell auch hier wieder verbunden mit<br />
der Möglichkeit etwas zu gewinnen. Man könnte in das IBF Informationskurse zum<br />
Thema oder sogar Kochkurse einführen, die nicht zwingend intern stattfinden müssen.<br />
Laut BKK gibt es einen großen Markt an Dienstleistern, die entsprechende Angebote<br />
im Programm haben. Die BKK gibt beispielsweise den Hinweis auf den<br />
„Ernährungsberatungsdienst Großverpflegung der Deutschen Gesellschaft für<br />
Ernährung“, die ein umfangreiches Angebot an Betriebsberatungen, Lehrgängen und<br />
Fortbildungen anbietet. Hier besteht gewiss die Möglichkeit, internes Fachwissen der<br />
Diätberatung im Betrieb zu nutzen.<br />
Eine weitere Idee ist, auf dem Speiseplan das Rezept des alternativen Menüs<br />
anzubieten, welches natürlich entsprechend gekennzeichnet werden sollte.<br />
Die BKK rät weiterhin nicht nur alternative Kost anzubieten, sondern zusätzlich ein<br />
„reguläres“ Menü anzubieten. Da es in unserer Cafeteria sowieso mehrere Menüs zur<br />
Wahl gibt, wäre dies gegeben. Außerdem soll man darauf achten, was als Alternative<br />
angeboten wird. Bietet man ein Menü, welches bisher immer viele Mitarbeiter<br />
Seite 11
überzeugt hat, ist es für die alternative Kost noch um einiges schwieriger, Abnehmer<br />
zu finden.<br />
Die Versorgung am Nachmittag liegt in den Händen des Betriebes und natürlich der<br />
Küche. Hier sollte ein Umdenken stattfinden und das Angebot erweitert werden damit<br />
man sich als Mitarbeiter im Spätdienst adäquat versorgen kann. Denn ein mit guter<br />
Verpflegung versorgter Mitarbeiter ist auch ein zufriedener Mitarbeiter und der Bedarf<br />
an entsprechender Ernährung gerade im Spätdienst ist vorhanden und wird sich wie<br />
oben beschrieben in Zukunft wahrscheinlich sogar noch erhöhen. Damit Pausen<br />
eingehalten werden können im Rahmen des Spätdienstes war es schon ein wichtiger<br />
Schritt, dass vom Betrieb weiteres Personal eingestellt wurde, dass sich um die<br />
<strong>Essen</strong>sverteilung kümmert.<br />
Für die Ausweitung der Speisenvielfalt um Vollwertkost und Ähnliches bedarf es<br />
allerdings nicht nur des Einbringens des Betriebes und der Küche, sondern auch des<br />
Interesses und der Bereitwilligkeit der Mitarbeiter, sich auf Neues einzulassen. Dieses<br />
lässt sich mit Sachkenntnis durch entsprechende, bereits oben beschriebene, Lehr-<br />
gänge und Schulungen steigern. Essgewohnheiten und Essverhalten zu ändern ist ein<br />
Prozess, der viel Zeit braucht, daher ist die vorausgehende intensive Planung wichtig.<br />
Hier nochmals der Hinweis, das man gerade Jugendliche, die Ihren Start ins<br />
Berufsleben im Rahmen einer Berufsausbildung erleben, die Umstellung vereinfachen<br />
kann und sie zu verantwortungs- und gesundheitsbewussten Mitarbeitern machen<br />
kann.<br />
Es gibt Möglichkeiten für Betriebe, sich bei einem so großen Vorhaben zur<br />
Gesundheitsprävention unterstützen und begleiten zu lassen. Die BKK bietet diese<br />
Unterstützung beispielsweise an; dort wäre zu klären, ob dies auch für die <strong>Kliniken</strong><br />
<strong>Essen</strong>-<strong>Mitte</strong> möglich ist.<br />
Seite 12
5. Zusammenfassung<br />
Betriebsverpflegung im Spätdienst ist in den <strong>Kliniken</strong> <strong>Essen</strong>-<strong>Mitte</strong> ein Thema, das<br />
sehr häufig unter Kollegen, gerade in der Pflege, diskutiert wird. Insgesamt hört man<br />
überwiegend Beschwerden, dass das Angebot unserer Cafeteria unzureichend ist.<br />
Glaubt man den Gesprächen, wird das Angebot der „Snacks am Nachmittag“ wenig in<br />
Anspruch genommen, da es trotz der Möglichkeit, telefonisch vorzubestellen, zeitauf-<br />
wändig ist, geschmacklich nur bedingt überzeugen kann und nicht den Anforderungen<br />
an Verpflegung im Schichtdienst gerecht wird. Die meisten Mitarbeiter bringen sich<br />
entweder kalte Speisen von zu Hause mit, selten extra Gekochtes oder es wird ein<br />
Lieferdienst für Pizza oder Ähnliches beauftragt.<br />
Dies ist schade, da sämtliche Voraussetzungen gegeben sind, eine adäquate<br />
Versorgung zu gewährleisten, dieses Problem könnte mit relativ kleinem Aufwand<br />
behoben werden und würde maßgeblich zur Zufriedenheit der Mitarbeiter im<br />
Spätdienst beitragen. Zudem würde die Ausgaben der Beschäftigten für die<br />
Verpflegung im Betrieb bleiben und die Ersparnis für die Mitarbeiter bei Betriebs-<br />
verpflegung im Gegensatz zu einem Lieferdienst wäre sicherlich ein weiterer Anreiz,<br />
diese in Anspruch zu nehmen.<br />
Eine Ausweitung des Speiseangebotes durch alternative Kostformen wäre ein weiterer<br />
Schritt, bei dem ebenfalls schon viele Voraussetzungen in den <strong>Kliniken</strong> <strong>Essen</strong>-<strong>Mitte</strong><br />
gegeben sind.<br />
Insgesamt kann mal also sagen, dass die <strong>Kliniken</strong> <strong>Essen</strong>-<strong>Mitte</strong> mit geringerem<br />
Aufwand als andere Betriebe, Gesundheitsprävention im Bereich ernährungs-<br />
physiologisch ausgewogener Ernährung durchführen und auch für eine adäquate<br />
Versorgung im Spätdienst sorgen könnten.<br />
Seite 13
6. Ausblick<br />
Wenn adäquate Verpflegung im Spätdienst bzw. Nachmittagsbereich etabliert ist,<br />
könnte der nächste Schritt sein, sich Gedanken zu machen, wie eine Versorgung für<br />
die Mitarbeiter im Nachtdienst bewerkstelligt werden könnte. Hier sind die<br />
Anforderungen an ernährungsphysiologisch ausgewogene und sinnvolle Kost noch<br />
extremer, da hier die Nahrungsaufnahme völlig zuwider der normalen physiologischen<br />
Prozesse im Körper stattfindet und Ernährung noch gezielter notwendig ist. Auch hier<br />
besteht ein Bedarf im Betrieb und diese Mitarbeitergruppe ist noch anfälliger für<br />
Krankheiten als die Beschäftigten im Tagdienst.<br />
Seite 14
7. Eigenständigkeitserklärung<br />
Ich versichere, das ich die vorgelegte <strong>Projektarbeit</strong> eigenständig und ohne fremde<br />
Hilfe verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen verwendet und die den<br />
benutzten Quellen entnommenen Passagen als solche kenntlich gemacht habe.<br />
Diese <strong>Projektarbeit</strong> ist in dieser oder einer ähnlichen Form in keinem anderen Kurs<br />
vorgelegt worden.<br />
Unterschrift:_________________________________________________________<br />
<strong>Essen</strong>, den:__________________________________________________________<br />
Seite 15
8. Literaturverzeichnis<br />
1. Shafiq, Fabian; Macht und Herrschaft vor dem Hintergrund der<br />
Internationalen Beziehungen, Gibt es Berührungspunkte zwischen dem<br />
Machtverständnis Hannah Arendts und dem Sozialkonstruktivismus<br />
<strong>Alexander</strong> Wendts?; 1. Auflage; Darmstadt; GRIN Verlag; 2010<br />
2. Brockhaus – Die Enzyklopädie, 20. Auflage, Leipzig, Mannheim, F.A.<br />
Brockhaus GmbH, 1997, Band 10<br />
3. BKK Bundesverband, Die Betriebsverpflegung als Handlungsfeld der<br />
betrieblichen Gesundheitsförderung, PDF,<br />
http://www.bkk.de/fileadmin/user_upload/PDF/Arbeitgeber/Betriebliche_Ges<br />
undheitsfoerderung/Betriebsverpflegung/betriebsverpflegung_handlungsfeld_<br />
01.pdf, Zugriff 05.09.2011<br />
4. BKK Bundesverband, Fragebogen zum Ist-Zustand der Betriebsverpflegung,<br />
PDF,<br />
http://www.bkk.de/fileadmin/user_upload/PDF/Arbeitgeber/Betriebliche_Ges<br />
undheitsfoerderung/Betriebsverpflegung/betriebsverpflegung_fragebogen.pdf,<br />
Zugriff 05.09.2011<br />
Seite 16