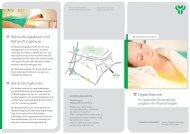Kursleitung: M. Bellarosa - Kliniken Essen-Mitte
Kursleitung: M. Bellarosa - Kliniken Essen-Mitte
Kursleitung: M. Bellarosa - Kliniken Essen-Mitte
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Krankenpflegeschule der <strong>Kliniken</strong> <strong>Essen</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Henricistraße 92<br />
45136 <strong>Essen</strong><br />
Kurs 2008 / 2011 (Oberkurs)<br />
<strong>Kursleitung</strong>: M. <strong>Bellarosa</strong><br />
Lernbereich 2: Ausbildungs- und Prüfungssituation von Pflegenden<br />
Teilbereich 6: Persönliche Gesunderhaltung<br />
Projektarbeit zur mündlichen Abschlussprüfung in der Gesundheits- und<br />
Krankenpflege am 22. September 2011<br />
Möglichkeiten der persönlichen Gesunderhaltung in der beruflichen<br />
Pflege am Beispiel des betrieblichen Gesundheits- und Eingliederungsmanagements<br />
Name : Lisa Lindenberg<br />
Macht und Hierarchie<br />
Adresse : Angerstraße 5, 45134 <strong>Essen</strong><br />
Abgabedatum: 16. September 2011<br />
1
1. Einleitung<br />
2. Hauptteil<br />
3. Zusammenfassung<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
4. Schlussfolgerung/ Eigene Meinung<br />
5. Anhang<br />
6. Quellenverzeichnis<br />
7.Eigenständigkeitserklärung<br />
2
1. Einleitung<br />
Macht und Hierarchie im Gesundheitssystem und speziell im Krankenhaus<br />
stellen oftmals ein großes Problem dar. Ausübung von Macht gibt es in<br />
nahezu allen Lebensbereichen. Um Diese ausüben zu können, bedarf es<br />
immer mindestens zweier Akteure. Zudem ist die Ausübung von Macht<br />
fast immer mit Konflikten zwischen den Akteuren verbunden, „da Einer<br />
seinen Willen gegen jemand Anderen durchzusetzen versucht“ (Brock-<br />
haus, Band 13 Seite 706). Sowohl im Gesundheitssystem als auch spezi-<br />
ell in der Institution Krankenhaus wird das Innehaben von Macht noch<br />
deutlicher, z.B. durch teilweise sichtbare und teilweise unsichtbare hierar-<br />
chische Strukturen. Eine Hierarchie besteht immer aus solchen Ebenen,<br />
„deren Angehörigen bestimmte Befugnisse bzw. Verpflichtungen zugeord-<br />
net sind.“ (Brockhaus, Band 10 Seite 67)<br />
Durch die vielen unterschiedlichen Ordnungen und den damit verbunde-<br />
nen Aufgaben und Erwartungen sind Druck und Anforderungen, vor allem<br />
für Pflegende, sehr groß. Pflegekräfte unterliegen sowohl den Anordnun-<br />
gen von Ärzten als auch denen der Pflegedienstleitung, Fachbereichslei-<br />
tung und Stationsleitung. Gesundheits-und Krankenpflegeschüler/- in sind<br />
noch in weitere hierarchische Ordnungen eingegliedert. Nicht nur jede Art<br />
von Leitungsposition steht über ihnen, sondern auch jede examinierte<br />
Pflegekraft befindet sich auf einer übergeordneten Autoritätsebene (siehe<br />
Graphik 1). Dadurch ist es oftmals schwierig, richtig zu handeln und Kon-<br />
flikte zu vermeiden, da es zu viele verschiedene Erwartungen und Anfor-<br />
derungen an den Einzelnen gibt. Daraus resultieren Demotivation, Nieder-<br />
geschlagenheit und womöglich auch psychiatrische Erkrankungen, wie<br />
Depressionen und/ oder Burn- out Syndrom. Folglich häufen sich Krank-<br />
meldungen schon bei Auszubildenden. Vor allem aber das Verhältnis zwi-<br />
schen Gesundheits- und Krankenpflegeschüler-in und Arzt kann ein gro-<br />
ßes Problem sein, dass es im pflegerischen Alltag zu bewältigen gilt.<br />
3
2. Hauptteil<br />
In der Geschichte der Krankenpflegeausbildung ist der Beruf/die Rolle des<br />
Arztes immer wieder im Fokus. Zu Beginn der Ausbildung stand/steht der<br />
Arzt als Hauptlehrperson; gegenüber dem Schüler nimmt er zwei Macht-<br />
positionen ein: Er war/ ist auf der einen Seite Respektperson in der Institu-<br />
tion Schule und auf der anderen Seite war/ist er Ausbilder und Respekt-<br />
person im pflegerischen Alltag. Schon immer hatte der Arzt einen großen<br />
Einfluss auf den Schüler als Menschen, aber auch auf die Arbeit des Ein-<br />
zelnen. Eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten wurden nicht<br />
gelehrt, vielmehr wurde Wert darauf gelegt, das Durchführen von ärztli-<br />
chen Anordnungen zu erlernen und dem Arzt entsprechend zu assistieren.<br />
So wurde der Schüler zum „ärztlichen Assistenten“ herangezogen. Der<br />
Schüler, aber auch die examinierte Krankenschwester, sah sich dem Arzt<br />
immer untergeordnet. Erst mit der Zeit und somit der Weiterentwicklung<br />
des Pflegeberufes und auch der Ausbildung zur Gesundheits- und Kran-<br />
kenpfleger/ in, gewann die Pflege mehr Respekt und entwickelte sich zu<br />
einem eigenständigen Berufsbild.<br />
Allerdings findet man immer noch ähnliche Strukturen. Auch heute steht<br />
der Arzt in der Hierarchie, bezogen auf den Pflegealltag, auf der obersten<br />
Ebene, auch heute besitzt Er noch mehr Macht/Autorität als die Gesund-<br />
heits- und Krankenpfleger/-in oder gar der Auszubildende. Anhand der<br />
Graphiken 2,3 und 4 zeigt sich der Unterschied für den Auszubildenden<br />
von früher und den Auszubildenden von heute. Auch wenn der Arzt in der<br />
hierarchischen Ordnung nach wie vor auf der obersten Ebene steht, so ist<br />
sein Einfluss auf den Auszubildenden nicht mehr so enorm wie er es vor<br />
Jahrzehnten war. Der Schüler profitiert in seiner Ausbildung auch von<br />
Lehrpersonen, die ebenfalls die Gesundheits- und Krankenpflege erlernt<br />
haben und zusätzlich pädagogische Kenntnisse besitzen. Dieses verein-<br />
facht es dem Schüler, den schulischen Teil der Ausbildung erfolgreich zu<br />
bestehen, wohingegen sich an dem praktischen, alltäglichen Teil während<br />
der Ausbildung nicht allzu viel verändert hat. Aus eigener Erfahrung weiß<br />
ich, wie schwierig es für Schüler ist, richtig zu handeln oder den Mut zu<br />
haben, sich Konfliktsituationen zu stellen.<br />
4
Die Macht, die ein Arzt besitzt, wird in vielen Situationen deutlich. Allein<br />
ärztliche Anordnungen, die die Pflegekraft durchzuführen hat, unterstrei-<br />
chen nochmal den Stellenwert der beiden Berufsgruppen und der damit<br />
verbundenen Diskrepanz. Für den Schüler ist es oftmals diffizil, den An-<br />
ordnungen durch den Arzt gerecht zu werden, da Schüler, je nach Ausbil-<br />
dungsstand, vieles nicht selbstständig durchführen dürfen. Da stellt sich<br />
dem Schüler jedes Mal die Frage, ob er, entgegen der Ausbildungsver-<br />
ordnung, diese Anordnung durchführt, oder ob er sich weigert und somit<br />
womöglich einen Konflikt zwischen Arzt und Schüler provoziert. Diese Hie-<br />
rarchie findet ihre Begründung darin, dass der Arzt, im Gegensatz zur<br />
Pflege, akademisiert ist. So „sprechen zum Beispiel mehrere Ärztevertre-<br />
ter von einer Akademisierung des Proletariats“ (aus der Zeitschrift „Die<br />
Schwester Der Pfleger“, Seite 193) hinsichtlich der Überlegung, den Pfle-<br />
geberuf, mit Hilfe von Studiengängen, ebenfalls zu akademisieren. Diese<br />
Fakten schüchtern Schüler immer wieder aufs Neue ein, sobald sie, im<br />
Zuge der Ausbildung, die Station wechseln und immer wieder mit neuen<br />
Ärzten und deren unterschiedlichen Arbeitsweisen und Auffassungen von<br />
Hierarchie/Autorität konfrontiert werden, verbunden mit dem Problem der<br />
Desintegration. Der Arzt kennt den Schüler nicht, desweiteren ist er/ sie ja<br />
„nur“ ein/-e Schüler/-in. Das hat zur Folge, dass man sich als Schüler von<br />
vorne herein als unerwünscht/minderwertig fühlt und teilweise „von oben<br />
herab behandelt“ wird, was die Hierarchie zwischen Arzt und Schüler<br />
nochmals unterstreicht. Vor allem das System der Bereichspflege und<br />
Funktionspflege macht es dem Schüler fast unmöglich, von Ärzten ernst<br />
genommen oder gar respektiert zu werden. In diesen Systemen steht<br />
mehr die Erkrankung des Patienten im Vordergrund, welche dann mehr<br />
medizinisch als pflegerisch zu betrachten ist. Oft herrschen auf diesen<br />
Stationen Standards, die, je nach Operationsart, anzuwenden sind, so<br />
dass zwar eigenverantwortliches Arbeiten in Grenzen möglich ist, die ver-<br />
trauensvolle Zusammenarbeit mit den Ärzten aber erschwert. Eine weitere<br />
Schwierigkeit liegt darin, den Ärzten verständlich zu machen, dass sie auf<br />
die Pflegekräfte angewiesen, sogar abhängig sind, und somit auch von<br />
Gesundheits- und Krankenpflegeschülern. Durch die schon immer dage-<br />
wesene Hierarchie und damit verbundene Machtverteilung ist dies in sol-<br />
5
chen Pflegesystemen nicht möglich. All diese verschiedenen Punkte kön-<br />
nen sich negativ auf den Schüler auswirken; bei vielen häufen sich die<br />
Krankmeldungen, weil sie dem Druck nicht standhalten können oder teil-<br />
weise Angst haben, auf dieser Station zu arbeiten. Bei Schülern ist oft zu<br />
beobachten, dass sich Krankmeldungen immer dann häufen, wenn sie auf<br />
einer Station eingesetzt sind, wo sie große Schwierigkeiten haben. Auch<br />
psychiatrische Erkrankungen wie das Burn-out oder Depression sind bei<br />
Schülern immer häufiger zu beobachten.<br />
Definition Burn-out:<br />
„Unter dem Burnout Syndrom versteht man einen Zustand emotionaler<br />
Erschöpfung. Mit ihm reduziert sich die eigene Leistungsfähigkeit. Der<br />
Mensch fühlt sich ausgebrannt, schwach, lustlos und ist nicht mehr fähig,<br />
sich in irgendeiner Weise zu erholen“. (www.das-burn-out-syndrom.com/<br />
Zugriff am 14.09.2011 17:33)<br />
In solchen Fällen greift das Gesetz des betrieblichen Gesundheitsmana-<br />
gements, welches im Jahr 2004 im Sozialgesetzbuch in §84 Absatz 2<br />
SGB IX festgeschrieben wurde. Dieses beinhaltet: „Sind Beschäftigte in-<br />
nerhalb eines Jahres länger als 6 Wochen ununterbrochen oder wieder-<br />
holt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessen-<br />
vertretung (…) mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person<br />
die Möglichkeit, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden<br />
kann und mit welchen Leistungen oder Hilfen einer erneuten Arbeitsunfä-<br />
higkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebli-<br />
ches Eingliederungsmanagement).“ (§ 84 Abs. 2 SGB IX)<br />
(www.betriebliche-eingliederung.de/ 13.09.2001 14:05) Dieses bezieht<br />
sich sowohl auf die Examinierte Schwester, als auch auf den Auszubil-<br />
denden, wobei sich eine solche Situation für den Schüler noch etwas an-<br />
ders darstellt. Der Schüler darf während der drei Jahre Ausbildung nicht<br />
mehr als 10 % im schulischen Teil und 10% im praktischen Teil fehlen. Ist<br />
dies der Fall, hat allerdings die Schule die Möglichkeit, das Gespräch mit<br />
dem Schüler zu suchen, so dass durch das Vertrauensverhältnis zwischen<br />
Lehrer und Schüle schon Lösungsansätze für diese Situation gefunden<br />
werden können. Schon das erneuerte Kurrikulum für die Ausbildung zum/r<br />
6
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in beinhaltet Fächer wie Gesundheits-<br />
förderung- und Prävention oder Psychologie, welche dem Schüler schon<br />
zeigen, wie wichtig die die persönliche Gesunderhaltung ist. Somit haben<br />
wir konkret in dem schulischen Bereich der Ausbildung Lösungen gefun-<br />
den, um psychiatrischen Erkrankungen oder Krankmeldungen über einen<br />
langen Zeitraum vorzubeugen. Jetzt stellt sich die Frage, wie lösen wir<br />
solche Probleme im praktischen Alltag? Im folgendem stelle ich Ihnen ver-<br />
schiedene Lösungsansätze vor:<br />
In jeder Institution in Deutschland, in der Pflege durchgeführt wird, existie-<br />
ren verschiedene Pflegesysteme. Allein im Krankenhaus werden unter-<br />
schiedliche praktiziert. Je nach Station gibt es, wie zuvor erwähnt, die<br />
Funktionspflege, die Bereichspflege und das System der Bezugspflege.<br />
Wie ebenfalls bereits genannt, wirken sich das System der Funktionspfle-<br />
ge und das der Bereichspflege eher negativ auf den pflegerischen Alltag<br />
aus, wohin gegen ich im Weiteren zeigen möchte. wie hilfreich die Be-<br />
zugspflege in dieser Situation ist.<br />
Definition Funktionspflege:<br />
„Funktionspflege wird auch als „funktionelle Pflege“ oder „Stationspflege“<br />
bezeichnet. Hierbei werden (Pflege-)Handlungen am Patienten in einzelne<br />
Arbeitsschritte eingeteilt, die dann von den zuständigen Mitarbeitern, je<br />
nach Qualifikation ausgeführt und umgesetzt werden.“ (www.thieme.de/<br />
13.09.2011 15:16)<br />
Definition Bereichspflege:<br />
„Bei der Bereichspflege wird die Station in Einzelbereiche unterteilt, unab-<br />
hängig von den Krankheitsbildern. Jedem Bereich wird ein Pflegeteam<br />
bzw. eine Pflegeperson zugeordnet. Die Einteilung erfolgt durch die Stati-<br />
onsleitung. Formen der Bereichspflege sind die sogenannte Zimmerpflege<br />
(die Einteilung erfolgt nach Zimmern) oder die Gruppenpflege (bestimmte<br />
Patienten bilden die Gruppe für die Pflegenden).“ (www.thieme.de/<br />
13.09.2011 15:27)<br />
7
Definition Bezugspflege:<br />
„Zielsetzung der Bezugspflege ist die individuelle, ganzheitliche Betreuung<br />
des Patienten/ Klienten/ Bewohners usw. Sie wird mittels Bezugspflege-<br />
personen umgesetzt. Es handelt sich um ein dezentral- egalitäres Organi-<br />
sationsprinzip, das heißt, dass alle Bezugspflegenden gleichgestellt sind<br />
und niemand übergeordnete Tätigkeiten delegiert.“ (www.thieme.de /<br />
13.09.2011 15:30) „Da niemand eine 24- Stunden- Verantwortung über-<br />
nehmen kann, wird die Bezugspflegeperson in der Durchführung der Pfle-<br />
ge von anderen Kollegen und Kolleginnen unterstützt“. (aus dem Buch<br />
Pflegemanagement in Altenheimen, Grundlagen für Konzeptentwicklung<br />
und Organisation von Karla Kämmer)<br />
Die Bezugspflege stellt somit ein ganzheitlich orientiertes System dar.<br />
Dadurch ist der Patient optimal versorgt, vor allem aber steht nicht die Er-<br />
krankung im Vordergrund, sondern der Mensch an sich. Das hat zur Kon-<br />
sequenz, dass die Pflegenden auch Bezugsperson für den Patienten sind<br />
und diese während ihres Aufenthaltes sehr gut kennen lernen. Konzentrie-<br />
ren wir uns auf den Schüler, ist auch für diesen die Bezugspflege hinsicht-<br />
lich seines Pflegealltags vorteilhaft. Um ein solches System praktizieren<br />
zu können, müssen Ärzte und Pflegende eng zusammenarbeiten und re-<br />
gelmäßig miteinander kommunizieren, um so für den Patienten eine opti-<br />
male Versorgung gewährleisten zu können. Da die Pflegenden die Patien-<br />
ten kennen, muss der Arzt für seine Therapie auf dieses Wissen zurück-<br />
greifen. Des Weiteren vereinfacht die Bezugspflege das eigenverantwortli-<br />
che und selbstständige Arbeiten. Bezogen auf den Schüler ist es am wich-<br />
tigsten zu erwähnen, dass auf einer Station, auf der dieses System ange-<br />
wendet wird, ein anderes Arbeitsklima herrscht. Auch Auszubildende wer-<br />
den nach ihrer Meinung gefragt und aktiv mit einbezogen, da auch sie ihre<br />
eigene Patientengruppe betreuen. Durch dieses Gesamtkonzept herrscht<br />
dort ein besonderer Teamgeist. Jeder arbeitet mit dem Anderen eng zu-<br />
sammen, sei es die Pflegenden mit ihren Arbeitskollegen, die Ärzte jeweils<br />
unter sich, oder Ärzte mit Pflegenden. Die Bezugspflege wird standard-<br />
mäßig auf allen psychiatrischen und verwandten Stationen durchgeführt.<br />
Dadurch hat man als Pflegende/r und auch als Auszubildender zusätzlich<br />
8
Kontakt zu Psychiatern und Psychologen und arbeitet auch mit diesen eng<br />
zusammen.<br />
Trotz des positiven Effekts und den Vorteilen, die dieses System mit sich<br />
bringt, fällt die Umsetzung vielen Institutionen und einzelnen Stationen im<br />
Krankenhaus sehr schwer. Grund: Personalmangel und teilweise sehr<br />
kurze Verweildauer der Patienten lassen für viele Beteiligte die Bereichs-<br />
pflege praktizierbarer als die Bezugspflege erscheinen.<br />
Um den Gesundheits- und Krankenpflegeschülern die praktische Ausbil-<br />
dung positiver und einfacher zu gestalten, reichen auch weniger große<br />
Veränderungen aus. Da die Hierarchie zwischen Arzt und Auszubilden-<br />
dem oftmals Schwierigkeiten mit sich bringt, wäre es sinnvoll, dass nicht<br />
nur Pflegende über die erlaubten Tätigkeiten im jeweiligen Ausbildungs-<br />
jahr informiert sind, sondern auch die Ärzte. So lassen sich Konfliktsituati-<br />
onen aufgrund ärztlicher Anordnungen vermeiden und der Arzt weiß, wel-<br />
chen Schüler er ansprechen kann und welchen nicht. Desweiteren ist es<br />
wichtig, dass die Schüler, auch wenn sie häufig nur kurze Zeit auf einer<br />
Station eingesetzt sind, sich jedes Mal bei den Ärzten, vor allem aber dem<br />
leitenden Oberarzt oder Chefarzt persönlich vorstellen. So wäre es mög-<br />
lich, das immer wiederkehrende Gefühl der Desintegration zu vermeiden.<br />
Außerdem ist es vielen Chefärzten ein großes Anliegen, darüber informiert<br />
zu sein, wer auf seiner Station arbeitet. Aber nicht nur bei den Ärzten und<br />
Schülern müssen Veränderungen stattfinden, auch die Pflegenden können<br />
helfen. Diese müssen den Schülern bei eventuell bestehenden Konflikten<br />
zur Seite stehen und sich für diese einsetzen und nicht wegschauen. Al-<br />
lerdings wäre dies am besten durchführbar, wenn schon in der Ausbildung<br />
zum/r Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Kommunikation in Konfliktsitu-<br />
ation auch mit Leitungspositionen geübt wird, um so den Schülern mehr<br />
Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu geben. Ein letzter weiterer Schritt<br />
ist der der Praxisanleitung, der gesetzlich schon vorgeschrieben ist. Im<br />
Huyssens-Stift haben die Schüler den Vorteil, dass auf nahezu allen Stati-<br />
onen ausgebildete so genannte „Praxisanleiter“ arbeiten. Problematisch<br />
wird es nur, wenn mehrere Schüler auf der gleichen Station eingesetzt<br />
sind, sodass eine Eins zu Eins oder maximal eine Eins zu Zwei- Betreu-<br />
9
ung nicht mehr möglich ist. In dem Klinikverbund Südwest und der dazu-<br />
gehörigen Schule für Gesundheitsberufe wird ein ähnliches, aber detail-<br />
lierteres System der Praxisanleitung und Vermeidung von Konflikten<br />
durchgeführt. Da die meisten Auszubildenden sich zum Zeitpunkt der<br />
Ausbildung in einer schwierigen Lebensphase befinden, in der sie sich<br />
selbst zu finden versuchen, arbeitet die Schule dort sowohl mit ehrenamt-<br />
lichen Praxisanleitern zusammen als auch mit hauptamtlichen. Desweite-<br />
ren gibt es dort einen festangestellten Psychologen sowie eine Vertrau-<br />
enslehrerin und einmal jährlich findet eine Mediatorenausbildung für Schü-<br />
ler statt. Zusätzlich erzählt Marina Schnabel, berufstätige Diplom-<br />
Pflegepädagogin im Personalmanagement des Klinikverbundes Südwest,<br />
dass die einzelnen Kurse zu externen Teamentwicklungsseminaren ge-<br />
hen, und in jedem Theorieblock ein von den Schülern moderiertes Klas-<br />
sengespräch durchgeführt wird. (Aus der Zeitschrift die Schwester Der<br />
Pfleger, Seite 12)<br />
10
3.Zusammenfassung<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Macht und Hierarchie im Kran-<br />
kenhausalltag immer existieren werden. Auf der einen Seite brauchen wir<br />
hierarchische Ordnungen, da sie uns Struktur, Halt und Ordnung bieten;<br />
auf der anderen Seite ist es wichtig darauf zu achten, dass die unter-<br />
schiedlichen Ebenen nicht zu weit voneinander entfernt sind. Macht und<br />
Hierarchie üben, wie im Text erklärt, einen teilweise zu großen Druck, vor<br />
allem auf den unerfahrenen Auszubildenden, aus. Das Verhältnis zwi-<br />
schen Pflegeschülern und Ärzten war in früheren Jahren schon schwierig,<br />
welches sich bis zum heutigen Tag nur teilweise gebessert hat. Es gibt<br />
mittlerweile Lehrpersonal für Pflegeberufe, dadurch haben es Schüler ein-<br />
facher, da der Druck von zwei Seiten durch den Arzt wegfällt. Auch die<br />
Weiterentwicklung des Pflegeberufes hat schon einiges zum Positiven<br />
verändert. Allein durch die erneuerte Ausbildung wird der Schüler nicht<br />
mehr zum „ärztlichen Assistenten“ herangezogen. Desweiteren lernen die<br />
Auszubildenden auf sich selbst Acht zu geben durch Fächer wie bei-<br />
spielsweise Psychologie. Trotzdem ist es nochmals wichtig zu erwähnen,<br />
dass auch das Ärztepersonal seinen Teil dazu beiträgt, dass Auszubilden-<br />
de überfordert sind / sich überfordert fühlen und auf den Stationen<br />
Schwierigkeiten mit ihrer Integration haben. Durch den Unterschied, dass<br />
der Arzt einen akademischen Werdegang hat, die Pflegenden aber nicht,<br />
zeigen viele Schüler von vorneherein nicht ein solches Selbstbewusstsein,<br />
wie sie es Pflegenden gegenüber zeigen. Dieses erschwert von vorne<br />
herein die Zusammenarbeit untereinander. Es ist schwierig auf beiden<br />
Seiten, zu erkennen, dass man voneinander abhängig ist. Diese beiden<br />
Berufsgruppen stehen in einer Wechselwirkung miteinander. Um dieses<br />
gewährleisten zu können, müssen Pflegende und Ärzte an sich arbeiten.<br />
Eine Hilfestellung könnte die allgemeine Einführung der Bezugspflege<br />
darstellen, aber auch kleine Schritte auf beiden Seiten und speziell in der<br />
Ausbildung zum/-r Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, können dabei<br />
hilfreich sein.<br />
11
Schlussfolgerung/ Eigene Meinung<br />
Aus eigener Erfahrung als Gesundheits- und Krankenpflegeschülerin,<br />
weiß ich, dass es oft schwierig ist selbstbewusst aufzutreten, vor allem<br />
gegenüber Ärzten. Die Hierarchie zwischen Arzt und Auszubildendem ist<br />
im Alltag teilweise so deutlich sichtbar, dass man eingeschüchtert ist und<br />
Angst hat Fragen zu stellen. Außerdem kommt es häufig vor, dass man<br />
als Schüler ärztliche Anordnungen erhält, die man nicht ausführen darf.<br />
Dieses könnte man, meiner Meinung nach verhindern, indem man auch<br />
den Ärzten erklärt, was Schüler im jeweiligen Ausbildungsjahr, selbststän-<br />
dig machen dürfen und was nicht. Zusätzlich halte ich es für förderlich,<br />
schon in der Ausbildung Kommunikation mit Leitungspositionen und Ver-<br />
halten in Konfliktsituationen mit hierarchisch übergeordneten Menschen zu<br />
lernen. Das gibt gerade den noch Unerfahrenen, also den Schülern im<br />
ersten Lehrjahr mehr Selbstbewusstsein. Aber auch die Pflegenden müs-<br />
sen lernen; sie müssen lernen die Schüler in Konfliktsituationen zu unter-<br />
stützen und nicht wegzuschauen, auch wenn ein Problem mit einem Arzt,<br />
oder gar dem Chefarzt besteht. Zwar ist es schwierig dies alles bei dem<br />
momentanen Fachkräftemangel umzusetzen, aber dennoch wäre der<br />
Krankenhausalltag für alle beteiligten Berufsgruppen einfacher, da sich<br />
das Arbeitsklima insgesamt verbessern würde. Ein weiterer, aber großer<br />
Schritt, ist die allgemeine Einführung/ Etablierung der Bezugspflege. Im<br />
Laufe meiner Ausbildung, war ich auf zwei Stationen eingesetzt, auf de-<br />
nen dieses Pflegesystem angewendet wird. Schon der erste Tag war an-<br />
ders, als auf den bisherigen Stationen. Man erfährt einen großen Teamzu-<br />
sammenhalt, nicht nur unter den Pflegenden, sondern auch mit den Ärz-<br />
ten. Respekt und Anerkennung für seine Arbeit werden einem entgegen<br />
gebracht, welches wiederum das Selbstbewusstsein und die Motivation<br />
steigern, vor allem aber das Gefühl der Integration.<br />
12
1.)<br />
2.) Früher:<br />
Pflegedienstleitung <br />
Stationsleitung<br />
Praktikant<br />
5. Anhang<br />
Arzt Lehrperson<br />
Schüler<br />
3.) Heute: 4.) Heute:<br />
Lehrperson<br />
Schüler<br />
Arzt<br />
Gesundheits- und<br />
Krankenpflegeschüler/-in<br />
13<br />
Fachbereichs-leitung<br />
Arzt<br />
Examinierte<br />
Kraft<br />
Zivildienstleistender<br />
Schüler
6. Quellenverzeichnis<br />
- Brockhaus, Die Enzyklopädie/ 20. Auflage/ Band 10/ Seite 67, Ab-<br />
schnitt 2<br />
- Brockhaus, Die Enzyklopädie/ 20. Auflage/ Band 13/ Seite 706<br />
- Zeitschrift „Die Schwester Der Pfleger“/ Erscheinungsdatum Januar<br />
2011/ Seite 12/ Artikel: „Verändert haben sich auch die Schüler“<br />
- Zeitschrift „Die Schwester Der Pfleger“/ Erscheinungsdatum Febru-<br />
ar 2011/ Seite 193/ Artikel: „Warum Pflege studieren?“/ Abschnitt:<br />
Einblick<br />
- www.das-burn-out-syndrom.com/definition.htm<br />
- www.thieme.de/SID-177B3509-<br />
8EA5775B/local_pdf/cne_online/docnr3131498113_1008.pdf.<br />
14
7. Eigenständigkeitserklärung<br />
Ich versichere, das ich die vorgelegte Projektarbeit eigenständig<br />
und ohne fremde Hilfe verfasst, keine anderen als die angegebe-<br />
nen Quellen verwendet und die den benutzten Quellen entnomme-<br />
nen Passagen als solche kenntlich gemacht habe.<br />
Die Projektarbeit ist in dieser oder einer ähnlichen Form in keinem<br />
anderen Kurs vorgelegt worden.<br />
Unterschrift:<br />
<strong>Essen</strong>, den:<br />
15