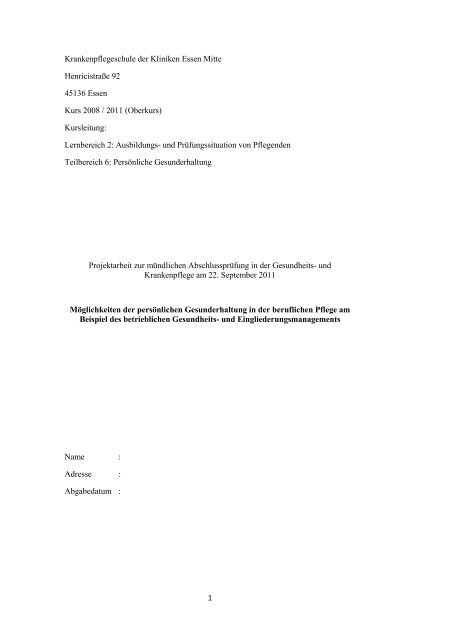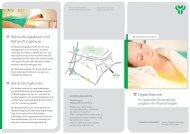Projektarbeit Danielle Näth - Kliniken Essen-Mitte
Projektarbeit Danielle Näth - Kliniken Essen-Mitte
Projektarbeit Danielle Näth - Kliniken Essen-Mitte
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Krankenpflegeschule der <strong>Kliniken</strong> <strong>Essen</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Henricistraße 92<br />
45136 <strong>Essen</strong><br />
Kurs 2008 / 2011 (Oberkurs)<br />
Kursleitung:<br />
Lernbereich 2: Ausbildungs- und Prüfungssituation von Pflegenden<br />
Teilbereich 6: Persönliche Gesunderhaltung<br />
<strong>Projektarbeit</strong> zur mündlichen Abschlussprüfung in der Gesundheits- und<br />
Krankenpflege am 22. September 2011<br />
Möglichkeiten der persönlichen Gesunderhaltung in der beruflichen Pflege am<br />
Beispiel des betrieblichen Gesundheits- und Eingliederungsmanagements<br />
Name :<br />
Adresse :<br />
Abgabedatum :<br />
1
Inhaltsverzeichnis Seite<br />
1. Einleitung 1<br />
2. Vorwort 2<br />
3. Definition 3 - 4<br />
4. Hilflosigkeit und ihre Folgen 4 - 7<br />
5. Praxisbeispiel und Transfer 7 – 10<br />
6. Fazit und Ausblick 11<br />
7. Literaturverzeichnis 12<br />
8. Eigenständigkeitserklärung 13<br />
2
1. Einleitung<br />
Mir ist das Thema „Helfen, hilflos sein“ persönlich wichtig, da ich in meiner<br />
Ausbildungszeit damit Erfahrung machen musste.<br />
Durch den Verlust eines Arbeitskollegen, der während meiner Dienstzeit<br />
verstorben ist, bin ich mit dem Thema besonders tief konfrontiert worden.<br />
Ich fühlte mich in dieser Situation hilflos, weil mir klar war, dass die Situation<br />
für den Patienten nicht gut ausgehen konnte und ich nicht in der Lage war zu<br />
helfen. Im Nachhinein habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob ich die<br />
Situation hätte verändern können, wenn ich früher zur Schelle gegangen wäre.<br />
Durch viele Gespräche, mit Pflegedienstleitung, Schule und natürlich<br />
Kollegen, wurde mir klar gemacht, dass es nichts geändert hätte.<br />
Ich denke, dass dieses Thema jeden Berufstätigen in der Pflege betrifft, weil<br />
jeder in seinem Berufsleben mit Sterben oder anderen schwierigen Situationen<br />
in Berührung kommt. Dann ist es wichtig entsprechende Unterstützung zu<br />
erhalten um das Erlebte zu verarbeiten.<br />
3
2. Vorwort<br />
Der folgende Text zum Thema „Helfen, hilflos sein“ soll unter der Fragestellung<br />
persönlicher Gesunderhaltung in der Pflege, klären welche Möglichkeiten es für<br />
Pflegende gibt Stress zu bewältigen. Stress soll in diesem Zusammenhang in<br />
Verbindung mit Hilflosigkeit gebracht werden.<br />
Im Hauptteil werde ich zunächst Stellung zu zwei Definitionen von Hilflosigkeit<br />
nehmen, um dann auf Hilflosigkeit und ihre Folgen zu sprechen zu kommen. Hierzu<br />
soll der Begriff Stress definiert, Stressfaktoren genannt und das biopsychologische<br />
Stresskonzept nach Hans Selye erläutert werden. Auch auf Stressbewältigung soll<br />
eingegangen werden.<br />
Im Anschluss daran Versuche ich anhand eines Praxisbeispiels die Verbindung<br />
zwischen Theorie und Praxis herzustellen. Zunächst soll das Praxisbeispiel erklärt<br />
werden, um dann zu erläutern wie mit dem Problem umgegangen werden kann. Zum<br />
Thema Stressbewältigung soll auch eine kurze Erläuterung zum Thema<br />
Wiedereingliederungsmanagement erfolgen.<br />
Im anschließenden Fazit, möchte ich noch einmal zusammenfassen was ich heraus<br />
gearbeitet habe und in wie weit es umsetzbar ist im beruflichen Alltag.<br />
4
3. Definition<br />
3.1 Hilflosigkeit<br />
„Das Gefühl und die Überzeugung mit eigenen Kräften eine Situation nicht<br />
bewältigen zu können, verknüpft mit der Angst, dass die Bewältigung auch von<br />
keinem anderen übernommen wird.“<br />
Meiner Meinung nach ist dies eine zutreffende Definition, weil es sowohl für<br />
Pflegende als auch für Patienten schwierig ist mit Hilflosigkeit umzugehen<br />
beziehungsweise diese zu bewältigen. Pflegende können Patienten in Ihrer<br />
Hilflosigkeit beistehen und versuchen die Angst und Unwissenheit bezüglich<br />
Untersuchungen zu nehmen.<br />
Patienten kommen meist mit einer Verdachtsdiagnose oder mit unklaren<br />
Beschwerden deren Ursache im Verlauf des Aufenthaltes geklärt werden muss.<br />
Patienten fühlen sich immer hilflos wenn Sie ins Krankenhaus kommen, da es<br />
für Sie eine fremde Situation darstellt, Sie nicht wissen was bezüglich<br />
Untersuchungen auf Sie zukommen und wie es in Zukunft für Sie weitergehen<br />
wird. Pflegende sind der erste Ansprechpartner für Patienten und müssen daher<br />
versuchen eine Vertrauensbasis aufzubauen damit der Patient sich in einem<br />
gewissen Rahmen wohlfühlt.<br />
Pflegende hingegen müssen mit ihrer Hilflosigkeit allein zurecht kommen. Sie<br />
sind oft zu gering besetzt und können sich nicht in dem Maße um Ihre<br />
Patienten kümmern wie Sie es gerne möchten und so macht sich<br />
Unzufriedenheit breit unter den Pflegenden. Dazu kommt, dass Pflegende in<br />
Situationen geraten in denen Sie nicht mehr helfen können und mit dieser<br />
Hilflosigkeit klar zu kommen ist oftmals schwierig.<br />
3.2 Ohnmachtsgefühl<br />
„ Empfindungen einer überlegenen Macht ausgeliefert zu sein, […]. Gerade in<br />
den Institutionen die ohne Pflegende nicht funktionieren würden, ist nicht zu<br />
übersehen, welchen zivilisatorischen Fortschritt sie darstellen. Ein<br />
Krankenhaus als Organisation ist immer wach, kann immer reagieren, kann<br />
immer Krisensituationen bewältigen. Das muss organisiert werden. Zwar kann<br />
5
das fast immer noch besser und für alle Beteiligten noch konstruktiver<br />
geschehen, doch ist es trotz aller Reibereien und Konflikte im Ablauf ein<br />
kleines Wunder, ein lebensrettendes, lebenserhaltendes System, das über jeden<br />
Einzelnen hinausgreift und für das weder allein dem Chefarzt noch allein dem<br />
Pflege- oder Verwaltungsdirektor zu danken ist, sondern allen, die darin<br />
arbeiten.“<br />
Diese Definition befasst sich mehr mit den Pflegenden als mit den Patienten.<br />
Wie in dem Zitat genannt ist auf den Krankenhausalltag bezogen, der Tod die<br />
überlegene Macht, der man in manchen Fällen nichts mehr entgegen wirken<br />
kann.<br />
Ich denke, dass frisch Examinierten und Auszubildenden die Konfrontation mit<br />
sterbenden Menschen Angst macht und es sie überfordert. Es müssen nicht nur<br />
Extremsituationen sein die Überforderung hervorrufen sondern auch<br />
Situationen in denen man den Toten im Zimmer auffindet.<br />
Durch die Unterbesetzung und das zu bewältigende hohe Arbeitspensum sind<br />
die Pflegenden täglich Stress ausgeliefert, der auf unterschiedlichste Weise<br />
bewältigt wird, auf Stress, Stressbewältigungsstrategien und deren Folgen<br />
werde ich im Verlauf noch weiter eingehen.<br />
Bezugnehmend auf die oben genannte Definition von Ohnmachtsgefühlen, ist<br />
ein Krankenhaus eine komplexe Organisationsform in der jede einzelne<br />
Berufsgruppe maßgeblich zum Erfolg beiträgt, wenn jeder einzelne<br />
funktioniert.<br />
4. Hilflosigkeit und ihre Folgen<br />
Ausgehend von der Annahme, dass Stress auch eine Form von Hilflosigkeit ist,<br />
soll im folgenden Kapitel näher auf das Thema Stress und mögliche Folgen<br />
eingegangen werden.<br />
Zunächst soll der Begriff Stress definiert werden. Des Weiteren werden<br />
Stressfaktoren und das biopsychologische Stresskonzept nach Hans Selye<br />
6
eschrieben werden. Im Anschluss daran möchte ich auf Folgen für die<br />
Gesundheit und auf Stressbewältigung eingehen.<br />
Zur Definition von Stress ist zu sagen, dass es ein Sammelbegriff für viele<br />
verschiedene Einzelphänomene ist. Der Körper versucht sich durch<br />
verschiedene Anpassungsmechanismen an die Umweltgegebenheiten<br />
anzupassen. Stress ist „ein Zustand des Organismus, bei dem das Wohlbefinden<br />
durch innere oder äußere Bedrohung gefährdet wird und deshalb alle Kräfte<br />
konzentriert, um den Organismus vor Bedrohung zu schützen.“ Desweiteren<br />
muss man Stress in zwei Formen unterscheiden, in den positiven Eustress und<br />
den negativen Disstress.<br />
Es gibt fünf Formen von Stressoren die ich im Folgenden aufführen werde:<br />
1. Äußere Stressoren wie zum Beispiel die Überflutung oder der Entzug<br />
von Sinnesreizen oder Informationen; Schmerzreize;<br />
Gefahrensituationen (Unfälle, Operationen, Kampfsituationen)<br />
2. Der Entzug von Nahrung, Schlaf, Wasser, Bewegung (d.h. primäre<br />
Bedürfnisse werden nicht befriedigt)<br />
3. Leistungsstressfaktoren wie zum Beispiel Überforderung durch<br />
Zeitdruck, Mehrfachbelastung, Ablenkung oder Mangel an<br />
ausreichender Erholungsmöglichkeit; Monotonie; Prüfungen; Versagen;<br />
Kritik<br />
4. Soziale Stressoren zum Beispiel Isolation<br />
5. Psychische oder psychosoziale Stressoren zum Beispiel Konflikte,<br />
Ungewissheit, fehlende Kontrolle und das Gefühl des Ausgeliefertseins<br />
Das biopsychologische Stresskonzept wurde von Hans Selye entwickelt und<br />
besagt, dass Stressoren unabhängig von Ihrer Qualität ein Syndrom<br />
körperlicher Anpassungsreaktionen auslöst, Dieses nennt man auch das<br />
Adaptationssyndrom, welches aus drei Phasen besteht.<br />
1. Alarmreaktionen<br />
Sind physiologische Reaktionen wie zum Beispiel Blutzuckererhöhung zur<br />
Energiebereitstellung oder die Freisetzung von Adrenalin und Noradrenalin.<br />
7
2. Widerstandsphase<br />
Der Widerstand gegenüber dem aktuellen Stressor ist erhöht d.h. der Körper<br />
konzentriert sich darauf und vernachlässigt währenddessen den Widerstand<br />
gegenüber anderen Stressoren. Zum Beispiel die Schwächung des<br />
Immunsystems während besonders stressigen Arbeitsphasen.<br />
3. Erschöpfungsphase<br />
Je nach dem wie lange der Körper diesem Druck stand halten muss und die<br />
Grundverfassung des Einzelnen ist, kommt es zu psychosomatischen,<br />
psychischen oder psychosozialen Folgen.<br />
Geht man von dem Adaptationssyndrom aus, können mögliche Folgen für die<br />
Gesundheit zum Beispiel eine Beeinträchtigung der Infektabwehr sein wie sie<br />
zum Beispiel bei Personen mit hoher psychischer Belastung (Pflegepersonal)<br />
der Fall sein kann. Besonders bei chronischem Stress ist ein erhöhtes Auftreten<br />
von Magen-Darm-Erkrankungen; Bronchialasthma; Arthritis; Migräne;<br />
Spannungskopfschmerz und Allergien möglich.<br />
Die individuelle Stressbewältigung ist für die soziale Funktionstüchtigkeit und<br />
die Gesundheit wichtig, jeder Mensch hat seine eigene Art Stress abzubauen.<br />
Die Häufigkeit und Intensität von Stresserleben sind ebenfalls unterschiedlich.<br />
Auch die Forschung geht mittlerweile davon aus, dass die Persönlichkeit eines<br />
Menschen Auswirkungen darauf hat, welche Folgen Stress auf den Einzelnen<br />
hat. Es gibt positive und negative Stressbewältigungsversuche. Positiv wäre<br />
Ursachenforschung und – bekämpfung, negativ das Unterlassen von<br />
Handlungen beziehungsweise Vermeidungsstrategien. Positive Faktoren für<br />
eine günstige Stressbewältigung sind ein intaktes soziales Stützsystem wie zum<br />
Beispiel Freunde und Familie, eine gute eigene Selbsteinschätzung und<br />
Optimismus.<br />
Bei nicht erfolgter Stressbewältigung, wäre eine mögliche Folge das Burnout-<br />
Syndrom. Die Hauptsymptome sind emotionale Erschöpfung,<br />
Depersonalisation und verminderte Leistungsfähigkeit. Mögliche<br />
8
Verhaltensweisen sind negative Einstellung, Zurückgezogenheit, ein Gefühl<br />
der Sinnlosigkeit und die Hilflosigkeit.<br />
Das Krankheitsbild entwickelt sich langsam und ist das Ergebnis eines<br />
Prozesses bei dem Arbeitsbelastung, Stress und psychische Anpassung<br />
miteinander einhergehen. Auch die Persönlichkeit spielt hierbei wieder eine<br />
Rolle, da persönliche Stressoren wie zum Beispiel hohe Leistungserwartung<br />
oder starke Identifikation mit der Arbeit wichtige Auslöser sein können. Häufig<br />
betroffen sind Beratungs-, Pflege- und Betreuungsberufe. Mögliche<br />
Maßnahmen für den Heilungsprozess sind zum Beispiel die Stärkung<br />
individueller Ressourcen (Stressbewältigungsstrategien) und die Reduktion von<br />
Perfektionismus und unrealistischen Erwartungen.<br />
Die in diesem Kapitel beschriebenen Probleme sind eine Form von<br />
Hilflosigkeit oder können Hilflosigkeit hervorrufen, je nachdem wie stark die<br />
Symptome ausgeprägt sind. Deshalb ist es wichtig Auszubildende und frisch<br />
Examinierte über Stress und Stressbewältigungsstrategien aufzuklären und<br />
entsprechende Bewältigungsstrategien aufzuzeigen, um der Hilflosigkeit<br />
vorzubeugen.<br />
5. Praxisbeispiel und Transfer<br />
Aus eigener Erfahrung weiß ich wie es ist, eine bekannte Person zu pflegen,<br />
die eine Diagnose, die möglicherweise mit dem Tod enden kann, bekommen<br />
hat. Als Pflegende/r weiß man nicht wie man mit dieser Person umgehen soll:<br />
Kann man sie duzen oder soll man sie siezen? Wie geht man mit den<br />
Angehörigen um, die man möglicherweise auch kennt? Dies waren Fragen die<br />
ich mir gestellt habe und keine Antwort darauf wusste, also habe ich nach<br />
Gefühl gehandelt. Dadurch, dass das Pflegepersonal keinerlei Aufklärung<br />
darüber erhielt, was mit dem Patienten passieren könnte, ging ich völlig<br />
unvorbereitet in dieses Zimmer. Dies war für mich ein großer Schockmoment<br />
und es war schwer für mich adäquat zu reagieren, da ich so etwas in meiner<br />
Ausbildungszeit noch nicht erlebt hatte. Darum war ich mir nicht im Klaren,<br />
dass es für den Patienten keine Rettung mehr gab. Ich denke wenn ich vorher<br />
9
über das mögliche Geschehen informiert worden wäre, wäre ich mit einer<br />
anderen Erwartung in die Situation getreten. Das Ereignis wäre nicht weniger<br />
schrecklich gewesen, aber ich wäre möglicherweise vorbereiteter gewesen.<br />
Nachdem ich erfahren hatte, dass der Patient verstorben ist, habe ich mich<br />
hilflos gefühlt und hatte große Schuldgefühle. Dies war eine sehr schwere<br />
Zeit für mich und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich etwas hätte<br />
anders machen können. Mithilfe vieler Gespräche wurde mir klar gemacht,<br />
dass ich nichts weiter hätte tun können. Diesen Vorfall werde ich nicht<br />
vergessen können zum einen, weil es eine Person war die ich kannte und zum<br />
andern, weil es ein einschneidendes Erlebnis war.<br />
Ich denke, der Umgang mit bekannten sterbenden Personen ist gerade für frisch<br />
Examinierte und Auszubildende schwierig, da ihnen häufig die Erfahrung fehlt,<br />
die sich langjährig Examinierte im Laufe der Zeit angeeignet haben.<br />
Mit bekannten Patienten umzugehen ist eine Sache, mit sterbenden bekannten<br />
Patienten umzugehen erfordert Kraft und psychische Stärke. Das kann man in<br />
der Schule nicht lernen, das sind Erfahrungen, die man sich mit der Zeit im<br />
Beruf aneignet.<br />
Ich finde die Vorbereitung darauf einen sterbenden bekannten Menschen zu<br />
pflegen ist eine wichtige Grundlage um eine solche Situation so gut wie<br />
möglich bewältigen zu können. Gerade neu Examinierte und Schüler/innen,<br />
die häufig noch sehr jung sind, ist Unterstützung und Hilfestellung im Umgang<br />
mit dem Patientenklientel von großer Bedeutung. Es ist wichtig, wenn so eine<br />
Situation auf Station auftritt, dass man mit dem gesamten Team spricht und<br />
auch die Schüler/innen anspricht und für ihre Fragen und Ängste offen ist.<br />
Desweiteren muss besprochen werden wie man mit dem Patienten umgehen<br />
kann, damit frisch Examinierte und Auszubildende einen gewissen Leitfaden<br />
haben. Ich denke jedoch, dass es keine festen Umgangsformeln gibt mit<br />
sterbenden Bekannten umzugehen, aber durch die möglichen Erfahrungen der<br />
älteren Pflegenden kann man sich untereinander austauschen. Ich denke, dass<br />
es auch für das gesamte Team hilfreich sein könnte, denn auch für erfahrene<br />
Pfleger/innen ist es eine nicht alltägliche Situation. Weiterhin sollten Ärzte das<br />
Pflegeteam über mögliche Folgen einer Erkrankung aufklären, wie zum<br />
Beispiel den plötzlich eintreffenden Tod des Patienten. Damit sich die<br />
10
Schwestern und Pfleger auf eine Situation vorbereiten können und mit den<br />
Schülern und frisch Examinierten zusammensetzen, um mit Ihnen über die<br />
möglichen Folgen sprechen zu können. In diesen Gesprächen sollte man Ihnen<br />
auch ganz klar sagen, dass wenn Sie feststellen, dass sie mit der Situation<br />
überfordert sind oder sich unwohl fühlen, sie sich raus ziehen dürfen und auch<br />
müssen. Das ist keinerlei Ausdruck für Schwäche und auch das muss den frisch<br />
Examinierten und Auszubildenden klar gemacht werden. Ein Patient merkt es<br />
wenn man sich unwohl fühlt und Patienten, die man kennt merken es noch<br />
besser.<br />
Sollte der Fall eintreten, dass der Patient verstirbt und das ein Pflegender in die<br />
eben beschriebene Situation kommt, muss man ihn begleiten, Gespräche<br />
anbieten möglicherweise auch mit geschultem Personal. Man sollte den<br />
betreffenden Pflegenden mögliche Anlaufstellen aufzeigen, wenn sie nicht mit<br />
Mitarbeitern sprechen wollen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass der Betroffene<br />
im Voraus darüber aufgeklärt wurde, wie er in der Situation reagieren kann<br />
allerdings muss jeder für sich entscheiden was für ihn das Beste ist.<br />
Stellen Mitarbeiter der Station fest, dass der Betroffene sich häufig krank<br />
meldet, sich sozial zurück zieht, sich aus pflegerischen Tätigkeiten zurückzieht<br />
oder sich anderweitig sein Verhalten ändern sollte, muss dies dem Arbeitgeber<br />
gemeldet werden um entsprechende Schritte einleiten zu können. Der erste<br />
Schritt allerdings sollte sein, dass man mit dem Betroffenen persönlich das<br />
Gespräch sucht. Sollte sich an der Situation nichts ändern, kann der<br />
Arbeitgeber gegebenenfalls Schritte wie das Wiedereingliederungsmanagement<br />
einleiten. Die rechtliche Grundlage hierzu ist:<br />
§ 84 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) IX:<br />
„Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres<br />
länger als sechs Wochen ununterbrochen<br />
oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der<br />
Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung<br />
im Sinne des § 93, bei<br />
schwerbehinderten Menschen außerdem<br />
mit der Schwerbehindertenvertretung,<br />
11
mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen<br />
Person die Möglichkeiten, wie<br />
die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden<br />
werden und mit welchen Leistungen<br />
oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit<br />
vorgebeugt und der Arbeitsplatz<br />
erhalten werden kann (betriebliches<br />
Eingliederungsmanagement). ...“<br />
Das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) bietet dem Mitarbeiter die<br />
Möglichkeit sein Problem und die Hilflosigkeit zu überwinden und wieder in<br />
den Arbeitsalltag einzusteigen. Da ein Mitarbeiter der sich häufig und über<br />
lange Zeit krank meldet ein hoher Kostenfaktor für den Betrieb ist kann ein<br />
erfolgreiches BEM diese Kosten wieder senken und die Zufriedenheit und<br />
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter erhöhen. Deshalb ist wichtig frisch<br />
Examinierten und Auszubildenden entsprechendes Werkzeug an die Hand zu<br />
geben, wie sie mit Stress und Hilflosigkeit umgehen können, damit BEM<br />
vielleicht gar nicht erst greifen muss.<br />
Desweiteren könnte man auf somatischen Stationen, sowie es auf der<br />
Psychiatrie üblich ist, sogenannte Supervisionen einführen. Dort wird in<br />
regelmäßigen Abständen über bewegende Ereignisse im Arbeitsalltag der<br />
Mitarbeiter gesprochen. In diesen Gesprächen kann man gemeinsam<br />
Stressbewältigungsstrategien entwickeln. Außerdem merkt man, dass man mit<br />
seinen Problemen nicht alleine ist. Die regelmäßigen Treffen sind für den<br />
Gruppenzusammenhalt wichtig und können das Arbeitsklima verbessern.<br />
12
6. Fazit und Ausblick<br />
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Körper, Geist und Seele so wie es das<br />
holistische Menschenbild sagt, zusammenhängen. Das heißt, ist eine der<br />
Komponenten angeschlagen hat dies automatisch Auswirkungen auf die<br />
anderen. Dies kann man besonders gut anhand des Adaptationssyndroms<br />
erkennen wie es in Kapitel 4 beschrieben wird, da psychischer Stress immer<br />
auch Auswirkung auf die körperliche Gesundheit hat. Stress geht immer mit<br />
dem Gefühl der Hilflosigkeit einher, da man sich einer Situation hilflos<br />
ausgeliefert fühlt und alleine keinen Ausweg findet. In dem Beruf der<br />
Gesundheits- und Krankenpflege, versucht man den Patienten klar zu machen,<br />
dass sie Körper, Geist und Seele in Einklang bringen müssen um zu genesen.<br />
Die Pflegenden stellen dies für sich häufig an letzte Stelle und reagieren meist<br />
erst wenn es schon fast zu spät ist und ihr Körper resigniert. Darum ist es<br />
wichtig, dass man von Anfang an Pflegende auf ihren Beruf vorbereitet und<br />
ihnen mögliche Stressbewältigungsstrategien vermittelt. Aber auch die<br />
Pflegenden selbst, müssen sich ihre Auszeiten einräumen und auf ihre<br />
körperliche und seelische Gesundheit achten, um ihren anspruchsvollen Beruf<br />
erfolgreich und möglichst lang ausüben zu können.<br />
Der Gesetzgeber hat den Betrieben in Form von BEM ein Werkzeug an die<br />
Hand gegeben um Arbeitnehmern die Möglichkeit zu bieten, wenn ihre<br />
Stressbewältigungsstrategien nicht mehr greifen, wieder in ihren Beruf zurück<br />
zu kehren.<br />
Ich denke, dass es eine wichtige Angelegenheit ist, weil man gegenüber den<br />
Patienten eine große Verantwortung hat aber auch sich selbst gegenüber und<br />
das vergessen viele Pflegende im Arbeitsalltag. Meiner Meinung nach ist es<br />
zwar schwierig allen Mitarbeitern gerecht zu werden, aber wenn alle<br />
zusammen arbeiten und auf einander acht geben ist es umsetzbar.<br />
13
Literaturverzeichnis<br />
Der Brockhaus Psychologie; Fühlen, Denken und Verhalten verstehen; 2<br />
vollständige überarbeitete Auflage; Mannheim, Leipzig; F.A. Brockhaus,<br />
Mannheim<br />
Schmidbauer, Wolfgang; Helfersyndrom und Burnout-Syndrom; 1. Auflage;<br />
Jena; Urban & Fischer Verlag München; 2002<br />
Broschüre BEM ZB Info<br />
14
Eigenständigkeitserklärung<br />
Ich versichere, das ich die vorgelegte <strong>Projektarbeit</strong> eigenständig und ohne fremde<br />
Hilfe verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen verwendet und die den<br />
benutzten Quellen entnommenen Passagen als solche kenntlich gemacht habe.<br />
Diese <strong>Projektarbeit</strong> ist in dieser oder einer ähnlichen Form in keinem anderen Kurs<br />
vorgelegt worden.<br />
Unterschrift:_________________________________________________________<br />
<strong>Essen</strong>, den:__________________________________________________________<br />
15