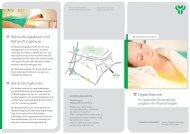Projektarbeit Janina Levermann - Kliniken Essen-Mitte
Projektarbeit Janina Levermann - Kliniken Essen-Mitte
Projektarbeit Janina Levermann - Kliniken Essen-Mitte
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Krankenpflegeschule der <strong>Kliniken</strong> <strong>Essen</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Henricistraße 92<br />
45136 <strong>Essen</strong><br />
Kurs 2008 / 2011 (Oberkurs)<br />
Kursleitung:<br />
Lernbereich 2: Ausbildungs- und Prüfungssituation von Pflegenden<br />
Teilbereich 6: Persönliche Gesunderhaltung<br />
<strong>Projektarbeit</strong> zur mündlichen Abschlussprüfung in der Gesundheits- und Krankenpflege am<br />
22. September 2011<br />
Möglichkeiten der persönlichen Gesunderhaltung in der beruflichen Pflege am Beispiel<br />
des betrieblichen Gesundheits- und Eingliederungsmanagements<br />
Name :<br />
Adresse :<br />
Abgabedatum :<br />
Helfen und hilflos sein<br />
Krankenpflegeschüler/innen auf der gynäkologischen Onkologie
Inhaltsverzeichnis Seite<br />
1. Einleitung 1<br />
2. Vorwort 1 - 2<br />
3. Definition<br />
3.1 Helfen 2<br />
3.2 Hilflos sein (Hilflosigkeit) 3<br />
4. Praxisbeispiel und Transfer 3 - 9<br />
Zusammenfassung 9 - 10<br />
Ausblick 10 - 11<br />
5. Eigenständigkeitserklärung 12<br />
6. Literaturverzeichnis<br />
6.1 Zeitungsartikel 13<br />
6.2 Bücher 13 - 14<br />
6.3 Internetdokumente 15 - 16
1.Einleitung<br />
Das betriebliche Gesundheitsmanagement beinhaltet Maßnahmen zum Schutz und zur<br />
Gesunderhaltung des Arbeitnehmers. Es sorgt dafür, dass dem Arbeitnehmer<br />
Gesundheitsdienstleistungen angeboten werden, die zum einen die Gesundheit erhalten, und<br />
zum anderen weiteren Krankheiten vorbeugen soll. Dabei ist es nicht nur wichtig, dem<br />
festangestellten Personal zu helfen, sondern auch den Auszubildenden, da gerade diese am<br />
Anfang eines langen Arbeitslebens stehen. Der Alltag einer Gesundheits- und<br />
Krankenpflegeschüler/in besteht hauptsächlich im „Helfen“, sei es den Patientinnen bei der<br />
Grundpflege, beim Wiedererlernen von bestimmten Abläufen im Alltag, bei der Hilfe zur<br />
Selbstpflege/ -hilfe oder den Ärzten bei diagnostischen Verfahren. Es gibt nicht selten<br />
Situationen im Alltag der Schüler/innen wo sie hilflos sind, in denen sie die Situation nicht<br />
richtig meistern können, da es für manche Patientinnen keine medizinische oder pflegerische<br />
Hilfe gibt. Man versucht das Beste für den Patientinnen zu ermöglichen und ihm so viel<br />
Lebensqualität, wie es nur möglich ist, zu geben, doch trotzdem sterben viele Patientinnen<br />
viel zu früh. Als Schüler/in denkt man dann noch oft über manche Schicksale nach, bei denen<br />
man sich hilflos gefühlt hat, bei denen man machtlos war und das Gefühl hatte zu versagen.<br />
Deswegen finde ich es wichtig, dass man sich nicht nur um die Patientinnen kümmert,<br />
sondern auch um die Pflegenden, dass wenn sie sich hilflos fühlen, unfähig bestimmte<br />
Situationen zu meistern oder sich machtlos fühlen, ihnen beigestanden und geholfen wird.<br />
Aus diesem Grund haben ich mich in dieser Hausarbeit näher mit dem Thema Helfen und<br />
hilflos sein im Zusammenhang mit dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement, befasst.<br />
Nur jemand der vollständig gesund ist, kann einem Kranken helfen wieder gesund zu werden.<br />
2. Vorwort<br />
In der <strong>Projektarbeit</strong> habe ich mich mit dem Thema „Helfen und hilflos sein“<br />
auseinandergesetzt. Ich finde es gerade in diesem Beruf als Gesundheits- und<br />
Krankenpfleger/in sehr wichtig, sich mit diesem Thema zu befassen, da es oft Patientinnen<br />
gibt, denen man nicht mehr helfen und dementsprechend nicht gesund pflegen kann.<br />
Besonders als Krankenpflegeschüler/in fängt man dadurch an, sich in diesen Situationen und<br />
bei solchen Patientinnen hilflos zu fühlen, man merkt, dass man nicht mehr helfen kann, wie<br />
man es gelernt hat. Deshalb habe ich mich in der Hausarbeit damit beschäftigt, in welchen<br />
Situationen die Krankenpflegeschüler/innen besonders auf der gynäkologischen Onkologie,
sich oft hilflos fühlen, um dann zu sehen, wie man ihnen am besten helfen kann. Wie kann der<br />
Schüler/in trotz seines Alltags, den Arbeitsbedingungen, den immer wiederkehrenden und<br />
nicht enden wollenden schlimmen Schicksalen, sich am besten schützen und gesund halten.<br />
Wie hält man die Schüler mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement also nicht nur<br />
körperlich sondern auch psychisch und physisch gesund? Kann man es schaffen die Schüler<br />
durch bestimmte Angebote im Krankenhaus zu entlasten und ihnen helfen den Stress und die<br />
Hilflosigkeit bei manchen Fällen abzubauen. Ich habe in der Hausarbeit versucht einen<br />
Lösungsansatz für den Pflegealltag herauszuarbeiten, um die körperliche und psychische<br />
Gesundheit der Pflegenden zu erhalten, zu fördern und das Gefühl der Hilflosigkeit zu<br />
vermindern.<br />
3. Definition<br />
3.1 Helfen:<br />
3.1.1 „Helfen bezieht sich auf die hervorzubringende Wirkung, beistehen auf die<br />
Unterstützung und Ergänzung einer Kraft, die zur Erledigung einer Aufgabe nicht<br />
hinreicht. Beistehen wird daher nur von denkenden, mit Vernunft handelnden Wesen<br />
gesagt, helfen dagegen von Personen wie von Sachen. Die Pfeiler, die ein Gebäude<br />
unterstützen, helfen die ganze Last desselben tragen, aber man sagt nicht: sie stehen<br />
einander bei. Dagegen sagt man: Ein Freund steht dem andern in Not und Gefahr bei.“<br />
(6.3.1, Z. 1-7)<br />
3.1.2 „Helfen ist im System des Enneagramms eine Umschreibung für die Falle des<br />
Enneagramm-Typs 2. Es geht ihm dabei darum, sich um die Bedürfnisse der<br />
Mitmenschen zu kümmern, ihre verschiedenartigen Belange zu erspüren und zur<br />
richtigen Zeit und am rechten Ort einfühlsam und förderlich für sie da zu sein. Aus<br />
dieser eigentlich menschenfreundlichen Einstellung können sich jedoch beträchtliche<br />
Schwierigkeiten ergeben, wenn sie zur Unentbehrlichkeit wird oder gar zu einer<br />
geradezu klebrigen Aufdringlichkeit oder anhänglichen Bemutterung umschlägt.“<br />
(6.3.2, Z. 1- 8)<br />
3.2 Hilflos sein: (Hilflosigkeit)
3.2.1 „Im ATSG (Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts), Art. 9 ist Hilflosigkeit<br />
wie folgt definiert: Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der<br />
Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der<br />
persönlichen Überwachung bedarf.“ (6.3.3, Z. 1- 3)<br />
3.2.2 „Hilflosigkeit wird in der Literatur übereinstimmend beschrieben als psychologischer<br />
Zustand, der von Gefühlen der Unzulänglichkeit, des Versagens, der Unfähigkeit, eine<br />
Situation zu meistern, einhergeht. Hilflosigkeit ist oft verbunden mit Angst,<br />
Hoffnungslosigkeit und Machtlosigkeit. Hilflosigkeit tritt dann auf, wenn der Mensch<br />
eine Situation nicht >>beherrschen
Stationen zu bekommen. Im stationären Bereich gibt es oft Situationen in denen man<br />
Patientinnen gut helfen kann, da sie kooperativ sind und viele Ressourcen aufweisen. Die<br />
Patientinnen wollen wieder gesund werden, mit aller Kraft, die sie auftreiben können und das<br />
so schnell wie möglich. Auch Patientinnen die nicht mehr sehr viele Ressourcen haben und<br />
die ihre Krankheit noch nicht eingesehen haben, oder nicht einsehen wollen, gibt es<br />
verschiedene Möglichkeiten auf sie einzugehen und ihnen zu helfen. Pflegestandards<br />
vereinfachen es den Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, die Patientinnen wieder gesund<br />
zu pflegen. Auch gibt es Prophylaxen, um weitere Krankheiten vorzubeugen und die<br />
Gesundheit des Patientinnen weiter zu erhalten. Man sieht, dass es für die Patientinnen viele<br />
Möglichkeiten gibt, von den Pflegenden gesund gepflegt zu werden oder Hilfe zur<br />
Selbstpflege zu erlangen. Auf der gynäkologischen Onkologie gibt es oft Patientinnen, denen<br />
man nicht mehr mit medizinischen <strong>Mitte</strong>ln helfen kann, da der Krebs so metastasiert ist, dass<br />
die Patientinnen nur noch wenige Wochen zum Leben bleiben. Wenn man als Schüler/in auf<br />
der Station eingesetzt ist, wo es diese aussichtslosen Fälle gibt, fühlt man sich hilflos, da man<br />
das, was man in der Ausbildung gelernt hat und gerade lernt nicht anwenden kann. Man kann<br />
den Patientinnen nicht mehr helfen. Als ich als Schülerin auf der gynäkologischen Onkologie<br />
eingesetzt war, habe ich mich des Öfteren hilflos gefühlt. Aus Gesprächen mit examinierten<br />
Kollegen konnte ich entnehmen, dass es ihnen in diesen Situationen genauso erging wie mir.<br />
Sie fühlten sich machtlos und wussten nicht, wie sie den Patientinnen helfen konnten. Eine<br />
Kollegin von mir sagte in einem Gespräch: „Wenn ich in manche Zimmer gehe und die<br />
Personen, nicht älter als man selber sind, eine so niederschmetternde Diagnose haben, könnt<br />
ich weinen.“ Das hat meine Gefühlslage in viele Situationen wiedergespiegelt. Der Umgang<br />
mit den Patientinnen selbst, in ausweglosen Situationen, ist schwierig, da man ihnen nicht<br />
zeigen möchte, dass sie sterben werden, oder, dass sie eine schlechte Diagnose erhalten<br />
werden. Auch der Umgang mit den Angehörigen, die es nicht wissen durften, da die<br />
betroffenen Patientinnen sie nicht belasten wollte, indem sie es ihnen verheimlichen,<br />
besonders den angehörigen Kindern. Man hat diese Fälle nicht mehr aus seinem Kopf<br />
bekommen, und fühlte sich schlecht, die Patientinnen taten einem Leid und man wusste nicht<br />
wie man ihnen genau helfen konnte. Das Gesundpflegen, wie man es sonst immer durchführte<br />
und wie man es wollte, konnte man nicht. Nach den Konfrontationen mit solchen Situationen<br />
hat man versucht sich selbst zu helfen wie zum Beispiel: “Das Geschehene ins Auge zu sehen<br />
und es anzuerkennen, sich selbst Augenblicke der Entspannung gegönnt Routinearbeiten<br />
gemacht und Konfrontation mit Ablenkung abgewechselt.“ (6.2.1; S. 115, Z. 2- 3; Z. 6- 8)<br />
Dabei war es aber auch wichtig „Das Gefühl nicht in sich hineinzufressen, sondern diese zu
äußern,[…] oder es nicht zu vermeiden, über das Erlebte zu sprechen, das Geschehene mit<br />
anderen Revue passieren zu lassen […] und nicht vorzutäuschen Unverletzbar zu sein. Man<br />
sollte bereit sein Unterstützung anzunehmen.“(6.2.1; 1997; S. 115, Z. 9- 24) Doch oft ist man<br />
mit diesen Eindrücken nach Hause gegangen zu seiner Familie und hat mit ihnen darüber<br />
geredet, was einen dann entlastet hat für den Moment. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass<br />
man nicht nur den Erkrankten hilft mit Prophylaxen, Operationen, Therapien und<br />
psychologischen Gesprächen, sondern auch den Pflegenden und Krankenpflegeschüler/innen.<br />
Auf der einen Seite ist jeder für sein eigenes Wohl und seine eigene Gesundheitsförderung<br />
zuständig. Dazu zählt gesundes, ausgewogenes <strong>Essen</strong>, Bewegung, möglichst wenig Stress,<br />
Halt bei Familie und Freunden, alles in allem ein gesunder Lebensstil, der bei jedem<br />
unterschiedlich aussieht. Auf der anderen Seite ist aber nicht nur der Einzelne für seine<br />
Gesundheit zuständig, sondern auch der Arbeitgeber ist für die Gesundheit seiner<br />
Arbeitnehmer zuständig. Mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement wird dafür gesorgt<br />
dass dem Arbeitnehmer Gesundheitsdienstleistungen angeboten werden. Das könnte zum<br />
Beispiel „Massagen, Rückenschulen, Teamsupervisionen, monatliche Teambesprechungen,<br />
Mitarbeitergespräche, Stressbewältigung, Sportkurse, gesunde Pausengestaltung,<br />
Aromatherapie, Selbstverteidigung …“ sein, die dem Mitarbeiter helfen sich gesund zu fühlen<br />
und es auch zu sein. Das alles soll nicht nur dem körperlichen, sondern auch dem seelischen<br />
Wohl dienen. Es gibt aber viele Situationen als Gesundheits- und Krankenpflegeschüler/in, da<br />
helfen keine Massagen, Sportkurse oder Teambesprechungen, es hat nichts direkt mit dem<br />
körperlichen Wohl des Schülers/in zu tun, sondern es sind die Situationen in denen man sich<br />
hilflos fühlt und nicht mehr weiter weiß. Das spiegelt sich bei jedem anders wieder und ist<br />
sehr individuell, es kommt dabei auf den Charakter und familiäre, gesellschaftliche<br />
Sozialisation an. „Einige Menschen drücken ihre Hilflosigkeit in Worten und Gesten aus,<br />
andere wiederum scheuen sich davor, ihre Befindlichkeit gegen außen zu zeigen oder gar um<br />
Hilfe zu bitten.“(6.2.2; S.72, Z. 8- 11) Es ist für viele Menschen schwierig sich helfen zu<br />
lassen und damit ihre Hilflosigkeit preiszugeben, da man die eigene Schwäche zugibt. „Die<br />
Tatsache, Hilfe annehmen zu müssen, bedroht nach Meuler die Selbstachtung, die<br />
Unabhängigkeit, das eigene Vermögen, mit der Situation klarzukommen. Um Hilfe bitten zu<br />
müssen bedeutet, sich dem Anderen ein Stück weit auszuliefern. Es bedeutet ein<br />
Eingeständnis der eigenen Schwächen, Unsicherheit und Hilflosigkeit.“ (Meuler, 1997 –<br />
6.2.2; S.72, Z. 13-17) Man muss deshalb lernen sich Schwächen und somit die Hilflosigkeit<br />
einzugestehen und sich somit helfen zu lassen, sonst kommt es auf kurz oder lang zu<br />
Depressionen oder zum Burnout und somit zu längeren Krankheitsausfällen. „An Burnout
Erkrankte leiden unter einer starken geistigen, körperlichen und seelischen Erschöpfung. [...]<br />
Besonders gefährdet, an Burnout zu erkranken, sind Menschen in sozialen Berufen<br />
(Altenpfleger, Krankenschwestern), sowie Lehrer und Seelsorger. Die Betroffenen wollen<br />
anderen helfen. Sie geben viel, bekommen aber wenig Anerkennung und Bestätigung zurück.<br />
Das Gefährliche am Burnout ist, dass sich diese Erkrankung - wie eine Alkoholerkrankung -<br />
schleichend entwickelt und die Betroffenen erst nach Jahren an den Punkt gelangen, wo nichts<br />
mehr geht, der Akku leer ist und sie total erschöpft sind. Es fehlt die Kraft zum Leben. Der<br />
Wille, zu arbeiten, ist vielleicht noch da, Körper und Geist versagen jedoch ihre Dienste.“<br />
(6.3.4; Z. 3- 17) Die Erkrankung des Burnout- Syndroms kann auch entstehen, durch<br />
„Enttäuschungen, z.B. bei schwerkranken Patientinnen an die Grenzen der pflegerischen<br />
Möglichkeiten zu stoßen. (6.2.3; S.39, Z.11-13) Wie man das auf der gynäkologischen<br />
Onkologie als Krankenpflegeschüler/in oder auch als examinierte Gesundheits- und<br />
Krankenpfleger/in des Öfteren erlebt. „Diese Belastungen werden nicht abgebaut oder<br />
verarbeitet, sondern die Pflegekraft (auch Schüler/innen) versucht, ihnen mit großem<br />
emotionalem und zeitlichem Einsatz zu begegnen. Sie beginnt, sich freiwillig oder<br />
unfreiwillig zu überfordern, z.B. indem sie (zu) viele Überstunden leistet, um die hohe<br />
Arbeitsbelastung zu bewältigen, oder indem sie jederzeit bereit ist, sich auf das Gefühlsleben<br />
der Patientinnen einzustellen“ (6.2.3; S.39, Z.13- 19) Dadurch entsteht die Gefahr sich<br />
emotional zu verausgaben und zu überfordern, was mit der Zeit dann kritisch wird und<br />
langsam sich zu einer psychischen Erkrankung entwickelt. Diese psychischen Erkrankungen<br />
nehmen immer mehr zu und verursachen eine Erhöhung der Krankheitstage. Nach einer<br />
Studie des BKK- Landesverband NORDWEST „fehlte jeder pflichtversicherte Arbeitnehmer<br />
in NRW durchschnittlich 15,1 Tage, bundesweit sind es dagegen durchschnittlich „nur“ 14,8<br />
Tage. Dabei stieg der Grund der psychischen Erkrankung vom Platz 4 (2009) auf Platz 3<br />
(2010).“ (6.1.2; Z. 5- 15) Um dies generelle Erhöhung zu verhindern gibt es das betriebliche<br />
Eingliederungsmanagement (BEM). „Mit der Novellierung des SGB IX zum 01.05.2004<br />
wurde im § 84 Abs. 2 SGB IX ein „Betriebliches Eingliederungsmanagement“ eingeführt. Die<br />
Initiative zu seiner Durchführung wird dem Arbeitgeber auferlegt und es betrifft nicht nur<br />
schwerbehinderte Menschen, sondern nunmehr alle Beschäftigten im Unternehmen. Das<br />
Betriebliche Eingliederungsmanagement umfasst alle begleitenden Hilfen und Maßnahmen,<br />
einschließlich Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die geeignet sind, die<br />
Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern mit langen krankheitsbedingten Ausfallzeiten<br />
wiederherzustellen, neuer Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und deren Arbeitsverhältnisse<br />
nachhaltig zu sichern.“ (6.1.1; S.5, Z. 20- 27) Man versucht sich um die Mitarbeiter zu
kümmern, die öfters krank oder sehr lange krankgeschrieben sind. Dem Arbeitnehmer und<br />
den Krankenpflegeschüler/innen muss geholfen werden wieder gesund zu werden und es<br />
muss einer neuen Erkrankung vorgebeugt werden, indem man herausfindet, was genau die<br />
Erkrankten haben. Das Eingliederungsmanagement kann man auch auf die oben genannte<br />
Situation der gynäkologischen Onkologie beziehen, wenn die Krankenpflegeschüler/in sich<br />
hilflos fühlt. Krankenpflegeschüler/innen sind besonders davon betroffen, da sie wenig<br />
Erfahrung mit bestimmten Situationen haben, noch neu in diesem Beruf sind und<br />
wohlmöglich sehr jung sind. Die Schüler/innen haben dann das Gefühl, „den Eindruck, mit<br />
intensiven Gefühlen oder körperlichen Reaktionen nicht umgehen zu können, nicht mehr sich<br />
selbst zu finden, wenn Sie sich chronisch angespannt, verwirrt, leer oder ausgelaugt fühlen.<br />
Wenn Sie wiederholt den Drang oder das Bedürfnis verspüren sich krank zu melden, weil die<br />
Arbeit Ihnen außergewöhnlich viel Kraft abverlangt; wenn körperliche Symptome nicht<br />
verschwinden“ (6.2.1; S.117, Z. 23- 30) Dieser Hilflosigkeit kann man vorbeugen, in dem<br />
man den Schüler/innen die notwendige Unterstützung und professionelle Hilfe zukommen<br />
lässt, in der Ausbildung, die sie benötigen und auch in Anspruch nehmen sollten. Man kann<br />
dafür professionelle psychologische Gespräche als Prävention nutzen, vorgeschaltet vor dem<br />
betrieblichen Eingliederungsmanagement. Eine Art Aufklärung und Hilfestellung vor<br />
bestimmten „Traumareaktionen“ und deren Verarbeitung, mit dem Ziel den<br />
Krankheitsausfällen durch Erschöpfung und Hilflosigkeit zuvorzukommen. In der<br />
Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegeschüler/in ist es von Vorteil, dass die Lehrer<br />
für ihre Schüler/innen da sind, Gespräche anbieten und durch ihre praktischen Erfahrungen<br />
helfen können, besser mit Situationen um zugehen. Wir wurden in unserer Ausbildung zur<br />
Gesundheits- und Krankenpflegerin von einem Psychologen in der Wissensgrundlage:<br />
Geistes- und Sozialwissenschaften unterrichtet, als er uns unterrichtet hat, hat er uns oft<br />
gefragt, wie wir uns in der Praxis zu Recht finden und wie es uns körperlich und psychisch<br />
geht. Wir konnten Probleme kurz schildern und er hat versucht uns zu helfen und eine Lösung<br />
zu finden, was uns oft sehr geholfen hat, mit unseren Problemen besser umzugehen. Diese<br />
Hilfestellung war nicht nur im Klassenverband möglich, sondern auch außerhalb des<br />
Unterrichts in Einzelgesprächen. Die Vorgehensweise kann man auch für Schüler/innen<br />
benutzten, die auf der gynäkologischen Onkologie eingesetzt sind. Zum einen um ihrer<br />
derzeitigen Hilflosigkeit entgegenzuwirken, zum anderen um der Hilflosigkeit präventiv<br />
vorzubeugen. Dazu könnte man jedes halbe Jahr oder in jedem Quartal eine „Sprechstunde“<br />
mit einem Psychologen den Schüler/innen anbieten. Das Vorhaben müsste dann in Absprache<br />
mit der Krankenpflegeschule geschehen, denn vorzugsweise solle man die Gespräch
Sequenzen in den theoretischen Schulblöcken, oder an einem dem Schultag in der Woche<br />
anbieten, da dadurch keine Probleme mit den unterschiedlichen Schichtdiensten der<br />
Schüler/innen zustande kommen. Dazu könnte man die letzte Unterrichtsstunde verwenden,<br />
damit die Schüler/innen sich danach nicht auf neue Unterrichtsinhalte konzentrieren müssen.<br />
Diese Gespräche kann man zum einen im ganzen Klassenverband anbieten, wenn Bedarf<br />
besteht, zum anderen stehen besonders die Einzelgespräche im Vordergrund. Die Gespräche<br />
im Klassenverband, könnten dann in Form einer Selbsthilfegruppe aufgebaut sein, jeder<br />
Schüler/in könnte die eigenen Erfahrungen in bestimmten Situationen auf der<br />
gynäkologischen Onkologie schildern und von seinen Bewältigungsstrategien den Anderen<br />
berichten. Zum Austausch von Lösungen, um sich bei manchen Patientinnen und Situationen<br />
nicht mehr hilflos zu fühlen. Wenn es sich um Einzelgespräche handelt, kann man den andern<br />
Schüler/innen in der bestimmten Schulstunde einen Arbeitsauftrag zum Erledigen geben. Um<br />
die Notwendigkeit der „Sprechstunde“ herauszufinden, könnte man vorher eine anonyme<br />
Umfrage im Klassenverband durchführen lassen, ob Bedarf besteht. Wenn ja, könnte man<br />
eine weiter, aber diesmal nicht anonyme Umfrage durchführen, wie viel diese Gespräch<br />
Sequenzen konkret in Anspruch nehmen wollen. Das Ergebnis solcher Gespräche könnten<br />
präzise Lösungen für den einzelnen und generelle Bewältigungsstrategien für alle darstellen.<br />
Das Resultat wäre nicht nur ein körperliches Wohlbefinden der Schüler/innen sondern auch<br />
ein seelisches und psychisches. Des Weiteren müsste man sich überlegen, woher man den<br />
Psychologen engagiert. Ist es besser eine aus dem eigenen Krankenhaus zu nehmen, oder<br />
lieber einen außerbetrieblich, den man wahrscheinlich extra bezahlen muss. Meiner Meinung<br />
nach wäre es besser einen außerhalb des Krankenhauses zu nehmen, trotz der weiteren<br />
Kosten, da man mit ihm nicht auf der Station zusammen trifft und zusammenarbeiten muss.<br />
Es scheint oft schon schwierig genug seine Hilflosigkeit preiszugeben und sich andern<br />
gegenüber zu öffnen, da lässt man sich noch mehr davon abschrecken, wenn man weiß, der<br />
Person, der man sich geöffnet hat, läuft ihnen jeden Tag bei der Arbeit über den Weg. Man<br />
fühlt sich wohlmöglich ertappt oder schwach. Es müsste berechnet werden, wie viel Geld man<br />
zur Verfügung hat, und wie viel der Psychologe von außerhalb dadurch kosten darf. Diese<br />
Kosten sollten aber ermöglicht werde können, da damit wohlmöglich den Krankheitsausfällen<br />
mit psychischen Hintergrund bei den Schüler/innen vorgebeugt wird. Es wird nicht darauf<br />
gewartet, dass die Schüler/innen, besonders die auf der gynäkologischen Onkologie eingesetzt<br />
sind, sich krank melden, wegen Überforderung und Hilflosigkeit, und somit das<br />
Frühwarnsystem des Betrieblichen Eingliederungsmanagements zum Tragen kommt, sondern<br />
es wir schon Primärprävention betrieben. Es wird versucht schon vorher die Schüler/innen zu
entlasten und ihnen mit Gespräch Sequenzen und Bewältigungsstrategien geholfen sich in<br />
vielen ausweglosen Situationen nicht hilflos zu fühlen.<br />
Zusammenfassung<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jeder Krankenpflegeschüler/in, der in einem<br />
praktischen Einsatz auf der gynäkologischen Onkologie eingesetzt war, schon ausweglose<br />
Situationen am eigenen Leib miterlebt und sich des Öfteren auch hilflos gefühlt hat. Mit den<br />
gesammelten Informationen konnte ich einen umsetzbaren Lösungsansatz für die<br />
Krankenpflegeschüler/innen entwerfen, um deren Hilflosigkeit in manchen Situationen<br />
vorzubeugen und ihnen die Möglichkeit zu geben professionelle Gespräche darüber zu führen,<br />
die ihnen helfen sollen. Um die Umsetzung dieser Idee der wiederkehrenden professionellen<br />
psychologischen Gespräch Sequenzen bei Krankenpflegeschüler/innen auf der<br />
gynäkologischen Onkologie durchzuführen, muss man viele Hürden überwinden. Man<br />
braucht in erster Linie das Geld zur Umsetzung, dabei wäre es praktisch, wenn das Land oder<br />
der Bund so eine Aktion bezuschussen würde. Genaueres darüber ließ sich im Internet oder in<br />
Broschüren über das Betrieblich Eingliederungsmanagement nicht herausfinden. Desweitern<br />
braucht man die Kooperation des Krankenhauses mit der Schule um diese Gespräche<br />
durchzuführen und zu guter Letzt, einen Psychologen außerhalb des Betriebes, der<br />
quartalsweise für 90 Minuten in die Krankenpflegeschule kommen würde. Alles in allem ein<br />
machbares Projekt, was den Nutzen hätte, Krankheitsausfällen von<br />
Krankenpflegeschüler/innen mit psychischen Hintergrund zu vermeiden und vorzubeugen.<br />
Diese Projekt wäre eine Instanz, die man vor das betriebliche Eingliederungsmanagement<br />
setzten sollte, da es für die Schüler/innen zur Prävention dient, wenn man es quartalsweise in<br />
jedem der drei Jahre Ausbildungszeit durchführt.<br />
Ausblick<br />
In dem Beruf als Gesundheits- und Krankenpfleger/in arbeitet man im Schichtdienst,<br />
manchmal 10 Tage hintereinander, vielleicht im Früh- Spätwechsel, was für den Körper eine<br />
große Anstrengung ist. Für Schüler/innen ist das alles schwieriger, da diese meist vorher einen<br />
geregelten Schultag und eine geregelte Woche hatten und jetzt mit der neuen Situation im<br />
Schichtdienst umgehen müssen. Da ist es sehr angenehm, wenn der Betrieb einem
Möglichkeiten der Gesunderhaltung bietet, wie Massagen zu Entspannung. Man arbeitet im<br />
Beruf als Gesundheits- und Krankenpfleger/in eng mit Menschen zusammen, die oft sehr<br />
krank sind, die ein bewegendes Schicksal haben und die teilweise wissen, dass sie bald<br />
sterben werden. Da ist es für den Alltag angenehm, dass es auch in dieser Hinsicht Angebote<br />
im Betrieb gibt, besonders für Krankenpflegeschüler/innen die einem helfen mit der Situation<br />
besser umzugehen. Als Prävention und Hilfe wären diese Gespräch Sequenzen mit einem<br />
Psychologen für die Schüler/innen sehr ratsam. Durch dieses und generell alle Angebote die<br />
der Betrieb anbietet zur Gesunderhaltung des Arbeitnehmers und der Schüler/innen, könnte<br />
sich ein entspannteres Arbeitsklima bilden. Auch ein Sterbeseminar direkt am Anfang der<br />
Ausbildung, bevor man den ersten praktischen Einsatz erlebt, wäre von Vorteil, damit die<br />
Schüler/innen sofort wissen, wie man mit dem Tod und den Sterbenden umzugehen hat.<br />
Wenn sich alle Mitarbeiter gesund und zufrieden, nicht schlapp und nicht hilflos in<br />
bestimmten Situationen fühlen, kann man anders auf die Patientinnen eingehen und sie besser<br />
gesund pflegen. In diesem Beruf wird man nicht jünger und durch die körperlich oft<br />
anstrengende Arbeit, ist es wichtig, dass es solche Angebote zur Gesunderhaltung gibt und,<br />
dass diese auch genutzt werden. Besonders die Schüler/innen sollten diese Angebote nutzten,<br />
da sie noch einen langes Arbeitsleben vor sich haben. Nur wer selbst gesund ist, kann anderen<br />
zur guten Genesung verhelfen.
5. Eigenständigkeitserklärung<br />
Ich versichere, dass ich die vorgelegte <strong>Projektarbeit</strong> eigenständig und ohne fremde Hilfe<br />
verfasst, keinen anderen als die angegebenen Quellen verwendet und die den benutzen<br />
Quellen entnommenen Passagen also solche kenntlich gemacht habe.<br />
Diese <strong>Projektarbeit</strong> ist in dieser oder einer ähnlichen Form in keinem anderen Kurs vorgelegt<br />
worden.<br />
Unterschrift:__________________________________________________________<br />
<strong>Essen</strong>, den:___________________________________________________________
6. Literaturverzeichnis<br />
6.1 Zeitungsartikel<br />
6.1.1<br />
6.1.2<br />
1. Adlhoch, Ulrich; Fankhaenel, Karin; Magin, Johannes; Dr. Seel, Helga; Westers,<br />
Birgit; Zorn, Gerhard<br />
2. Landschaftsverband Rheinland, Landschaftsverband Westfalen-Lippe<br />
3. 2005<br />
4. Handlungsempfehlungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement<br />
5. Landesamt für Gesundheit und Soziales Integrationsamt<br />
6. Berlin<br />
7. 1. Ausgabe<br />
8. März 2006<br />
9. S.5; Z.20ff<br />
1. BKK Landesverband NORDWEST<br />
2. 2011<br />
3. Krankenstand in NRW knapp über Bundestrend – Psychische Erkrankungen bereits<br />
auf Platz 3<br />
4. Pressemeldung im Internet<br />
5. <strong>Essen</strong><br />
6. 19.08.2011<br />
7. http://esssen.de/de/meldungen/pressemeldung_584711.html<br />
8. Z.5ff
6.2 Büchern<br />
6.2.1<br />
6.2.2<br />
6.2.3<br />
1. Buijssen<br />
2. Huub.<br />
3. Wenn der Beruf zum Aptraum wird:<br />
4. Traumatische Erfahrungen in der Krankenpflege<br />
5. 1. Aufl.<br />
6. Ort: Weinheim und Basel<br />
7. Beltz Verlag<br />
8. 1997<br />
9. Pflegen & Betreuen<br />
10. S.115, Z.2ff; S.117, Z.23ff<br />
1. Käppeli, Silvia (Hrsg.)<br />
2. Mädel, Max; Zeller-Forster, Franziska; Bühlman, Josi; Siegwart, Hanna; Schiemann,<br />
Doris; Steppe, Hilde<br />
3. Pflegekonzepte<br />
4. Phänomene im Erleben von Krankheit und Umfeld<br />
5. 1. Nachdruck 1998<br />
6. Bern; Göttingen; Toronto; Seattle<br />
7. Hans Huber Verlag<br />
8. 1998<br />
9. Band 1<br />
10. S.65, Z.15ff; S.72, Z.8ff<br />
1. Kristel<br />
2. Karl Heinz<br />
3. Gesund Pflegen<br />
4. Stressbewältigung und Selbstpflege<br />
5. 1. Auflage
6. München; Wien<br />
7. Urban und Schwarzenberg<br />
8. 1998<br />
9. S.39, Z.11ff<br />
6.3 Internetdokumente:<br />
6.3.1<br />
6.3.2<br />
6.3.3<br />
1. Eberhard<br />
2. Johann August<br />
3. Synonymisches Handwörterbuch der deutschen Sprache<br />
4. 1910<br />
5. Titel: 776. Helfen 1) . Beistehen 2) .<br />
6. HTML Seite<br />
7. Internet: http://www.textlog.de/38086.html<br />
8. Zugriff: 03.09.2011, 14:15<br />
9. Z.1ff<br />
1. Engler-Seminare (Malte R. Engler)<br />
2. Das Enneagramm-Lexikon<br />
3. (Nicht vorhanden)<br />
4. Helfen<br />
5. HTML Seite<br />
6. Internet: http://www.enneagrammseiten.de/enneagrammlexikon/lexikonh.html<br />
7. Zugriff: 03.09.2011, 14:30<br />
8. Z.1ff<br />
1. Glossar Versicherungsmedizin<br />
2. Swiss Insurance Medicine (s. Autoren im Impressum)<br />
3. 2006
6.3.4<br />
4. Hilflosigkeit<br />
5. WWW-Seite<br />
6. Internet: http://www.henet.ch/glossar/content/index.php?term=Hilflosigkeit<br />
7. Zugriff: 03.09.2011, 14:45<br />
8. Z.1ff<br />
1. Dr. Merkle<br />
2. Rolf<br />
3. 1999- 2011<br />
4. Burnout Syndrom - Ursachen und Symtome<br />
5. HTML- Seite<br />
6. Internet: http://www.palverlag.de/Burnout.html<br />
7. Zugriff: 12.09.2011, 16:10<br />
8. Z.3ff