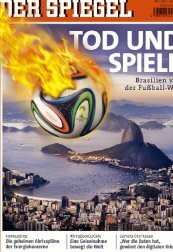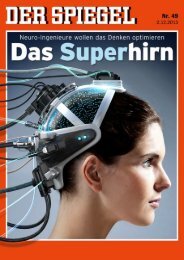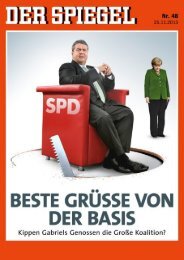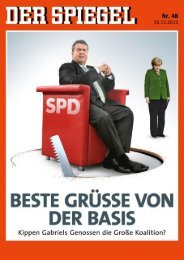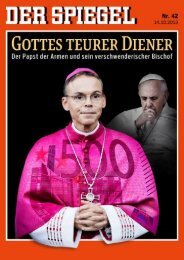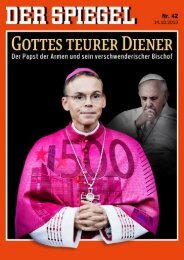SPIEGEL_2015_42
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Autofahrerin Katia um 1950, Brief an Sohn Klaus 1944 (Ausrisse): Das Familienunternehmen sicher durch die ganze Welt geführt<br />
FOTO: KURT SCHRAUDENBACH / SZ PHOTO; BRIEF: THOMAS-MANN-ARCHIV DER ETH-BIBLIOTHEK<br />
fersucht war mit Sicherheit eines der Motive,<br />
die Klaus Mann zum Schreiben dieses<br />
Enthüllungsromans brachten.<br />
Eifersucht, aber auf wen denn jetzt genau?<br />
Kurzer Katalog der Familienlieben:<br />
Klaus liebt vor allem Erika, sein Tagebuch<br />
ist voller Hinweise darauf, dass er nur deswegen<br />
keine stabile Beziehung führen<br />
kann, weil er im Grunde seine Schwester<br />
liebt. Elisabeth wiederum bewundert Erika<br />
so sehr, dass sie den Verleger Fritz Lands -<br />
hoff, der unsterblich und unglücklich in Erika<br />
verliebt ist, so ausdauernd und heftig<br />
mit Liebeserklärungen verfolgt, bis auch<br />
sie von der Familie zum Therapeuten geschickt<br />
wird, um sie von dieser ungesunden<br />
Leidenschaft zu heilen. Michael, den seine<br />
Geschwister Bibi nennen, fühlt sich so heftig<br />
zu Klaus hingezogen, dass dieser, dem<br />
sonst keine Leidenschaften fremd sind, im<br />
Tagebuch irritiert notiert: „Bibi in der Besoffenheit<br />
merkwürdig zudringlich zu mir.<br />
Was für Komplexe?“ Und den Bruder Golo<br />
lockte Michael einmal im Boot auf den Zürichsee,<br />
um sich dort, in der Mitte des Sees,<br />
im Beisein des großen Bruders mittels<br />
Schlafmitteln das Leben zu nehmen. Es<br />
reichte aber nur zu einer kleinen Übelkeit.<br />
Bei anderer Gelegenheit gesteht Michael<br />
Golo, er sei eigentlich immer davon ausgegangen,<br />
dass sein Sohn Toni in Wahrheit<br />
von ihm, dem großen Bruder, gezeugt wurde.<br />
Und schließlich, die unheimlichste Liebesgeschichte,<br />
die Erika, im letzten Lebensjahrzehnt<br />
Thomas Manns, mit dessen<br />
bestem Freund, dem Dirigenten Bruno<br />
Walter, einging. Es war in der Zeit, als Erika<br />
mehr und mehr die Rolle der Ehefrau<br />
Katia im Haus einnahm, für den Vater Briefe<br />
schrieb und so weiter. Kein Wunder,<br />
dass diese Affäre mit Walter die einzige<br />
Liebesgeschichte ihrer Kinder war, die die<br />
unendlich tolerante Mutter missbilligte:<br />
„Ich kann mir nun einmal von dieser Verbindung,<br />
die mir ein ebenso großer Fehler<br />
zu sein scheint, wie wenn eine Tochter ihren<br />
eigenen Vater heiratet – auf die Dauer<br />
kein Heil versprechen.“<br />
Nur das Mönle war an all diesen internen<br />
Familienirrungen nicht beteiligt. Wie auch,<br />
wenn sie von allen verachtet wird? Als sie<br />
dann schließlich irgendwann in den Dreißigerjahren<br />
einen respektablen Mann findet,<br />
der sie liebt und sie heiraten will, schicken<br />
die Familienmitglieder einander erstaunte<br />
Briefe. Wie jetzt, das Mönle? Man kann<br />
sie – lieben? Es ist die besondere Tragik<br />
dieses tragischen Lebens, dass ausgerechnet<br />
sie, Monika, ihren Ehemann früh und auf<br />
besonders tragische Weise verliert. Das<br />
Schiff, mit dem sie zusammen mit ihrem<br />
Mann, dem ungarischen Kunsthistoriker<br />
Jenö Lányi, im September 1940 von Europa<br />
nach Amerika fuhr, wurde von einem deutschen<br />
U-Boot versenkt. Stundenlang hatte<br />
sich Monika im Ozean an ein Stück Holz<br />
geklammert, bis sie gerettet wurde. Erika<br />
kümmerte sich um die Schwester, die in ein<br />
Krankenhaus in Schottland gebracht wurde.<br />
In Briefen schildert Erika die Einzelheiten<br />
des Unglücks: „Den Jenö hat das Mönle<br />
noch 3 Mal aus den Wellen rufen hören,<br />
,aber das dritte Mal klang schon sehr<br />
schwach‘. Sie ist davon überzeugt (und mag<br />
recht haben), dass er sich aufgegeben hat,<br />
weil er sie für verloren hielt.“<br />
Als Klaus Mann das liest, entsteht in seinem<br />
Kopf sogleich eine Art tragische Komödie:<br />
Es könne ja sein, dass er irgendwo<br />
wieder auftauche, der Lányi, „vielleicht<br />
nah dem Nordpol, an ein Stück treibendes<br />
Holz geklammert, mit vor Grauen weiß<br />
gewordnem Haar.“ Später macht er tatsächlich<br />
ein Theaterstück aus dem Unglück.<br />
Es wird nicht veröffentlicht.<br />
Das ist ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich<br />
für diese Familie. Denn, wenn auch<br />
längst nicht immer alles offen ausgesprochen<br />
wird – aufgeschrieben wird alles. Die<br />
Manns sind vor allem anderen eine Schriftstellerfamilie,<br />
eine Familie aus Buchstaben,<br />
die den Stoff für all ihre Bücher direkt<br />
im Leben, im Familienleben vor allem, findet.<br />
Thomas Mann hat mit den „Buddenbrooks“,<br />
dem Roman, der seinen Ruhm<br />
begründete und in dem er Mitglieder seiner<br />
Familie als Vorbilder für seine Romanfiguren<br />
nutzte, das Gründungsbuch dieses<br />
Verfahrens geschrieben. Klaus Mann ist<br />
25, als er seine erste Autobiografie schreibt.<br />
Golo Manns erste Erzählung handelt von<br />
einem ihm stark ähnelnden Internatsschüler,<br />
der unter seiner Homosexualität leidet.<br />
Mit fast niemandem hatte Golo bis dahin<br />
über sein geheimes Lebensproblem gesprochen.<br />
Sein Freund Pierre Bertraux, der als<br />
einer von wenigen davon wusste, fragte<br />
sich, nachdem er die Erzählung gelesen<br />
hatte, in einem Brief an seine Eltern: „Um<br />
Gottes willen, warum hat er es veröffentlicht?“<br />
Und gibt sich selbst die Antwort.<br />
Es ist eine Familienkrankheit: „Die Manie<br />
der Familie Mann ist nicht so sehr die des<br />
Schreibens wie die des Veröffentlichens.“<br />
Alles muss raus. Gleich die erste Erzählung<br />
Klaus Manns spielte in der Odenwaldschule,<br />
wo er als Internatsschüler untergebracht<br />
war; der literarisch nur wenig maskierte<br />
Internatsleiter nähert sich den ihm<br />
anvertrauten Schülern auf unangemessene<br />
Weise. Daraufhin beschwerte sich der Leiter<br />
der Odenwaldschule beim Vater des<br />
ehemaligen Schülers und wies ihn auf die<br />
Verantwortung des Sohnes und Jungschriftstellers<br />
hin. Und auf den Unterschied zwischen<br />
der Wirklichkeit, in der er sich keiner<br />
sexuellen Übergriffe schuldig gemacht<br />
habe, und der Literatur.<br />
In dieser Familie gilt die Literatur als<br />
Wahrheitsaggregator. Wollen die Kinder wissen,<br />
was der Vater wirklich von ihnen hält,<br />
hilft ein Blick in seine Bücher. In der Erzählung<br />
„Unordnung und frühes Leid“ lässt<br />
Thomas Mann die Familienmitglieder in ihren<br />
Lebensrollen auftreten. Erika, die hier<br />
Ingrid heißt, werde ihren Schulabschluss mittels<br />
Augenaufschlag und Lehrerbetörung erhalten.<br />
Klaus, als Bert, will gar keinen Abschluss<br />
machen, er ist ein Träumer, der sein<br />
Auftreten nach dem des Hausdieners ausrichtet,<br />
als Berufsziele gibt er Tänzer oder<br />
Kellner in Kairo an. Auf diese Erzählung<br />
reagierte Klaus Mann mit seiner „Kindernovelle“,<br />
in der er wiederum seinen Bruder<br />
Golo, den er Fridolin nennt, als einen intelligenten,<br />
aber kleinen, hässlichen, dämonischen,<br />
unterwürfigen und von sonderbarem<br />
Ehrgeiz getriebenen Jungen schildert.<br />
Sie sind uns auch deswegen heute noch<br />
so nah, weil sie alle diese moderne Mittei-<br />
DER <strong>SPIEGEL</strong> <strong>42</strong> / <strong>2015</strong><br />
123