EPP 07-08.2016
- Text
- Unternehmen
- Jetter
- Fertigung
- Doris
- Industrie
- Entwicklung
- Anforderungen
- Elektronik
- Produktion
- Systeme
MESSEN + VERANSTALTUNGEN
MESSEN + VERANSTALTUNGEN Christoph Hippin, Endress+Hauser GmbH+Co. KG Effiziente Verarbeitung von Micro- und Macrobauteilen im Reflowprozess Der Vortrag behandelte das Back-Side-Reflow-Verfahren inklusive dem Wärmemanagement, der Bauteilfixierung sowie dem Rework von Macro- bzw. THT-Bauteilen. Die Vorteile des Back-Side-Reflow – auch Löten über Kopf – liegen darin, dass das Pastenvolumen dem Schwerkrafteinfluß folgt und es kein Abtropfen von Lot gibt, die Lötstellen entsprechen der IPC A 610 (Klasse 3). THT-Bauteile müssen keine Reflowtemperaturen aushalten, die eingebrachte Energie wirkt direkt an der Lötstelle. Auch können hohe Füllgrade für z.B. große Pins realisiert werden. Das BSR-Lötprofil ist auch bei Standard-Baugruppen für ein schonendes Löten einsetzbar, das Wiederaufschmelzen der ersten Seite wird verhindert sowie die Unterseitentemperatur begrenzt. Zur Bauelementfixierung empfiehlt der Referent einen UV-Prozess mit einem dualhärtenden Klebstoff für Elektronikanwendungen. Selbst bei Lötung mit einer Reworkstation zeigen BSR-Bauteile ihre Vorteile. Zusammenfassend unterstützt die gemeinsame Verarbeitung von Micro- und Macrobauteilen (THT- Bauteilen) mit dem Back-Side-Reflow-Verfahren in Kombination mit dem UV-Klebeprozess zur Fixierung von Bauteilen sowohl bei der Qualitätssteigerung als auch bei der Kostenreduzierung durch weniger Prozessschritte und durch einen geringeren Einsatz von Betriebsmitteln. Christoph Hippin Dipl.-Inf. (Univ.) Dominik Bösl Foto: Doris Jetter Foto: Doris Jetter Jörg Trodler Dr.-Ing. habil. Heinz Wohlrabe Foto: Doris Jetter Foto: Doris Jetter Jörg Trodler, Heraeus Deutschland GmbH Sprödbruchrisiko an keramischen Bauelementen in Abhängigkeit vom Hochtemperatur-Lotwerkstoff und der Beanspruchungsgeschwindigkeit Zur Einführung wurden Beispiele für Sprödbrüche an keramischen Zweipolern für Test- und Feldbelastungen sowie das Lotkriechen für bleifreie Weichlote SAC 375/305, Innolot und HT1-Lot aufgezeigt. Die Finite Elemente Simulation wurde mit keramischen Chipwiderständen und -kondensatoren mittels Temperaturbelastungen durch Temperaturschock und -wechsel demonstriert. So konnten die Spannungsbeanspruchungen von Zweipolern im Vergleich von SAC, Innolot und HT 1 sowie die Effekte der Zyklusarten dargestellt werden. Innolot zeigt geringe Kriechdehnung, ein typisch besseres Ermüdungsverhalten aber höhere Spannungsbeanspruchung, was sich eventuell als kritisch für keramische Zweipoler erweisen kann. Die Mikrostruktur-abhängige Kriecheigenschaften von Innolot wirken sich auch auf die Beanspruchung der Keramik aus. In beiden Fällen sind die Spannungen deutlich höher als für SAC. Sie unterscheiden sich weniger, als aufgrund der starken Unterschiede in den Kriechgesetzen vermutet wurde. Für HT1 treten deutlich geringere Spannungen auf als für Innolot. Die Spannungsbeanspruchung für HT1 liegt etwas unter der für SAC. Maximale Spannungen entstehen nach Erreichen der unteren Haltetemperatur, maximale Spannungen unterscheiden sich nur unwesentlich für die beiden Rampengeschwindigkeiten in Thermoschock und Thermowechsel. Lange Rampen im Feld verringern Spannungen überproportional für gleiche T-Hübe. Es besteht die Gefahr unterschiedlicher Fehlermodes im Testfeld. Foto: Doris Jetter Foto: Doris Jetter Dipl.-Ing. Wolfgang Motzek Prof. Mathias Nowottnick 62 EPP Juli/August 2016
Foto: Doris Jetter Foto: Doris Jetter Die ca. 115 Teilnehmer nutzten die Pausen für einen umfassenden Erfahrungsaustausch sowie den Besuch der Table-top-Ausstellung. Dipl.-Inf. (Univ.) Dominik Bösl, Kuka AG Zukunft der Robotik und Digitalisierung Der Vortrag behandelte neben Zukunftsstrategien auch bahnbrechende Innovationen. Die einhergehende Veränderung wurde durch die Megatrends aufgezeigt, der Mobilität, der Globalisierung, der globalen Erwärmung, die zu einer abnehmenden Artenvielfalt und extremem Wetter führt und nicht zuletzt der Überalterung unserer Gesellschaft von einem weltweiten jetzigen durchschnittlichen Alter von 27,2 Jahren auf 37,3 Jahren in 2050. Erwähnt wurden auch die Urbanisation, das digitale Leben, die Individualisierung sowie die Gesundheit. So wird die Überalterung in Deutschland – in 2020 werden bereits 50 % der Bevölkerung über 50 Jahre alt sein – wird die Arbeitnehmerstruktur verändern und einen höheren Automatisierungsgrad erfordern. Hier spielt dann die Zukunft der Robotik eine große Rolle, die anhand der Roboterrevolution demonstriert wurde. So ist z. B. der Zusammenbau des Kraftfahrzeugs Ford in der Automobilbranche in 100 Jahren von 90 Minuten auf heute gerade mal 82 Sekunden gesunken. Zukünftig, in der 4. Roboterrevolution, sollen Roboter in der Lage sein, auch Dinge zu tun, wozu sie vorher nicht in der Lage waren und kognitive Eigenschaften erhalten. Stand heute führen Roboter lediglich noch den Mensch unterstützende Arbeiten durch. Mittels einer Forschungs-Roadmap wurde die Umsetzung verdeutlicht. Unsere Enkel werden die Robotic natives, während die heutige Generation eher den Robotic Immigrants entspricht. Laut Bill Gates soll bis 2025 in jeder Wohnung ein Roboter sein. Dr.-Ing. habil. Heinz Wohlrabe, TU Dresden Optimierung der Qualität des SMT-Montageprozesses mittels Simulation Der Vortrag konzentrierte sich auf die geometrische Montagegenauigkeit ohne Betrachtung von Voids, Grabsteinen, Lotperlen, schlechte Benetzung etc. Die aktuellen Herausforderungen für die geometrische Montagegenauigkeit liegen in den kleiner werdenden Strukturen mit größeren Anschlussanzahlen bei teilweise zunehmenden Leiterplattengrößen. Der Redner ging den Fragen nach, ob mit der gegebenen Ausrüstung und Produkt eine ausreichende Montagequalität gefertigt werden kann, was geändert werden muss und welche Anforderungen an das verwendete Material zu stellen sind. Die vorgestellte Simulation ist eine Möglichkeit, um die Montagequalität bei einer SMT-Montage abzuschätzen, dabei ist die Präzision der Ergebnisse abhängig von der Güte der Modellierung und Genauigkeit der benutzten Daten. Es kann nicht alles berücksichtigt werden wie z. B. das Einschwimmen. Die genaue Vorausberechnung der zu erwartenden Fehlerquoten ist nicht machbar, die Tendenzen sind aber zutreffend. Eine Adaption des Systems an zusätzliche Aufgabenstellungen ist umsetzbar. Dipl.-Ing. Wolfgang Motzek, Coronex Electronic Manufacturing Services Counterfeit Electronic Components aus der Sicht eines EMS- Dienstleisters. Counterfeit Electronics erkennen und vermeiden – Beispiele und Lösungsansätze! „The ticking time bomb“ nannte der Referent die steigende Tendenz der Produktpiraterie, die großen Schaden durch Funktionsausfälle hervorrufen kann. Maßnahmen, um Obsolescencen vorzubeugen, finden sich in der sorgfältigen Auswahl der Beschaffungsquellen. Es sollte also bei Originalherstellern, bei authorisierten Distributoren oder bei qualifizierten unabhängigen Distributoren gekauft werden. Bestimmte Beschaffungsanforderungen müssen klar sein, so sorgen Qualitätsmanagement System Audits und / oder Counterfeit Parts Vorbeugungsprozess Audit wie z.B. AS9100 und AS9120 neben der Prüfung des RMA Prozess des Lieferanten und Tools zur Teile Authentifizierung für mehr Sicherheit. Als weiterer Schutz gegen Counterfeits empfiehlt der Referent eine Eingangsprüfung von Verpackung, Füllmaterial, Etiketten, ESD-Schutz, MSL-Level und den Beschriftungen, gefolgt von einer visuellen Inspektion zur Identifizierung u.a. der Art der Komponente, Dimensionen, Anzahl der Anschlüsse, Logo, etc.. Mittels Stereomikroskop sollten u.a. Textur, Anschlussoberflächen, eventuelle Verletzungen des Package unter die Lupe genommen werden. Ein anschließender Acetontest zur Ablösung einer Lackschicht und Beschriftung sollte die Änderung der Textur zeigen. Röntgen, Ultraschall, XRF, Elektrische Tests sowie Freilegen des Chips dürften die letzten Zweifel aus dem Weg räumen. Prof. Mathias Nowottnick, Universität Rostock, IEF/IGS Beschleunigte Alterung – Vergleich aktiver und passiver Zyklentests Der Vortrag basierte größtenteils auf Eigenuntersuchungen und behandelte neben der realen Alterung elektronischer Baugruppen die beschleunigte Alterung durch sowohl erhöhten Temperaturen als auch schnelleren Zyklen oder durch eine aktive Erwärmung. Die Schlussfolgerungen aus den Untersuchungen lies erkennen, dass die obere Temperaturgrenze durch Ausfallmechanismen begrenzt ist, während die untere Temperaturgrenze den Test erheblich verlängert. Die aktiven Power-Zyklen beanspruchen dabei die Lötverbindungen kaum. Eine separate Optimierung des oberen und unteren Haltepunktes ist zu empfehlen. Eine Kombination von aktiven und passiven Zyklen (air/liq) kann den Wechsel verkürzen. (dj) www.wir-gehen-in-die-tiefe.eu EPP Juli/August 2016 63
- Seite 1 und 2:
07/08 2016 EPP Elektronik Produktio
- Seite 3 und 4:
EDITORIAL Vier Jahrzehnte EPP In un
- Seite 5 und 6:
66 Erfolgreich Reworken Ersa Roadsh
- Seite 7 und 8:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN Ersatzteile
- Seite 9 und 10:
„Wer aufhört, deutsche Leiterpla
- Seite 11 und 12: 03/04 2015 SMT Hybrid Packaging Hal
- Seite 13 und 14: DANKE für Ihre Treue - auf viele w
- Seite 15 und 16: „Ich lese die EPP … … weil ic
- Seite 17 und 18: EPP Juli/August 2016 17
- Seite 19 und 20: 1989 entwickelte LPKF Prototypingve
- Seite 21 und 22: Ein Partner Systeme | Dienstleistun
- Seite 23 und 24: DAGE X-ray 4K High Resolution Manua
- Seite 25 und 26: Foto: Reinhardt System- und Messele
- Seite 27 und 28: Selektivlötanlagen? Ersa! Weltweit
- Seite 29 und 30: Das in Balingen angesiedelte Untern
- Seite 31 und 32: Steigern Sie Ihre Zuverlässigkeit,
- Seite 33 und 34: Der Betriebsrundgang in der Fertigu
- Seite 35 und 36: Our Team. Our Spirit. Your Success.
- Seite 37 und 38: ADVERTORIAL Dampfphase Inline - ech
- Seite 39 und 40: ADVERTORIAL Rehm bietet Lösungen r
- Seite 41 und 42: Besuchen Sie uns: SMT, Halle 7, Sta
- Seite 43 und 44: ADVERTORIAL Besonders leistungsstar
- Seite 45 und 46: SO GEHT Ein Auftakt mit Torte In di
- Seite 47 und 48: der Mitte des vergangenen Jahrhunde
- Seite 49 und 50: ADVERTORIAL EPP Juli/August 2016 49
- Seite 51 und 52: Über 120 Delegierte aus Ostdeutsch
- Seite 53 und 54: Unsere Medienmarken Das Kompetenz-
- Seite 55 und 56: Prof. Dr. Artem Ivanov, Hochschule
- Seite 57 und 58: Rahmen des BFS-Forschungsprojekts V
- Seite 59 und 60: lid-State Lighting Messungen. Im Ze
- Seite 61: Die Umsetzung einer Smart SMT-Ferti
- Seite 65 und 66: last a long time Camalot ® | Dis
- Seite 67 und 68: AUS IHRER SICHT, IST ES VIEL GRÖß
- Seite 69 und 70: TITEL VTQ Videotronik hat sich als
- Seite 71 und 72: „Wir haben neben dem Benchmark au
- Seite 73 und 74: Prüfung in eigenen Hochfrequenz- S
- Seite 75 und 76: Foto: Ersa Nah am Kunden, nah am Th
- Seite 77 und 78: PRODUKT NEWS Kratzfreie Kontaktieru
- Seite 79 und 80: Die gesamte Raumklimatisierung wird
- Seite 81 und 82: PRODUKT NEWS Foto: bebro electronic
- Seite 83 und 84: Unterstützung für die Vereinzelun
- Seite 85 und 86: len Wert hat, müssen alle gesammel
- Seite 87 und 88: PRODUKT NEWS Wärmeableitung und Um
- Seite 89 und 90: Ein großes Modernisierungsprojekt
- Seite 91 und 92: Steckverbinder für automatisches R
- Seite 93 und 94: Foto: Tanaka Precious Metals Neue T
- Seite 95 und 96: Das Unternehmen ist seinen Marktbeg
- Seite 97 und 98: Kleben und kleben lassen Nicht auf
- Seite 99 und 100: Heiß geliebt Foto: MCD Elektronik
- Seite 101 und 102: Foto: Creaform Foto: Creaform Von e
- Seite 103 und 104: Highend-Bildverarbeitungsplattform
- Seite 105 und 106: EPP präsentiert Ihnen „Kompetenz
- Seite 107 und 108: Das Stellen-Portal für Ihren Erfol
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...


























































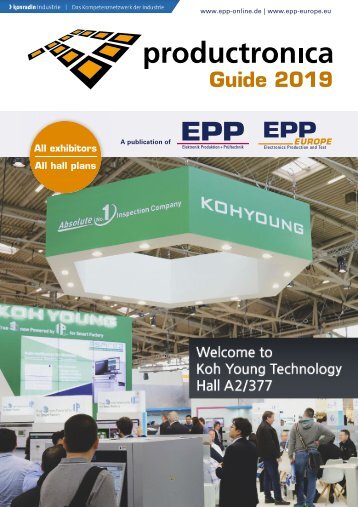
Twitter