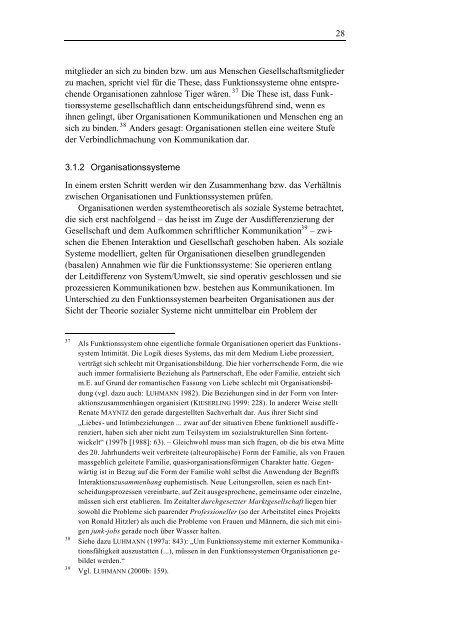Steuerung sozialer Systeme - Konstantin Bähr
Steuerung sozialer Systeme - Konstantin Bähr
Steuerung sozialer Systeme - Konstantin Bähr
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
mitglieder an sich zu binden bzw. um aus Menschen Gesellschaftsmitglieder<br />
zu machen, spricht viel für die These, dass Funktionssysteme ohne entsprechende<br />
Organisationen zahnlose Tiger wären. 37 Die These ist, dass Funktionssysteme<br />
gesellschaftlich dann entscheidungsführend sind, wenn es<br />
ihnen gelingt, über Organisationen Kommunikationen und Menschen eng an<br />
sich zu binden. 38 Anders gesagt: Organisationen stellen eine weitere Stufe<br />
der Verbindlichmachung von Kommunikation dar.<br />
3.1.2 Organisationssysteme<br />
In einem ersten Schritt werden wir den Zusammenhang bzw. das Verhältnis<br />
zwischen Organisationen und Funktionssystemen prüfen.<br />
Organisationen werden systemtheoretisch als soziale <strong>Systeme</strong> betrachtet,<br />
die sich erst nachfolgend – das heisst im Zuge der Ausdifferenzierung der<br />
Gesellschaft und dem Aufkommen schriftlicher Kommunikation 39 – zwischen<br />
die Ebenen Interaktion und Gesellschaft geschoben haben. Als soziale<br />
<strong>Systeme</strong> modelliert, gelten für Organisationen dieselben grundlegenden<br />
(basalen) Annahmen wie für die Funktionssysteme: Sie operieren entlang<br />
der Leitdifferenz von System/Umwelt, sie sind operativ geschlossen und sie<br />
prozessieren Kommunikationen bzw. bestehen aus Kommunikationen. Im<br />
Unterschied zu den Funktionssystemen bearbeiten Organisationen aus der<br />
Sicht der Theorie <strong>sozialer</strong> <strong>Systeme</strong> nicht unmittelbar ein Problem der<br />
37 Als Funktionssystem ohne eigentliche formale Organisationen operiert das Funktionssystem<br />
Intimität. Die Logik dieses Systems, das mit dem Medium Liebe prozessiert,<br />
verträgt sich schlecht mit Organisationsbildung. Die hier vorherrschende Form, die wie<br />
auch immer formalisierte Beziehung als Partnerschaft, Ehe oder Familie, entzieht sich<br />
m.E. auf Grund der romantischen Fassung von Liebe schlecht mit Organisationsbildung<br />
(vgl. dazu auch: LUHMANN 1982). Die Beziehungen sind in der Form von Interaktionszusammenhängen<br />
organisiert (KIESERLING 1999: 228). In anderer Weise stellt<br />
Renate MAYNTZ den gerade dargestellten Sachverhalt dar. Aus ihrer Sicht sind<br />
„Liebes- und Intimbeziehungen ... zwar auf der situativen Ebene funktionell ausdifferenziert,<br />
haben sich aber nicht zum Teilsystem im sozialstrukturellen Sinn fortentwickelt“<br />
(1997b [1988]: 63). – Gleichwohl muss man sich fragen, ob die bis etwa Mitte<br />
des 20. Jahrhunderts weit verbreitete (alteuropäische) Form der Familie, als von Frauen<br />
massgeblich geleitete Familie, quasi-organisationsförmigen Charakter hatte. Gegenwärtig<br />
ist in Bezug auf die Form der Familie wohl selbst die Anwendung der Begriffs<br />
Interaktionszusammenhang euphemistisch. Neue Leitungsrollen, seien es nach Entscheidungsprozessen<br />
vereinbarte, auf Zeit ausgesprochene, gemeinsame oder einzelne,<br />
müssen sich erst etablieren. Im Zeitalter durchgesetzter Marktgesellschaft liegen hier<br />
sowohl die Probleme sich paarender Professioneller (so der Arbeitstitel eines Projekts<br />
von Ronald Hitzler) als auch die Probleme von Frauen und Männern, die sich mit einigen<br />
junk-jobs gerade noch über Wasser halten.<br />
38 Siehe dazu LUHMANN (1997a: 843): „Um Funktionssysteme mit externer Kommunikationsfähigkeit<br />
auszustatten (...), müssen in den Funktionssystemen Organisationen gebildet<br />
werden.“<br />
39 Vgl. LUHMANN (2000b: 159).<br />
28