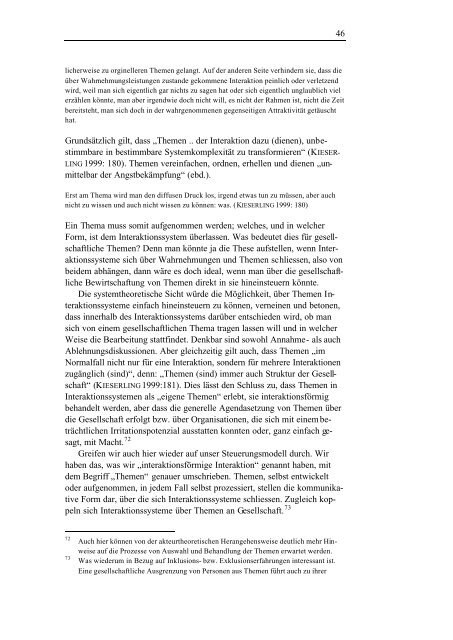Steuerung sozialer Systeme - Konstantin Bähr
Steuerung sozialer Systeme - Konstantin Bähr
Steuerung sozialer Systeme - Konstantin Bähr
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
licherweise zu orginelleren Themen gelangt. Auf der anderen Seite verhindern sie, dass die<br />
über Wahrnehmungsleistungen zustande gekommene Interaktion peinlich oder verletzend<br />
wird, weil man sich eigentlich gar nichts zu sagen hat oder sich eigentlich unglaublich viel<br />
erzählen könnte, man aber irgendwie doch nicht will, es nicht der Rahmen ist, nicht die Zeit<br />
bereitsteht, man sich doch in der wahrgenommenen gegenseitigen Attraktivität getäuscht<br />
hat.<br />
Grundsätzlich gilt, dass „Themen .. der Interaktion dazu (dienen), unbestimmbare<br />
in bestimmbare Systemkomplexität zu transformieren“ (KIESER-<br />
LING 1999: 180). Themen vereinfachen, ordnen, erhellen und dienen „unmittelbar<br />
der Angstbekämpfung“ (ebd.).<br />
Erst am Thema wird man den diffusen Druck los, irgend etwas tun zu müssen, aber auch<br />
nicht zu wissen und auch nicht wissen zu können: was. (KIESERLING 1999: 180)<br />
Ein Thema muss somit aufgenommen werden; welches, und in welcher<br />
Form, ist dem Interaktionssystem überlassen. Was bedeutet dies für gesellschaftliche<br />
Themen? Denn man könnte ja die These aufstellen, wenn Interaktionssysteme<br />
sich über Wahrnehmungen und Themen schliessen, also von<br />
beidem abhängen, dann wäre es doch ideal, wenn man über die gesellschaftliche<br />
Bewirtschaftung von Themen direkt in sie hineinsteuern könnte.<br />
Die systemtheoretische Sicht würde die Möglichkeit, über Themen Interaktionssysteme<br />
einfach hineinsteuern zu können, verneinen und betonen,<br />
dass innerhalb des Interaktionssystems darüber entschieden wird, ob man<br />
sich von einem gesellschaftlichen Thema tragen lassen will und in welcher<br />
Weise die Bearbeitung stattfindet. Denkbar sind sowohl Annahme- als auch<br />
Ablehnungsdiskussionen. Aber gleichzeitig gilt auch, dass Themen „im<br />
Normalfall nicht nur für eine Interaktion, sondern für mehrere Interaktionen<br />
zugänglich (sind)“, denn: „Themen (sind) immer auch Struktur der Gesellschaft“<br />
(KIESERLING 1999:181). Dies lässt den Schluss zu, dass Themen in<br />
Interaktionssystemen als „eigene Themen“ erlebt, sie interaktionsförmig<br />
behandelt werden, aber dass die generelle Agendasetzung von Themen über<br />
die Gesellschaft erfolgt bzw. über Organisationen, die sich mit einem beträchtlichen<br />
Irritationspotenzial ausstatten konnten oder, ganz einfach gesagt,<br />
mit Macht. 72<br />
Greifen wir auch hier wieder auf unser <strong>Steuerung</strong>smodell durch. Wir<br />
haben das, was wir „interaktionsförmige Interaktion“ genannt haben, mit<br />
dem Begriff „Themen“ genauer umschrieben. Themen, selbst entwickelt<br />
oder aufgenommen, in jedem Fall selbst prozessiert, stellen die kommunikative<br />
Form dar, über die sich Interaktionssysteme schliessen. Zugleich koppeln<br />
sich Interaktionssysteme über Themen an Gesellschaft. 73<br />
72 Auch hier können von der akteurtheoretischen Herangehensweise deutlich mehr Hinweise<br />
auf die Prozesse von Auswahl und Behandlung der Themen erwartet werden.<br />
73 Was wiederum in Bezug auf Inklusions- bzw. Exklusionserfahrungen interessant ist.<br />
Eine gesellschaftliche Ausgrenzung von Personen aus Themen führt auch zu ihrer<br />
46