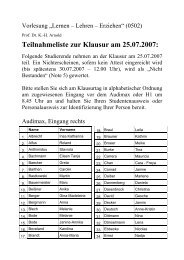Mediale-Schatten_Moving-shadows fertige lit.liste.indd - Universität ...
Mediale-Schatten_Moving-shadows fertige lit.liste.indd - Universität ...
Mediale-Schatten_Moving-shadows fertige lit.liste.indd - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abb. 4: René Magritte: „Die<br />
unmögliche Reproduktion.“<br />
1937-1939, Maße: 81,3x65 cm<br />
Abb. 5: René Magritte: „Das<br />
Prinzip der Unsicherheit“<br />
1944, Maße: 65x51 cm<br />
In einem anderen Werk, „Der Salon Gottes“<br />
von 1958 versucht er die umgekehrte Wirkung<br />
durch einen Nachthimmel gekoppelt mit<br />
sonniger Landschaft zu erzeugen. Hierzu findet<br />
sich ein Zitat von Ihm selber: „Ich kann mir eine<br />
besonnte Landschaft unter nächtlichem Himmel<br />
denken, sie aber zu sehen und in Malerei<br />
umzusetzen: nur einem Gott ist das möglich. In<br />
der Erwartung, einer zu werden, lasse ich das<br />
Projekt fallen…“ (Torczyner, 1977, S. 179). In<br />
der Tat lässt sich der Widerspruch nicht lösen<br />
- unsere Seherfahrung findet kein Äquivalent,<br />
auch nicht teilweise, für die dargestellte Situation.<br />
„Die unmögliche Reproduktion“ (Abb. 4) zeigt<br />
einen Mann in Rückenansicht, der schräg vor<br />
einem Spiegel steht. Entgegen der erwarteten<br />
Ansicht erblickt man im Spiegel dieselbe<br />
Rückenansicht und nicht die Vorderansicht von<br />
ihm. Magrittes Malstil ist hier auch wieder sehr<br />
sachlich und naturalistisch. Uns beunruhigt jedoch<br />
die falsche Spiegelansicht, wir können das<br />
Gesicht des Mannes nicht sehen. Magritte gibt<br />
seinen Bildern eine innere Spannung durch das<br />
Fehlen von Deutungsansätzen. Nach Magritte<br />
sind seine Arbeiten erst dann erfolgreich, wenn<br />
keine Erklärung die Neugierde des Betrachters<br />
befriedigen kann. Die innere Unruhe ist ebenfalls<br />
notwendig, um zum Denken angeregt<br />
zu werden. „Wer in der Malerei nur das sucht,<br />
was er zu finden wünscht, wird niemals etwas<br />
finden, dass über seinen Wunsch hinausgeht.<br />
Wenn aber jemand einmal vom Geheimnis<br />
eines Bildes, das sich jeder Erklärung widersetzt,<br />
eingefangen wird, kann zuweilen ein Augenblick<br />
der Panik eintreten. Diese Augenblicke der<br />
Panik sind es, die für Magritte zählen. Für ihn<br />
sind sie die besten, weil sie aus dem Mittelmäßigen<br />
hinausführen.“ (Gablik, 1971, S.10.). Deutlich<br />
wird hierbei bereits, dass Magritte keine<br />
Interpretation seines Bildes haben möchte, so<br />
dass man zu einem abschließenden Ergebnis<br />
kommt, vielmehr soll man rätseln ohne zu<br />
einem Ende oder einer Lösung zu gelangen<br />
und die Neugierde des Betrachters soll nicht<br />
verloren gehen (siehe oben).<br />
Auf dem Bild „Das Prinzip der Unsicherheit“<br />
(Abb. 5) von 1944 sieht man eine Frau, die vor<br />
einer Wand steht und stark angeleuchtet wird.<br />
Ein Vorhang verstärkt die Bühnensituatuion.<br />
Doch an Stelle ihres eigenen <strong>Schatten</strong>s wirft sie<br />
den eines Vogels mit ausgebreiteten Flügeln<br />
an die Wand. Magritte entfremdet die Situation<br />
erneut mit „einfachsten“ Mitteln. Seine naturalistische<br />
Malweise macht uns die abgebildeten<br />
Gegenstände sehr vertraut. Man muss sich nun<br />
entscheiden: ist entweder die Frau real und der<br />
<strong>Schatten</strong> Illusion, oder ist es doch umgekehrt.<br />
Natürlich meint Magritte damit auch die „echte“<br />
Umwelt. Stellt man sich hier die Frage, gelangt<br />
man zu Überlegungen nach Manipulation und<br />
Rea<strong>lit</strong>ät. In diesem Fall macht uns die gezeigte<br />
Bühnensituation den Gegenstand jedoch<br />
scheinbar einfach. Das Prinzip der Unsicherheit<br />
33<br />
zwischen Körper, Körpergefühl, Abbild und Betrachterposition<br />
kann nicht aufgelöst werden.<br />
Bezogen auf den <strong>Schatten</strong> ist in weiterem Sinne<br />
dessen Nicht-Rea<strong>lit</strong>ät fe4stzuhalten, denn man<br />
kann ihn nicht wie den Gegenstand, von dem<br />
er ausgeht, anfassen und benutzen. Weiter<br />
existiert er nur in Verbindung mit dem Gegenstand<br />
und einer Lichtquelle und kann manipuliert<br />
werden, indem man diese Lichtquelle<br />
verändert. Der <strong>Schatten</strong> kann andere Formen<br />
und Gestalten annehmen, indem man z. B. den<br />
Lichteinfall variiert (bei tragbarer Lichtquelle)<br />
und somit den <strong>Schatten</strong> „streckt“ oder „kürzt“<br />
und weiter kann man den Gegenstand selber<br />
in einem anderen Winkel dem Licht aussetzen<br />
(vergleiche <strong>Schatten</strong>spiel mit den Fingern).<br />
Magrittes Bilder sind ähnlich zu lesen. Seine<br />
Abbilder sind ebenfalls nicht real, sie bilden einen<br />
Gegenstand nach aber sind nicht identisch<br />
mit dem Original, denn auch das Abbild kann<br />
man nicht anfassen und benutzen, gleich dem<br />
<strong>Schatten</strong>. Sie sind unerreichbar für uns und<br />
Magritte manipuliert sie weiter, nicht durch<br />
eine Lichtquelle, aber durch seine Anordnung<br />
im Bild. Bezogen auf Plinius und dem „Mythos<br />
von der Erfindung der Malerei“ stellt Magritte<br />
ebenfalls die Frage nach dem Ursprung des<br />
Abbildes, handelt es sich doch auch hier um die<br />
zweidimensionale Abbildung eines<br />
dreidimensionalen Vorganges.<br />
Francis Bacon<br />
Francis Bacon ist am 28. Oktober 1898 in<br />
Belgien geboren. Er hat vor allem großformatige<br />
Ölgemälde hergestellt, die in Goldrahmen<br />
hinter Glas präsentiert werden. Finden sich bei<br />
Magritte noch realistische Darstellungen der<br />
Gegenstände sind diese bei Bacon undeutlich,<br />
bizarr und verschwommen. Er manipuliert den<br />
Raum, indem er ihn meist stark einschränkt<br />
und das Gefühl erzeugt es existieren mehrere<br />
Räume gleichzeitig, die ähnlich der Figuren,<br />
miteinander verbunden sind und sich im selben<br />
Atemzug duellieren. Den größten Einfluss auf<br />
sein Werk hatte wohl die Fotografie, wobei<br />
Bacons Interesse hier in der Bewegung liegt,<br />
insbesondere der Bewegung des Menschen.<br />
Wie in einem Filmabspann isoliert er die<br />
einzelnen Bewegungen, doch entgegen der<br />
aufeinander folgenden Bilder im Film setzte er<br />
sie übereinander und lässt sie zu etwas Neuem<br />
zusammenfließen, wobei er zum Teil einzelne<br />
Sequenzen einer Bewegung weglässt. „Diese<br />
Gleichzeitigkeit der eigentlich nacheinander<br />
vollzogenen Bewegungen konfrontiert den<br />
Betrachter mit einem unlösbaren Widerspruch,<br />
woraus Irritation erfolgt.“ (Schmied, 1985. S.<br />
50/51.).<br />
Die Bewegung innerhalb der Bildern steht für<br />
das menschliche Leben und dessen Spuren, die<br />
hinterlassen werden, Bacon nennt es Erinnerungsspur.<br />
„Ich möchte, dass meine Bilder<br />
so aussehen, als sei ein menschliches Wesen<br />
durch sie hindurchgegangen, wie eine Schne-