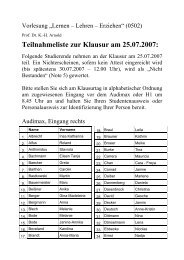Mediale-Schatten_Moving-shadows fertige lit.liste.indd - Universität ...
Mediale-Schatten_Moving-shadows fertige lit.liste.indd - Universität ...
Mediale-Schatten_Moving-shadows fertige lit.liste.indd - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abbildungen<br />
René Magritte: “Ceci n´est pas<br />
une pipe.” 1928-1929,<br />
Maße: 59x80 cm (aus: Torc<br />
zyner, Harry: René Magritte:<br />
Zeichen und Bilder. DuMont<br />
Buchverlag Köln, 1977. Seite<br />
119. Tafel 206.)<br />
RenéMagritte: „Das Reich der<br />
Lichter“ 1950, Maße: 79x99<br />
cm<br />
(aus: Torczyner, Harry: René<br />
Magritte: Zeichen und Bil<br />
der. DuMont Buchverlag<br />
Köln, 1977. Seite 177. Tafel<br />
382.)<br />
René Magritte: „Der Salon Got<br />
tes.“ 1958, Maße: 43x59 cm<br />
(aus: Torczyner, Harry: René<br />
Magritte: Zeichen und Bil<br />
der. DuMont Buchverlag<br />
Köln, 1977. Seite 181. Tafel<br />
391.)<br />
RenéMagritte: „Die unmögliche<br />
Reproduktion.“ 1937-1939,<br />
Maße: 81,3x65 cm (aus:<br />
Torczyner, Harry: René<br />
Magritte: Zeichen und Bil<br />
der. DuMont Buchverlag<br />
Köln, 1977. Seite 55. Tafel<br />
74.)<br />
René Magritte: „Das Prinzip<br />
der Unsicherheit“ 1944,<br />
Maße: 65x51 cm (aus: Torc<br />
zyner, Harry: René Magritte:<br />
Zeichen und Bilder. DuMont<br />
Buchverlag Köln, 1977. Seite<br />
159. Tafel 326.)<br />
Francis Bacon: „Mann<br />
mit Hund.“, 1953, Maße:<br />
152,5x117 cm, (aus: Schnei<br />
der, Helmut: Francis Bacon.<br />
Meine Bilder. Prestel Verlag,<br />
München 1983. Tafel 12.)<br />
Francis Bacon: „Triptychon von<br />
1972“, Maße: 198x147,5<br />
cm, (aus: Leiris, Michael:<br />
Francis Bacon. Full face<br />
and in profile. Phaidon Ver<br />
lag, Oxford 1983. Tafel 89.)<br />
Francis Bacon: „Kopf I“, 1948,<br />
Maße: 103x75 cm<br />
(aus: Schneider, Helmut:<br />
Francis Bacon. Meine Bilder.<br />
Prestel Verlag, München<br />
1983. Tafel 51.)<br />
oder jenen auf der Kontur lokalisierten Punkt<br />
entwichen ist.“ (Deleuze, 1995. S. 17).<br />
Neben dem Aspekt des „fleischgewordenen“<br />
<strong>Schatten</strong>s gibt es bei Bacon noch seine Figuren,<br />
die nur noch ein <strong>Schatten</strong> eines menschlichen<br />
Lebewesens sind. Er reduziert z. B. beim „Kopf I“<br />
(Abb. 8) aus dem Jahre 1948 den Schrei eines<br />
Menschen auf das Wesentliche und Markante,<br />
nämlich den Mund. Die Gestalt selber können<br />
wir nur noch erahnen und uns vorstellen, wie<br />
die Person beim Schrei den Kopf in den Nacken<br />
wirft, denn diese Bewegung stellt Bacon unscharf<br />
dar. Das einzige was gut und deutlich<br />
erkennbar ist, ist der Mund der Gestalt, doch<br />
erinnert dieser durch die langen und scharfen<br />
Eckzähne eher an ein Tier und tatsächlich hat<br />
er für diese als Vorlage die Zähne eines Schimpansen<br />
verwendet. Wie oben bereits erwähnt<br />
unterschied Bacon nicht immer differenziert<br />
zwischen Mensch und Tier.<br />
Es ist möglich, dass Bacon sich von den Texten<br />
Batailles inspirieren ließ, der schreibt in seinem<br />
„Kritischen Wörterbuch“: „Bei großen Ereignissen<br />
konzentriert sich das menschliche Leben<br />
ganz tierisch auf den Mund; der Zorn lässt<br />
einen die Zähne zusammenbeißen, die Angst<br />
oder fürchterliches Leiden machen den Mund<br />
zum Organ gellender Schreie. Es lässt sich dabei<br />
leicht beobachten, dass der Betroffene seinen<br />
Hals reckt, seinen Kopf ungestüm zurückwirft,<br />
so dass der Mund, soweit dies möglich ist,<br />
an eine Stelle gerät, die einer Fortsetzung des<br />
Rückgrats gleichkommt, mit anderen Worten<br />
in die Position, in der er sich normalerweise bei<br />
Tieren befindet.“ (Stuttgart und Berlin, 1985. S.<br />
13). Bacon anonymisiert die Personen durch<br />
seine Darstellungsweise, manchmal kann man<br />
nicht mehr zwischen Mann und Frau differenzieren.<br />
Die Gestalten scheinen in ihrer Pein<br />
gefangen auf der Schwelle zwischen dieser<br />
(unserer) Welt und dem Leben nach dem Tode<br />
zu stehen. Es ist ein idealer, quälenden Schrei<br />
durch Bacons abstrakte Darstellungsweise seinem<br />
Wesen gemäß umgesetzt. Die Darstellung<br />
erschüttert mehr als ein Foto von einem schreienden<br />
Menschen, vielleicht liegt das Geheimnis<br />
in dem Verschwommenen bei Bacon. Durch<br />
das Anonyme schreit nicht ein bestimmter<br />
Mensch, sondern es wirkt wie der personifizierte<br />
Schrei selber. Man spürt den Schrei und den<br />
Schmerz regelrecht. In dieser Qual unterscheidet<br />
sich der Mensch nicht mehr vom Tier.<br />
„Das gewaltsame Zusammenbringen von<br />
Mensch/Tier in einer Weise, die den herkömmlichen<br />
Unterschied zwischen beiden in Frage<br />
stellt, war Teil von Batailles fortwährenden Angriffen<br />
auf die „idealistische Selbsttäuschung“,<br />
die der Mensch an sich verübt. In diesem Fall<br />
geht es um die Enthüllung des Tierischen oder<br />
Fast-Tierischen im Menschen, vor allem in<br />
Situationen, in denen er glaubt, sich von seiner<br />
menschlichsten oder edelsten Seite zu zeigen.“<br />
(Stuttgart und Berlin, 1985. Seite 14).<br />
35<br />
Abb. 8: Francis Bacon: „Kopf I“, 1948, Maße:<br />
103x75 cm