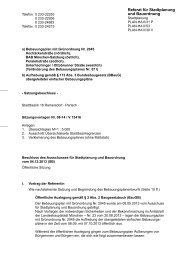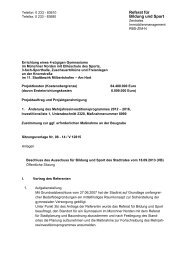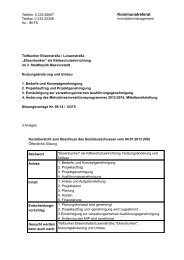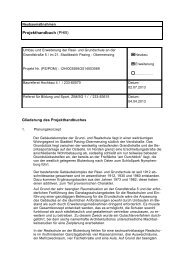Anlage 1 - RIS
Anlage 1 - RIS
Anlage 1 - RIS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2. Berechnung der Kaufkraft des Regelsatzes<br />
2.1 Grundsätzliches zum Begriff „Kaufkraft“<br />
Was ist mit dem Begriff „Kaufkraft“ genau gemeint? Das Wort „Kaufkraft“ wird durchaus<br />
unterschiedlich benutzt und weist definitorische Unschärfen auf, die zu Mehrdeutigkeiten<br />
führen können. 3 Im Folgenden werden daher die unterschiedlichen<br />
Gebrauchsweisen des Begriffes „Kaufkraft“ erläutert, nicht zuletzt, um eine terminologische<br />
Klarheit zu erreichen. 4<br />
In Pressemeldungen wie „Kaufkraft in Bayern Spitze“ oder „Kaufkraft wird 2012 stagnieren“<br />
werden zwei unterschiedliche Definitionen vermengt:<br />
(1) Einmal ist davon die Rede, dass „jedem Bundesbürger im Durchschnitt 20.014<br />
Euro für Konsum, Miete oder anderen Lebenshaltungskosten zur Verfügung<br />
stehen (2012)“. Gemeint ist hier demnach i. S. der Marktbeobachtung „Kaufkraft“<br />
als möglicher Konsum von Verbrauchern.<br />
(2) Dieser inzwischen allgemeine Sprachgebrauch entspricht aber nicht der bisherigen<br />
ökonomischen Bedeutung des Begriffs: „Kaufkraft“ wird gebraucht in der<br />
Bedeutung der „Kaufkraft des Geldes“. „Kaufkraft ist der Maßstab für den Wert<br />
des Geldes. Die Kaufkraft des Geldes gibt an, welche Gütermenge mit einer<br />
Geldeinheit oder einem bestimmten Geldbetrag gekauft werden kann.“ 5 Die<br />
vorliegende Untersuchung arbeitet ausschließlich mit dieser Bedeutung des<br />
Begriffs „Kaufkraft“.<br />
Die Veränderung der „Kaufkraft“ wird monatlich durch den vom Statistischen Bundesamt<br />
ermittelten Verbraucherpreisindex („Inflationsrate“) gemessen. Zusätzlich zu<br />
dieser zeitlichen Veränderung der Kaufkraft des Geldes existieren in Deutschland –<br />
wie in anderen Staaten – recht starke regionale Unterschiede der „Kaufkraft“.<br />
In der Alltagssprache wird die Frage „Wie viel ist der Lohn wert?“ durch die Worte wie<br />
„teure Stadt“ oder „teure Gegend“ ausgedrückt. Dahinter steckt die Erfahrung, dass<br />
3<br />
Vgl. Kohlhuber, Franz (2000): Wirtschaftskraft und Kaufkraftdisparität in Bayern. Utz Verlag, München,<br />
S. 3 ff.<br />
4<br />
Fürst, Gerhard (1976): Überblick über die Aufgaben und Probleme der Kaufkraftmessung. In: Messung<br />
der Kaufkraft des Geldes, Gerhard Fürst (Hrsg.), Allgemeines statistisches Archiv, Sonderheft<br />
Bd. 10, S. 5-22.<br />
5<br />
Duden Wirtschaft von A bis Z (2009). Bibliographisches Institut, 4. Aufl., Mannheim<br />
6