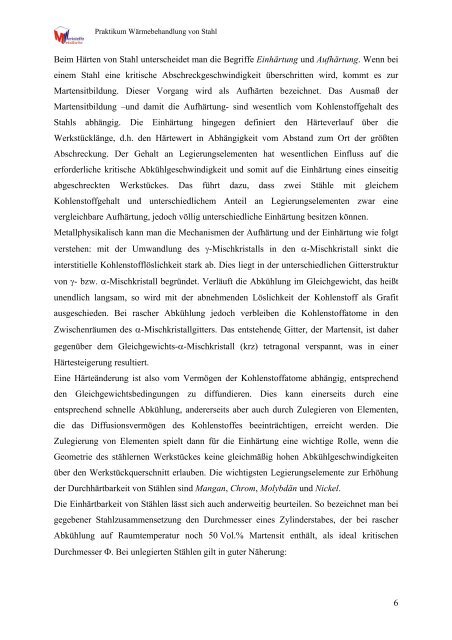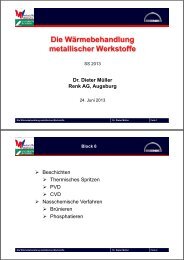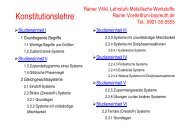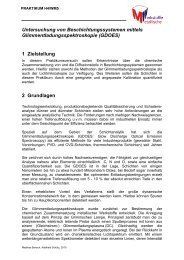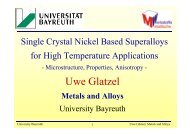Wärmebehandlung von Stahl - Stirnabschreckversuch nach DIN EN ...
Wärmebehandlung von Stahl - Stirnabschreckversuch nach DIN EN ...
Wärmebehandlung von Stahl - Stirnabschreckversuch nach DIN EN ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Praktikum <strong>Wärmebehandlung</strong> <strong>von</strong> <strong>Stahl</strong><br />
Beim Härten <strong>von</strong> <strong>Stahl</strong> unterscheidet man die Begriffe Einhärtung und Aufhärtung. Wenn bei<br />
einem <strong>Stahl</strong> eine kritische Abschreckgeschwindigkeit überschritten wird, kommt es zur<br />
Martensitbildung. Dieser Vorgang wird als Aufhärten bezeichnet. Das Ausmaß der<br />
Martensitbildung –und damit die Aufhärtung- sind wesentlich vom Kohlenstoffgehalt des<br />
<strong>Stahl</strong>s abhängig. Die Einhärtung hingegen definiert den Härteverlauf über die<br />
Werkstücklänge, d.h. den Härtewert in Abhängigkeit vom Abstand zum Ort der größten<br />
Abschreckung. Der Gehalt an Legierungselementen hat wesentlichen Einfluss auf die<br />
erforderliche kritische Abkühlgeschwindigkeit und somit auf die Einhärtung eines einseitig<br />
abgeschreckten Werkstückes. Das führt dazu, dass zwei Stähle mit gleichem<br />
Kohlenstoffgehalt und unterschiedlichem Anteil an Legierungselementen zwar eine<br />
vergleichbare Aufhärtung, jedoch völlig unterschiedliche Einhärtung besitzen können.<br />
Metallphysikalisch kann man die Mechanismen der Aufhärtung und der Einhärtung wie folgt<br />
verstehen: mit der Umwandlung des γ-Mischkristalls in den α-Mischkristall sinkt die<br />
interstitielle Kohlenstofflöslichkeit stark ab. Dies liegt in der unterschiedlichen Gitterstruktur<br />
<strong>von</strong> γ- bzw. α-Mischkristall begründet. Verläuft die Abkühlung im Gleichgewicht, das heißt<br />
unendlich langsam, so wird mit der abnehmenden Löslichkeit der Kohlenstoff als Grafit<br />
ausgeschieden. Bei rascher Abkühlung jedoch verbleiben die Kohlenstoffatome in den<br />
Zwischenräumen des α-Mischkristallgitters. Das entstehende Gitter, der Martensit, ist daher<br />
gegenüber dem Gleichgewichts-α-Mischkristall (krz) tetragonal verspannt, was in einer<br />
Härtesteigerung resultiert.<br />
Eine Härteänderung ist also vom Vermögen der Kohlenstoffatome abhängig, entsprechend<br />
den Gleichgewichtsbedingungen zu diffundieren. Dies kann einerseits durch eine<br />
entsprechend schnelle Abkühlung, andererseits aber auch durch Zulegieren <strong>von</strong> Elementen,<br />
die das Diffusionsvermögen des Kohlenstoffes beeinträchtigen, erreicht werden. Die<br />
Zulegierung <strong>von</strong> Elementen spielt dann für die Einhärtung eine wichtige Rolle, wenn die<br />
Geometrie des stählernen Werkstückes keine gleichmäßig hohen Abkühlgeschwindigkeiten<br />
über den Werkstückquerschnitt erlauben. Die wichtigsten Legierungselemente zur Erhöhung<br />
der Durchhärtbarkeit <strong>von</strong> Stählen sind Mangan, Chrom, Molybdän und Nickel.<br />
Die Einhärtbarkeit <strong>von</strong> Stählen lässt sich auch anderweitig beurteilen. So bezeichnet man bei<br />
gegebener <strong>Stahl</strong>zusammensetzung den Durchmesser eines Zylinderstabes, der bei rascher<br />
Abkühlung auf Raumtemperatur noch 50 Vol.% Martensit enthält, als ideal kritischen<br />
Durchmesser Φ. Bei unlegierten Stählen gilt in guter Näherung:<br />
6