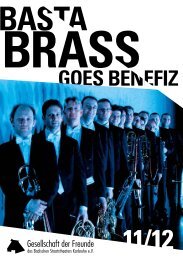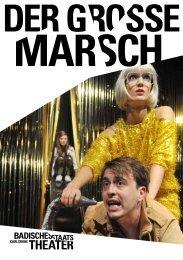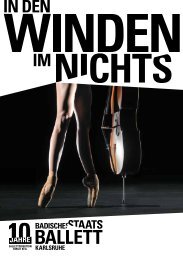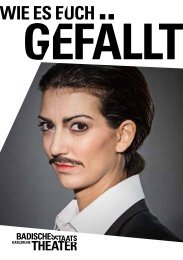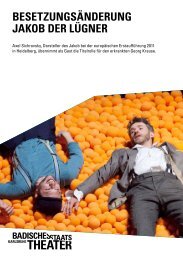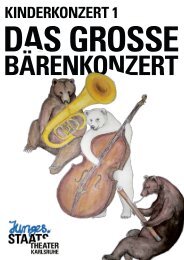Programmheft - Badisches Staatstheater Karlsruhe
Programmheft - Badisches Staatstheater Karlsruhe
Programmheft - Badisches Staatstheater Karlsruhe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Landsknechts verdichteten.“ So lassen<br />
sich die rhythmischen Grundstrukturen in<br />
Mahlers Liedern klar in Tanz- und Militärrhythmen<br />
unterteilen. Der Musikwissenschaftler<br />
Siegfried Mauser unterscheidet<br />
im Weiteren zwischen verschiedenen<br />
Kompositionstypen, durch die sich die<br />
einzelnen Vertonungen voneinander abheben:<br />
Gehlieder, Drehlieder sowie deren<br />
Mischform. Unter der Gruppe „Gehlieder“<br />
sind jene Werke aus Mahlers Liedœuvre<br />
gemeint, „deren hervorragendes Charakteristikum<br />
jenes des Fortbewegens ist. Sie<br />
lassen sich dabei zusätzlich nach der Art<br />
der Fortbewegung weiter unterscheiden<br />
in marschierende, wandernde, reitende<br />
sowie der besondere Typus des Trauermarsches.“<br />
Die Drehbewegung untermalt<br />
die Singstimme im Dreiertakt, meist in Anlehnung<br />
an Ländler und Walzer (rheinlegendchen,<br />
Wer hat dies Liedlein erdacht).<br />
Wo die schönen trompeten blasen ist eine<br />
Mischform dieser beiden für Mahler so<br />
charakteristischen Kompositionstypen.<br />
Man erkennt einen deutlichen „ziel- und<br />
vorwärts gerichteten Charakter“ sowie<br />
eine „auf sich selbst bezogene und in sich<br />
kreisenden Figuration.“<br />
Im rheinlegendchen ist in strahlendem<br />
A-Dur die Liebesthematik äußerst klar<br />
artikuliert. Nicht zufällig fühlt man hier<br />
an Schubert erinnert, sei es der frühlingstraum<br />
der Winterreise oder die<br />
Wassermotivik der Schönen Müllerin und<br />
der forelle. Betrachtet man dagegen den<br />
Inhalt von verlorener Liebe und vergangenen<br />
Zeiten, so entsteht eine unverkennbar<br />
ironische Grundstimmung Heine‘scher Prägung.<br />
Wo die schönen trompeten blasen<br />
beginnt mit einem fanfarenhaften Vorspiel,<br />
immer wieder ist der Text von sanften militärischen<br />
Reminiszenzen durchbrochen.<br />
Die düstere Grundtonart d-Moll verbreitet<br />
6<br />
zudem einen Schatten der Hoffnungslosigkeit.<br />
Die wörtliche Rede kippt unverzüglich<br />
in lyrisch-volksliedhafte Phrasen, die über<br />
das blockhafte Strophenschema hinweg<br />
einen Zusammenhang stiften. Auch die<br />
Schubert‘schen Dur-Moll-Kontraste rücken<br />
das Lied in die Reihe romantischer<br />
Liedtradition. In Wer hat dies Liedlein<br />
erdacht hört man die Synthese von<br />
markanter Rhythmik und volksliedhafter<br />
Melodielinie heraus, wie sie in den frühen<br />
Orchesterwerken, den sogenannten<br />
Wunderhorn-Sinfonien verwendet werden.<br />
Die erzählende Rahmenhandlung<br />
umfasst das eigentliche „Liedlein“, das<br />
sich nicht in seiner musikalischen Textur<br />
abhebt, sondern vielmehr durch eine kürzere<br />
geschlossene Strophenform, die sich<br />
in einem spannungsreichen Crescendo<br />
entfaltet. Auch die arkadische Tonart F-<br />
Dur unterstreicht diese Naturstimmung.<br />
Die Ausweglosigkeit des menschlichen<br />
Daseins in Urlicht veranlasste den Komponisten<br />
zur Vertonung in Des-Dur, einer der<br />
tiefsten Tonarten des Quintenzirkels. Nicht<br />
zuletzt Wagner hat mancher tannhäuser-<br />
Szene durch Des-Dur tiefste Verzweiflung<br />
und Hilflosigkeit verliehen.<br />
Neben Felix Mendelssohn-Bartholdy, Carl<br />
Maria von Weber und Ludwig van Beethoven<br />
war Louis Spohr seinerzeit einer<br />
der erfolgreichsten Komponisten im Deutschen<br />
Reich. Neben zehn Opern und vier<br />
Oratorien bildet die Gattung Lied einen<br />
vergleichsweise kleinen Teil seines Werkes.<br />
Das Liedschaffen Spohrs beschränkt<br />
sich, ähnlich wie bei Robert Schumann,<br />
auf eine intensive Schaffensphase. In<br />
der Zeit von 1836 bis 1839 schuf er rund<br />
vierzig Lieder und Duette. Allerdings war<br />
Spohrs Kompositionsstil nicht frei von<br />
scharfer Kritik. In der Zeitschrift „The<br />
Musical World“ war zu lesen: „Dass es<br />
Gustav Mahler