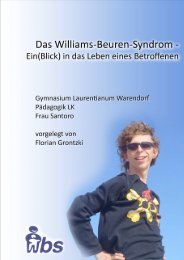Gibt es eine Aufholphase bei Kindern mit Williams-Beuren-Syndrom?
Gibt es eine Aufholphase bei Kindern mit Williams-Beuren-Syndrom?
Gibt es eine Aufholphase bei Kindern mit Williams-Beuren-Syndrom?
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
auf das jeweilige Diexisobjekt zu lenken, ist allen vier großen G<strong>es</strong>tenklasse zuordbar (Fricke<br />
2007). Mit dem Einsatz der Zeigeg<strong>es</strong>te werden immer eindeutige Referenzen zur Umwelt<br />
herg<strong>es</strong>tellt. Wichtig ist <strong>es</strong>, zwischen Form und Funktion zu unterscheiden und sie entsprech-<br />
end dem kommunikativen Kontext zu analysieren.<br />
3.2.2 McNeills psycholinguistisch begründet<strong>es</strong> Klassifikationssystem<br />
Es gibt <strong>eine</strong> Reihe von Klassifikationssystemen redebegleitender G<strong>es</strong>ten, welche ich in di<strong>es</strong>er<br />
Ar<strong>bei</strong>t nicht im Einzelnen vorstellen möchte (Wundt 1900; Elfron 1941; 1972; Ekman und<br />
Fri<strong>es</strong>en 1969; 1981; Freedman und Hoffman 1967; Müller 1998). Ich verweise <strong>bei</strong> Inter<strong>es</strong>se<br />
auf die einschlägige Fachliteratur. Müller (1998) und Fricke (2007) liefern <strong>eine</strong>n gut verständ-<br />
lichen Überblick.<br />
Ich möchte mich in m<strong>eine</strong>r Ar<strong>bei</strong>t das psychologisch begründete Klassifikationssystem von<br />
McNeill (1992; 2007) kurz vorstellen. Er betrachtet und untersucht in s<strong>eine</strong>n Studien vor<br />
allem spontane redebegleitende G<strong>es</strong>ten, das heißt G<strong>es</strong>ten, die die Sprecher willkürlich währ-<br />
end d<strong>es</strong> Sprechvorgangs produzieren. Die Ergebnisse s<strong>eine</strong>r langjährigen Forschungsar<strong>bei</strong>t zu<br />
den redebegleitenden G<strong>es</strong>ten präsentiert McNeill in s<strong>eine</strong>n Hauptwerken „Hand and Mind“<br />
(1992) und „G<strong>es</strong>ture and Thought“ (2007).<br />
Abbildung 2: Die Subklassifikation redebegleitender G<strong>es</strong>ten nach McNeill 23<br />
Ikonische G<strong>es</strong>ten<br />
(iconics)<br />
In s<strong>eine</strong>r Klassifikation führt McNeill als ersten G<strong>es</strong>tentyp die ikonische (iconics; Mc Neill<br />
1992; 12) G<strong>es</strong>te auf. Ikonische G<strong>es</strong>ten bilden nach McNeill Aspekte d<strong>es</strong> Bezeichneten ab.<br />
Voraussetzung hier<strong>bei</strong> ist, dass <strong>es</strong> sich um konkrete Gegenstände oder Ereignisse handelt. Da-<br />
<strong>bei</strong> geben die ikonischen G<strong>es</strong>ten die, analog im mentalen Gedächtnis d<strong>es</strong> Sprechers g<strong>es</strong>pei-<br />
cherten, bildlichen Repräsentationen d<strong>es</strong> Gegenstand<strong>es</strong> oder d<strong>es</strong> Ereigniss<strong>es</strong> wieder.<br />
23 Quelle: Fricke 2007; 172<br />
Metaphorische<br />
G<strong>es</strong>ten<br />
(metaphonics)<br />
Redebegleitende G<strong>es</strong>ten<br />
(g<strong>es</strong>tur<strong>es</strong>)<br />
Taktstock-<br />
g<strong>es</strong>ten<br />
(beats)<br />
Kohäsionsg<strong>es</strong>ten<br />
(coh<strong>es</strong>iv<strong>es</strong>)<br />
Zeigeg<strong>es</strong>ten<br />
(deictics)<br />
34