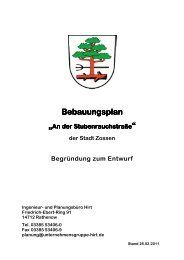29.02.2012 - Stadt Zossen
29.02.2012 - Stadt Zossen
29.02.2012 - Stadt Zossen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
29. Februar 2012<br />
Der Eichenprozessionsspinner -<br />
Lebensweise und Entwicklungszyklus<br />
Der Eichenprozessionsspinner<br />
(EPS) ist ein dicht<br />
behaarter, unauffälliger,<br />
graubrauner und sehr<br />
kurzlebiger Nachtfalter<br />
mit einer Größe von bis zu<br />
32 mm. Der Saugrüssel ist<br />
vollständig zurückgebildet,<br />
dass heißt, er kann keine<br />
Nahrung aufnehmen,<br />
sondern zehrt von den Reserven,<br />
die im Raupenstadium<br />
angelegt wurden.<br />
Der bevorzugte Lebensraum<br />
umfasst trocken-warmeRegionen<br />
mit lichten<br />
Eichenwäldern,<br />
Waldränder und Einzelbäume.<br />
Der EPS<br />
kommt auf dem Gebiet<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Zossen</strong><br />
an Stieleichen (Quercus<br />
robur) und Traubeneichen<br />
(Quercus<br />
petraea) vor. Im Jahr<br />
2011 waren die klimatischenBedingungen<br />
so optimal,<br />
dass es zur Gradation<br />
(Massenvermehrung)<br />
kam. Eine Massenvermehrung<br />
kann zu<br />
Zuwachsverlusten<br />
und dem Ausfall der<br />
Eichelmast führen,<br />
weiterhin kann mehrmaliger<br />
Kahlfraß<br />
hintereinander das<br />
Absterben der befallenen<br />
Bäume begünstigen.<br />
Der Falterflug/<br />
Schwarm (Paarungsflug)<br />
findet von Ende<br />
Juli bis Anfang September<br />
in trockenwarmen<br />
Abend- und<br />
Nachtstunden statt.<br />
Anhand der Befallskartierung<br />
ist<br />
festzustellen, dass sich der<br />
Falter mit der Hauptwindrichtung<br />
West Richtung<br />
Osten ausbreitet und hierbei<br />
hauptsächlich Alleen<br />
als Verbreitungskorridore<br />
nutzt. Das Weibchen legt<br />
bis zu 200 mohnkorngroße,<br />
silbergraue Eier plattenförmig<br />
in regelmäßigen Zeilen<br />
im besonnten oberen<br />
Kronenbereich an dünnen<br />
Zweigen älterer Eichen ab.<br />
Diese Eiplatten werden mit<br />
grauer Afterwolle verkittet<br />
und somit gut getarnt. Bereits<br />
im Herbst entwickelt<br />
sich der Embryo, die fertige<br />
Jungraupe überwintert im<br />
Ei. Anfang Mai schlüpfen<br />
die Raupen und benagen<br />
zunächst gemeinsam die<br />
frisch austreibenden Knospen.<br />
Die Eiräupchen sind<br />
orangebraun, stark behaart<br />
und haben eine schwarze<br />
Kopfkapsel. Von Beginn<br />
an leben sie in geselligen<br />
Familienverbänden und<br />
sammeln sich nestartig<br />
an locker zusammen gesponnenen<br />
Blättern oder<br />
Zweigen, gern auch in Astgabeln.<br />
Die ältere Raupe<br />
ist bläulich schwarzgrau,<br />
dunkelköpfig, an den Seiten<br />
weißlich und hat auf<br />
dem Rücken rötlichbrau-<br />
ne langbehaarte Warzen.<br />
Ab dem 3. Larvenstadium<br />
wachsen den Raupen als<br />
Schutz gegen Fraßfeinde<br />
sehr feine Brennhaare, die<br />
leicht brechen und durch<br />
Luftströmungen über weite<br />
Strecken verbreitet werden<br />
können. In späteren Entwicklungsstadien<br />
im Juni<br />
- die Raupe durchläuft bis<br />
zu sechs - spinnen die Raupen<br />
an geschützten Stellen<br />
lockere Nester mit zum Teil<br />
beachtlichen Ausmaßen,<br />
von welchen sie allabendlich<br />
in Prozessionen (in<br />
Reihe Raupe an Raupe)<br />
zum Fraß des Laubwerkes<br />
ausrücken und am nächsten<br />
Morgen auf gleiche<br />
Weise zurückkehren. Tagsüber<br />
liegen sie ruhig im<br />
Nest bzw. häuten sich. In<br />
den Gespinstnestern sammeln<br />
sich Kot, Brennhaare<br />
und Exuvien (abgestreifte<br />
Raupenhüllen). Am En-<br />
de des 6.<br />
Larvenstadiums<br />
kann eine<br />
Raupe<br />
eineKörper- länge von bis<br />
zu 4 cm erreichen. Die Verpuppung<br />
erfolgt im Juni/<br />
Anfang Juli in dicht anein-<br />
ander gedrängten Kokons<br />
im Gespinstnest, welches<br />
mehrere Jahre als festes<br />
Gebilde erhalten bleiben<br />
kann. Die Puppenruhe<br />
dauert 3-6 Wochen, nach<br />
der die Falter Ende Juli<br />
ausschlüpfen.<br />
Der EPS hat eine Vielzahl<br />
natürlicher Feinde, die ihre<br />
volle Wirkung aber erst<br />
nach mehreren Jahren der<br />
Massenvermehrung entfalten.<br />
Besonders wirksam<br />
sind Ei- und Raupenparasiten<br />
wie die Raupenfliegen,<br />
deren Larven sich im Inneren<br />
des Wirtes entwickeln.<br />
Wichtigste räuberische Käferart<br />
ist der Puppenräuber<br />
– seine Larven suchen sich<br />
ihre Beute im Raupengespinst,<br />
während der Käfer<br />
die freien Raupen atta-<br />
ckiert. Weitere geschickte<br />
Jäger sind Fledermäuse,<br />
die dem schwärmenden<br />
Falter nachts<br />
den Garaus<br />
machen.<br />
Auch der<br />
Kuckuck verspeist<br />
die Rau-<br />
pen trotz der<br />
Brennhaare gerne<br />
- diese zeigen bei<br />
ihm keine Wirkung, da er<br />
seine Magenschleimhaut<br />
mit den darin festsitzenden<br />
Haaren herauswürgen<br />
kann.<br />
Grundsätzlich können<br />
alle behaarten<br />
Raupen allergische<br />
Reaktionen hervorrufen.<br />
Beim EPS ist<br />
die Gesundheitsgefährdung<br />
durch leicht<br />
brechende Brennhaare<br />
der Raupen und<br />
durch die Gespinstnester<br />
(enthalten<br />
Spinnfäden, Raupenkot,<br />
Häutungsreste<br />
(Exuvien) und Brennhaare)<br />
bei Massenpopulationen<br />
besonders<br />
hoch. Die Brennhaare<br />
enthalten das Nesselgift<br />
Thaumetopoein,<br />
welches beim Menschen<br />
allergische Reaktionen<br />
und Entzündungen<br />
auf der Haut<br />
(Raupen-Dermatitis),<br />
auf Schleimhäuten<br />
und in den Augen<br />
hervorrufen können.<br />
Problematisch kann<br />
dies zum Beispiel bei<br />
Allergikern, Asthmatikern<br />
und Kindern<br />
werden. Daher hat<br />
sich die <strong>Stadt</strong> <strong>Zossen</strong> in<br />
diesem Jahr zu einer vorbeugenden<br />
Spritzaktion<br />
mit dem Insektizid Dipel<br />
ES und dem Wirkstoff Bacillus<br />
thuringiensis entschlossen,<br />
welches eine<br />
wiederkehrende Massenpopulation<br />
verhindern<br />
soll. Sollte es im Einzelfall<br />
notwendig sein, wird die<br />
mechanische Bekämpfung<br />
durch Absaugen der Nester<br />
fortgesetzt.<br />
Grundsätzlich gilt die Regel:<br />
Befallene Bäume meiden,<br />
einen direkten Kontakt<br />
mit den Raupen, den<br />
Häutungsresten oder Gespinstnestern<br />
verhindern<br />
und etwaige Befallsherde<br />
in der <strong>Stadt</strong> im Bürgerbüro<br />
unter Telefonnummer<br />
03377 / 30 40 500 melden.<br />
<strong>Stadt</strong>blatt Seite 13<br />
Mit DIPEL ES gegen<br />
die Raupenplage<br />
Das Grünflächenamt bekämpft in diesem<br />
Jahr den Eichenprozessionsspinner<br />
Aufgrund der enormen Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners<br />
(Thaumetopoea processionea)<br />
im <strong>Stadt</strong>gebiet im Jahr 2011 und der damit<br />
verbunden Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung,<br />
hat sich die <strong>Stadt</strong> <strong>Zossen</strong> im Jahr 2012<br />
für den Einsatz eines Pflanzenschutzmittels<br />
entschieden. Das warme und trockene Klima<br />
der letzten Jahre förderte die Entwicklung einer<br />
Massenpopulation und so gibt es kaum noch<br />
eine Eiche, die nicht von dem Falter befallen ist.<br />
Dabei stellt eigentlich nicht der eher unauffällige<br />
Nachtfalter das Problem dar, sondern die<br />
freifressenden Raupen ab dem dritten Larvenstadium<br />
(L3). Diese entwickeln auf der Rückenseite<br />
Brennhaare mit Widerhaken, welche<br />
das Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Auf<br />
einer Raupe sind bis zu 600.000 Brennhaare<br />
zu finden, die diese eigentlich vor Fraßfeinden<br />
schützen soll. Da die Brennhaare bei Berührung<br />
leicht brechen, kann es zu einer Konzentration<br />
am Boden kommen bzw. zu einer witterungsabhängigen<br />
Verdriftung durch Wind (>200 m).<br />
Ferner ist eine sehr hohe Konzentration von<br />
Brennhärchen in den bis zu fußballgroßen<br />
Raupennestern am Baumstamm zu finden, die<br />
der Eichenprozessionsspinner zur Verpuppung<br />
anlegt. Diese können während des Abbauprozesses<br />
als Gespinstballen zu Boden fallen. Die<br />
Brennhaare sind aufgrund ihrer langen Haltbarkeit<br />
noch mehrere Jahre in der Umwelt nachzuweisen<br />
(≥10 Jahre) und stellen somit durch jährliche<br />
Zufuhr von neuen Raupengenerationen<br />
eine latente Gesundheitsgefährdung dar (Kumulation<br />
führt zur allergenen Dauerwirkung).<br />
Somit muss der Eichenprozessionsspinner als<br />
Hygieneschädling betrachtet werden und nicht<br />
unbedingt als Baum- bzw. Forstschädling – eine<br />
gesunde Eiche kompensiert einen Kahlfraß<br />
meist schon mit dem Johannistrieb im Juni.<br />
Beim Menschen tritt kurz nach dem unmittelbaren<br />
Kontakt mit den Brennhärchen die sogenannte<br />
Raupendermatitis (starker Juckreiz,<br />
insektenstichartige Bläschen, nesselsuchtartige<br />
Quaddeln, schmerzhafte Hautrötungen,<br />
bei Allergikern anaphylaktischer Schock) auf.<br />
Ferner kann es zu Entzündungen der Atemwegsschleimhäute<br />
(Husten, Asthma) und Augen<br />
kommen.<br />
Im vergangenen Jahr erfolgte die Bekämpfung<br />
des Eichenprozessionsspinners ausschließlich<br />
mechanisch durch das Absaugen der Nester. Im<br />
<strong>Stadt</strong>gebiet konnten durch die Bürger Schädlingsbekämpfungsexperten<br />
mit Atemschutzmasken<br />
und geschlossenen Schutzanzügen auf<br />
einer Hebebühne beobachtet werden.<br />
In diesem Jahr soll das selektive Fraßgift DIPEL<br />
ES mit dem Wirkstoff Bacillus thuringiensis<br />
auf die Eichenblätter appliziert werden, dass<br />
die Raupen aufnehmen, indem sie das Laub<br />
fressen (potentielle Antagonisten werden verschont).<br />
Auf diesem Wege gelangt das Insektizid<br />
(ein Endotoxin) in deren Verdauungstrakt<br />
und zerstört diesen. Einfach erklärt, kann man<br />
sagen, die Raupe verhungert. Das Mittel DIPEL<br />
ES ist vollständig biologisch abbaubar und ist<br />
für Mensch und Tier ungefährlich. Die Wirkung<br />
ist witterungsabhängig, dass heißt, das Mittel<br />
kann durch Regen von den Blättern abgewaschen<br />
werden und ist nicht UV-stabil. Durch<br />
die Einordnung der Zulassungsbehörde in die<br />
Bienenschutzklasse B4 (nicht bienengefährlich)<br />
besteht zudem auch keine Gefahr für die Nutzinsekten.