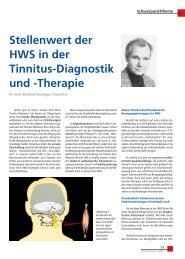Tinnitustherapierecherche - Deutsche Tinnitus Liga eV
Tinnitustherapierecherche - Deutsche Tinnitus Liga eV
Tinnitustherapierecherche - Deutsche Tinnitus Liga eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong><strong>Tinnitus</strong>therapierecherche</strong><br />
Bis in die jüngste Vergangenheit war dieses Modell in allen einschlägigen Fachbüchern zu finden.<br />
Diese Hypothese hat sich inzwischen als fragwürdig bzw. als weitgehend falsch herausgestellt.<br />
Damit erklären sich auch die Erfolglosigkeit und das Dilemma bei der konservativen Behandlung<br />
von <strong>Tinnitus</strong> (Jäger, Kröner-Herwig).<br />
Goebel, Büttner (2004) schreiben zu diesem Thema: Bei 25-40 % der Fälle bleibt die Ursache<br />
unklar, man nennt das dann den so genannten ideopathischen <strong>Tinnitus</strong>.<br />
Bei vielen <strong>Tinnitus</strong>patienten lassen sich keine Funktionsstörungen des Innenohrs nachweisen.<br />
Die bisherigen Modellvorstellungen der peripheren (Innenohr) und primär zentralen Ursachen<br />
des <strong>Tinnitus</strong> gingen davon aus, dass über die pathologische Hörnervenaktivität bzw. eine veränderte<br />
Spontanaktivität der Hörvorgang gestört wird und dadurch der <strong>Tinnitus</strong> als abnormes Muster<br />
auf der Hörrinde abgebildet wird.<br />
Die Kombination mehrerer Typen des <strong>Tinnitus</strong> ist grundsätzlich möglich, aber aufgrund neuerer<br />
Erkenntnisse erscheint eine Einteilung in somatogenen und psychogenen oder peripheren und<br />
zentralem <strong>Tinnitus</strong> problematisch.<br />
Und sinngemäß an anderer Stelle:<br />
Vergegenwärtigt man sich die neurophysiologische Differenziertheit des Hörorgans, sowie<br />
die äußerst komplexen neuronalen Schaltungen auf den verschiedenen Ebenen sowie die<br />
Funktionen der beidseits vorhandenen Kerne und Strukturen, so ist eine rein „periphere“<br />
Theorie (Ursache Innenohr, Durchblutungsstörung) heute kaum noch haltbar. Dies<br />
ist also ein „Freispruch“ für die Innenohrtheorie und eine klare Abkehr von der jahrelang<br />
vertretenen konventionellen <strong>Tinnitus</strong>erklärung.<br />
4.2 „Ohrgeräusche“ von F. J. Ganz 1986<br />
Bereits 1986 hat F.J. Ganz in seinem Klassiker „Ohrgeräusche“ folgenden Erklärungsansatz<br />
vertreten: Aufgrund meiner Recherchen gelange ich zu der Annahme, dass die physiologischen<br />
Ohrgeräusche ihre Entstehung „im Hörnerv oder zentral (also im Gehirn) haben (müssen) und<br />
nicht schwingungsbedingt (also aus dem Innenohr kommend) sind, sondern vielmehr als Folge<br />
und Ausdruck einer Daueraktivität, also eines Erregungszustands der Nerven- und Sinneszellen<br />
ohne äußeren Reiz (also ohne Störung im Innenohr) anzusehen sind“. F. J. Ganz hat dafür den<br />
anschaulichen Begriff „akustisches Nervenschwirren“ geprägt und war damit mit seiner Modellvorstellung<br />
bereits vor 20 Jahren auf der richtigen Spur!<br />
4.3 Das neurophysiologische Modell (Jastreboff)<br />
Am Anfang stand die Entwicklung eines bis dahin für schwer realisierbar gehalten Tiermodells<br />
zur <strong>Tinnitus</strong>forschung (Jastreboff et. al. 1988). Ausgehend von diesen Untersuchungen entwickelte<br />
wiederum vor allem Jastreboff das neurophysiologische <strong>Tinnitus</strong>modell. Es ist Jastreboffs<br />
unbestreitbarer Verdienst, hiermit ein Modell entwickelt zu haben, dass nicht nur neurophysiologische<br />
Entsprechungen für die von Hallam (1987) angenommenen psychischen Prozesse bietet,<br />
sondern mit dessen Hilfe einige bisher nicht entschlüsselte Erklärungen für die Entstehung von<br />
<strong>Tinnitus</strong> abgeleitet werden konnten. (Und es ergaben sich daraus neue Impulse für konkrete<br />
zukunftweisende Therapieansätze). Weiter führte er aus, dass ein Teil aller <strong>Tinnitus</strong>betroffenen<br />
schwer unter ihren Ohrgeräuschen leidet, ohne dass hierfür (im Vergleich mit den anderen) objektive<br />
Merkmale vorliegen. Er folgert daraus, dass das zentrale auditorische System bei der<br />
Verarbeitung eines dekompensierten <strong>Tinnitus</strong> nur eine sekundäre Rolle spielt.<br />
Dominant seien andere mit ihm verbundene Systeme wie das autonome Nervensystem und das<br />
limbische System. Weiterhin alle Zentren, die relevant sind in Bezug auf Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsfunktionen.<br />
Zwischen dem <strong>Tinnitus</strong>signal und den Reaktionen in den genannten<br />
Zentren liegen Verknüpfungen im Sinne konditionierter Reflexe vor. Dabei werden zwei Rückkopplungs-Schleifen<br />
unterschieden:<br />
Zwischen dem auditorischen System und der bewussten Wahrnehmung/Bewertung der <strong>Tinnitus</strong>verarbeitung<br />
und weiter: Die meist dominante Verbindung zwischen dem auditorischen System<br />
<strong><strong>Tinnitus</strong>therapierecherche</strong> Seite 8 von 39