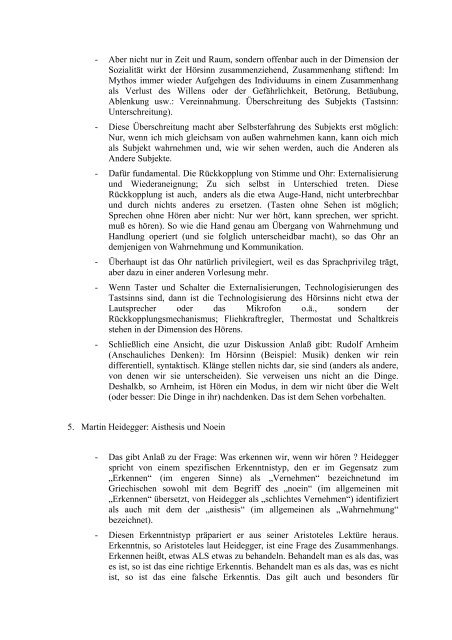Hören, Vernehmen, Verstehen
Hören, Vernehmen, Verstehen
Hören, Vernehmen, Verstehen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- Aber nicht nur in Zeit und Raum, sondern offenbar auch in der Dimension der<br />
Sozialität wirkt der Hörsinn zusammenziehend, Zusammenhang stiftend: Im<br />
Mythos immer wieder Aufgehgen des Individuums in einem Zusammenhang<br />
als Verlust des Willens oder der Gefährlichkeit, Betörung, Betäubung,<br />
Ablenkung usw.: Vereinnahmung. Überschreitung des Subjekts (Tastsinn:<br />
Unterschreitung).<br />
- Diese Überschreitung macht aber Selbsterfahrung des Subjekts erst möglich:<br />
Nur, wenn ich mich gleichsam von außen wahrnehmen kann, kann oich mich<br />
als Subjekt wahrnehmen und, wie wir sehen werden, auch die Anderen als<br />
Andere Subjekte.<br />
- Dafür fundamental. Die Rückkopplung von Stimme und Ohr: Externalisierung<br />
und Wiederaneignung; Zu sich selbst in Unterschied treten. Diese<br />
Rückkopplung ist auch, anders als die etwa Auge-Hand, nicht unterbrechbar<br />
und durch nichts anderes zu ersetzen. (Tasten ohne Sehen ist möglich;<br />
Sprechen ohne <strong>Hören</strong> aber nicht: Nur wer hört, kann sprechen, wer spricht.<br />
muß es hören). So wie die Hand genau am Übergang von Wahrnehmung und<br />
Handlung operiert (und sie folglich unterscheidbar macht), so das Ohr an<br />
demjenigen von Wahrnehmung und Kommunikation.<br />
- Überhaupt ist das Ohr natürlich privilegiert, weil es das Sprachprivileg trägt,<br />
aber dazu in einer anderen Vorlesung mehr.<br />
- Wenn Taster und Schalter die Externalisierungen, Technologisierungen des<br />
Tastsinns sind, dann ist die Technologisierung des Hörsinns nicht etwa der<br />
Lautsprecher oder das Mikrofon o.ä., sondern der<br />
Rückkopplungsmechanismus; Fliehkraftregler, Thermostat und Schaltkreis<br />
stehen in der Dimension des <strong>Hören</strong>s.<br />
- Schließlich eine Ansicht, die uzur Diskussion Anlaß gibt: Rudolf Arnheim<br />
(Anschauliches Denken): Im Hörsinn (Beispiel: Musik) denken wir rein<br />
differentiell, syntaktisch. Klänge stellen nichts dar, sie sind (anders als andere,<br />
von denen wir sie unterscheiden). Sie verweisen uns nicht an die Dinge.<br />
Deshalkb, so Arnheim, ist <strong>Hören</strong> ein Modus, in dem wir nicht über die Welt<br />
(oder besser: Die Dinge in ihr) nachdenken. Das ist dem Sehen vorbehalten.<br />
5. Martin Heidegger: Aisthesis und Noein<br />
- Das gibt Anlaß zu der Frage: Was erkennen wir, wenn wir hören ? Heidegger<br />
spricht von einem spezifischen Erkenntnistyp, den er im Gegensatz zum<br />
„Erkennen“ (im engeren Sinne) als „<strong>Vernehmen</strong>“ bezeichnetund im<br />
Griechischen sowohl mit dem Begriff des „noein“ (im allgemeinen mit<br />
„Erkennen“ übersetzt, von Heidegger als „schlichtes <strong>Vernehmen</strong>“) identifiziert<br />
als auch mit dem der „aisthesis“ (im allgemeinen als „Wahrnehmung“<br />
bezeichnet).<br />
- Diesen Erkenntnistyp präpariert er aus seiner Aristoteles Lektüre heraus.<br />
Erkenntnis, so Aristoteles laut Heidegger, ist eine Frage des Zusammenhangs.<br />
Erkennen heißt, etwas ALS etwas zu behandeln. Behandelt man es als das, was<br />
es ist, so ist das eine richtige Erkenntis. Behandelt man es als das, was es nicht<br />
ist, so ist das eine falsche Erkenntis. Das gilt auch und besonders für