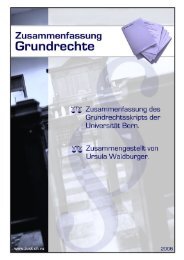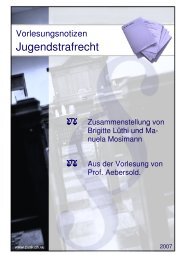DRUEY / Erbrecht - Studentenverbindung Concordia Bern
DRUEY / Erbrecht - Studentenverbindung Concordia Bern
DRUEY / Erbrecht - Studentenverbindung Concordia Bern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Zusammenfassung<br />
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong><br />
4. Auflage 1997<br />
von David Vasella<br />
Mit wenigen eigenen Ergänzungen, deshalb: alle Angaben ohne Gewähr<br />
1/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Inhalt<br />
Superkurzzusammenfassung / Prüfungsschema.........................................................................3<br />
Die Systematik des <strong>Erbrecht</strong>s ..................................................................................................4<br />
Das Thema des <strong>Erbrecht</strong>s........................................................................................................7<br />
Prinzipien des <strong>Erbrecht</strong>s..........................................................................................................7<br />
Gesetzliche Erbfolge...............................................................................................................8<br />
Der Pflichtteil.......................................................................................................................10<br />
Die Enterbung ......................................................................................................................11<br />
Die Herabsetzung .................................................................................................................12<br />
Die Ausgleichung.................................................................................................................13<br />
Das Spezifische der Verfügung von Todes wegen...................................................................15<br />
Das Testament......................................................................................................................16<br />
Der Erbvertrag......................................................................................................................17<br />
Die Arten von Anordnungen auf den Todesfall („Verfügungsarten“, 481 ff.) ............................19<br />
Erben- und Legatarsubstitution..............................................................................................20<br />
Die mangelhafte Verfügung...................................................................................................21<br />
Der Nachlaß.........................................................................................................................23<br />
Das Handeln für den ungeteilten Nachlaß...............................................................................25<br />
Handeln aufgrund besonderen Amts.......................................................................................26<br />
Sichernde Maßnahmen..........................................................................................................28<br />
Eintritt der Erben in ihre Stellung ..........................................................................................28<br />
Das allgemeine Teilungsrecht................................................................................................31<br />
Das bäuerliche <strong>Erbrecht</strong> (kurz) ..............................................................................................34<br />
2/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Superkurzzusammenfassung / Prüfungsschema<br />
1. Aufstellung der fraglichen Personen (Parentelensystem, Eintritts- und Anwachsungsprin-<br />
zip. Enterbung wirkt nicht für Erbeserben, nur Verzicht).<br />
2. Bestimmung der Pflichtteile und der verfügbaren Quote (Herabsetzung); Enterbung?<br />
3. Herabsetzungsklage? Ausgleichung?<br />
4. Prüfung allfälliger Verfügungen von Todes wegen: gültig? (öffentliches oder holographes<br />
Testament, Erbvertrag).<br />
5. Vermächtnisse, Auflagen, Bedingungen<br />
6. Nachlaßberechnung (Aktiven, Passiven). Gläubigerschutz! Erbschaftsklage (+/- Vindika-<br />
tion).<br />
7. Erbengemeinschaft. Handeln für den Nachlaß (privat, öffentlich auf Begehren, von Am-<br />
tes wegen)? Aufgrund besonderen Amtes (Willensvollstrecker, mit weniger Kompeten-<br />
zen Erbenvertreter, Erbschaftsverwalter)?<br />
8. Maßnahmen zur Sicherung (Siegelung und Inventar)<br />
9. Testamentseinreichung, Eröffnung, Erbbescheinigung<br />
10. Ausschlagung, Inventar, amtliche Versteigerung?<br />
11. Teilung: Autonomie der Erbengemeinschaft. Hilfe von Behörde, ev. Willensvollstrecker.<br />
12. Zuteilungsregeln<br />
13. Krisenmanagement: Gericht!<br />
14. Haftung geht weiter!<br />
3/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Die Systematik des <strong>Erbrecht</strong>s<br />
3. Teil: Das <strong>Erbrecht</strong><br />
1. ABTEILUNG: DIE ERBEN<br />
13. Titel: Die gesetzlichen Erben<br />
A. Verwandte Erben<br />
B. Überlebender Ehegatte<br />
C. ...<br />
D. Gemeinwesen<br />
14. Titel: Die Verfügungen von Todes wegen<br />
1. Abschnitt: Die Verfügungsfähigkeit<br />
A. Letztwillige Verfügung<br />
B. Erbvertrag<br />
C. Mangelhafter Wille<br />
2. Abschnitt: Die Verfügungsfreiheit<br />
A. Verfügbarer Teil<br />
B. Enterbung<br />
3. Abschnitt: Die Verfügungsarten<br />
A. Im Allgemeinen<br />
B. Auflagen und Bedingungen<br />
C. Erbeinsetzung<br />
D. Vermächtnis<br />
E. Ersatzverfügung<br />
F. Nacherbeneinsetzung<br />
G. Stiftungen<br />
H. Erbverträge<br />
4. Abschnitt: Die Verfügungsformen<br />
A. Letztwillige Verfügungen<br />
B. Erbverträge<br />
C. Verfügungsbeschränkung<br />
5. Abschnitt: Der Willensvollstrecker<br />
A. Erteilung des Auftrages<br />
B. Inhalt des Auftrages<br />
6. Abschnitt: Die Ungültigkeit und Herabsetzung von Verfügungen<br />
A. Ungültigkeitsklage<br />
B. Herabsetzungsklage<br />
7. Abschnitt: Klagen aus Erbverträgen<br />
A. Ansprüche bei Ausrichtung zu Lebenszeit<br />
4/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
2. ABTEILUNG: DER ERBGANG<br />
B. Ausgleichung beim Erbverzicht<br />
15. Titel: Die Eröffnung des Erbganges<br />
A. Voraussetzung auf Seite des Erblassers<br />
B. Ort der Eröffnung und Gerichtsstand<br />
C. Voraussetzung auf der Seite des Erben<br />
D. Verschollenheit<br />
16. Titel: Die Wirkung des Erbganges<br />
1. Abschnitt: Die Sicherungsmaßregeln<br />
A. Im Allgemeinen<br />
B. Siegelung der Erbschaft<br />
C. Inventar<br />
D. Erbschaftsverwaltung<br />
E. Eröffnung der letztwilligen Verfügung<br />
2. Abschnitt: Der Erwerb der Erbschaft<br />
A. Erwerb<br />
B. Ausschlagung<br />
3. Abschnitt: Das öffentliche Inventar<br />
A. Voraussetzung<br />
B. Verfahren<br />
C. Verhältnis der Erben während des Inventars<br />
D. Wirkung<br />
E. Haftung für Bürgschaftsschulden<br />
F. Erwerb durch das Gemeinwesen<br />
4. Abschnitt: Die amtliche Liquidation<br />
A. Voraussetzung<br />
B. Verfahren<br />
5. Abschnitt: Die Erbschaftsklage<br />
A. Voraussetzung<br />
B. Wirkung<br />
C. Verjährung<br />
D. Klage der Vermächtnisnehmer<br />
17. Titel: Die Teilung der Erbschaft<br />
1. Abschnitt: Die Gemeinschaft vor der Teilung<br />
A. Wirkung des Erbganges<br />
B. Teilungsanspruch<br />
C. Verschiebung der Teilung<br />
D. Anspruch der Hausgenossen<br />
2. Abschnitt: Die Teilungsart<br />
A. Im Allgemeinen<br />
B. Ordnung der Teilung<br />
C. Durchführung der Teilung<br />
D. Besondere Gegenstände<br />
5/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
3. Abschnitt: Die Ausgleichung<br />
A. Ausgleichungspflicht der Erben<br />
B. Ausgleichung bei Wegfallen von Erben<br />
C. Berechnungsart<br />
D. Erziehungskosten<br />
E. Gelegenheitsgeschenke<br />
4. Abschnitt: Abschluß und Wirkung der Teilung<br />
A. Abschluß des Vertrages<br />
B. Haftung der Miterben unter sich<br />
C. Haftung gegenüber Dritten<br />
6/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Das Thema des <strong>Erbrecht</strong>s<br />
n Sukzession<br />
Nicht zum <strong>Erbrecht</strong> gehört<br />
• Rechtsverhältnisse, die mit dem Tod des Erblassers aufhören<br />
• Regelung der Rechte und Pflichten, die im Tod fällig werden (Güterrecht)<br />
• Auflösung juristischer Personen<br />
n Vermögenswerte<br />
Es geht dabei immer um Vermögenswerte; Rechte, die jemandem aufgrund seiner Persönlichkeit<br />
zukommen, werden nicht vererbt (Der postmortale Persönlichkeitsschutz: Geschützt werden hier<br />
die Gefühle der Angehörigen. Sie können z.B. einer Organentnahme zustimmen oder sie verbie-<br />
ten, sogar in eine zu Lebzeiten eingereichte Ehrverletzungsklage des Erblassers oder in das Straf-<br />
antragsrecht des Erblassers eintreten. Ist aber nicht Teil des <strong>Erbrecht</strong>s!)<br />
Außerdem können Anordnungen des Erblassers über nicht vermögensrechtliche Belange außer-<br />
halb der Formenstrenge des <strong>Erbrecht</strong>s ergehen.<br />
Prinzipien des <strong>Erbrecht</strong>s<br />
Le mort saisit le vif (der Tod erfaßt den Lebendigen)<br />
n Identität von Todesfall und Erbgang: ohne „logische Sekunde“ (560 I)<br />
n Universalsukzession<br />
in den gesamten Nachlaß: Diese Automatik durchbricht die Prinzipien des Sachenrechts (Singu-<br />
larsukzession/Spezialitätsprinzip). Es gehen auch Werte in das Eigentum der Erben(-gemein-<br />
schaft) über, die der Erblasser gar nicht kannte, ebenso die Schulden.<br />
n Gesamtnachfolge<br />
aller Erben: Keiner der Erben besitzt einen eigenen Titel, nur eine rechnerische Quote. Die Erben<br />
bilden eine Gesamthandsgemeinschaft (Einstimmigkeitsprinzip, vgl. ZGB 652-654. ZGB 651 III<br />
verweist auf die Regeln des <strong>Erbrecht</strong>s. Sie haben aber Mitbesitz, nicht Gesamtbesitz).<br />
n Keine Erbenlosigkeit<br />
Erbfähigkeit ist ein Ausfluß der Rechtsfähigkeit (11).Bestimmt jemand keine Erben, so stellt das<br />
Gesetz eine Erbenordnung zur Verfügung; sind auch keine gesetzlichen Erben da, so erbt das<br />
7/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Gemeinwesen (Formelle Erbenlosigkeit besteht nur bei Ausschlagung durch alle Erben, vgl. 573<br />
II. Konkursamtliche Liquidation, SchKG 193; fällt also nicht an das Gemeinwesen. Das tut er<br />
nur, wenn gar nie gesetzliche oder gewillkürte Erben vorhanden waren).<br />
n Verfangenheit und Verfügungsfreiheit: Verfangenheit bedeutet, daß die Erben vorgegeben sind<br />
(Pflichtteilsrecht).<br />
Einschränkungen:<br />
• Formstrenge<br />
• Numerus clausus von möglichen Inhalten<br />
• keine unbeschränkte zeitliche Wirkung<br />
• keine zu großen Eingriffe in die Persönlichkeit des Erben<br />
• Hilfsbedarf durch lebende Subjekte<br />
• Vorbehalt des Mißbrauchs<br />
Gesetzliche Erbfolge<br />
n Allgemeines<br />
Eingesetzte und gesetzliche Erben stehen einander gleich, mit gewissen Ausnahmen (zulasten der<br />
Erben: ZGB 556 III: provisorische Überlassung der Erbschaft an die gesetzlichen Erben bei Er-<br />
öffnung des Erbganges; zugunsten der eingesetzten Erben: Verfügungen von Todes wegen sind<br />
immer nur anfechtbar, nicht ex officio nichtig, 519 ff., 522).<br />
Als letzter gesetzlicher Erbe erscheint das Gemeinwesen (Kanton bzw. eine Gemeinde, 466) am<br />
letzten Wohnsitz des Erblassers (538; IRRG 86, 90). Es haftet diesfalls nur der Nachlaß (592).<br />
n Das Parentelensystem<br />
Eine Parentel besteht aus einer Person (Aszendent) und deren Nachkommen (Deszendenten). Die<br />
erste Parentel bildet der Erblasser und seine Nachkommen, die zweite die Eltern des Erblassers<br />
und deren Nachkommen (Geschwister, Nichten und Neffen usw.), die dritte die Großeltern und<br />
deren Nachkommen (Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins usw..); eine vierte gibt es nicht (460).<br />
• Angehörige einer Parentel können nur Erben sein, wenn keine Angehörige einer vorge-<br />
henden Parentel vorhanden sind.<br />
• Innerhalb einer Parentel kommt nur die oberste Schicht (Kinder, Tanten) zum Zug; wenn<br />
Angehörige dieser Schicht ausfallen, tritt die nächste Generation an deren Stelle.<br />
• Gleichheitsprinzip: Geschwister erben - nach dem Gesetz - immer gleichviel.<br />
8/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
n Eintrittsprinzip<br />
Fällt ein Erbe aus, so treten dessen Kinder (unter denen wieder das Gleichheitsprinzip gilt) an<br />
seine Stelle, dann deren Kinder usw. Verfügungen des ausfallenden Erben über seine Erbfolge<br />
sind hier unbeachtlich.<br />
Die Nachkommen treten auch dann ein, wenn ihre Vorfahren und ersten Erben enterbt wurden<br />
(478 II und III), erbunwürdig waren (541 II) oder die Erbschaft ausschlugen (572 I). Durchbro-<br />
chen wird das Eintrittsprinzip nur bei Erbverzicht (495 III) und bei Ausschlagung aller nächsten<br />
gesetzlichen Erben (573 I).<br />
n Anwachsungsprinzip<br />
ist zum Eintretensprinzip subsidiär. Es besagt, daß, fällt ein Erbe aus, dessen Anteil am Nachlaß<br />
seinen Miterben gleicher Stufe gleichmäßig zugute kommt (aber eben nur, wenn keine Nach-<br />
kommen des Ausfallenden gierig warten). Das Prinzip gilt auch unter Ehegatten. Ist z.B. der Va-<br />
ter des Erblassers vorverstorben, so ist dies nur beachtlich, wenn der Erblasser selbst keine Nach-<br />
kommen hatte (Parentelensystem) und der Vater seinerseits keine (dito), so daß das Eintretens-<br />
prinzip nicht greifen kann, dann tritt erst die Mutter des Erblassers in den Teil des Vaters ein. Die<br />
Anwachsung kommt dem eigenen Stamm zugute; fällt ein Erbe aus, so wächst sein Teil (hori-<br />
zontal) seinen Geschwistern an, erst nachher anderen Stämmen (d.h. es gilt dann wieder das Ein-<br />
trittsprinzip).<br />
n Der überlebende Ehegatte<br />
ist immer gesetzlicher Erbe außerhalb des Parentelensystems. Beim Tod kommt es zur güter-<br />
rechtlichen Auseinandersetzung. Seine Quote hängt davon ab, mit welcher Parentel er konkurriert<br />
(462; erste Parentel 1/2, zweite Parentel 3/4, sonst das Ganze; davon jeweils eine Pflichtteilsquote<br />
von 1/2, 471 Ziff. 3). Stehen die Nachkommen unter der elterlichen Sorge des überlebenden Ehe-<br />
gatten, so verwaltet dieser auch deren Vermögen.<br />
Güterrechtlich kommt dem Ehegatten die Hälfte des Vorschlages zu (210 I, 215 I: Der Vorschlag<br />
ist der Gesamtwert der Errungenschaft abzüglich der Schulden).<br />
n Zuweisung der Nutznießung an den überlebenden Ehegatten nach Art. 473 ZGB<br />
Nach 473 kann dem überlebenden Ehegatten die Nutznießung an der ganzen Erbschaft zugewie-<br />
sen werden, gegenüber den gemeinsamen und den während der Ehe gezeugten nicht gemeinsa-<br />
men Kindern. Allerdings entfällt dadurch der Pflichtteil des Ehegatten (Abs. 2). Nach dem Tod<br />
des zweitverstorbenen Ehegatten erben die gemeinsamen Nachkommen die nicht konsumierten<br />
Erträgnisse der Nutznießung; diese entfällt. Bei seiner Wiederverheiratung können die Erben die<br />
9/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Herabsetzung der Nutznießung verlangen auf den Wert, der bei Beachtung ihrer Pflichtteile ma-<br />
ximal belastbar gewesen wäre (d.h. verfügbare Quote).<br />
Neben der Nutznießung nach 473 kann der Erblasser dem Ehegatten die Quote zu Eigentum zu-<br />
weisen, die daneben verfügbar bleibt. Die Berechnung ist umstritten 1 . Art. 473 geht 530 vor, wo-<br />
nach die Erben die Belastung mit einer Nutznießung über die verfügbare Quote hinaus nicht zu<br />
dulden haben, sondern deren Herabsetzung oder sogar deren Ablösung fordern können, allerdings<br />
unter Überlassung der verfügbaren Quote an den eigentlichen Nutznießer (denn dies würde be-<br />
deuten, daß entweder Nutznießung oder Zuweisung der verfügbaren Quote möglich ist; beim<br />
Ehegatten geht aber beides, zulasten der gemeinsamen Nachkommen).<br />
Der Pflichtteil<br />
n Allgemeines<br />
1. Art. 470-480: Materieller Teil<br />
2. Art. 522-533: Formeller Teil, enthält auch materiell bedeutsame Bestimmungen.<br />
Berechnung als Quote des gesetzlichen Erbteils. Der Erbe hat Anrecht auf den Pflichtteil „dem<br />
Werte nach“ (522 I, wo diese Formulierung nicht den Inhalt des Pflichtteils, sondern die Klagele-<br />
gitimation betrifft: Der Erblasser kann also schon vor seinem Tode den Erben durch Vorempfän-<br />
ge, die dem Pflichtteil wertmäßig entsprechen, von der Erbengemeinschaft fernhalten). Das Ur-<br />
teil, das einer Pflichtteilsverletzung folgt, ist ein Gestaltungsurteil (a.M. TUOR). Der Pflichtteil ist<br />
verzichtbar (negativer Erbvertrag, s.u.).<br />
n Berechtigung und Berechnung<br />
Ein Teil der gesetzlichen Erben hat Pflichtteilsansprüche. Diese sind rechnerisch Bruchteile von<br />
Bruchteilen.<br />
Faktoren:<br />
• Ehegatten 1/2<br />
• Nachkommen 3/4<br />
1 nach Tuor beträgt diese Quote 2/8 (Grund: 472 II spricht davon, daß die Erbberechtigung des Ehegatten<br />
mit der Nutznießung entfällt, also ist der ganze Nachlaß den Nachkommen zustehend. 3/4<br />
sind pflichtteilsgeschützt, verbleiben also 1/4 = 2/8). Nach anderer Meinung (Piotet) beträgt diese<br />
Quote 3/8 (was sich nach Druey kaum mit dem Wortlaut von 473 II verträgt), nach wieder anderer<br />
1/8 (Grund: der Erblasser habe mit der Zuweisung der Nutznießung über den Anteil des Ehegatten<br />
verfügt, also über 1/2, bleibt 1/2, davon 3/4 sind pflichtteilsgeschützt, bleibt 1/8). Druey sympathisiert<br />
mit der Lösung von 1/8; ebenso Hegnauer/Breitschmid, Eherecht, S. 228.<br />
10/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
• Eltern 1/2<br />
... des gesetzlichen Erbteils. Geschwister haben keine Pflichtteilsansprüche.<br />
Verfügbare Quote also: Gesamter Nachlaß abzüglich<br />
• Ehegatten 1/2 x 1/2 = 1/4<br />
• Nachkommen 1/2 x 3/4 = 3/8<br />
... ergibt eine verfügbare Quote von 3/8, wenn Ehegatte und Nachkommen vorhanden (genauer:<br />
berechtigt) sind.<br />
Zudem erhält der Ehegatte u.U. Vermögenswerte aus Güterrecht (Vorschlag). Dieser Anteil ist<br />
durch Ehevertrag abänderlich, aber nicht zulasten der Pflichtteile der gemeinsamen Nachkommen<br />
(216 II).<br />
n Inhalt<br />
• Erbenstellung: Bei Enterbung kann der Pflichtteilsberechtigte mit der Herabsetzungskla-<br />
ge die Anerkennung als Erbe erzwingen (Gestaltungsklage), wenn ihn die Erben nicht<br />
auch so anerkennen (aber 522 I: Kein Schutz, wenn der Erbe seinen Pflichtteil bereits<br />
„dem Werte nach“ erhalten hat.<br />
• Belastungsfreiheit: Herabsetzungsklage als Schutz.<br />
• Bedingungsfreiheit (auch kein Aufschub der Erbteilung im Rahmen des Pflichtteils, s.u.<br />
S. 30)<br />
• Auflagenfreiheit: jedenfalls keine Auflagen, die einen Vermögensaufwand bedeuten (530<br />
analog). Für nicht vermögensmäßige Bedingungen: unklar; immerhin verbietet 531 einen<br />
Fall der Auflagen, die nicht ins Vermögen eingreifen. Nach <strong>DRUEY</strong> sind solche Auflagen<br />
generell erlaubt aus (vermutetem oder fingiertem?) Respekt für den Erblasser; jedenfalls<br />
zulässig sind auch Teilungsvorschriften im Bereich des Pflichtteilsrechts).<br />
• Gleichbehandlungsgebot: Deshalb kann der Erblasser nicht allzu einseitig gewisse Nach-<br />
kommen belasten.<br />
Die Enterbung<br />
n Strafenterbung (477-479)<br />
Pflichtteilsentzug (Wegfall der Erbenstellung!) wegen schwerer Vergehen:<br />
• schuldhaftes schweres Verbrechen gegen den Erblasser oder eine nahe verbundene Per-<br />
son (z.B. Verlobten, enge Freunde, Hausgenossen)<br />
• schuldhafte schwere Verletzung familienrechtlicher Pflichten gegen den Erblasser oder<br />
eine ihm nahestehende Person (Verletzung der Unterstützungspflicht, 328, kann ein sol-<br />
cher Grund sein).<br />
11/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Je näher das Verhältnis, desto geringere Anforderungen an die Schwere des Vergehens.<br />
Kein Grund ist es, wenn das Verbrechen in Erfüllung einer anderen Pflicht erfolgte, oder bei<br />
Verzeihung des Erblassers.<br />
n Präventiventerbung (480)<br />
Der Erbe kann u.a. enterbt werden, wenn er<br />
• Nachkomme ist<br />
• Beim Erbgang Verlustscheine für mehr als 1/4 seines gesetzlichen Erbteils vorliegen<br />
• Die entzogene Quote muß den Nachkommen des Enterbten nach gesetzlicher Erbordnung<br />
zukommen<br />
Hat der Erbe keine Nachkommen, kommt dieser Grund nicht zur Anwendung.<br />
n Nennung des Enterbungsgrundes<br />
Der Enterbungsgrund muß in den Verfügung von Todes wegen enthalten sein; die Beweislast für<br />
das Vorliegen des Grundes ist beim Profiteur der Enterbung (also wohl beim gesetzlichen Erben).<br />
Bei fehlender Angabe kann der Enterbte seinen Pflichtteil mit der Herabsetzungsklage verlangen<br />
(aber nicht mehr).<br />
Die Herabsetzung<br />
n Funktion und Wirkung<br />
Sanktion der Pflichtteilsverletzung (Transaktion vom Beklagten zum Begünstigten),Vollzug der<br />
Pflichtteilsgarantien; es sei denn, der geschützte habe bereits zu Lebzeiten „dem Werte nach“ sei-<br />
nen Pflichtteil erhalten (522). Nicht dasselbe wie die Angleichung, trotz Marginalie zu 535 (Irr-<br />
tum des Gesetzgebers).<br />
n Herabsetzbare Verfügungen<br />
sind Verfügungen von Todes wegen und Zuwendungen zu Lebzeiten (maßgebend ist der Zeit-<br />
punkt des Vollzugs).<br />
Katalog von 527:<br />
• Heiratsgut, Ausstattung, Vermögensabtretung (außer sie sind der Ausgleichung unterwor-<br />
fen, z.B. durch Anordnung des Erblassers)<br />
• Erbabfindungen, Auskaufsbeträge<br />
• Schenkungen, die der Erblasser frei widerrufen konnte, 5 Jahre vor seinem Tod verfügt<br />
• Umgehungsgeschäfte (auch früher als 5 Jahre)<br />
12/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
n Mehrheit herabsetzbarer Verfügungen<br />
Zwei Regeln:<br />
1. Zuerst werden die Verfügungen von Todes wegen herabgesetzt, dann die Zuwendungen<br />
unter Lebenden (523)<br />
2. Die Verfügungen auf gleicher Stufe werden proportional gekürzt (525 I).<br />
Keine solidarische Haftung unter den unter den Herabsetzungspflichtigen gegenüber den Pflicht-<br />
teilserben.<br />
n Maßgeblicher Zeitpunkt<br />
Pflichtteilsberechnung erfolgt zum Wert beim Todestag (474 I 2 ). Der Empfänger herabsetzbarer<br />
Schenkungen hat die Verlustgefahr nicht zu tragen (474, 528 I).<br />
n Klage<br />
• Der Pflichtteilserbe ist aktiv-, der zu Unrecht Begünstigte passiv legitimiert. Der Wil-<br />
lensvollstrecker ist nicht Partei. Ausnahmen: 524, Gläubiger der Pflichtteilserben, die<br />
Verlustscheine besitzen (direkter Anspruch gegen die Begünstigten).<br />
• Der Pflichtteilsanspruch ist erblich (542 II), aber nicht übertrag- oder pfändbar.<br />
• Klagefrist: 1 Jahr ab Kenntnis, absolut 10 Jahre ab Testamentseröffnung. Verwirkungs-<br />
frist. Einredeweise aber unbeschränkt geltend zu machen (533 III).<br />
Die Ausgleichung<br />
n Allgemeines<br />
Die Ausgleichung ist die Subtraktion der ausgleichungspflichtigen Werte im Zeitpunkt der Tei-<br />
lung.<br />
Zeitpunkt der Wertbestimmung ist der Todestag (630). Bei Verkauf der empfangenen Werte ist<br />
der Erlös maßgebend, bei Darlehen die Darlehenssumme (sog. Fixierung des Preises). Die An-<br />
rechnung ist diesfalls eine Verrechnung: Der Erblasser hat eine Forderung gegen den Schuldner,<br />
der durch Erbgang diese Forderung erwirbt (Konfusion).<br />
Der Pflichtige kann sich von der Ausgleichung befreien, wenn er die vorbezogenen Werte in den<br />
Nachlaß einwirft (Realkollokation, 628).<br />
n Pflicht zur Ausgleichung<br />
2 Wenn es um die Zuteilung geht, ist aber der Teilungszeitpunkt maßgebend; 474 I dient nur als<br />
Grundlage einer allfälligen Herabsetzung.<br />
13/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
626 teilt implizit die Erben in drei Kategorien:<br />
1. Die Nachkommen: nach 626 II haben sie außergewöhnliche, größere Zuwendungen aus-<br />
zugleichen, auch 631 II (Unübliche Ausbildungsleistungen).<br />
2. Die gesetzlichen Erben: Es wird nicht vermutet, daß irgendwelche empfangenen Werte<br />
auszugleichen seien, diese Vermutung ist aber einfach umzustoßen (626 I; jede Äußerung<br />
des Erblassers genügt, ist also „ausdrücklich“). Dasselbe gilt für die Nachkommen im Be-<br />
reich der Gelegenheitsgeschenke und üblichen Ausbildungsleistungen.<br />
3. Die eingesetzten Erben: Maßgebend sind ausschließlich Testamente usw.<br />
n Recht auf Ausgleichung<br />
Recht auf Ausgleichung haben die Erben, nach Meinung von <strong>DRUEY</strong> auch der überlebenden Ehe-<br />
gatte und auch die eingesetzten Erben. Sicher nicht Vermächtnisnehmer.<br />
n Die ausgleichungspflichtige Zuwendung<br />
• Jeder unentgeltlich erlangte Wert, ob Schenkung oder etwas anderes, auch was in Erfül-<br />
lung einer sittlichen Pflicht geleistet wurde (trotz 239 III OR).<br />
• Nach BGer und der h.L. ist nicht auszugleichen, was in Erfüllung einer Rechtspflicht<br />
geleistet wurde.<br />
• Ausstattungen: wird als Oberbegriff gesehen. Gemeint seien Zuwendungen, die der Exi-<br />
stenzsicherung, -begründung oder -verbesserung diesen sollen (BGer). Das Gleichbe-<br />
handlungsproblem muß augenfällig sein. Nach 631 gehen auch Ausbildungsleistungen<br />
größeren Ausmaßes unter „Ausstattungen“.<br />
• Zuwendungen über den Erbteil hinaus: 629 vermutet, diese seien auszugleichen, außer<br />
der Erblasser habe nachweislich (nicht ausdrücklich!) die Empfänger begünstigen wollen.<br />
Vermutungsweise nicht auszugleichen sind Heiratsausstattungen.<br />
• Zinsen, Gebrauchswert: 630 II verweist auf die Besitzesregeln: „Bösgläubig“ und also<br />
ausgleichungspflichtig soll derjenige Erbe sein, der trotz Kenntnis der Ausgleichungs-<br />
pflicht die Substanz der empfangenen Werte vermindert hat (vergleichbar der Stellung<br />
eines Pächters).<br />
n Anordnungen des Erblassers über die Ausgleichungspflicht<br />
• ... sind Verfügungen von Todes wegen. Der Erblasser ist frei in der Regelung der Aus-<br />
gleichungspflicht (nur 631 [Erziehungskosten] ist zwingend). Anordnungen können auch<br />
in einem Erbvertrag ergehen.<br />
• Form: Solche Anordnungen sind formfrei gültig (m.a.W.: die gesetzlichen Vermutungen<br />
von 626-632 sind mit irgendwelchen Nachweisen umzustoßen, nur 626 II für die Dispen-<br />
sierung von der Ausgleichung der Ausstattungen will eine „ausdrückliche Äußerung“).<br />
14/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Das Spezifische der Verfügung von Todes wegen<br />
n Irrelevanz erbrechtlicher Normen vor dem Erbgang<br />
Verfügungen von Todes wegen werden erst beim Erbgang wirksam, auch der Erbvertrag.<br />
• strenge Formerfordernisse<br />
• Jederzeitige Widerruflichkeit (außer Erbvertrag).<br />
Erbanwartschaften: können verkauft, verpfändet usw. werden, mit Zustimmung (und „Mitwir-<br />
kung“) allerdings des Erblassers (636 I), und in Schriftform (OR 165 [Zessionsvertrag], ZGB<br />
900 [Verpfändung einer Forderung ohne Urkunde]).<br />
n Höchstpersönlichkeit<br />
Verfügungen von Todes wegen sind absolut höchstpersönlich, also vertretungsfeindlich. Lücken<br />
können keine entstehen, da immer das gesetzliche <strong>Erbrecht</strong> bereit steht.<br />
• formeller Aspekt: Der Erblasser hat die Verfügung selbst vorzunehmen (mind. unter-<br />
schreiben, beim öffentlichen Testament).<br />
• materieller Aspekt: Der Inhalt der Verfügung muß vom Erblasser stammen; erforderlich<br />
n Abgrenzung<br />
ist auch eine genaue Spezifizierung der Anordnungen (sonst ev. Konversion in eine Stif-<br />
tung denkbar, wie es das BGer bei einer Zuwendung an „die Aussätzigen“ getan hat).<br />
Ein Geschäft unter Lebenden ist alles, was seine Wirkungen nicht (erst und nur) beim Tod einer<br />
Person entfalten soll.<br />
Rechtsgeschäfte unter Lebenden sind also:<br />
• Fortführung eines Geschäfts/Verhältnisses nach dem Tod (z.B. Vollmacht, OR 35 I)<br />
• Auflösung eines Vertrages beim Tod<br />
• Abmachungen, deren Wirkungen nach dem Tod eintreten, aber nicht den Nachlaß betref-<br />
fen<br />
• Abmachungen, die dem überlebenden Partner zugute kommen soll, unabhängig von der<br />
Reihenfolge des Todes<br />
• Todesfallversicherungen zugunsten Dritter<br />
Schenkungen, die beim Tod zu vollziehen sind, sind Vermächtnisse.<br />
15/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Das Testament<br />
n Das Spezifische des Testaments<br />
ist die Form. Das ZGB spricht von „letztwilliger Verfügung“ , 498 ff.<br />
Das Testament ist jederzeit widerruflich, weshalb korrespektive Testamente (Vollzug einer Ab-<br />
machung über das Testieren) ungültig sind.<br />
n Das holographe (eigenhändige) Testament (505 I)<br />
• handschriftliche Angabe von Tag, Monat, Jahr bei Abschluß der Niederschrift.<br />
• handschriftliche Niederschrift (Verweisungen sind also nicht möglich). Auch erfüllt,<br />
wenn die Hand des Erblassers gestützt wird, die Schrift muß nur individuelle Züge tra-<br />
gen.<br />
• Unterschrift, bei Abschluß der Niederschrift (Unterschrift). Wenn die Identifikation ge-<br />
währleistet ist, reicht ein Ausdruck wie „euer Vater“, „Der Bundespräsident“ usw. Beizug<br />
externer Umstände möglich.<br />
• 520a: Gültig ist ein Testament auch bei fehlender/falscher Datumsangabe, falls das Da-<br />
tum anders eruiert werden kann oder keine Rolle spielt.<br />
n Das öffentliche Testament (499 ff.)<br />
Der Erblasser teilt dem Beamten vor zwei urteilsfähigen Zeugen (499) seinen Willen mit, worauf<br />
dieser die Urkunde aufsetzt und unterschreibt.<br />
1. Der Erblasser unterschreibt und liest die Urkunde und erklärt, die Urkunde enthalte sei-<br />
nen Willen. Die Zeugen bestätigen seine Urteilsfähigkeit und die Tatsache seiner Erklä-<br />
rung unterschriftlich (501 II).<br />
2. Der Beamte liest die Urkunde vor, worauf der Erblasser erklärt, sie enthalte seinen Wil-<br />
len. Die Zeugen bestätigen unterschriftlich, die Urkunde sei vorgelesen worden, der Erb-<br />
lasser habe sein Einverständnis erklärt und sei urteilsfähig gewesen.<br />
Nach 503 haben die Zeugen gewisse Anforderungen zu erfüllen.<br />
n Nottestament<br />
506 ff. Der Erblasser ist wegen außerordentlicher Umstände (506) verhindert. Er kann seinen<br />
letzten Willen vor zwei Zeugen zu erklären. Einer von dieser schreibt die Erklärung nieder, beide<br />
unterschreiben und die Urkunde bei einer Gerichtsbehörde zu deponieren.<br />
16/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
n Ergänzung, Widerruf, Änderung (509 - 511)<br />
Ein Testament kann jederzeit geändert werden. Abgeschlossen ist es mit Datierung und Unter-<br />
schrift. Spätere Änderungen sind selbständige Verfügungen und müssen ihrerseits datiert und<br />
unterschrieben werden, auch wenn sie auf demselben Dokument stehen. Streichungen sind als<br />
Teilvernichtungen (510) immer möglich, ohne neue Datierung/Unterschrift.<br />
Ein neueres Testament hebt ein altes auf (511 I). Der Beweis des Widerrufs kann mit Indizien<br />
außerhalb des Testaments geführt werden.<br />
Widerruf durch physisches Einwirken (510), irgendeiner Art, auch durchstreichen des ganzen<br />
Testaments.<br />
Durch Widerruf des Widerrufs kann ein altes Testament wieder aufleben.<br />
Ein Widerruf kann in einem Erbvertrag (s.u.) liegen.<br />
Der Erbvertrag<br />
n Allgemeines<br />
Positiver (494) oder negativer (495) Erbvertrag. Bindend für beide, im Gegensatz zum Testament.<br />
Der Erbvertrag ist sowohl in den „Verfügungsarten“ (materielles) als auch in den „Verfügungs-<br />
formen“ (formelles) geregelt, 494-497 und 512-515; Klagen aus Erbvertrag 534 ff.<br />
Der Erbvertrag steht grundsätzlich unter <strong>Erbrecht</strong>, nicht unter OR, das nur anwendbar ist, soweit<br />
es ins <strong>Erbrecht</strong> paßt (z.B. 468 ZGB).<br />
n Form (512)<br />
• Erblasser: Seine Erklärung hat den Anforderungen von 501 oder 502 zu genügen. Die<br />
Zeugenbestätigung muß sich nur auf ihn beziehen. Unterschrift vertretungsfeindlich.<br />
• Andere Partei: ist nur der einfachen Schriftlichkeit unterworfen, 512 II ist für ihn ein<br />
Verweis auf OR 14. OR 13 nicht anwendbar. Vertretungsfreundlich.<br />
• Bei kombinierten Ehe- und Erbverträgen haben die Verfügungen von Todes wegen den<br />
Anforderungen von 501 oder 502 zu genügen.<br />
• Es können testamentarische Bestimmungen aufgenommen werden, da die Form des Erb-<br />
vertrags die Form des öffentlichen Testaments enthält.<br />
n Aufhebung des Erbvertrags (513 f.)<br />
Nur mit Zustimmung der Gegenpartei, aber schriftlich (OR 115 nicht anwendbar, wohl aber OR<br />
13: es reicht, wenn der Begünstigte unterschreibt).<br />
Einseitiger Widerruf:<br />
• Vorliegen eines Enterbungsgrundes (s.o.): Widerruf in Testamentsform<br />
17/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
• Säumnis in der Erbringung von Gegenleistungen: Widerruf formlos (analog 107 OR)<br />
• Willensmängel: formlose Erklärung<br />
• Der nicht verfügende Partner hat ein Widerrufsrecht, wenn der andere Leistungen nicht<br />
erbringt (beim negativen Erbvertrag).<br />
• Auch der Begünstigte soll ein Widerrufsrecht haben (z.B. bei arglistiger Vermögensver-<br />
schwendung)<br />
n Inhalt des negativen Erbvertrages<br />
Ist die Erbabfindung zu groß (d.h. verletzt sie Pflichtteile), unterliegt sie der Herabsetzung (535).<br />
Der Erbverzicht wirkt vermutungsweise auch zulasten der Nachkommen des Verzichtenden (495<br />
III, vgl. aber Enterbung/Erbunfähigkeit). Profitieren vom Verzicht soll der Erblasser, indem seine<br />
verfügbare Quote ansteigt.<br />
n Parteien und Vorgänge<br />
Immer der Erblasser, daneben irgendwelche anderen Parteien beim positiven, gesetzliche Erben<br />
beim negativen Erbvertrag, ev. auch seinerseits Erblasser.<br />
Mögliche Vorgänge sind Verfügungen von Todes wegen, Rechtsgeschäfte unter Lebenden (Ge-<br />
genleistungen), Entgegennahme von Erklärungen.<br />
n Unmöglicher Inhalt<br />
Anordnungen mit zwingender Testamentsform:<br />
• Einsetzung eines Willensvollstreckers<br />
• Errichtung einer Stiftung auf den Todesfall<br />
• Enterbung<br />
n Bindungswirkung<br />
• Erblasser: Der Erblasser verpflichtet sich, keine gegenteiligen Verfügungen von Todes<br />
wegen zu erlassen. Frühere widersprechende Verfügungen sind aufgehoben. Zu Lebzei-<br />
ten kann der Erblasser aber alles tun, was er will, außer 494 III: Anfechtung von Schen-<br />
kungen und Verfügungen von Todes wegen. Der Erblasser kann aber neben des notwen-<br />
digen Inhalts des Erbvertrages Zusagen zur Verwendung der versprochenen Werte ma-<br />
chen (960: ev. im GB vormerkbar).<br />
• Gegenpartei: Das Erbe kann immer noch ausgeschlagen werden, Vermächtnisse können<br />
abgelehnt werden. Aber der Verzichtende kann im Rahmen des Verzichts keine Pflicht-<br />
teile mehr geltend machen. Doch besteht Bindung an die versprochene Gegenleistung<br />
(pacta sunt servanda).<br />
18/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
• Aufhebung der Bindung: s.o. Nimmt ein Dritter eine Erklärung entgegen, so hat er zuzu-<br />
stimmen.<br />
n Klagen (534 ff., 522 ff.)<br />
• Herabsetzungsklage. Wie das Testament steht der Erbvertrag bei der Herabsetzung an er-<br />
ster Stelle (532). Herabzusetzen ist jede Leistung, die die Pflichtteile der anderen Erben<br />
verletzt; Obergrenze ist der Pflichtteil des Verzichtenden, obwohl dessen Erbenstellung<br />
entfällt (535 II). Es handelt sich um Herabsetzung, nicht um Ausgleichung. Der Anspruch<br />
auf Herabsetzung entfällt für diejenigen, die selbst Partei sind im Erbvertrag (Einwilli-<br />
gung).<br />
• Ungültigkeitsklage: Formfehler oder inhaltlicher Mangel (519 ff.). Der Erblasser selbst<br />
kann auch Mängel geltend machen, die auf die Zeit vor Vertragsschluß zurückgehen.<br />
Nach <strong>DRUEY</strong> und PICENONI reicht einfache, formfreie Mitteilung (514 verweist ohnehin<br />
auf OR).<br />
• Klage aus 494 III: Anfechtung von Schenkungen und Verfügungen von Todes wegen, die<br />
die Vereinbarungen des Erbvertrages aushöhlen.<br />
Die Arten von Anordnungen auf den Todesfall („Verfügungsarten“, 481 ff.)<br />
n Gesetzlicher Katalog<br />
Das Gesetz kennt einen numerus clausus von möglichen Anordnungen (z.B. keine Baugesuchs-<br />
stellung von Todes wegen). Dies kann umgangen werden durch Auflagen und Bedingungen.<br />
481-497 listen die Möglichkeiten auf.<br />
n Erbeinsetzung<br />
Auch eine juristische Person kann eingesetzt werden. Nur unter gewissen Aspekten wird zwi-<br />
schen gesetzlichen und eingesetzten Erben differenziert (Erbbescheinigung, Ausgleichungs-<br />
pflicht).<br />
n Vermächtnis / Legat<br />
Zuwendung bestimmter Vermögenswerte (Sachen, Rechte, Nachlaßquote, Geldsumme usw.),<br />
auch mit Modalitäten (Zuweisung einer Wohnung, aber mit Pflicht zur Mietzinszahlung an einen<br />
Erben).<br />
Die Abgrenzung ist Auslegungsfrage. Nach 483 II wird vermutet, die Zuweisung einer Quote sei<br />
Erbeinsetzung.<br />
19/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Das Vermächtnis kann eine Sache betreffen, die nicht im Nachlaß ist (Verschaffungsvermächt-<br />
nis), mit einem Ausgleichungsvermächtnis kann ein Erbe zugunsten anderer zur Ausgleichung<br />
verpflichtet werden, es können Untervermächtnisse angeordnet werden usw.<br />
Das Legat lastet auf einem bzw. auf allen Erben. Der Legatar hat gegen den oder die Beschwerten<br />
einen obligatorischen Anspruch, der entsteht, wenn ein Erbe sein Erbe angenommen hat. Ab die-<br />
sem Zeitpunkt läuft auch der Zins. Es besteht keine Mängelhaftung (485 I) oder sonstige Siche-<br />
rung an Bestand und Wert der vermachten Sache. Die Rechte der Erbschaftsgläubiger gehen vor.<br />
Der Legatar ist nicht Mitglied der Erbengemeinschaft. Ein Legatar kann aber auch Erbe sein; es<br />
wird aber vermutet, die Zuweisung einer Sache sei eine Teilungsvorschrift (608 III, 522 II).<br />
n Die Auflage<br />
Es können Verhaltensweisen der Erben und der Vermächtnisnehmer angeordnet werden (Tei-<br />
lungsvorschriften, Nutzungsweisen, alles mit Bezug auf den Nachlaß, nicht aber unbedingt mit<br />
Bezug auf ein Nachlaßobjekt).<br />
Jedermann mit einem Interesse am Vollzug der Auflage hat nach 482 I ein Klagerecht (Unter-<br />
schied zum Legatar: Kein Recht auf Schadenersatz bei Nichterfüllung der Auflage).<br />
Abgrenzung:<br />
• Alles, was ein Vermächtnis sein kann, ist im Zweifel ein Vermächtnis (so kann auch das<br />
stoßende Fehlen der Schadenersatzberechtigung umgangen werden).<br />
• Ein bedingter Anspruch geht unter mit Nichterfüllung, ein Anspruch mit Auflage aber<br />
nicht bei Nichterfüllung der Auflage. Auslegungsfrage.<br />
• Begünstigung an eine Vielzahl unbestimmter Empfänger kann die Errichtung einer Stif-<br />
tung sein.<br />
Haben Auflagen Vermögensaufwand zur Folge, unterstehen sie der Herabsetzung (530 analog).<br />
Dauer: Nach BGer max. 50-70 Jahre, vermutungsweise nur die Lebzeit des belasteten Erben.<br />
Erben- und Legatarsubstitution<br />
n Nacherbschaft, Nachvermächtnis<br />
Der Erblasser kann festlegen, wann ein Nachfolger in das Erbe eines Erben oder Vermächtnis-<br />
nehmers eintritt (489 I: vermutungsweise mit dem Tod). Unterliegt der Herabsetzungsklage<br />
(531).<br />
Nach 488 II ist nur eine einstufige Einsetzung gestattet.<br />
z.B. kann die Ehefrau als Nutznießerin (s.o.), einen Sohn als Vor- und den anderen als Nacherbe.<br />
Die Vorerbenstellung ist vererblich.<br />
20/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
n Ersatzverfügung<br />
Einsetzung eines Substituenten für den Fall, daß eine andere Person ausfällt (487, Kapitel „Ver-<br />
fügungsarten“). Kommt nur zum Zug, wenn der Erbe oder Vermächtnisnehmer seine Position<br />
überhaupt nie antritt.<br />
Die mangelhafte Verfügung<br />
n Auslegung<br />
Unklarheit schadet, kann aber u.U. durch Auslegung beseitigt werden (Kontext der Verfügung,<br />
Gegebenheiten außerhalb der Verfügung, rechtliche Auslegungshilfen durch Vermutungen).<br />
• Erbvertrag: hier geht es um Parteienschutz, weshalb das Vertrauensprinzip zur Anwen-<br />
dung kommt.<br />
• Testament: Willensprinzip. Es geht um die Ermittlung des Willens, der aber immer form-<br />
gedeckt sein muß. Der hypothetische Wille ist also irrelevant; dennoch kommt man nicht<br />
um die ergänzende Auslegung herum. Ist der Wortlaut klar, ist kein Platz für Auslegung.<br />
„favor testamenti“: Es wird versucht, das Testament weiterleben zu lassen; deshalb wird<br />
eine ungültige, unklare Bestimmung nach Möglichkeit als Stiftungserrichtung verstanden.<br />
Rechtliche Auslegungshilfen (Vermutungen):<br />
• Zuwendung einer Quote ist im Zweifel Erbeinsetzung, nicht Legat (483 II)<br />
• Zuwendung eines Objekts ist im Zweifel nicht Verschaffungspflicht (484 III)<br />
• Anspruch auf ein Vermächtnis trotz Erbausschlagung (486 III)<br />
• Vermutung des Widerrufs durch eine spätere Verfügung (511)<br />
• Zuweisung eines Objekts ist im Zweifel Teilungsvorschrift (608 III)<br />
• 626, 629, 631 I: Ausgleichungspflicht<br />
• 543 II: Bei Wegfall von Vermächtnisnehmern wird vermutet, daß deren Erben nicht in ih-<br />
re Stellung treten.<br />
n Die rechtlich mangelhafte Verfügung<br />
519 ff. (Titel „Ungültigkeitsklage“). Ungültigkeit muß immer gerichtlich erklärt werden, also auf<br />
Klage hin.<br />
Der wichtigste rechtliche Mangel, die Pflichtteilsverletzung, wird bei der Herabsetzungsklage<br />
behandelt.<br />
• Verfügungsunfähigkeit (Testament: 18. Altersjahr; Erbvertrag: volle Handlungsfähigkeit;<br />
keine Ausnahmen, auch nicht i.S. 19 II, außer für den nicht verfügenden Partner). Maß-<br />
gebender Zeitpunkt ist die Verfügung. Schwelle ist recht niedrig.<br />
21/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
• Willensmängel: Irrtum, Täuschung, Drohung, Furchterregung. Nicht OR-Maßstab, da das<br />
Vertrauensprinzip entfällt. Es reicht die Wahrscheinlichkeit der inhaltlichen Änderung<br />
der Verfügung durch äußeren Einfluß i.S. 519.<br />
• Rechts- und Sittenwidrigkeit: Nachteilsandrohung für rechtlich gewährleistete Handlun-<br />
gen ist rechtswidrig (mit Ausnahmen: „privatorische Klausel“, wenn der Erblasser recht-<br />
lich zulässige Anordnungen mit rechtlich zulässigen Mitteln durchsetzt [bei Kündigung<br />
einer Wohnung fällt die Wohnung an die Mieterin: legitim]).<br />
• Formfehler: Ausnahme enthält 520a.<br />
n Ungültigkeitsklage<br />
• Auf Klage oder durch (auch implizite) Anerkennung.<br />
• Der Erblasser kann eine ungültige (besser wäre anfechtbare) Verfügung bestehen lassen.<br />
Im Allgemeinen kann die Verfügung dennoch angefochten werden; nicht aber, wenn es<br />
sich um Willensmängel handelt: Nach einem Jahr des Schweigens nach Entdeckung ist<br />
der Mangel geheilt (469 II, diesfalls wird die erschlichene Verfügung zu seiner eigenen,<br />
da er sie genehmigt). Stirbt der Erblasser nach Ablauf der Jahresfrist, ist die Klage ausge-<br />
schlossen.<br />
• Parteien: 519 II, klagen kann jeder, der als Erbe oder Bedachter ein Interesse hat (v.a. die<br />
benachteiligten gesetzlichen Erben; nicht aber andere Personen wie z.B. die Erbengläubi-<br />
ger). Passiv legitimiert sind die begünstigten Personen.<br />
• (Verwirkungs-)Frist: Relativ ab Kenntnis 1 Jahr, absolut ab Testamentseröffnung 10 Jah-<br />
re. Im Fall von 521 II 30 Jahre (absolut und relativ). Einredeweise ist Ungültigkeit immer<br />
geltend zu machen.<br />
• Wirkung: Gestaltungsklage. Unwirksamkeit ex tunc der Verfügung. Das Urteil wirkt nur<br />
zwischen den Prozeßparteien (!). Es gibt also unvollständige Ungültigkeit sowohl in<br />
sachlicher wie personeller Hinsicht.<br />
• Nichtigkeit: Hier ist das Urteil ein Feststellungsurteil. Akte, die nicht vom Erblasser<br />
stammen, ohne schlüssigen Inhalt, inhaltlich nicht in eine Kategorie von Verfügungen<br />
faßbar. Nach RIEMER auch qualifiziert rechts- oder sittenwidrige Akte.<br />
• Auflagen und Bedingungen: Mängel der Auflagen oder Bedingungen können die Begün-<br />
stigungen, an denen sie haften, „infizieren“ (519 I Ziff. 3 in Bezug auf Bedingungen, 482<br />
II für Auflagen und Bedingungen). Ausnahme: vexatorische Klausel, 482 II, gelten als<br />
nicht geschrieben).<br />
22/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Der Nachlaß<br />
n Begriff und Berechnung<br />
Der Nachlaß bildet ein Sondervermögen der Erbengemeinschaft, ist also nicht nur durch Rechts-<br />
trägerschaft, sondern auch durch den Erwerb gekennzeichnet.<br />
Surrogation tritt ein, wenn ein wertmäßiger Zusammenhang gewahrt ist (Verkaufserlös eines<br />
Hauses, angelegt in Wertpapieren: Wird Teil des Nachlasses).<br />
Der Nachlaß wird berechnet als Nettogröße, unter Hinzurechnung der ausgleichungspflichtigen<br />
Werte.<br />
War der Erblasser verheiratet, ergibt sich der Nachlaß nach der güterrechlichten Auseinanderset-<br />
zung (Vorschlag, 210). Deren Vorbereitung ist Teil der Aufgaben des Willensvollstreckers.<br />
Jeder Erbe hat ein Recht auf Informationen über den Nachlaß gegenüber den anderen Erben (607<br />
III, 610 II), auch gegenüber Dritten.<br />
n Aktiven<br />
• 560 II: Übergang aller Aktiven (und Passiven), auch der Verfahrenspositionen wie Zivil-<br />
prozesse und Baubewilligungsverfahren, auch öffentlich-rechtliche Positionen, sofern<br />
diese nicht an die Person des Erblassers gebunden sind.<br />
• Höchstpersönliche Rechte sind nicht vererblich, wohl aber Ansprüche, die auf höchstper-<br />
sönlichen Rechten gründen (Unterhaltsanspruch geht mit dem Tod unter, bereits fällige<br />
Raten gehen über). Zwingend höchstpersönlich ist die Nutznießung, Arbeitsvertrag,<br />
dispositiv bei Auftrag, irregulären Dienstbarkeiten wie Bau- und Quellenrechten.<br />
• Erblich ist auch die Aktionärs- und Kommanditärstellung (außer Vinkulierung), bei ande-<br />
ren Gesellschaften kann die Unvererblichkeit oder deren Gegenteil vorgesehen werden.<br />
• Versicherungsansprüche: Ansprüche, die durch Tod ausgelöst werden, gehören nicht in<br />
den Nachlaß, ebenso Lebensversicherungen auf eigenen Namen des Erblassers (vgl.<br />
VVG 78, 85, 90 II). Begünstigungsklausel zugunsten Dritter sind nach der Praxis form-<br />
frei. Das Problem des Pflichtteilsschutzes (476, 529): in den Nachlaß einbezogen wird<br />
der Rückkaufswert (da die Versicherung vor dem Tod ja Teil des Vermögens ist). 3<br />
n Erbschaftsklage: Schutz der Nachlaßansprüche<br />
Durchsetzung in natura (598 I, Leistungsklage, auf Besitzverschaffung bzw. Registereintrag. In<br />
Bezug auf Forderungen ist es eine Feststellungsklage), analog der Vindikation. Die Klage ist sub-<br />
sidiär gegenüber der Teilungsklage.<br />
3 Kein Rückkaufswert: die temporäre Todesfallversicherung (Ungewißheit über den Eintritt des<br />
Versicherungsfalles).<br />
23/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Besonderheiten gegenüber der rei vindicatio:<br />
• Gesamtklage: Spezifizierung der Gegenstände erst auf Vollstreckungsstufe (zulässig ist<br />
auch die Klage auf Besitzverschaffung an einzelnen Gegenständen).<br />
• Gerichtsstand am letzten Wohnsitz des Erblassers.<br />
• Verjährung: 1 Jahr ab Kenntnis, absolut 10 Jahre / 30 Jahre bei Bösgläubigkeit. Diese<br />
Regeln stehen der Fahrnisersitzung als leges speciales entgegen.<br />
• Surrogation tritt ein<br />
• Beweisthema: nur die Erbenstellung, früherer Besitz des Erblassers oder der Erben ist ir-<br />
relevant<br />
• es können nicht nur Sachen, sondern alle Positionen herausverlangt werden.<br />
• Aktivlegitimation: Erbengemeinschaft; beschwerte Person im Falle von 601.<br />
• Passivlegitimation: Besitzer, der die <strong>Erbrecht</strong>e nicht anerkennt.<br />
n Passiven<br />
• Erbschaftsschulden (Schulden des Erblassers, begründet in dessen Leben).<br />
• Erbgangsschulden (Kosten des Begräbnisses, Honorar des Willensvollstreckers, begrün-<br />
det im Tod des Erblassers). Diese Kosten sind von der Pflichtteilsberechnung abzuziehen<br />
(474 I).<br />
• Haftung: für die Erbgangsschulden die Träger der posthumen Unterhaltspflicht. Beim öf-<br />
fentlichen Inventar haftet subsidiär der beantragende Erbe (584 II) für die Kosten des In-<br />
ventars. Schon vor der Teilung haften die Erben solidarisch und unbeschränkt (603 I);<br />
nach der Teilung externe Haftung (639). Bussen und Strafen sind gehen unter.<br />
• Steuern: bereits geschuldete, betragsmäßig festgelegte Steuerschulden gehen über.<br />
n Gläubigerschutz<br />
• Risiko für den Erbengläubiger: Sie werden geschützt in ihren Erwartungen auf den Erb-<br />
anfall eines nicht überschuldeten Nachlasses: Sie können sich durch Anfechtung (6 Mte.<br />
frist) zur Wehr setzen gegen Ausschlagung mit der Absicht der Gläubigerschädigung<br />
(578). Zudem können die Gläubiger bzw. die Konkursverwaltung an seiner Stelle die<br />
Herabsetzung verlangen. Bei der Teilung können die Erbengläubiger die Behörde ein-<br />
schalten (609 I).<br />
• Risiko für den Erbschaftsgläubiger: Erwerb durch einen überschuldeten Erben. Sie kön-<br />
nen bei begründeter Besorgnis für ihre Forderungen die Liquidation der Erbschaft ver-<br />
langen; diesfalls werden sie vom Erlös vorab befriedigt. Auch gehen sie den Vermächt-<br />
nisnehmern vor (564; gilt für die Erbengläubiger, wenn der Erbe die Erbschaft vorbe-<br />
haltlos angenommen hat).<br />
24/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Kein Schutz: gegen die Annahme einer überschuldeten Erbschaft; gegen die unterlassene An-<br />
fechtung eines nachteiligen Testaments. Die Erben können aber ihre Quote schriftlich abtreten<br />
(635), wodurch die Gläubiger einen Anspruch auf die zugefallenen Werte haben. Kein Schutz bei<br />
fehlenden Erben und Anfall an das Gemeinwesen, das nur mit dem Nachlaß selbst haftet.<br />
Das Handeln für den ungeteilten Nachlaß<br />
n Organisation des Erbganges<br />
Es geht um die Erhaltung des Nachlasses einerseits, um die Liquidation andererseits. Der Erb-<br />
schaftsverwalter des Erhaltens (554) ist nicht derselbe wie derjenige der Liquidation (595).<br />
Drei Ebenen:<br />
1. Privates Handeln<br />
2. staatliches Handeln auf Ersuchen eines Dritten: Ernennung eines Erbenvertreters, 602<br />
III), Erstellung eines öffentlichen Inventars (580-592), amtliche Liquidation (593-<br />
596), Entgegennahme der Ausschlagungserklärung (570).<br />
3. staatliche Handlungen ex officio: Sicherungsmaßnahmen, 551-555.l<br />
Erhaltung des Nachlasses:<br />
• Behörde<br />
• Erbschaftsverwalter<br />
• Erbenvertreter<br />
• Willensvollstrecker<br />
Liquidation:<br />
• Einzelobjekte: Willensvollstrecker<br />
• Gesamtnachlaß: Erbschaftsverwalter, Konkursamt<br />
Teilung:<br />
• Liquidation: s.o.<br />
• Zuweisung: Erbengemeinschaft, Mitwirkung Willensvollstrecker<br />
Die „Behörde“: meist im EG ZGB oder der ZPO bezeichnet. Zuständig ist der Kanton, in dem der<br />
Erblasser seinen letzten Wohnsitz hatte. Meist eine richterliche oder administrative Behörde.<br />
n Erbengemeinschaft<br />
Gemeinschaft zur gesamten Hand (652-654), Einstimmigkeitsprinzip zwingend. Der einzelne Er-<br />
be hat aber immer die Teilungsklage.<br />
Befugnisse einzelner Erben und Dritter:<br />
25/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
• Handlungen in dringenden Fällen<br />
• GoA (OR 419-424) in dringenden Fällen<br />
• Bestellung eines Erbenvertreters (602 III)<br />
• Entgegennahme von dringlichen Erklärungen Dritter durch jeden Erben (Betreibungsur-<br />
kunden: ohne Dringlichkeit, SchKG 65 III).<br />
• wo Erben gegen Erben stehen, kann keine Einstimmigkeit gefordert werden<br />
• jeder Erbe kann außerprozessual Vertragsmängel als Einrede/-wendung geltend machen<br />
Nicht als Handeln für den Nachlaß zu qualifizieren ist das Einholen von Auskünften usw.<br />
Handeln aufgrund besonderen Amts<br />
Erbschaftsverwalter, Erbenvertreter, Willensvollstrecker (vgl. S. 21 f.).<br />
n Gemeinsamkeiten<br />
• Vertretung der Erben (auch der Willensvollstrecker ist Vertreter der Erben). Es geht aber<br />
immer auch um Verwaltung des Nachlasses.<br />
• Können nicht abberufen werden (auch nicht durch einstimmigen Beschluß der Erbenge-<br />
meinschaft)<br />
• Nicht von den Instruktionen der Erben abhängig (Handeln nach objektiven Gesichts-<br />
punkten)<br />
• sie schließen das eigene Handeln der Erben für den Nachlaß aus.<br />
• sie treten in eigenem Namen auf<br />
• sie haben Besitz am Nachlaß (sollten aber den Erben die Sachen überlassen)<br />
• Das Amt des Willensvollstreckers umfaßt die Aufgaben des Erbenvertreters und des Erb-<br />
schaftsverwalters (517 f., 554 II)<br />
n Vertragsverhältnis<br />
Auftragsrecht, OR 394 ff.<br />
• Haftung nach OR 398 f. (Auftragsrecht)<br />
• Rechenschaftspflicht (OR 400)<br />
• Rücktrittsrecht (OR 404) des Beauftragten (nicht des Auftraggebers, vgl. oben)<br />
n Aufsicht<br />
durch die kantonal bestimmte Behörde (ZGB 595 III für den „Liquidationsverwalter“, Verweis in<br />
518 I für den Willensvollstrecker; gilt aber auch für die anderen).<br />
26/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Inhalt der Aufsicht:<br />
• Auskunftspflicht gegenüber der Behörde<br />
• Weisungsbefugnis<br />
• Aufhebung gewisser Amtshandlungen<br />
• Absetzung<br />
• Disziplinarmaßnahmen<br />
Handeln nur aufgrund einer Beschwerde, in krassen Fällen ex officio. Zivilrichter bleibt zuständig<br />
für materielle Fragen. BGer beurteilt solche Entscheide (Willkürbeschwerde, OG 68).<br />
n Erbschaftsverwalter<br />
Nachlaßerhaltung, ZGB 554 f., Erhaltung und Vermehrung der Werte / der Objekte in natura. Hat<br />
insb. mit der Teilung und der güterrechtlichen Auseinandersetzung nichts zu tun<br />
• Abwesenheit eines Erben ohne Vertreterbestellung<br />
• Ungewißheit über Erbenstellung<br />
• besondere Fällen (Nacherbschaft (490 III), Verschollenheit (548 I), vorläufige Maßnah-<br />
men bei Testamentseröffnung i.S. 556 III, vorläufige Maßnahme bei Zahlungsunfähigkeit<br />
eines Miterben (604 III).<br />
Der Erbschaftsverwalter im Zusammenhang mit der Liquidation, 595: Dieselben Aufgaben, aber<br />
er betreut hier auch die Veräußerung und die Schuldentilgung (Konkurs: 597, Liquidation durch<br />
das Konkursamt), Inventarerstellung und Rechnungsruf (595 II).<br />
n Erbenvertreter<br />
nur in 602 III.<br />
Einsetzung: Auf Antrag eines Erben, durch die Behörde (kann Antrag auch ablehnen)<br />
Amtsenthebung: durch die Behörde. Der Vertreter kann jederzeit grundlos aufgeben (OR 404).<br />
Aufgaben: Wie Erbschaftsverwalter, kann auch eingeschränkt werden<br />
n Willensvollstrecker<br />
Regelung: 517 Einsetzung, 518 Funktionen.<br />
Einsetzung: durch den Erblasser, im Testament (kann nicht in einem Erbvertrag geschehen, 517<br />
I).<br />
Funktion: Durchsetzung des Testaments und allfälligen Erbvertrages, des Erblasserwillens und<br />
des Rechts im Allgemeinen, Teilung ausführen (eig. vorbereiten, wozu auch die güterrechtliche<br />
Auseinandersetzung gehört), Vermächtnisse ausrichten, Nachlaß verwalten, Schulden bezahlen<br />
(umfaßt die Aufgaben der anderen Ämter). Er hat das Verfügungsrecht über die Nachlaßsachen.<br />
Kann als Schlichter zwischen den Erben walten.<br />
27/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Bei der Teilung ist der Willensvollstrecker auf die Erben angewiesen: Gegen deren Willen kann<br />
er nichts tun, nur Vorschläge machen (trotz 518 II). Grund: Autorität in Teilungsfragen ist immer<br />
nur der Richter (604).<br />
Der Willensvollstrecker ist nicht Partei im...<br />
• Streit um die Gültigkeit einer Verfügung von Todes wegen<br />
• Herabsetzungsstreit<br />
• Teilungsklage<br />
... weil er nie Partikularinteressen vertritt. Er kann also immer dann Partei sein, wo es für bzw.<br />
gegen den gesamten Nachlaß geht (z.B. in einer Erbschaftsklage). Befindet sich der Willensvoll-<br />
strecker in einem Interessenkonflikt, kann die Einsetzungsverfügung des Erblassers angefochten<br />
werden.<br />
Sichernde Maßnahmen<br />
n Allgemeines<br />
Wenn kein besonderer Nachlaßvertreter einsetzbar ist, sollte die Behörde selber eingreifen und<br />
die notwendigen Maßnahmen treffen (551 II) .<br />
Kantone: regeln die Siegelung (Verweis in 552).<br />
Bund/ZGB: regelt nur das amtliche Inventar, 553.<br />
n Siegelung und Inventar<br />
• Siegelung: eher enge Regelung der Kantone. Tatsächliches Verschlie-<br />
ßen/Unzugänglichmachen als Sicherung gegen Entwendung.<br />
• Inventar: Entwendungssicherung. Arten von Inventaren: Sicherungsinventar (553), öf-<br />
fentliches Inventar zur Begrenzung der Haftung für Erbschaftsschulden (580-592), In-<br />
ventar bei Erbschaftsliquidation (=amtliche Liquidation, 595 II), Steuerinventar (kant.<br />
Recht).<br />
Beim Sicherungsinventar sind nur die Aktiven wesentlich.<br />
Eintritt der Erben in ihre Stellung<br />
sofort (uno actu).<br />
n Einreichung des Testaments<br />
Einzureichen durch den Beamten und den Finder bei der Behörde ist alles, was eine letztwillige<br />
Verfügung sein will (556 I, II). Sonst:<br />
28/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
• Schadenersatz nach 556 I<br />
• Urkundenunterdrückung i.S. 254 StGB<br />
• Erbunwürdigkeit nach 540 Ziff. 4 ZGB (bei Urkundenbeseitigung/Verunmöglichung)<br />
Gültig ist die Urkunde auch, wenn sie erst 20 Jahre später auftaucht.<br />
Erbverträge: höchstens kantonale Regelung.<br />
n Eröffnung<br />
Kenntnisnahme durch die Behörden, Kenntnisgabe an die „Interessierten“:<br />
• Alle, die aus dem Bestand resp. Nichtbestand Vorteile ziehen (Begünstigte, gesetzliche<br />
Erben)<br />
• Legatare: diesen wird nur bekanntgegeben, was sie betrifft (558)<br />
Einladung zur Eröffnung an die Erben (557) II, erhalten den Eröffnungsbeschluß, können ihre<br />
Standpunkte bez. Gültigkeit und Interpretation bekanntgeben, erhalten Kopie des Testa-<br />
ments/Erbverträge.<br />
n Erbbescheinigung (559)<br />
an die eingesetzten und gesetzlichen (nicht erwähnt, weil selbstverständlich) Erben, wenn deren<br />
Erbeneigenschaft nicht durch die gesetzlichen Erben bestritten wird (durch schriftliche, auch un-<br />
begründete Einsprache innert 1 Monat).<br />
Wirkung:<br />
• ZGB 9: Vermutung der Richtigkeit der Bescheinigung (aber: Vorbehalt der Ungültig-<br />
keits- und Erbschaftsklage (559 III)<br />
• Gutglaubensschutz Dritter betreffend die Verfügungsfähigkeit der (provisorischen) Erben<br />
(z.B. Ausweis für einen GB-Eintrag, 18 II lit. a GBV); eine Bank muß Geld auszahlen,<br />
wenn dies gestützt auf eine Erbenbescheinigung verlangt wird.<br />
n Ausschlagung<br />
des Legats: Forderungsverzicht i.S. OR<br />
der Erbschaft: <strong>Erbrecht</strong>liches Institut. Durch mündliche oder schriftliche, unbedingte und vorbe-<br />
haltlose Erklärung an die Behörde.<br />
Ausschlagung z.B. zugunsten eines anderen Erben oder weil die Erbschaft manifest überschuldet<br />
ist (hier wird die Ausschlagung vermutet, 566 II. Annahmeerklärung: auch zuhanden der Behörde<br />
(ohne Regelung im ZGB).<br />
• Frist: nach 567 I drei Monate, ab Kenntnis des Erbanfalls (Abs. 2)/Zugang der behördli-<br />
chen Mitteilung für die eingesetzten Erben. Verlängerung aus wichtigem Grund ist mög-<br />
29/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
lich (576; z.B. Irrtum über das Volumen des Erbes und deswegen erfolgter Unterlassung<br />
der Ausschlagung). Erbeserben: neue Frist, 569.<br />
• Annahmerklärung: immer verbindlicher Verzicht auf die Ausschlagung (570 I analog<br />
anwendbar).<br />
• Einmischung (571 II, Betätigung als Erbe. Interpretation à la Vertrauensprinzip): Unwi-<br />
derrufliche Verwirkung der Ausschlagung; auch die Ausschlagungsvermutung bei über-<br />
schuldeter Erbschaft entfällt.<br />
• Wirkung: Wegfall der Erbenstellung, ex tunc. Nicht betroffen sind andere Zuwendungen<br />
(Legat, Versicherungsanspruch, Vorempfänge. Vgl. aber 578 [Anfechtung der Ausschla-<br />
gung durch die Erbengläubiger] und 564 [Vorrang der Erbengläubiger vor den Ver-<br />
mächtnisnehmern]). Es gilt das Eintritts- und subsidiär das Anwachsungsprinzip (s.o.).<br />
Schlagen alle gesetzlichen Erben aus, wird die Liquidation durch das Konkursamt ange-<br />
ordnet (573), ev. nach Anfrage des Ehegatten oder der entfernteren Erben. Allfällige Ak-<br />
tiven gehen trotzdem an die Erben, wobei nicht klar ist, wer das ist<br />
n Das öffentliche Inventar<br />
Errichtung durch ein kantonales Amt; Haftungsbeschränkung der Erben auf das Nachlaßvermö-<br />
gen.<br />
Verfahren: Begehren eines Erben, Frist 1 Monat (580 II), falls bis dahin nicht angenommen/aus-<br />
geschlagen/verwirkt/amtliche Liquidation angeordnet wurde (580 I). Kostentragung durch den<br />
Erben, wenn der Nachlaß nicht reicht (584 II).<br />
Aufgenommen werden Aktiven und Passiven, werden beide bewertet, ebenso Steuern und Forde-<br />
rungen aus öffentlichen Registern (z.B. GB), es wird ein Schuldenruf durchgeführt (582 I. Es gibt<br />
eine Reaktionsfrist). Während der Aufnahme ruhen die Betreibungen und nicht dringlichen Pro-<br />
zesse betreffend die Erbschaftsschulden (586), Verjährungen stehen still (OR 134 II).<br />
Nach Inventar haben alle Erben das Wahlrecht:<br />
• Annahme<br />
• Ausschlagung<br />
• amtliche Liquidation (Wirkung für alle, deshalb Einstimmigkeit verlangt).<br />
• Annahme „unter öffentlichem Inventar“ (gilt, wenn keine Erklärungen eingehen). Volle<br />
Haftung der Erben, nur für die inventarisierten Passiven 4 .<br />
Bereits erklärte Annahmen oder Ausschlagungen bleiben bestehen.<br />
n Die amtliche Liquidation<br />
4 Haftung für nicht inventarisierte Schulden nur im Rahmen der „Bereicherung“, d.h. mit den<br />
Nachlaßaktiven Bemessung per Todestag (590 II).<br />
30/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
Radikalere Maßnahme als das öffentliche Inventar. Der Sinn ist die Getrennthaltung von Nachlaß<br />
und Erbenvermögen. Versilberung der Aktiven, Haftung für die Schulden nur mit dem Nachlaß.<br />
Unterschied zur Ausschlagung aller Erben:<br />
• Erben behalten Erbenstellung<br />
• in beiden Fällen behalten die Erben eine Beteiligung an allfälligen Aktiven (578 III),<br />
doch ist hier die Situation klar (s.o.).<br />
• Der Nachlaß wird nicht durch das Konkursamt, sondern durch einen speziell bestimmten<br />
Verwalter liquidiert.<br />
Verfahren: Jeder Erbe kann die amtliche Liquidation verlangen, jeder auch verhindern durch<br />
(vorbehaltlose oder A. unter öffentlichem Inventar) Annahme der Erbschaft (593). Ebenso jeder<br />
Erbschafsgläubiger. Die Erbengläubiger nur, wenn ein überschuldeter Erbe ausgeschlagen hat,<br />
und nur aufgrund einer gerichtlicher Anfechtung der Ausschlagung (578, „Erbschaftspauliana“).<br />
n Die Stellung des provisorischen Erben<br />
Er ist bis zur Ausschlagung Vollerbe.<br />
Das allgemeine Teilungsrecht<br />
n Begriff und Funktion der Teilung<br />
Nach 604 hat jeder Erbe Anspruch auf Teilung. Durch die Teilung löst sich die Erbengemein-<br />
schaft auf.<br />
Einstimmigkeit. Niemand kann die Teilung aufzwingen, außer der angerufene Richter. Die Er-<br />
bengemeinschafterstellung kann nur an einen Miterben übertragen werden (StV ist aber möglich.<br />
Mit Dritten kann der Miterbe eine Treuhänderstellung vereinbaren, wirkt dann auf eigenen Na-<br />
men, aber fremde Rechung.<br />
Partielle Teilung:<br />
• objektiv partiell: nur gewisse Werte/Passiven<br />
• subjektiv partiell: nur gewisse Erben<br />
Die Solidarhaftung besteht weiter (639; Verjährung in 5 Jahren. Der Willensvollstrecker soll dar-<br />
auf hinwirken, daß die Schulden zuerst erledigt werden.<br />
n Teilungsvertrag<br />
1. Realteilung: wie eine Handschenkung<br />
31/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
2. Vertrag: wie ein Schenkungsversprechen, schriftlicher Vertrag und Besitzübertragung<br />
(traditio oder -surrogat). Auch Grundstücke können schriftlich zugeteilt werden 5 .<br />
Die Erbengemeinschaft haftet dem Erben für Sachmängel, bei Forderungen für Bestand und<br />
Zahlungsfähigkeit(also weiter als im OR AT!); dem Legataren gegenüber wird nicht gewährlei-<br />
stet (Vermutung von 485 I, widerlegbar durch Verfügung von Todes wegen).<br />
Die Verbindlichkeiten werden vermutungsweise nach Erbquoten aufgeteilt (640 III, entsprechen-<br />
de Regreßhaftung intern, 639 und 640); hier ist keine Schriftlichkeit erforderlich, außer es gehört<br />
integral zur Aktivenzuteilung (<strong>DRUEY</strong>, PICENONI, TUOR, a.M. ESCHER).<br />
Zuweisung ist vermutungsweise kein Vorkaufsfall (OR 216c II für Grundstücke, vgl. SCHMID,<br />
Sachenrecht). Aktienrecht: Vinkulierung wirkt nur im Zusammenhang mit der „Escape Clause“<br />
(OR 685b IV), bei börsenkotierten A. gar nicht.<br />
n Einleitung der Teilung<br />
• Einleitung: Jeder Erbe, jederzeit (604), aber auf den entsprechende Erbanteil beschränkt<br />
(subjektiv partielle Teilung, die anderen müssen nicht).<br />
• Aufschub: Auf Verlangen bei Gefahr von Werteinbussen (604 II); zwingend bei Rück-<br />
sicht auf einen nasciturus (605), auf Anordnung bei entsprechender Verfügung des Erb-<br />
lassers (als Auflage nach 482 oder als Teilungsvorschrift nach 608 oder als Bedingung 6 ),<br />
was allerdings nur im Rahmen der verfügbaren Quote möglich ist. Der erblasserische<br />
Teilungsaufschub kann durch formlosen Beschluß der Erbengemeinschaft aufgehoben<br />
werden (und auch beschlossen). Kein Aufschub durch Verfügung des Erblassers im<br />
Rahmen des Pflichtteile (s.o.).<br />
• Sicherstellung/Tilgung: kann jeder Erbe verlangen, 610 III.<br />
Der Willensvollstrecker macht einen oder mehrere Teilungsvorschläge, darf die Teilung aber<br />
nicht präjudizieren; bei Uneinigkeit keine partiellen Teilungen.<br />
n Zuteilungsregeln<br />
Gleichbehandlung: Der Anspruch auf eine bestimmte Sache ist – im Rahmen der Quoten – für<br />
alle gleich (entsprechend ist 611 II zu verstehen: keine besonderen Rechte durch besondere Nähe<br />
zum Erblasser). Es kann durchaus auf die persönliche Verwendung ankommen.<br />
Feste Zuteilungsregeln:<br />
• Forderungen gegen einen Erben sind diesem zuzuweisen, zum Nennwert (614; jeder trägt<br />
sein eigenes Bonitätsrisiko. Konfusion läßt die Forderungen untergehen).<br />
5 Vgl. ZGB 655 II. GB-Eintrag deklarativ für Verfügungsberechtigung, konstitutiv aber für die Verfügungsfähigkeit.<br />
Beim Verkauf ist im Anspruch auf GB-Anmeldung zum Verkauf auch ein Anspruch<br />
auf Eintragung des Veräußerer-Eigentümers enthalten.<br />
6 Privatorische Klausel: Ansprüche hängen von der Beachtung des Aufschubs ab.<br />
32/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
• Wer ein verpfändetes Objekt übernimmt, übernimmt auch die pfandgesicherte Schuld 7<br />
(615).<br />
• Überlebender Ehegatte: kann Nutznießung oder Zuweisung zu Eigentum verlangen, inkl.<br />
Hausrat (612a): keine Pflicht zur Übernahme.<br />
• Anspruch auf naturale Zuweisung: keine Versilberung. Ausnahmen: Zu großer Wert ei-<br />
nes Objekts oder fehlende Einigung (612 II: ist auf eben zu große Objekte bezogen zu<br />
verstehen, mind. nach <strong>DRUEY</strong>).<br />
Grenzen der Teilbarkeit: Zusammengehörige Teile sollten nicht getrennt werden, 613 (Unter-<br />
nehmen, Bibliotheken, Computeranlagen), ebenso, wenn dies einen großen Wertverlust bedeuten<br />
würde, 612 (z.B. antikes Schachset); gilt fast immer auch für Fälle von 613, weshalb es egal ist,<br />
ob Zugehör zu 612 oder 613 gehört.<br />
n Vorschriften des Erblassers<br />
Formzwang.<br />
Verbindlich (608 I, v.a. II).<br />
Trotzdem ist die Erbengemeinschaft nicht gebunden (Teilung: geschieht immer entweder durch<br />
Einigung aller, nur einiger Erben [subjektiv partiell] oder auf richterliches Urteil) 8 !<br />
Der Erblasser kann Zuteilungen (als Anrechung auf die Quote; ohne Anrechnung ist dies eine<br />
besondere Begünstigung, was keine Teilungsvorschrift ist), Verfahrensregeln bestimmen.<br />
n Bewertung<br />
Ist ein Verhandlungsakt der Erben, m.a.W. gibt es auch hier nur Wertschätzung, kein „iustum<br />
pretium“; Grenzen sind keine gesetzt. 9 Gesetzliche Teilungsvorschriften sind nur Leitlinien. Ein<br />
„objektiver“ Wert kann auf dem Weg der Versteigerung bestimmt werden (612 III: Auf Verlan-<br />
gen eines Erben; es kann auch eine amtliche Schätzung verlangt werden (618, maßgebend die<br />
Werte im Zeitpunkt der Teilung, 617, zur Bestimmung der Anrechnungsverhältnisse für<br />
Grundstücke; doch gilt dies auch für die Objekte der Pflichtteile: 474 I nennt den Todeszeitpunkt,<br />
dies aber nur als Grundlage der Herabsetzung! 617 nennt noch den Verkehrswert, doch ist nach<br />
<strong>DRUEY</strong> eben der Handelspartner nur der andere Erbe. Dito für 613a, der von Nutzwert spricht).<br />
Oft nennt auch der Erblasser Bewertungsvorschriften.<br />
7 Vermächtnisse: Objekt wird belastet, aber ohne die gesicherte Schuld übernommen.<br />
8 613 III, Zuteilung durch eine Behörde: nach Druey keine Ausnahme, sondern beziehe sich nur auf<br />
Familienwertgegenstände (613 II).<br />
9 Zum Marktwert: Der Markt ist hier eben die Erbengemeinschaft.<br />
33/34
<strong>DRUEY</strong> / <strong>Erbrecht</strong> von David Vasella im Dez. 2000<br />
n Teilungsverfahren<br />
• Einigung der Erben: Schriftlicher Vertrag, außer bei Realteilung. Die Erben haben ein<br />
Auskunfts- und Mittelungsrecht (607 III, 610 II).<br />
• Mitwirkung Dritter: Durch Vereinbarung der Erben oder durch Erblasser (Willensvoll-<br />
strecker: Vorbereitung, Durchführung, Schlichtung).<br />
• Streit: jeder Erbe kann die Behörde um Hilfe angehen (611 II; macht – unverbindliche –<br />
Vorschläge. Auch der Erbengläubiger kann die Behörde einschalten (609 I).<br />
Die einzige verbindliche Anordnung kann vom Gericht auf Teilungsklage kommen (Anord-<br />
nung der Teilung und Zuteilung). Der Erblasser kann ein Schiedsgericht einsetzen (h.L. , a.<br />
M. VOGEL).<br />
n Krisenmanagement<br />
• Grundregel: Losziehung, Zufallsentscheid (611 III). Praktisch selten 10 . Passen Objekte<br />
nicht in die Lose, sind sie zu verkaufen (612 II).<br />
• ev. Zuweisung durch eine Drittinstanz (Gericht). Verfahren: Zuteilung nach den Kriterien<br />
von 611 II; hilft dies nicht weiter, dann durch Zufallslose).<br />
Das bäuerliche <strong>Erbrecht</strong> (kurz)<br />
n Ungeteilte Zuweisung an den Selbstbewirtschafter<br />
Geschlechter sind gleichgestellt.<br />
Selbstbeanspruchung durch denjenigen Erben, der selbst bewirtschaften will und geeignet er-<br />
scheint (BGBB 11 I).<br />
n Familienbindung<br />
Bei mehreren Anwärtern haben die pflichtteilsgeschützten Erben den Vorrang (11 II).<br />
n Anrechnung zum Ertragswert (s.o.)<br />
BGBB 17. Verkehrswert also nicht maßgebend. Bundesrätliche Schätzungsanleitung beachten.<br />
10 Bedarf einer Anzahl Lose, die dem kgV entspricht. (bei /20-Bruchteilen 20 Lose, d.h. 20 Häufchen,<br />
die sogar noch möglichst homogen sein sollten, um dem Grundsatz der Gleichbehandlung zu<br />
entsprechen.<br />
34/34