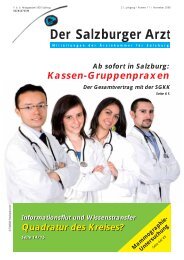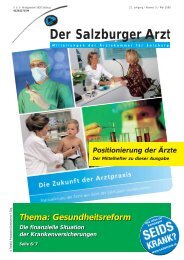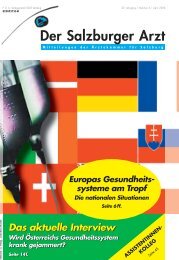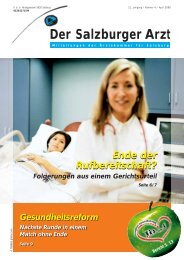7 - Ärztekammer für Salzburg
7 - Ärztekammer für Salzburg
7 - Ärztekammer für Salzburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
medizin in salzburg<br />
entscheiden. Auf die Gefahren einer sogenannten<br />
Triple-Therapie (OAK, ASS,<br />
Thienopyridine) bedeutet in jedem Fall<br />
eine erhöhte Blutungsgefahr (Univ.-Prof.<br />
Dr. Pichler – Univ.Kardiologie <strong>Salzburg</strong>).<br />
Es existieren dazu allerdings keine prospektiven<br />
Studien. Empfohlen wird ein<br />
engmaschiges INR-Monitoring, ein vorsichtiger<br />
Einsatz der sogenannten Bridging-Therapie<br />
mit Heparin (nur bei mechanischem<br />
Klappenersatz und Beinvenenthrombosen<br />
unter 3 Monaten), eine<br />
Blutdruckeinstellung unter 130/80 mm<br />
Hg, eine prophylaktische PPI-Einnahme<br />
bei Patienten mit Magenulcus bzw. die<br />
Eradikation bei HP-positiver Gastritis,<br />
die explizite Aufklärung bezüglich Gefahren<br />
bei Einnahme von NSAR und<br />
Aspirin-haltigen Medikamenten und die<br />
Risikostratifizierung bei Vorhofflimmern<br />
mit CHADS 2-Score. Bei der Notwendigkeit<br />
eines Stentings sollte nach Möglichkeit<br />
die Implantation eines drug eluting-Stents<br />
(DES) vermieden werden.<br />
Die ärgste Form einer Blutung ist wohl<br />
die intracerebrale Blutung, wobei allerdings<br />
bis 2005 der Begriff „major bleeding“<br />
nicht einheitlich definiert war<br />
(Univ.Prof.Dr. Iglseder – CDK <strong>Salzburg</strong>).<br />
Ein exzessiver Anstieg des ICH-Risikos<br />
besteht bei INR > 5, es sind dann auch<br />
größere Infarktvolumina und eine erhöhte<br />
Letalität zu erwarten. Ebenso ist<br />
bekannt, dass starke INR-Schwankungen<br />
mit einem erhöhten Blutungsrisiko<br />
assoziiert sind. Generell kann man<br />
sagen, dass das Blutungsrisiko sich pro<br />
INR-Zunahme etwa um 1 verdoppelt,<br />
hingegen wird das Blutungsrisiko bei<br />
Sturzgefährdung allgemein eher überschätzt.<br />
Bei Einhaltung eines INR-Zielbereiches<br />
von 2,0 – 3,0 ist ein signifikanter<br />
Anstieg intracranieller Blutungen<br />
nach Sturz nicht zu erwarten.<br />
Die tiefe Beinvenenthrombose stellt<br />
eine der häufigsten Erkrankungen des<br />
Herzkreislaufsystems dar, die jährliche<br />
Inzidenz beträgt 40–160 pro 100.000<br />
Einwohnern, die Inzidenz der Pulmonalembolie<br />
20–70 pro 100.000 (OA Dr.<br />
Sturm – Med. Universität Innsbruck).<br />
Entscheidungshilfen <strong>für</strong> eine optimale<br />
OAK-Therapie sind Schweregrad des<br />
VTE-Ereignisses, die Frage ob ein idiopathisches<br />
oder provoziertes Ereignis vor-<br />
liegt, das Blutungsrisiko, das Thrombophilie-Screening<br />
und die Guidelines zur<br />
antithrombotischen Therapie (ACCP<br />
2008 CHEST). Bei peripherer arterieller<br />
Verschlußkrankheit ist eine Langzeit-Antikoagulation<br />
nur <strong>für</strong> den Zustand nach<br />
Embolektomie und/oder hohem Risiko<br />
<strong>für</strong> einen Bypassverschluss sinnvoll, ansonsten<br />
werden Thrombozytenfunktionshemmer<br />
empfohlen.<br />
Die Hälfte der Indikationen zur oralen<br />
Antikoagulation im Kindesalter sind kardiologische<br />
Erkrankungen (Univ.-Prof.<br />
Dr. Streif – Med. Universität Innsbruck).<br />
Jüngere Kinder benötigen mehr Warfarin,<br />
mehr Zeit zum Erreichen des Ziel-INR,<br />
häufigere Testung und mehr Dosisanpassungen.<br />
Eine notwendige antithrombotische<br />
Therapie sollte man Kindern<br />
nicht vorenthalten, eine sehr geeignete<br />
Methode wäre in diesem Fall auch das<br />
Patienten-Selbstmanagement bei gleichzeitiger<br />
Einschulung der Eltern.<br />
Das Patienten-Selbstmanagement ist<br />
durchaus auch <strong>für</strong> ältere Patienten geeignet<br />
(Univ.-Prof. Dr. Siebenhofer-<br />
Kroitzsch – Med. Universität Graz). Im<br />
Vergleich zu Jüngeren sollte dabei eine<br />
niedrigere Startdosis gewählt werden,<br />
auch die Erhaltungsdosis ist häufig niedriger<br />
wegen Medikamenteninteraktionen<br />
und reduzierter Nierenclearance.<br />
Da häufigere Kontrollen das Blutungsrisiko<br />
vermindern sollte durchaus auch<br />
älteren Mitmenschen, die einen Schulungskurs<br />
besuchen wollen, Patienten-<br />
Selbstmanagement angeboten werden.<br />
Die Schulungsstelle <strong>Salzburg</strong> – Ambulatorium<br />
Nord (OA Dr. Krüttner, MMag.<br />
Dr. Zauner, SKA RZ Großgmain) konnte<br />
in einem 9 Jahre follow up zeigen, dass<br />
das Patienten-Selbstmanagement nach<br />
entsprechend qualitätskontrollierter und<br />
strukturierter Einschulung auch im Langzeitverlauf<br />
eine sichere Methode <strong>für</strong> das<br />
Monitoring der oralen Antikoagulation<br />
darstellt. Wie viele Studien und mehrere<br />
Review-Arbeiten eindeutig zeigen, reduziert<br />
sich die Thromboembolierate<br />
und die Gesamtmortalität signifikant unter<br />
Steuerung der OAK mit Selbstmanagement.<br />
Es verbessert sich somit die<br />
Qualität der Gerinnungseinstellung gegenüber<br />
jeglicher Fremdkontrolle.<br />
Entscheidend ist dies auch <strong>für</strong> die Le-<br />
32<br />
Der <strong>Salzburg</strong>er Arzt November 2008<br />
bensqualität der betroffenen Patienten,<br />
wie dies Frau Ulrike Walchshofer – Obfrau<br />
einer Selbsthilfegruppe von Gerinnungspatienten<br />
www.INR-Austria.at am<br />
eigenen Beispiel zeigte. Die Gerinnungskontrollen<br />
im Alltag bedeuten bei<br />
Selbstmanagement wesentlich weniger<br />
Streßbelastung <strong>für</strong> den einzelnen betroffenen<br />
Patienten.<br />
Interaktionen einer oralen Antikoagulation<br />
mit anderen Medikamenten (200<br />
Arzneimittel führen zur relevanten Interaktionen)<br />
sind zu beachten (OA Dr.<br />
Schuler – Univ.-Kardiologie <strong>Salzburg</strong>),<br />
insbesondere Vorsicht ist bei gleichzeitiger<br />
Gabe von Amiodaron, Tamoxifen<br />
und Allopurinol angezeigt. Bei diesen<br />
Medikamenten ist eine deutliche INR-<br />
Steigerung bzw. ein steigendes Blutungsrisiko<br />
zu beobachten. Dazu gibt es eine<br />
eigene Pharmakovigilanzstudie aus dem<br />
Jahre 2007.<br />
Ein abschließendes „Gerinnungsfeuerwerk“<br />
wurde von Herrn Univ.Prof.Dr.<br />
Pechlaner (Med. Universität Innsbruck)<br />
abgefeuert und dabei eine vorweihnachtliche<br />
Wunschliste an einen neuen<br />
Gerinnungshemmer abgegeben: Ein<br />
neuer Gerinnungshemmer sollte eine<br />
Tablette sein, weniger Einstellungsschwankungen<br />
aufweisen, weniger Blutungen<br />
und Thrombosen nach sich ziehen,<br />
keine allgemeinen Nebenwirkungen<br />
haben, keine Laborkontrollen benötigen,<br />
die Nierenfunktion unbeeinflusst<br />
lassen und nicht zu teuer sein.<br />
Abschließend bleibt somit die Gerinnung,<br />
was sie auch derzeit ist: spannend<br />
und ungewiss.<br />
Der Autor:<br />
OA Dr. Hermann<br />
Krüttner<br />
Sämtliche Literatur beim Verfasser:<br />
OA Dr. Hermann Krüttner<br />
SKA-RZ Großgmain<br />
<strong>Salzburg</strong>er Str. 520, 5084 Großgmain<br />
Hermann.kruettner@pva.sozvers.at