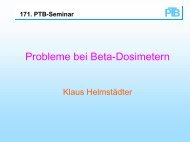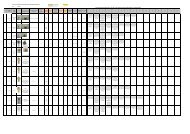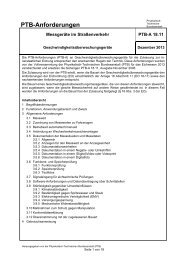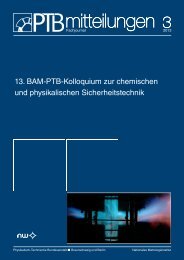Kapitel 1.2: Länge, Fläche, Volumen, Winkel - PTB
Kapitel 1.2: Länge, Fläche, Volumen, Winkel - PTB
Kapitel 1.2: Länge, Fläche, Volumen, Winkel - PTB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>1.2</strong>.1 <strong>Länge</strong> 27<br />
optische Mittel wird erreicht, daß die Strahlungen von zwei Eigenschwingungen mit den<br />
Frequenzen Vj und V2 senkrecht zueinander polarisiert den Laser verlassen. Über die<br />
Teilerplatte Ti gelangt ein Teil beider Strahlungen auf den Detektor Di. Hier entsteht ein<br />
phasenstarres Referenzsignal der Schwebungsfrequenz v, - V2. Die Phase des entsprechenden<br />
Signals aus dem Detektor D2 hängt dagegen von der Lage des Reflektors K2 ab.<br />
Sie ändert sich um 360° bei einer Verschiebung von K2 um Xiß ßi ist hierbei die kurze<br />
Wellenlänge der Strahlung der Frequenz V2 und nicht diejenige der Schwebung). Durch<br />
Vergleich mit dem Referenzsignal des Detektors D| können die Phasenänderungen des<br />
Signals aus dem Detektor D2 und damit die Verschiebung des Reflektors K2 gemessen<br />
werden.<br />
Meßfehler. Zählende Interferometer messen lediglich die Komponente der Spiegelverschiebung<br />
in Strahlrichtung. Um sogenannte Kosinusfehler zu vermeiden, müssen der Laserstrahl und die<br />
Richtung der Spiegelverschiebung parallel ausgerichtet werden. Zur Justierung kann das seitliche<br />
Auswandern des reflektierten Strahls, das bei fehlerhafter Ausrichtung während der Verschiebung<br />
auftritt, genutzt werden (Fig. 1.14).<br />
Fig. 1,14<br />
Fehlerhafte Ausrichtung von Laserstrahl und Verschieberichtung<br />
l vom Interferometer angezeigte Komponente der<br />
Spiegelverschiebung.<br />
'2 = 2/, seitliches Auswandern des reflektierten<br />
Strahls während der Verschiebung.<br />
Häufig ist die zu messende Spiegelverschiebung klein gegen den Gangunterschied im Interferometer.<br />
Schwankungen der Wellenlänge während der Messung durch Änderungen der Laserstabilisierung<br />
oder der Brechzahl der Luft wirken sich auf den gesamten Gangunterschied aus und führen in<br />
diesem Fall zu erhöhten Meßfehlern.<br />
Verschiebekomparatoren Um Strichmaßstäbe oder andere Prüflinge an die Wellenlängennormale<br />
der <strong>Länge</strong> anzuschließen, werden zählende Interferometer zusammen mit<br />
sogenannten Verschiebekomparatoren benutzt (Fig. 1.15). Der Prüfling P befindet sich<br />
zusammen mit dem Reflektor K2, dessen Verschiebung interferentiell gemessen wird, auf<br />
einem Schlitten. Der Meßkopf M dient zur Lokalisierung des Prüflings. Er muß der<br />
jeweiligen Meßaufgabe angepaßt werden. Zum Anvisieren von Strichen dienen Mikroskope<br />
mit Feinmeßokularen (Becker (1951)) oder automatisch arbeitende fotoelektrische<br />
Meßmikroskope, deren Reproduzierbarkeit bei 0,01 ^im liegt (Clark u. Cook<br />
(1956); Hock (1964)). Inkrementalmaßstäbe werden mit einem Vergleichsgitter unter<br />
Ausnutzung von Moire-Effekten abgetastet (Ernst (1989); Spies (1990)). Prüflinge<br />
Fig.1,15<br />
Verschiebekomparator<br />
I Zählendes Interferometer<br />
B massives Maschinenbett<br />
W verschiebbarer Wagen<br />
P Prüfling<br />
M Meßkopf<br />
El<br />
3: IS 3P<br />
• w