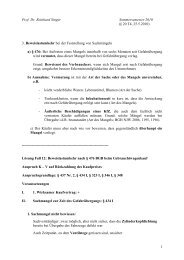7 Teil 5 - Prof. Dr. Reinhard Singer
7 Teil 5 - Prof. Dr. Reinhard Singer
7 Teil 5 - Prof. Dr. Reinhard Singer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Reinhard</strong> <strong>Singer</strong> Wintersemester 2009/2010<br />
(16.12.2009, § 7/T5)<br />
8. Das Fehlen des Erklärungsbewusstseins<br />
Grundkurs im Bürgerlichen Recht<br />
Lehrbuch-Beispiel: Trierer Warenversteigerung<br />
Ortsfremder (O) kommt nach Trier, geht in eine Gastwirtschaft, entdeckt einen Bekannten<br />
und winkt ihm zu. Zuschlag für einen „Fuder“ Wein zum Preis von 5.000 €. O war, ohne dass<br />
er dies bemerkt hatte, in eine Weinversteigerung geraten.<br />
a) Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Inhaltsirrtum:<br />
- Gemeinsamkeit: objektiver Tatbestand einer konkludenten Willenserklärung<br />
- Unterschied: subjektiver Tatbestand. Erklärender hat weder den Willen, noch das<br />
Bewusstsein, überhaupt eine Willenserklärung abzugeben (Erklärungsbewusstsein).<br />
b) Übersicht zum subjektiven Tatbestand der Willenserklärung:<br />
objektiver Tatbestand:<br />
subjektiver Tatbestand:<br />
Handlungswille<br />
§§ 104, 105<br />
Erklärung<br />
Erklärungsbewusstsein<br />
§ 118<br />
Geschäftswille<br />
§ 119<br />
(1) Fehlt Handlungswille: Erklärung nichtig (§ 105 I BGB). § 122 BGB analog nur<br />
anwendbar, wenn Vertrauenstatbestand zurechenbar ist (nicht bei Bewusstlosen,<br />
Geisteskranken).<br />
(2) Fehlt Geschäftswille: Erklärung nicht nichtig, sondern anfechtbar;<br />
Vertrauensschaden des Geschäftspartner ist zu ersetzen (§§ 119, 122 BGB).<br />
(3) Fehlt Erklärungsbewusstsein: h.M. wie Geschäftswille (§§ 119, 122 BGB analog).<br />
(a) arg.: Fehler der Selbstbestimmung prinzipiell gleichwertig und gleichgewichtig; ebenso<br />
Vertrauenstatbestand. Allerdings muss dieser zurechenbar sein; h.M. verlangt deshalb,<br />
dass der Verpflichtete wenigstens erkennen konnte, dass sein Verhalten als WE<br />
aufgefasst werden durfte.<br />
1
(b) Trierer Weinversteigerung: hier durchaus zweifelhaft, ob Ortsfremder den Irrtum<br />
vermeiden konnte. Tatfrage: Hinweise auf Auktion.<br />
(c) Münchener Merkur vom 14./16. August 1987: Immobilienversteigerung in Bristol<br />
(Großbritannien); Besucher mit nervösem Leiden ersteigerte unfreiwillig – als seine<br />
Hand zuckte - einen Häuserblock im Wert von mehreren Millionen Pfund.<br />
Bei unbewussten Reflexen fehlt sogar Handlungswille (§ 105 II analog: WE nichtig).<br />
Allerdings § 122 BGB analog oder §§ 280 I, 311 II, 241 II (vorvertragliche<br />
Pflichtverletzung):<br />
wer an einem nervösen Leiden mit Zuckungen leidet, muss ggf. Versteigerungen meiden<br />
oder Veranstalter informieren, um Missverständnisse zu vermeiden.<br />
Lösung Fall 41:<br />
I. Abgabe einer Bürgschaftserklärung?<br />
Auslegung gem. §§ 133, 157 BGB<br />
1. Wortlaut:<br />
„... haben wir ... Bürgschaft in Höhe von 150.000 € übernommen“.<br />
„Perfekt“: Bezugnahme auf Sachverhalt in Vergangenheit;<br />
aber: „haben“ kann sich auch auf die – vor Abgabe der Erklärung liegende – interne<br />
Willensbildung der Sparkasse beziehen.<br />
2. Umstände bei oder vor Vertragsschluss:<br />
Banken benutzen bei Bürgschaftsversprechen regelmäßig Formulare (AGB !), nicht<br />
einfache Briefe.<br />
3. BGH: Bürgschaftsversprechen.<br />
II. Willensmangel des Sparkassenangestellten (§ 166 BGB):<br />
1. Tatbestand: A wollte lediglich eine Bescheinigung erteilen, keine Willenserklärung<br />
abgeben; also fehlte das Erklärungsbewusstsein.<br />
2. Rechtsfolgen fehlenden Erklärungsbewusstseins:<br />
a) BGHZ 91, 324: § 119 I, 2. Alt. analog<br />
aa) Tatbestand vergleichbar: wer kein Erklärungsbewusstsein hat, will – wie im Fall des<br />
§ 119 I, 2. Alt. „eine Erklärung dieses Inhalts“ nicht abgeben<br />
Mängel der Selbstbestimmung und Vertrauenstatbestände in wesentlicher Hinsicht<br />
gleich gelagert: Wer erklärt zu kaufen, sich aber Verkauf vorstellt (fehlender<br />
Geschäftswille), befindet sich in einer ganz ähnlichen Lage wie derjenige, der das für<br />
2
Kauf übliche Zeichen gibt, aber nicht an Kauf denkt (fehlendes<br />
Erklärungsbewusstsein).<br />
bb) Zurechnung des Vertrauenstatbestandes setze allerdings voraus, dass dem<br />
Verpflichteten sein Erklärungsverhalten erkennbar und vermeidbar war<br />
(„fahrlässige Willenserklärung“).<br />
cc) Kritik: Zurechenbarkeitserfordernis richtig, zeigt aber zugleich, dass Fälle eben doch<br />
nicht völlig gleich gelagert sind; BGH formuliert Tatbestand der culpa in<br />
contrahendo (§§ 280 I, 311 II, 241 II BGB): Haftung auf Schadensersatz, aber keine<br />
Erfüllungshaftung (Staudinger/<strong>Singer</strong>, Vorbem. vor §§ 116 – 144 Rn. 37).<br />
2. Anfechtungserklärung:<br />
a) wirksame Anfechtungserklärung erfordert, dass der Irrende deutlich macht, die Erklärung<br />
solle wegen eines Willensmangels nicht gelten.<br />
b) allgemein gehaltene Formulierung der Sparkasse, dass sie keine Bürgschaft übernommen<br />
habe, genügte nicht.<br />
c) Kritik: angesichts der harten Haftung bei Fristversäumnis (Bürgschaft!) sind scharfe<br />
Anforderungen an die Anfechtungserklärung schwer verständlich.<br />
3. Abhandenkommen einer in einer Urkunde verkörperten Willenserklärung<br />
Lösung Fall 42:<br />
Wirksamkeit des Kaufvertrages:<br />
1. Übereinstimmende Willenserklärungen liegen vor, allerdings nicht zwischen F und K,<br />
sondern zwischen M und K. F ist hieraus nur verpflichtet, wenn M sie wirksam vertreten<br />
konnte:<br />
a) Auftreten in fremdem Namen (§ 164 I 2)<br />
b) Vertretungsmacht?<br />
aa) Ursprünglich hatte M Vollmacht gemäß § 167 Abs. 1 BGB; diese ist aber durch<br />
Widerruf erloschen (§ 168 Satz 2).<br />
bb) Rechtsscheinhaftung gem. § 172 BGB: M wurde Vollmachtsurkunde ausgehändigt<br />
und dem <strong>Dr</strong>itten (I) vorgelegt.<br />
Aber: Urkunde wurde an Vollmachtgeberin F zurückgegeben (§ 172 Abs. 2:<br />
Rechtsschein beseitigt).<br />
2) Vertrauenshaftung der F?<br />
a) Fahrlässige Verursachung eines Rechtsscheintatbestandes: Verwahrung der<br />
Urkunde im Wäscheschrank fahrlässig.<br />
3
) Ähnlichkeit mit dem Fehlen des Erklärungsbewusstseins?<br />
aa) BGH: §§ 170 - 172 BGB sind Fälle, in denen bewusst ein Rechtsscheintatbestand<br />
geschaffen worden ist. Fahrlässige Herbeiführung des Rechtsscheins genüge nicht.<br />
bb) Haftung wegen Verschuldens bei Vertragsverhandlungen (culpa in contrahendo)<br />
gem. §§ 280 I, 311 II, 241 II BGB; Umfang: Vertrauensschaden, keine<br />
Erfüllungshaftung.<br />
cc) Parallele zum fahrlässig verursachten Rechtsscheins bei fehlendem<br />
Erklärungsbewusstsein:<br />
- spricht aber für Gleichbehandlung der Fälle; also entweder §§ 119, 122 BGB analog<br />
oder einheitlich culpa in contrahendo (vgl. Staudinger/<strong>Singer</strong>, Vorbem. vor §§ 116 –<br />
144 Rn. 49).<br />
- wegen des erhöhten Missbrauchsrisikos (Vollmachtsurkunde) sogar<br />
verschuldensunabhängige Haftung analog § 122 BGB sachgerecht.<br />
--------------------------------------------------------------------<br />
Exkurs: Unterschriftsirrtum:<br />
a) Vom Irrenden selbst verfasste Urkunde: allg. Regeln; Verschreiben = § 119 Abs. 1, 2.<br />
Alt. usw.<br />
b) Unterschrift unter eine von anderen verfasste Urkunde:<br />
aa) wenn der unterschreibende die Urkunden verwechselt: § 119 Abs. 1, 2. Alt.<br />
bb) wenn er den Inhalt falsch versteht: Inhaltsirrtum<br />
cc) wenn er nicht bemerkt, dass er eine rechtsgeschäftliche Erklärung abgibt<br />
Bsp.: Absender unterschreibt Glückwunschkarten, darunter befindet sich ein<br />
Bestellformular für einen Handy-Vertrag, den A versehentlich mitunterschreibt;<br />
fehlendes Erklärungsbewusstsein.<br />
dd) wenn Unterschrift unter eine rechtserhebliche Erklärung (Handy-Vertrag) unter einem<br />
Vorwand (Autogramm, Bescheinigung über Kundenbesuch) erschlichen wird:<br />
arglistige Täuschung (§ 123 Abs. 1 BGB).<br />
ee) wenn Urkunde ungelesen unterschrieben wird, zwei Fälle zu unterscheiden:<br />
(1) kein Irrtum, wenn sich Erklärender keine konkreten Vorstellungen vom Inhalt der<br />
Urkunde macht (Larenz/Wolf, § 36 Rn. 27 f.)<br />
Grund: Irrtum setzt voraus, dass sich Erklärender Vorstellungen macht<br />
(2) Wenn sich aber Erklärender konkrete Vorstellungen macht (Verlängerung des<br />
Mietvertrages), aber ein Schriftstück anderen Inhalts unterschreibt (Kündigung des<br />
Mietvertrages): Inhaltsirrtum, § 119 Abs. 1 BGB.<br />
------------------------------------------------------------------------------<br />
4
[4. Der Dissens gemäß §§ 154, 155 BGB und seine Abgrenzung gegenüber dem<br />
Inhaltsirrtum<br />
a) Inhaltsirrtum: wenn durch objektiv-normative Auslegung Inhalt des Vertrages wird, was<br />
der Erklärende nicht erklären wollte.<br />
Beispiel Haakjöringsköd: objektiv Vertrag über Haifisch; Inhaltsirrtum, wenn nur<br />
Verkäufer sich irrt (Walfisch).<br />
b) Kein Dissens, da Willenserklärungen objektiv übereinstimmen und - falls V nicht anficht –<br />
mit dieser Bedeutung gelten.<br />
Im Original-Fall: kein Dissens, weil sich Parteien subjektiv einig waren (falsa<br />
demonstratio non nocet)<br />
c) Dissens nur, wenn die Willenserklärungen objektiv und subjektiv nicht<br />
übereinstimmen.<br />
Lösung Fall 43:<br />
V<br />
890<br />
980<br />
K<br />
980<br />
890<br />
Total-Dissens: Willenserklärungen stimmen weder objektiv, noch subjektiv überein.<br />
§ 155 BGB nicht einschlägig: Einigungsmangel in Bezug auf Hauptpunkte; § 155 gilt nur für<br />
Nebenpunkte (accidentalia).<br />
Lösung Variante von Fall 43:<br />
Falls K erkennt, dass sich V verschrieben hat:<br />
Einigung über den von V gewollten Kaufpreis von 980 € (falsa demonstratio non nocet).<br />
11. Die mehrdeutige und widersprüchliche Willenserklärung:<br />
Bsp.: Fall 24 („Zwei Zimmer mit drei Betten“):<br />
5
a) Willenserklärung, die objektiv mehrdeutig ist, ist nichtig<br />
b) Ausnahme: Geschäftspartner erkennt zufällig den wahren Willen des Erklärenden.<br />
c) Silber-Fall oder Börsenkurs-Fälle: hier ist unklar, ob Käufer auch bereit ist, den richtig<br />
errechneten Kaufpreis zu zahlen.<br />
Folge: kein Konsens wie im Rubel-Fall (Fall 34), wohl aber Anfechtungsrecht analog §<br />
119 Abs. 1 BGB oder Rücktrittsrecht wegen eines gemeinsamen Irrtums über die<br />
Geschäftsgrundlage gem. § 313 II, III BGB. ]<br />
12. Die <strong>Dr</strong>ohung gemäß § 123 I BGB<br />
Anfechtungsgrund: Widerrechtliche <strong>Dr</strong>ohung;<br />
Anfechtungsfrist: 1 Jahr (§ 124 BGB) ab dem Zeitpunkt, zu dem die Zwangslage aufhört.<br />
1. <strong>Dr</strong>ohung<br />
a) Definition: In-Aussicht-Stellen eines Übels, dessen Verwirklichung vom Willen des<br />
<strong>Dr</strong>ohenden abhängen soll.<br />
b) Beispiel: <strong>Dr</strong>ohung mit einer Kündigung, Strafanzeige usw.<br />
c) Gegensatz: Bloße Warnung = Hinweis auf Folgen, die ohne Rücksicht auf den Willen<br />
des Warnenden eintreten.<br />
Beispiel: Bankkunde droht mit Insolvenz, wenn die Bank nicht Kredit gewährt.<br />
Keine <strong>Dr</strong>ohung im Rechtssinne, da der Konkurs wegen Zahlungsunfähigkeit eintritt,<br />
nicht, weil der Bankkunde dies will.<br />
2. Widerrechtlichkeit der <strong>Dr</strong>ohung<br />
a) Widerrechtlichkeit des Mittels: Rechtswidrig, wenn <strong>Dr</strong>ohung mit rechtswidrigem<br />
Verhalten<br />
Beispiel: Eintreiben von Forderungen mit der Androhung, Schuldner zu verprügeln;<br />
legitim ist dagegen die <strong>Dr</strong>ohung, den Schuldner zu verklagen.<br />
b) Rechtswidrigkeit des Zwecks: Rechtswidrig, wenn kein Anspruch gegen den Bedrohten<br />
Beispiel: <strong>Dr</strong>ohung mit einer Strafanzeige, wenn Bedrohter nicht 5.000 DM zahlt (auf<br />
die kein Anspruch besteht); Erpressung.<br />
6
c) Lösung Fall 44:<br />
Rechtswidrigkeit der Mittel-Zweck-Relation:<br />
1. Mittel der <strong>Dr</strong>ohung: <strong>Dr</strong>ohung mit Strafanzeige per se rechtmäßig.<br />
Problem: Strafanzeige richtet sich nicht gegen die Bedrohte, sondern gegen deren<br />
Ehemann auch Übel für F<br />
2. Rechtmäßigkeit des Zwecks? Gläubiger G hat keinen Anspruch auf Bürgschaft der F.<br />
Ansprüche bestehen höchstens gegen S.<br />
3. BGH: entscheidend Mittel-Zweck-Relation<br />
a) <strong>Dr</strong>ohung rechtmäßig, wenn der <strong>Dr</strong>ohende ein berechtigtes Interesse an dem<br />
angestrebten Erfolg hat und die <strong>Dr</strong>ohung ein angemessenes Mittel zur Verfolgung dieses<br />
Interesses darstellt.<br />
BGH: Gläubiger G hat zwar keinen Anspruch auf eine Bürgschaft nach der<br />
Rechtsordnung, wohl aber nach der Sittenordnung; für Ehefrau gehöre es sich, ihrem<br />
Mann zu helfen und seine Schulden zu bezahlen.<br />
Kritik: Sippenhaftung! Bedrohte Ehefrau eher davor zu schützen, dass sie gezwungen<br />
wird, eine Sicherheit zu stellen (Vertragsfreiheit).<br />
Seit Bürgschaftsrechtsprechung (BVerfGE 89, 214 – Fall 6: strukturelle Unterlegenheit<br />
bei familiärer Zwangslage) wohl nicht mehr vertretbar; Fremdbestimmung.<br />
b) BGH: Strafanzeige gegen <strong>Dr</strong>itte gerechtfertigt, wenn der Bedrohte an der Straftat<br />
mitgewirkt hat oder daraus Vorteile gezogen hat.<br />
F war an der Firma des S beteiligt.<br />
-----------------------------------------------------------------------------<br />
Ergänzung: nach BGH wäre auch <strong>Dr</strong>ohung gegenüber Eltern, Sohn wegen bestimmter<br />
Straftaten anzuzeigen, wenn diese nicht den Schaden wiedergutmachen, gerechtfertigt!<br />
Bedenklich, weil Eltern außerhalb von § 832 BGB grds. nicht zum Schadensersatz<br />
verpflichtet.<br />
Allenfalls dann vertretbar, wenn diese Vorteile aus der strafbaren Handlung des Sohnes<br />
gezogen hätten.<br />
------------------------------------------------------------------------------<br />
Lösung Fall 45:<br />
<strong>Dr</strong>ohung mit einer Kündigung, um eine einvernehmliche Auflösung des<br />
Arbeitsverhältnisses zu erreichen.<br />
1. <strong>Dr</strong>ohung widerrechtlich, wenn Kündigung rechtswidrig?<br />
2. BAG: ausreichend, wenn verständiger Arbeitgeber eine Kündigung für berechtigt halten<br />
durfte.<br />
7
a) Kritik: Maßstab nicht justiziabel.<br />
b) Fall: Kündigung rechtswidrig, weil verständiger Arbeitgeber bei Pflichtverletzungen<br />
nur nach einer vorhergehenden Abmahnung kündigt.<br />
Ergebnis: Anfechtung des Auflösungsvertrages wegen widerrechtlicher <strong>Dr</strong>ohung gemäß §<br />
123 Abs. 1 BGB wirksam.<br />
--------------------------------------------------------------------------<br />
13. Arglistige Täuschung gemäß § 123 BGB<br />
a) Unterschied zu § 119 BGB: Arglistige Täuschung kann sich auf jeden Irrtum, auch auf<br />
Motivirrtum beziehen.<br />
Beispiele: Verkauf der Grafik Papagenos (Fall 34) Irrtum der Verkäuferin über die<br />
richtige Preisliste = einseitiger unerkannter Motivirrtum<br />
Falls aber Kunde der Verkäuferin vorschwindelt, dass auf der Preisliste 850.- € statt<br />
2.500.- € stehen, Anfechtung wegen arglistiger Täuschung über Motivirrtum<br />
b) Täuschung = vorsätzliche Erregung eines Irrtums.<br />
aa) Für den Vorsatz genügt „dolus eventualis“.<br />
Bsp.: „Angaben ins Blaue“<br />
Ungeprüfte - blinde - Angabe des Verkäufers, das verkaufte Fahrzeug sei unfallfrei<br />
Falls Unfallwagen, liegt eine vorsätzliche Irrtumserregung vor, weil Verkäufer als sicher<br />
hingestellt hat, was in Wahrheit unsicher ist.<br />
bb) Keine Täuschung im Rechtssinne liegt vor, wenn es erlaubt ist, die Unwahrheit zu<br />
sagen.<br />
Jedenfalls ist Täuschung dann nicht rechtswidrig. Hauptbedeutung: Personalfragebögen<br />
im Arbeitsrecht.<br />
-----------------------------------------------------------------------------<br />
Lösung Fall 46:<br />
Lösung: Arbeitgeber darf nur zulässige Fragen stellen.<br />
Grund: unzulässige Fragen verletzen Persönlichkeitsrecht des AN; Unwahrheit =<br />
Notwehr des AN<br />
Zulässig sind Fragen, an deren Antwort Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse hat.<br />
8
Einzelfragen:<br />
(1) Vorstrafen: nur einschlägige und nach dem BZRG noch nicht getilgte<br />
Vorstrafe wegen Unterschlagung: bei einem Buchhalter als Vermögensdelikt<br />
einschlägig.<br />
Tilgungsfrist gem. § 46 II Nr. 2 BZRG (Schö 92) bei Freiheitsstrafen von mehr als drei<br />
Monaten, aber nicht mehr als einem Jahr, wenn die Vollstreckung zur Bewährung<br />
ausgesetzt worden ist: 10 Jahre.<br />
Hier: 11 Jahre; A darf „lügen“.<br />
(2) Schwangerschaft:<br />
EuGH und BAG: Frage nach der Schwangerschaft generell unzulässig; auch wenn<br />
Nachtschwester nicht beschäftigt werden darf (§ 8 MuSchG - Beschäftigungsverbot).<br />
Grund: Unzulässige Diskriminierung von Frauen gem. §§ 1, 7 AGG (früher § 611a<br />
BGB). Nur Frauen werden schwanger und werden daher gegenüber Männern bei der<br />
Einstellung benachteiligt, wenn sie die Frage wahrheitsgemäß beantworten müssen<br />
(siehe auch Art 3 II und III GG, Art 141 EG-Vertrag).<br />
Geschlecht ist auch keine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung<br />
gem. § 8 Abs. 1 AGG (wie z.B. bei Mannequin), da Beschäftigungsverbot nur<br />
vorübergehendes Hindernis.<br />
Finanzielle Belastungen des AG rechtfertigen keine Diskriminierung<br />
(3) Frage nach der Schwerbehinderung war nach älterer Rspr. des BAG (NZA 1996, 371)<br />
zulässig trotz Art 3 III 2 GG.<br />
Grund: Schutzpflicht für die Schwerbehinderten erfüllt Gesetzgeber im SGB IX. Gem.<br />
§ 71 SGB IX ist jeder Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen verpflichtet, 5 %<br />
der Arbeitsplätze mit Behinderten zu beschäftigen.<br />
Aber seit 2006 wegen § 81 II SGB IX, der auf die §§ 1, 7 AGG verweist, nicht mehr<br />
vertretbar (Brox/Rüthers/Henssler, Rn. 170; ErfK/Preis, § 611 Rn. 274); Frage nach<br />
Schwerbehinderung/Behinderung in pauschaler Form unzulässig<br />
zulässig ist allerdings Frage nach Behinderung, die vertragsgemäße Arbeitsleistung<br />
dauerhaft unmöglich macht (arg.: § 8 I AGG „wesentliche und entscheidende<br />
berufliche Anforderung“).<br />
---------------------------------------------------------------------------<br />
9