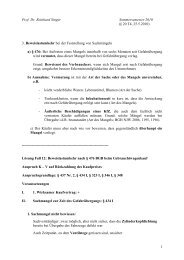Lösungshinweise Examensklausur Tinnitus:
Lösungshinweise Examensklausur Tinnitus:
Lösungshinweise Examensklausur Tinnitus:
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Lösungshinweise</strong> <strong>Examensklausur</strong> <strong>Tinnitus</strong>:<br />
A. Ansprüche des K gegen das Theater ?<br />
I. Schadensersatz und Schmerzensgeld wegen des Gehörschadens gem. §§ 280 I,<br />
253 II BGB<br />
Voraussetzung: Schuldverhältnis B – K<br />
gemischttypischer Theaterbesuchsvertrag (Elemente: §§ 535, 631 BGB)?<br />
1. übereinstimmende Willenserklärungen (-); weder B noch K wollten einen Vertrag<br />
schließen.<br />
2. Lehre vom sozialtypischen Verhalten (Hamburger Parkplatzfall, BGHZ 21, 319)?<br />
- wird nicht mehr vertreten, da Widerspruch zur Privatautonomie<br />
- stattdessen Vertragsschluss gem. § 151 S. 1 BGB (Medicus, BR Rn. 190) oder – bei<br />
Minderjährigen – Herausgabe der erlangten Vorteile über Bereicherungsrecht<br />
(BGHZ 55, 128 – Flugreise).<br />
- kein Vertragsschluss gem. § 151 S. 1; Theater will nicht mit jedem Besucher einen<br />
Vertrag schließen (Plätze begrenzt), jedenfalls nicht mit K (Hausverbot)<br />
II. Schadensersatz und Schmerzensgeld gem. §§ 831, 253 II BGB<br />
1. Verrichtungsgehilfe<br />
- mit Wissen und Wollen des Geschäftsherrn in dessen Interesse tätig<br />
- weisungsgebunden (arg. § 831 I 2, 2. Hs. )<br />
G und Regisseur = Arbeitnehmer des Theaters (+)<br />
2. Rechtswidrige unerlaubte Handlung<br />
a) Verletztes Rechtsgut:<br />
aa) Körper: körperliche Unversehrtheit (+)<br />
bb) Gesundheit: Störung der normalen körperlichen Lebensfunktionen (=<br />
Krankheit): (+) Ohrgeräusche<br />
b) Handlung: aktives Tun oder Unterlassen ?<br />
natürliche Betrachtung: positives Tun<br />
1
Aber: Schuss für normalen Zuschauer ohne Folgen; Schwerpunkt des<br />
Tatvorwurfs (Otto, Jura 2000, 549) eher unterlassene Warnung empfindlicher<br />
Zuschauer<br />
BGH NJW 2006, 610 und Vorinstanzen (OLG Frankfurt NJW 2004, 2833; LG<br />
Wiesbaden NJW-RR 2004, 887) prüfen nur Verkehrspflichtverletzung.<br />
schwieriges Aufbauproblem: am besten Vergleich beider Möglichkeiten<br />
aa) Unterlassen:<br />
(1) Verkehrssicherungspflicht des B gegenüber K:<br />
Grundlage: Schaffung einer Gefahrenlage durch Eröffnung Verkehr<br />
(2) Geschützt: Personen, mit deren Gefährdung der Pflichtige üblicherweise<br />
rechnen muss, also idR nicht Unbefugte (Palandt/Sprau, § 823 Rn. 47; BGH<br />
NJW 1957, 499; VersR 1964, 727). Daher wohl keine VSP gegenüber K.<br />
A.A. vertretbar: Purer Zufall, dass nicht „normaler“ Theaterbesucher einen<br />
‚<strong>Tinnitus</strong>-Schaden erleidet, sondern „Unbefugter“ .<br />
(3) Reichweite VSP: nicht Schutz vor jeder abstrakten Gefahr, sondern nur vor nahe<br />
liegenden Gefahren<br />
Maßstab: Urteil eines „verständigen, umsichtigen, vorsichtigen und<br />
gewissenhaften Angehörigen der betreffenden Berufsgruppe“ (BGH NJW<br />
2006, 611)<br />
Fallbezogen: Gehörschaden möglich (ab 84 dB), aber lt. SVst. extrem<br />
unwahrscheinlich (Promillebereich); BGH NJW 2006, 611: keine nahe liegende<br />
Gefahr!<br />
Vergleichsfälle:<br />
- aus Sägegatter herausgeschleudertes Kantholz trifft Abholer (BGH<br />
NJW-RR 2003, 1459 f.)<br />
- abgesplitterte Metallteile beim Einschlagen eines Metallstifts in den<br />
Holzstiel einer Harke (BGH VersR 1975, 812)<br />
BGH: nicht voraussehbare Gefahr; Unfallverhütungsvorschriften sahen –<br />
damals - keine Sicherungsvorkehrungen vor<br />
Argumente des K:<br />
- Möglichkeit, geräuscharme Schreckschusspistolen einzusetzen? BGH: aus<br />
Möglichkeit folgt keine Pflicht!<br />
- Risiko von Gesundheitsschäden ab 84 dB? BGH: beweist nur Eignung der<br />
Verletzung!<br />
- Arbeitsplatzschutznormen und Lärmschutzbestimmungen für Volksfeste und<br />
Livemusik-Darbietungen? BGH nicht einschlägig!<br />
2
Ergebnis: keine Haftung des B<br />
bb) Haftung des B bei positivem Tun<br />
(1) Rechtsgutsverletzung: s.o.<br />
(2) Haftungsbegründende Kausalität<br />
(a) Äquivalenz: Schuss = condicio sine qua non für den Hörschaden (+)<br />
(b) Adäquanz: wenn die betreffende Handlung im Allgemeinen und nicht nur<br />
unter ganz besonders eigenartigen, unwahrscheinlichen und nach dem<br />
gewöhnlichen Verlauf der Dinge außer Betracht zu lassenden Umständen<br />
geeignet ist, einen Erfolg der eingetretenen Art herbeizuführen (BGHZ 3, 261,<br />
267; BGH NJW 1976, 1144; Medicus, SR I, Rn. 598; Larenz, SR I, § 27 III b:<br />
Maßstab erfahrener Beobachter).<br />
Danach Adäquanz eher zu verneinen (Risiko eines Hörschadens ganz<br />
unwahrscheinlich („im Promillebereich“).<br />
Gegenarg.: BGHZ 18, 286 bejahte Adäquanz in einem Impfschadensfall bei<br />
einee Schadenswahrscheinlichkeit von weniger als 0,01 %. Besonderheit:<br />
Urheber hat entfernt liegende Möglichkeit eines schädigenden Ereignisses<br />
bewusst in Kauf genommen (hier: -)<br />
Ergebnis: Schuss = keine adäquate Bedingung für Hörschaden (aA vertretbar)<br />
(c) Ausschluss der Zurechnung wegen Vorschädigung des K?<br />
(-) Schädiger kann nicht verlangen, so gestellt zu werden, als wenn der<br />
Verletzte gesund gewesen wäre (BGHZ 132, 341, 345; RGZ 155, 38, 41 f.;<br />
Palandt/Heinrichs, Vorb v § 249 Rn. 67 f.).<br />
aber wohl keine Zurechnung bei „ganz ungewöhnlichen, keinesfalls zu<br />
erwartenden Verläufen; Beispiele:<br />
- geringfügige Ehrverletzung („kleiner Scheißer“) verursacht<br />
Gehirnblutung (BGH NJW 1976, 1143, 1144 unter II 2 b aa)<br />
- falsche Anschuldigung im Anschluss an Verkehrsunfall führt zu einem<br />
Schlaganfall (BGHZ 107, 359, 363; krit. von Bar JZ 1989, 1071; Lipp,<br />
JuS 1991, 809, 811)<br />
- Herzinfarkt durch Erregung über Hunderauferei (OLG Karlsruhe<br />
MDR 1993, 29)<br />
Vertretbar ist daher auch an dieser Stelle ein Ausschluss der Zurechnung, aber<br />
auch weiterhin seine Bejahung.<br />
3
(3) Rechtswidrigkeit:<br />
(a) Grundsatz: bei unmittelbaren Rechtsgutsverletzungen ist Rechtswidrigkeit<br />
indiziert; Ausnahmen: mittelbare Rechtsgutsverletzung;<br />
Verkehrssicherungspflichten<br />
Unwerturteil bei unmittelbarer Verletzung: Verwirklichung des Erfolgs<br />
(Erfolgsunrecht)<br />
Bei mittelbarer Verletzung von Rechtsgütern versagt diese Lehre; sonst<br />
Notwehr gegen Autohersteller; hier und bei VSP bewährt sich Lehre vom<br />
Handlungsunrecht (vgl. Larenz/Canaris, SR II/2, § 75 II 3).<br />
(b) Hier unmittelbare Verletzung der Rechtsgüter des K:<br />
(aa) daher: Rechtswidrigkeit indiziert (+)<br />
(bb) A.A. Vertretbar; arg.: grundsätzlich erlaubtes Handeln kann nicht per se<br />
rechtswidrig sein<br />
Rechtfertigungsgrund verkehrsrichtigen Verhaltens (BGHZ 24, 21)<br />
Kritik: Schädiger haftet ohnehin nicht<br />
- §§ 823, 826 setzen Verschulden voraus<br />
- Keine Haftung für schuldlosen Verrichtungsgehilfen<br />
(Kausalitätsvermutung des 831 I 2, 3. Alt. widerlegt: auch der<br />
sorgfältig ausgesuchte und überwachte Gehilfe kann sich nicht<br />
besser als verkehrsrichtig verhalten (Medicus, BR Rn. 606 und 782).<br />
Ergebnis: Jedenfalls keine Haftung des B gem. § 831 I 2, 3. Alt.<br />
Konsequenz: B haftet weder für Unterlassen, noch für positives Tun seiner<br />
Verrichtungsgehilfen.<br />
III. Ansprüche des K auf Aufhebung des Hausverbotes<br />
1. Hausverbot Ausfluss der Vertragsfreiheit des B<br />
2. Kontrahierungszwang des B:<br />
a) Vertragsfreiheit gilt nicht schrankenlos. In Sondergesetzen zahlreiche Ausnahmen,<br />
insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge:<br />
- § 10 Allgemeines Eisenbahngesetz (Sartorius 962): Kontrahierungszwang für<br />
öffentliche Eisenbahnen,<br />
4
- § 22 PersonenbeförderungsG (Sartorius 950): Kontrahierungszwang für<br />
Straßenbahn, Bus und Taxi,<br />
- § 10 Energiewirtschaftsgesetz (Sartorius 830): Abschlusspflicht für<br />
Energieversorgungs-Unternehmen bei der Lieferung von Elektrizität und Gas,<br />
- § 3 PostdienstleistungsVO (Sartorius [E] 910b): Kontrahierungszwang für<br />
Postdienstleistungen,<br />
- § 5 Abs. 2 PflVersG: Kfz-Haftpflicht<br />
b) Allgemeiner Kontrahierungszwang gem. § 826 BGB?<br />
Zirkelschluss; Pflicht zum Vertragsschluss wird vorausgesetzt, ist aber gerade zu<br />
begründen.<br />
Vorzugswürdig: Gesamtanalogie zu den gesetzlichen Vorschriften (ggf. i.V.m.<br />
dem Sozialstaatsprinzip, Art. 20 GG).<br />
c) Voraussetzungen:<br />
- Angewiesensein der Interessenten auf den Vertragsschluss (oft, aber nicht nur<br />
beim Angebot lebenswichtiger Güter oder Dienste),<br />
- Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit einer anderweitigen Befriedigung des<br />
Bedarfs (fehlende Ausweichmöglichkeit) und<br />
- Fehlen eines sachlichen Grundes für die Ablehnung.<br />
d) Anerkanntes Bsp.: Kontrahierungszwang für Theaterkritiker<br />
RGZ 133, 388 erkannte Kontrahierungszwang an, billigte aber Schutz vor<br />
unsachlicher Kritik.<br />
Besser OLG Köln (NJW-RR 2001, 1051): Hausverbot für kritischen<br />
Sportjournalisten unwirksam (arg. Schutz der Art. 3, 5 und 12 GG).<br />
Ergebnis: K kann gegen Hausverbot mit Erfolg vorgehen<br />
B. Ansprüche des Theaters (B) gegen K<br />
I. Auf Löschung der Kritik gem. § 824 BGB<br />
keine Tatsachenbehauptung, sondern Bewertung<br />
II. Auf Löschung der Kritik gem. § 823 I (Allgemeines Persönlichkeitsrecht)<br />
1. Rechtsgut: Allgemeines Persönlichkeitsrecht als „sonstiges Recht“ iSd § 823 I<br />
BGB<br />
Zur Persönlichkeit gehört die – strafrechtlich gem. §§ 185 ff StGB geschützte –<br />
Ehre.<br />
2. Widerrechtlichkeit<br />
5
Wegen Konturlosigkeit des APkR positiv festzustellen. Dabei Abwägung<br />
zwischen Kunstfreiheit des K (Art. 5 III GG) und Persönlichkeitsrecht des B<br />
(Art. 2 I GG).<br />
a) Grundsatz: Vorrang Art. 5 GG, aber Kunst- und Meinungsfreiheit nicht<br />
schrankenlos.<br />
b) Schranken: wenn Kritik Menschenwürde antastet oder Formalbeleidigung<br />
oder Schmähung darstellt (BVerfG 1995, 3303, 3304 – Soldaten sind Mörder).<br />
c) Schmähkritik: wenn nicht mehr Auseinandersetzung in der Sache im<br />
Vordergrund steht, sondern persönliche Herabsetzung (BVerfGE 82, 272, 281<br />
= NJW 1991, 95; NJW 1995, 3303, 3304).<br />
aa) „Ekeltheater“: Kontext mit Werturteil über Vorstellung; nachvollziehbare<br />
Polemik: viele Menschen finden Exkremente ekelig.<br />
bb) „Sinnloser Lärm um nichts“: polemische Kritik angesichts der Schüsse<br />
nachvollziehbar und von sachlichem Anliegen getragen.<br />
cc) “Erbärmliche Inszenierung“ im Grenzbereich; aber auch hier sachlicher<br />
Bezug zum Stück; außerdem: wer selbst provoziert, riskiert deftige Kritik<br />
(BGHZ 31, 308, 313; Palandt/Sprau, § 823 Rn. 98).<br />
Ergebnis: keine Schmähkritik<br />
III. Ansprüche auf Löschung gem. §§ 823 I (eingerichteter und ausgeübter<br />
Gewerbebetrieb), 823 II iVm § 185 StGB, 826, 1004 analog BGB<br />
scheitern aus den gleichen Gründen wie Anspruch wegen Verletzung APkR (unter II. )<br />
IV. Anspruch auf Bezahlung der Theaterkarte<br />
1. Deliktische Ansprüche:<br />
a) § 823 I BGB<br />
Verletzte Rechtsgüter:<br />
- Eigentum wegen der vorübergehenden Gebrauchsbehinderung durch<br />
unberechtigte Einnahme eines Sitzplatzes (vgl. MünchKomm/ Mertens, §<br />
823 Rn. 112 ff.) (+)<br />
- Besitz (+)<br />
- Eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb: (-) kein<br />
betriebsbezogener (finaler) Eingriff; Kritik an Regie, nicht am Theater<br />
b) Anspruchsgrundlage § 823 II BGB i.V.m. § 265a StGB (Erschleichen von<br />
Leistungen):<br />
6
fraglich, da es K nicht auf die Unentgeltlichkeit des Theaterbesuchs, sondern auf<br />
die Umgehung des Hausverbots ankam (zur Absicht vgl. Schönke-<br />
Schröder/Lenckner/Perron, StGB, § 265a Rn. 12).<br />
Ohne Hausverbot hätte K wahrscheinlich Pressekarten erhalten<br />
c) Problem: Schaden<br />
aa) Differenzhypothese: Vergleich der tatsächlichen mit der<br />
hypothetischen Vermögenslage (ohne Rechtsgutsverletzung)<br />
Leistungserschleichung: keine Einnahmen des B/übliche Kosten<br />
Keine Erschleichung: keine Einnahmen des B /übliche Kosten<br />
Differenz: 0<br />
bb) Normativer Schaden? Entgangene Gebrauchsvorteile (Sitzplatz im<br />
Theater) als Schaden?<br />
nach BGHZ 98, 212, 222 nur ersatzfähig, wenn es sich um Lebensgüter<br />
handelt, deren ständige Verfügbarkeit für die eigenwirtschaftliche<br />
Lebensführung von zentraler Bedeutung ist (-)<br />
Bsp.: KfZ, Fahrrad, Wohnung, Haus (+);<br />
Pelzmantel, Laptop, Motorboot, Pferd (-)<br />
Ergebnis: kein Schaden (-)<br />
2. Bereicherungsrechtlicher Anspruch gem. § 812 I 1, 2. Alt., 818 II<br />
a) Etwas erlangt: Theateraufführung<br />
b) durch Leistung (-) oder in sonstiger Weise (+): K wurde von Personal nicht<br />
bemerkt<br />
c) Eingriff rechtsgrundlos, wenn in Widerspruch zum Zuweisungsgehalt<br />
eines fremden absoluten Rechts (Eigentum des B)<br />
d) auf Kosten des B: K unmittelbar auf Kosten des B bereichert; Prüfung<br />
zudem überflüssig, da Merkmal mit Subsumtion unter a – c feststeht<br />
e) Rechtsfolge: Herausgabe des Erlangten (-), Gebrauchsvorteile nicht mehr<br />
rückgabefähig<br />
f) Wertersatz gem. § 818 II: üblicher Preis<br />
7
g) Wegfall der Bereicherung (§ 818 III): Gebrauchsvorteile nicht mehr real<br />
vorhanden<br />
K aber bereichert, soweit er Aufwendungen erspart hat.<br />
Tatfrage: hätte K sich Karte gekauft? Kritiker bekommen gewöhnlich<br />
Pressekarten und zahlen nichts; dann wäre K nicht bereichert (-)<br />
3. Anspruch gem. §§ 819 I, 818 IV, 292 analog, 989, 990 BGB auf Zahlung des<br />
Eintritts<br />
a) K war bösgläubig (+)<br />
b) Verschärfte Haftung: im Ergebnis keine Berufung auf § 818 III, sondern<br />
jedenfalls Wertersatz gem. § 818 II (Wert des Theaterbesuchs =<br />
Eintrittsgeld)<br />
Ergebnis: K muss Eintrittsgeld zahlen (+)<br />
C. Anwaltliche Erwägungen:<br />
Erfolgsaussichten Klage Theater gering (keine Schmähkritik, allenfalls Eintrittspreis)<br />
Erfolgsaussichten Klage des K: nur bezüglich Hausverbot; zwar Risiko der Widerklage<br />
(Grund: kein Kostenvorschuss erforderlich), aber Risiko der Verurteilung gering.<br />
Empfehlung: Klage auf Aufhebung des Hausverbots (§ 242 BGB)<br />
8