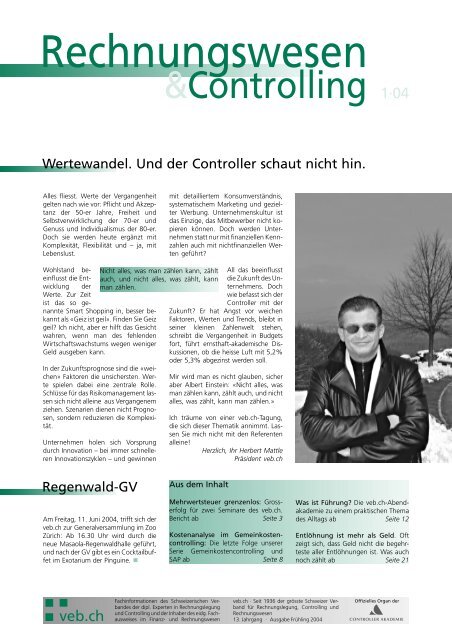1.04 - VEB
1.04 - VEB
1.04 - VEB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
Wertewandel. Und der Controller schaut nicht hin.<br />
Alles fliesst. Werte der Vergangenheit<br />
gelten nach wie vor: Pflicht und Akzeptanz<br />
der 50-er Jahre, Freiheit und<br />
Selbstverwirklichung der 70-er und<br />
Genuss und Individualismus der 80-er.<br />
Doch sie werden heute ergänzt mit<br />
Komplexität, Flexibilität und – ja, mit<br />
Lebenslust.<br />
Wohlstand beeinflusst<br />
die Entwicklung<br />
der<br />
Werte. Zur Zeit<br />
ist das so ge-<br />
Regenwald-GV<br />
veb.ch<br />
Nicht alles, was man zählen kann, zählt<br />
auch, und nicht alles, was zählt, kann<br />
man zählen.<br />
nannte Smart Shopping in, besser bekannt<br />
als «Geiz ist geil». Finden Sie Geiz<br />
geil? Ich nicht, aber er hilft das Gesicht<br />
wahren, wenn man des fehlenden<br />
Wirtschaftswachstums wegen weniger<br />
Geld ausgeben kann.<br />
In der Zukunftsprognose sind die «weichen»<br />
Faktoren die unsichersten. Werte<br />
spielen dabei eine zentrale Rolle.<br />
Schlüsse für das Risikomanagement lassen<br />
sich nicht alleine aus Vergangenem<br />
ziehen. Szenarien dienen nicht Prognosen,<br />
sondern reduzieren die Komplexität.<br />
Unternehmen holen sich Vorsprung<br />
durch Innovation – bei immer schnelleren<br />
Innovationszyklen – und gewinnen<br />
Am Freitag, 11. Juni 2004, trifft sich der<br />
veb.ch zur Generalversammlung im Zoo<br />
Zürich: Ab 16.30 Uhr wird durch die<br />
neue Masaola-Regenwaldhalle geführt,<br />
und nach der GV gibt es ein Cocktailbuffet<br />
im Exotarium der Pinguine. n<br />
Aus dem Inhalt<br />
Fachinformationen des Schweizerischen Verbandes<br />
der dipl. Experten in Rechnungslegung<br />
und Controlling und der Inhaber des eidg. Fachausweises<br />
im Finanz- und Rechnungswesen<br />
mit detailliertem Konsumverständnis,<br />
systematischem Marketing und gezielter<br />
Werbung. Unternehmenskultur ist<br />
das Einzige, das Mitbewerber nicht kopieren<br />
können. Doch werden Unternehmen<br />
statt nur mit finanziellen Kennzahlen<br />
auch mit nichtfinanziellen Werten<br />
geführt?<br />
All das beeinflusst<br />
die Zukunft des Unternehmens.<br />
Doch<br />
wie befasst sich der<br />
Controller mit der<br />
Zukunft? Er hat Angst vor weichen<br />
Faktoren, Werten und Trends, bleibt in<br />
seiner kleinen Zahlenwelt stehen,<br />
schreibt die Vergangenheit in Budgets<br />
fort, führt ernsthaft-akademische Diskussionen,<br />
ob die heisse Luft mit 5,2%<br />
oder 5,3% abgezinst werden soll.<br />
Mir wird man es nicht glauben, sicher<br />
aber Albert Einstein: «Nicht alles, was<br />
man zählen kann, zählt auch, und nicht<br />
alles, was zählt, kann man zählen.»<br />
Ich träume von einer veb.ch-Tagung,<br />
die sich dieser Thematik annimmt. Lassen<br />
Sie mich nicht mit den Referenten<br />
alleine!<br />
Herzlich, Ihr Herbert Mattle<br />
Präsident veb.ch<br />
Mehrwertsteuer grenzenlos: Grosserfolg<br />
für zwei Seminare des veb.ch.<br />
Bericht ab Seite 3<br />
Kostenanalyse im Gemeinkostencontrolling:<br />
Die letzte Folge unserer<br />
Serie Gemeinkostencontrolling und<br />
SAP ab Seite 8<br />
veb.ch · Seit 1936 der grösste Schweizer Verband<br />
für Rechnungslegung, Controlling und<br />
Rechnungswesen<br />
13. Jahrgang · Ausgabe Frühling 2004<br />
1·04<br />
Was ist Führung? Die veb.ch-Abendakademie<br />
zu einem praktischen Thema<br />
des Alltags ab Seite 12<br />
Entlöhnung ist mehr als Geld. Oft<br />
zeigt sich, dass Geld nicht die begehrteste<br />
aller Entlöhnungen ist. Was auch<br />
noch zählt ab Seite 21<br />
Offizielles Organ der
Mehrwertsteuer grenzenlos<br />
Ein Grosserfolg war das ausgebuchte<br />
veb.tax-Seminar mit zwei<br />
mal 160 Teilnehmern zur Mehrwertsteuer<br />
am 3. und 10. Dezember<br />
2003 in Zürich. Wir vermitteln im Folgenden<br />
ein paar wichtige Erkenntnisse<br />
der Veranstaltung.<br />
1. Blick in die 6. EG-Richtlinie<br />
1.1 Werkleistung<br />
In der EU gilt die Be- oder Verarbeitung<br />
eines «beweglichen körperlichen Gegenstandes»<br />
als Dienstleistung. Die<br />
Mitgliedstaaten können die Erbringung<br />
von Bauleistungen als Lieferung betrachten<br />
(Art. 5 Abs. 5 6. EG-RL).<br />
1.2 Werklieferung<br />
Die Herstellung, Bearbeitung oder Verarbeitung<br />
eines Gegenstandes unter<br />
Verwendung von Hauptstoffen ist eine<br />
Werklieferung.<br />
1.3 Vermietung<br />
In der EU gilt die Vermietung als Dienstleistung<br />
(Übertragung des Rechts zur<br />
ausschliesslichen Nutzung eines Gegenstandes).<br />
1.4 Ortsbestimmung<br />
Die Verlagerung des Ortes der Dienstleistung<br />
an den Sitz des Empfängers<br />
setzt voraus, dass der Empfänger in<br />
Unsere Referenten<br />
Regine Schluckebier, Rechtsanwältin,<br />
zugelassen an deutschen Gerichten,<br />
Niederer, Kraft & Frey, Zürich, Mitglied<br />
des Kompetenzzentrums MWST der<br />
Treuhand-Kammer, Mitglied der Vereinigung<br />
zur wissenschaftlichen Pflege<br />
des Umsatzsteuerrechts e.V., München.<br />
Felix Geiger, lic.iur., Rechtsanwalt, Inhaber<br />
der VAT Consulting AG, als ehemaliger<br />
Mitarbeiter der Stabsstelle Gesetzgebung<br />
der Hautpabteilung Mehrwertsteuer<br />
massgeblich an der Erarbeitung<br />
des MWST-Gesetzes beteiligt.<br />
einem Drittstaat ansässig ist oder in<br />
einem anderen EU-Mitgliedstaat steuerpflichtig<br />
ist.<br />
1.4.1 Begutachtung und Bearbeitung<br />
von «beweglichen körperlichen<br />
Gegenständen»<br />
Der Tätigkeitsort ist massgebend im<br />
Falle der Bearbeitung und Begutachtung<br />
von «beweglichen körperlichen<br />
Gegenständen». Durch Angabe der<br />
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer<br />
(UID-Nr.) kann der Leistungsempfänger<br />
den Ort der Besteuerung vom Ort der<br />
Tätigkeit in einen anderen Mitgliedstaat<br />
verlagern (Art. 28b F der 6. EG-RL).<br />
Voraussetzung ist jedoch, dass der Gegenstand<br />
den Mitgliedstaat verlässt, in<br />
dem die Leistung erbracht worden ist.<br />
1.4.2 Vermittlung<br />
Dienstleistungen von Vermittlern, die<br />
im Namen und für Rechnung Dritter<br />
handeln, gelten am Ort des vermittelten<br />
Umsatzes als erbracht (Art. 28b E<br />
Abs. 3 der 6. EG-RL). Sie gelten am Sitz<br />
des Empfängers als erbracht, wenn es<br />
sich bei der vermittelten Leistung um<br />
eine Leitung im Sinne von Art. 9 Abs. 2<br />
Bst. E der 6. EG-RL handelt. Durch<br />
Angabe der UID-Nummer kann der Leistungsempfänger<br />
den Ort der Besteuerung<br />
vom Ort des vermittelten Umsatzes<br />
in einen anderen Mitgliedstaat verlagern<br />
(Art. 28b E Abs. 3 Unterabs. 6<br />
der 6. EG-RL).<br />
1.4.3 Vermietung<br />
von Beförderungsmitteln<br />
Der Unternehmersitz gilt als Dienstleistungsort<br />
im Falle der Vermietung von<br />
Beförderungsmitteln.<br />
1.4.4 Vermietung «beweglicher<br />
körperlicher Gegenstände»<br />
Bei der Vermietung «beweglicher körperlicher<br />
Gegenstände» ist der Leistungsort<br />
grundsätzlich am Sitz des<br />
Empfängers.<br />
1.4.5 Beförderungsleistungen<br />
Bei innergemeinschaftlichen Beförderungen<br />
kann der Leistungsempfänger<br />
(43) ist dipl. Experte in Rechnungslegung<br />
und Controlling, Inhaber der P.W.<br />
Consulting GmbH in Olten, Dozent an der Controller<br />
Akademie und der AKAD sowie Leiter der<br />
Fachkommission Controlling der Höheren Fachprüfungen.<br />
Er ist regelmässiger Mitarbeiter von<br />
«Rechnungswesen & Controlling». n<br />
durch Angabe der UID-Nummer den<br />
Ort der Besteuerung in einen anderen<br />
Mitgliedstaat verlagern (Art. 28b D der<br />
6. EG-RL).<br />
1.5 Reverse-charge-Verfahren<br />
Steuerschuldner einer Dienstleistung<br />
nach Art. 9 Abs. 2 Bst. E ist der (im<br />
Inland registrierte) Empfänger, wenn<br />
die Dienstleistung von einem im Ausland<br />
ansässigen Steuerpflichtigen erbracht<br />
wird (Art. 21 Abs. 1 Bst b der 6.<br />
EG-RL).<br />
Für andere Dienstleistungen wird die<br />
Steuer grundsätzlich vom Leistungserbringer<br />
geschuldet.<br />
Wird die Dienstleistung von einem nicht<br />
im Inland ansässigen Steuerpflichtigen<br />
bewirkt, können die Mitgliedstaaten<br />
abweichend bestimmen, dass der Empfänger<br />
die Steuer schuldet.<br />
Beim sogenannten Reverse-charge-<br />
Verfahren hat der leistende Unternehmer<br />
eine Rechnung ohne gesonderten<br />
Steuerausweis auszustellen.<br />
1.5.1. Anwendungsbereich in<br />
Deutschland<br />
In Deutschland findet das Reverse-charge-Verfahren<br />
nicht nur Anwendung auf<br />
Dienstleistungen, die dem Empfängerortsprinzip<br />
unterliegen, sondern auf<br />
sämtliche Formen von Dienstleistungen.<br />
1·04 Rechnungswesen<br />
3<br />
&Controlling
Abweichend von der Grundregel in der<br />
6. EG-RL findet das Reverse-charge-<br />
Verfahren auch in jenen Fällen Anwendung,<br />
in denen der Leistungsempfänger<br />
im Ausland ansässig ist.<br />
In anderen Worten: Der Leistungsempfänger,<br />
nicht der leistende Unternehmer<br />
hat sich in Deutschland registrieren<br />
zu lassen.<br />
1.5.1.1 Rechnungsstellung nach<br />
deutschem UstG<br />
In der Rechnung sind der Vermerk<br />
«Übergang der Steuerschuldnerschaft<br />
auf den Leistungsempfänger gemäss §<br />
13b UstG» und die UID-Nummer des<br />
Leistungsempfängers aufzuführen.<br />
Wird die Steuer in der Rechnung fälschlicherweise<br />
ausgewiesen, hat der Leistungsempfänger<br />
grundsätzlich keinen<br />
Anspruch auf Vorsteuerabzug. Die ausgewiesene<br />
Steuer ist gleichwohl geschuldet.<br />
1.5.1.2 Deklaration<br />
durch Leistungsempfänger<br />
Umsätze, für die der Leistungsempfänger<br />
die Steuer schuldet, sind in der<br />
Umsatzsteuererklärung zu deklarieren.<br />
Die deklarierte Steuer kann in derselben<br />
Umsatzsteuererklärung wieder in Abzug<br />
gebracht werden.<br />
2. Grenzüberschreitender<br />
Warenhandel<br />
2.1 Definition<br />
Jedes (direkte) Bewegen eines Gegenstandes<br />
ins Ausland. Zugrundeliegende<br />
Lieferung ist nicht erforderlich (zum<br />
Beispiel Verbringen von Gegenständen<br />
ins Ausland, Konsignations- oder Auslieferungslager).<br />
2.2 Steuerbefreite Ausfuhr<br />
Rechtsgrund für die Steuerbefreiung:<br />
Kein inländischer Verbrauch der Ware.<br />
Für Inanspruchnahme der Steuerbefreiung<br />
ist entscheiden, wer sie wie geltend<br />
machen kann.<br />
Steuerbefreit ist die Ausfuhr von Ware<br />
nur, wenn der Gegenstand direkt ins<br />
Ausland befördert oder versandt wird<br />
und die Ausfuhr zollamtlich nachgewiesen<br />
werden kann und keine vorherige<br />
inländische Ingebrauchnahme des Ge-<br />
genstandes oder ein Liefergeschäft mit<br />
einem Dritten vorliegen.<br />
2.3 Exportformalitäten<br />
Für die Rechnung gelten dieselben<br />
Formvorschriften wie für Inlandlieferungen.<br />
Ein Hinweis auf die Steuerbefreiung<br />
(zum Beispiel «Export», «steuerfreier<br />
Export», «MWST 0 %») ist nicht erforderlich,<br />
kann aber empfehlenswert<br />
sein.<br />
Vorsicht: Eine irrtümlich ausgewiesene<br />
Steuer auf einer Rechnung für eine<br />
Ausfuhrlieferung ist geschuldet. Eine<br />
Korrektur ist nur mittels Gutschrift oder<br />
Storno der Rechnung und korrekter<br />
Neuausstellung möglich.<br />
Als zollamtliches Dokument für die Ausfuhr<br />
gelten:<br />
n zollamtlich gestempeltes Exemplar<br />
Nr. 3 des Einheitspapiers (Form Nr.<br />
11.030)<br />
n Zollausweis Modell 90-Ausfuhr<br />
(wird nicht gestempelt)<br />
n zollamtlich gestempelte Ausfuhrliste<br />
für Ausfuhren nach vereinfachter<br />
Ausfuhrregelung (VAR), nur bei<br />
entsprechender Vereinbarung mit EZV<br />
möglich<br />
Eine Korrektur von Ausfuhrdokumenten<br />
ist nur innerhalb 60 Tagen seit der<br />
Zollabfertigung möglich. Zuständig ist<br />
die Zollkreisdirektion.<br />
2.3.1 Echter Ausfuhrwert<br />
Der Rechnungsbetrag des Schweizer<br />
Lieferanten muss auf den Ausfuhrdokumenten<br />
erscheinen (BGer v. 6. März<br />
2001).<br />
Bei (bewusstem) Überfakturieren oder<br />
-deklarieren zu hoher Werte wird angenommen,<br />
dass ausländische (Zoll)vorschriften<br />
aus handelspolitischen oder<br />
fiskalischen Gründen umgangen werden<br />
sollen.<br />
2.3.1.1 Rechtliche Folge<br />
des Verstosses in der Schweiz<br />
Versagung der Steuerbefreiung auf<br />
dem Gesamtbetrag der betreffenden<br />
Lieferung, jedoch Toleranz für die Kosten<br />
der Beförderung sowie für Nebenleistungen<br />
des Transportgewerbes bis<br />
zur Grenze.<br />
4 Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
2.3.1.2 Rechtliche Folgen<br />
des Verstosses in der EU<br />
n Falscher Einfuhrwert für allfälligen<br />
Zoll und EU-Steuer.<br />
n Bei Konzernverhältnissen besteht<br />
das Risiko für eine (zollrechtliche)<br />
Verbundenheitsprüfung.<br />
n Die Daten werden an die Steuerämter<br />
(Meldung) weitergegeben.<br />
2.4 Einfuhr in die EU<br />
Wenn ein im Ausland ansässiger Unternehmer<br />
in der EU steuerbare Umsätze<br />
erbringt, muss er sich grundsätzlich im<br />
betreffenden Mitgliedstaat umsatzsteuerlich<br />
registrieren lassen.<br />
2.4.1 Registrierung<br />
Beim zuständigen Finanzamt im betreffenden<br />
Mitgliedstaat wird eine Steuernummer<br />
(UID-Nummer) erteilt. Für in<br />
der Schweiz ansässige Unternehmer gilt<br />
bei der Registrierung in Deutschland:<br />
n ohne Betriebsstätte, Zweigniederlassung<br />
in Deutschland: Finanzamt<br />
Konstanz<br />
n mit Betriebsstätte, Zweigniederlassung<br />
in Deutschland: Das jeweils<br />
örtlich zuständige Finanzamt<br />
Grundsätzlich besteht für Schweizer<br />
Unternehmen in den meisten Ländern<br />
der EU die Verpflichtung, einen Fiskalvertreter<br />
zu bestellen.<br />
2.4.1.1 Rechtliche Folgen (Meldeund<br />
Informationspflichten)<br />
Der Unternehmer wird für Mehrwertsteuerzwecke<br />
wie ein ansässiges Unternehmen<br />
behandelt:<br />
n Mit der Registrierung erhält der<br />
Unternehmer eine UID-Nummer.<br />
n Kein Vorsteuervergütungsverfahren<br />
mehr möglich.<br />
n Abgabe von Umsatzsteuer-<br />
Voranmeldungen, zum Teil Abgabe<br />
von Jahreserklärungen.<br />
n Gegebenenfalls Abgabe von<br />
«Zusammenfassenden Meldungen»<br />
und «Intrastat»-Meldungen.<br />
n Revisionen der Steuerbehörden<br />
möglich.<br />
2.4.1.2 UID-Nummer<br />
Die UID-Nummer ist der Schlüssel für<br />
die Teilnahme am Europäischen Binnen-<br />
1·04
In der Kürze...<br />
Die wertrvollen Berichte von Peter Wullschleger<br />
von den veb.ch-Fortbildungsveranstaltungen<br />
erfahren eine Änderung:<br />
Inskünftig erscheinen die Beiträge<br />
in konzentrierter Form über einen oder<br />
mehrere auswählte Aspekte der jeweiligen<br />
Seminare oder Lehrgänge. Wir<br />
freuen uns, unseren Lesern damit eine<br />
grössere Vielfalt an Artikeln bieten zu<br />
können.<br />
Redaktion<br />
Rechnungswesen & Controlling<br />
markt. Sie wird in jedem Mitgliedstaat<br />
von einer bestimmten Behörde (in<br />
Deutschland vom Bundesamt für Finanzen,<br />
Aussenstelle Saarlouis) an den Unternehmer<br />
auf Antrag vergeben.<br />
Wer eine UID-Nummer besitzt, kann<br />
steuerfrei Waren in einen anderen Mitgliedstaat<br />
liefern, wenn auch der Erwerber<br />
eine gültige UID-Nummer besitzt.<br />
Die UID-Nummer setzt sich nach den<br />
europäischen Vorgaben aus dem Länderkennzeichen<br />
und maximal zwölf<br />
weiteren Stellen zusammen, in<br />
Deutschland aus dem Kürzel DE und<br />
neun Ziffern (Bsp: DE 123456789).<br />
In der Presse<br />
Die Weltmeister der Buchhaltung»<br />
habe sich die Expertengruppe<br />
der Börse verpflichten<br />
können, ist im Zusammenhang mit<br />
dem verspäteten Jahresabschluss des<br />
Unternehmens Adecco gesagt worden.<br />
Diese Behauptung hat der veb.ch für<br />
seinen letzten Auftritt in der Schweizer<br />
Presse genutzt. In den wichtigsten regionalen<br />
Zeitungen und in Wirtschaftsblättern<br />
sind auffällige Anzeigen im redaktionellen<br />
Textteil erschienen, die<br />
den «Weltmeistern der Buchhaltung»<br />
die «Schweizermeister» gegenüberstellen.<br />
Damit hat der veb.ch die Gelegenheit<br />
ergriffen, sich und das Know-how seiner<br />
Mitglieder in Erinnerung zu rufen:<br />
Wenn die Bilanz stimmen soll, baut man<br />
auf die Schweizermeister der Buchhaltung!<br />
n<br />
3. Innergemeinschaftliche<br />
Lieferung<br />
3.1 Steuerbefreiung<br />
Die Steuerbefreiung ist möglich, wenn<br />
der Lieferer alle nachfolgenden Voraussetzungen<br />
nachweisen kann:<br />
n UID-Nummer des Abnehmers<br />
n buch- und belegmässiger Beweis<br />
n Formvorschriften für Rechnung<br />
n (regelmässiger Hinweis auf Steuerbefreiung)<br />
n Prüfverfahren der Richtigkeit der<br />
UID-Nummer in Mitgliedstaaten<br />
möglich<br />
n MIAS-Datenbank<br />
n Umfang des Vertrauensschutzes in<br />
Mitgliedstaaten unterschiedlich<br />
3.2 Zusammenfassende Meldung ZM<br />
Der Lieferer hat innergemeinschaftliche<br />
Lieferungen an die zuständige Steuerbehörde<br />
zu melden. Der Erwerber hat den<br />
innergemeinschaftlichen Erwerb in seiner<br />
Umsatzsteuererklärung zu melden.<br />
Da an den Binnengrenzen der EG die<br />
Grenzkontrollen und damit auch die<br />
Erhebung der Einfuhrsteuer weggefallen<br />
sind, musste zur Sicherung des<br />
«In der Expertengruppe der Börse<br />
sind Finanzchefs, Verwaltungsräte<br />
und Forscher drin – die<br />
<br />
der Buchhaltung, wenn ich so sagen<br />
darf.»<br />
Prof. Conrad Meyer<br />
in der SonntagsZeitung<br />
über den Adecco-Fall<br />
«Wenn Ihre Bilanz stimmen soll,<br />
bauen Sie auf die<br />
<br />
der Buchhaltung – auf unsere Mitglieder,<br />
dipl. Experten in Rechnungslegung<br />
und Controlling und Fachleute<br />
im Finanz- und Rechnungswesen.»<br />
Herbert Mattle<br />
Präsident veb.ch<br />
veb.ch<br />
Der grösste Schweizer Verband für<br />
Controlling, Rechnungslegung und<br />
Rechnungswesen · Seit 1936<br />
Steueraufkommens ein Kontrollverfahren<br />
entwickelt werden. Dieses beruht<br />
auf einem EG-weiten Informationsaustausch<br />
bestimmter Daten, die zum Beispiel<br />
in Deutschland beim Bundesamt<br />
für Finanzen gespeichert sind (MIAS).<br />
Kernstück des umsatzsteuerlichen Kontrollverfahrens<br />
ist die sogenannte Zusammenfassende<br />
Meldung, die jeder<br />
Unternehmer, der innergemeinschaftliche<br />
Lieferungen ausführt, meistens vierteljährlich<br />
bei einer bestimmten Behörde<br />
im betreffen Mitgliedstaat abgeben<br />
muss, in Deutschland beim Bundesamt<br />
für Finanzen, Aussenstelle Saarlouis.<br />
Die Informationen aus der Zusammenfassenden<br />
Meldung werden in einer Datenbank<br />
für den Abruf durch die Finanzbehörden<br />
des EG-Mitgliedstaates bereitgehalten,<br />
indem der Warenabnehmer<br />
seinen innergemeinschaftlichen Erwerb<br />
versteuern muss. Können bestehende<br />
Zweifel anhand dieser Daten nicht ausgeräumt<br />
werden, hat jede Finanzbehörde<br />
das Recht, über ein Einzelauskunftsersuchen<br />
bei der jeweils zuständigen<br />
Behörde weitere Auskünfte einzuholen<br />
– in Deutschland ist das das Bundesamt<br />
für Finanzen.<br />
3.3 Intrastatmeldung<br />
n Intrastat erfasst im Gegensatz zur<br />
Zusammenfassenden Meldung nur die<br />
Länder, die an der tatsächlichen<br />
Warenbewegung beteiligt sind<br />
(Eingangs- und Ausgangsstaat).<br />
n Der Lieferer hat die innergemeinschaftliche<br />
Lieferung an die zuständige<br />
Steuerbehörde zu melden (Formular<br />
«Versendung»).<br />
n Der Erwerber hat den innergemeinschaftlichen<br />
Erwerb an die<br />
zuständige Steuerbehörde zu melden<br />
(Formular «Eingang»)<br />
4. Innergemeinschaftlicher<br />
Erwerb<br />
Der Ort der Besteuerung ist dort, wo<br />
sich der Gegenstand am Ende der Beförderung<br />
befindet. Eine Verlagerung<br />
des Ortes mit UID-Nummer möglich.<br />
n Erwerber ist Steuerschuldner, nicht<br />
Lieferant.<br />
n Erwerbssteuer ist grundsätzlich als<br />
Vorsteuer abzugsfähig.<br />
n Innergemeinschaftlicher Erwerb<br />
und steuerfreie innergemeinschaftliche<br />
Lieferung sind miteinander<br />
verknüpft. n<br />
1·04 Rechnungswesen<br />
5<br />
&Controlling
Gehaltserhebung: Erfassung abgeschlossen<br />
Die Erfassung der Erhebungsbogen<br />
zur diesjährigen Gehaltsfrage<br />
ist abgeschlossen! Alle gültigen<br />
Gehaltsmeldungen, die bis zum 22.<br />
Februar in unserem Sekretariat eingegangen<br />
sind, wurden in die Datenbank<br />
eingegeben. Nun folgt die grosse Arbeit<br />
der Auswertungen. Wir freuen uns,<br />
über die Resultate in der nächsten Ausgabe<br />
von «Rechnungswesen & Controlling»<br />
ausführlich zu informieren.<br />
Insgesamt sind 160 Meldung oder fast<br />
9 % mehr eingegangen als in der letzten<br />
Erhebung vor zwei Jahren. Die Zahl<br />
der Meldungen von Frauen ist dabei<br />
überproportional angestiegen. An dieser<br />
Stelle danken wir allen 1991 veb.ch-<br />
Mitgliedern (1482 Männer und 509<br />
Frauen) ganz herzlich, dass sie den Erfassungsbogen<br />
ausgefüllt und retourniert<br />
haben.<br />
Mit diesem kleinen Aufwand unterstützen<br />
sie eines der wichtigsten Marketinginstrumente<br />
für unseren Beruf und<br />
unseren Verband aktiv. Die zweijährige<br />
Gehaltserhebung stösst bei den Personalabteilungen<br />
vieler Unternehmen<br />
und bei immer mehr Personalvermittlern<br />
auf ein äusserst positives Echo.<br />
Zusammen mit Publikationen in diversen<br />
Medien leistet unsere Gehaltserhebung<br />
sehr gute Werbung für unseren<br />
Berufsstand. Natürlich soll hier auch<br />
erwähnt werden, dass die Gehaltserhebung<br />
schon manchen Diplom- oder<br />
Fachausweisinhaber sicher durch Anstellungsgespräche<br />
geleitet hat. n<br />
Das neue «Jahrbuch zum Finanzund<br />
Rechnungswesen 2004»,<br />
seit Jahren ein «Opinion leader»<br />
in der Schweiz, ist erschienen. Aktuell<br />
und praxisnah ziehen elf bekannte Autoren<br />
aus Wirtschaft und Wissenschaft<br />
mit praxisnahen Fachberichten und Fallstudien<br />
Bilanz und zeigen neue Wege<br />
auf. Die thematische Vielfalt garantiert,<br />
dass der Leser eine Fülle wichtiger Informationen<br />
und Anregungen für die praktische<br />
Umsetzung erhält. Es geht um<br />
Themen wie das Controlling in stark<br />
wachsenden Unternehmen, die strategische<br />
und operative Führung in mittleren<br />
Dienstleistungsunternehmen, die fi-<br />
<br />
AG 53 69 122 6.59 %<br />
AI 2 1 3 0.16 %<br />
AR 1 1 2 0.11 %<br />
BE 109 147 256 13.84 %<br />
BL 23 34 57 3.08 %<br />
BS 39 36 75 4.05 %<br />
FL 7 10 17 0.92 %<br />
FR 34 29 63 3.41 %<br />
GE 26 23 49 2.65 %<br />
GL 4 3 7 0.38 %<br />
GR 8 12 20 1.08 %<br />
JU 3 2 5 0.27 %<br />
LU 39 49 88 4.76 %<br />
NE 5 9 14 0.76 %<br />
NW 1 7 8 0.43 %<br />
OW 2 3 5 0.27 %<br />
SG 49 63 112 6.05 %<br />
SH 8 7 15 0.81 %<br />
SO 33 29 62 3.35 %<br />
SZ 15 15 30 1.62 %<br />
TG 23 23 46 2.49 %<br />
TI 32 98 130 7.03 %<br />
UR 3 4 7 0.38 %<br />
VD 58 65 123 6.65 %<br />
VS 33 18 51 2.76 %<br />
ZG 30 47 77 4.16 %<br />
ZU 172 234 406 21.95 %<br />
Total Angestellte 812 1038 1850 100.00 %<br />
Selbständige 80 61 141<br />
Umfrage Total 892 1099 1991<br />
Woher kommen die Meldungen für die Gehaltserhebung 2003–2004? Die Tabelle<br />
listet sie nach Kantonen auf.<br />
Meinungen zum Rechnungswesen Kostenlos<br />
nanzwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung,<br />
Basel II, konsequente Kapitalkonsolidierung,<br />
und die herausfordende<br />
Frage, ob die traditionelle Budgetierung<br />
noch Zukunft hat. Dieses Buch<br />
regt an, gibt Ideen und provoziert. Es ist<br />
ein Muss für alle, die die fachliche Auseinandersetzung<br />
suchen.<br />
Jahrbuch Finanz- und Rechnungswesen<br />
2004, Hrsg.: Prof. Dr. Conrad Meyer<br />
und Prof. Dr. Dieter Pfaff; 298 Seiten,<br />
gebunden, CHF 98.– (exkl. MWSt. u.<br />
Versand) ISBN 3-297-14100-1, WEKA<br />
Verlag, Zürich;<br />
Bestellung: info@weka.ch.<br />
6 Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
Das Fachforum im Internet für<br />
Rechnungslegung, Controlling<br />
und Rechnungswesen: Beitritt<br />
kostenlos und täglich anregend.<br />
www.veb.ch<br />
1·04
1·04 Rechnungswesen<br />
7<br />
&Controlling
Kostenanalyse im Gemeinkostencontrolling<br />
Wie im letzten Beitrag («Rechnungswesen<br />
& Controlling<br />
4-2003») angekündigt, betrachten<br />
wir im dritten und letzten Teil<br />
des Gemeinkostencontrolling die Kostenanalyse<br />
beziehungsweise die Abweichungsermittlung.<br />
Besonders interessant<br />
sind die Unterschiede zwischen<br />
der in der Schweiz bekannten Theorie<br />
und der SAP-Lösung.<br />
Theorie der Kostenanalyse<br />
der Standardkostenrechnung<br />
in der Schweiz<br />
Manche von uns mögen sich noch an<br />
die für die Prüfungen beliebte Theorie<br />
im Bereich der Gemeinkosten erinnern.<br />
Diese sieht in Kurzform wie folgt aus:<br />
n Ermittlung der<br />
Grundplanung als<br />
durchschnittliche<br />
Beschäftigung<br />
einer Kostenstelle<br />
für die nächsten<br />
drei Jahre<br />
n Aufteilung der<br />
Kosten in variable<br />
und fixe Anteile<br />
n Erfassung der Istkosten und der<br />
Standardleistung der Periode<br />
n Erfassung der Anwesenheitszeit<br />
Die Abweichungsanalyse ermittelt<br />
folgende Zahlengrössen:<br />
n Istkosten – verrechnete Standardkosten<br />
= Gesamtabweichung<br />
n Istkosten – flexibel budgetierte<br />
Kosten = Verbrauchsabweichung<br />
n Flexibel budgetierte Kosten –<br />
verrechnete Stadardkosten = Volumenabweichung<br />
n Aufteilung der Volumenabweichung<br />
in eine Beschäftigungs- und<br />
Leistungsabweichung<br />
Abweichungsermittlung<br />
im SAP-System<br />
Das SAP-System unterscheidet grundsätzlich<br />
die Abweichungen auf der Einsatz-<br />
und Verrechnungsseite einer Kostenstelle.<br />
(Siehe Darstellung 1)<br />
Abweichungen<br />
der Einsatzseite<br />
Die Einsatzseite umfasst alle Be- und<br />
Entlastungen auf Kostenstellen ausser<br />
den Entlastungen durch Leistungsverrechnungen.<br />
Auf der Einsatzseite werden die Istkosten<br />
mit den Sollkosten (entsprechen<br />
unserem flexiblen Budget) verglichen.<br />
Die Abweichungen der Einsatzseite beinhalten<br />
Mehr- oder Minderkosten oder<br />
einen Mehr- oder Minderverbrauch bei<br />
einzelnen Kostenarten, differenziert<br />
nach fixen und variablen Anteilen.<br />
Einsatzpreisabweichung<br />
Das SAP-Schaufenster von «Rechnungswesen<br />
& Controlling» beschreibt in Praxisbeiträgen<br />
die SAP-Funktionalität, das<br />
Projektvorgehen mit allfälligen Herausforderungen<br />
sowie die neuesten Entwicklungen<br />
aus Sicht der Experten in<br />
Rechnungslegung und Controlling.<br />
Die Einsatzpreisabweichung weist auf<br />
Kostenänderungen durch Preisänderungen<br />
hin. Als Beispiel können die<br />
höheren Lohnkosten einer Kostenstelle<br />
aufgeführt werden, die man ausschlies-<br />
slich auf höhere<br />
Löhne zurückführen<br />
kann. Diese<br />
werden als Gemein-<br />
und nicht<br />
als Einzelkosten in<br />
unserem Beispiel<br />
behandelt. Voraussetzung<br />
ist neben<br />
der wertmässigen<br />
Planung und Erfassung dieser relevanten<br />
Kosten die gleichzeitige Mengenplanung<br />
-und Erfassung.<br />
Einsatzmengenabweichung<br />
Die Einsatzmengenabweichung weist<br />
den mengenbezogenen Mehr- beziehungsweise<br />
Minderverbrauch von Kostenarten<br />
aus. Als Beispiel kann der mengenmässige<br />
Minderverbrauch von<br />
Schmieröl genannt werden. Auch hier<br />
erfolgt die Mengenplanung und Erfassung,<br />
um diese Abweichung darzustellen.<br />
Strukturabweichung<br />
Die Strukturabweichung zeigt einen<br />
anderen Kosten(arten)einsatz als geplant<br />
auf. Sie tritt auf, wenn eine nicht<br />
geplante Kostenart im Ist gebucht worden<br />
ist oder wenn zu einer geplanten<br />
Kostenart keine Istdaten vorhanden<br />
sind.<br />
Einsatzrestabweichung<br />
Die Einsatzrestabweichung beinhaltet<br />
Abweichungen, die zwar auf der Ein-<br />
8 Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
(47), Zufikon AG, dipl. Buchhalter/Controller,<br />
geschäftsführender Partner der<br />
AIT-Avantgarde Information Technology, Vaduz,<br />
einem Beratungsunternehmen im SAP-Umfeld.<br />
Unser Autor hat langjährige Berufserfahrung als<br />
Projektleiter und Berater im Umfeld von R/2 und R/<br />
3, ist Fachvorstand der mündlichen Prüfung für<br />
Experten in Rechnungslegung und Controlling,<br />
Dozent an der Fachhochschule Aargau für Wirtschaftsinformatik,<br />
Praxistransfer mit SAP R/3-Systemen,<br />
für Management Accounting bei der<br />
Ausbildung zum dipl. Buchhalter/Controller und<br />
Gastreferent an diversen Universitäten und Fachhochschulen<br />
zum Thema Management Accounting<br />
und SAP-Systeme. n<br />
satzseite entstanden sind, aber nicht<br />
der vorhergehenden Kategorie zugeordnet<br />
werden können. Folgende Ursache<br />
ist möglich: es wurden Kostenarten<br />
geplant und im Ist gebucht, jedoch<br />
keine Verbrauchsmengen geführt; die<br />
Ermittlung von Einsatzpreis- und Einsatzmengenabweichung<br />
war deshalb<br />
nicht möglich.<br />
Abweichungen<br />
der Verrechnungsseite<br />
Verrechnungspreisabweichung<br />
Eine Verrechnungspreisabweichung<br />
entsteht, wenn ein Tarif (Kostensatz)<br />
verwendet wird, der nicht dem Plantarif<br />
entspricht, der monatlich iterativ auf<br />
Basis der Planleistung ermittelt wird. Es<br />
werden somit Durchschnittstarife statt<br />
Periodentarife verwendet.<br />
Verrechnungsmengenabweichung<br />
Die Verrechnungsmengenabweichung<br />
ergibt sich als Differenz zwischen der<br />
Istentlastung und der Sollentlastung,<br />
die durch die Abweichung der manuel-<br />
1·04
len von der verrechneten Istmenge bedingt<br />
ist. Diese Abweichung wird nach<br />
folgender Formel berechnet: (Istmenge<br />
– manuelle Istmenge) x Plantarif. Aus<br />
bestimmten Gründen kann die Sollentlastung<br />
(Standard) manuell durch eine<br />
Isteingabe korrigiert werden. Das kann<br />
als eher theoretisch betrachtet werden.<br />
Fixkostenabweichung<br />
Die Fixkostenabweichungen ergeben<br />
sich daraus, dass bei einer Istbeschäftigung,<br />
die von der Planbeschäftigung<br />
abweicht, ein Teil der fixen Plankosten<br />
durch die Entlastungen entweder unter-<br />
oder überdeckt wird.<br />
Restabweichung<br />
Bei der Restabweichung handelt es sich<br />
um die Differenz zwischen Sollkosten<br />
und verrechneten Istkosten, die nicht<br />
den vorhergehenden Abweichungskategorien<br />
zugerechnet werden konnten.<br />
Oft wird sie ausgewiesen, wenn die<br />
Ermittlung der Abweichungskategorien<br />
auf der Verrechnungsseite im SAP-<br />
System deaktiviert wurde.<br />
Zusammenfassung<br />
Die Abweichungskategorien des SAP-<br />
Systems verbinden eigentlich in der<br />
Kostenstellenrechnung die in der<br />
Schweiz bekannte Theorie der Abweichungsanalyse<br />
im Bereich der Einzelund<br />
Gemeinkosten. Dieser Ansatz entspricht<br />
den Forderungen der Praxis. Die<br />
Methode der Erfassung der Einzellöhne<br />
mit anschliessender Analyse auf dem<br />
Kostenträger kann nicht als zeitgemäss<br />
Kollegen in Europa<br />
Mitglieder des veb.ch profitieren<br />
von der guten Zusammenarbeit<br />
ihres schweizerischen<br />
Verbandes mit bedeutenden europäischen<br />
Fachverbänden: Die veb.ch-<br />
Partnerverbände sind gerne behilflich,<br />
wenn es darum geht, Kontakte zu Fachleuten<br />
herzustellen oder Know-how-<br />
Quellen im jeweiligen Lande zu erschliessen.<br />
Zudem bieten sie den<br />
veb.ch-Mitgliedern den Besuch ihrer<br />
Veranstaltungen zu Mitgliederkonditionen<br />
an.<br />
Darstellung 1: Abweichungskategorien<br />
bezeichnet werden. Trotzdem werden<br />
leider noch heute solche Aufgaben an<br />
unseren Prüfungen gestellt.<br />
So verführerisch und interessant diese<br />
genaue und transparente Methode im<br />
SAP-System auch ist, in der Praxis findet<br />
auch sie kaum in einem solchen Detaillierungsgrad<br />
Anwendung. Immer mehr<br />
Unternehmen gehen dazu über, auf die<br />
in der Theorie so beliebte Aufteilung der<br />
fixen und variablen Kosten zu verzichten.<br />
Was eigentlich nur noch interessiert,<br />
ist, wieviel Kosten die Kostenstel-<br />
n Europa: EMAA-Geschäftsstelle:<br />
Tel. 0049 228 9 63 93 18, Fax 0049 0<br />
228 9 63 93 14, Postfach 2629, D-<br />
53016 Bonn, kontakt@emaa.de,<br />
www.emaa.de<br />
n Bundesverband der Bilanzbuchhalter<br />
und Controller, Am Propsthof 15–<br />
17, Postfach 26 55, D-53016 Bonn<br />
Telefon 0049 228 9 63 93 0, Fax 0049<br />
228 9 63 93 14, kontakt@bvbc.de,<br />
www.bvbc.de<br />
len haben verrechnen können – das<br />
heisst die Über- oder Unterdeckung.<br />
Schliesslich geht es nur darum, ob ein<br />
Unternehmen seine Kapazitäten auslasten<br />
kann. Dies muss auch ein Kostenrechner<br />
akzeptieren können.<br />
Vorschau<br />
Der SAP-Beitrag der nächsten Ausgabe<br />
von «Rechnungwesen & Controlling»<br />
betrachet, was SAP im Bereich der Prozesskostenrechnung<br />
anbieten kann. n<br />
n Bundesverband der Österreichischen<br />
Bilanzbuchhalter, Eipeldauer<br />
Strasse 38/19/3, A-1020 Wien, Fax<br />
0043 1 258 22 19, boeb@chello.at,<br />
www.boeb.at<br />
n Tschechien: SU – Svaz Úcetnich,<br />
The Union of Accountants, Lubomir<br />
Harna, Präsident, Stepánská 28, CZ-<br />
11000 Praha 1, Tel. 00422 24041015,<br />
Fax 00422 24042915<br />
harna@svaz-ucetnich.cz<br />
www.svaz-ucetnich.cz<br />
1·04 Rechnungswesen<br />
9<br />
&Controlling
Workshop Steuern 2004<br />
Mit rund 250 Teilnehmern hat<br />
das traditionelle «Januar-<br />
Steuerseminar» des veb.ch<br />
wieder ein klares Zeichen gesetzt. Die<br />
MWST ist weiterhin ein «heisses Thema»:<br />
Besonders wenn es grössere Änderungen<br />
im «Steuergesetzwald» gibt,<br />
vermag das Treuhänder und Berater<br />
sehr zu interessieren.<br />
Der folgende Beitrag greift aus dem<br />
umfangreichen Programm vier Fälle aus<br />
der aktuellen Rechtsprechung heraus.<br />
1. Nachsteuern<br />
Voraussetzungen und Umfang der Mitwirkungspflicht<br />
des Steuerpflichtigen<br />
im Nachsteuerverfahren:<br />
Die X AG ist für die<br />
Steuerjahre 1992–<br />
1995 rechtskräftig<br />
eingeschätzt. Anlässlich<br />
einer Prü-<br />
fung der Bücher der Geschäftsjahre<br />
1995 und 1996 stellt der steueramtliche<br />
Revisor verschiedene Mängel in der<br />
Buchführung und Jahresrechnung fest.<br />
Gestützt auf diese Feststellungen eröffnet<br />
das Steueramt ein Nachsteuer- und<br />
Steuerstrafverfahren für die Steuerjahre<br />
1992–1995. Begründet wird die Einleitung<br />
eines Nachsteuer- und Strafsteuerverfahrens<br />
damit, dass die anlässlich<br />
der Revision festgestellten erheblichen<br />
Mängel im Rechnungswesen so-<br />
Unsere Referenten<br />
Benno Frei, dipl. Experte in Rechnungslegung<br />
und Controlling, Experte MWST,<br />
Inhaber FISKAL Schulung + Beratung<br />
GmbH, Widnau, Buchautor und Fachdozent<br />
an diversen Fachschulen<br />
Sikander von Bhicknapahari, lic.iur.,<br />
dipl. Experte in Rechnungslegung und<br />
Controlling, Dozent an verschiedenen<br />
Fachhochschulen für Planung, Risk Management,<br />
Investitionsrechnung und<br />
Recht<br />
Heinrich Jud, Dr.iur., Rechtsanwalt, Partner<br />
bei Bührer & Frey, Rechtsanwälte für<br />
Steuerrecht, Zürich, Inhaber der juristischen<br />
Datenbank JUDAT, Zumikon<br />
Der traditionelle veb.tax-Workshop Steuern<br />
zum Jahresbeginn hat 250 Teilnehmer<br />
angezogen.<br />
wie viele geschäftsmässig nicht begründete<br />
Aufwendungen (Privataufwendungen<br />
des Aktionärs) den Schluss zulassen,<br />
dass solche Mängel auch in den<br />
Vorjahren vorliegen. In der Folge legt<br />
das Steueramt die Nachsteuern fest.<br />
Mit Rekurs wehrt sich die X AG gegen<br />
die Auferlegung einer Nachsteuer.<br />
Für das Nachsteuerverfahren gelten<br />
gemäss § 162 Abs. 3 Satz 2 StG die<br />
Bestimmungen über die Verfahrensgrundsätze,<br />
das Einschätzungs- und<br />
das Rekursverfahren sinngemäss. Daraus<br />
folgt, dass der rechtskräftig eingeschätzte<br />
Steuerpflichtige auch im Nachsteuerverfahren<br />
an der Sachverhaltsermittlung<br />
mitzuwirken und demzufolge<br />
die in den Bestimmungen von § 133 bis<br />
§ 135 StG geregelten Verfahrenspflichten<br />
zu erfüllen<br />
hat, namentlich<br />
also der SteuerbehördeAuskunft<br />
erteilen<br />
und Beweismittel<br />
vorlegen muss. So wie im Einschätzungsverfahren<br />
die Mitwirkungspflicht<br />
vom Vorliegen der Steuerpflicht abhängt,<br />
kann der Betroffene aber nur<br />
unter der Bedingung zur Mitwirkung<br />
herangezogen werden, dass er der<br />
Nachsteuerpflicht unterliegt.<br />
Im Einklang mit der allgemeinen Beweislastregel<br />
trägt die Steuerbehörde<br />
die Beweislast für die Tatsachen, welche<br />
die Nachsteuerpflicht begründen. Doch<br />
Hans Ulrich Meuter, lic.iur., dipl. Steuerexperte,<br />
Ing. Agr. ETH, Chef Inventarkontrolle<br />
und Gemeindesteuerausscheidung,<br />
Kantonales Steueramt Zürich<br />
Beat Walker, lic.rer.pol., dipl. Steuerexperte,<br />
Vizedirektor der Schweizerischen<br />
Akademie für Steuerlehre, Geschäftsführer<br />
der stw.consult.ag, Verwaltungsrat<br />
und Geschäftsführer der<br />
first.seminare.ag<br />
Christian Wey, dipl. Bankfachexperte,<br />
Besondere Steueruntersuchungen ESTV,<br />
Hauptabteilung direkte Bundessteuer,<br />
ehemaliges Mitglied der Arbeitsgruppe<br />
GeBüV der ESTV<br />
10 Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
dürfen die Anforderungen an diesen<br />
Beweis – jedenfalls soweit die Mitwirkungspflicht<br />
des rechtskräftig eingeschätzten<br />
Steuerpflichtigen im Nachsteuerverfahren<br />
in Frage steht – nicht<br />
überspannt werden. Es muss genügen,<br />
dass der von der Steuerbehörde angenommene<br />
Sachverhalt aufgrund bestimmter<br />
Anhaltspunkte sehr wahrscheinlich<br />
ist.<br />
Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden<br />
Fall nur bezüglich eines nicht<br />
aktivierten WIR-Kontos gegeben. Da<br />
diesbezüglich die Steuerpflichtige aber<br />
nicht angehört worden ist, wurde ihr<br />
rechtliches Gehör verletzt; die Sache im<br />
Nachsteuer(ein-schätzungs)verfahren<br />
ist zurückzuweisen.<br />
2. Nachsteuerperiode<br />
Prüfung einer Unterbesteuerung nur<br />
innerhalb einer Steuerperiode (für Korrekturen<br />
zu Gunsten des Pflichtigen<br />
müssen die Voraussetzungen der Revision<br />
erfüllt sein):<br />
Die Pflichtige bezweckt die Vermögensverwaltung<br />
für institutionelle Anleger<br />
und ist für die Steuerjahre 1993–1997<br />
rechtskräftig eingeschätzt. Im Einschätzungsverfahren<br />
für die Jahre 1998 ff.<br />
stellt der Steuerkommissär fest, dass<br />
einzelne Retrozessionsverträge teilweise<br />
falsch verbucht worden sind. Im<br />
Nachsteuerverfahren werden die entsprechenden<br />
Korrekturen für die Steuerjahre<br />
1993 ff. durchgeführt. Das<br />
Nachsteuerverfahren für das Steuerjahr<br />
1995 wird eingestellt, weil in diesem<br />
Jahr keine Unterbesteuerung eingetreten<br />
sei. Das Steueramt verweigert somit<br />
für das Steuerjahr 1995 eine Korrektur<br />
zu Gunsten des Steuerpflichtigen.<br />
Die altrechtliche Regelung der Nachsteuerperiode<br />
von sechs Steuerjahren<br />
ist formeller Natur. Sie ist daher nach<br />
dem Grundsatz der «sofortigen» Geltung<br />
verfahrensrechtlicher Vorschriften<br />
auch für Steuerjahre bis 1998 nicht<br />
mehr anzuwenden.<br />
Ohne Bedeutung bleibt somit der unter<br />
dem alten Recht im Licht des Verbots<br />
einer Überbesteuerung gezogene<br />
Schluss, der Steuerausfall des Gemeinwesens<br />
müsse sich als Saldo der gesamten<br />
«Nachsteuerperiode» ergeben.<br />
Nach neuem Recht entscheidend ist im<br />
Sinn der Periodizität der Steuer die voll-<br />
1·04<br />
Porträt des Autoren Peter Wullschleger auf Seite 3
ständige und gerechte (richtige) Besteuerung<br />
der Steuerpflichtigen in jeder<br />
Steuerperiode (§160, 161 rev ZH StG; §<br />
103 a ZH StG).<br />
Entgegen der Kritik der Rekurrentin<br />
wird auf diese Weise nicht gegen das<br />
aus dem Gesetzmässigkeitsgrundsatz<br />
fliessende Verbot der Überbesteuerung<br />
verstossen, kann sich dieses doch angesichts<br />
der Periodizität der in Frage stehenden<br />
Ertrags- beziehungsweise Gewinnsteuer<br />
grundsätzlich nur auf die<br />
Einschätzung der steuerpflichtigen Person<br />
für die einzelne Steuerperiode beziehen<br />
(vgl. § 1 Abs. 2 a StG bzw. § 1 lit<br />
b StG). Daher verfängt auch der unter<br />
Berufung auf Känzig/Behnisch erhobene<br />
Einwand der Rekurrentin nicht, wonach<br />
entscheidend sein müsse, dass<br />
dem Gemeinwesen auf längere Sicht<br />
beziehungsweise im Rahmen der Verjährungsfrist<br />
im Ergebnis kein Steuerbetrag<br />
vorenthalten werde. Die Periodizität<br />
der Steuer verlangt vielmehr die<br />
vollständige und gerechte (richtige) Besteuerung<br />
der Steuerpflichtigen in jeder<br />
Steuerperiode (vgl.. § 132 Abs. 1 StG<br />
bzw. § 71 a StG).<br />
3. Nachsteuerverfahren<br />
Neue Tatsache, Nichtdeklaration eines<br />
Liquidationsüberschusses:<br />
Y erhält als Aktionär der liquidierten X<br />
AG einen Liquidationsüberschuss, der<br />
zu einem grossen Teil in Wertschriften<br />
ausgerichtet wird. In der Folge unterlässt<br />
es Y, den Liquidationsüberschuss in<br />
seiner persönlichen Steuererklärung<br />
1997/98 als Einkommen zu deklarieren.<br />
Im Wertschriftenverzeichnis führte er<br />
hingegen die erhaltenen Wertschriften<br />
auf und weist auf die Liquidation der X<br />
AG hin. Die Einschätzung 1997/98 ist in<br />
Rechtskraft erwachsen. Im Zusammenhang<br />
mit einem anderen Veranlagungsverfahren<br />
wird das Steueramt später<br />
auf die Ausschüttung des Liquidationsüberschusses<br />
aufmerksam und leitet<br />
ein Nachsteuer- und Steuerstrafverfahren<br />
ein.<br />
Bei der Beantwortung der Frage, ob<br />
neue Tatsachen oder Beweismittel vorliegen,<br />
die es erlauben, auf eine rechtskräftige<br />
Veranlagung zurückzukommen,<br />
kommt es entscheidend auf die<br />
Würdigung der jeweiligen Pflichten der<br />
Steuerpflichtigen und der Steuerbehörden<br />
im Veranlagungsverfahren an. Ein<br />
Verschulden des Steuerpflichtigen ist<br />
nicht erforderlich. In casu hat der Pflichtige<br />
sowohl die Beteiligung an der<br />
liquidierten AG als auch die Liquidation<br />
als solche sowie die als Liquidationsdividende<br />
erhaltenen Wertschriften im<br />
Wertschriftenverzeichnis deklariert und<br />
entsprechende Belege beigelegt. Er hat<br />
jedoch den Liquidationsanteil nicht<br />
beim Einkommen, sondern beim Vermögen<br />
deklariert, womit nach höchstrichterlicher<br />
Auffassung der Anschein<br />
erweckt wirde, es sei noch kein Anspruch<br />
darauf entstanden. Deshalb sind<br />
die Voraussetzungen für ein Nachsteuerverfahren<br />
gegeben. Dies, obwohl die<br />
Steuerbehörde im Zeitpunkt der Veranlagung<br />
an sich Kenntnis von der Ausschüttung<br />
des Liquidationsüberschusses<br />
haben musste, weil ihr das entsprechende<br />
verrechnungssteuerliche Meldeformular<br />
vorlag. In steuerstrafrechtlicher<br />
Hinsicht hat sich der Steuerpflichtige<br />
zumindest eine Sorgfaltspflichtverletzung<br />
zuschulden kommen lassen,<br />
weshalb er sich der vollendeten Steuerhinterziehung<br />
schuldig gemacht hat.<br />
Bei diesem Verfahrensausgang sind die<br />
bundesgerichtlichen Kosten dem unterliegenden<br />
Beschwerdegegner aufzuerlegen<br />
(Art. 156 Abs. 1, Art. 153 und<br />
153a OG). Eine Parteientschädigung ist<br />
nicht zuzusprechen (Art. 159 Abs. 1<br />
und 2 OG).<br />
4. Abgrenzung steuerbarer<br />
Vermögensertrag/steuerfreier<br />
Kapitalgewinn<br />
Z. deklariert in der Steuererklärung<br />
2000 beim Vermögen unter dem Titel<br />
«X Devisenkonto Nr. ...» erstmals einen<br />
Betrag von CHF 44 212.–. Dieser entspricht<br />
dem Nettogewinn aus der Differenz<br />
des entsprechenden Kontosaldos<br />
per Ende 2000 von CHF 186 766 und<br />
den vom Pflichtigen auf das Konto geleisteten<br />
Einzahlungen in den Jahren<br />
1999 und 2000 von CHF 131 500, abzüglich<br />
einer zwanzigprozentigen Gewinnbeteiligung<br />
der Y Investment AG.<br />
In der Folge wirde Z. mit einem steuerbaren<br />
Einkommen von CHF 133 100<br />
und einem steuerbaren Vermögen von<br />
CHF 587 000 eingeschätzt. Beim Einkommen<br />
wird unter anderem der ausgewiesene<br />
Devisengewinn von CHF<br />
44 212 aufgerechnet.<br />
Wer eine Finanzgesellschaft beauftragt,<br />
mit Mitteln aus seinem Privatvermögen<br />
in eigenem Namen, jedoch auf<br />
Rechnung des Auftraggebers jeweils<br />
über ein persönliches Konto einzeln<br />
abgerechnete Devisenhandelsgeschäfte<br />
zu tätigen, erzielt bei erfolgreichem<br />
Abschluss dieser Geschäfte keinen<br />
steuerbaren Vermögensertrag, sondern<br />
einen steuerfreien Kapitalgewinn.<br />
Dass die Einlage zusammen mit solchen<br />
anderer Kunden am Markt investiert<br />
wird, betrifft die technische Abwicklung<br />
des Geschäfts und bedeutet nicht<br />
«Poolen» im Sinn der Rechtsprechung.<br />
Es ist zwar offenkundig, dass es sich bei<br />
den getätigten Devisentransaktionen<br />
um rein spekulative Geschäfte handelt,<br />
die aufgrund der verabredeten «Handelslinie»<br />
(= dem Zehnfachen des einbezahlten<br />
Betrags) zudem mit einem<br />
relativ hohen Risiko behaftet sind. Indessen<br />
ist dies entgegen der Auffassung<br />
der Steuerkommissärin für die<br />
Rechtsnatur der damit erzielten Ergebnisse<br />
nicht entscheidend, sondern beschlägt<br />
allein die Sicherheit der Anlage<br />
und hat schlimmstenfalls zur Folge,<br />
dass der Kunde die Geldeinlage vollumfänglich<br />
verliert.<br />
Ebenso unmassgeblich ist sodann, ob<br />
die Pflichtigen die jeweiligen Transaktionen<br />
selber veranlasst haben oder ob sie<br />
nach Gutdünken der Y Investment AG<br />
ausgeführt worden sind, da dies die Art<br />
des «Poolens» nicht beeinflusst. Im<br />
Übrigen werden die Pflichtigen die einzelnen<br />
Geschäfte wohl mehrheitlich<br />
der Y Investment AG überlassen und<br />
dazu nicht selber den Auftrag gegeben<br />
haben, da sie sich aufgrund der besseren<br />
Kenntnisse der Y Investment AG<br />
über das Marktgeschehen davon mehr<br />
Erfolg versprochen haben dürften. Dies<br />
lässt die erzielten Gewinne jedoch nicht<br />
zu Vermögensertrag werden. n<br />
<br />
<br />
Die Portokosten steigen immer mehr.<br />
Mit einer Beilage in «Rechnungswesen<br />
& Controlling» geben Sie Gegensteuer:<br />
Sie erreichen eine interessante Zielgruppe<br />
zu vorteilhaften Konditionen.<br />
Verlangen Sie eine Offerte:<br />
Rechnungswesen & Controlling<br />
verlag@hurter.com<br />
052 770 20 40<br />
1·04 Rechnungswesen<br />
11<br />
&Controlling
veb.ch-Abendakademie: Personalführung<br />
Die veb.ch-Abendakademie beschränkt<br />
sich nicht auf Rechnungslegung,<br />
Controlling und<br />
Rechnungslegung: Sie erschliesst auch<br />
weitere Horizonte in anderen Fachbereichen,<br />
etwa in der Personalführung.<br />
Besonders beliebt an den Lehrgängen<br />
der veb.ch-Abendakademie ist die<br />
Möglichkeit einer Zertifikatsprüfung.<br />
Eine gut besuchte Veranstaltungsreihe<br />
der Abendakademie hat sich mit Aspekten<br />
der Personalführung befasst: Welche<br />
Macht geht von der Kommunikation<br />
aus? Wie<br />
wählt man Personal<br />
richtig aus,<br />
und wie bewirbt<br />
man sich wirkungsvoll?<br />
Aus<br />
dem Programm herausgegriffen wird<br />
im Folgenden der Teil Führung.<br />
1. Mitarbeiterführung<br />
1.1 Definition<br />
Unter Führung versteht man «persönliche<br />
und zielorientierte Steuerung und<br />
Einwirkung auf menschliches Verhalten,<br />
mit der Absicht, sowohl die Ziele<br />
des Unternehmens als auch die der<br />
Menschen, die in ihr wirken, möglichst<br />
weitgehend zu verwirklichen.»<br />
Weitere Definitionen legen andere<br />
Schwerpunkte:<br />
Unsere Referentinnen<br />
Judith Bettoja Regli, dipl. Personalleiterin<br />
ZGP, Ausbildnerin mit eidg. Fachausweis,<br />
Fachbereichsverantwortliche Arbeit-<br />
und Laufbahnplanung eines Stellenvermittlungs-Unternehmen,Lehrgangsleiterin<br />
Personalfachausbildung<br />
an einer Kader- und Management-<br />
Schule.<br />
Karin Bosshard von Gunten, dipl. Personalleiterin<br />
ZGP, dipl. Mediatorin FHA/<br />
Konfliktcoach, Dozentin an verschiedenen<br />
Schulen, Trainerin, Seminarleiterin<br />
in den Bereichen Führung, Kommunikation,<br />
Personalmarketing, Personalselektion<br />
und -suche.<br />
n Führen bedeutet, Mitarbeiter durch<br />
aktive Beeinflussung so zum Handeln<br />
zu bringen, dass ein gemeinsames,<br />
übergeordnetes Ziel wie zum Beispiel<br />
Unternehmenserfolg, erreicht wird.<br />
(Steiner)<br />
n Führung kann als Willensbildung<br />
und Willensdurchsetzung zur Erreichung<br />
eines oder mehrerer Ziele<br />
interpretiert werden. (Hahn)<br />
Wie erhält Personalführung Wirkungskraft?<br />
Rezepte aus der veb.ch-Abendakademie<br />
n Führen heisst Menschen von einer<br />
Idee überzeugen und sie befähigen,<br />
diese Überzeu-<br />
1.2 Ist Führung lernbar?<br />
gung in aktives<br />
Handeln zu<br />
transformieren.<br />
(Zollikofer)<br />
Führung ist mit der Veränderung des<br />
Menschenbildes anspruchsvoller geworden<br />
und für das Funktionieren von<br />
Unternehmen unerlässlich.<br />
Die Fähigkeit zu führen beruht einerseits<br />
auf Begabung und auf bestimmten<br />
Charaktereigenschaften, andererseits<br />
aber auch auf systematischer<br />
Schulung. Die Geschichte zeigt allerdings,<br />
dass auch Persönlichkeiten ohne<br />
Führungsausbildung – sogenannte<br />
«geborene Führer» – bedeutende Führungserfolge<br />
erzielen. Das schwächt die<br />
Bedeutung einer Führungsausbildung<br />
jedoch keineswegs ab.<br />
Während entscheidende Eigenschaften<br />
einer Führungskraft wie Loyalität, Mut,<br />
Durchhaltevermögen, ethische und soziale<br />
Haltung nur beschränkt beeinflussbar<br />
sind und deshalb bei Führungskräften<br />
vorausgesetzt werden müssen,<br />
sind andere Führungseigenschaften erlernbar.<br />
Zu den erlernbaren Qualitäten<br />
zählen insbesondere:<br />
n Erkennen und Verstehen politischer,<br />
sozialer und wirtschaftlicher<br />
Zusammenhänge und die Abschätzung<br />
ihres Einflusses auf die unternehmerische<br />
Tätigkeit<br />
n Formulieren von Zielen<br />
n Abstraktionsvermögen<br />
n Erkennen und Analysieren von<br />
Problemen<br />
n Treffen von Entscheidungen<br />
n Beherrschen der Führungsmittel<br />
und -methoden<br />
12 Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
Führung ist ein dauernder, komplexer<br />
Lernprozess, in dessen Verlauf der Vorgesetzte<br />
sich auf immer neue Situationen,<br />
Mitarbeiter und Entwicklungen<br />
einstellen muss.<br />
2. Führungsverhalten<br />
Das Führungsverhalten spielt unter anderem<br />
bei der Einführung von Führungsmodellen,<br />
bei der Beförderungspolitik<br />
und als Anhaltspunkt für Verhaltensänderungen<br />
eine grosse Rolle. Das<br />
Führungsverhalten wird erfasst, indem<br />
gewisse Merkmale isoliert geprüft und<br />
Beurteilungskriterien geschaffen werden.<br />
Das bekannteste dieser Verfahren<br />
ist das zweidimensionale Verhaltensgitter<br />
von Blake und Mouton, auch Managementgitter<br />
(«Management Grid»)<br />
genannt (siehe Darstellung 1).<br />
2.1 Die Grenzbereiche<br />
Die Zahlen am Ende der folgenden Abschnitte<br />
beziehen sich auf das Managementgitter<br />
auf Seite 13.<br />
n Geringes Interesse an Menschen<br />
und Produktion. Keine Einwirkung, es<br />
kann kaum von Führung die Rede<br />
sein; entspricht am ehesten dem<br />
«laisser-faire»-Führungsstil. (1.1)<br />
n Starke Betonung der menschlichen<br />
Belange, Vernachlässigung der<br />
Produktion und der Wirtschaftlichkeit.<br />
Angenehmes Arbeitsklima. (1.9)<br />
n Hohe Arbeitsleistung bei Vernachlässigung<br />
der menschlichen Belange;<br />
entspricht dem autoritären Führungsstil.<br />
(9.1)<br />
n Ausgeglichene, mittlere Berücksichtigung<br />
der Menschen wie auch<br />
der Arbeitsleistung. (5.5)<br />
n Hohe Arbeitsleistung von begeisterten<br />
Mitarbeitern ergibt ein maximales<br />
Ergebnis; entspricht dem<br />
kooperativen Führungsstil. (9.9)<br />
2. Führungsstile<br />
2.1 Kooperativer Führungsstil<br />
Der kooperative Führungsstil wird auch<br />
demokratischer, kollegialer oder partizipativer<br />
Führungsstil genannt.<br />
1·04<br />
Porträt des Autoren Peter Wullschleger auf Seite 3
Damit wird ein Führungsstil bezeichnet,<br />
bei dem Vorgesetzte und Mitarbeiter<br />
gemeinsam planen und entscheiden.<br />
Der starke Wandel in Wirtschaft, Technologie<br />
und Gesellschaft der letzten<br />
Jahre hat auch Spuren an den Führungsstilen<br />
hinterlassen. Die immer<br />
komplizierteren Produktionsprozesse<br />
und Arbeitsabläufe, weitgehende Arbeitsteilung,<br />
ein wachsender Informationshunger,<br />
die immer bessere Ausbildung<br />
und somit qualifiziertere Mitarbeiter,<br />
haben nach neuem Führungsverhalten<br />
gerufen.<br />
Aus diesen und zahlreichen weiteren<br />
Gründen lässt sich autoritäre Führung<br />
nicht mehr mit moderner Unternehmensführung<br />
in Einklang bringen.<br />
Es ist aber zu unterstreichen, dass es<br />
auch im kooperativen Führungsstil Autorität<br />
gibt – ohne sie ginge es nicht! Es<br />
handelt sich hier aber um eine natürliche<br />
oder persönliche Autorität – im<br />
Gegensatz zur institutionellen, gegebenen<br />
hierarchischen Autorität, die auf<br />
Rang und Tradition beruht.<br />
2.1.1 Hauptmerkmale und Vorteile<br />
n Vorgesetzte und Mitarbeiter sind<br />
Partner, die gemeinsam beim Entscheidungsprozess<br />
mitwirken. Dieser<br />
Führungsstil ist motivierend für<br />
engagierte, mitdenkende Mitarbeiter.<br />
n Gemeinsame Zielvereinbarungen<br />
erreichen, dass Mitarbeiter hinter den<br />
Zielen stehen und sich entsprechend<br />
einsetzen. Die Chancen für die<br />
Zielerreichung sind grösser.<br />
n Die Mitarbeiter denken selbstständig<br />
und kritisch mit und entlasten so<br />
den Vorgesetzten.<br />
n Die Firmenkontinuität (Nachfolgeplanung)<br />
wird einfacher.<br />
n Informationen fliessen von oben<br />
nach unten und umgekehrt – Informationsbedürfnisse<br />
werden besser<br />
abgedeckt.<br />
n Die Chance für ein gutes Arbeitsklima<br />
wird mit diesem Führungsstil<br />
massiv erhöht, Kreativität und Einsatz<br />
der Mitarbeiter werden stark gefördert.<br />
2.1.2 Nachteile<br />
n Mehr Zeitaufwand für Informationsaustausch<br />
und Diskussionen.<br />
Darstellung 1: «The Management Grid» nach Blake/Mouton<br />
n Eventuell entstehen Zielkonflikte,<br />
da der Vorgesetzte nicht «einfach<br />
bestimmt» – wobei zu bemerken ist,<br />
dass diese Zielkonflikte auch beim<br />
autoritären Führungsstil vorhanden<br />
sind. Nur wird in so geführten Firmen<br />
nicht darüber diskutiert...<br />
n Unter Umständen gibt es keine<br />
Verantwortlichen für bestimmte<br />
Fragen.<br />
2.2 Situativer Führungsstil<br />
Fragt man sich, was das Entscheidende<br />
bei der Führung ist, kommt man darauf,<br />
dass es nach aller Wahrscheinlichkeit<br />
nicht darum geht, immer nur kooperativ<br />
oder autoritär zu führen.<br />
Es ist auch zu beachten, dass es Menschen<br />
gibt, die gerne autoritär geführt<br />
werden wollen. Beide Führungsstile<br />
mögen in bestimmten Fällen richtig<br />
sein, ihre konsequente Einhaltung ist<br />
aber nicht das oberste Ziel. Das Ziel<br />
besteht darin, möglichst wirksam zu<br />
führen.<br />
Wann und wie<br />
ist Führung wirksam?<br />
Führung ist – einfach ausgedrückt –<br />
wirksam, wenn die Situation richtig erkannt<br />
worden ist und wenn danach<br />
gehandelt wird: Der Führungsstil ist situativ.<br />
Die Situation wird beeinflusst<br />
durch die Organisation selbst, durch die<br />
Umwelt, die Vorgesetzten, die Mitarbeiter,<br />
die Kollegen und weitere interne<br />
und externe Umstände.<br />
Folgende Fähigkeiten werden vom Vorgesetzten<br />
verlangt, der sich für den<br />
situativen Führungsstil entschieden hat:<br />
n Flexibilität<br />
n die Fähigkeit, eine Situation richtig<br />
zu erkennen und zu beurteilen<br />
n die Fähigkeit, eine Situation wenn<br />
nötig im gewünschten Sinn zu ändern<br />
Wenn diese Voraussetzungen – und<br />
selbstverständlich ähnliche für die Mitarbeiter<br />
– gegeben sind, wird der situative<br />
Führungsstil grosse Aussichten auf<br />
Erfolg, sowohl in Leistungserreichung<br />
wie Mitarbeiterzufriedenheit, haben. n<br />
1·04 Rechnungswesen<br />
13<br />
&Controlling
Es gehört sich einfach<br />
Warum ich im veb.ch mitmache?<br />
Weil es sich doch einfach<br />
gehört. Man sollte etwas<br />
für die Gemeinschaft tun. Alle sollten<br />
etwas für die Gemeinschaft tun.<br />
Dass ich Buchhalter werde, war mir<br />
nicht vorbestimmt. Ich habe in Wipkingen<br />
und Oerlikon die Primar- und die<br />
Sekundarschule besucht. Meine Kameraden<br />
treffe ich heute noch jeden Monat<br />
– bis zum letzten Jahr war auch<br />
unser Lehrer immer mit dabei.<br />
Nach der Sekundarschule bin ich in eine<br />
private Handelsschule im Welschland,<br />
wie es damals üblich war.<br />
Bei Weidmann & Sohn, China- und<br />
Japanimporte, habe ich die kaufmännische<br />
Lehre absolviert. Wir haben mit<br />
Perlmuttknöpfen und Porzellan gehandelt,<br />
mit Honanseide und anderen exotischen<br />
Kostbarkeiten. Der spätere Uni-<br />
Professor Paul Weilenmann war unser<br />
Klassenlehrer an der Kaufmännischen<br />
Berufsschule Zürich.<br />
Nach dem Abschluss hat mir mein Vater<br />
eine Stelle als Englisch-Korrespondent<br />
in der Florentiner Strohindustrie verschafft.<br />
Wohlen im Aargau und Florenz<br />
haben damals die Modezentren der<br />
Welt mit Strohhüten beliefert. Nach der<br />
RS bin ich als Italienisch-Korrespondent<br />
in den Gemüsehandel im Londoner<br />
Covent Garden Market.<br />
Doch bald einmal habe ich gedacht, ich<br />
könnte Europa erforschen: Als Reiseführer<br />
auf Busreisen.<br />
Solche beruflichen Auslanderfahrungen<br />
waren damals unabdingbar, wollte<br />
man etwas erreichen. Heute setzt man<br />
sich in den Flieger und reist zum Spass,<br />
um etwas von der Welt zu sehen. Dazu<br />
haben wir schlicht und ergreifend kein<br />
Geld gehabt. Ich wüsste nicht, was<br />
besser ist – es war eben eine andere<br />
Zeit.<br />
Irgendwann habe ich gedacht, ich<br />
müsse etwas lernen, das nicht jeder<br />
könne. Dann wäre ich jemand! Also<br />
bin ich eidg. dipl. Buchhalter geworden.<br />
Nach ein paar Jahren habe ich mit<br />
In dieser Ausgabe von Rechnungswesen<br />
& Controlling lesen Sie in unserer<br />
Reihe «Persönlich» ein Doppelportrait<br />
aus zwei Generationen.<br />
einem Compagnon die<br />
Dr. Schnyder und<br />
Trachsler Verwaltungs<br />
AG gegründet. Wir haben<br />
Immobilien bewirtschaftet,<br />
und ich habe<br />
sicher etwa 1000 Eigentumswohnungenkennen<br />
gelernt. 1987 habe<br />
ich die Firma verkauft,<br />
aber es war natürlich<br />
noch zu früh für den<br />
Ruhestand. Ich habe mir<br />
vorgenommen, noch etwas<br />
«fürs Vaterland»<br />
tun. So bin ich Einschätzungsbeamter<br />
im Steueramt<br />
der Stadt Zürich<br />
geworden. Kurz vor<br />
meiner Pensionierung<br />
habe ich in die Finanzabteilung<br />
des Gesundheitsamtes<br />
gewechselt.<br />
Das war ein lustiger Laden:<br />
Schlachthof und<br />
Schädlingskontrolle haben<br />
zu uns gehört wie<br />
auch die städtischen<br />
Hallenbäder.<br />
Mein Beruf ist mir stets<br />
auch Hobby gewesen. Arbeiten hat<br />
mich erfüllt, leere Zeiten habe ich keine<br />
füllen müssen. Workaholic bin ich<br />
trotzdem nie gewesen. Meine Frau ist<br />
Ärztin und hat mir immer gesagt, wann<br />
Schluss ist.<br />
Seit vierzig Jahren bin ich veb.ch-Mitglied.<br />
Warum? Wohl weil ich ein Vereinsmeier<br />
bin und weil mir wohl ist im<br />
veb.ch. Weil es zu unserer Familie gehört<br />
hat, in einem Berufsverband zu<br />
sein. Ich habe nie berechnet, wieviel ich<br />
dank der Mitgliedschaft hier und dort<br />
sparen könnte. Man ist einfach dabei.<br />
Heute bin ich Revisor der Sektion Zürich<br />
des veb.ch.<br />
Mehr denn je steht man heute «neben<br />
den Schuhen», wenn man sich nicht<br />
fortbildet. Das ist der grosse Nutzen des<br />
veb.ch: die ausgezeichnete Fortbildung.<br />
Der Austausch mit Kollegen ist<br />
eine wertvolle Nebenwirkung.<br />
Früher ist es weder besser noch schlechter<br />
gewesen. Davon bin ich fest überzeugt.<br />
Ich habe beruflich eine gute Zeit<br />
gehabt – so wie man heute eine gute Zeit<br />
haben oder faillieren kann. Etwas wird<br />
wohl immer gleich bleiben: Man muss<br />
hart arbeiten, um Erfolg zu haben.» n<br />
14 Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
Hans Trachsler, 70, wohnhaft am Zürichberg,<br />
eidg. dipl. Buchhalter, Revisor<br />
des veb.ch Zürich<br />
1·04
Gespannt auf die Zukunft<br />
Du hast zwei linke Hände.» Das<br />
habe ich mir schon oft anhören<br />
müssen, und ich gebe zu: Teilweise<br />
ist diese Aussage berechtigt. Was<br />
liegt also näher als eine kaufmännische<br />
Ausbildung...?<br />
Im Ernst: Ich habe mir nie etwas anderes<br />
als eine kaufmännische Laufbahn<br />
vorstellen können. Darauf habe ich<br />
mich gefreut, diesen Weg habe ich<br />
begonnen, und er bereitet mir je länger<br />
je mehr Freude: Ich bin gerne im Büro,<br />
der Umgang mit Menschen bedeutet<br />
mir viel, und Zahlen sind zu einem<br />
wichtigen Teil meiner Berufswelt geworden.<br />
Angefangen hat es in Karl Schweris<br />
Imperium, bei Franz Carl Weber in<br />
Spreitenbach, wo ich meine 3-jährige<br />
Lehre als kaufmännischer Angestellter<br />
absolvierte. Anschliessend habe ich in<br />
der Zweiten Säule bei der Credit Suisse<br />
Freizügigkeitsstiftung weitere Praxis-Erfahrungen<br />
gesammelt, und heute bin<br />
ich bei der BDO Visura Zürich in der<br />
Wirtschaftsprüfung tätig.<br />
Die kaufmännische Lehre hat sich für<br />
mich mehr als bewährt. Auf dieser<br />
Grundlage will ich im Rechnungswesen<br />
weitere Fachkenntnisse gewinnen.<br />
Das Schweizerische Informatik-Zertifikat<br />
SIZ und den Fachausweis Finanzund<br />
Rechnungswesen habe ich bereits<br />
erworben. Jetzt bereite ich mich auf<br />
die Wirtschaftsprüfer-Diplomprüfung<br />
vor.<br />
Ich weiss, jetzt wird die eine und andere<br />
Augenbraue in die Höhe schnellen:<br />
«Warum wird der nicht Experte in<br />
Rechnungslegung und Controlling?»<br />
Die Antwort ist ganz einfach: Ich kann<br />
so beide Aspekte verbinden, einerseits<br />
das Rechnungswesen und andererseits<br />
die Revision. In zwei Jahren werde<br />
ich voraussichtlich die Prüfung ablegen.<br />
Neben dem Beruf, der Weiterbildung<br />
und meinem Engagement im veb.ch<br />
bleibt mir nicht viel Freizeit: Ich spiele<br />
Fussball und geniesse das Zusammensein<br />
mit Freunden und meiner Freundin.<br />
Die Reihenfolge ist zufällig; da gibt es<br />
nichts herauszulesen...!<br />
Im veb.ch ist es meine Aufgabe, über<br />
die Fachempfehlungen Rechnungswesen<br />
FER zu berichten. Zudem organisiere<br />
ich mit dem Verantwortlichen im<br />
Vorstand Fortbildungsanlässe:<br />
Wir suchen<br />
nach Inhalten und Referenten<br />
und klären die<br />
Marktchancen ab. Das<br />
macht mir einerseits<br />
grossen Spass, andererseits<br />
bin ich auch fachlich<br />
an der Fortbildung<br />
interessiert. Der beste<br />
Lohn sind das wachsende<br />
Beziehungsnetz und<br />
die vielen Leute, die man<br />
kennen lernt.<br />
Zum veb.ch bin ich aus<br />
eigener Unvorsichtigkeit<br />
gekommen: Ich habe<br />
mich per E-Post nach<br />
den Angeboten erkundigt,<br />
bin mit dem Präsidenten<br />
ins Gespräch gekommen<br />
– und hängen<br />
geblieben.<br />
Der veb.ch ist eine feine<br />
Sache: Weil der Einzelne<br />
nicht viel bewirken kann;<br />
brauchen wir als Berufsstand<br />
einen seriösen und<br />
aktiven Verband. Das ist<br />
denn auch das überzeugendste Argument,<br />
weshalb man sich im veb.ch engagieren<br />
sollte: Wir sollten das Ansehen<br />
unseres Berufes noch weiter fördern.<br />
Ich finde, heute liegt der Hauptnutzen<br />
des veb.ch in den vielen Kontakten,<br />
dem «Networking»: Man kann fachsimpeln,<br />
Ideen austauschen und von<br />
den Erfahrungen anderer profitieren. In<br />
Zukunft werden wir wohl noch stärker<br />
in der beruflichen Qualitätskontrolle<br />
tätig sein – etwa mit permanenter<br />
Schulung. Schade, dass das Internet-<br />
Forum des veb.ch noch nicht so intensiv<br />
genutzt wird. Aber das kommt schon<br />
noch, denn die eine oder andere Erfahrung<br />
lässt sich auch über das Forum<br />
austauschen.<br />
Unser Beruf bietet eine interessante Zukunft.<br />
Wir werden teilweise weniger<br />
zahlenlastig denken müssen und auch<br />
immer mehr zu neuen Visionen gezwungen.<br />
Das hat übrigens nichts zu<br />
tun mit dunkler buchhalterischer<br />
«Kreativität».<br />
Wir werden auch als Buchhalter unternehmerisch<br />
mitdenken und – je nach<br />
Rechnungslegungsstandard – Spielräume<br />
entwickeln.» n<br />
Christian Feller, 25, wohnhaft in Neuenhof,<br />
Fachman im Finanz- und Rechnungswesen<br />
mit eidg. Fachausweis,<br />
Schweizerisches Informatikzertifikat<br />
SIZ und Projektleiter Fortbildung im<br />
veb.ch<br />
1·04 Rechnungswesen<br />
15<br />
&Controlling
Interne Revision: A pain in the neck oder value added...?<br />
Aktuelle Gegebenheiten, Regulierung<br />
und Katastrophenmeldungen<br />
rufen nach einer Verstärkung<br />
der Kontrollmechanismen.<br />
Noch ist der Glaube daran intakt, dass<br />
die Führungsorgane ihre Verantwortung<br />
wahrnehmen, aber eine Verbesserung<br />
der Instrumente tut Not. Manchmal<br />
genügt ein guter Finanzchef, der in<br />
Zusammenarbeit<br />
mit dem Verwaltungsratsinnvolle<br />
Informationen<br />
rasch gewinnt<br />
und ein Frühwarnsystem<br />
entwickelt. In grösseren<br />
Organisationen ist die Bildung eines<br />
Controlling und auch einer Funktion<br />
«Interne Revision» ein Muss. Wie aber<br />
müsste eine Interne Revision ausgestattet<br />
sein?<br />
Steigende Komplexitäten der Organisationen<br />
in der Wirtschaft, die zunehmende<br />
Globalisierung, Geschäftsprozesse<br />
und Verfahren erschweren oder<br />
verunmöglichen die unternehmerische<br />
Führung. Mit einer Internen Revision,<br />
sollte diese Existenzsicherung auf lange<br />
Sicht gewährleistet werden. Im Weiteren<br />
kann es sein, dass dank vermehrter<br />
Selbstkontrolle und der damit verbundenen<br />
Transparenz im Hinblick auf «Basel<br />
II» bessere Bankenkonditionen erreicht<br />
werden.<br />
Die Interne Revision sieht ihre Arbeit<br />
darin, unabhängige und objektive Prüfungsdienstleistungen<br />
zu erbringen.<br />
Dadurch werden Mehrwert geschaffen,<br />
Schwachstellen minimiert und Geschäftsprozesse<br />
optimiert. Sie unterstützt<br />
die Organisation bei der Zielerreichung,<br />
indem sie systematisch und zielgerichtet<br />
die Effektivität des Risikomanagements,<br />
der Kontrollen und der<br />
Führungs- und Überwachungsprozesse<br />
bewertet und diese verbessern hilft. Die<br />
Interne Revision erhöht die Sicherheit<br />
im Unternehmen und ist dem Verwaltungsrat<br />
ein zusätzliches Führungsinstrument.<br />
In einem veränderten Umfeld<br />
hat die Corporate Governance, insbesondere<br />
für börsenkotierte Unternehmen,<br />
einen bedeutenden Stellenwert<br />
erhalten und ist mehr als ein Modewort.<br />
Für Publikumsgesellschaften sieht der<br />
«Swiss Code of Best Practice» die Errichtung<br />
einer Internen Revision vor. In<br />
der «Rechtslandschaft» gibt es diverse<br />
Berührungspunkte zwischen den geltenden<br />
Vorschriften, Richtlinien und<br />
Empfehlungen mit der Internen Revisi-<br />
Die Frage drängt sich heute auf: Wie<br />
muss die Interne Revision funktionieren,<br />
damit sie wirklich funktioniert?<br />
on. OR 716a sieht unter anderem die<br />
Ausgestaltung des Rechnungswesens,<br />
der Finanzkontrolle und der Finanzplanung<br />
vor. Die Oberaufsicht im Hinblick<br />
auf das Einhalten der Gesetze, Statuten<br />
und Reglemente haben die Personen,<br />
die mit der Geschäftsführung betraut<br />
sind. Im Swiss Code of Best Practice sind<br />
unter den Ziffern 19 und 20 die Aufgaben<br />
des Verwal-<br />
tungsratesgenauer definiert: Der<br />
Verwaltungsrat<br />
hat für ein dem<br />
Unternehmen angepasstes<br />
internes Kontrollsystem und<br />
Risikomanagement zu sorgen. Der Verwaltungsrat<br />
hat zusätzlich Massnahmen<br />
zur Einhaltung der anwendbaren<br />
Normen zu treffen. Ist eine Gesellschaft<br />
noch mit dem «Sarbanes-Oxley Act of<br />
2002» betraut, muss zusätzlich jährlich<br />
ein Bericht über die Wirksamkeit des<br />
internen Kontrollsystems der Revisionsstelle<br />
vorgelegt werden.<br />
Die Interne Revision ist grundsätzlich<br />
dem Verwaltungsrat beziehungsweise<br />
dem Audit Committee unterstellt und<br />
nimmt von diesem Gremium Aufträge<br />
entgegen. Damit eine Interne Revision<br />
ihre Aufgaben wirkungsvoll erfüllen<br />
kann, sollte sie in die Unternehmenshierarchie<br />
eingegliedert werden. Zu beachten<br />
ist insbesondere der Grundsatz<br />
der Unabhängigkeit von den Stellen, die<br />
sie prüfen muss. Interessenskonflikte<br />
dürfen auf keinen Fall auftreten und<br />
sind wo möglich bereits bei der Errichtung<br />
der Internen Revision zu beseitigen,<br />
weil sonst die Wirksamkeit der<br />
Stelle nicht garantiert werden kann<br />
oder sie bereits zu Beginn zum Scheitern<br />
verurteilt ist. So ist eine Unterstellung<br />
unter den Finanzchef verboten.<br />
Allenfalls kann sie dem Präsidenten<br />
oder dem Delegierten des Verwaltungsrates<br />
oder der Geschäftsleitung unterstellt<br />
werden. Zu den leitenden Organen<br />
der Gesellschaft sollte ein möglichst<br />
kurzer Dienstweg führen. Damit<br />
Interessenskonflikte bereits zu Beginn<br />
ausgeschlossen werden, ist es möglich,<br />
eine externe Stelle für die Aufgabe der<br />
internen Revision vorzusehen. Diverse<br />
Revisionsgesellschaften können das<br />
Unternehmen bei der Einführung einer<br />
internen Revisionsstelle unterstützen.<br />
Die Interne Revision sollte so aufgebaut<br />
sein, dass sie dort eingesetzt werden<br />
kann, wo es die Risiken verlangen und<br />
wo der Nutzen am grössten ist. In einem<br />
16 Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
ersten Schritt sind das bestehende Risikomanagement<br />
und die Qualität des<br />
risikoorientierten Controllings zu beurteilen.<br />
Dazu gehören die bereits vorhandenen<br />
Hilfsmittel wie beispielsweise<br />
der Risiko- und Sicherheitsbericht. Im<br />
Rahmen einer ersten noch nicht detaillierten<br />
Risikoanalyse sind die vorhandenen<br />
Unterlagen und Konzepte zu bewerten.<br />
Dazu muss eine «Auslegeordnung»<br />
erstellt werden. Nach Beurteilung<br />
der vorhandenen Instrumente und<br />
nach der ersten Risikoanalyse können<br />
die Prüfungsgebiete der Internen Revision<br />
festgelegt und in eine strategische<br />
Prüfungsplanung integriert werden.<br />
Die Anforderungen und Zuverlässigkeiten<br />
an die Personen, die mit der Internen<br />
Revision betraut sind, sollten hoch<br />
angesiedelt sein. Neben der Rechtschaffenheit<br />
und Objektivität müssen<br />
Vertraulichkeit und Fachkompetenz im<br />
Vordergrund stehen. Die Rechtschaffenheit<br />
von internen Revisoren begründet<br />
Vertrauen und schafft damit die<br />
Grundlage für die Zuverlässigkeit ihres<br />
Urteils. Sie dürfen auf keinen Fall an<br />
Aktivitäten beteiligt sein oder Beziehungen<br />
unterhalten, die ihr unparteiisches<br />
Urteil beeinträchtigen könnten.<br />
Jeder Anschein in diese Richtung ist zu<br />
vermeiden. Interne Revisoren beurteilen<br />
alle relevanten Umstände ausgewogen<br />
und lassen sich in ihrem Urteil nicht<br />
durch eigene oder fremde Interessen<br />
beeinflussen. Mit den Informationen,<br />
die sie im Verlauf ihrer Tätigkeit erhalten,<br />
haben sie umsichtig und interessenswahrend<br />
umzugehen. Informationen<br />
dürfen ohne entsprechende Befugnis<br />
nicht offen gelegt werden, es sei<br />
denn, es bestehen dazu rechtliche oder<br />
berufliche Verpflichtungen. Interne Revisoren<br />
setzen das für die Durchführung<br />
ihrer Arbeit erforderliche Wissen und<br />
Können sowie die entsprechende Erfahrung<br />
ein – ihre Fachkenntnisse, die<br />
Effektivität und Qualität ihrer Arbeit<br />
müssen ständig verbessert und zusätzlich<br />
gefördert werden.<br />
Die Aufgaben der internen Revision<br />
können in Financial Auditing, Operational<br />
Auditing und Management Auditing<br />
gegliedert werden. Der Umfang<br />
der Aufgaben ist abhängig von der<br />
fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter.<br />
Unter Financial Auditing werden Ergebnisprüfungen<br />
verstanden. Diese Prüfungshandlungen<br />
beinhalten Informa-<br />
1·04<br />
Porträt des Autoren Christian Feller auf Seite 22
Die neuesten Erfolgsrezepte<br />
Ueli Aeschbacher, weshalb sollte<br />
man im Mai an den 3. Schweizer<br />
Controller-Tag reisen?<br />
Weil man kaum je einfacher und günstiger<br />
so viele bewährte Erfolgsrezepte<br />
erhält.<br />
In welchen Fachbereichen nützen einem<br />
die etwas?<br />
Persönlichen Gewinn aus dem Seminar<br />
ziehen werden Fachleute im Finanzund<br />
Rechnungswesen sowie Experten<br />
in Rechnungslegung und Controlling –<br />
und damit auch alle Verantwortlichen<br />
auf Geschäftsleitungsebene in Klein-,<br />
Mittel und Grossbetrieben.<br />
Was unterscheidet den Controller-Tag<br />
von anderen, von ähnlichen Veranstaltungen?<br />
Man kommt heute an den Controller-<br />
Tag, und morgen kann man schon den<br />
eigenen Betrieb auf den Kopf stellen.<br />
Oder etwas bescheidener ausgedrückt:<br />
3. Schweizer Controller-Tag: 27. Mai<br />
2004 im Kongresshaus Zürich. Anmeldung:<br />
Telefon 043 211 51 90 oder<br />
www.controller-akademie.ch.<br />
tionen, die im direkten Zusammenhang<br />
mit dem Rechnungswesen stehen. Es<br />
geht hierbei nicht um die Prüfung der<br />
Jahresrechnung, sondern um Prüfungen<br />
der Organisation und der Verfahren<br />
des Rechnungswesens. Daraus ist auch<br />
ersichtlich, dass es sich beim Financial<br />
Auditing um eine vergangenheitsorientierte<br />
Prüfung handelt.<br />
Das Operational Auditing sieht die Verfahrens-<br />
und Systemprüfungen vor.<br />
Diese Prüfungshandlungen verfolgen<br />
das Ziel, die betriebliche Organisation<br />
und Tätigkeit systematisch zu beurteilen.<br />
Die systematischen Aufnahmen<br />
sind zwar auch vergangenheitsorientiert,<br />
doch sollten hier Schwachstellen<br />
der Organisation minimiert und Res-<br />
Wir legen Wert darauf, dass man neue<br />
Erkenntnisse in einer Form erhält, in der<br />
man sie sofort mit Nutzen umsetzen<br />
kann. Was unsere Referenten vortragen,<br />
ist direkt aus der Praxis, hat sich<br />
bewährt und ist so ausgewählt, dass es<br />
sich nicht nur in einer engen Nische<br />
anwenden lässt. Zudem versteht man<br />
unsere Referenten auch ohne Spezialkenntnisse.<br />
Das ist aber nicht alles Verlockende.<br />
Was kommt denn noch hinzu?<br />
Nicht genug betonen kann man das<br />
Networking, den grossen Kontaktwert<br />
des Controller-Tages. Er hat sich etabliert<br />
als der jährliche Treffpunkt in diesem<br />
Fachbereich. Mit Recht, wenn man<br />
die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
und der Referenten liest.<br />
Wer referiert?<br />
Fachleute aus Praxis und Forschung, die<br />
etwas zu sagen haben: im Besonderen<br />
praxisverbundene Professoren aus dem<br />
In- und Ausland und «Top-Shots» aus<br />
dem Finanz- und Rechnungswesen erfolgreicher<br />
Unternehmen.<br />
Alle bringen interessante Lösungen für<br />
Probleme aus allen Branchen. n<br />
sourcen und Prozesse optimal für die<br />
Zukunft eingesetzt werden.<br />
Beim Management Auditing möchte<br />
man die Entscheide des Managements<br />
auf ihre Wirksamkeit überprüfen. Es<br />
beurteilt, wie Führungskräfte ihren unternehmerischen<br />
Handlungsspielraum<br />
nutzen und wie sie für ihre Entscheidungsfindung<br />
Führungs- und Informationsinstrumente<br />
gestalten und einsetzen.<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden,<br />
dass die Errichtung einer Internen<br />
Revisionsstelle mit viel Aufwand verbunden<br />
ist, aber zu einer «Win-Win-<br />
Situation» führt. Der Nutzen kann gross<br />
sein: Funktionierende interne Kontrol-<br />
Ueli Aeschbacher, lic.oec.publ., Geschäftsleiter<br />
der Controller Akademie<br />
und Organisator des 3. Schweizer Controller-Tages<br />
len können Fehler und Unregelmässigkeiten<br />
verhindern. Die Optimierung der<br />
Geschäftsprozesse, die Minimierung<br />
der Schwachstellen und die Schaffung<br />
von Mehrwert stehen im Zentrum. Bessere<br />
Kreditkonditionen sind allenfalls<br />
ein positiver Nebeneffekt.<br />
Besteht in der Gesellschaft keine rechtliche<br />
Verpflichtung zur Errichtung einer<br />
Internen Revisionsstelle, sollten insbesondere<br />
die Sicherung der Unternehmensexistenz<br />
und die Unabhängigkeit<br />
der Revisionsstelle ein ausreichender<br />
Anreiz für deren Einführung sein: Konstruktive<br />
Verbesserungsvorschläge<br />
stützen die Zusammenarbeit mit der<br />
Geschäftsleitung und schaffen ein positives<br />
Kontrollumfeld. n<br />
1·04 Rechnungswesen<br />
17<br />
&Controlling
Würden Sie noch bestehen?<br />
In unserer Serie «Würden Sie noch<br />
bestehen?» präsentieren wir Ihnen<br />
die Aufgabe «Mehrwertsteuer, Eidg.<br />
Stempelabgaben und Verrechnungssteuer»<br />
aus den eidgenössischen Berufsprüfungen<br />
2003 für Fachleute im<br />
Finanz- und Rechnungswesen.<br />
1. Aufgabe<br />
Der steuerpflichtige Briefmarkenhändler<br />
Hans Muster, Morgartenstrasse 60,<br />
Zug, erwarb am 15.3.2002 von Felix<br />
Geiger, Rütlistrasse 47, Luzern (Nichtsteuerpflichtiger)<br />
drei alte Briefmarken<br />
(Alt-Schweiz aus den Jahren 1950 und<br />
früher) für CHF 50 000.–:<br />
Basler Taube, Los-Nr. 128/01/2002<br />
Zürich 4, Los-Nr. 128/02/2002<br />
Waadt 4, Los-Nr. 128/03/2002<br />
Diese Briefmarken veräusserte er wie<br />
folgt an nichtsteuerpflichtige Personen:<br />
Los-Nr. 128/02/2002 am 25.05.2002<br />
an Hans Nüssli, Rigistr. 10, Schwyz<br />
CHF 34 000<br />
Los-Nr. 128/01/2002 am 30.07.2002<br />
an Fritz John, Bergstr. 30, Weggis<br />
CHF 17 000<br />
Los-Nr. 128/03/2002 am 30.10.2002<br />
an Franz Bünzli, Seestr. 60, Zürich<br />
CHF 22 000<br />
Berechnen Sie bei jedem einzelnen Verkauf<br />
die von Hans Muster geschuldete<br />
Steuer, wenn er die für ihn steuerlich<br />
optimalste Vorgehensweise wählt.<br />
2. Aufgabe<br />
Bestimmen Sie für die nachfolgenden<br />
Leistungen den massgebenden Steuersatz.<br />
Gelangt weder der Steuersatz von<br />
7,6 % noch von 2,4 % zur Anwendung,<br />
ist eine Begründung zwingend<br />
erforderlich.<br />
Hinweise: Bei den Leistungserbringern<br />
handelt es sich ausschliesslich um steuerpflichtige<br />
Unternehmen mit Sitz im<br />
Inland.<br />
Sofern nichts anderes vermerkt ist,<br />
werden die Leistungen an Abnehmer<br />
mit Sitz im Inland erbracht, und bei der<br />
Lieferung von Gegenständen befindet<br />
sich der Ort der Lieferung im Inland.<br />
1 Abonnementsgebühr für eine<br />
Schweizer Tageszeitung<br />
2 Inserat in einer Schweizer Tageszeitung<br />
für die Suche eines Finanzchefs<br />
3 Inserat in einer Schweizer Zeitschrift<br />
für ein französisches Hotel (Rechnungsstellung<br />
an das Hotel mit Sitz in<br />
Frankreich)<br />
4 Ernten von Getreide für einen<br />
Landwirt<br />
5 Ein Personalverleihunternehmen<br />
stellt der Maschinenbau GmbH mit<br />
Sitz in Deutschland für die Montage<br />
einer Produktionsanlage in Basel<br />
Personal zur Verfügung<br />
6 Scheren eines Hundes durch einen<br />
Hundesalon<br />
7 Behandlung eines Pferdes durch<br />
einen Tierarzt<br />
8 Verkauf von Wertpapieren (Aktien)<br />
9 Verkauf des Buches «Hannibal» von<br />
Thomas Harris (Umfang 500 Sei-ten)<br />
10 Druck von Broschüren (Bedienungsanleitungen<br />
für eine Produktionsmaschine,<br />
Umfang 17 Seiten)<br />
11 Beförderung einer Maschine mit<br />
einem Lastwagen im Auftrage des<br />
deutschen Lieferanten von Düsseldorf<br />
(D) zum Abnehmer in Lausanne (CH);<br />
Rechnungsstellung an den Lieferanten<br />
in Deutschland<br />
12 Eintritt für ein Fussball-Länderspiel<br />
in Genf<br />
3. Aufgabe<br />
Der steuerpflichtige Bauunternehmer<br />
Sergio Gregori (Einzelfirma) in Lugano,<br />
der die Abrechnung nach der effektiven<br />
Methode vornimmt, erstellte im<br />
Jahr 2002 für seine Familie ein Einfamilienhaus<br />
in Lugano.<br />
Beurteilen Sie die nachfolgenden Sachverhalte<br />
in steuerlicher Hinsicht, und<br />
berechnen Sie die allfällig abziehbare<br />
Vorsteuer beziehungsweise geschuldete<br />
Steuer. Sofern die Leistungen von<br />
Steuerpflichtigen bezogen wurden, erfüllen<br />
die Rechnungen die formellen<br />
Anforderungen. Begründen Sie Ihre<br />
Antworten.<br />
1.Die gesamten Planungsarbeiten erfolgten<br />
durch den befreundeten<br />
Architekten Mazzola in Como (Italien):<br />
Rechnung vom 30. Juni 2002: CHF<br />
50 000.–<br />
18 Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
2.Von Drittunternehmen bezogene<br />
Leistungen:<br />
2.1 Sanitär-, Schreinerarbeiten usw.<br />
von steuerpflichtigen Unternehmen<br />
mit Sitz im Inland (inkl. MWST)<br />
CHF 170 000<br />
2.2 Malerarbeiten von einer nichtsteuerpflichtigen<br />
Unternehmung mit<br />
Sitz im Inland CHF 30 000<br />
2.3 Plattenbelagsarbeiten durch ein<br />
Unternehmen mit Sitz in Italien,<br />
das in der Schweiz nicht steuerpflichtig<br />
ist CHF 25 000<br />
3. Der Einstandspreis des Baumaterials<br />
im Zusammenhang mit der Ausführung<br />
der eigenen Bauarbeiten, welches von<br />
steuerpflichtigen Unternehmen bezogenen<br />
wurde, betrug CHF 84 000 (inkl.<br />
MWST). Der Preis der eigenen Baumeisterarbeiten<br />
(inkl. Material, Löhne und<br />
Gemeinkosten- und Gewinnkostenzuschlag)<br />
würden bei der Ausführung für<br />
einen unabhängigen Dritten CHF<br />
250 000 (exkl. MWST) betragen; die<br />
Architekturleistungen von Mazzola in<br />
Como (I) sind darin nicht enthalten.<br />
4. Aufgabe<br />
Frau Meier-Lee lebt mit ihrem Ehemann<br />
in Zürich; Frau Meier-Lee ist gebürtige<br />
Chinesin und verfügt über Hochschulabschlüsse<br />
in englischer und deutscher<br />
Sprache. Neben ihrer Tätigkeit als Hausfrau<br />
hat sie bis Ende des Jahres 2000 für<br />
das Unternehmen des Ehemannes gelegentlich<br />
Übersetzungsarbeiten von der<br />
deutschen in die chinesische Sprache<br />
ausgeführt. Seitdem ihre Kinder erwachsen<br />
sind, führt Frau Meier-Lee<br />
auch für Dritte Übersetzungsarbeiten<br />
aus. Zudem ist sie gelegentlich als<br />
selbstständige Referentin (Sprachlehrerin)<br />
tätig. Sie gründete daher auf den<br />
1.1.2001 die Lee GmbH, Übersetzungen,<br />
Zürich.<br />
Die Lee GmbH erzielte folgende Einnahmen:<br />
Honorar für die Referententätigkeit von<br />
Frau Meier-Lee an der Privatschule X<br />
(AHV wird durch die Lee GmbH<br />
abgerechnet)<br />
2001: 12 000<br />
2002: 6 000<br />
2003: 0<br />
Übersetzungsarbeiten für Unternehmen<br />
mit Sitz in der Schweiz<br />
2001: 38 000<br />
1·04
2002: 40 000<br />
2003: 80 000<br />
Übersetzungsarbeiten für Unternehmen<br />
mit Sitz in Liechtenstein<br />
2001: 4 000<br />
2002: 21 000<br />
2003: 24 000<br />
Übersetzungsarbeiten für Unternehmen<br />
mit Sitz im Ausland<br />
2001: 6 000<br />
2002: 34 000<br />
2003: 52 000<br />
Für die Abklärung der Steuerpflicht ist<br />
die abziehbare Vorsteuer (für Materialaufwand/Dienstleistungen<br />
sowie Investitionen<br />
und übrigem Betriebsaufwand)<br />
annäherungsweise mit 1 % des massgeblichen<br />
Umsatzes zu berechnen!<br />
Bestimmen Sie, auf welchen Zeitpunkt<br />
allenfalls die Lee GmbH obligatorisch<br />
steuerpflichtig wird. Falls Umsätze für<br />
die Bestimmung der obligatorischen<br />
Steuerpflicht nicht zu berücksichtigen<br />
sind, ist dies zu begründen.<br />
5. Aufgabe<br />
5.1 Berechnen Sie für die nachfolgenden<br />
Geschäftsfälle die von der steuerpflichtigen<br />
Anwaltskanzlei Trepp geschuldete<br />
Umsatzsteuer. Die Anwaltskanzlei<br />
Trepp erstellt die Abrechnung<br />
nach der effektiven Methode und<br />
nach vereinbarten Entgelten. Falls Leistungen<br />
der Steuer nicht unterliegen, ist<br />
dies zu begründen.<br />
Die Anwaltskanzlei Trepp in Zürich stellt<br />
im Monat Oktober 2002 folgende Leistungen,<br />
welche im Monat September<br />
2002 erbracht wurden, in Rechnung<br />
(die Beträge verstehen sich inkl. allfällige<br />
MWST):<br />
a) Der Novchem AG, chem. Produkte,<br />
Grenzweg 10, Basel:<br />
Honorare für unsere anwaltschaftlichen<br />
Bemühungen im Zusammenhang<br />
mit der Zulassung des neuen Medikaments<br />
«Blocklan» in den USA:<br />
CHF 20 000.–<br />
Ersatz der Auslagen gemäss Vereinbarung:<br />
Flug First-Class Zürich – New York<br />
– Zürich: CHF 9600.–<br />
Helikoptertaxi in New York:<br />
CHF 900.–<br />
Übernachtungen im Hotel Mariott,<br />
New York: CHF 2400.–<br />
Verpflegungskosten in New York:<br />
CHF 1600.–<br />
Total CHF 34 500.–<br />
b) Der Demag AG, Maschinenfabrik,<br />
Fürstengasse 10, Köln (Deutschland):<br />
Honorar für unsere anwaltschaftlichen<br />
Bemühungen im Rechtsstreit gegen U.<br />
P. vor dem kantonalen Obergericht in<br />
Genf: CHF 15 000.–<br />
Auslagenersatz:<br />
In Ihrem Namen und für Ihre Rechnung<br />
bezahlte Gerichtsgebühr:<br />
CHF 2000.–<br />
Flug First-Class Zürich –<br />
Genf – Zürich: CHF 600.–<br />
1 Übernachtung im Hotel Beau-Rivage<br />
in Genf (exkl. Frühstück): CHF 450.–<br />
1 Frühstück im Hotel Beau-Rivage in<br />
Genf: CHF 30.–<br />
Übrige Verpflegungskosten<br />
in Genf: 400.–<br />
Total: CHF 18 480.–<br />
5.2 Die unter dem Bst. b bezogenen<br />
Leistungen (Auslagenersatz) wurden<br />
ohne Zuschlag weiterfakturiert, aber<br />
inkl. der allfällig beim Einkauf bezahlten<br />
MWST.<br />
Berechnen Sie für die Anwaltskanzlei<br />
den korrekten Vorsteuerabzug auf den<br />
Leistungsbezügen (Auslagenersatz) gemäss<br />
Bst. b. Sofern kein oder nur ein<br />
teilweiser Vorsteuerabzug möglich ist,<br />
ist eine Begründung erforderlich.<br />
Hinweis: Leistungen wurden, sofern<br />
steuerbar, von steuerpflichtigen Unternehmen<br />
bezogen, und die Rechnungen<br />
entsprechen den formellen Anforderungen<br />
der Rechnungsstellung.<br />
6. Aufgabe<br />
6.1 Im Hinblick auf die geplante Fusion<br />
mit der Alpha-Technik AG haben die<br />
sieben Aktionäre der Alpha AG anlässlich<br />
der ausserordentlichen Generalversammlung<br />
vom 5. April 2001 beschlossen,<br />
das Aktienkapital um CHF<br />
300 000 von CHF 500 000 auf CHF<br />
800 000 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung<br />
erfolgt zu Lasten der Reserven der<br />
Alpha AG. Die Bilanzposten der Alpha<br />
AG vor und nach der Kapitalerhöhung<br />
sehen wie folgt aus:<br />
Und die Lösung?<br />
Bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe<br />
von «Rechnungswesen & Controlling»<br />
Ende Juni 2004 ist die Lösung<br />
dieser Aufgabe kostenlos erhältlich im<br />
«Download»-Bereich von www.veb.ch.<br />
Alpha AG – vor Kapitalerhöhung:<br />
Umlaufsvermögen 850 000<br />
Anlagevermögen 1 350 000<br />
Fremdkapital 710 000<br />
Aktienkapital 500 000<br />
Reserven<br />
und Gewinnvortrag 990 000<br />
Alpha AG – nach Kapitalerhöhung:<br />
Umlaufsvermögen 850 000<br />
Anlagevermögen 1 350 000<br />
Fremdkapital 710 000<br />
Aktienkapital 800 000<br />
Reserven<br />
und Gewinnvortrag 690 000<br />
Welche Folgen löst dieser Vorgang für<br />
die Emissionsabgabe und die Verrechnungssteuer<br />
aus? Geben Sie die entsprechenden<br />
Gesetzesartikel an. Allfällige<br />
Steuern sind zu berechnen.<br />
6.2 Kurz danach beschliessen die Aktionäre<br />
der Alpha AG und der Alpha-<br />
Technik AG die Fusion der beiden Gesellschaften.<br />
Zu diesem Zweck erhöht<br />
die Alpha AG im Mai 2001 ihr Aktienkapital<br />
um CHF 800 000 auf CHF<br />
1 600 000 durch Ausgabe von 800<br />
Aktien zum Nominalwert von<br />
CHF 1000. Das Bezugsrecht für die bisherigen<br />
Aktionäre wird ausgeschlossen.<br />
Die Kapitalerhöhung wird mittels Übernahme<br />
der Aktiven und Passiven der<br />
Alpha-Technik AG zu Buchwerten liberiert.<br />
Die neuen Aktien der Alpha AG<br />
werden den Aktionären der Alpha-<br />
Technik AG im Tauschverhältnis 1:1 abgegeben.<br />
Das Aktienkapital der Alpha-Technik<br />
AG betrug CHF 800 000. Aufgrund einer<br />
Expertise wird der Verkehrswert auf<br />
CHF 2 000 000 geschätzt. Die Alpha-<br />
Technik AG wird im Anschluss an die<br />
Fusion im Handelsregister gelöscht.<br />
Welche Folgen löst diese Transaktion<br />
für die Emissionsabgabe und die Verrechnungssteuer<br />
aus? n<br />
1·04 Rechnungswesen<br />
19<br />
&Controlling
Kontakte knüpfen, pflegen, nutzen: «netzwerk veb.ch»<br />
In der Vergangenheit haben die Mitglieder<br />
des veb.ch und seiner Regionalgruppen<br />
oft angenommen,<br />
veb.ch und die Regionalgruppen seien<br />
ein und dasselbe. Somit hat man sich<br />
entweder bei einer veb.regionalgruppe<br />
oder beim veb.ch als Mitglied registrieren<br />
lassen – oder bei der Regionalgruppe<br />
und beim schweizerischen Verband.<br />
An der Generalversammlung 2003 ist<br />
nun einstimmig beschlossen worden,<br />
dass ab 2004 jedes veb.ch-Mitglied einer<br />
veb.regionalgruppe und dem<br />
veb.ch angehört.<br />
Seit Beginn dieses Jahres arbeitet der<br />
führende und grösste Schweizer Verband<br />
für Rechnungslegung, Controlling<br />
und Rechnungswesen in der<br />
Planung und Durchführung seiner Veranstaltungen<br />
noch enger mit seinen<br />
Regionalgruppen zusammen.<br />
Veranstaltungen von<br />
«netzwerk veb.ch»<br />
n veb.ch zentralschweiz:<br />
Montag, 26. April 2004<br />
n veb.ch espace mittelland:<br />
Dienstag, 27. April 2004<br />
n veb.ch zürich: Montag,<br />
3. Mai 2004<br />
n veb.ch ostschweiz: Dienstag,<br />
4. Mai 2004<br />
n veb.ch nordwestschweiz:<br />
Mittwoch, 5. Mai 2004<br />
Die Veranstaltungen beginnen jeweils<br />
um 18.00 Uhr; Mitglieder werden<br />
persönlich eingeladen.<br />
Das hat für die Mitglieder wesentliche<br />
Vorteile, und der veb.ch verspricht sich<br />
viel davon: Den Mitgliedern wird inskünftig<br />
in ihrer Region mit den «netzwerk-veb.ch-Veranstaltungen»<br />
eine<br />
Plattform geboten, auf der man sich<br />
trifft und fachsimpelt. Daneben kann<br />
man Beziehungen knüpfen, die im beruflichen<br />
Alltag nützlich sind. Besonders<br />
auch die jüngeren, am Beginn ihres<br />
Berufslebens stehenden Mitglieder sollen<br />
mit dem netzwerk.ch angesprochen<br />
werden. Die Idee stammt von veb.ch-<br />
Präsident Herbert Mattle, der sich mit<br />
dem veb.ch-Netzwerk am «networking»<br />
der Banken orientiert hat. Zusammen<br />
mit den Präsidenten der Regionalgruppen<br />
ist die Idee ausgearbeitet worden<br />
Mit «netzwerk veb.ch» kommt den<br />
Regionalgruppen eine noch wichtigere<br />
Rolle zu: Sie bilden, neben ihren gesellschaftlichen<br />
Aufgaben, für die Mitglieder<br />
einen wichtigen fachlichen Treffpunkt<br />
in der Region – für die Kontaktund<br />
Beziehungspflege und für den gesellschaftlichen<br />
und fachlichen Erfahrungsaustausch<br />
auf hohem Niveau.<br />
Netzwerk-Themen von nationaler Bedeutung<br />
werden vom veb.ch angeboten.<br />
Kantonale oder regionale Themen,<br />
vor allem im Bereich Steuern, werden<br />
weiterhin von den Regionen angeboten.<br />
Zudem organisieren die Regionalgruppen<br />
die gesellschaftlichen Anlässe.<br />
Der Eintritt in die Netzwerk-Veranstaltungen<br />
ist kostenlos – Teilnehmer müssen<br />
Mitglied des veb.ch sein.<br />
20 Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
Vier Mal jährlich werden in allen fünf<br />
veb.regionalgruppen dieselben netzwerk-veb.ch-Veranstaltungenangeboten<br />
– und zwar immer nach dem Feierabend.<br />
Eine Ausnahme sind die Steuerveranstaltungen,<br />
die kantonalen Bedürfnissen<br />
entsprechen müssen. Ein<br />
netzwerk.ch-Referat dauert eine Stunde,<br />
und der Referent ist auch beim<br />
anschliessenden Apéro anwesend.<br />
Interessante Themen sind geplant: Der<br />
erste Abend im Frühling 2004 dreht sich<br />
um Gehälter und Personalfragen; im<br />
Herbst 2004 wird «netzwerk veb.ch»<br />
zum Thema Swiss GAAP FER stattfinden.<br />
n<br />
Was ist Networking?<br />
Der Begriff Networking bedeutet im<br />
deutschen Sprachgebrauch «Beziehungen<br />
pflegen, soziale Kontakte unter<br />
Gleichgesinnten herstellen, die einem<br />
bestimmten Zweck dienen; Zusammenarbeit<br />
und Austausch von Informationen<br />
und gegenseitige Unterstützung<br />
beim Lösen von Problemen.»<br />
Networking ist sinnvoll, wenn statt einer<br />
starren Hierarchie gleich starke Partner<br />
gefragt sind. Ein gutes Netzwerk<br />
belebt, regt an, gleicht aus, rät, hilft<br />
weiter – und ist keine Belastung.<br />
In diesem Sinn bietet der veb.ch zusammen<br />
mit den veb.regionalgruppen exklusiv<br />
für seine Mitglieder ein attraktives<br />
netzwerk-veb.ch-Programm an.<br />
Members only. Lassen Sie sich die vielen Vorteile nicht entgehen,<br />
die Sie als Inhaber des Fachausweises im<br />
Finanz- und Rechnungswesen und als diplomierter<br />
Experte in Rechnungslegung und<br />
Controlling haben – wenn Sie veb.ch-Mitglied<br />
sind.<br />
veb.ch<br />
Informationen und Anmeldungen:<br />
veb.ch · Hans-Huber-Strasse 4<br />
Postfach 687 · 8027 Zürich<br />
Telefon 01 283 45 37 · Fax 01 283 45 50<br />
www.veb.ch · info@veb.ch<br />
1·04
Entlöhnung ist mehr als Geld<br />
Es ist allgemein anerkannt, dass<br />
auch die beste Entlöhnung, besonders<br />
die reine Bezahlung, das<br />
positive Arbeitsumfeld nicht ersetzen<br />
kann: Vertrauen, eine Arbeit mit Inhalt<br />
und die Freude daran werden oft gleich<br />
oder gar höher gewichtet als Geld.<br />
Trotzdem ist die Entlöhnung ein sichtbares<br />
und direktes Mittel der Motivation.<br />
Die richtige Entlöhnung zieht die<br />
Mitarbeiter an, die das Unternehmen<br />
weiter bringen, sie schafft Bindung und<br />
fördert die Unternehmensentwicklung.<br />
Manche sehen in der Entlöhnung nur die<br />
Bezahlung. Fachleute betrachten sie in<br />
einem weiteren Rahmen; für sie ist Entlöhnung<br />
«alles, was das Unternehmen<br />
direkt oder indirekt als Gegenleistung für<br />
den Beitrag des Angestellten bieten<br />
kann: einerseits Elemente wie Bezahlung,<br />
materielle Anreize und Vorteile,<br />
andererseits Elemente wie Stolz auf die<br />
Arbeit, Lob, ein gutes soziales Gefüge<br />
und Selbstbestätigung.» Die Entlöhnung<br />
will eine starke Bindung der Angestellten<br />
ans Unter-<br />
nehmen und hohe<br />
Leistungen erreichen,<br />
indem sie<br />
Haltung, Benehmen<br />
und Motivation<br />
beeinflusst. Der<br />
hohen Personalkosten wegen will man<br />
mit Entlöhnungsstrategien einen hohen<br />
Wert aus der «Investition» ins Personal<br />
schöpfen.<br />
Eine – bei weitem nicht vollständige -<br />
Literaturübersicht gibt wertvolle Hinweise,<br />
wie man im eigenen Unternehmen<br />
im Bereiche Entlöhnung etwas<br />
zum Besseren verändern könnte:<br />
n Was Menschen motiviert, sind Anreize.<br />
Eine der wichtigsten unternehmerischen<br />
Aufgaben im Personalwesen<br />
ist es also, Angestellten Anreize zu bieten.<br />
Einer der besten finanziellen Anreize<br />
ist Eigentum. Das lässt sich im Unternehmen<br />
über Teilhaber- oder Partnerschaften<br />
oder mit der Ausgabe von<br />
Aktien umsetzen.<br />
n Ausbildung kann auch als Entlöhnung<br />
eingesetzt werden – mit Vorteil im<br />
Rahmen eines Mehrjahresplanes.<br />
n Regelmässige Lohnerhöhungen in<br />
Ehren – besser jedoch wird die (finanzielle)<br />
Anerkennung aufgenommen,<br />
wenn sie persönliche Erfolge individuell<br />
berücksichtigt.<br />
Entlöhnung ist mehr als Bezahlung. Oft<br />
zeigt sich, dass Angestellte andere Werte<br />
höher gewichten als Geld.<br />
n Entlöhnungsunterschiede in einem<br />
breiten Band innerhalb einer Stellenkategorie<br />
erlauben die Anerkennung von<br />
Erfolgen und Kompetenzen ohne Beförderung,<br />
die oft von beiden Seiten<br />
nicht gewünscht wird.<br />
n Mehr Freizeit, die Möglichkeit, ein<br />
Überstunden- und Überzeitenkonto zu<br />
führen, persönliche Arbeitszeiten, die<br />
den individuellen Bedürfnissen entsprechen,<br />
Dienstleistungen für den Heimbereich,<br />
etwa Reparaturen durch Fachleute<br />
des Unternehmens, firmeneigene Fitnesszentren<br />
oder Kinderhorte sind oft<br />
wirkungsvolle Argumente – ebenso der<br />
öffentliche (!) Dank für gute Dienste.<br />
n Dass ein Unternehmen von seinen<br />
Kunden lebt, kann noch stärker in die<br />
Entlöhnung einbezogen werden: Wer<br />
die Kunden besser zufrieden stellt, wird<br />
besser entlöhnt.<br />
n Das motivierende Entlöhnungssystem<br />
folgt bestimmten formalen Regeln:<br />
1. Der Massstab<br />
wird überall und<br />
immer gleich angelegt,<br />
und die<br />
Angestellten verstehen<br />
ihn. 2. Die<br />
Verantwortlichen<br />
tragen alle sachdienlichen Informationen<br />
zusammen und berücksichtigen<br />
sie bei ihrem Entscheid. 3. Es werden<br />
müssen auch «subjektive» Faktoren<br />
berücksichtigt, die zum Erfolg des<br />
Unternehmens beitragen, etwa die<br />
«soft skills» des Angestellten. 4. Das<br />
Vertrauen in die Beurteiler ist umfassend<br />
und uneingeschränkt. 5. Das Beurteilungssystem<br />
zieht in Betracht, dass<br />
jedes Individuum einzigartig ist. 6. Das<br />
System kann im Personalmarkt ausserhalb<br />
des Unternehmens bestehen.<br />
Die moderne Literatur ist sich einig, dass<br />
die Entlohnung mehr als nur Bezahlung<br />
beinhaltet, und sie beurteilt die folgenden<br />
Charakteristika wirksamer Entlöhnungssysteme<br />
übereinstimmend:<br />
1. Die Entlöhnung muss mit den Unternehmenszielen<br />
und den allgemeinen<br />
Regeln des Personalwesens im Unternehmen<br />
übereinstimmen. Im Falle des<br />
Finanz- und Rechnungswesens kann<br />
das heissen, dass folgendes belohnt<br />
wird: die Zufriedenheit interner Kunden,<br />
die Entwicklung finanzieller und<br />
administrativer Instrumente, die helfen,<br />
die Unternehmensziele zu erreichen,<br />
(34), MScBA, dipl. Betriebswirtschafter<br />
(Universität von Rotterdam) mit Spezialgebiet<br />
Finanzmanagement, certified in Management<br />
of Change and Innovation; Geschäftsleiter<br />
von Contaplus AG, der grössten schweizerischen<br />
Spezialistin für Personalberatung im Finanz- und<br />
Rechnungswesen.<br />
veb.ch und Contaplus sind in einer engen Partnerschaft<br />
verbunden. In wesentlichen Bereichen ihrer<br />
Tätigkeiten treten Contaplus und veb.ch gemeinsam<br />
auf. Contaplus ist vertreten in Bern, Genf,<br />
Lausanne, Luzern, Neuenburg und Zürich-Winterthur,<br />
sowie in Deutschland, Grossbritannien, Italien,<br />
Spanien und Schweden. n<br />
aber auch die individuelle berufliche<br />
Entwicklung.<br />
2. Fast ausnahmslos wird eine flexible<br />
Bezahlung befürwortet, die die Leistung<br />
des Individuums und oft auch die<br />
Leistung des Unternehmens berücksichtigt.<br />
Diskutiert wird jedoch, wie die<br />
Bezahlung von der Leistung abhängig<br />
gemacht werden und welchen Anteil<br />
der flexible Teil des Salärs haben sollte.<br />
3. Das Entlöhnungssystem und damit<br />
das Bewertungssystem muss für beide<br />
Seiten fair sein. Für diese Fairness gibt es<br />
zwei Voraussetzungen: Transparenz<br />
und der Einbezug des Angestellten in<br />
die Definition eines (neuen) Systems.<br />
Modernen Theorien ist weniger am Inhalt<br />
gelegen denn an der Qualität des<br />
Prozesses, mit dem man ein optimales<br />
Entlöhnungssystem erreicht.<br />
4. Durchwegs wird hervorgehoben,<br />
wie wichtig es ist, die Entlöhnung zu<br />
individualisieren. Erst mit ihrer Individualisierung<br />
lässt sich die Entlöhnung<br />
als Motivationsmittel einsetzen, das<br />
den Bedürfnissen des einzelnen Angestellten<br />
entspricht. Obwohl persönliche<br />
Aufmerksamkeit und individuelle Entlöhnungssysteme<br />
in grösseren Unternehmen<br />
sicher schwierigere Disziplinen<br />
sind, besticht dieser Punkt und sollte zu<br />
weiterer Forschung anregen. n<br />
1·04 Rechnungswesen<br />
21<br />
&Controlling
Lehrgang zu Swiss GAAP FER<br />
Im Februar 2004 hat der veb.ch in<br />
Zürich und Bern die Swiss-GAAP-<br />
FER*-Zertifikatslehrgänge 3 und 4<br />
gestartet. Wie bereits die früheren –<br />
inhaltlich identischen – Parallellehrgängen<br />
sind auch diese beiden Kurse bis auf<br />
vereinzelte Plätze in Bern restlos belegt.<br />
Die Teilnehmer der ersten beiden Paral-<br />
Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
Swiss GAAP FER<br />
Fachempfehlungen<br />
Rechnungswesen<br />
lel-Lehrgänge haben vor kurzem die<br />
Zertifikatsprüfungen abgelegt. Über<br />
die Resultate werden wir in der nächsten<br />
Ausgabe von «Rechnungswesen &<br />
Controlling» berichten.<br />
Mit der Zertifikatsprüfung sollen eine<br />
sachliche Ausbildung belegt sowie eine<br />
angemessene berufliche Anerkennung<br />
gewährleistet und geschaffen werden.<br />
Vorgesehen ist, dass die erfolgreichen<br />
Absolventen nicht nur das Zertifikat erhalten,<br />
das vom veb.ch und der Con-<br />
* GAAP: Generally Accepted Accounting<br />
Principles; FER: Fachempfehlungen<br />
zur Rechnungslegung<br />
Statistik<br />
Der Klassiker «Statistik: Instrument der<br />
Betriebsführung»ist wieder erhältlich –<br />
als Original-Nachdruck. Aus dem Inhalt:<br />
Einführung in die Methoden der betriebswirtschaftlichen<br />
Statistik, betriebswirtschaftliche<br />
Statistik als Instrument<br />
der Betriebsführung, Aufgaben<br />
zur betriebswirtschaftlichen Statistik<br />
und Betriebsanalyse, Lösungen. 8. unveränderte<br />
Auflage und 7. unveränderte<br />
Auflage der Lösungen (Originalnachdruck).<br />
Theorie, Aufgaben und Lösungen<br />
in einem Band, 600 Seiten, gebunden,<br />
CHF 98.–. ISBN 3-9522571-0-9.<br />
Erhältlich bei www.verlagskv.ch.<br />
troller Akademie gemeinsam verliehen<br />
wird, sondern dass sie auch auf der<br />
Internetseite des veb.ch und in diversen<br />
Tageszeitungen mit Namen, Vornamen<br />
und Wohnort publiziert werden.<br />
An dieser Stelle sei erwähnt, dass der<br />
veb.ch als grösster Schweizer Verband<br />
für Rechnungslegung, Controlling und<br />
Rechnungswesen in den letzten Wochen<br />
die Schaffung eines Kompetenzzentrums<br />
im Bereich des schweizerischen<br />
Rechnungslegungsstandards<br />
Swiss GAAP FER vorangetrieben hat.<br />
Mit der Schaffung des Kompetenzzentrums<br />
wird das Ziel verfolgt, Klein- und<br />
Mittelunternehmen eine optimale<br />
Plattform für Anliegen und Wünsche im<br />
Bereich dieses Rechnungslegungsstandards<br />
zu bieten.<br />
Das Kompetenzzentrum will im Weiteren<br />
die Bedürfnisse der Mitglieder an<br />
die entsprechenden Fachgremien weiterleiten<br />
und als Kontaktstelle für Fachfragen<br />
in auftreten. Das Internetforum<br />
auf www.veb.ch soll sich zu einer wichtigen<br />
Austauschadresse für Fachfragen<br />
entwickeln. Die geltenden Standards<br />
werden benutzerfreundlich auf dem<br />
Internetportal zusammengefasst, damit<br />
Interessierte einen schnellen Überblick<br />
über Swiss GAAP FER erhalten.<br />
Obwohl ab dem Jahr 2005 an der SWX<br />
der Rechnungslegungsstandard IFRS<br />
(International Financial Reporting Standards)<br />
Pflicht wird, können sich insbe-<br />
22 Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
(25), Buchhalter mit eidg. Fachausweis<br />
und Inhaber des Schweizerischen Informatik-<br />
Zertifikats (SIZ), ist bei BDO Visura in Zürich Oerlikon<br />
in der Wirtschaftsprüfung tätig. «Rechnungswesen<br />
und Controlling» wird in Zukunft regelmässig einen<br />
Beitrag von Christian Feller zu den Fachempfehlungen<br />
Rechnungswesen FER veröffentlichen. Fragen<br />
zum Thema beantwortet der Autor gerne:<br />
christian.feller@veb.ch. n<br />
sondere KMU mit primär nationaler<br />
Ausrichtung mit Swiss GAAP FER ein<br />
geeignetes Mittel verschaffen, um die<br />
Anforderungen an eine einheitliche,<br />
aussagekräftige Jahresrechnung für<br />
den Bilanzleser erfüllt sind. Eine standardisierte<br />
Rechnungslegung bringt<br />
den KMU zahlreiche Vorteile. Immer<br />
mehr Banken und andere Geldgeber<br />
verlangen – auch im Hinblick auf «Basel<br />
II» – einen transparenten Jahresabschluss.<br />
Die Swiss GAAP FER bieten<br />
diesbezüglich eine gute und auch für<br />
KMU einfach umzusetzende Lösung.<br />
Die Chancen, die sich damit bieten,<br />
dürfen nicht unterschätzt werden: Die<br />
aktive Auseinandersetzung mit den eigenen<br />
Stärken und Schwächen führt<br />
zusätzlich zur Sicherung des eigenen<br />
Unternehmens – ein interessanter Zusatzeffekt!<br />
Neue Lehrgänge für<br />
Swiss-GAAP-FER<br />
Bereits im Oktober 2004 werden die<br />
beiden nächsten Swiss-GAAP-FER-Zertifikatslehrgänge<br />
in Zürich beginnen –<br />
mit einer zusätzlichen Präsenzveranstaltung,<br />
was ihre Zahl auf 13 erhöht.<br />
Damit wird garantiert, dass nicht nur<br />
auf die bestehenden 24 Swiss GAAP<br />
FER Standards eingegangen werden<br />
kann, sondern auch auf die Neuerungen.<br />
Die Zahl der Teilnehmer an den<br />
Zertifikatslehrgängen ist beschränkt –<br />
mit Vorteil meldet man sich rasch an,<br />
will man sich einen der begehrten Plätze<br />
sichern (Adresse Seite 28). n<br />
1·04
Qualitätssicherung für Lehrgänge<br />
Die Fernfachhochschule (FFHS)<br />
Schweiz führt seit Januar 2004<br />
zusammen mit dem veb.ch zum<br />
ersten Mal den Nachdiplomkurs «Mehrwertsteuer-Experte/Expertin»<br />
durch.<br />
Während 14 Monaten bilden sich die<br />
Teilnehmer berufsbegleitend auf Hochschulniveau<br />
zum<br />
Mehrwertsteuer-<br />
Experten weiter.<br />
Innerhalb weniger<br />
Tage ist der<br />
Pilotkurs ausgebucht<br />
gewesen. Das zeigt, wie gefragt<br />
gut ausgebildete Mehrwertsteuer-Experten<br />
in allen Wirtschaftsbereichen<br />
sind.<br />
Die Dozenten, die für diesen Nachdiplomkurs<br />
verantwortlich sind, arbeiten<br />
hauptberuflich als Mehrwertsteuer-<br />
Spezialisten in grossen Unternehmen,<br />
in Beratungsfirmen, in der eidgenössischen<br />
Steuerverwaltung (ESTV) oder an<br />
Hochschulen im Ausland.<br />
Das Bundesamt für Berufsbildung und<br />
Technologie (BBT) schreibt für anspruchsvolle<br />
Weiterbildungsangebote<br />
einen hohen Qualitätsstandard vor.<br />
Zwei voneinander unabhängige Expertengruppen<br />
aus Andragogikern – Andragogik<br />
ist die Wissenschaft von der<br />
Erwachsenenbildung – gewährleisten<br />
die Qualitätssicherung dieses Nachdiplomkurses.<br />
Die Gruppen sind zusammengesetzt<br />
aus Ausbildern mit eidgenössischem<br />
Fachausweis und ausgewiesenen<br />
Mehrwertsteuerfach-Experten .<br />
Die Skripte, Übungen und Fälle der<br />
Dozenten werden von den Ausbildern<br />
auf Leserfreundlichkeit, aber auch auf<br />
methodisch-didaktische Anforderungen<br />
überprüft. Die Ausbilder unterstützen<br />
die Dozenten auch bei der Planung<br />
der Präsenzveranstaltungen: Gemeinsam<br />
wird der Aufbau der Lektionen, die<br />
sogenannte Lernchoreographie, besprochen<br />
und geplant. Dabei wird grosser<br />
Wert gelegt auf einen methodisch<br />
sinnvollen Wechsel zwischen Referatsteil,<br />
Projektunterricht, Workshop, Einzel-,<br />
Partner- oder Gruppenarbeiten,<br />
damit die Teilnehmer einen möglichst<br />
hohen Lerneffekt erzielen.<br />
Die Mehrwertsteuerfach-Experten<br />
bringen ihre wertvollen praktischen Erfahrungen<br />
einerseits durch Co-Referate<br />
in den Unterricht ein, andererseits<br />
Straffe Qualitätskontrolle für den Lehrgang<br />
Mehrwertsteuer-Experte der Fernfachhochschule<br />
und des veb.ch<br />
erarbeiten sie anspruchsvolle interdisziplinäre<br />
Fallstudien, die im Präsenzunterricht<br />
bearbeitet werden. Zudem<br />
überprüfen sie die Unterlagen der Dozenten<br />
auf den aktuellen Praxisbezug.<br />
An den Präsenzveranstaltungen werden<br />
die Dozenten sowohl von den Andragogikern<br />
als auch von den Mehrwertsteuerfach-<br />
Experten besucht<br />
und bezüglich<br />
Fach-, Sozial- und<br />
Methodenkompetenz<br />
schriftlich<br />
beurteilt. Die Qualifikationsformulare<br />
werden mit den Dozenten besprochen<br />
und für das BBT aufbewahrt. Zudem<br />
werden die Dozenten von beiden Expertengruppen<br />
im Sinne eines Coachings<br />
für künftige Veranstaltungen unterstützend<br />
gefördert und begleitet.<br />
Dank dem elektronischen Lernmanagementsystem<br />
«LUVIT» können sich die<br />
Studenten im Selbststudium anhand<br />
verschiedener Unterlagen wie Folienskripten,<br />
kleineren Fällen, offenen und<br />
Multiple-choice-Fragen auf den Präsenzunterricht<br />
vorbereiten oder den<br />
Lernstoff repetieren und vertiefen. «LU-<br />
VIT» steht für Lund University Virtual<br />
Information Technology und dient der<br />
Kommunikation einerseits zwischen<br />
Studenten und Dozenten, andererseits<br />
unter den Studenten zwischen den Präsenzunterrichtszeiten.<br />
n<br />
Der veb.ch und die Fernfachhochschule Schweiz<br />
1998 hat der Bundesrat die Errichtung<br />
und Führung der Fernfachhochschule<br />
Schweiz (FFHS) genehmigt.<br />
Die FFHS bietet in der ganzen Schweiz<br />
als eidgenössisch genehmigte und kantonal<br />
anerkannte Teilschule einer Fachhochschule<br />
berufsbegleitend Fachhochschullehrgänge<br />
an, deren Abschlüsse<br />
mit solchen von Vollzeit-Fachhochschulen<br />
gleichwertig sind. Neben<br />
dem Hauptsitz in Brig betreibt sie drei<br />
Regionalzentren in Basel, Bern und Zürich.<br />
Ziel der FFHS ist es, ein nationales Kompetenzzentrum<br />
für Fernunterricht und<br />
E-Learning aufbauen. Die heute schon<br />
bestehende internationale Einbindung<br />
soll ausgebaut werden.<br />
, dipl. Personalleiterin ZGP, Ausbilderin<br />
mit eidg. Fachausweis, Fachbereichsverantwortliche<br />
Arbeit und Laufbahnplanung eines Stellenvermittlungs-Unternehmens,<br />
Lehrgangsleiterin Personalfachausbildung<br />
an einer Kader- und Management-Schule<br />
(Personaladministration, Personalentwicklung,<br />
Betriebspsychologie und Mitarbeiterführung).<br />
n<br />
, (36), dipl. Experte in Rechnungslegung<br />
und Controller, Ausbilder mit eidg.<br />
Fachausweis, Steuerexperte bei der ESTV, Abteilung<br />
Besondere Steueruntersuchungen, Verantwortlicher<br />
Fortbildung im Vorstand des veb.ch und Hauptdozent<br />
für Finanzen bei der Fernfachhochschule<br />
Schweiz. n<br />
Trägerschaft ist der «Verein Fernfachhochschule<br />
Schweiz (VFFHS)», der<br />
1995 von öffentlichen Körperschaften<br />
gegründet worden ist.<br />
Den Nachdiplomkurs «Mehrwertsteuer-Experte/Expertin»<br />
bieten der veb.ch<br />
und die Fernfachhochschule gemeinsam<br />
an.<br />
Informationen über das Angebot der<br />
Fernfachhochschule: www.ffhs.ch.<br />
1·04 Rechnungswesen<br />
23<br />
&Controlling
Die Spannung steigt<br />
In St. Gallen, Delsberg, Neuenburg<br />
und Lugano ist dieses Jahr der mündliche<br />
Teil der Berufsprüfungen für<br />
Fachleute im Finanz- und Rechnungswesen<br />
und der Höheren Fachprüfungen<br />
für Experten in Rechnungslegung<br />
und Controlling abgenommen worden.<br />
Der letzte Prüfungstag in der Deutschschweiz<br />
ist der 20. April. Aus naheliegenden<br />
Gründen werden die schriftli-<br />
Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
Informationen aus dem<br />
Prüfungssekretariat<br />
chen Prüfungen in der ganzen Schweiz<br />
am gleichen Tag abgelegt; bei den<br />
mündlichen gelten diese «Vorsichtsmassnahmen»<br />
nicht.<br />
Jetzt steigt bei den Kandidatinnen und<br />
Kandidaten die Spannung! Am 21.<br />
April werden alle Arbeiten korrigiert<br />
sein. Dann treffen sich die beiden Klausurkommissionen<br />
für die Höhere Fachprüfung<br />
und die Berufsprüfung: Die<br />
Fachverantwortlichen tauschen ihre<br />
Eindrücke aus und berichten, wie die<br />
Prüfungen aus ihrer Sicht verlaufen<br />
sind. Anschliessend werden die Noten<br />
auf Fachebene bereinigt. Auf jeden Fall<br />
beziehungsweise Kandidaten wird dabei<br />
individuell eingegangen. Der Entscheid<br />
«bestanden» oder «nicht bestanden»<br />
wird von der Prüfungskommission<br />
gefällt, die in der Folge tagt.<br />
Alles über die Prüfungen<br />
Das Informationsheft «Fachausweis<br />
und Diplom» des veb.ch gibt einen<br />
umfassenden und detaillierten Einblick<br />
in die beiden Lehrgänge und Prüfungen<br />
und in die Berufsbilder. Es ist bei veb.ch<br />
(Adresse Seite 28) und über die Website<br />
www.veb.ch kostenlos erhältlich.<br />
Ende April erhalten die Kandidaten eine<br />
Kurzmeldung über ihren Erfolg. Wer<br />
nicht bestanden hat, kriegt eine Woche<br />
später eine rekursfähige Verfügung.<br />
Am 4. Juni treffen sich die erfolgreichen<br />
Absolventen im Casino Bern zur traditionellen<br />
Schlussfeier, begleitet von vielen<br />
Familienangehörigen und Freunden,<br />
die in den oft entbehrungsreichen<br />
Jahren der Prüfungsvorbereitung Motivation<br />
gespendet haben.<br />
Dieses Jahr sind die Prüfungen schon<br />
zum zweiten Mal nach dem neuen Reglement<br />
durchgeführt worden. Die letzte<br />
Möglichkeit, sie nach altem Reglement<br />
abzulegen, wird 2005 geboten.<br />
Ein aktueller Überblick des Prüfungssekretariates<br />
zeigt, dass etwa 1100 Kandidatinnen<br />
und Kandidaten aus der<br />
Deutsch- und der Westschweiz sowie<br />
dem Tessin angetreten sind – damit hat<br />
die Zahl vom Vorjahr schon wieder vergrössert<br />
werden können.<br />
Beschwerden<br />
45 Kandidaten der Prüfungen 2003<br />
haben gegen ihre Prüfungsresultate<br />
beim Bundesamt für Berufsbildung und<br />
Technologie BBT Beschwerde eingelegt.<br />
Davon ist rund ein Dutzend geschützt<br />
worden. Die übrigen sind abgewiesen<br />
oder sind noch nicht endgültig<br />
entschieden worden.<br />
Expertentätigkeit beliebt<br />
Die Prüfungen können dank einiger<br />
hundert Prüfungsexperten durchgeführt<br />
werden. Obwohl ihre Aufgabe<br />
sehr anspruchsvoll ist, gelingt es immer<br />
wieder, genügend Experten zu gewinnen.<br />
Allen Prüfungsexperten gilt der<br />
Dank der Absolventen und der Prüfungsträgerschaft!<br />
Die nächsten Daten<br />
Die Prüfungsdaten 2005 sind provisorisch<br />
festgelegt worden:<br />
n Die Berufsprüfungen (Fachausweis)<br />
finden statt vom 30.3.–1.4.2005<br />
(schriftlich) und am 25. und<br />
26.4.2005 (mündlich).<br />
24 Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
veb.ch in der Trägerschaft<br />
Träger der Berufs- und höheren Fachprüfung<br />
(Berufsprüfung für Fachfrau/<br />
Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen<br />
und höhere Fachprüfung für<br />
Expertin/Experte in Rechnungslegung<br />
und Controlling) ist der «Verein für höhere<br />
Prüfungen in Rechnungswesen<br />
und Controlling». Der Verein ist im Handelsregister<br />
eingetragen und hat zwei<br />
Mitglieder: den veb.ch und den KV<br />
Schweiz.<br />
n Die Höheren Fachprüfungen<br />
(Diplom) finden an folgenden Daten<br />
statt: Fallstudie: 3. und 4.3.2005,<br />
Übrige Fächer: 9.3.–11.3.2005,<br />
Mündlicher Teil: Erste Hälfte April<br />
2005.<br />
n Auf den 3.6.2005 wird zur<br />
Schlussfeier ins Casino Bern eingeladen.<br />
n Wer dieses Jahr nach dem neuem<br />
«Reglement 1999» zum ersten Mal<br />
nicht bestanden hat, kann die<br />
Prüfung 2005 nochmals ablegen. Er<br />
lässt sich in allen Fächern prüfen, in<br />
denen er weniger als eine 5 erhalten<br />
hat. n<br />
Beilagen in dieser Ausgabe<br />
Beachten Sie bitte die Beilagen in dieser<br />
Ausgabe von «Rechnungswesen<br />
& Controlling»:<br />
n «Controller-Leitfaden» oder «Jahrbuch<br />
Finanz- und Rechnungswesen»<br />
(in Teilauflagen; Jahrbuch-Rezension<br />
auf Seite 6), WEKA Verlag, Zürich<br />
n «Intensivstudium Mehrwertsteuer»<br />
der Unternehmerforum Schweiz AG,<br />
Zürich<br />
n «Mehrwertsteuer-Workshops<br />
2004», SwissVAT AG, Zürich<br />
n 3. Schweizer Controller-Tag,<br />
Controller Akademie, Zürich<br />
Inserate und Beilagen:<br />
Rechnungswesen & Controlling<br />
verlag@hurter.com · 052 770 20 40<br />
1·04
Schweizer Controllertag: Wo sich Controller treffen<br />
Ein Tag mit unmittelbarem Nutzen!»<br />
So beschreibt Ueli Aeschbacher,<br />
Geschäftsleiter der Controller<br />
Akademie, den 3. Schweizer Controller-<br />
Tag vom 27. Mai 2004 im Kongresshaus<br />
Zürich. Fachleute treffen auf Fachleute:<br />
Anerkannte Experten aus Unternehmensführung,<br />
Finanzmanagement und<br />
Rechnungswesen vermitteln einem engagierten<br />
Publikum neueste Erkenntnisse.<br />
Beachten Sie dazu auch das Interview<br />
auf Seite 17.<br />
Die noch kurze, aber bereits bestens<br />
etablierte Reihe wird nächstes Jahr fortgesetzt:<br />
Der 4. Schweizer Controller-<br />
Tag wird am 26. Mai 2005 in Zürich<br />
stattfinden.<br />
Höhepunkt Prüfung<br />
53 Kandidatinnen und Kandidaten der<br />
Controller Akademie haben sich für die<br />
Höheren Fachprüfungen angemeldet.<br />
Am 22. März haben fast alle Studentinnen<br />
und Studenten an einer Simulation<br />
mündliche Prüfungen unter «Ernstfallbedingungen»<br />
teilgenommen. Dabei<br />
sind, so die Beobachtungen, sehr gute<br />
Leistungen gezeigt und fachliche wie<br />
auch methodische Verbesserungsmöglichkeiten<br />
aufgezeigt worden.<br />
Die Schlussfeier der Controller Akademie<br />
findet am Donnerstag, 13.Mai<br />
2004, um 18.00<br />
Uhr im Dozentenfoyer<br />
der<br />
ETH Zürich statt.<br />
Wer alle Zertifikatsprüfungen<br />
bestanden hat, erhält das Diplom der<br />
Controller Akademie, allen anderen<br />
wird eine Studienbestätigung überreicht.<br />
Peter Vonlanthen, Verwaltungsratspräsident<br />
der Controller Akademie,<br />
hält die Festansprache, und Herbert<br />
Mattle, veb.ch-Präsident, kommentiert<br />
die Prüfungen.<br />
Neues Studienjahr<br />
Innert Kürze etabliert: Schon zum dritten<br />
Mal lädt die Controller Akademie zum<br />
Schweizer Controller-Tag ein.<br />
Das nächste Studienjahr beginnt am 18.<br />
Oktober 2004. Noch sind einige Plätze<br />
frei – erfahrungsgemäss muss aber<br />
schon ab Juni eine Warteliste geführt<br />
werden. Interessenten tun also gut daran,<br />
sich rasch anzumelden. Unter bestimmten<br />
Voraussetzungen ist vor allem<br />
Absolventen von Universitäten und<br />
Fachhochschulen ein Direkteintritt ins<br />
zweite Semester möglich.<br />
Neue Räume<br />
Die Controller Akademie belegt eine<br />
Reihe von Räumen: Die Geschäftsleitung<br />
ist neu an der Hohlstrasse 550 in<br />
8048 Zürich-Altstetten untergebracht<br />
und erreichbar über Telefon 043 211 51<br />
90 sowie Fax 043 211 51 92. Lehrräume<br />
finden sich an der Hohlstrasse 532, 535<br />
und 550 sowie an der Limmatstrasse<br />
310 im Gebäude der KV Zürich Business<br />
School. Für Seminare werden Räume im<br />
Technopark, ArabellaSheraton Hotel Atlantis<br />
und anderen belegt.<br />
Auch im Cyberspace hat sich die Controller<br />
Akademie verändert – mit dem<br />
Startschuss zur neuen Website<br />
www.controlle-akademie.ch, die laufend<br />
ausgebaut und Studenten- wie<br />
auch Dozentenschaft zahlreiche neue<br />
Möglichkeiten bieten wird.<br />
Zertifikatsprüfungen<br />
Eine neue Höchstzahl ist bei den nächsten<br />
Zertifikatsprüfungen zu verzeichnen:<br />
135 von 170 Studentinnen und<br />
Studenten werden daran teilnehmen.<br />
Nach dem ersten Semester werden die<br />
Fächer BWL, Derivate, Finanzierung, Investitionsrechnung,<br />
Mathematik, Unternehmensbewertung<br />
und VWL je 60<br />
Minuten geprüft.<br />
Nach dem dritten<br />
Semester werden die Kenntnisse in den<br />
Fächern Controlling, Kostenrechnung,<br />
Steuern, Kostenrechnungsanwendung<br />
und Prozesskostenrechnung sowie Projekt-<br />
und Informationsmanagement je<br />
90 Minuten getestet. Ueli Aeschbacher<br />
bezeichnet die Zertifikatsprüfungen als<br />
«hart, aber unterlässlich»: An der Controller<br />
Akademie studieren Berufsleute<br />
im Alter zwischen 25 und über 50 Jahren<br />
– die Zertifikatsprüfungen bereiten<br />
die Kandidaten auf einer einheitlichen<br />
Stufe auf die Diplomprüfung vor.<br />
IFRS<br />
Zur Zeit laufen an der Controller Akademie<br />
zwei erfolgreiche Parallel-Lehrgänge<br />
zum «Certified IFRS/IAS Accoun-<br />
tant». Für den 3. und 4. Lehrgang wird<br />
bereits eine Warteliste geführt, weshalb<br />
man einen fünften, parallelen Lehrgang<br />
ins Auge fasst. Erfreulich gut sind die<br />
Bewertungen der Teilnehmer aus dem<br />
ersten und zweiten Lehrgang – so gut,<br />
dass etliche Unternehmen weitere Mitarbeiter<br />
in die IFRS-Ausbildung der Controller<br />
Akademie senden!<br />
Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
Informationen<br />
aus der Controller Akademie<br />
Am 26. Mai 2004 enden der 1. und 2.<br />
Lehrgang mit einem gemeinsamen Tag,<br />
unter anderem mit Prof. Giorgio Behr<br />
von der Universität St. Gallen.<br />
Für die Diplomprüfung ist eine Prüfungskommission<br />
unter der Leitung<br />
von Prof. Dr. Dieter Pfaff von der Universität<br />
Zürich gebildet worden. Einsitz haben<br />
neben Vertretetern aus der Trägerschaft<br />
auch Fachleuten aus der Praxis.<br />
Seminare<br />
Dieses Jahr bietet die Controller Akademie<br />
mehrere Praxis-Seminare zu folgenden<br />
Themenkreisen an:<br />
n Bewertung und Controlling<br />
n Risikomanagement, Kreditrating,<br />
Bonität und Controlling<br />
n Leistungsspektrum und Nutzen von<br />
Rechnunswesen und Controlling<br />
n Controller-Workshop mit Case<br />
Studies<br />
n Lieber Kosten managen als Kosten<br />
verwalten<br />
n Business Intelligence und Controlling<br />
Näheres ist demnächst hier und auf<br />
www.controller-akademie.ch zu<br />
erfahren. n<br />
1·04 Rechnungswesen<br />
25<br />
&Controlling
Burnout: Stress lass nach!<br />
Schnelllebigkeit, hoher Druck und<br />
ständiger Wandel prägen die heu<br />
tige Arbeitswelt. Anpassung an<br />
neue Anforderungen und Flexibilität<br />
sind unerlässlich. Sich diesen Herausforderungen<br />
zu stellen, bedeutet für jeden<br />
Mitarbeiter eine individuelle Auseinandersetzung<br />
mit sich selbst. Nicht jeder<br />
ist dem gewachsen: Zuviel negativer<br />
Stress führt zum Burnout-Syndrom.<br />
Doch das lässt sich vermeiden.<br />
Allgemeine Einflüsse<br />
Die Globalisierung und der Wettbewerb<br />
fordern von den Unternehmen<br />
und ihren Mitarbeitern Flexibilität, Ausdauer<br />
und Belastbarkeit. Veränderungen<br />
sind besonders in Zeiten unbeständiger<br />
Wirtschaftslage an der Tagesordnung.<br />
Stellenabbau, Konkurse, Firmenübernahmen<br />
bedeuten für die Arbeitnehmer<br />
Unsicherheit und somit zusätzlichen<br />
Stress. Obwohl Veränderungen<br />
nötig sind, um den<br />
Durchbruch zu<br />
schaffen und Erfolge<br />
zu erzielen,<br />
sind über 80 %<br />
der Menschen<br />
nicht bereit, sich Neuem zu stellen. In<br />
Anbetracht der vielen Misserfolge, die<br />
durch Veränderungen entstanden sind,<br />
ist dies nicht erstaunlich. Das Umsetzen<br />
von Veränderungen gelingt oft aus folgenden<br />
Gründen nicht:<br />
n Unklare, zuwenig ausgereifte Strategien<br />
n «Ego-Entscheide» im Management<br />
n Zu hohe Konzentration auf das<br />
Leistungsmanagement<br />
n Keine Berücksichtigung verschiedener<br />
Kulturen<br />
n Keine Bereitschaft für Veränderungen<br />
bei den Mitarbeitern<br />
Zahlen und Fakten<br />
In den frühen 70er Jahren hat man<br />
erstmals das Burnout-Syndrom (burn<br />
out, engl. für ausbrennen) festgestellt.<br />
Das Burnout-Syndrom entsteht bei zu<br />
viel negativem Stress, der nicht mehr<br />
selber abgebaut werden kann. Mittlerweile<br />
gehört Stress zu den häufigsten<br />
Krankheitsursachen in den Industriestaaten<br />
– er hat sogar die Grippe vom<br />
ersten Platz verdrängt.<br />
In den USA sind aufgrund von arbeitsbedingtem<br />
Stress in den 80-er Jahren<br />
Kosten von rund 150 Milliarden Dollar<br />
entstanden. Grossbritannien hat<br />
stressbedingte Fehlzeiten von fünf Milliarden<br />
Pfund verzeichnet und<br />
Deutschland solche von 100 Milliarden<br />
Euro. Zudem haben die Deutschen für<br />
entsprechende Medikamente 20 Milliarden<br />
Euro ausgegeben.<br />
Ursachen und Symptome<br />
Diagnose Stress<br />
Angst und Unsicherheit sind gewichtige<br />
Stressfaktoren, die zum Burnout führen<br />
können. Wie lässt sich das vermeiden?<br />
Der Körper reagiert auf gewisse Reize.<br />
Diese können positiv (Eustress) oder<br />
negativ (Disstress) sein. Ausgelöst wird<br />
Stress zum Beispiel durch Überlastung,<br />
innere Unruhe, Über- und Unterforderung.<br />
Doch jeder Mensch reagiert individuell<br />
auf diese Reize, weshalb Stress<br />
individuell interpretiert wird. Der eine<br />
braucht einen gewissen Stress als Motivation,<br />
um besser arbeiten zu können,<br />
der andere wie-<br />
derum arbeitet<br />
effizienter und<br />
effektiver ohne<br />
Druck. Allerdings<br />
benötigen wohl<br />
alle Menschen einen gewissen Adrenalinstoss,<br />
damit sie sich am Morgen erheben...<br />
Oft stehen aber heute Mitarbeiter<br />
unter einem gewissen Dauerstress,<br />
der Symptome wie Kopfschmerzen,<br />
Migräne, Bauchschmerzen, Zuckungen,<br />
Rückenschmerzen, Blähungen,<br />
Allergien, Schwindelgefühle, Depressionen<br />
und mehr hervorrufen kann.<br />
Ernsthaftere Krankheiten wie zum Beispiel<br />
ein Magengeschwür sind erste Anzeichen<br />
für das Burnout-Syndrom. Diverse<br />
Studien belegen zudem, dass zu<br />
viel negativer Stress sogar Krebs, Herzinfarkte<br />
und weitere Krankheiten auslösen<br />
kann.<br />
Ursachen von Burnout<br />
Die Diagnose lautet Burnout, wenn für<br />
den Stressgeplagten kein Stressabbau<br />
mehr möglich ist und wenn folgende<br />
Faktoren Psyche und Körper beeinflussen:<br />
n Lang anhaltender Stress<br />
n Mangel an Kontrolle<br />
n Permanente Arbeitsüberlastung<br />
n Unzureichende Entschädigung<br />
n Keine Wertschätzung<br />
n Ungerechtigkeit, fehlende Fairness<br />
n Mobbing<br />
26 Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
(28) ist Marketinplanerin. Sie arbeitet<br />
auf der Redaktion des «Schweizer Arbeitgebers».<br />
Der vorliegende Artikel beruht auf dem<br />
Seminar «Burnout» von Rolf P. Rado im Rahmen<br />
der VEDIBA-Veranstaltungen. n<br />
n Angst, die Stelle zu verlieren,<br />
Arbeits-losigkeit<br />
n Unzufriedenheit<br />
n Keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten,<br />
Unterforderung<br />
n Wertekonflikt, wenn etwa Mitarbeiter<br />
nicht hinter der Unternehmensphilosophie<br />
stehen können<br />
n Zusammenbruch des Teams<br />
Besonders gefährdet sind Personen aus<br />
Berufsgattungen des sozialen Bereichs<br />
wie (Assistenz)ärzte, Krankenschwestern,<br />
Lehrer und Sozialarbeiter.<br />
Anzeichen eines Burnout<br />
Erste Anzeichen eines Burnout machen<br />
sich auf der Gefühlsebene bemerkbar.<br />
Die Motivation lässt nach, der Mitarbeiter<br />
verbreitet schlechte Laune, ist depressiv<br />
und frustriert, leicht reizbar, ermüdet<br />
schnell, vergisst wichtige Termine<br />
und Gegenstände und zieht sich vor<br />
allem zurück. Der Rückzug findet aber<br />
nicht nur am Arbeitsplatz statt, sondern<br />
betrifft insbesondere auch die Familie<br />
und die Freunde.<br />
Daneben leidet auch die körperliche<br />
Verfassung. Kopfschmerzen und allgemeine<br />
Schmerzen sind oft Begleiter<br />
eines zu «gestressten» Menschen. Bei<br />
diesen Alarmsignalen ist es höchste Zeit<br />
zum Handeln: Hilfe von Fachpersonen<br />
ist notwendig. Ein Burnout-Patient benötigt<br />
zwingend psychologische Be-<br />
1·04<br />
Gekürzte Fassung aus dem «Schweizer Arbeitgeber» Nr. 2/2004
treuung, um wieder «geheilt» zu werden<br />
und nicht zu einem IV-Bezüger zu<br />
werden.<br />
Stressbewältigung<br />
Stressmanagement<br />
Mit Stress umgehen ist ein individueller<br />
Prozess mit sich selbst. Fünf Faktoren<br />
sind als Rahmenbedingung für das<br />
Stressmanagement wichtig:<br />
1. Wahrnehmung<br />
Zuerst muss die «gestresste» Person<br />
überhaupt erkennen, dass sie zu viel<br />
Stress hat. Nimmt sie diesen Zustand<br />
wahr, ist es wichtig herauszufinden, wie<br />
sie in «stressigen» Situationen reagiert.<br />
2. Annahme<br />
In dieser Phase beginnt sich der «gestresste»<br />
Mensch mit der Situation auseinanderzusetzen.<br />
Es ist fundamental<br />
zu wissen, was diese Lage für ihn bedeutet.<br />
3. Abkühlung und Aktivieren (Yin und<br />
Yang)<br />
Ist sich der «Stressgeplagte» seiner Situation<br />
bewusst, soll er sich «im Hier<br />
und Jetzt» bewegen, versuchen den<br />
Körper ins Gleichgewicht zu bringen,<br />
um wieder klar denken zu können.<br />
Abschalten und Energie auftanken sowie<br />
sein persönliches Tempo finden und<br />
die Aufgaben sachlich angehen sind die<br />
nächsten Schritte auf dem Weg zur<br />
Besserung. Sich Mut zusprechen und<br />
VEDIBA, der Verein der Absolventen<br />
AKAD Business, gegründet 1972, ist die<br />
Absolventenvereinigung von AKAD-<br />
Business-Studiengängen. Sie bietet ihren<br />
Mitgliedern Seminare zu aktuellen<br />
Wirtschafts-Themen an. Auch Nichtmitglieder<br />
sind zur Seminarteilnahme<br />
eingeladen. Rechnungswesen & Controlling<br />
informiert regelmässig über VE-<br />
DIBA.<br />
Informationen und Anmeldungen zu<br />
Seminaren: VEDIBA Sekretariat, Yvonne<br />
Casas, Postfach, 8050 Zürich<br />
y.casas@akad.ch, www.akad.ch<br />
Nächste Seminare: IT-Outsourcing für<br />
KMU, 6. April 2004, Referent: Silvio<br />
Vecellio; Mehrwertsteuer, 22. April<br />
2004, Referent: Benno Frei; Personalmanagement,<br />
Mai 2004; FER/IFRS, 17.<br />
Juni 2004, Referent: Daniel Suter; Beschwerdemanagement,<br />
1. Juli 2004,<br />
Referent: Hannes Gerber<br />
auch Teilerfolge als Erfolge ansehen gehören<br />
in diese Phase.<br />
4. Gewohnheiten aufbauen<br />
Wichtig ist die Basis realistischer Ziele,<br />
die erreicht werden können. Anstehende<br />
Aufgaben und Projekte sollen – mit<br />
einem Zeitpuffer – geplant, Entscheidungen<br />
getroffen und Prioritäten entsprechend<br />
gesetzt werden. Hier kann<br />
eine Wichtigkeits- und Dringlichkeitsmatrix<br />
helfen und die Planung und Entscheidung<br />
vereinfachen, kommt es<br />
doch vor allem darauf an «die richtigen<br />
Dinge» zu tun. Zudem sollte sich die<br />
betroffene Person des Pareto-Prinzips<br />
bewusst sein, der 80:20-Regel, die unter<br />
anderem besagt , dass mit etwa<br />
20 % des Aufwandes bereits rund<br />
80 % des Resultats erreicht werden.<br />
Probleme sind Vorboten des Erfolges.<br />
Wer nach den Ursachen der Probleme<br />
sucht, der behält die Probleme. Wer<br />
aber Probleme lösen will, der sucht nach<br />
Lösungen und handelt. Das Problem<br />
muss zuerst definiert und dann analysiert,<br />
schliesslich muss die Lösung gefunden<br />
werden. Danach geht es um die<br />
Umsetzung und letztlich um die Erfolgskontrolle.<br />
5. Einstellung entwickeln<br />
Stress ist völlig von der subjektiven<br />
Wahrnehmung beziehungsweise Einstellung<br />
abhängig. Entscheidungen<br />
sollten wenn möglich rasch erfolgen.<br />
Sie können später immer wieder geändert<br />
werden, denn Unsicherheit gilt als<br />
einer der grössten Stressfaktoren.<br />
Zudem sollte man sich nicht in die «Opferrolle»<br />
begeben – denn eigentlich<br />
müssen wir nichts tun, sondern wir wollen<br />
etwas tun. Sodann sollte man realistische<br />
Erwartungen hegen und auch einmal<br />
Nein sagen können – denn Erwartung<br />
kommt von warten und Enttäuschungen<br />
sind das Ende von Täuschungen<br />
. Weitere wichtige Faktoren sind die<br />
Wertschätzung gegenüber sich selbst,<br />
die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen und<br />
viel Positives zu sehen. Zudem sollte man<br />
sich für das Glück entscheiden.<br />
Stressabbau und -prophylaxe<br />
Es gibt verschiedene Möglichkeiten,<br />
Stress abzubauen. Jeder muss für sich<br />
selbst herausfinden, welche für ihn die<br />
beste ist. Die nachstehende Auflistung<br />
enthält eine Auswahl möglicher Stressabbau-Methoden:<br />
n Massage<br />
n Sport (Ausdauersport, jedoch kein<br />
Leistungssport)<br />
n Entspannungsübungen<br />
n Sekundenschlaf<br />
n Hyperventilieren (sitzend)<br />
n Meditation, autogenes Training,<br />
Yoga<br />
n Mentaltraining<br />
n Musik<br />
n Atemübungen<br />
n Erfüllendes, entspannendes Hobby<br />
betreiben<br />
n Friedliches Umfeld in Familie,<br />
Partnerschaft und Freundeskreis<br />
n Ausreichend Schlaf<br />
n Genügend Wasser trinken<br />
n Über Themen reden, die einen<br />
beschäftigen, sich abgrenzen, Arbeit<br />
delegieren<br />
n Täglich etwas Erfreuliches tun, das<br />
nichts mit der Arbeit zu tun hat<br />
Von Vorteil schreibt man sich auch seine<br />
privaten Termine – zum Beispiel das<br />
Sporttraining – in die Agenda, damit<br />
auch diese eingehalten und nicht immer<br />
wieder «aus beruflichen Gründen»<br />
verschoben werden.<br />
Dem Burnout-Syndrom kann vorgebeugt<br />
werden, indem man sich mit dem<br />
Thema Burnout auseinandersetzt. Ein<br />
Coach kann dabei und bei der Entwicklung<br />
von eigenen Visionen und Werten<br />
helfen. Diese sollten auch gelebt werden.<br />
Das Wissen um die effektiven Kosten<br />
einer Burnout-bedingten Abwesenheit<br />
sowie der Aufbau eines entsprechenden<br />
Umfeldes tragen massgeblich<br />
zur Vorbeugung bei.<br />
Fazit<br />
Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
Informationen aus der<br />
Stress ist aus unserem (Arbeits-)Alltag<br />
kaum mehr wegzudenken. Er aber aber<br />
reguliert und wieder abgebaut werden.<br />
Da jede Person individuell auf die entsprechenden<br />
Reize reagiert, muss jede<br />
selber ergründen, welche Stressabbau-<br />
Methode am besten wirkt. Das Wichtigste<br />
jedoch ist, die eigenen Wünsche<br />
und Ziele zu kennen und danach zu<br />
leben. n<br />
1·04 Rechnungswesen<br />
27<br />
&Controlling
Veranstaltungen und Adressen<br />
veb.ch<br />
Hans-Huber-Strasse 4<br />
Postfach 687, 8027 Zürich<br />
Telefon 01 283 45 37<br />
Fax 01 283 45 50<br />
www.veb.ch, info@veb.ch<br />
SWISCO<br />
Association suisse des comptables/contrôleurs<br />
de gestion diplômés, Suisse romande,<br />
Rue de Neuchâtel 1<br />
1400 Yverdon-les-Bains<br />
Téléphone 024 425 21 72<br />
Fax 024 425 21 71<br />
www.swisco.ch, info@swisco.ch<br />
<strong>VEB</strong>IT<br />
Vereinigung eidg. dipl. Buchhalter/Controller<br />
im Treuhandfach, Industriestrasse<br />
10, 6010 Kriens, vebit@veb.ch<br />
Impressum<br />
«Rechnungswesen und Controlling», Fachinformationen des<br />
Schweizerischen Verbandes der dipl. Experten in Rechnungslegung<br />
und Controlling und der Inhaber des eidg. Fachausweises<br />
im Finanz- und Rechnungswesen veb.ch<br />
ISSN 1660-7899<br />
Erscheint vierteljährlich in einer Auflage von 5500 Exemplaren.<br />
Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2004.<br />
Herausgeber: «Rechnungswesen und Controlling»,<br />
Postfach 687, 8027 Zürich, Telefon 01 283 45 37<br />
Fax 01 283 45 50, info@veb.ch<br />
Redaktion und Inserate:<br />
HURTER · Kommunikation · Publikationen<br />
Schützenhausstrasse 1, 8267 Berlingen<br />
Telefon 052 770 20 40, Fax 052 770 20 41<br />
verlag@hurter.com, www.hurter.com<br />
Redaktionsleitung: Herbert Mattle, Obfelden; Koordination:<br />
Jürg Hurter, Berlingen<br />
Der veb.ch-Vorstand: Herbert Mattle, Obfelden, Präsident, PR<br />
und Sonderaufgaben · Peter Jakob, Kirchberg, Vizepräsident,<br />
Finanzen · Thomas Widmer, Rotkreuz, Vizepräsident, Treuhand,<br />
Sonderaufgaben · George Babounakis, Fortbildung,<br />
Wetzikon · Melitta Bischofberger, Richterswil, Marketing ·<br />
Roland Vannoni, Reinach BL · Thomas Ernst, Pregassona,<br />
Vertreter Tessin · Ivan Progin, Vertreter Westschweiz<br />
veb.ch<br />
Offizelles Organ der<br />
Contaplus AG, die Spezialistin für<br />
Stellen im Finanz- und Rechnungswesen,<br />
ist Partnerin des veb.ch<br />
Der veb.ch ist Partner des<br />
ACF<br />
Ass. dei contabili-controller diplomati<br />
federali – Gruppo della svizzera italiana<br />
Thomas Ernst, Presidente<br />
Lambertini, Ernst & Partners S.A.<br />
via S. Balestra 18, 6900 Lugano<br />
Telefono 091 910 40 40<br />
Fax 091 923 23 23<br />
www.acf.ch, info@acf.ch<br />
Nordwestschweiz<br />
Roland Vannoni<br />
Präsident<br />
Mischelistrasse 37<br />
4153 Reinach<br />
Telefon 061 267 92 68<br />
Fax 061 267 93 92<br />
nordwestschweiz@veb.ch<br />
n Netzwerk-Veranstaltung: 5. Mai 2004<br />
Espace Mittelland<br />
Thomas Zbinden, Präsident<br />
Kirchweg 6a, 3076 Worb<br />
Telefon 031 720 92 07<br />
espace.mittelland@veb.ch<br />
n Netzwerk-Veranstaltung: 27. April 2004<br />
Zentralschweiz<br />
Karl Gasser, Präsident<br />
Türlacherstr. 18, 6060 Sarnen<br />
Telefon 041 767 24 00<br />
zentralschweiz@veb.ch<br />
n Netzwerk-Veranstaltung: 26. April 2004<br />
Ostschweiz<br />
Franz J. Rupf, Präsident<br />
Quaderstrasse 5, 7000 Chur<br />
Telefon 081 252 07 22<br />
Fax 081 253 33 73, ostschweiz@veb.ch<br />
n Netzwerk-Veranstaltung: 4. Mai 2004<br />
Zürich<br />
Michael Lang, Präsident a.i.<br />
Postfach 8160, 8036 Zürich<br />
Telefon 01 363 10 15<br />
Fax 01 363 10 26, zuerich@veb.ch<br />
n Netzwerk-Veranstaltung: 3. Mai 2004<br />
Controller Akademie<br />
n 3. Schweizer Controller-Tag, 27. Mai<br />
2004, im Kongresshaus Zürich<br />
n IFRS/IAS-Diplomlehrgang ab 8. September<br />
2004<br />
Seminare der Controller-Akademie:<br />
n Bewertung und Controlling<br />
n Risikomanagement, Kreditrating,<br />
Bonität und Controlling<br />
n Leistungsspektrum und Nutzen von<br />
Rechnunswesen und Controlling<br />
n Controller-Workshop mit Case Studies<br />
n Lieber Kosten managen als Kosten<br />
verwalten<br />
n Business Intelligence und Controlling<br />
28 Rechnungswesen<br />
&Controlling<br />
veb.ch – demnächst<br />
Lehrgänge mit Zertifikatsprüfungen<br />
n Personaladministration – Lehrgang<br />
für Finanzfachleute: 21. April bis<br />
26. Mai 2004, Hotel Marriott Zürich<br />
n Revision: 11. Mai bis 29. Juni 2004,<br />
Hotel Marriott Zürich<br />
n Swiss GAAP FER: Ab 19. Oktober<br />
2004, Hotel Marriott Zürich<br />
n Swiss GAAP FER: Ab 20. Oktober<br />
2004, Hotel Marriott Zürich<br />
<br />
n Fusionsgesetz kontra MWST: 28.<br />
April 2004, Hotel Marriott, Zürich<br />
n Fusionsgesetz kontra MWST: 23.<br />
Juni 2004, Hotel Marriott, Zürich<br />
<br />
n Mehrwertsteuerpraxis – Risiken und<br />
Tücken: 12. Mai 2004, Hotel Marriott<br />
Zürich<br />
n Steuern und Creative Accounting:<br />
27. Oktober 2004, Hotel Marriott Zürich<br />
<br />
n Unternehmensbewertung – rechtliche<br />
Grundlagen und Methoden:<br />
9. Juni 2004, Hotel Olten in Olten<br />
n Sozialversicherungen: 1. September<br />
2004, Hotel Marriott, Zürich<br />
n Controlling – Ein Update für Praktiker:<br />
Ein Tag im Oktober, Hotel Marriott<br />
Zürich<br />
n Immobilien – ein brennendes Thema:<br />
Ein Tag im Oktober, Hotel Marriott<br />
Zürich<br />
n Sozialversicherungen: 18. November<br />
2004, Hotel Marriott, Zürich<br />
<br />
n Generalversammlung des veb.ch:<br />
11. Juni 2004, Zoo Zürich, Masoala Regenwaldhalle<br />
<br />
n Motorrad- und Cabriolet-Treffen in<br />
Gletsch: 4. September 2004<br />
1·04