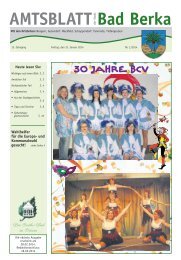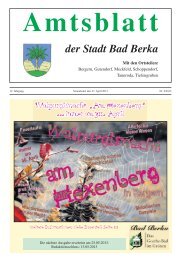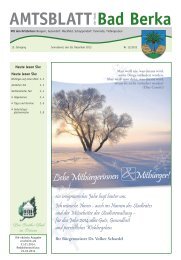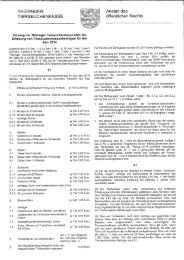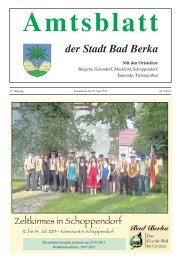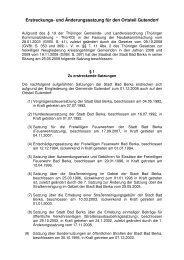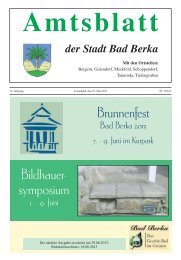Bad Berka und seine Mühlen (Teil 1) - Kurstadt Bad Berka
Bad Berka und seine Mühlen (Teil 1) - Kurstadt Bad Berka
Bad Berka und seine Mühlen (Teil 1) - Kurstadt Bad Berka
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aufzählungen der Auseinandersetzungen <strong>und</strong> Prozesse lassen sich weiter<br />
fortsetzen. Immer wieder mussten besonders bau- <strong>und</strong> wasserrechtliche Streitfälle<br />
geklärt werden.<br />
1856 hatte Oschatz in <strong>seine</strong>m Besitz: die Obermühle mit 4 Wasserrädern. Sie<br />
dienten zum Treiben der Mahlmühle mit 4 Mahlgängen <strong>und</strong> einer<br />
Reinigungsmaschine sowie der daneben liegenden Sägemühle. Weiterhin die<br />
Untermühle mit 3 Wasserrädern, die wiederum die Mahlmühle mit 4 amerikanischen<br />
Mahlgängen <strong>und</strong> 2 Reinigungsmaschinen, die Ölmühle <strong>und</strong> eine Lohmühle<br />
antrieben.. Oschatz gehörten außerdem umfangreiche Ländereien in <strong>Berka</strong>s Fluren,<br />
Stallungen im Bereich der heutigen Bleichstraße <strong>und</strong> an der Untermühle <strong>und</strong> der<br />
gesamte Mühlgraben mit Wehren <strong>und</strong> Schleusen. Mit zielstrebiger Arbeit <strong>seine</strong>r<br />
großen Familie, Glück bei <strong>seine</strong>n wirtschaftlichen Unternehmungen, aber auch Härte<br />
<strong>und</strong> Strenge gegenüber <strong>seine</strong>n Untergebenen, gelangte Oschatz zu Wohlstand. Laut<br />
Steuerkataster war er in dieser Zeit der wohlhabendste Bürger in <strong>Berka</strong>.<br />
Besitzteilung – ein geniales Bauwerk entsteht<br />
1869 erschienen zwei der neun Oschatz-Kinder als Pächter der <strong>Mühlen</strong>. Constantin<br />
betrieb die Obermühle, sein Bruder Carl August die Untermühle. Schon 1875<br />
bezeichneten sich beide als Besitzer. Der Mühlgraben <strong>und</strong> die Mühllache mit Wehren<br />
<strong>und</strong> Schleusen von der Ableitung an der Ilm bis zur Untermühle blieben<br />
gemeinschaftliches Eigentum. Wie der Vater, so versuchten auch die Söhne ihren<br />
Besitz zu mehren. Der Obermüller Constantin Oschatz nahm sich der Idee des<br />
Gutsbesitzers Heubel von München an, eine Sägemühle, das heutige Martinswerk an<br />
der Straße nach München zu errichten. Nach dem Landerwerb begann er 1874 mit<br />
dem Bau. Auf Gr<strong>und</strong> von Beschwerden von Anliegern, die durch den Stau der Ilm<br />
Hochwasser befürchteten, erhielt er zunächst von den Behörden keine<br />
Genehmigung. Erst 1879, nach Beseitigung der Mängel am Wehr, konnte er mit der<br />
Produktion beginnen. Ausgestattet war der Betrieb mit einem Sägegatter sowie einer<br />
Bandsäge <strong>und</strong> Fräsmaschine für die Leistenproduktion.<br />
Im gleichen Jahr begannen die beiden Brüder ein gemeinsames Bauwerk an ihrem<br />
<strong>Mühlen</strong>standort in <strong>Berka</strong>. Sie stellten beim Direktor des I. Verwaltungsbezirkes<br />
Weimar den Antrag zur „Genehmigung eines Projektes zur Zusammenlegung der<br />
Gefälle ihrer <strong>Mühlen</strong>“. Der Gr<strong>und</strong>gedanke war eine Leistungssteigerung der<br />
<strong>Mühlen</strong>werke. Erreichen wollten sie das durch die Anschaffung leistungsfähiger<br />
oberschlächtiger Wasserräder gegenüber den bisherigen unterschlächtigen. Dazu<br />
mussten sie aber die Wasserläufe erhöhen. Weiterhin war es notwendig, oberhalb<br />
der Obermühle ein <strong>Teil</strong>ungsgrieswerk, bestehend aus zwei Gerinnen <strong>und</strong> Schleusen<br />
zum Steuern des Wassers zu errichten. Über eines dieser Gerinne sollte das Wasser<br />
zum oberschlächtigen Wasserrad der Obermühle geführt werden. Nach <strong>seine</strong>m<br />
Absturz war geplant, das Wasser durch einen 96m langen Viadukt zur Untermühle<br />
fließen zu lassen. Das zweite Gerinne sollte nun in einem offenen Kanal auf dem<br />
Viadukt zur Untermühle geführt werden, um dort die oberschlächtigen Wasserräder<br />
in Bewegung zu setzen. Nach der Vereinigung beider Wasser sollte es zur Ilm<br />
fließen. Trotz Einsprüchen einiger Anlieger erhielten die Bauherren die Genehmigung<br />
<strong>und</strong> begannen 1880 mit den Arbeiten. In kürzester Zeit mussten die beiden<br />
Steinhauer Otto Huschke <strong>und</strong> Louis Seyfarth nach einer Ausschreibung Sandsteine<br />
in bester Qualität aus ihren Brüchen an der Trebe liefern. Im März begannen die<br />
Maurermeister Börmel <strong>und</strong> Hetzer sowie Zimmermeister Linke mit der Errichtung des<br />
Bauwerkes, im August waren die Arbeiten beendet. Mit höherer Leistung konnten<br />
nun die Wasserräder ihre Arbeit aufnehmen.